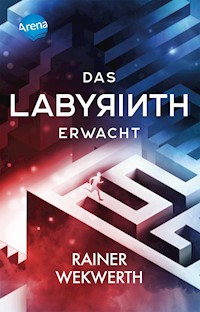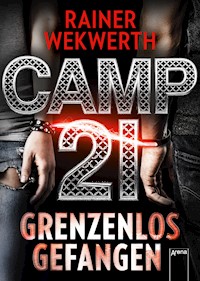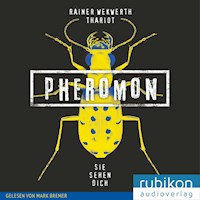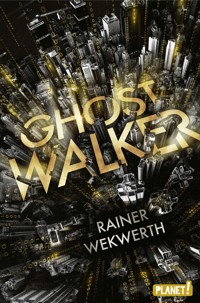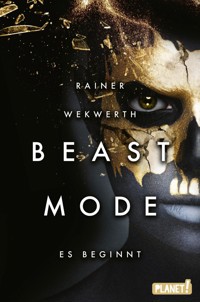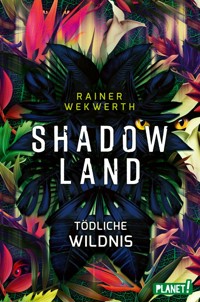
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Planet! in der Thienemann-Esslinger Verlag GmbH
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Wer bist du in einer Welt, die keine Hoffnung mehr kennt? Vielleicht die Hoffnung selbst. 2169, USA: Nach mehreren Katastrophen ist die Zivilisation am Abgrund, ein neuartiges Virus verwandelt Menschen in tödliche Bestien. Nur ein Ort ist noch vor ihnen sicher. Eine freie Stadt in Kalifornien, um die eine meterhohe Mauer errichtet wurde. In dieser Sicherheitszone lebt Kaia. Als sie den Auftrag erhält, hinter die Mauer zu gehen, glaubt sie, vorbereitet zu sein. Die Welt jedoch, in die sie eintaucht, ist fantastischer, schöner und gefährlicher als alles, was sie sich vorgestellt hat. Gleichzeitig entdeckt sie eine Wahrheit, die alles verändert! Wer der Natur schadet, schadet sich selbst: Das zeigt Bestsellerautor Rainer Wekwerth eindrucksvoll in seinem neuen Standalone, in dem er die Ausbeutung der Erde durch den Menschen actionreich und atemraubend verpackt. //Der dystopische Fantasy-Roman »Shadow Land« ist ein in sich abgeschlossener Einzelband.//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Das Buch
2069, USA: Nach mehreren Katastrophen ist die Zivilisation am Abgrund, ein neuartiges Virus verwandelt Menschen in tödliche Bestien. Nur ein Ort ist noch vor ihnen sicher. Eine freie Stadt in Kalifornien, um die eine meterhohe Mauer errichtet wurde. In dieser Sicherheitszone lebt Kaia. Als sie den Auftrag erhält, hinter die Mauer zu gehen, glaubt sie, vorbereitet zu sein. Die Welt jedoch, in die sie eintaucht, ist fantastischer, schöner und gefährlicher als alles, was sie sich vorgestellt hat. Gleichzeitig entdeckt sie eine Wahrheit, die alles verändert!
Der Autor
© Christian Witt
Rainer Wekwerth hat zahlreiche Bücher veröffentlicht und dafür Preise gewonnen. Zuletzt die Jugendbuchpreise Segeberger Feder, Goldene Leslie und Ulmer Unke. Mit seiner »Labyrinth«-Trilogie landete er zudem auf der Spiegelbestsellerliste. Die Kinoverfilmung ist in Vorbereitung. Seine »Pheromon«-Buchreihe, erschienen bei Planet!, wurde für vier weitere Buchpreise nominiert, darunter für den renommierten Buxtehuder Bullen und den Deutschen Phantastik Preis.
Mehr über Rainer Wekwerth:www.wekwerth.com
Rainer Wekwerth auf Facebook:www.facebook.com/rainer.wekwerth
Der Verlag
Du liebst Geschichten? Wir bei Planet! auch!Wir wählen unsere Geschichten sorgfältig aus, überarbeiten sie gründlich mit Autor*innen und Übersetzer*innen, gestalten sie gemeinsam mit Illustrator*innen und produzieren sie als Bücher in bester Qualität für euch.
Deshalb sind alle Inhalte dieses E-Books urheberrechtlich geschützt. Du als Käufer erwirbst eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf deinen Lesegeräten. Unsere E-Books haben eine nicht direkt sichtbare technische Markierung, die die Bestellnummer enthält (digitales Wasserzeichen). Im Falle einer illegalen Verwendung kann diese zurückverfolgt werden.
Mehr über unsere Bücher und Autoren auf:www.planet-verlag.de
Planet! auf Instagram:https://www.instagram.com/thienemannesslinger_booklove
Viel Spaß beim Lesen!
Für Claudia
Prolog
Heute, Jahr 2169, USA, Sicherheitszone
Kaia spürte die rissigen Holzdielen der Veranda durch ihre Shorts, aber sie rührte sich nicht. Starrte hinaus auf die Wellen, die sich an der Küste brachen. Blau. So blau. Mit weißen Schaumkronen. Gischt, die wie gierige Teufel auf dem Wasser tanzte. Irgendwo klagte eine hungrige Möwe.
Der Wind zerzauste ihr Haar, während die Sonne heiß auf sie herabschien. Kaia roch das Wasser, das nach Tang schmeckte, spürte die salzige Luft auf ihrer Haut. Aber all das nahm keinen Platz in ihrem Bewusstsein ein, denn sie starrte nachdenklich auf ein altes, längst verblichenes Foto.
Sie wusste nicht, wer das Bild gemacht hatte, und im Grunde war es egal, denn dieses Foto zeigte den letzten Moment des Glücks in ihrem Leben.
Ihr Vater stand darauf, stolz aufgerichtet. Ein breites Grinsen auf seinen Lippen, während die blasse Frau neben ihm still lächelte. An seiner Hand die siebenjährige Kaia, daneben ihre zwei Jahre ältere Schwester Sarah.
Die Sonne schien heiß, damals wie heute. Kaia erinnerte sich an diesen Moment. An die Luft, die von Blütenduft erfüllt war. An die Gewissheit, dass alles für alle Zeit gut sein würde.
Aber es war nicht die Ewigkeit gewesen, wie sich herausgestellt hatte, nur ein kurzer Augenblick.
Kaia ließ das Foto sinken und nahm stattdessen einen vergilbten Zeitungsausschnitt in die Hand. Grob herausgetrennt, mit fransigen Rändern berichtete er von einem Mutiertenüberfall in Oregon. Ein Tross von einhundert Flüchtlingen war den Monstern der Wilden Welt zum Opfer gefallen. Überlebende: keine. Kaia verzog den Mund. So war es nicht richtig, denn ein kleines, sieben Jahre altes Mädchen hatte das Blutbad überstanden. Bis heute. Doch noch immer griff diese Nacht mit gierigen Fingern nach ihr.
Vorsichtig, als könnte der Zeitungsartikel zu Staub zerfallen, legte Kaia ihn zurück in die Holzkiste, in der sie all ihre Erinnerungen aufbewahrte. Ein Band aus rosafarbenem Stoff, mit dem ihre Haare früher gebunden gewesen waren. Das Kleid, das sie an diesem Tag getragen hatte. Teddy mit den klugen Glasaugen und dem verfilzten Fell.
Ihre Hand zitterte, als sie nach der Desert Eagle griff. Matt glänzend, wie ein altes Versprechen, lag sie schwer in ihrer Hand.
Happy Birthday, Baby, dachte sie.
Dann schob sich Kaia den kalten Lauf der Waffe in den Mund.
1.
10 Jahre zuvor, Oregon
»Wir müssen weiter«, sagte ihr Vater zu Hank Murdoch, dem Mann mit den grauen langen Haaren. Er wirkte nervös.
Kaia wusste, dass er Geld von den Flüchtlingen dafür bekam, sie durch die Wildnis zu führen. Sie stand still neben den beiden. Teddy im Arm. Die Augen weit aufgerissen.
»Nachts ist es zu gefährlich«, sagte der Scout. »Lass uns rasten. Morgen früh ziehen wir weiter.«
»Wovor hast du Angst?«, fragte ihr Vater.
Der Mann starrte ihn an. »Vor allem. Das hier ist das Wilde Land …«
»Mutierte?«, fuhr ihn ihr Vater an.
»Geister«, kam es ruhig zurück.
»Du spinnst doch!«
»Ich habe viele Dinge gehört.«
»Aber nichts gesehen. Du widerst mich an. Wir hätten dir niemals so viel Geld bezahlen dürfen.«
Der Alte räusperte sich. »Ihr seid dort nicht willkommen.«
»Was soll das heißen?«
»Wir haben darüber gesprochen. Die Stadt hinter den Mauern fürchtet sich vor Fremden.«
»Sie können uns nicht zurückweisen.«
»Ihr seid infiziert.«
»Sie auch. Jeder ist das!«
»Aber sie haben eine Möglichkeit gefunden, die Infektion zu verlangsamen und so fast ein normales Leben zu führen.«
Ihr Vater nickte. »Darum wollen wir dorthin. Ein besseres Leben. Nahrung für alle.«
»Da täuschst du dich, es reicht nicht für alle, die kommen. Die meisten werden davongejagt.«
»Trotzdem nimmst du unser Geld.«
»Ja.« Der Alte nickte. »Was sollte ich sonst tun?«
Selbst Kaia verstand, dass es keine Frage war.
»Haben sie tatsächlich Strom?«
Hank verzog den Mund. »Ja, ich war einmal hinter den Mauern. Dort ist es wie in den alten Erzählungen. Straßenlaternen leuchten, von Licht erfüllte Wohnungen. Manchmal sogar Klimaanlagen, die laut summen.« Er zögerte. »Es ist wie ein verdammtes Wunder, dass sie all das gerettet haben.« Dann spuckte er auf den Boden. »Und darum teilen sie nicht gern. Je weniger sie uns geben, desto mehr bleibt für sie.«
»Die ganze beschissene Welt ist durch das Virus untergegangen und sie verstecken sich hinter hohen Mauern.«
»Yeah, was würdest du an ihrer Stelle tun?«
»Helfen.«
»Zehntausende streunen durchs Land. Denen kann man nicht allen helfen. Beim besten Willen nicht.«
»Mag sein, trotzdem ist es unmenschlich, vor einem vollen Kühlschrank zu sitzen und den Rest der Welt verhungern zu lassen.«
»Richard, ich bringe euch dorthin, weil ihr es wollt und weil ihr mich dafür bezahlt habt, doch ich sage dir: Das ist kein guter Ort.«
»Ich weiß, damit liegst du uns seit dem ersten Tag in den Ohren, und wir sind schon zwei Monate unterwegs.«
»Etwas stimmt nicht mit den Leuten hinter der Mauer.«
»Da hast du recht«, sagte ihr Dad. »Sie sind gesund.«
»Oh nein«, stieß der Alte aus. »So würde ich das nicht nennen. Ihre Technik ist Teufelswerk.«
»Warst nicht du es, der mir erzählt hat, alle Menschen in der Stadt trügen einen implantierten Chip im Hals …«
»Jaja, habe ich«, unterbrach ihn Hank. »Er verzögert die Verwandlung, aufhalten kann er sie jedoch nicht. Wenn es so weit ist, wird eine Nachricht an die Zentrale geschickt, die sich darum kümmert, dass nichts Schlimmeres passiert.«
»Warum redest du immer drum herum? Schlimmeres passiert? Wir wissen beide, was das heißt. Die Leute werden eliminiert, bevor sie zur Gefahr für andere werden.« Er deutete auf sein Jagdgewehr. »Uns wird das nicht passieren und Mutierte fürchte ich auch nicht. Wir sind in der Lage, uns zu verteidigen.«
Kaia hatte nicht alles verstanden, aber jetzt bekam sie Angst. Sie schluchzte auf.
Ihr Vater bückte sich zu ihr. »Kaia, alles ist gut.« Sanft strich seine Hand über ihr Haar. »Willst du zurück zu Mama und Sarah?«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich möchte bei dir –«
Ein Schrei erfüllte die Luft. Drüben beim Lagerplatz entstand Unruhe. Im Schein der untergehenden Sonne sah Kaia Schatten huschen.
Noch ein Schrei. Dann ein tiefes Stöhnen.
Ein Schuss fiel.
Das Gesicht ihres Vaters war bleich geworden. Er ließ Kaias Hand los, nahm das Jagdgewehr von seiner Schulter und lud durch.
Murdoch zog eine altmodische Pistole aus seinem Hosenbund. Er sprach kein Wort.
»Kaia, lauf weg und versteck dich!«
»Aber …«
»Tue, was ich dir sage. Wir haben keine Zeit. Egal, was du siehst oder hörst, rühr dich nicht, bis ich dich hole. Und jetzt lauf!«
Das letzte Wort schrie er.
Kaia rannte los. In den Wald hinein. Zwischen die hohen, finsteren Schatten der Bäume. Äste griffen nach ihr, Wurzeln ließen sie stolpern, aber sie fiel nicht.
Hinter ihr immer mehr Schüsse. Wildes, zornerfülltes Brüllen, verzweifelte Schmerzensschreie. Doch je weiter sie sich in den Wald vorankämpfte, desto ruhiger wurde es. Kaia blieb stehen.
Lauschte.
Da war etwas! Irgendwas bewegte sich in den Schatten der Bäume. Geflüsterte Worte drangen an ihr Ohr. Das machte ihr mehr Angst als die Schreie zuvor.
Kaia spürte, dass das da draußen im fahlen Licht gefährlich war. Wer auch immer dort herumschlich, hatte die Flüchtlinge überfallen, und nun waren sie hinter ihr her. Sie kniff die Augen zusammen und schaute sich nach einem Versteck um.
Dort. Eine mächtige umgestürzte Eiche. Darunter konnte sie eine Ausbuchtung, eine kleine Erdhöhle ausmachen. Kaia ging hinüber, ließ sich auf den Waldboden fallen und kroch hinein.
Ihre Finger stießen auf etwas Weiches. Kaia zuckte zurück. Sie konnte nichts sehen, aber da war etwas Lebendiges. Ein Fiepen erklang. Angsterfüllt. Vorsichtig streckte sie ihre Hand wieder aus. Tastete. Erspürte Fell. Flauschige Ohren. Pfoten. Leises Knurren.
Ein Hund.
Wie es schien, war es ein Welpe. Nur wenige Wochen alt. Er zitterte unter ihren Fingern.
»Du musst keine Angst haben«, flüsterte Kaia. »Ich tue dir nichts.«
Sie kroch tiefer in das Erdloch. Drinnen konnte sie sich hinsetzen. Sie zog den kleinen Hund an sich.
»Bist du allein? Wo sind deine Mutter und dein Vater? Hast du Geschwister?«
Eine raue Zunge leckte über ihre Hand.
»Ich bin auch allein«, sagte Kaia. »Böse Menschen haben uns überfallen, aber mach dir keine Sorgen. Nachher kommt mein Dad und holt uns. Dann ist wieder alles gut. Bis dahin müssen wir leise sein, damit uns niemand findet.«
Der Welpe schmiegte sich an sie. Sie kraulte sein Fell.
Irgendwo brach ein Ast unter einem schweren Tritt. Sie waren nach wie vor da draußen. Suchten nach ihr.
Kaia begann leise zu weinen. Die Tränen kamen einfach so, sie konnte nichts dagegen tun. Ein Schluchzen kroch in ihre Kehle, aber sie gab kein Geräusch von sich.
Erneut drang ein Flüstern an ihr Ohr. Kaia drückte ihr Gesicht in das Fell des Hundes, damit sie nicht aufschrie.
Dann wurde es still.
2.
Heute, Jahr 2169, USA, Sicherheitszone
Die Mündung der Waffe schmeckte kalt und bitter in ihrem Mund. Neben ihr gab Storm ein leises Geräusch von sich. Sie blickte zu ihm. Er lag nicht weit entfernt. Seine gelben Augen fixierten Kaia. Sie spürte seine Unruhe.
Ihre Gedanken wanderten zu der Nacht zurück, in der sie ihn gefunden hatte. Verdreckt, verängstigt. Kein Hund. Ein Wolf. Allein, wie sie.
Drei Tage lang hatte sie sich an ihn gekauert, bis sie von Tom Hayes, einem Kundschafter der Sicherheitszone gefunden worden war.
Schwer bewaffnet, das Gesicht mit Tarnfarbe beschmiert, im Camouflage-Anzug hatte er wie ein dunkler Geist des Waldes gewirkt, aber ein breites, freundliches Lächeln ließ weiße Zähne aufblitzen.
»Komm«, sagte er nur und streckte seine Hand aus.
Kaia rührte sich nicht.
»Komm.«
»Sind die bösen Menschen weg?«, fragte sie leise.
»Ja.«
»Wo ist mein Dad?«
Er schwieg, dann ein Räuspern. »Tot. Sie sind alle tot.« Kaia schluchzte auf. »Mama und Sarah auch?«
»Ja.«
»Dann will ich hierbleiben.«
»Ein Sturm zieht auf.«
Warum er das gesagt hatte, wusste Kaia bis heute nicht, aber die wenigen Worte hatten ihr klargemacht, dass sie nicht im Wald bleiben konnte.
Sie fasste nach der Hand des Soldaten. Er zog sie heraus, zögerte aber, als er sah, was sie an sich gepresst hielt.
»Was ist das?«
»Mein Hund.«
»Er kann nicht mit uns kommen. Du musst ihn zurücklassen.«
Kaia schüttelte wild den Kopf. »Dann gehe ich auch nicht.«
»Kind, es ist ein weiter, gefährlicher Weg. Wir müssen vorsichtig sein. Der Hund könnte uns verraten.« Kaia presste stumm die Lippen aufeinander. Der Mann schwieg, schließlich sagte er: »Also gut.«
Er hob sie hoch. Auf seinen Arm. Sie und den Hund, der ein Wolf war.
»Lass uns gehen.«
Tom Hayes hatte sie in die Sicherheitszone gebracht. Sie und Storm, wie sie den Wolf später genannt hatte. Er hatte sie wie eine Tochter aufgezogen und ausgebildet. Als er zu alt wurde, hatte sie seinen Platz im System eingenommen, während Hayes damit beschäftigt war, sämtlichen Bars der Stadt seine Aufwartung zu machen.
Er hatte schon immer viel getrunken, aber in den letzten Jahren war es schlimm geworden. Sie wusste nicht, welche Schatten ihn quälten, doch sie mussten finsterer als die Hölle sein. Ließen ihn kaum Schlaf finden, trieben ihn in die Nacht hinaus.
Hayes war vor sechs Monaten vom Strandhaus in die Innenstadt gezogen. In eine kleine Wohnung, die nach Verzweiflung und billigem Schnaps roch. So war es ihm lieber. Näher an den Bars. Sie sahen einander nur selten, denn wann immer Kaia ihn besuchen wollte, war er nicht da. Ihre Funknachrichten blieben unbeantwortet, vielleicht hatte sein Funkgerät auch den Geist aufgegeben. Ersatzteile waren schwer aufzutreiben.
Ein Ruf erklang vom Weg, der zu ihrem Haus führte. Kaia zog hastig die Waffe aus ihrem Mund und legte sie auf den alten Schaukelstuhl neben sich.
»Kaia? Bist du da?«, tönte es erneut.
Sie seufzte. »Was willst du, Adam?«
Der Wind fuhr durch seine verstrubbelten braunen Haare, als Adam um die Ecke bog, und ließen ihn einmal mehr wie ein zu groß geratenes Kind aussehen. Seine dunklen Augen blitzten sie an. Er lächelte.
»Was versteckst du hinter deinem Rücken?«, fragte Kaia misstrauisch, als er vor ihr stand.
Ein Strahlen erschien auf seinem Gesicht, dann streckte er die verborgene Hand aus, die einen Teller mit einem kleinen Topfkuchen hielt. Darauf eine Kerze.
»Alles Gute zum Geburtstag, Kaia«, sagte er leise.
»Du hast daran gedacht?«
»Ja, wieso nicht?«
»Mir hat niemand gratuliert. Nicht einmal Tom hat sich gemeldet.«
»Das ist schade.«
Sie nickte. »Hast du den selbst gebacken?«
Adam grinste. »Das ist Nummer drei, die beiden ersten sind nichts geworden.«
Kaia spürte, wie ein warmes Gefühl in ihr aufstieg. Adam war wie ein Sommerregen. Er tat einfach gut.
Sie beugte sich vor und küsste ihn auf die Wange. »Danke«, flüsterte sie in sein Ohr.«
»Dafür nicht.«
»Nein, dafür, dass du immer da bist.«
Nun trat er verlegen von einem Fuß auf den anderen. Kaia wusste, dass Adam in sie verliebt war, auch wenn er nie ein Wort dazu sagte oder Anstalten machte, ihr seine Zuneigung deutlich zu zeigen. Er war einfach da für sie und liebte sie stumm.
Kaia nahm seine Hand, zog ihn mit sich. »Ich habe etwas Kaffee auf dem Markt auftreiben können, den trinken wir zu deinem Kuchen. Kalte Milch habe ich auch. Es gab seit gestern Abend keinen Stromausfall mehr.«
»In der Zentrale haben sie heute darüber gesprochen, das Mobilfunknetz aufzubauen«, sagte Adam.
Kaia lachte leise. »Das erzählen sie doch bereits seit Jahren.«
»Ja, aber diesmal scheinen sie es ernst zu meinen, und wenn sie schon dabei sind, wollen sie auch gleich das Internet wieder an den Start bringen.«
»Jetzt mal ehrlich, Adam. Das sind doch Märchen. Seit dem Ausbruch des Virus und den Katastrophen danach ist es permanent bergab gegangen. Inzwischen gibt es nicht einmal mehr dauerhaft Strom. Essen ist bloß noch mit Lebensmittelmarken oder auf dem Schwarzmarkt zu bekommen. Meist ist von allem zu wenig zu kriegen, vieles überhaupt nicht mehr.«
»Ach …«
»Wann hast du die letzte Orange gesehen? Wusstest du, dass die Südfrüchte aus Kalifornien einmal weltberühmt waren?«
»Ja, aber der Anbau kostet zu viel Wasser. Es wird besser werden.«
»Du bist ein hoffnungsloser Optimist.« Kaia seufzte. »Jetzt komm rein. Draußen ist es zu heiß.«
Storm gab ein leises Knurren von sich, als Adam an ihm vorbeiging.
»Man sollte meinen, dass er sich inzwischen an mich gewöhnt hat.«
»Hat er doch, du liegst nicht mit aufgerissener Kehle auf der Veranda und verblutest.«
»Echt, über deinen Humor müssen wir mal reden.«
»Was ist damit?«
»Manchmal weiß ich nicht, ob du es witzig oder ernst meinst.«
»Lach einfach an den Stellen, die dir gefallen.«
Adam blieb stehen und schaute sie an. »Siehst du, genau darauf will ich hinaus.«
»Jetzt hör schon auf. Setz dich.«
Adam zog sich einen Stuhl heran und nahm am Tisch Platz, während Kaia eine kleine Eisenkanne auf den Gaskocher stellte, Wasser hineinschüttete und die Flamme entzündete.
Sie reichte ihm ein Messer und zwei Plastikteller, die bereits ziemlich verkratzt waren.
»Du kannst inzwischen den Kuchen anschneiden.«
»Erst musst du die Kerze ausblasen und dir etwas wünschen.«
Er fischte ein altmodisches Benzinfeuerzeug aus der Tasche seiner Jeans und zündete die Kerze an. Kaia kam an den Tisch, lächelte, dann pustete sie die Flamme aus. Für einen Moment schloss sie die Augen.
»Und?«, fragte Adam, als sie die Lider wieder aufschlug. »Was hast du dir gewünscht?«
Dass dieser Moment ewig hält.
»Du weißt, dass man das nicht verraten darf, sonst geht der Wunsch nicht in Erfüllung.«
Im Hintergrund blubberte das kochende Wasser. Kaia schaufelte aus einer verbeulten Blechdose zwei Löffel Kaffee hinein, rührte alles um und brachte die Kanne mit zwei Porzellantassen an den Tisch.
»Die kenne ich noch gar nicht«, meinte Adam.
»Sind nur für besondere Anlässe.«
»Wo hast du die her?«
»Schwarzmarkt. Gegen zwölf Schuss Gewehrmunition eingetauscht.«
»Wenn das der Kommandant mitkriegt, bist du fällig, dann wanderst du in den Knast.«
Kaia winkte ab. »Ich habe keine Angst vor Goya.«
Eigentlich habe ich eine Menge Angst vor ihm, aber es tut gut, das zu sagen.
»Solltest du aber«, beharrte Adam. »Ich arbeite täglich mit ihm zusammen. Der Typ versteht keinen Spaß.«
»Was machst du gerade für ihn?«
Kaia wusste, dass Adam ein hochbegabter Techniker war, dem es ständig gelang, aus alten Teilen etwas Neues zu basteln. Goya hatte das frühzeitig erkannt und ihm einen eigenen Technikraum in der Zentrale eingerichtet, in dem er vollkommen unabhängig von allen anderen arbeiten konnte.
Kaia selbst kam nur selten in die Zentrale. Meist zur Einsatzbesprechung, oft wurden ihr aber auch die Jagdbefehle und alle Informationen zum Ziel per Funk mitgeteilt.
»Goya will die Reichweite der Detektoren erhöhen, mit denen wir die Chips im Hals der Leute aufspüren können. Erscheint mir sinnlos, denn die jetzige Reichweite ist komplett ausreichend. Dreißig Meilen. Danach beginnt der Wald und da will niemand rein.«
Er räusperte sich.
»Geht es dir gut?«, fragte Kaia. Adams Stirn war schweißbedeckt und auf seiner Oberlippe sammelten sich kleine, klare Tröpfchen.
»Es ist verdammt heiß heute«, meinte Adam
Wahrscheinlich hat er kein Insulin mehr.
»Macht dir dein Diabetes zu schaffen? Hast du noch genug –«
»Alles in Ordnung. Ich komme schon klar.« Mehr wollte er anscheinend nicht zu diesem Thema sagen.
»Adam?«
»Was?«
»Erklär mir mal etwas.«
»Leg los, wenn ich kann, gern.«
»Wir leben doch inzwischen auf einem technischen Stand, der noch unter dem Niveau des zwanzigsten Jahrhunderts liegt. Es gibt zu wenig Nahrungsmittel, kaum Medikamente. Ersatzteile für Geräte jeder Art sind schwer aufzutreiben. Außer Militärfahrzeugen sind kaum noch Autos unterwegs. Fernsehen ist tot. Ebenso das Internet und der Mobilfunk.« Sie verzog den Mund. »Aber in der Zentrale arbeiten sie mit Computern, Luftraumüberwachung durch Drohnen, und sie pflanzen jedem Bürger kurz nach Geburt diesen Hightech-Chip ein, der unsere Körperfunktionen überwacht, die Mutation verzögert und meldet, wenn wir beginnen, uns zu verwandeln. Wie passt das zusammen?«
Adam sah sie nachdenklich an. »Die Stadt nutzt die verbliebenen Ressourcen, um uns vor der Gefahr da draußen zu schützen. Ein letzter Hort der Zivilisation in einer untergegangenen Welt. Kaia, da ist sonst nichts mehr. Bloß noch Wildnis und Mutierte, die bedenkenlos alles töten und zerstören. Ohne diese Technik wären wir verloren.«
»Das weiß ich doch. Was ich meine, ist etwas anderes. Ihre Technik ist genauso hoch entwickelt wie vor der Katastrophe. Gleichzeitig sind die Solarzellen auf meinem Dach defekt und niemand ist in der Lage, sie zu reparieren. Ich kann mir nicht mal einen neuen Toaster kaufen, aber wenn ich im Einsatz bin, folgt mir eine schwerbewaffnete Drohne auf Schritt und Tritt. Der Ablauf der Mission wird penibel an Computern ausgewertet und zu Hause gibt es nur das Radio mit einem Sender.«
»Was willst du damit sagen?«
»Ich … Ich weiß es nicht, aber das passt doch nicht zusammen.«
»Du glaubst also, die Regierung verweigert uns das aus einem bestimmten Grund. Warum sollte sie das tun? Satte und zufriedene Bürger sind einfacher zu kontrollieren. Es gab schon zwei Aufstände wegen der Versorgungslücken, die vielen Menschen das Leben gekostet haben. Glaub mir: Wir sind nicht mehr so viele freie Menschen, dass sich das ein Staat leisten kann. Ich denke, es ist einfach nicht mehr da und das Vorhandene wird nach Priorität eingesetzt.«
Kaia ließ den Kopf sinken.
»Ich verstehe es trotzdem nicht.«
»Komm, wir können uns nicht beschweren. Trotz allem geht es den meisten Menschen in der Sicherheitszone einigermaßen gut. Niemand verhungert, alle haben irgendwie ihr Auskommen und die Stadt sorgt für uns. Draußen in der Wilden Welt würden wir wahrscheinlich keinen Tag überleben. Ganz zu schweigen von den Mutierten, die im Wald lauern.«
»Das erklärt aber nicht die Ungereimtheiten. Warum stelle eigentlich nur ich mir solche Fragen? Weshalb scheint jeder, den ich kenne, die Zustände zu akzeptieren? Seit Jahren wird die Lage schlechter, aber niemanden kümmert das. Wohin soll das Ganze führen? Hat irgendjemand einen Plan?«
»Wie gesagt: Goya und der Stadtrat geben ihr Bestes. Vielleicht bekommen sie es mit dem Mobilfunk ja doch hin.«
»Und dann?«
»Haben wir wieder Handys und Smartphones. In den Lagern liegen Tausende davon herum.«
»Denkst du wirklich, die funktionieren noch? Die Akkus werden leer und die Geräte defekt sein.«
»Man kann sie reparieren.«
»Okay, und was machen wir damit?«
»Wieder telefonieren. So wie es die Leute vor der Katastrophe getan haben. Man rief sich an, plauderte oder verabredete sich.«
»Das klappt schon mit dem Festnetz nicht«, schnaubte Kaia.
Adam seufzte. »Weil ein Großteil der Leitungen defekt oder lediglich notdürftig geflickt ist. Es gibt kein Ersatzmaterial, bei den Handys ist das ja anders. Funktionieren drahtlos.«
»Ehrlich, du bist ein hoffnungsloser Optimist, Adam. Ich glaube es erst, wenn ich es sehe.«
»Du wirst es erleben, irgendwann wird alles besser.«
»Das sagst du ständig.«
Adam knuffte sie in den Arm. »Komm, lass uns den Kuchen essen und den Kaffee trinken, solange er noch heiß ist.« Eine Weile herrschte Schweigen, dann sagte Adam: »Wäre es nicht schön, wenn es immer so wäre?«
Er spricht aus, was ich mir vorhin gewünscht habe.
Aber Kaia wusste, dass Adam etwas anderes meinte. »Wir haben darüber geredet.«
»Vor sechs Monaten, seitdem ist viel passiert. Alles ist noch schwerer geworden. Wenn wir zusammenwohnen, wärst du nicht mehr so viel allein.«
Kaia blickte zur Veranda. Sie sah Storm, der mit geschlossenen Augen in der Sonne lag, trotzdem bewegten sich seine Ohren unentwegt.
Er nimmt jede Stimmungsänderung wahr.
»Ich bin nicht allein«, sagte sie härter als beabsichtigt.
»Das ist ein Wolf, kein Mensch. Niemand, mit dem du sprechen kannst, wenn du einsam bist.«
»Ich bin –«
»Doch, bist du. Ich sehe es dir an. Und ich habe auch die Waffe draußen auf dem Schaukelstuhl bemerkt. Sag mir, Kaia, warum liegt sie da?«
»Das geht dich nichts an.«
»Du hast dir wieder das alte Foto angeschaut.«
»Und? Das ist meine Familie.«
»Sie sind tot. Lange schon.«
»Ich denke, es ist besser, du gehst jetzt. Danke für den Kuchen.«
»Kaia, jetzt sei nicht so. Ich bin dein Freund, wir können über alles reden.«
»Darüber nicht, und ich bitte dich, das endlich zu akzeptieren.«
»Okay.« Er sah aus wie ein geprügelter Hund.
»Außerdem würden dir deine Eltern niemals die Erlaubnis geben, hier einzuziehen, und vor deinem einundzwanzigsten Geburtstag darfst du nicht selbst für dich entscheiden. So ist das Gesetz.«
»Ich kann mit ihnen reden. Sie werden einsehen …«
»Nein.«
Sie hatte das Wort zu laut ausgestoßen. Von draußen erklang ein dumpfes Grollen.
Adam erhob sich. »Also dann …«
Kaia zögerte kurz, presste schließlich ein Danke heraus.
»Man sieht sich.«
Adam wandte sich um und ging ohne ein weiteres Wort in die heiße Sonne hinaus. Kaia blickte ihm traurig nach. Er war ein netter Kerl, herzensgut und voller Wärme, aber sie konnte seine Gefühle nicht erwidern. Nicht so, wie er es verdient hätte.
3.
Heute, Jahr 2169, USA, Sicherheitszone
Kaia trank einen Schluck Wasser aus der Leitung, dann trat sie vor das Haus. Der Wind hatte sich gelegt, aber die Wellen trugen noch weiße Schaumkronen, rollten unablässig an Land und zogen sich wieder zurück. Der ewige Kreislauf seit Menschengedenken. Sie fischte einen alten Haargummi aus der Hosentasche und band sich einen Pferdeschwanz. Die Sonne kribbelte auf ihren nackten Armen, allerdings war es kein unangenehmes Gefühl.
»Storm, komm«, sagte sie.
Der Wolf erhob sich sofort.
Kaia folgte dem Pfad die Felsen hinab und hielt auf den verfallenen Bootssteg zu. Ein altes, sechs Meter langes und blau-weiß gestrichenes Fischerboot war daran festgemacht.
John Peters war gerade dabei, seinen Fang zu sortieren, als sie zum Boot trat.
»Hi, John.«
Er sah nicht auf. Langes weißes Haar und ein grauer Vollbart bedeckten sein sonnenverbranntes Gesicht, auf dem stets ein Lächeln lag.
Er ist so alt wie die Zeit selbst.
»Guten Tag, Kaia.«
Das war auch etwas, das sie an ihm mochte, diese altmodische Höflichkeit.
»Wie war es draußen? Hast du einen guten Fang gemacht?«
»Nicht viel, drei Makrelen und ein kleiner Barsch, der nur für die Suppe taugt. Es wird täglich schwerer, ausreichend Fische ins Netz zu kriegen.« John blickte auf. Er hielt eine Makrele in einer Hand, in der anderen ein Messer mit dünner Klinge. »Erträgst du den Anblick, oder soll ich das später machen?«
»Nimm sie ruhig aus, mich ekelt das nicht.«
»Okay. Dein Wolf scheint Hunger zu haben.«
Kaia drehte sich zu Storm um, der in gespannter Haltung auf dem Bootssteg saß. Beide Ohren aufrecht, die Augen fest auf den Fisch in Johns Hand gerichtet.
»Er ist immer hungrig«, seufzte Kaia. »Manchmal weiß ich nicht, wie ich ihn satt bekommen soll. Es gibt nur wenig Fleisch zu kaufen und das ist teuer. Abends lasse ich ihn raus, in den Dünen Wildkaninchen jagen.«
»Bringt er sie dir?«
»Nein, niemals. Das ist kein Hund, der seine Beute apportiert. Er verschlingt seine Opfer an Ort und Stelle.«
John schnitt den Kopf der Makrele ab und warf ihn Storm zu, der ihn aus der Luft schnappte und mit laut krachendem Kiefer zerbiss. Dann saß er wieder da wie eine ägyptische Statue.
»Warum ist das so?«, fragte Kaia.
»Was meinst du?«
»Seit Jahrzehnten gibt es keinen kommerziellen Fischfang mehr, bloß noch einzelne Boote wie deines, die rausfahren. Die Bestände müssten sich längst erholt haben.«
»Oh, das haben sie. Im Meer tummeln sich große Schwärme, Fische aller Arten, aber sie sind zu weit draußen, und Schiffsdiesel ist viel zu teuer geworden, als dass es sich lohnen würden, weiter als eine Stunde in die Fanggebiete zu fahren. Und noch etwas ist anders.« Er sah sie ernst an. »Halt mich nicht für verrückt, wenn ich das sage, aber ich glaube, die Fische haben gelernt, die Küstengebiete zu meiden, an denen Menschen leben.«
»Denkst du das wirklich?«
Er nickte. »Ich spüre, dass es so ist. Mein Leben lang fahre ich aufs Meer, schon als Junge war ich mit meinem Vater draußen. Ich kenne die See wie kein Zweiter, etwas ist anders geworden seitdem. Etwas ist da draußen, sorgt dafür, dass ich kaum noch etwas fange.«
Eine kalte Hand griff nach Kaias Nacken. »Klingt unheimlich. Bedrohlich.«
»Ja, das ist es wohl.«
»Hast du keine Angst, wenn du allein auf dem Boot bist?«
Er lächelte sie an, kleine Grübchen erschienen auf seinen Wangen und für einen Moment erinnerte er sie an Santa Claus auf den Bildern ihrer Kinderbücher.
»Wenn mich die See holen will, bin ich bereit. Ich möchte nicht an Land sterben, da gehöre ich nicht hin.«
Ein weiterer Fischkopf flog in Storms Richtung.
»Warum hast du nie geheiratet?« Kaia hatte sich schon oft mit dem Alten über belanglose Dinge unterhalten, aber noch nie nach seiner Vergangenheit gefragt.
John wurde ernst. »Ich war verheiratet, hatte einen Sohn, der starb, weil es keine Medikamente gab. Er wurde fünf Jahre alt.«
Kaia schluckte schwer, bedauerte, dass ihre Frage alte Wunden aufriss. »Das tut mir leid.«
»Muss es nicht. Meine Frau ertrug den Schmerz nicht. Eines Tages kam ich vom Fischfang zurück und sie hatte sich mit einer Wäscheleine am Dachbalken unseres Hauses aufgehängt. Ich blieb zwei Tage bei ihr, bevor ich sie in dasselbe Grab wie unseren Sohn legte. Dort.« Er deutete die Klippen hinauf. »Grooves Head, da habe ich sie begraben. Man kann die Kreuze von hier aus nicht sehen, aber ihr Grab ist in direkter Nähe des Meeres. Sie sind mir nah.«
»Und du willst nicht dort beerdigt werden?«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, so war es auch, als sie noch am Leben waren. Ich bin raus auf See gefahren, während sie an Land blieben. Meine Frau hat meine Sehnsucht nach dem Meer nie verstanden. Nie verstanden, was mich bei Wind und Wetter raustrieb. Obwohl sie mich als Fischer kennenlernte, stand das zwischen uns. Sie konnte oder wollte ihre Angst, mich zu verlieren, nicht kontrollieren und hat mich immer wieder gedrängt, mir einen Job in der Stadt zu suchen, aber das war nichts für mich. Ich bin ein Kind des Meeres, in meinen Adern fließt kein Blut, sondern Salzwasser.« Er lachte dröhnend. »Als du klein warst, hast du mich gefürchtet.«
Kaia lächelte. »Ich war oft hier unten, habe mich zwischen den Felsen versteckt und dich beobachtet.«
»Ja, ich weiß, ich habe dich jedes Mal gesehen und den Wolf auch. Ich wusste, eines Tages würdest du deine Angst überwinden und wir würden uns kennenlernen. Es war nur eine Frage der Zeit.«
»Manchmal hast du einen Fisch auf dem Bootssteg vergessen, den habe ich mir dann geholt.«
John grinste wissend.
»Was? Du hast ihn gar nicht vergessen?« So oft hatte sie sich bereits mit ihm unterhalten, aber auf das Thema vergessene Fische waren sie nie gekommen.
»Sehe ich aus wie jemand, dem so etwas passiert? Mehrfach?«
»Nein, wenn ich es mir jetzt überlege, wird mit klar, dass der Gedanke unsinnig ist.«
»Es waren Geschenke an dich.«
»Ich habe mich nie bedankt.«
»Das musstest du nicht.«
»Dann tue ich es jetzt – danke.«
Peters schaute zu den zerfetzten Schleierwolken auf. Der Himmel war ansonsten strahlend blau.
»Es wird noch heißer werden«, sagte er. »Der Wind lässt nach.«
Kaia stöhnte. »Die Hitze bringt einen jetzt schon um.«
Der Alte sah zu dem Wolf. »Wie hält er das aus?«
»Ehrlich gesagt: keine Ahnung.«
»Ich fahre heute Abend noch mal raus. Willst du mitkommen?«
Kaia verzog den Mund. »Nein danke, ist nicht so mein Ding. Du weißt schon, Wasser hat keine Bretter.«
»Aber du kannst schwimmen wie ein Fisch. Ich habe dich oft baden gesehen.«
»Das ja. Aber da draußen, fern dem Ufer«, sie deutete auf den Ozean, »habe ich Angst.«
»Okay, wenn du es dir anders überlegst, sind meine alte Sea Witch und ich bereit. Ich fahre mit dir zu den Klippen, dort kann man herrlich tauchen, obwohl ich inzwischen zu alt dafür bin. Du wirst es nicht bereuen.«
»Ich gehe dann mal, möchte noch etwas am Strand spazieren, danke für die Fischköpfe.«
»Gern geschehen.«
Kaia zog die Kampfstiefel aus, rollte ihre Hosenbeine hoch und ging ein Stück in die Brandung. Das Wasser war angenehm kühl. Sie folgte der weißen Linie, die von den Wellen in den Sand gezogen wurde, und dachte nach. Storm blieb am Strand, er traute dem Wasser noch weniger als sie.
Das Gespräch mit John hatte ihr gutgetan. Ihren aufgewühlten Geist allerdings kaum beruhigt.
Heute war ihr Geburtstag und dieser Tag war niemals ein Tag der Freude gewesen, denn sie hatte ihn nicht mit ihrer Familie begehen können. Dass Hayes nicht aufgetaucht war oder sich gemeldet hatte, schmerzte sie, aber wahrscheinlich hing er um diese Uhrzeit schon wieder in irgendeiner Bar ab und ließ sich volllaufen.
Und dann war da noch der Umstand, dass sie Adam enttäuscht hatte. Wieder einmal.
Manchmal denke ich, es wäre besser, wir würden uns nicht mehr sehen, doch dann wäre ich ganz allein, in dem Punkt hat er recht.
Mit Hayes konnte sie nicht mehr rechnen. Schon seit geraumer Zeit. Irgendetwas ging in ihm vor, aber was, wusste sie nicht. Er sprach nie darüber, ersäufte alles lieber in Unmengen von Alkohol.
Wie lange wird das gut gehen? Er verfällt vor meinen Augen und ich kann nichts dagegen tun.
Manchmal war Tom unglaublich stur. Verschlossen und finster wie eine mondlose Nacht. Trotzdem liebte sie ihn wie einen Vater, und das war er auch für sie gewesen, seit ihre Familie von Mutierten überfallen und zerfetzt worden war.
Brennender Zorn loderte in Kaia auf, trotzdem zwang sie sich zur Ruhe. Hayes hatte ihr oft genug erklärt, dass diese Menschen nicht für das verantwortlich zu machen waren, was sie taten. Das Virus hatte ihren Geist zerstört, sie zurückgeworfen auf das Niveau wilder Tiere. So war es seit der großen Katastrophe.
Kaia spuckte ins Wasser. Das alles konnte sie sich sagen, so oft sie wollte, der Schmerz blieb.
Als Kaia ins Haus zurückgekehrt war, füllte sie Storms Napf mit Wasser, über das er sich sofort hermachte. Dann ließ sie eine kleine Plastikschüssel volllaufen und wusch sich den Sand zwischen den Zehen heraus.
In ihrem Rücken knisterte das Funkgerät. Ein altes Teil aus Army-Beständen, von dem der Lack abblätterte.
Eine harte Stimme erklang, begleitet von lautem Rauschen.
»Zentrale an 612. Sind Sie da?«
Kaia setzte sich vor den Kasten und zog das Mikrofon heran. »612 hört.«
»Neuer Einsatz. Melden Sie sich in einer Stunde in der Zentrale.«
»Irgendwelche Anweisungen vorab?«
»Negativ. Seien Sie einfach pünktlich da. Goya hat heute verdammt schlechte Laune. Over and out.«
Kaia ging hinaus, griff nach der Desert Eagle und schob sie in ein Oberschenkelhalfter aus schwarzem Plastik. Dann zog sie sich um. Camouflage-Anzug in Tarnfarben mit hellen Mustern. Wüstenausrüstung. Sie schnürte das Halfter an ihrem Schenkel fest und schlüpfte in ihre schweren Kampfstiefel. Zum Schluss griff sie nach der Sonnenbrille, ohne die man draußen im Ödland blind werden konnte. Waffen, Munition und Proviant würde sie in der Zentrale erhalten.
Sie warf noch einen Blick auf den halb gegessenen Kuchen. Bis sie zurückkam, würde er ausgetrocknet sein. Kaia würde den Kuchen allerdings auch essen, wenn er hart wie Stein war. Das war sie Adam schuldig.
Storm erhob sich sofort, als sie an ihm vorbeiging, und trabte ihr hinterher. Kaia lief zu dem alten Pick-up, klappte die Ladeklappe herunter und Storm sprang mit einem mächtigen Satz hinauf. Hinter der Fahrerkabine rollte er sich zusammen.
Der Motor sprang erst beim dritten Versuch an. Der Tank war fast leer, aber in der Zentrale würde sie Benzin bekommen.
Als sie aufs Gaspedal trat, wirbelte sie eine Staubwolke auf, in der das kleine Strandhaus verschwand.
Kaia blickte nicht zurück.