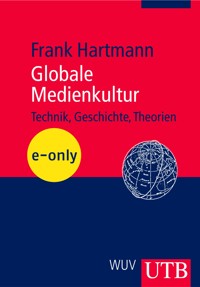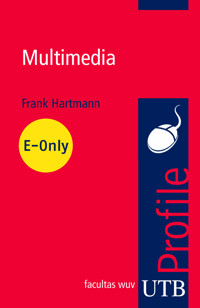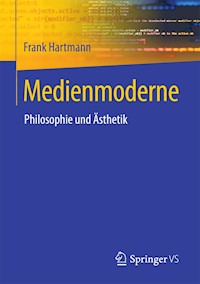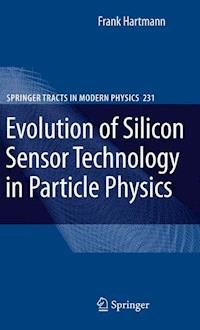Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Dschihadisten des Islamische Staates unter der Führung von Abu Bakr Al-Baghdadi wollen in Syrien und im Irak ein Kalifat gründen und lösen Al-Kaida als größte internationale Bedrohung ab. Auch in Deutschland, wo Islamisten einen Anschlag auf ein Regierungsflugzeug mit der Bundeskanzlerin an Bord verüben und US-Geheimdienstler Vangélis Tsakátos, seine Frau, die Ärztin Sharon Baumann, und Tochter Lydia in einen Zwischenfall mit tödlichem Ausgang verwickelt werden. Während Vangélis sich von Berlin aus auf die Suche nach Al-Baghdadi konzentriert, stellt ein Al-Kaida-Mitglied einen hochgiftigen Biokampfstoff her. Als der Anti-Terrorspezialist mit den griechischen Wurzeln erkennt, wer dahintersteckt, wird er mit einem schweren Fehler aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Eine weitere Herausforderung haben Vangélis und Sharon gemeinsam zu bestehen, als Lydia sich in den Bruder ihrer besten Freundin verliebt und dem IS-Kämpfer nach Syrien folgt. Dadurch gerät der Terroristenjäger selbst unter Verdacht. Der Direktor seines Geheimdienstes stellt ihn vor eine Wahl, bei der Vangélis' Existenz auf dem Spiel steht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für unsere Tochter – vertraue deiner inneren Stimme
Inhalt
Prolog Rakka, Syrien
Kapitel 1 – November 2018 Berlin, Deutschland
Kapitel 2 – Mai 2019 Berlin, Deutschland
Kapitel 3 – Sept. 2019 Maputo, Mosambik
Kapitel 4 – Oktober 2019 Hamburg, Deutschl.
Kapitel 5 – Januar 2020 Athen, Griechenland
Kapitel 6 – Januar 2020 Berlin, Deutschland
Kapitel 7 – Juni 2020 Celle, Deutschland
Kapitel 8 – Juli 2020 Lésbos, Griechenland
Kapitel 9 – August 2020 Fort Meade, Maryl., USA
Statt einer Danksagung
Über den Autor
»Ich finde Gott in den leidenden Augen, die sich in meinen widerspiegeln. Wenn du mir auf diese Weise offenbart wirst, werde ich dich für immer suchen.«
(Kayla Jean Mueller über ihre Arbeit. Die Seite www.forkayla.org ist der US-Aktivistin für Menschenrechte gewidmet.)
Prolog
Kayla Mueller wurde 1988 in Prescott im Grand-Canyon-Staat Arizona geboren. Im selben Jahr hatte die Sowjetunion bereits einen großen Teil ihrer mehr als einhunderttausend in Afghanistan stationierten Soldaten abgezogen – und der neunjährige Basim Atwa durch eine Landmine am Rande der Hauptstadt Kabul gerade beide Beine verloren.
Prescott zählte damals fünfundzwanzigtausend Einwohner und war die Heimatstadt von Carl und Marsha Mueller. Als das Ehepaar an einem warmen Augusttag überglücklich sein zweites Kind, Kayla, im Arm hielt, ahnten die Muellers nicht, dass der Name ihrer Tochter einmal mit einer der wichtigsten geheimen Militäroperationen der Vereinigten Staaten verbunden sein würde. Wie sollten sie?
Kayla besuchte die Tri-City College Prep High School in Prescott, um sich auf das College vorzubereiten. Sie war kontaktfreudig, zeltete gern und liebte es, die Yavapai-Hügel mit ihren Kakteen, Palmlilien und Mesquite-Bäumen zu durchstreifen. Den zweieinhalbtausend Meter hohen Berg Mingus, auf dem Bären, Jaguare und Pumas Jagd machten auf Wapitihirsche, Gabelböcke und Dickhornschafe, wollte sie auch noch erkunden. Bald.
Kayla war ganz anders als ihr älterer Bruder und suchte, beeinflusst von den vielen christlichen Strömungen um sie herum, nach ihrer Bestimmung im Leben. Sie beschäftigte sich früh mit den Zielen von Amnesty International und der buddhistischen Achtsamkeitslehre, arbeitete tagsüber für eine Aids-Klinik und half nachts in einem Frauenhaus.
Als sie an der Northern Arizona University in Flagstaff studierte, kam Kayla in Kontakt mit der propalästinensischen Organisation International Solidarity Movement, für die sie Freiwilligendienst im Mittleren Osten leistete. Sie engagierte sich aber auch in Projekten für Arme, Unterdrückte und Verfolgte in anderen Teilen der Welt.
Ihren späteren Verlobten, den Syrer Omar Alchani, lernte Kayla bei einem Aufenthalt in Ägypten kennen. Die beiden sprachen oft über das schreckliche Blutvergießen in Syrien, über die fast zwei-hunderttausend Menschen, die umgekommen waren, über die Millionen, die fliehen mussten. Omar suchte nach einer Gelegenheit, seinen Landsleuten zu helfen, und Kayla bestärkte ihn darin.
Als Omar den Auftrag erhielt, in einer von Spanien geleiteten Klinik der Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen in Aleppo eine Internetverbindung einzurichten, stritten Kayla und er sich, denn die syrische Stadt galt als ausgesprochen gefährlich für Ausländer. Doch Omar hatte sich entschieden, und Kayla wollte ihn unbedingt begleiten, wollte sich trotz der Gefahren in dem vom Bürgerkrieg gezeichneten Land dem Leid der Menschen stellen und helfen, wo und wie sie konnte. Und sie setzte ihren Willen durch.
Den Einsatz ihres Verlobten in der Klinik nutzte Kayla, um sich von syrischen Frauen über deren Alltag berichten zu lassen. Sie hörte ihnen aufmerksam zu, fühlte mit ihnen und versuchte, ihnen Trost und Hoffnung zu spenden.
Dann kam der Tag, als Omars Arbeit getan war und sie gemein-sam mit einem Bus in die Türkei weiterreisen wollten. Weil der Weg unsicher und ihr Gepäck schwer war, nahmen sie ein Taxi zum nahen Busbahnhof. Normalerweise dauerte die Fahrt nicht länger als zehn Minuten. Doch als Kayla und Omar das Taxi bestiegen, waren die Straßen Aleppos überfüllt. Als sie wieder einmal im Gedränge halten mussten, erschienen plötzlich mehrere vermummte Gestalten neben dem Wagen. Mit vorgehaltenen Waffen zwangen sie alle Insassen des Taxis auszusteigen und verschleppten sie in ein Gefängnis des IS, der Terrormiliz Islamischer Staat.
Omar wurde geschlagen und verhört, sollte Auskunft geben über seine Arbeit, seine Religion, seine Beziehung zu Kayla. All das ertrug er, weil er wusste, dass Kayla lebte. Mal sprach er so laut in seiner Zelle, dass sie ihn hören und mit einem Husten antworten konnte. Bei anderen Gelegenheiten kniete er tief auf dem Boden, damit er durch einen Schlitz unter der Tür wenigstens ihre nackten Füße in den Sandalen sehen konnte.
Nach zwanzig Tagen ließen die Entführer den jungen Syrer frei und befahlen ihm zum Abschied, seine Verlobte zu vergessen. Schweren Herzens setzte Omar sich in die Türkei ab. Kayla, von den Entführern und deren Frauen unter die tiefschwarze Vollverschleierung des IS gezwungen, musste als Geisel zurückbleiben.
Für Abu Bakr Al-Baghdadi, den selbsternannten Kalifen und Führer des IS, stellten alle gefangen genommenen Frauen eine Kriegsbeute dar, die seinen Leuten zustand. Vor allem jenen Kämpfern, die sich noch keine Ehe mit einer Frau leisten konnten. Kayla jedoch beanspruchte er für sich selbst, sah sie als seinen legitimen Besitz an. Wenn er gewaltsam in sie eindrang, betrachtete er das nicht als Vergewaltigung. Solches Denken war ihm fremd. Nein, mit Kayla belohnte er sich für die erfolgreiche Ausbreitung des von ihm beherrschten Kalifats. Zugleich behielt er im Hinterkopf, dass sie Amerikanerin war, für die sich gewiss ein guter Preis aushandeln ließ. Fünf, sechs, vielleicht sieben Millionen Dollar. Also ließ er zu, dass sie einen langen Brief an ihre Eltern schreiben und aus dem Gefängnis schmuggeln konnte. Einen Brief, in dem sie ihren Eltern mitteilte:
Bitte wisst, dass ich an einem sicheren Ort bin, komplett unverletzt + gesund (habe tatsächlich an Gewicht zugelegt); ich bin mit höchstem Respekt + Freundlichkeit behandelt worden.
Bitte seid geduldig, gebt euren Schmerz an Gott. Ich weiß, dass ihr wollen würdet, dass ich stark bleibe. Das ist genau das, was ich tue. Habt keine Angst um mich, betet weiterhin, wie ich es auch tun werde + so Gott will, werden wir bald wieder zusammen sein. Alles, was ich habe, Kayla
Das wenige Sekunden kurze Video, das der IS von ihr drehte, dokumentierte eine andere Wirklichkeit, zeigte eine völlig veräng-stigte Kayla mit schwarzer Kopfbedeckung und freigelegtem Gesicht. Es war offensichtlich, dass sie ziemlich abgenommen hatte und ihrer Mutter dadurch noch ähnlicher sah. Zu sehen war eine junge Frau, deren Augen ihr Martyrium und eine unendliche Traurigkeit widerspiegelten. Ihre Botschaft bestand aus wenigen Sätzen. »Mein Name ist Kayla Mueller. Ich brauche eure Hilfe. Ich bin schon zu lange hier, und ich war sehr krank. Es ist entsetzlich hier.«
Einer ihrer Entführer mailte die Filmsequenz an einen von Kay-las Freunden in den USA. Der leitete das Video an das FBI weiter. Nachdem Experten die Aufnahme geprüft, ausgewertet und als echt eingestuft hatten, spielte man sie den Muellers vor.
An jenem Tag, an dem sich ihre Eltern Tausende Kilometer entfernt ansehen mussten, in welchem Zustand ihre Tochter war und mit welch unsicherer Stimme ihre sonst so fröhliche und lebensbejahende Kayla um Worte rang, wie sehr sie sich darum bemühte, vor der Kamera die Fassung zu bewahren, brach Carl und Marsha Mueller das Herz.
Weitere Briefe folgten, in denen Kayla ihren Eltern Mut zusprach. Auf die Zahlung von Lösegeld durch die Regierung hofften die Muellers jedoch vergeblich.
»Sobald wir dies täten, würden wir nicht nur das Abschlachten unschuldiger Menschen finanzieren und ihre Organisation stärken, sondern US-Bürger zu noch attraktiveren Zielen für künftige Geiselnahmen machen«, begründete der US-Präsident, warum die USA grundsätzlich keine Lösegeldforderungen von Extremistengruppen erfüllten.
Am 6. Februar 2015 lag die Temperatur in Syrien bei elf Grad. Der Himmel war vielerorts leicht bewölkt, und es regnete stellenweise. In Prescott hielten Carl und Marsha Mueller ein neues Schreiben ihrer Tochter in den Händen, das mit den Worten endete:
… Habt keine Angst um mich, betet weiter, so wie ich es tun werde, und wenn Gott will, werden wir bald wieder zusammen sein. In Liebe Kayla
Am selben Tag verbreitete der IS über seine Propagandakanäle, Kayla Mueller sei bei einem Luftangriff eines jordanischen Kampfflugzeuges auf ein Haus im syrischen Rakka ums Leben gekommen. Die jordanische Regierung in Amman reagierte umgehend und wies die Anschuldigung als frei erfunden zurück. Das Weiße Haus in Washington bestätigte Kaylas Tod, machte aber keine Angaben zu den näheren Umständen. Man teilte lediglich mit, dass die Entführer der Familie in den vergangenen Tagen eine Botschaft mit zusätzlichen Informationen übermittelt hätten. Den Fotos zufolge könne es keinen Zweifel am Tod der jungen Frau geben. Außerdem informierte der US-Präsident darüber, dass die USA mit einem Spezialkommando versucht hätten, Kayla Mueller und weitere Gefangene des IS in Syrien zu befreien. Der Präsident sagte in einer öffentlichen Erklärung: »Ich habe unter enormem Risiko eine Operation eingesetzt, um sie und andere Geiseln zu befreien. Vermutlich verpassten wir sie um ein oder zwei Tage.«
Kayla Mueller wurde sechsundzwanzig Jahre alt.
»Die Bedrohungen für die freiheitlich-demokratische Grundordnung werden vielfältiger und komplexer.«
(Auszug aus dem deutschen Verfassungsschutzbericht 2018. Er wurde am 27. Juni 2019 von Bundesinnenminister Horst Seehofer und Verfassungsschutz-Präsident Thomas Haldenwang vorgestellt.)
1. Kapitel
30. November 2018, Berlin, Deutschland
Der Tower am Flughafen Tegel ließ sich an diesem bewölkten und trüben Novemberabend mehr erahnen als erkennen. Manfred Weidland trank genussvoll einen Schluck des frisch gebrühten Kaffees, den Chef-Stewardess Judith Heinzeller ihm nach vorne ins Cockpit gebracht hatte, und sah aus dem Seitenfenster.
Weidland gehörte zu einer eintausend Mitglieder zählenden Bundeswehr-Spezialeinheit der Luftwaffenflotte der Bundesregierung und trug wie üblich Militärkleidung. Er rechnete mit einem ruhigen, knapp zwölftausend Kilometer langen Nachtflug über den Atlantik nach Buenos Aires. Die kalkulierte Flugzeit betrug 14,5 Stunden. Vierundzwanzig Stunden später sollte der Kurz-Trip der Bundeskanzlerin um die halbe Welt wieder zurückgehen. Für Weidland und seinen Copiloten Jan Bremmecke reine Routine.
Der schneeweiße, 300 Millionen teure Airbus 340-313X VIP der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums, in dessen Cockpit Weidland und Bremmecke saßen und auf die Startfreigabe warteten, war nach dem ersten Kanzler der Bundesrepublik Deutschland benannt. Die Konrad Adenauer stand mit einhundert Tonnen Kerosin vollgetankt auf der Startbahn. Alle Systeme des früheren Lufthansa-Jets, der nach dem Umbau in ein fliegendes Büro mit einen Freund-Feind-Erkennungssystem und zusätzlichen Treibstofftanks ausgestattet war und gut einhundertvierzig Passagiere aufnehmen konnte, waren gecheckt.
Auch die am Rumpf installierte Technik für das Abwehrsystem des Flugzeugs meldete keine Störung. Die Sensoren, die das Umfeld erfassten, waren aktiviert. Bei einer Bedrohung durch eine Boden-Luft-Rakete würden sie einen Laserstrahl auslösen, der den Suchkopf der Rakete zerstörte. Gegen den Angriff mit einer herkömmlichen Lenkrakete war die Konrad Adenauer ebenfalls geschützt. Die Piloten konnten die Rakete in die Irre führen, indem sie glühend heiße Täuschkörper ausstießen, die die Hitze der Triebwerke imitierten, so dass die Rakete den Airbus verfehlte.
Judith Heinzeller schloss die Tür zum Cockpit hinter sich und strich sich eine Strähne hinter das Ohr. Dann setzte sie ihr strahlendes Lächeln auf und begann den letzten Gang vor dem Start durch die auf angenehme 21,5 Grad Kabinentemperatur klimatisierte Maschine. Ihre Augen waren überall.
Das Privatappartement der Bundeskanzlerin an Bord mit eigenem Schlafzimmer war jetzt leer. Die Kanzlerin hatte sich in ihr Badezimmer zurückgezogen, um sich kurz frisch zu machen für die anstehenden Vorbereitungsgespräche mit ihrer Delegation. Der Technikraum für Funker und Sicherheit war besetzt, die kleine Küche dahinter auf alle Speisen und Getränke vorbereitet, die die Regierungschefin liebte – von Kartoffelsuppe, Königsberger Klopsen, Grünkohleintopf mit Mettwurst, Rinderrouladen, frischen Mohrrüben und Gurken bis zu Weißwein, Tee und Kaffee.
Der schallisolierte, mit Videokommunikation ausgestattete Besprechungsraum für den Regierungsstab wurde intern Wohnzimmer genannt. Dort saßen der Vize-Kanzler und weitere hochrangige Vertreter der Bundesregierung und studierten intensiv ihre Akten. Eine Sektion dahinter unterhielten sich die engsten Vertrauten und Berater der Kanzlerin und ihre persönliche Sekretärin auf dick gepolsterten grauen Ledersesseln. Noch weiter hinten, zwischen den dreizehn Sitzreihen der früheren Economy-Klasse mit den schmalsten Plätzen in der Maschine, hatten sich Leibwächter, ausgewählte Journalisten und der Rest der Service-Crew verteilt.
Alle waren mit sich oder ihrem Sitznachbarn beschäftigt, niemand beachtete Judith Heinzeller, die einen prüfenden Blick in die beiden Küchenzeilen ganz am Ende der Maschine warf. Sämtliche Geräte waren ausgeschaltet, die Rollcontainer gesichert.
Heinzeller griff zum Bordtelefon und informierte den Piloten, dass alles okay war in ihrem Zuständigkeitsbereich und sie starten konnten. Dann nahm sie in der letzten Sitzreihe neben ihren Kolleginnen am Mittelgang Platz und bereitete sich gedanklich auf den bevorstehenden Serviceablauf vor.
Im Cockpit sah Manfred Weidland auf seine Armbanduhr. Genau neunzehn Uhr. Er nickte seinem Copiloten zu.
Jan Bremmecke meldete dem Tower: »Ready for Take-Off.«
Wenige Sekunden später kam die Antwort des Fluglotsen: »All cleared for departure, go ahead.«
Sie konnten starten.
Bremmecke legte seine Hand auf die vier Schubhebel und brachte die Triebwerke zunächst auf die Hälfte ihrer Leistung. Als sie störungsfrei liefen, schob er die Hebel bis zum Anschlag nach vorn – auf Maximalleistung.
Die Bundeskanzlerin wurde von den argentinischen Gastgebern und von den Staatsoberhäuptern der führenden Industrienationen zum G-20-Gipfel erwartet. Wenn der Flug planmäßig verlief, würden die deutsche Regierungschefin und ihre Delegation am nächsten Vormittag um zehn Uhr deutscher Zeit pünktlich in Buenos Aires landen.
*
Zwischen der Kleingartenkolonie Vor den Toren und dem Alten Wiesenweg ging Alpaslan Haddad in die Hocke und zog ein Monokular mit der vielsagenden Modellbezeichnung Nightspy aus einer grau-blauen Umhängetasche hervor, die neben ihm auf dem Boden stand. Er hatte das für ein Auge konstruierte Fernglas gebraucht gekauft und bar bezahlt, in einem muffig riechenden Second-Hand-Geschäft im Wedding, dessen Inhaber seinen Kunden niemals Fragen stellte. Bei Dunkelheit betrug die Reichweite des Monokulars mehrere hundert Meter.
Haddad hob das Fernglas vor das rechte Auge, kniff das andere zu und zoomte das Flughafengelände heran. Mit klammen Fingern drehte er vorsichtig das Fokussierrädchen, bis die mit laufenden Turbinen wartenden Flugzeuge scharf zu sehen waren. Um das Bild nicht zu verwackeln, atmete er flach und suchte dabei Meter für Meter die Startbahn ab.
Da! Das musste die Konrad Adenauer sein! Eine weiße, vierstrahlige Maschine mit einem schwarz-rot-goldenen Längsstreifen, der sich über die gesamte Länge der Maschine zog. Über dem Streifen, genau zwischen den Türen des Vorder- und Hintereinstieges, prangte in Großbuchstaben ein unübersehbarer Schriftzug.
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
Haddad nickte unmerklich.
Der Airbus nahm Fahrt auf und beschleunigte. In Gedanken zählte Haddad mit, langsam und gleichmäßig – siebzehn, achtzehn, neunzehn. Nach zwanzig Sekunden auf der Startbahn hob die Maschine mit 300 Stundenkilometern in Richtung Osten ab.
Haddad legte das Monokular zurück in die aus dem Material einer früheren Turnmatte hergestellte Tasche und holte ein Smartphone älterer Bauart aus dem Inneren hervor. Er fischte eine Prepaid-SIM-Karte aus der Hosentasche und steckte sie in das Smartphone. Dann schaltete er das Handy ein und gab einen vierstelligen Zahlencode ein. Als das Hauptmenü erschien, tippte er auf InterComText, die einzige installierte Programm-App. Eine leere, weiße Sprechblase vor hellblauem Hintergrund öffnete sich.
InterComText galt als eines der sichersten Messenger-Programme weltweit. Die kaum zu knackende Verschlüsselung der Nachrichten war durch mehrere Tests bestätigt worden. Aufmerksam geworden waren Haddad und seine Glaubensbrüder auf den kostenlosen Kurznachrichtendienst durch einen ehemaligen amerikanischen CIA-Mitarbeiter und Whistleblower. Dessen Enthüllungen hatten der ganzen Welt Einblicke in das unfassbare Ausmaß der weltweiten Überwachungs- und Spionagepraktiken von Geheimdiensten gegeben – vor allem die der Vereinigten Staaten und Großbritanniens. Die Veröffentlichungen des Whistleblowers waren so brisant, dass sie im Sommer 2013 eine Affäre um den auf technische Überwachung spezialisierten NSW auslösten, den US-Geheimdienst National Security Worldwide.
Um einer Haftstrafe in den USA zu entgehen, lebte der Whistleblower an einem unbekannten Ort im Exil. Einem Reporter hatte er erzählt, dass er InterComText täglich nutzte, weil die Nachrichten sich auf Wunsch des Senders oder des Empfängers selbst löschten, nachdem sie gelesen worden waren. Außerdem hatten die Programmierer der App die Quellcodes als Open Source vollständig offengelegt. Das schloss nachrichtendienstliche Hintertüren aus, von denen die Anwender nichts wussten. Es hieß, auch populärere Messengerdienste basierten auf dem für InterComText verwendeten Protokoll, das der sicheren Übertragung der Nachrichten diente. Für die Entschlüsselungs-Computer des NSW, der weltweit Festnetz- und Mobilfunkgespräche abhörte, Faxe, Mails und Kurznachrichten abfing und auswertete, war das ein bisher ungelöstes Problem. Die Programmierer des US-Geheimdienstes arbeiteten fieberhaft daran InterCom-Text zu knacken. Bisher jedoch erfolglos.
Nachdem Haddad eine aus fünf Personen bestehende InterComText-Kontaktgruppe ausgewählt hatte, öffnete sich ein hellblaues Dialogfenster. Er tippte auf Arabisch die Nachricht:
Die Tante hat pünktlich ihren Zug erreicht und ist abgefahren.
Dann drückte er die Return-Taste, schaltete das Handy wieder aus und entfernte die SIM-Karte. Er würde beides auf dem Nachhauseweg in den Reinickendorfer Schäfersee werfen. Das Smartphone und die Karte würden lautlos in dem kreisrunden, sieben Meter tiefen Gewässer versinken – so wie die Maschine der deutschen Bundesregierung mit der verhassten Bundeskanzlerin an Bord in den unendlichen Tiefen des Atlantiks.
Alles war perfekt geplant. Sehr wahrscheinlich würden die Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung in Braunschweig keine eindeutige Absturzursache ermitteln können. Der Regierungssprecher würde von einem technischen Defekt sprechen, mit dem die Maschinen der Flugbereitschaft in den vergangenen Jahren mehrfach Schlagzeilen gemacht hatten. Zuletzt Mitte November, als der Bundespräsident eine mehrstündige Zwangspause in Südafrika einlegen musste, weil eines der Triebwerke nur mit Hilfe externer Druckluft- und Bodenstromgeräte angeworfen werden konnte.
Alpaslan Haddad entspannte sich und hob die Hände zum Himmel. Am liebsten hätte er seine Vorfreude auf den großen Augenblick, den Moment, der die gesamte Welt schockieren würde, laut herausgerufen. Aber weil niemand ihn hören durfte, unterdrückte er den aufkommenden Gefühlsausbruch und murmelte nur etwas, das klang wie »Allahu akbar«, Gott ist groß.
*
Nachdem der Airbus 340 seine Reiseflughöhe erreicht hatte und die Anschnallzeichen erloschen waren, löste Judith Heinzeller ihre Schultergurte, setzte wieder ihr gewinnendes Lächeln auf und ging nach vorn, um nach der Bundeskanzlerin zu sehen. Die Regierungschefin saß bereits im Besprechungsraum direkt hinter ihrem Privatquartier mit dem Rücken zum Fenster und schrieb eine kurze SMS. Als sie Heinzeller sah, lächelte auch sie, legte ihr Handy auf die breite Armlehne ihres Ledersessels und bestellte für die erwarteten Gesprächspartner Kaffee. Sie selbst entschied sich für einen Pfefferminztee.
»Sehr gerne«, antwortete die Chef-Stewardess und verschwand in der kleineren der beiden Bordküchen, die sich zwischen dem Privatbereich der Kanzlerin und dem Besprechungsraum befand.
Als sie wenige Minuten später mit Kaffeekannen, Tassen, Milchkännchen und Zuckerdosen auf einem Rollwagen zurückkam und Tee und Kaffee auf einem kleinen Tablett servierte, waren alle acht Ledersessel neben und vor der Kanzlerin im Besprechungsraum mit Journalisten besetzt, leicht zu erkennen an den vielen Fragen, die sie der Kanzlerin stellten. Keiner der Presseleute, sechs Männer und zwei Frauen, hatte ein Diktiergerät oder Notizblock und Stift dabei. Was hier an Informationen und an Meinungen weitergegeben wurde, blieb „unter drei“. Das war eine eiserne Regel, die in Deutschland seit Jahrzehnten für bestimmte Treffen von Politikern, Unternehmern, Behördenmitarbeitern, Polizisten und Soldaten mit Journalisten galt. Presseleute, die diese Regel brachen, wurden nicht mehr zu vertraulichen Gesprächen eingeladen. Auf diese Weise sollten geschützte Räume geschaffen werden, in denen die offiziellen Gesprächspartner frei ihre Einschätzungen abgeben konnten, ohne befürchten zu müssen, Minuten später in Online-Medien oder am nächsten Tag in gedruckter Form zitiert zu werden. Auf diese Weise ließen sich negative Reaktionen von Vorgesetzten und ungewollte politische Konsequenzen im In- und Ausland vermeiden.
Beim Verteilen des Geschirrs und dem Einschenken des Kaffees half Judith Heinzeller der Kanzlerin, die bei solchen Reisen und vergleichbaren Treffen immer darauf bestand, ihre Gäste auch selbst zu bedienen. Später würden Heinzellers Kolleginnen und Kollegen die Journalisten im hinteren Teil der Maschine weiter versorgen, weil vorgesehen war, dass die Pressevertreter ihre Plätze dann mit dem Vizekanzler tauschten.
Um Punkt viertel vor acht erschien der Vizekanzler im Besprechungsraum und fragte gut aufgelegt in die Journalistenrunde: »Na, alle Geheimnisse der Großen Koalition aufgedeckt?«
»Wenn mein Kollege und Stellvertreter erscheint, wird es ernst, dann muss ich zum Schluss kommen. Auf dem Rückflug finden wir sicher Gelegenheit, weitere ihrer Fragen zu beantworten«, leitete die Kanzlerin zuversichtlich lächelnd das Ende des vertraulichen Gespräches ein. »Jetzt wünsche ich Ihnen und uns allen weiterhin einen ruhigen Flug.«
Zwei Minuten später saßen die Regierungschefin und ihr Stellvertreter sich gegenüber. Wie gewünscht, brachte Judith Heinzeller eine Flasche Weißwein, einen französischen Burgunder, leicht gekühlt. Sie wollte sich gerade in den hinteren Teil der Maschine begeben, um zu sehen, ob sie ihr Team unterstützen konnte, als das Lämpchen aufleuchtete, mit dem die Piloten ihr signalisierten, dass sie im Cockpit erwartet wurde. Wahrscheinlich bekamen die beiden Männer langsam Hunger. Sie entschuldigte sich und ging nach vorn.
Mit flinken Fingerbewegungen gab Heinzeller den elektronischen Zugangscode ein, der die drei Türriegel entsicherte, und betrat das Cockpit. Sofort wurde ihr klar, dass etwas nicht stimmte. Eine laute Computerstimme wiederholte im Abstand weniger Sekunden »Master Caution – Master Caution – Master Caution«, während mehrere Warnleuchten gleichzeitig rot pulsierten, um technische Fehlfunktionen anzuzeigen.
»Schließen sie die Tür«, forderte Weidland sie in einem Ton auf, den sie von ihm nicht kannte. Sie kam der Aufforderung umgehend nach. Ohne den Blick von den Instrumenten zu nehmen, fuhr der Kapitän fort: »Wir haben ein Problem. Ein großer Teil des Stromsystems ist ausgefallen. Wir müssen schnellstmöglich landen. Holen sie die Bundeskanzlerin.«
Heinzeller folgte Weidlands Blick und sah auf den Bildschirmen beider Piloten eine Anzeige blinken.
DC Essential BUS FAULT DC Essential BUS FAULT
Was genau das bedeutete, wusste sie nicht. Es spielte auch keine Rolle. Der Pilot hatte sich klar ausgedrückt.
Heinzeller drehte sich um und verließ das Cockpit mit pochendem Herzschlag. Als sie den Konferenzraum betrat, sprachen die kanzlerin und ihr Stellvertreter leise miteinander. Ihre Weingläser, an denen sich außen kleine Wasserperlen gebildet hatten, hatten beide noch nicht angerührt.
Heinzeller trat näher und beugte sich leicht hinunter. »Frau Bundeskanzlerin.«
Die Kanzlerin reagierte nicht gleich, sondern sprach zunächst ihren Satz zu Ende. Dann sah sie zu ihr hoch.
»Entschuldigen sie, Frau Bundeskanzlerin. Der Pilot möchte sie sprechen. Es ist wirklich wichtig.«
»Das sollte es auch sein«, sagte der Vizekanzler leicht gereizt, ohne seine Stimme zu erheben, als die Regierungschefin sich mit hochgezogenen Augenbrauen kommentarlos erhob und der Chef-Stewardess folgte.
Im Cockpit bemühte Jan Bremmecke sich seit zwanzig Minuten darum, mit der Bodenstation Kontakt aufzunehmen. Vergeblich. Keines der Funksysteme der Konrad Adenauer funktionierte. Es wurde Zeit, den dafür vorgesehenen vierstelligen Code am Transponder einzustellen, um die Bodenstation, aber auch andere Flugzeuge über ihre Situation zu informieren. 7.600 stand in der zivilen Luftfahrt für Radio Failure. Inoffiziell merkten Piloten sich die Ziffern mit dem sarkastischen, englischdeutschen Spruch: »Seven-Six – hear nix.«
Als die Kanzlerin das Cockpit betrat, erhob Manfred Weidland sich von seinem Sitz und kam gleich zur Sache. »Frau Bundeskanzlerin, es tut mir leid, dass wir Ihre Gespräche unterbrechen müssen, aber wir haben ein ernstes technisches Problem. Seit wir Braunschweig überflogen haben, funktionieren einige wichtige Systeme der Maschine nicht mehr. Wir befinden uns bereits im holländischen Luftraum, müssen aber umkehren. Wir werden nicht nach Berlin zurückfliegen, sondern in Köln landen. Die Strecke ist kürzer. Bitte informieren Sie ihre Delegation. Um die anderen Passagiere kümmern sich Frau Heinzeller und ihr Team.«
Die Kanzlerin atmete tief durch und fragte: »Können Sie unter diesen Umständen sicher landen?«
Weidland zögerte einen Moment mit der Antwort, bevor er mit fester Stimme sagte: »Sie müssen sich keinerlei Sorgen machen. Das kriegen wir hin. Bitte nehmen Sie wieder Platz und schnallen Sie sich an. Wir kehren jetzt um.«
Eine Minute später saß die Kanzlerin angeschnallt wieder in ihrem Sitz und klärte ihren Stellvertreter auf. Der Vize-Kanzler schnaubte. Vor vierzehn Tagen hatte es ihn schon einmal erwischt. »In Indonesien, Nagerbefall auf Bali. Ich musste in eine Linienmaschine umsteigen, weil die Konrad Adenauer nicht starten konnte, und Zwischenstopps in Hongkong und Zürich einlegen. Zur Begründung wurde mir gesagt, Mäuse oder Ratten hätten einige Kabel angefressen, die natürlich erst repariert werden mussten. Alles in allem hat der Rückflug zweiundzwanzig Stunden gedauert.«
Die Bundeskanzlerin ging nicht auf die Bali-Schilderung ein. Das war nicht ihre Aufgabe, sondern Sache der Bundesverteidigungsministerin. Stattdessen nahm sie ihr Smartphone zur Hand und bat ihre persönliche Sekretärin per SMS, die Flugbereitschaft in Köln-Wahn zu informieren, dem zweiten Heimatstandort der Regierungsflugzeuge. Die sollten den Weiterflug mit der einzigen anderen Regierungsmaschine organisieren, die für derart lange Strecken geeignet war – die Theodor Heuss.
Währenddessen navigierte Bremmecke mit Hilfe des Satellitentelefons. Er hatte noch immer keinen Kontakt mit der Bodenstation und leitete die Umkehr mit einer engen Kurve über der Nordsee ein. »Wie schätzen sie unsere Chance für eine unfallfreie Landung ein?«, wandte er sich an Weidland, der über einige Jahre mehr Flugerfahrung mit dem A 340 verfügte.
»Fragen sie mich was Leichteres. Vor einem halben Jahr war ich im Flugsimulator mit einer ähnlichen Situation konfrontiert. Hinterher wusste ich nicht mehr, wie ich heiße. Technisch ist die Landung natürlich machbar. Aber die Tanks sind noch fast voll. Wir sind viel zu schwer, das ist das Hauptproblem. Für eine solche Belastung sind das Fahrwerk und die Bremsen nicht ausgelegt. Ich schätze, die Bremsen werden bei der Landung glühen.«
Bremmecke fühlte, wie sich Schweißtropfen unter seinen Achseln bildeten und ihm ins T-Shirt liefen. »Ich versuche, so viel Treibstoff wie möglich abzulassen, bis wir Köln erreichen.«
»Tun sie das, aber vorschriftsmäßig – nur über dünn besiedeltem Gebiet, Flughöhe nicht unter eintausendachthundert Metern, Geschwindigkeit mindestens fünfhundert km/h.«
Der Copilot drückte zweimal einen Knopf. Doch nichts passierte. »Oh Mann, das Ventil öffnet sich auch nicht«, stöhnte Bremmecke und sah Weidland vielsagend an. Der erfahrenste Pilot der Flugbereitschaft kniff die Lippen zusammen und entließ einen Stoßseufzer durch die Nase.
Judith Heinzeller und ihr Team taten ihr Möglichstes, um die Passagiere mit Getränken, Snacks und Gesprächen abzulenken. Doch gerade unter den Journalisten gab es kein anderes Thema mehr als die Serie bekannt gewordener Pannen deutscher Regierungsflugzeuge, von denen sie selbst gerade eine miterlebten. Das würde Schlagzeilen geben! Die ersten Presseleute twitterten bereits und baten die Kolleginnen und Kollegen in den Redaktionen, ihre Live-Eindrücke um die archivierten Vorfälle der vergangenen Jahre zu ergänzen und umgehend damit online zu gehen.
»Unglaublich«, hörte Heinzeller wenige Minuten später einen Zeitungsmann sagen, als die ersten Eilmeldungen im Netz kursierten. »Hört euch das an, Juni 2018 – Hydraulikschaden der Konrad Adenauer verzögert Reise des Bundespräsidenten nach Weißrussland; Februar 2017 – bei der Rückreise der Bundesverteidigungs-ministerin aus Litauen fällt der neue Transportflieger der Bundeswehr mit Triebwerkschaden aus; Mai 2016 – als der A 340 mit dem Bundesaußenminister nach Afrika abheben will, platzt ein Reifen, und der Pilot muss eine Vollbremsung hinlegen; Oktober 2015 – die Bundeskanzlerin muss wegen technischer Probleme statt in einer der Regierungsmaschinen in einem Truppentransporter nach Indien fliegen. Und so geht das immer weiter – Feueralarm wegen eines qualmenden Triebwerks, überhitztes Triebwerk, Notlandung nach Druckabfall.«
Zwei Reihen hinter ihm meldete sich die Kollegin einer Presseagentur zu Wort. »Die Verteidigungsministerin hat schon Stellung bezogen. Der Abbruch unserer Reise sei bedauerlich, aber kein Hinweis auf ein grundsätzliches Problem bei der Flugbereitschaft. Wenn ausgerechnet ein Flug der Kanzlerin ein Problem habe, sei das zwar besonders unangenehm. Mit nur zwei Prozent ausgefallenen Regierungsflügen in den beiden letzten Jahren und einer Einsatzbereitschaft von durchschnittlichen fast neunzig Prozent sei die Flugbereitschaft statistisch betrachtet aber sehr zuverlässig.«
»Lange wird Flinten-Unschi wohl keine Gelegenheit mehr haben, eine solche Kette von Zwischenfällen unter ihrer Führung schönzureden«, spottete ein junger Online-Kollege.
»Wie heißt es so schön, runter kommen sie alle«, warf ein älterer Politikredakteur ein, der für ein politisches Magazin arbeitete. Die meisten Journalisten um ihn herum reagierten mit Gelächter. Ihr Lachen kam aber nicht aus vollem Herzen, sondern hatte angesichts der angespannten Atmosphäre an Bord eher etwas Befreiendes, etwas, das die unsichtbare Beklemmung der Passagiere kurzzeitig ablöste. So empfand es Heinzeller, die im Laufe ihrer Berufsjahre eine ziemlich gute Menschenkenntnis erworben hatte und mit ihrer Einschätzung meistens richtig lag.
Als Bremmecke den Landeanflug auf den Flughafen Köln einleitete und Judith Heinzeller aus dem Seitenfenster sah, fiel ihr ein Dutzend Feuerlöschfahrzeuge auf, die mit eingeschaltetem Blaulicht in der Nähe der Landebahn standen und sie erwarteten. Offenbar aus gutem Grund. Die Konrad Adenauer setzte so hart auf, dass sie und alle anderen fest in den Sitz gedrückt und dann so mächtig durchgeschüttelt wurden, wie sie es noch nie erlebt hatten. Dass die Piloten bremsten, war deutlich zu spüren, als die Fliehkräfte sie in die Haltegurte presste. Die Maschine wurde zwar immer langsamer, kam aber einfach nicht zum Stehen, rollte weiter und weiter. Auf einem kleineren Flughafen mit kürzerer Landebahn wären sie schon über die Asphaltdecke hinausgeschossen, ging es Heinzeller durch den Kopf. Dann, nach weiteren Sekunden, die ihr endlos lang erschienen, kamen die Räder des Airbus mit einem deutlichen Ruck zum Stillstand. Endlich. Die Chef-Stewardess schloss für einen Moment die Augen. Und obwohl sie nicht besonders gläubig war, dankte sie Gott – das Fahrwerk und die Bremsen hatten trotz des viel zu hohen Landegewichts durchgehalten.
Als Heinzeller sich abgeschnallt hatte und nach vorn ging, um nach ihrem wichtigsten Fluggast zu sehen, fiel ihr auf, dass aus den Sorgenfalten der Kanzlerin Falten des Unverständnisses geworden waren. Neben ihr saßen der Regierungssprecher und ihre Sekretärin, die ihr gut zuredete. »Ein direkter Weiterflug mit einem Ersatz-Airbus ist wegen der Arbeitszeitregelung zwar nicht möglich, weil die Crew dafür schon zu lange im Dienst ist. Derzeit sind auch keine anderen Besatzungen und Flugkapitäne verfügbar. Aber es wird geprüft, wann Sie und eventuell ein Teil der Delegation nach Argentinien fliegen können. Vielleicht startet heute Abend noch ein Linienflug. Dann können Sie zumindest an einem Teil des Gipfelprogramms noch teilnehmen, zum Beispiel am Dinner der Staats- und Regierungschefs.«
»Zum Abendessen nach Buenos Aires fliegen? Also da habe ich Wichtigeres zu tun«, antwortete die Kanzlerin unwirsch und zog die Mundwinkel nach unten.
Obwohl sie über alle Schritte der Feuerwehr und der Flugzeugtechniker wegen der überhitzten Bremsen des A 340 informiert wurde und einsah, dass die Sicherheitsüberprüfungen Vorrang hatten, zeigte sich die Kanzlerin im Verlauf der nächsten Stunde zunehmend ungeduldig. »Wir sind vor siebzig Minuten gelandet, aber wir dürfen die Maschine immer noch nicht verlassen. Wie lange dauert das denn noch?«, beklagte sie sich bei ihrem Regierungssprecher. Über ihrer Nasenwurzel zeichneten sich deutlich zwei Falten ab.
Ihre Sekretärin beendete in diesem Moment ein Handygespräch und informierte die Regierungschefin. »Es tut mir leid, aber eine Weiterreise ist heute nicht mehr möglich. Wir fahren Sie nach Bonn ins Maximilian. Dort übernachten Sie und die Delegation. Für morgen früh haben wir Sie und den Vize-Kanzler auf eine Linienmaschine der spanischen Iberia von Madrid nach Buenos Aires gebucht.«
»Und was wird aus meinen Gesprächen mit dem amerikanischen Präsidenten und dem chinesischen Staatschef?«
»Wir versuchen gerade neue Termine mit ihren Büros abzustimmen. Bis wir im Hotel sind, wissen wir wahrscheinlich mehr.«
*
In der mit wenigen Möbelstücken spärlich eingerichteten Einzimmerwohnung von Alpaslan Haddad in Reinickendorf diskutierten hitzig fünf Männer auf Arabisch. Haddad und zwei weitere Männer saßen dicht nebeneinander auf seinem dunkelgrauen Schlafsofa. Zwei weitere Männer hockten mit angezogenen Knien vor ihnen auf dem braunen Teppichboden.
»Ich verstehe das nicht«, sagte der älteste von ihnen und schlürfte einen Schluck stark gesüßten, heißen Tee aus einem kleinen Glas ohne Henkel, das wie eine Blumenvase geformt war. »Fast zwei Jahre haben wir alles vorbereitet. Und jetzt so ein Fehlschlag. Wie konnte das passieren, Bruder?«
Der Mann mit den glänzenden, sorgfältig gescheitelten Haaren, der ihm gegenübersaß, nahm die Hände von seinen Schläfen und erhob seinen Blick. »Was guckt ihr mich an? Ich habe alles genau so gemacht, wie wir es besprochen hatten. Ich weiß doch auch nicht, was schiefgegangen ist.«
»Was sagen wir nur dem Kalifen?«, jammerte ein anderer.
»Die Wahrheit, was sonst«, bestimmte der älteste der fünf und forderte Haddad auf, sein Tablet einzuschalten. »Nun, was berichten die Lügenschreiber der westlichen Propaganda-Presse?«
Haddad starrte angestrengt auf den Bildschirm und wischte ein paar Mal hin und her. »Die deutschen und die internationalen Schlagzeilen über die Notlandung überschlagen sich.«
»Eine Zusammenfassung reicht für den Moment«, wies der Weißhaarige ihn an.
»Die Panne ist der deutschen Luftwaffe rätselhaft und peinlich. Der Flugkapitän ist fix und fertig und spricht von einem für ihn bislang unvorstellbaren Zusammenbruch der Kommunikationstechnik. Die Wehrexperten der Oppositionsparteien im Bundestag fragen, warum die Flugzeuge der Flugbereitschaft häufiger ausfallen als die im zivilen Betrieb und denken über eine Privatisierung der Flugbereitschaft nach. In deutschen und internationalen Sicherheits- und Regierungskreisen wird der Verdacht auf einen kriminellen Hintergrund geäußert. Anhaltspunkte dafür gefunden wurden bisher aber nicht.«
»Das ist gut«, sagte der Weißhaarige und trank einen weiteren Schluck Tee. »Das ist sehr gut.«
20. Dezember 2018, Berlin, Deutschland
Drei Wochen nach der Notlandung saß die Regierungschefin im Kanzleramt an ihrem Schreibtisch und ließ sich von einem der insgesamt vier Staatssekretäre des Bundesverteidigungsministeriums die Zusammenfassung des offiziellen Unfallreports vortragen. Sie hörte ruhig und aufmerksam zu. Die genaue Ursache der Panne war nicht gefunden worden. Der Technikausfall sei nicht nachvollziehbar und entgegen des vorgesehenen Systemverhaltens abgelaufen. Normalerweise hätte die Konrad Adenauer durch Ersatzsysteme, wenn auch eingeschränkt, funktionsfähig bleiben müssen. Herausgefunden hatten die Experten lediglich, dass eine Transformer-Gleichrichter-Einheit ausgefallen war, die den durch die Turbinen erzeugten Wechselstrom zu Gleichstrom für die Bordinstrumente und diverse hydraulische Funktionen umwandelt. Warum der Defekt nicht durch die beiden anderen im A 340 verbauten Ersatz-Transformatorsysteme verhindert wurde, blieb unerklärlich. Die Vermutung, dass eine viel zu hohe Spannung das System blitzartig überlastete und zur kompletten Abschaltung führte, ließ sich nicht bestätigen. Denn als Techniker die Überspannung gezielt nachgestellt hatten, war der Effekt nicht noch einmal aufgetreten. Auch externe Fachleute rätselten, warum der Ausfall eines Gleichrichters zu einem Komplettausfall geführt hatte.
»Alle unsere Experten sind sich einig, dass sich das Problem mit einem Austausch des Transformators und einer neuen Konfiguration restlos beheben lässt. Nach erfolgter Reparatur sind beide A 340 in wenigen Tagen wieder einsatzbereit«, beendete der Staatssekretär seine Ausführungen.
»Das reicht mir nicht«, antwortete die Bundeskanzlerin bestimmt. »Ich möchte eine ähnliche Situation nicht noch einmal erleben. Und ich wünsche es auch keinem anderen Mitglied der Bundesregierung.«
»Natürlich nicht«, sagte der Staatsekretär und berichtete von der Idee, ein oder zwei neue Langstreckenflugzeuge zu kaufen. »Am besten geeignet wären wohl Airbusse vom Typ A 330 oder A 350, die eine große Reichweite haben.«
»Wie immer eine Lösung aussieht«, sagte die Kanzlerin, die aufstand und ihrem Gesprächspartner damit signalisierte, dass das Treffen für sie beendet war, »finden Sie schnell eine.«
Drei Tage später ließ die Bundesverteidigungsministerin in einer Wochenzeitung verbreiten, sie plane eine Neuanschaffung von Regierungsflugzeugen und werde sehr bald mit dem Finanzminister über das dafür notwendige Budget verhandeln.
Zu diesem Zeitpunkt arbeitete die Bundeskanzlerin bereits an einem Plan B für die Ministerin. Nachdem diverse Flugzeuge und Hubschrauber der Luftwaffe wegen technischer Mängel am Boden bleiben mussten, die Reparaturkosten für das Segelschulschiff Gorch Fock sich mehr als verzehnfacht hatten und die Honorarhöhe für externe Berater des Ministeriums die der anderen Ministerien um ein Vielfaches überstiegen, war die Ministerin innenpolitisch angeschlagen. Für Mitte kommenden Jahres stand die Wahl eines neuen Präsidenten der Europäischen Kommission an. Sollte der deutsche Spitzenkandidat für dieses Amt, ein CSU-Mann aus Bayern, sich nicht durchsetzen lassen, würde sie Brüssel gerne eine Kandidatin präsentieren. Eine christdemokratische, weibliche Alternative aus Niedersachsen, dem flächenmäßig zweitgrößten deutschen Bundesland, aus dem schon mehrere Politiker für Spitzenämter in Berlin hervorgegangen waren.
»Im Kampf gegen terroristische Anschläge sind Menschen- und Bürgerrechte an vielen Orten der Welt außer Kraft gesetzt worden. Das Prinzip von der Unteilbarkeit und Allgemeinheit der Menschenrechte, einst das hohe Lied der westlichen Demokratien, hat im Krieg gegen den Terror Schaden genommen.«
(Jutta Limbach war Professorin für Zivilrecht an der FU Berlin und Justizsenatorin des Berliner Senats, bevor sie 1994 als erste Frau zur Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts gewählt wurde.)
2. Kapitel
25. Mai 2019, Berlin, Deutschland
Die Erkenntnis durchfuhr Vangélis Tsakátos wie ein Stromschlag. Sein Herzschlag beschleunigte sich. Er sprang auf und brüllte: »Eine Bombe!«
Nichts passierte.
Es konnte doch nicht sein, dass niemand reagierte!
Fassungslos wirbelte Vangélis auf der Tribüne des Fußballstadions zu seiner Frau Sharon und zu seiner Tochter Lydia herum. Nicht einmal sie schienen ihn gehört zu haben. Seine Stimmbänder brannten wie Feuer. Doch er ignorierte den Schmerz in seiner Kehle und schrie ein zweites Mal: »EINE BOMBE!«
Wieder keine Reaktion.
Panisch sah er zum Schiedsrichter auf das Spielfeld hinunter. Der Schiri hielt jetzt statt seiner Pfeife eine Fahne in der Hand und schwenkte sie mit beiden Händen über dem Kopf kraftvoll hin und her. Die Fahne war tiefschwarz mit einem weißen Kreis in der unteren Hälfte. Der Kreis sah aus wie handgemalt und war unregelmäßig geformt. Die Kriegsflagge der Terrormiliz IS! Auf der Fahne stand auf Arabisch in unterschiedlich großer Schrift:
Allah - Prophet - MohammedEs gibt keinen Gott, außer Allah
Die Scheinwerfer im Olympia-Stadion erloschen.
Die Anfeuerungsrufe der 74.000 Fußballfans verstummten.
Ein ohrenbetäubender Knall zerriss die Stille.
Von der Spielfeldmitte über die Behindertenplätze in der ersten Zuschauerreihe hinweg schoss eine Stichflamme empor. Sie dehnte sich in rasender Geschwindigkeit zu einem gewaltigen Feuerball aus, der eine Hitzewelle vor sich hertrieb und fauchend durch die Sitzreihen raste.
Direkt auf sie zu.
Reflexartig ergriff er Sharons und Lydias Hand – und verbrannte sich die Finger an ihrer glühend heißen Haut.
Vangélis' Arm zuckte so heftig unter der Bettdecke, dass er davon aufwachte. Ruckartig richtete er sich auf.
»Vangéli?«, murmelte Sharon verschlafen. Die Bettdecke auf ihrer Seite raschelte. Ihre Fingerspitzen tasteten über seinen Rücken. »Vangéli?«
Er ließ den Kopf auf die Brust sinken und verschränkte die Hände im Nacken. »Nichts.«
»Hast du wieder geträumt?«
Er atmete tief durch die Nase aus. »Schlaf weiter, Sharon.«
Zögernd zog sie ihre Hand zurück.
Vangélis ließ sich langsam zurücksinken, bis sein Hinterkopf in die Daunenfüllung seines Kopfkissens eintauchte, und starrte ins Dunkle. Wird es aufhören?
WIRD ES JEMALS AUFHÖREN?!
Zwei Zimmer weiter schlug Lydia die Augen auf, tastete auf dem Nachttisch nach dem Schalter ihrer Lavalampe und knipste sie an. Sie erinnerte sich, dass sie gestern Abend ihre Tür abgeschlossen hatte, um beim Lesen des Korans nicht von ihren Eltern überrascht zu werden, und griff nach dem Buch. Es lag neben der Lampe, in der sich das bernsteinfarbene Wachs in wenigen Minuten erwärmen und als wabernde Blasen langsam in dem von innen beleuchteten Glaszylinder aufsteigen würde. Doch sie hatte nur Augen für den Koran, dessen dunkelblauer Buchdeckel mit goldfarbenen Ornamenten verziert war und den Titel trug: Der edle Qur‘an und die Übersetzung seiner Bedeutung in die deutsche Sprache.
Lydia klappte das Buch an der Stelle auf, in die sie ein Flugblatt hineingelegt hatte, das sie als Lesezeichen benutzte.
Der edle Koran auf Deutsch
LIES!
IM NAMEN DEINES HERRN,
DER DICH ERSCHAFFEN HAT.
Jetzt KOSTENLOS erhältlich
Drei junge Männer, die an der Straße vor ihrer Schule standen und sich vorsichtshalber nach allen Seiten umsahen, hatten das Werbeblatt vor einiger Zeit verteilt. Sie hatten es ihr und einigen anderen Schülerinnen zusammen mit dem Buch in die Hand gedrückt und sie dabei mit strahlend weißen Zähnen angelächelt. Dann hatten die Männer eilig ihren Weg fortgesetzt.
Inzwischen war sie bei Sure 33, Vers 59:
O Prophet, sag deinen Gattinnen und deinen Töchtern und den Frauen der Gläubigen, sie sollen etwas von ihrem Überwurf über sich herunterziehen. Das bewirkt eher, dass sie erkannt und dass sie nicht belästigt werden.
Für ihre beste Freundin Afifa war es selbstverständlich, den pakistanischen Dupatta als Kopftuch zu tragen, wenn sie die Wohnung verließ. Und auch Afifas Mutter hatte sie noch nie ohne den langen, breiten Schal, der sich mit wenigen Bewegungen über die Haare ziehen ließ, auf der Straße gesehen.
Wie nervig sie die blöden Sprüche fand, die manche Mädchen und einige Jungen aus ihrer Klasse manchmal über Afifas Kopfbedeckung machten. Während die Bitches ihr unterstellten, das Kopftuch beweise ihre Unterdrückung als Frau und sie sei bestimmt schon zwangsverheiratet worden, höhnten die Alpha Kevins, sie sei sicher noch Jungfrau mit buschigem Schamhaar und Spinnweben zwischen den Beinen.
Wenn jemand sie so beleidigen würde, würde sie ihn mit den schlimmsten griechischen Flüchen überziehen, die sie von ihrem Vater aufgeschnappt hatte, wenn er sich ärgerte. Und wenn das nicht half, würde sie demjenigen, der es wagte, sie so zu demütigen, auch noch vor die Füße spucken.
Afifa, die von ihren Mitschülern oft einfach nur Opfer genannt wurde, reagierte ganz anders auf die Mobbing-Attacken – sie blieb immer cool und ertrug jede Gemeinheit. Es schien, als hätte sie für alles Verständnis. Und sie war nie nachtragend.
»Warum lässt du dir das gefallen und wehrst dich nicht, bist du eine Heilige, oder was?«, hatte sie Afifa eines Tages in der Pause auf dem Schulhof angeblafft – und war ziemlich schockiert gewesen über die Antwort.
»Es ist Allahs Wille. Ich glaube, er will mich prüfen. Und ich möchte diese Prüfung bestehen«, hatte Afifa ganz ruhig, aber mit fester Stimme erwidert. Dann hatte Afifa sie gefragt, was ihr wichtig ist im Leben. Lydia erinnerte sich, dass es ihr gar nicht so einfach gefallen war, diese Frage zu beantworten. Nach längerem Nachdenken hatte sie sich schließlich festgelegt. »Dass meine Eltern sich nicht scheiden lassen, dass wir beide beste Freundinnen bleiben und dass ich das Abi schaffe.«
Afifa hatte gelächelt und gesagt, da sei sie ganz sicher. Dann hatte sie ihr erklärt, dass es vier Geheimnisse für ein glückliches Leben gebe. »Iman, Shukr, Ikhlas und Sabr – Glaube, Dankbarkeit, Aufrichtigkeit und Geduld. Leicht zu behalten, wenn man sich die Anfangsbuchstaben merkt – ISIS. Das Wort stammt aus dem Altgriechischen, glaube ich. So hieß die ägyptische Hauptgöttin, die Frau von Osiris.«
Afifas Antwort hatte sie erst recht neugierig auf das Mädchen gemacht, das zu den besten Schülern gehörte, nie Alkohol trank, nicht rauchte, jede Party in Begleitung eines älteren Bruders als erste verließ und im Gegensatz zu vielen anderen sechzehnjährigen Mädchen trotzdem zufrieden mit sich und ihrem Leben wirkte. Inzwischen waren sie beste Freundinnen und sahen sich fast täglich.
Für das DFB-Finale im Olympiastadion am heutigen Samstag hatten Afifas Vater und ihre beiden Brüder sich Karten besorgt. Eigentlich interessierten die drei sich mehr für die pakistanischen Nationalsportarten Cricket und Hockey. Aber die letzten Weltmeistertitel ihres Heimatlandes lagen lange zurück. Im Fußball spielte Pakistan international überhaupt keine Rolle. In ihrer neuen Heimat Deutschland hingegen, dem viermaligen Weltmeister, war es die mit Abstand populärste aller Sportarten. Wer sich in Berlin mit den heimischen Top-Mannschaften und auch sonst mit der Bundesliga, dem DFB-Pokal und der Champions League nicht auskannte, konnte nicht mitreden und blieb als Mann in vielen Gesprächssituationen außen vor. Und das wollten Vater Boosheri und seine beiden Söhne Faisan und Masood auf keinen Fall. Auch wenn sie ihre Kultur und ihre Religion in ihrem Herzen trugen und niemals aufgeben würden, wollten sie nicht auffallen. Sie wollten dazugehören – oder taten wenigstens so.
Es klopfte an ihrer Tür. »Lydia?« Erneutes Klopfen.
»Lydia, bist du wach?«
Lydia ließ den Koran blitzartig unter ihrer Bettdecke verschwinden und antwortete: »Hi Mom, ja, bin wach.«
»Frühstück?«
»Komme gleich.«
»Beeil dich mit dem Tischdecken. Dein Vater hat schon Brötchen geholt. Sie sind noch warm.«
»Okay.«
Als die Schritte ihrer Mutter sich hinter der Tür entfernten, griff sie nach dem Koran unter ihrer Bettdecke, sprang aus dem Bett und öffnete ihren Kleiderschrank, der dem Bett gegenüberstand. Im oberen Fach lag, ordentlich zusammengelegt und herrlich frisch nach Weichspüler duftend, in zwei Stapeln ein halbes Dutzend Kapuzen-Pullis. Sie schob den Koran so tief zwischen die Hoodies, bis nichts mehr von dem Buch zu sehen war, und schloss die Schranktür wieder. Dann warf sie sich ihren flauschigen weißen Bademantel über, schloss so leise wie möglich ihre Tür auf und schlurfte gähnend über den mit Parkett ausgelegten Flur in die Küche, die ihrem Zimmer gegenüber lag.
»Giá sóu, patéra«, begrüßte sie ihren Vater auf Griechisch und drückte ihm einen flüchtigen Kuss auf den Oberarm. Früher hatte sie ihn mit Mbambá angeredet, Papa. Inzwischen benutzte sie lieber das sachlichere »patéra«, Vater, was ihm nicht entgangen war. Er regierte darauf, indem er ihre Begrüßungen statt mit ihrem Vornamen, mit dem neutralen Tochter erwiderte, »kóri.«
»Kaliméra kóri. Der Saft ist gleich fertig.«
Dass sie zusammen frühstückten, kam, wenn überhaupt, nur am Wochenende vor. Wenn Vangélis für den NSW einmal keine aktuelle Bedrohungslage zu analysieren hatte, der Dienstplan für Sharon keinen Notdienst im Tropeninstitut vorsah und Lydia nicht zur Schule musste, waren die Aufgaben im Hause Tsakátos klar verteilt. Vangélis holte Brötchen und presste frischen Saft, Sharon kümmerte sich um auf den Punkt mittelweich gekochte Eier oder servierte ein gut gewürztes Omelett mit Speck, garniert mit kleingeschnittenen Schnittlauchhalmen aus ihrem Mini-Kräutergarten vor dem großen Küchenfenster.
Lydia deckte den Tisch mit allem Drum und Dran. Ihrer Mutter zuliebe, die ihren amerikanischen Geschmack beibehalten hatte, stellte sie Pfannkuchen, Ahornsirup, Beerenmarmelade und Frühstücksflocken hin. Für ihren Vater gehörten zu einem guten Frühstück starker Mokka, griechischer Joghurt, Obst, der kretische Gerstenzwieback Paximádi, Olivenöl, Schafskäse, Tomaten und schwarze Oliven aus Kalamáta. Sie selbst mochte am liebsten aus Orangen, Äpfeln und Weintrauben gemischten Saft, helle, knackige Brötchen, hauchdünn geschnittene Scheiben Puten- oder Hähnchenbrust, Butterkäse, Kräuterquark und Erdbeermarmelade mit kleinen Fruchtstückchen.
»Wollen wir uns heute Nachmittag die Körperwelten-Ausstellung am Fernsehturm ansehen?«, schlug Vangélis vor, als sie zusammen am Tisch saßen.
»Für mich ist das nichts«, sagte Sharon. »Ich mag nicht, dass tote Menschen zur Schau gestellt werden. Und dann auch noch nackt. Das ist würdelos.« Sie leckte sich einen Tropfen Honig vom Daumen und sah ihren Mann an. »Findest du das etwa gut?«
»Echt gruselig, Tiere sind auch dabei«, warf Lydia ein und stellte ihr Saftglas ab.
Vangélis runzelte die Stirn. »Es wundert mich, dass gerade du als Ärztin das anatomische Interesse von Medizin-Laien nicht verstehst, Sharon. In einer aufgeklärten Gesellschaft wollen Menschen einfach wissen, wie sie aussehen, auch von innen. Die Ganzkörperpräparate sind authentisch und damit glaubwürdig. Und durch die Plastinierung sind natürliche Posen möglich, gerade damit man nicht ständig daran denken muss, eine echte Leiche vor sich zu haben. Gegen Anatomiekurse für Medizinstudenten, in denen Tote zersägt und aufgeschnitten werden, hast du doch sicher auch nichts einzuwenden, oder?«
»Das ist etwas anderes, das dient der Qualität unserer Ausbildung«, widersprach Sharon. »Aber hier ist die halbe Stadt mit Werbeplakaten für Körperwelten gepflastert, absolut kommerziell das Ganze. Und deshalb bleibe ich dabei – die Leichen werden instrumentalisiert. Unter dem Vorwand aufzuklären werden voyeuristische Neigungen befriedigt. Das finde ich nicht in Ordnung.«
Lydia, die nicht wollte, dass die Diskussion zwischen ihren Eltern sich ausweitete, verkündete: »Ich kann sowieso nicht.«
»Was hast du vor?«, fragte Sharon.
»Afifas Vater und ihre Brüder sind beim Fußball im Olympiastadion. Wir wollen uns einen ruhigen Mädels-Filmnachmittag mit Super-Streaming machen.«
»Ich tippe auf Folge neunhundertneunundneunzig von The walking dead«, sagte Sharon und verzog verständnislos den Mund.
»Walking dead?« Vangélis guckte fragend seine Frau und seine Tochter an. »Für mich klingt das nach Zombie-Horror-Müll.«
»Ist es auch«, sagte Sharon. »Aber irgendwie stehen fast alle jungen Leute darauf.«
Vangélis verdrehte die Augen, legte seinen Kopf schief, hob beide Hände, krümmte seine Finger zu Krallen und rief mit kehliger Stimme »Uuuaaarrrggghhh!«
Lydia rang sich ein gequältes Lächeln ab und stand auf. Was sie ihren Eltern verschwieg, war, dass sie und Afifa sich seit einiger Zeit in Wahrheit nur für eine Serie brennend interessierten und jeder neuen Folge entgegenfieberten: Die iranische Produktion mit englischen Untertiteln handelte von der Geschichte eines Propheten aus dem Koran und von islamischen Traditionen im alten Ägypten. Sie war höchst umstritten und wurde in einigen muslimischen Ländern wegen des strengen Bilderverbots, das für Tiere und Menschen und erst recht für Heilige galt, zensiert. Was die Serie thematisierte, war für fundamentalistische Muslime haram, verboten.
Afifas ältester Bruder Masood, der den Koran und andere religiöse Schriften des Islam besonders streng auslegte, würde toben und sie verfluchen, wenn er wüsste, dass seine Schwester und ihre beste Freundin heimlich diese Serie guckten und für den gutaussehenden Hauptdarsteller schwärmten.
In Afghanistan, wo die Taliban vor fast zwanzig Jahren die riesigen, in Felswänden stehenden Buddha-Statuen von Bamiyan gesprengt hatten, wären die beiden Mädchen für diese Sünde gesteinigt oder erschossen worden. Und im Irak und in Syrien hätten schwarz gekleidete Kämpfer des IS ihnen, ohne zu zögern, die Köpfe abgeschnitten. Als abschreckendes Beispiel, welches Schicksal alle Ungläubigen erwartete.
*
Die Provinz Idlib war das letzte Rebellengebiet in Syrien. Hügelketten, bis zu achthundert Meter hohe Gipfel und einige dünn besiedelte, verkrustete und verkarstete Plateaus prägten das karge Kalksteinmassiv im Norden des Landes. Wenige Kilometer von der türkischen Grenze entfernt lag das Dorf Barisha im Gebiet der Toten Städte, wie die Einheimischen die Ruinen der Siedlungen aus spätrömischer und frühbyzantinischer Zeit nannten.
Die Einwohner Barishas lebten seit Generationen vom Handel mit Oliven, Olivenöl und Trauben, in den Wintermonaten bauten sie Weizen und Gerste an. Da es in ihrem Gebiet trotz reichlicher Niederschläge im Winter keine Flüsse gab, hatten die Menschen seit der Antike Grundwasserbrunnen angelegt. Auch Höhlen in den karstigen Felsen, die nur an den runden Schöpföffnungen im Boden zu erkennen waren, dienten ihnen als Wasserspeicher.
Die älteste der aus dem massiven Kalksteinuntergrund gehauenen Zisternen war mit einem halbrunden, drei Meter hohen oberirdischem Gewölbe überdacht. Sie befand sich im Garten eines Bauernhofes am Rande Barishas, der von einer mannshohen Steinmauer umgeben war. Die Mauer schirmte das Haupthaus, die zwei Nebengebäude und die Zisterne gegen neugierige Blicke ab. Hinunter zum Boden des Brunnens, acht Meter unter der Erde, führte eine aus Monolithen gehauene Steintreppe entlang der Wand. Die Treppe mündete in eine vier Meter breite und sechseinhalb Meter lange Naturhöhle, in der ein erwachsener Mensch fast aufrecht stehen konnte. Das Wasser in dem unterirdischen Speicher stand kniehoch und war trinkbar, wenn man es filterte oder abkochte.
Dass irakische Schmuggler ihn quer durch die syrische Wüste in Pickups bis hierhergebracht hatten, dazu einige seiner Frauen und Kinder, zwei seiner Brüder mit ihren Frauen, eine Handvoll Vertrauter und ein gutes Dutzend Leibwächter, stellte eigentlich einen Bruch seiner strengen Sicherheitsregeln dar. Wer sich ihm nähern wollte, dem wurde zuvor das Mobiltelefon abgenommen. Botschaften wurden nur über Zettel oder mündlich weitergegeben.
Seit einem gezielten Luftangriff auf Al-Rakka, bei dem es ihn fast erwischt hätte, traute er nur noch wenigen Menschen. Aber blieb ihm eine Wahl? Die verfluchten Amerikaner hatten fünfundzwanzig Millionen Dollar für Hinweise ausgesetzt, die zu seiner Ergreifung führten. Genau so viel wie damals auf den Kopf des Al-Kaida-Führers Osama Bin Laden, seinem größten Konkurrenten um die Macht. Bin Laden hatten die pakistanischen Behörden zuerst jahrelang Unterschlupf im pakistanischen Abottabad gewährt. Doch dann hatten sie der vom vorherigen Präsidenten geführten US-Administration entscheidende Hinweise geliefert. Politische Versprechen und wirtschaftliche Zugeständnisse an Pakistan gegen Verrat am meistgesuchten Terroristen der Welt – das war der Deal.
Er strich sich über den wuchernden, ergrauten Vollbart und schnaubte verächtlich. Hier im Hoheitsgebiet der früheren Al-Nusra-Front, die bis vor drei Jahren mit Al-Kaida kooperiert, sich dann verselbstständigt hatte und seitdem den IS bekämpfte, würden seine Jäger ihn niemals vermuten. Dafür hatte er zu oft Killerkommandos beauftragt, die Al-Nusra-Anführer zu töten, damit ihre Kämpfer sich ihm und dem IS unterwarfen. Allerdings bestand das Risiko, dass das sehr hohe Kopfgeld einen der Schmuggler verführte, sein Versteck zu verraten.
Humpelnd, weil die schlecht verheilten Hüft- und Beinverletzungen seit der Schlacht um ihre frühere Hochburg Al-Rakka immer noch höllisch schmerzten, trat er vor die Tür des Haupthauses und rief einen der mit Maschinenpistole und Messer bewaffneten Männer zu sich, die vor den Gebäuden patrouillierten. »Wache, wann wollen die Iraker, die uns hierhergebracht haben, ihren Weg fortsetzen?«
Die Wache verbeugte sich tief. »Sie wollen im Morgengrauen weiterfahren, Kalif.«
Er spitzte die Lippen. Dann winkte er den Mann dicht zu sich heran und flüsterte ihm eine Anweisung ins Ohr.
Kurz nach Mitternacht kamen die Wachen des Kalifen schwer atmend aus einem der Nebengebäude. Sie trugen fünf Männer mit aufgeschlitzten Kehlen an Händen und Füßen bis zum ersten der Pickups, warfen die schlaffen Körper auf die Ladefläche, öffneten das massive Haupttor des Bauernhofes und brausten davon. Sie würden die Leichen der irakischen Schmuggler in einen der vielen trocken gefallenen Brunnenschächte am Rande des schlafenden Dorfes werfen. Niemand würde sie je finden.
»Die Menschenrechtsverletzungen von heute sind die Massaker von morgen.«
(Kofi Annan war von 1997 bis 2006 UN-Generalsekretär und nahm für die Vereinten Nationen den Friedensnobelpreis entgegen. 2018 wurde er in Ghana mit einem Staatsbegräbnis beigesetzt.)
3. Kapitel
3. September 2019, Maputo, Mosambik
In einem kleinen, rechteckigen Park inmitten der verkehrsreichen Hauptstadt erschallte Kinderlärm. Ein gutes Dutzend Jungen und Mädchen vergnügte sich ausgelassen an dem einzigen Spielgerät, einem Klettergerüst. Ihre Eltern saßen angesichts fehlender Bänke auf Steinstufen und erfrischten sich mit Saft und Limonade aus einer hölzernen Getränkebude. Ins Gespräch vertiefte Alte schlenderten bedächtig in ausgeleierten Sandalen und schief gelaufenen Badelatschen über den sandigen Boden des Jardim Vinte e Oito de Maio.
Am Ende des Platzes, auf dem vereinzelte Schirmakazien und Palisanderbäume Schatten spendeten und an dessen Rändern zwischen wilden Gräsern weiße und blaue Schmucklilien Farbkleckse bildeten, stand ein Toilettenhäuschen. An seiner Außenseite hing eine überdimensionale Fahne: Schwarz, Rot, Gold, Hammer, Zirkel, Ährenkranz – die Staatsfahne der Deutschen Demokratischen Republik.
»Es leben die Madgermanes«, schallte es auf Deutsch vielstimmig über den Platz. Knapp dreißig mosambikanische Männer und einige Frauen hatten einen Halbkreis gebildet und reckten die Fäuste. Zwei von ihnen hielten demonstrativ eine zweite DDR-Fahne hoch.
Die anderen Besucher des Parks schien das nicht weiter zu kümmern. Sie hatten sich an das Ritual ihrer Landsleute gewöhnt und ihnen den Spottnamen Madgermanes verpasst, verrückte Deutsche, die in diesem Park einmal in der Woche zusammenkamen und demonstrierten. In dem jahrzehntelang von Krieg beherrschten, von tiefer Armut und Korruption gezeichneten Land erschien das Vorhaben der Madgermanes vollkommen abwegig. Denn die ehemaligen Vertragsarbeiter, wie die Ende der siebziger Jahre angeworbenen Arbeitskräfte damals genannt wurden, verlangten seit ihrer Rückkehr von ihrer Regierung Lohnauszahlungen in Millionenhöhe – dabei galt Mosambik trotz mehrerer Schuldenschnitte seit Jahren als zahlungsunfähig.
Die Aufmerksamkeit von zwei Personen hatten die Madgermanes mit ihren Protestrufen aber auf sich gezogen. Ein junges Paar, bekleidet mit Outdoor-Hosen und Tropenhemden, mit Schirmkappen und Sonnenbrillen, um sich gegen die auch im Herbst noch kräftige Sonne zu schützen, schwenkte mit Trekking-Rucksäcken auf dem Rücken von der Straße in den Park ein. Neugierig geworden gingen die beiden auf die Gruppe zu.
»Hallo, wir sind aus Berlin und wollen uns den Nationalpark Limpopo ansehen. Das ist mein Verlobter Johannes, ich heiße Laura«, stellte die junge Frau sie vor und lächelte einen Mann an, der ganz vorn in der Gruppe stand. »Wir sind etwas überrascht, Sie haben gerade etwas auf Deutsch gerufen, oder?«
»Da habt ihr richtig gehört«, sagte der Mann und machte einen Schritt auf sie zu. »Wir alle hier sprechen deutsch.«
»Und warum protestieren Sie mit DDR-Fahnen?«, fragte der junge Deutsche mit einer Stimme, die zwischen Interesse und Skepsis schwankte.
»Weil wir viele Jahre in Ostdeutschland gearbeitet haben und man uns um viel Geld betrogen hat«, erwiderte der Mann. »Habt ihr davon noch nie gehört?«
Die jungen Leute sahen sich irritiert an. Der Mann machte den Eindruck, als wollte er ihnen diese Geschichte unbedingt erzählen, und sie ließen ihn.
»1979 unterzeichneten Erich Honecker und für Mosambik Samora Machel ein Abkommen über die Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger in Betrieben im sozialistischen Bruderland. Die DDR brauchte Arbeitskräfte im Bergbau, in der Industrie und in der Landwirtschaft. Bis 1990 waren in Ostdeutschland ungefähr zwanzigtausend von uns in fast zweihundertfünfzig Betrieben beschäftigt. Ein Teil unseres Lohns und der Sozialversicherungsbeiträge sollte angeblich nach Maputo überwiesen werden. Aber weil die DDR unser Land seit der Befreiung vom portugiesischen Kolonialismus wirtschaftlich und militärisch unterstützte, hatte unsere Regierung große Schulden, die sie nicht zurückzahlen konnte. Also wurden unsere Beträge von der DDR-Führung ohne unser Wissen einfach einbehalten, um zum Schuldenabbau beizutragen. Geld von uns allen hier.«
Das Berliner Paar sah in die Runde und schwieg betreten.
»Ich bin vierundfünfzig Jahre alt und muss immer noch bei meiner Mutter leben«, setzte der Mann seine Schilderung fort und senkte den Kopf, als schämte er sich dafür. »Jeder von uns hatte sich aus Ostdeutschland etwas mitgebracht. Manche einen Fernseher und einen Videorekorder, andere einen Kühlschrank und Töpfe, ich selbst ein Motorrad. Jetzt ist aber nichts mehr da. Wir mussten alles verkaufen.«
Plötzlich ergriff ein ehemaliger Kollege hinter ihm das Wort und berichtete innerlich aufgewühlt, wie hoffnungsvoll sie damals die Interflug-Maschine nach Berlin-Schönefeld bestiegen hatten – jung und stark, aber mit wenig Schulbildung, arbeitslos und arm. Seine Stimme klang nicht einmal mehr wütend. Nur resigniert.
Ein Gefühl, das ein weiterer ehemaliger Vertragsarbeiter teilte. Der Mann war verheiratet mit einer deutschen Frau und hatte mit ihr drei Kinder. Zweieinhalb Jahre hatte er die Maschinen geölt und die Qualität der Raspeln im volkseigenen Betrieb Feilenfabrik Wallhausen geprüft. Für seinen Akkord in drei Schichten plus Überstunden zahlte man ihm monatlich 200 Ostmark aus. »Sechzig Prozent des Lohns und ein Teil der Sozialversicherung würden automatisch nach Mosambik auf ein Staatskonto überwiesen, hat man uns damals versichert«, erzählte der Mann.
Die Folgen der deutschen Wiedervereinigung trafen ihn wie ein Schock. Statt der Aussicht auf ein Leben in Sicherheit und in bescheidenem Wohlstand, teilte man ihm schriftlich mit, dass er in Deutschland nicht mehr erwünscht sei. In besagtem Brief stand außerdem, er müsse entweder Asyl beantragen oder zurück in seine Heimat. Wie ein Bittsteller dazustehen, kam für den damals Dreiundzwanzigjährigen nicht in Frage. Also versuchten er und seine Frau ihr Glück zunächst in der mosambikanischen Provinzstadt Beira. Erfolglos. Dann pendelten sie mehrmals zwischen Mosambik und Deutschland. Doch Arbeit gab es für sie weder in seiner Heimat, noch in der seiner Frau. Genauso schlimm empfanden sie, dass sie in beiden Ländern auch noch mit Ressentiments und Rassismus konfrontiert wurden. Selbst ihre besten Freundinnen wollten nicht akzeptieren, dass sie einen Mosambikaner geheiratet hatte, berichtete die Ehefrau.
Dann sprach ihr Mann weiter. »In Beira gab man mir zu verstehen, dass die Madgermanes als Kriminelle enden würden und unerwünscht sind. Und dass ich zu ihnen gehörte, war wegen der Hautfarbe meiner Frau natürlich sofort zu erkennen.«
Aus der Menschenmenge heraus erklang eine laute Stimme. »Die Vertragsarbeiter aus Kuba, Angola und Vietnam haben doch auch ihr Geld erhalten. Nur wir nicht. Unsere Regierung hat uns betrogen! Und die deutsche Regierung lässt uns im Stich, obwohl die Bundesrepublik der Rechtsnachfolger der DDR ist. Dabei wollen wir nur, was uns zusteht.«
»Können Sie uns nicht helfen?«, ergriff der Mann mit der deutschen Frau wieder das Wort. »Sie sind doch aus Deutschland.«
»Ich wüsste nicht wie«, sagte die junge Berlinerin mitfühlend. »Wir haben weder viel Geld, noch Verbindungen in die Politik. Mein Verlobter studiert Biologie mit dem Schwerpunkt Geobotanik, und ich Völkerkunde. Wir sind hier, weil in Mosambik fast achtzig Volksgruppen leben, die vierzig verschiedene Sprachen sprechen. Und weil es einige Pflanzen gibt, die nur hier wachsen.«
»Und deshalb wollt ihr euch das Limpopo-Naturreservat ansehen?«, fragte der Mann nach.
»Genau. Es soll ungefähr fünf Autostunden von Maputo entfernt sein. Kommt das ungefähr hin?«
»Nur wenn es nicht regnet.« Ihr Gesprächspartner grinste sie verschmitzt an. »Angst vor Landminen oder Raubüberfällen habt ihr nicht?«
»Nee, wir wollen ja nicht selbst fahren, sondern mit einem Kleinbus. Das soll am billigsten sein«, antwortete der Student und zog seine Schirmkappe zurecht.
»Dann dauert die Fahrt aber länger als fünf Stunden, vielleicht müsst ihr sogar irgendwo übernachten.« Der Mann sah seine Frau an. »Kommt doch mit uns. Wir fahren mit dem Zug. Ich bewirtschafte eine kleine Plantage in meinem Heimatdorf. Das liegt direkt am Limpopo-Fluss. Den müsst ihr nur überqueren, dann seid ihr praktisch schon im Nationalpark.«
Die Studentin lächelte breit. »Das klingt doch gut. Was meinst du Johannes?«
Weil ihr Verlobter mit der Antwort zögerte, schaltete sich die deutsche Frau ihres Gesprächspartners ein und klopfte ihrem Mann leicht auf die Schulter. »Sie können sich auf ihn verlassen. Wenn mein Mann eines in der DDR gelernt hat, dann deutsche Ordnung, Disziplin und Pünktlichkeit.«
»Und Geduld«, warf der Mann ein. »Sonst hätte ich mich bei den Stürmen und Überschwemmungen, die unser Land regelmäßig heimsuchen, nie darauf eingelassen, eine Plantage aufzubauen.«
»Was bauen Sie denn an?«, fragte der Student. »Tabak, Zuckerrohr, Tee, Baumwolle oder Cashew- Nüsse?«
»Nein, nein, das machen die anderen Bauern schon. Ich wollte etwas, das viel schneller wächst und Geld einbringt. Ich baue Wunderbaum an, der bei euch in Deutschland auch Läusebaum oder Christuspalme genannt wird. Er blüht gerade.«
»Wunderbaum, Wunderbaum«, murmelte der Student und überlegte kurz. Dann erinnerte er sich an eine länger zurückliegende Vorlesung und verkündete: »Ricinus communis, gehört zur Familie der Wolfsmilchgewächse und war letztes Jahr bei uns in Deutschland ...«
»... die vom botanischen Sondergarten in Hamburg-Wandsbek gekürte Giftpflanze des Jahres. Ein Sieger, der wohl alle überrascht hat«, warf der Mosambikaner ein und lachte auf.
»Habe ich gar nicht mitbekommen«, sagte die Studentin und sah fragend ihren Freund an. »Hat Ricinus communis was mit Rizinusöl zu tun, das ist doch ein Abführmittel, oder?«
»Wenn Sie Probleme haben, können Sie die Wirkung des Rizinusöls bei uns gern ausprobieren«, schlug die Frau vor und kicherte. »Wir pressen die Castorbohnen selbst. Sie werden kalt gepresst und mit Wasserdampf behandelt. Das Öl verkaufen wir anschließend an einem Großhändler hier in Maputo.«