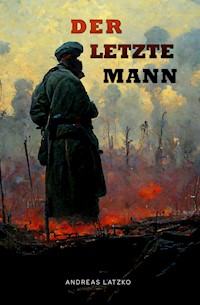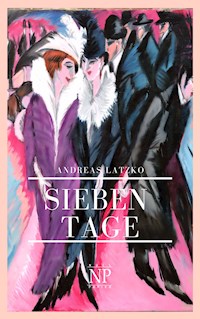
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Null Papier VerlagHörbuch-Herausgeber: LILYLA Hörbuch-Editionen
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein wiederentdeckter Krimi aus dem Deutschland der Zwischenkriegszeit. Wichtiger noch (fast) als die Handlung ist die Schilderung der politischen und gesellschaftlichen Zustände eines Landes in Auflösung. Weihnachten – Arm trifft auf Reich; der Arbeiter Karl Abt auf den reichen Unternehmer Baron Mangien. Abt weiß um den Ehebruch des Barons, er will diesen erpressen: Nur einmal für drei Tage will Abt den Luxus genießen, der sonst Mangien vorbehalten ist; einmal will er es sich gut gehen lassen, einmal den beschwerlichen Alltag abschütteln. Doch am Ende kommt alles anders. Denn Abt will nicht nur einen kurzen Rollentausch. Die "Goldenen Zwanziger" sind in Latzkos Geschichte nur ein Märchen, denn schon früh sah der Autor den Nationalsozialismus am Horizont aufziehen ("Es lastet ein Fluch auf Deutschland, dass immer wieder ein neuer Mann es ,glänzenden Zeiten entgegenführt'"). Das Buch steht damit in bester Tradition von Falladas "Kleiner Mann, was nun?" und Kästners "Fabian". Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 316
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Latzko
Sieben Tage
Roman
Andreas Latzko
Sieben Tage
Roman
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] 2. Auflage, ISBN 978-3-962815-43-1
null-papier.de/neu
Inhaltsverzeichnis
Erstes Buch – Das Geld
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
Zweites Buch – Die Hand
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Drittes Buch – Der Kopf
I.
II.
III.
IV.
V.
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Erstes Buch
Das Geld
I.
Die ersten Schatten des Weihnachtsabends fielen in das verrauchte Grau der Bahnhofshalle, als der längst fällige Hamburger Schnellzug endlich in Berlin einfuhr. Er schüttete eine ungewöhnlich dichte Masse von Reisenden auf den Bahnsteig, Kaufleute, die in letzter Stunde vor dem Fest ihren Familien zustrebten, und einige hundert Urlauber der Marine, die zum Anhalter Bahnhof hinüber mussten und, in Sorge um den gefährdeten Anschluss, rücksichtslos durch das Gedränge ruderten. Baron Mangien ließ die Menge an sich vorbeihasten, belustigt von dem übermütigen Treiben der Matrosen, das so angenehm von der irritierenden Biederkeit der zahlreichen Familienväter abstach. Er vertrug den selbstverliehenen Glorienschein, das Sichwichtignehmen dieser Brotverdiener nicht.
Im Grunde aber wusste er sehr wohl, warum ihm diese armen Teufel so arg auf die Nerven gingen. Sie erinnerten ihn an die Szene bei seiner Abreise, an den einzigen vorwurfsvollen Satz, den sich seine Frau, ganz gegen ihre Gewohnheit, diesmal hatte entreißen lassen. Natürlich war sie im Recht. Ohne Zweifel verbrachte jeder Durchschnittsmann den Heiligen Abend im Kreise seiner Familie. Aber wie töricht war es, hieraus die Folgerung abzuleiten, der Generaldirektor und Hauptaktionär der Mangien-Werke müsste sich erst recht freimachen können. Lag es nicht im Gegenteil auf der Hand, dass die erhöhte Verantwortlichkeit Beschränkungen notwendig machte? Man konnte nicht einer Fabrik vorstehen, die viertausend Arbeiter beschäftigte, und das Familienglück eines Wirkwarenreisenden beanspruchen!
Der peinliche Augenblick des Abschiednehmens, da er wie ein verlogener Schuljunge vor seiner Frau gestanden, hatte einen bitteren Nachgeschmack zurückgelassen. Um ihn loszuwerden, redete der Baron sich ein, er sei nur aus Trotz abgereist. Ein einziges, zärtliches Wort hätte genügt, ihn zum Bleiben zu bewegen. Er ertappte sich bei diesem Selbstbetrug, als er auf den glitschigen, nebelfeuchten Platz vor dem Bahnhof hinaustrat und die Berliner Lichtreklamen in die Dämmerung rieseln sah. Beim ersten Schritt in das Häusermeer fielen alle Bedenken und Verstimmungen von ihm ab. Er dachte an das leidenschaftliche Drängen seiner Geliebten am Telefon – warum hätte er die Flehende, die sich mit Worten schon die Kleider vom Leibe riss, abweisen sollen seiner Frau zuliebe, die es unter ihrer Würde fand, den Kampf aufzunehmen um ihren Mann. Nach bald zwölfjähriger Ehe tat es zwölffach wohl, noch immer umworben und begehrt zu werden.
Eben wollte er ungeduldig die Nummer seines Gepäckträgers rufen, da sah er ihn auch schon heranhumpeln, schwer beladen, schäumend gegen die »Blauen Jungens«, die keinen Menschen an ein Auto heranließen. In der Tat jagte eben das letzte Taxi, johlende Matrosen auf dem Trittbrett und selbst auf dem Gepäcksgitter hinten, mit Vollgas davon, und der Baron musste froh sein, dass er gerade noch eine elende Pferdedroschke für sich requirieren konnte.
Als der vorsintflutliche Karren klappernd losfuhr, vergaß Mangien Zorn und Ungeduld und bedauerte nur, dass kein Zeitungsfotograf bei der Hand war, den Berliner Einzug des größten Automobilfabrikanten Deutschlands in einer Pferdedroschke zu verewigen. Aber diese humoristische Seite hörte bald auf, ihn zu unterhalten, da kein vorbeiflitzender Chauffeur auf sein Winken und Rufen achtete und das Abströmen der Menge aus dem Stadtzentrum die Schneckenfahrt an jeder Straßenkreuzung stoppte. Wie ein unerschöpfliches Reservoir entleerte sich das Geschäftsviertel, beutebepackt stürmten die Horden der Plünderer aus der lodernden Stadt.
Im offenen Wagen, den rußigen, feuchtwehenden Nebel auf den Lippen, umtobt und überholt von allen Seiten, verlor der Baron den letzten Rest seiner Geduld, als in dem Hexenkessel vor dem Brandenburger Tor sein Wagen wie ein ängstlicher Fußgänger steckenblieb und der alte Kutscher zweimal die Gelegenheit zum überqueren versäumte.
Mehr noch als der Zeitverlust ärgerte ihn jedoch seine eigene Gereiztheit. Er musste an sich halten, um nicht aus dem Wagen zu springen, so laut donnerte ihm aus dem betäubenden Lärm der zehntausendfach widerhallende Vorwurf seiner Frau in die Ohren. Jeder einzelne Menschentropfen in dem vorbeijagenden Strom hatte das gleiche Ziel, jeder eilte heim, nur er saß abseits in der altmodischen Droschke, herausgehoben, angeprangert sozusagen als der eine, der von Frau und Kindern fort zu der Geliebten fuhr.
Sein Zorn machte sich in lautem Unmut Luft und wäre vielleicht in Tätlichkeiten gegen den Kutscher ausgeartet, ohne den weißen Handschuh des Verkehrsschutzmannes, der eben zum dritten Mal die Durchfahrt freigab. Ob nun der alte Mann auf dem Bock seine beleidigte Berufsehre herstellen oder nur seine Wut an dem wehrlosen Tier auslassen wollte: das arme Pferd, unsanft aus seinem knieweichen Dösen gerissen, glitschte aus und stürzte auf die Deichsel, die zerbrach.
Nach der Bummelei auf der Bahn auch noch ein Unfall! Das konnte alles verderben, wenn den Herren im Hotel das Warten zu lange wurde! Die angeblich wichtige Konferenz hatte den Vorwand für die Reise geboten, das Alibi durfte nicht versäumt werden. Statt erst lange nach einem Fahrzeug zu fahnden, ersuchte der Baron einen ärmlich gekleideten Mann, ihm das Gepäck zum nahen Hotel zu tragen.
Aber der Mann gebärdete sich wie ein Tollhäusler, sprang vor, um dem Baron aus nächster Nähe unter den Hut zu schauen, stieß mit dem Fuß nach den Handtaschen und schrie: »Ihnen – Ihnen soll ich helfen? Tragen Sie sich Ihren Dreck da selber!«
Mangien konnte sich nicht erinnern, dem Menschen jemals begegnet zu sein. Andere Hände griffen diensteifrig zu und das Gesicht des Wüterichs tauchte unter, ehe der Baron es genauer hätte prüfen können.
Ohne die Verspätung, die ihn zur Eile antrieb, wäre es ihm wohl kaum entgangen, dass sein unbekannter Feind gegenüber dem Hoteleingang hinter einer Litfasssäule hervorspähte, verächtlich schmunzelnd über die Ehrfurchtsbezeugungen des herausstürzenden Personals. Wie eine Koppel losgelassener Hunde sprangen die livrierten Burschen an dem reichen Gast hoch, wetteifernd um die Gunst, seine Aktentasche tragen zu dürfen. Goldbetreßte Mützen flogen von den Köpfen, tiefe Bücklinge begleiteten den großen Mann in die taghell strahlende Halle. Erst als der Türsteher wieder allein war, wagte sich der Fremde aus seinem Versteck hervor, ging zögernd näher und ließ es sich bestätigen, dass der eben angekommene Gast der reiche Baron Mangien aus Hamburg gewesen.
»Hast vielleicht wat ausjefressen in seiner Fabrik?« – erkundigte sich der Türsteher, neugierig wegen der finsteren Blicke und des gehässigen Tons, aber der sonderbare Kauz gab überhaupt keine Antwort, raste davon und blieb erst stehen, als die gestaute Menge an der nächsten Straßenecke ihn aufhielt. Es fehlte wenig, und er wäre noch einmal umgekehrt, sein Blick blieb haften an dem hohen Dach des Hotels. In Gedanken versunken, starrte er es unverwandt an, als könnte er durch Mauern und Wände jede Bewegung des verhassten Gegners beobachten.
Karl Abt – so hieß der armselig gekleidete Mann mit den starken, verbrauchten Proletarierhänden – war ein fleißiger Besucher der Lichtspieltheater, ließ sich aber sein Geld nur aus der Tasche locken, wenn die ausgestellten Bilder elegante Damen und betörend gut gekleidete Lebemänner in den verschiedenen Aufmachungen ihres bewegten Nichtstuerdaseins zeigten. Wie es armen Leuten ging, brauchte er sich nicht auf der Leinwand vorführen zu lassen. Von Schmutz und Not, Vorstadtkneipen und Zinskasernen wusste er ohnehin mehr, als ihm lieb war.
Als Folge dieses gründlichen Studiums hatten sich in dem Gehirn des Fabrikmechanikers Karl Abt unverrückbar feste Vorstellungen von der Lebensführung des reichen Mannes eingenistet. Der Anblick einer elegant gekleideten Wachsfigur, ein seidener Schlafanzug im Schaufenster genügte, um den aus hundert Filmen geschnittenen und zusammengeklebten Bildstreifen, der als Illustration des Begriffes »Wohlleben« in ihm bereit lag, augenblicklich vor seinem inneren Blick abrollen zu lassen.
So blitzte jetzt, von den hellgelben Reisetaschen Mangiens angekurbelt, der Film »Abreise des vornehmen Mannes« an den gehässig funkelnden Augen vorbei. Ein glattrasierter Kammerdiener legte mehrere Anzüge mit seidenem Futter sorgsam in den Koffer. Dann übernahm der Chauffeur die Taschen aus knirschendem Schweinsleder … Hier jedoch riss der Film jäh ab, verdrängt von der überraschenden Frage, was wohl den Freiherrn von Mangien, der in Hamburg Frau und Kinder und ein neuerbautes »fürstliches Heim« besaß, nach Berlin führte – am Heiligen Abend?
War es überhaupt möglich, dass ein Mann, so reich und unabhängig, den Weihnachtsabend nicht im Familienkreise verlebte? Der Türsteher hätte lügen, sich einen Schabernack leisten können, aber das Bild? … Das Bild in der illustrierten Zeitung?
Strich für Strich erweckte Abt die verdunkelte Erinnerung, bis das aufgefrischte Bild jeden Zweifel verjagte. Der schmunzelnde Herr, mit Frau und Kindern auf dem Rasenplatz vor seinem neuen Schloss fotografiert, war bestimmt derselbe Mann, der soeben in dem vornehmsten Hotel Berlins abgestiegen war. Was hatte er aber hier zu suchen, während in Hamburg der Christbaum für seine Kinder angesteckt wurde? Lebte er am Ende nicht in gutem Einvernehmen mit seiner Frau? Das Familienbild in der Zeitung konnte gestellt sein. Auch eine Art Reklame.
So trostreich es für Abt gewesen wäre, den verhassten Mann unglücklich zu wissen – er schüttelte doch gleich diesen Gedanken ab, weil er sich nicht feige mit Wahnbildern besänftigen wollte. Wen Erbitterung von daheim vertrieb, trug den Kopf nicht so hoch wie der Herr Baron, schritt nicht so eingenäht in seine Herrlichkeit an gewöhnlichen Sterblichen vorüber.
Was sonst aber konnte – – –
Geschäfte? – Unsinn! Dem ärmsten Mann war dieser Abend nicht feil.
Ohne recht zu wissen, warum, fühlte Abt sich bis in sein Innerstes aufgewühlt von der Frage. Wie ein Hund, der zitternd Wild wittert, stand er mitten im Menschengewühl, den Blick immer noch an den First des fernen Hotelpalastes gefesselt. Anfangs nur beiseite gestoßen, im Vorbeieilen angeschnauzt, erregte er allmählich Aufsehen. Der Menschenstrom begann sich zu kräuseln und lagerte eine Insel von Neugierigen um das Verkehrshindernis. Man wisperte und hielt ihn wohl für betrunken. Wer sonst pflanzte sich an der Ecke der Linden wie ein Wahrzeichen auf, verrußt und schmutzig, als hätte er es darauf abgesehen, Ärgernis zu erregen in dem festlichen Gedränge.
Mit kräftigen Stößen schaffte er sich Raum, ruderte mit Schultern und Ellenbogen rasch davon, ohne recht zu wissen, wohin. Was wollte er mit seiner Zeit beginnen? Die Einladung Doktor Landaus lautete erst auf halb acht, zum Rasieren und Umkleiden genügten zwanzig Minuten – früher als nötig in seine ungeheizte Bude zurückzukehren, drängte es ihn wahrhaftig nicht, aber die verwünschte Begegnung mit dem Baron hatte ihm das Bummeln gründlich verleidet. Er konnte nun keinen Schritt mehr tun, nirgends stehenbleiben oder hinschauen, ohne an den Herrn Baron erinnert zu werden, der alles, was in den zahllosen Schaufenstern geschichtet lag, kaufen konnte.
Nein, mit diesem Gedanken im Kopfe war es nicht möglich, ruhig durch die Straßen zu schlendern. Allein in einer Kneipe zu sitzen, war aber noch weniger verlockend, und selbst die Aussicht, den ganzen Abend mit Doktor Landau verbringen zu müssen, schreckte Abt nun so sehr, dass er am liebsten gleich telefonisch sich entschuldigt und unter irgendwelchem Vorwand abgesagt hätte, wäre es nicht eine unverzeihliche, ganz niederträchtige Undankbarkeit gewesen, seinen Wohltäter in letzter Stunde im Stiche zu lassen.
Ein Mann von der Bildung des Doktors hätte leicht bessere Unterhaltung finden können als die Gesellschaft eines verbrummten, unwissenden Fabrikarbeiters. Und nun sollte Abt ihn allein lassen?
Nein!
Entschlossen schnellte er in das Gedränge zurück und stieß so rücksichtslos um sich, als hätte es unter all den Eiligen kein anderer so eilig gehabt wie er. Nur fort, fort aus der Nähe der Versuchung! – An jeder Ecke überfiel ihn neu die Angst, er könnte doch noch umkehren und vor dem Hotel den Baron anpöbeln. Auf der Flucht vor sich selbst erreichte er durch finstere Nebengässchen den Schlesischen Bahnhof und presste sich in den ersten ostwärts fahrenden Stadtbahnzug.
Wie eine Kompresse kühlte die Schwärze vor dem Fenster des Abteils seine lichtmüden Augen. Er ruhte aus von Lärm und Eile und wäre auch eingenickt, hätte er nur die lästige, störrisch wiederkehrende Frage verscheuchen können:
»Warum hatte der Baron sein Haus verlassen? Warum verlebte er diesen Abend im Hotel?«
»Warum?«
II.
Der Baron hatte sich an den Herren vorbeistehlen müssen, die ihn längst in der Halle erwarteten; viel dringender als die angeblich wichtige Konferenz war ihm ein Telefongespräch mit Mimi. Er wollte hören, ob alles programmgemäß verlaufen, Gatte und Sohn richtig abgereist und alle Vorsichtsmaßnahmen getroffen waren.
Da fiel der Auftritt am Brandenburger Tor ihm ein. Wäre der Gedanke nicht so unsympathisch, beinahe widerwärtig gewesen, den Freund unter dem eigenen Dach, auf dem eigenen Lager zu betrügen – in der heiligen Christnacht noch dazu – hätte Mangien sich keinen Augenblick mit dem lächerlichen Problem beschäftigt, warum er auf die Sympathie eines unbekannten Proleten verzichten musste. Auch so schüttelte er die Bedenken rasch ab – warum sollte er sich die Freude verderben, da ihn keine Verantwortung traf? Mimi selbst hatte die Zusammenkunft angeregt – auch die »wichtige Konferenz« war ihr Einfall, und die Schuld trug allein Bodo. Warum hatte er seine Frau über Weihnachten allein gelassen? Sonst schleppte er sie auf alle Geschäftsreisen mit, hing so fest an ihren Röcken, dass sie ihm unter tausend Schwierigkeiten die Zeit für jedes hastige Schäferstündchen ablisten musste, und gerade darum hatte sie sich mit solcher Vehemenz auf die unverhoffte Gelegenheit gestürzt, einmal ohne Angst vor dem Uhrzeiger zwei ganze Nächte »frei« zu sein.
Auf dem Schreibtisch lag die Mitteilung der Hoteltelefonistin, es sei zweimal bereits, um siebzehn Uhr zwölf und um siebzehn Uhr sechsundzwanzig nach dem Herrn Baron gefragt worden. Das konnte nur Mimi sein. Sie rechnete nicht mit der Verspätung und zitterte schon, er könnte zuletzt doch nicht losgekommen und daheim geblieben sein.
Es bereitete dem Baron Vergnügen, sie noch ein wenig zappeln zu lassen, während er sich im Badezimmer die Hände wusch und, vom Hausdiener assistiert, rasch die Kleider wechselte. Er wusste nur zu gut, wie tief er hinabstieg, wenn er seine Frau mit dem »Luderchen« hinterging, das die gute Mimi ohne alle Zweifel war.
Aber für zwei heimliche Liebesnächte taugte am besten ein »Luderchen«. Was konnte die arme Mimi letzten Endes dafür, dass ein unwandelbares Naturgesetz die froschblütigsten, langweiligsten Männer vom Schlage Bodo Brenkens gerade zu den temperamentvollsten, abwechslungsbedürftigsten »Luderchen« hinzog? Eine solche Frau heiraten und dann auch noch allein in Berlin zurücklassen, der achtzigjährigen Mutter zuliebe, soviel Einfalt erforderte Sühne.
Das spöttische Schmunzeln Mangiens verschwand beim Eintritt des Boys, der im Auftrag der Herren Justizrat Rilla und Direktor Krüger ins Zimmer sprengte mit der Meldung: es sei gleich sechs, und aus Rücksicht auf den Heiligen Abend unmöglich, den Beginn der Konferenz noch länger hinauszuschieben.
Dass sie ihm nicht davonlaufen würden, auch nicht, wenn er sie bis sieben warten ließe, wusste der Baron genau. Es war durchaus nicht bloßer Zufall, dass er gerade diese beiden Namen aus der Liste seiner Aufsichtsräte herausgesucht hatte: die beiden, das stand unerschütterlich fest, konnte kein Christfest und kein Todesfall abhalten, wenn es ums Geldverdienen ging. Von den untersten sozialen Sprossen, mit Krallen und Zähnen, Bücklingen und Fußtritten emporgelangt, hassten sie jeden, der ohne Plage und Erniedrigung auf die Spitze der Leiter hinaufgeboren war. Ob höflich oder unhöflich, ob er sie warten ließ oder nicht, für diese beiden blieb er immer das verächtliche Vatersöhnchen. Warum sollte er ihnen nicht Zeit lassen, ihre Galle auszuspeien?
Auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin hatte der Baron einen schlauen Kriegsplan ausgeheckt: er wollte seine Ankunft Mimi offiziell bekanntgeben, durch den Diener bei der Hausfrau anfragen lassen, ob er als Tischgast erwünscht sei. So gab er Mimi unauffällig Nachricht und baute allen Verdächtigungen vor – nur die verdammte Pferdedroschke hatte ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht. Für den »Sprung« in den Spielwarenladen war es zu spät geworden, als angesagter Gast musste er Mimis Kinder unbedingt beschenken, er versuchte es mit einem telefonischen Auftrag, und sein Name übte die gewohnte Zauberkraft. Der Inhaber verpfändete dem Herrn Baron sein Wort, für rechtzeitige Zustellung zu sorgen, und wenn er selbst im Taxi mit den Waren in die Villa Brenken fahren müsste!
Der zweite Anruf fiel weniger glücklich aus, statt des Dieners kam gleich Mimi an den Apparat, und der Tonfall ihrer Begrüßung verriet, dass sie nicht allein im Zimmer war.
»Gib acht, was ich sage, Liebling!« – instruierte sie der Baron. – »Ich frage dich jetzt, ob ich morgen bei euch zu Mittag essen darf – nachher sagst du mir, dass Bodo mit dem Jungen nach Brenkenburg gefahren ist und deine Kleine mit Fieber zu Bett liegt.«
Sie führte den Auftrag aus und rief unmittelbar anschließend, als wehrte sie sein Bedauern ab: »Es ist nicht so schlimm, wirklich nicht so schlimm, Baron! Ich gehe mit einem guten Buch zu Bett, den Leuten habe ich das Grammophon geborgt, die werden tanzen und genau so vergnügt sein, als wäre auch die Katze aus dem Hause.«
Mangien lächelte befriedigt. Küche und Dienerschaftsräume lagen im Souterrain, mit den Fenstern nach dem Garten; wurde auch noch getanzt und Musik gemacht, so konnte man vorne aus und ein gehen, wie man wollte – Mimi verstand sich darauf, alle Möglichkeiten zu nützen – der arme Bodo war ihr, weiß Gott, nicht gewachsen.
»Pass auf, Schatz!« – rief er zwinkernd, als könnte sie seinen Gesichtsausdruck sehen – »ich werde jetzt die Stunden zählen, von Mitternacht zurück. Du rufe nur ›Ja‹, damit ich weiß, wann ich kommen soll. Also: Zwölf, elf, zehn – nun? Halb zehn? – Nein, hör mal! Noch früher wäre Leichtsinn! Gegen halb zehn also. Und den Schlüssel wie besprochen, nicht wahr?«
Ein Weilchen blieb er noch vor dem Apparat sitzen, dann griff er seufzend nach der Aktentasche und erteilte Auftrag, die Herren heraufzuführen.
Viel schlimmer, als der Baron vermuten konnte, war seine »Unverfrorenheit«, am Weihnachtsabend eine Besprechung anzusetzen, von den beiden Wartenden kritisiert worden. Besonders Direktor Krüger, Besitzer von Farbwerken, die mit großen Lieferungen an dem Unternehmen Mangiens interessiert waren, zappelte ruhelos zwischen den großen Lederstühlen der Halle umher und sparte nicht mit Kraftausdrücken. In regelmäßigen Zwischenräumen riss er seine goldene Uhr hervor, mit der Drohung, keine Sekunde länger zu warten. Justizrat Rilla zuckte nur die Achseln und lächelte sein saures, eiskaltes Lächeln.
»Gönnen Sie dem Mann doch sein Vergnügen! Welches Hochgefühl, andere antichambrieren zu lassen, wenn man von Vätern abstammt, die sich nächtelang auf dem Bock die Beine abfrieren mussten, während ihre Herren am Kartentisch saßen. Das welsche Kutscherblut meldet sich, voilà.«
»Kutscherblut? – Der Baron Mangien?« – staunte aufstrahlend Direktor Krüger und hörte augenblicklich zu tänzeln auf. »Ist das richtig? – Von Kutschern?«
»Das wissen Sie nicht? Stammvater Mangin, ohne e, mit dem französischen Nasallaut gesprochen, ist auf dem Bock einer gräflichen Kutsche nach Hamburg gekommen, als die Aristokraten von drüben vor der Guillotine davonliefen. Genau wie unsere russischen Emigranten, hatte auch der Marquis oder Vicomte nur mit einem kleinen Ausflug gerechnet, musste aber bald Pferde und Wagen an seinen eigenen Kutscher verkaufen. Für die Hanseaten war eine Fahrt in der goldstrotzenden, weich federnden französischen Karosse eine Sensation, das Geschäft florierte, und der schlaue Franzose verlegte sich auf das Fabrizieren ähnlicher Karossen, auf Halbpart mit einem Hamburger Wagenbauer, den er natürlich hinauswarf, als er ihn nicht mehr nötig hatte. Na und, was Konjunktur heißt, braucht Ihnen ja nicht erklärt zu werden. Fünfzehn Jahre lang hetzte Napoleon seine Offiziere und Minister durch Europa – man wohnte und schlief auf der Landstraße. Als der Wiener Kongress endlich Ordnung geschaffen, reiste der alte Marquis auf Kosten seines Kutschers nach Frankreich, der Kutscher blieb in dem prächtigen Patrizierhaus, das er aus dem Zusammenbruch für sich herausgefischt hatte, und schrieb fortan seinen Namen mit dem deutschen ›ie‹. Mehr noch als sein Reichtum war die Nase wert, die alle Nachkommen von ihm erbten. Der Enkel warf sich auf Waggons und Lokomotiven, wie dann der Vater unseres jetzigen Herrn und Gebieters als erster in Deutschland die Zukunft des Motors gerochen hat. Zwischendurch bescherte der Waggonbedarf des Krieges Anno 70 den französischen Kutscherssöhnen das Freiherrnwappen, und wenn heute der Herr Vicomte oder Marquis von dazumal den Urenkel seines Leibkutschers sprechen wollte, müsste er auch hier unten antichambrieren – ganz wie wir.«
Mit gespitzten Lippen hatte Direktor Krüger die Geschichte der kompromittierenden Abstammung, wie ein ergötzendes Getränk, in sich eingeschlürft. tief beglückt von der Verheißung, den glühend beneideten Baron mit Anspielungen auf Peitschenschäfte und Postillonstiefel meucheln zu können. Er hätte vor Freude beinahe vergessen, sich weiter über das lange Warten aufzuregen, wäre nicht der große Zeiger der elektrischen Uhr immer höher gerückt.
»Sechs Uhr!« – herrschte er wütend den Justizrat an – »wie lange wollen Sie denn eigentlich warten? Wir sind doch nicht seine Lakaien! Fahren wir einfach heim und fertig!«
Dr. Rilla wandte sich verächtlich ab, ohne die Aufforderung einer Antwort zu würdigen. Gerne hätte er sich den Spaß geleistet, auf den Vorschlag Krügers einzugehen, aber der gute Mann dachte ja nicht daran, einen so mächtigen Kommittenten wie Mangien wirklich vor den Kopf zu stoßen. Gewesener Korpsstudent mit dekorativ zersäbeltem Gesicht, hatte der Justizrat früh gelernt, dass alles bezahlt werden musste; die Frage war nur, ob die Ware den Preis wert sei. Es tat ja auch nicht gerade wohl, von den einstigen Korpsbrüdern geschnitten zu werden, weil man die getaufte Tochter des allmächtigen Bankjuden Geheimrat Landau geheiratet hatte und mit dem berüchtigten Stänkerer und Ehrenproleten Dr. Heinrich Landau verschwägert war. Wer aber mit noch nicht vierzig Jahren Syndikus1 des größten Banken- und Industriekonzerns sein wollte, musste diese Unannehmlichkeiten mit in Kauf nehmen.
Den Herrn Direktor brachte diese Gleichgültigkeit immer noch mehr aus dem Häuschen.
»Als Kutscherssohn könnte der Herr Baron wenigstens auf unsere Chauffeure Rücksicht nehmen! Meiner ist verheiratet, es ist nicht kollegial …«
»Schicken Sie Ihren Wagen ruhig fort«, fiel der Justizrat ein, »mein Chauffeur bringt Sie nach Hause.«
»Wie denn das? Sie wohnen doch im Grunewald! Ich kann Ihnen nicht zumuten, jetzt noch …«
Dr. Rilla winkte ungeduldig ab: »Ich muss ohnehin noch in die Stadt, zu meinem Schwager. Sie setzen mich nur am Gendarmenmarkt ab, das kostet Sie keine fünf Minuten, und mir ist es gleich, ob der Wagen mich unten erwartet oder eine Fahrt macht unterdessen.«
Direktor Krüger trat unentschlossen von einem Fuß auf den anderen, seine kleinen Äuglein tanzten neugierig über das steinerne Gesicht Rillas.
»Ihr Schwager? Ist das etwa der Bruder Ihrer Frau Gemahlin? Der Doktor Landau? Soll ein sonderbarer Heiliger sein. So ’ne Art Proletarierheiland. – Wie?« Das von Schmissen geschmückte Gesicht Rillas blieb undurchdringlich. »Mehr sonderbar als heilig«, gab er trocken zur Antwort, nicht geneigt, der boshaften Klatschsucht Krügers mit näheren Einzelheiten zu dienen. Was aus den Zeitungen über die Reden und Taten Dr. Heinrich Landaus bekannt war, genügte vollauf.
Wie ein Foxterrier um einen Igel, tänzelte der dicke, kleine Direktor um die unantastbare Stachligkeit des Justizrates, redlich bemüht, mit taktlosen Anspielungen und geheucheltem Bedauern auf eine durchlässige Stelle in der Panzerung zu stoßen. Aber Rilla verleugnete den Schwager nicht, dieser Schandfleck war in dem Kaufpreis seiner Karriere mit inbegriffen. Der Bruder seiner Frau, Dr. Heinrich Landau, war ein Narr – er befreite Proletarierfrauen von unerwünschtem Kindersegen und hatte den geehrten Namen seines Vaters durch die Gerichtssaalrubrik aller Zeitungen geschleift – was weiter? Das alles war stadtbekannt, Herr Krüger durfte sich den Schnabel daran wetzen. Waldemar Rilla hielt still, wie auf dem Mensurboden, bis der Gegner, von der undurchsichtigen Höflichkeit verlockt, sich zu weit vorwagte:
»Ich finde es merkwürdig, dass Ihr Herr Schwiegervater den unbequemen Sohn nicht längst unschädlich gemacht hat. Nach der Brandrede im Gerichtssaal wäre es einem Manne mit seinen Verbindungen doch ein leichtes gewesen …«
Wie ein guter Fechter im richtigen Moment die Parade durchschlägt, holte der Justizrat nun mit eisiger Ruhe zu einem wohlberechneten »Durchzieher« aus: »Aber, ich bitte Sie«, rief er beinahe herzlich, »was können meinem Schwiegervater solche Torheiten anhaben? Jeder anständige Mensch zieht vor dem Namen Geheimrat Landaus den Hut. Nur schäbiger, gemeiner Neid wird das ungeheure Lebenswerk des Vaters über dem verrückten Treiben des Sohnes vergessen – statt umgekehrt.«
Eine Ohrfeige von solcher nicht alltäglicher Dosierung stillschweigend einzustecken, wäre selbst einem abgehärteten Kämpen wie Direktor Krüger nicht leicht geworden, hätte nicht, wie auf Stichwort, ein Boy die Meldung gebracht, der Herr Baron lasse bitten.
Rechtsbeistand <<<
III.
Justizrat Rilla fand die Wohnungstür seines Schwagers unversperrt, ein Zeichen, dass die »Ordination« noch nicht beendet war. Er hätte es unter Umständen zwar vorgezogen, auf dem kalten Flur zu warten, überzeugte sich aber, dass kein sogenannter Patient im Wartezimmer saß, und pendelte zwischen Türe und Fenster auf und ab, ängstlich besorgt, ja nicht die Stühle zu streifen, die als einzige Möbel ringsum an den Wänden standen. Es empfahl sich, mit den Klienten, die hierorts verkehrten, nicht einmal mittelbar in Berührung zu kommen.
Das Knarren des Fußbodens musste auch im Ordinationszimmer hörbar sein, denn die Türe wurde plötzlich geöffnet und in dem schmalen Spalt erschien das blasse, magere Gesicht Dr. Landaus. Er spähte mit seinen kurzsichtigen Augen in den mangelhaft beleuchteten Raum und rief ohne Gruß: »Sind Sie’s, Abt? Nur fünf Minuten! Ich bin sofort fertig.« Dann verschwand sein länglicher Kahlkopf hinter der zuschnappenden Tür.
Der Justizrat wiegte spöttisch den Kopf. Das war wieder einmal der unverfälschte Heinrich Landau! Sprach zu einem Menschen, der gar nicht im Zimmer war – wie er immer und überall seine Hirngespinste für die Wirklichkeit hielt und die Realität vornehm ignorierte. Diese widerspruchsvolle Existenz, dem erfolgreichen, zielsicheren Leben des Vaters als unwürdige Fortsetzung angehängt, erinnerte den Justizrat an die Theorie, die er einmal irgendwo gelesen hatte: das Judentum sei keine ernste Gefahr für den Gesellschaftskörper, weil es gegen seinen brutalen Raubtierhunger nach Geld zugleich das Antitoxin im Blute trage. Längstens die dritte, vierte Generation – so hieß es – schied erschöpft aus dem Kampf um Macht und Besitz, rasch gesättigt und wehleidig, zufrieden, in irgendeiner brotlosen Kunst friedlich das Leben zu verspielen.
Für den kuriosen Fall Dr. Heinrich Landaus lieferte aber auch diese gewagte Hypothese keine Erklärung, hielt er sich doch für stark genug, an der bestehenden Weltordnung zu rütteln. Alles, was er tat, entbehrte der Folgerichtigkeit – er selbst stand sich überall im Wege. Nicht aus philosophischer Genügsamkeit hauste er wie ein moderner Diogenes zwischen kahlen Wänden. Der einzige Sohn des reichen Bankpräsidenten Landau hatte nie genug Geld, seine bescheidensten Wünsche zu erfüllen, weil er draußen in den Elendsquartieren der Millionenstadt Tag für Tag auf Menschen mit dringenderen Bedürfnissen stieß.
Mit einem Fünkchen gesunden Menschenverstandes hätte er sich die fettesten Stellen verschaffen können, um von einem großen Einkommen ein Heer von Armenärzten sowie Gebärkliniken, Kinderkrippen, Tuberkulosenheime zu unterhalten. Statt so im großen Stile zu helfen, zog er es vor, seine schäbige Wohltätigkeitsgreißlerei notdürftig in Gang zu halten, immer in Geldverlegenheit, immer unterwegs und abgehetzt, nicht einmal befriedigt von den Resultaten seines lächerlichen Kampfes gegen die unerschöpfliche Not der Großstadt. Der Reichtum des Vaters galt ihm nicht für »redlich« verdient, nur sein mütterliches Erbe, vor seiner Geburt auf ihm unbekannte Weise erworben, sollte ihn mit allen seinen Schmarotzern erhalten.
Für Justizrat Rilla bedeutete diese Prinzipientreue großen Gewinn, die Millionen, die sein Schwager ausschlug, flossen seiner Frau und seinen Kindern zu – ein ansehnlicher Profit, den des Schicksals Laune als Geschenk bescherte.
Nur eine Furcht trübte diese reine Freude: der Schwager konnte von heute auf morgen seine Ansichten ändern, plötzlich die entgegengesetzte Meinung vertreten, das »sündige« Vermögen des Vaters müsse durch große Stiftungen in die Hände jener zurückgeleitet werden, die es auch wirklich »erarbeitet« hatten. Wer würde dann solchem Unglück zu steuern vermögen?
Auf den alten Herrn, so stramm er ansonsten die Zügel noch in Händen hielt, war in dieser Frage kein Verlass. Als Vater war er der richtige, sentimentale Jude, bereit zu jedem Opfer, wenn nur sein vielgeliebter Herr Sohn sich herbeiließ, zu ihm zurückzukehren. Ein aufrechter deutscher Vater hätte sein Haus mit der Hetzpeitsche verteidigt gegen den ungeratenen Erben, statt Vermittler zu suchen, die »heimlich« trachten sollten, den verlorenen Sohn heimzubringen. Und gerade das heilige Christfest war als Rahmen gewählt worden für die sentimentale jüdische Familienszene! So zuwider Waldemar Rilla eine solche Gefühlsangelegenheit auch war, seine Frau hatte ihn doch leicht zu der Mission überreden können. Eine wirkliche Gefahr, der strenge Herr Sohn könnte sich erweichen lassen, drohte nicht. Ein Senegalneger und ein Eskimo lebten in weniger verschiedenen Atmosphären als der Herr Geheimrat und der Doktor Landau. Der Alte glitt in seinem Auto wie in einem Tauchboot durch die Stadt, von der Villa zur Bank und von der Bank zur Villa; die Menschenmassen, die er durchquerte, waren ihm nicht mehr als dem Perlenfischer das Meer, in das er mit angehaltenem Atem hinabstößt nach Beute. Wie sollte der Sohn, der das Geld verachtete und die Menschen liebte, in die Gletscherregion des Vaters zurückfinden? Ein derart risikofreies Unternehmen, das nur dem Schwiegerpapa eine Dankesschuld aufhalste, war durchaus nach dem Geschmacke Rillas. Forderungen an den Präsidenten der Deutschen Bodenbank verzinsten sich glänzend. Gemütseinlagen besonders. In der Verrechnung mit Familienangehörigen duldete der alte Herr kein Debetsaldo.
Es geschah also durchaus nicht aus Ungeduld, dass Rilla näher an das Ordinationszimmer heranrückte. Er hatte Zeit, war es nur müde, über den knarrenden Parkettboden zu spazieren, und horchte neugierig an der Tür. Gerade klirrte ein Instrument in die Stille – dann sagte der Doktor einige Worte, wurde unterbrochen von dem weinerlichen, monoton gurgelnden Gemurmel einer Frauenstimme.
Überzeugt, es sei nur Karl Abt im Wartezimmer, widmete sich Doktor Landau mit der gewohnten Gründlichkeit dem ausgemergelten, erschreckend verbrauchten Weib, das halbnackt, wie es vom Untersuchungstisch herabgestiegen war, seine Leiden klagte.
»Ziehen Sie sich erst an! Nachher sprechen wir weiter.«
Dem verzogenen Mund der Frau entfuhr ein Stöhnen, sie warf sich vor und starrte dem Doktor ins Gesicht, von der Angst gepackt, dass er sie nur vertrösten wollte. Nach langem, nutzlosen Wüten gegen den eigenen Leib, von Ärzten und Hebammen wie ein räudiges Tier verjagt, war ihr von einer mitleidigen Seele die Adresse des Doktor Landau zugeraunt worden. Sein Gesichtsausdruck schien ihr verheißungsvoll, und sie hätte sich auf seine herabhängenden Hände gestürzt, die Enden seines weißen Leinenkittels geküsst, wäre er nicht auf seiner Hut gewesen.
»Ziehen Sie sich an, zum Donnerwetter! Man wartet ja draußen!« schimpfte er mit gekünstelter Wut, aber seine Augen, verlegen abseits irrend, straften seinen Zorn Lüge. Wie von derselben Maschine gestanzt, die schon Hunderte ihrer Produkte auf das Wachstuch seines Untersuchungstisches geworfen hatte – sah er die schlotternde, erschöpfte Kreatur vor sich stehen, die schlaffen Brüste mit vernarbten Wunden besät, zerbissen von dem betrogenen Hunger der Kinder, die aus Sparsamkeit möglichst lange an der Brust behalten wurden, weil nur die vergeudete Lebenskraft die Wochenrechnung beim Krämer nicht erhöhte. Nur was dem eigenen Körper abgelistet und ausgepresst wurde, musste am Löhnungstage nicht bezahlt werden. Erschüttert wandte sich der Doktor ab und flüchtete zu dem Kind, das für die Dauer der Untersuchung vor das Fenster verbannt worden war. Dort stand es reglos, keinen Zug von Neugierde im altklugen Gesichtchen, so unbeteiligt, als hätte es die Mutter nicht wimmern und flehen gehört hinter sich.
Was musste ein siebenjähriges Mädchen schon gehört und erlebt haben, um gar nicht mehr darauf zu achten, was im gleichen Zimmer zwischen den Erwachsenen vorging? Auch dieses verhungerte kleine Ding wuchs unaufhaltsam dem Schicksal der Mutter entgegen, schon blitzte Feindschaft aus den verwilderten Augen und das zerzauste Köpfchen entzog sich misstrauisch der fremden Hand, die teilnahmsvoll über den strähnigen Scheitel strich. Woher sollte das Kind auch wissen, was Liebkosungen waren? Es kam von dort, wo der Kampf ums Dasein Bruder gegen Bruder stellt, der Ältere nur auf Kosten des Jüngeren sich sättigen kann. Und damit nun noch ein siebentes hungriges Kind die Geschwister verkürze, sollte der Unglücklichen da hinten noch eine Geburt auferlegt, ihrem ausgeweideten, zerfezten Leib noch ein Leben entrissen werden?
Den Blick verloren im Nebel, der am Fenster vorbeizog, verglich Doktor Landau die Härte eines Todesurteils, das Siechtum, Todesfurcht und Qual auf Stunden und Sekunden reduziert, mit der Grausamkeit, die ein schuldloses Wesen zu lebenslänglichem Leben verdammte, verschärft mit Hunger, harter Arbeit, hartem Lager, und als einziger Weg in die Freiheit den Tod. Wie konnte man das gehetzte Menschentier von der Schwelle jagen, den Lebenskeim in ihrem Leibe nicht begnadigen, mit Berufung auf Pflicht und Gewissen?
»Gewissen?« – knurrte der Doktor halblaut vor sich hin, aber der Zischlaut in der Mitte des Wortes schlug an das Ohr der ängstlich lauernden Frau und traf sie wie ein Peitschenhieb. Die Unglückliche missdeutete das Achselzucken, warf sich auf die Knie, und es war keine kleine Mühe, sie wieder zu beruhigen. Vor ihren Augen trug Landau Namen und Adresse in den Vormerkkalender ein, gab sein Ehrenwort, nächsten Donnerstag, zu Silvester also, mit einer Pflegerin bei ihr zu sein.
Die Frau stieß wie ein Raubvogel auf die Hand des Doktors nieder und bedeckte sie mit Küssen, bis es ihm endlich gelang, sich zu befreien.
Wütend überschimpfte er ihr Dankgestammel, schob sie mit dem Kind zur Tür hinaus, und der Anblick ihrer eckigen Schulterblätter, der schmale, wie aus Holz gehauene Märtyrerrücken hielten seinen Blick gefangen, sodass er, wie aus dem Schlaf geschreckt, zusammenzuckte, als Rilla ihn beim Vornamen anrief.
»Ach, du bist’s? Ich komme sofort.«
Der Justizrat lächelte spöttisch über den enttäuschten Ton, der Herr Schwager hielt es nicht für nötig, sich Zwang anzutun – dafür verabschiedete er umso herzlicher das lumpige Weib. Wohl auch eine Klientin von der bewussten Sorte? Der alte Herr musste sich beeilen, wollte er nicht erleben, dass der geliebte Sohn für eine Weile Pappschachteln zu kleben bekam.
Aus dem Vorzimmer zurückgekehrt, bot der Doktor dem Schwager keinen Stuhl, erkundigte sich barsch nach seinem Begehren und verhehlte seinen Unwillen nicht, als Rilla unaufgefordert in das Ordinationszimmer hinüberging.
»Wir könnten hier gestört werden, wie ich gehört habe, erwartest du ja noch einen Patienten.«
Die würdevoll herablassende Haltung wirkte so irritierend, dass Landau nicht gleich den Sinn der salbungsvollen Rede erfasste. Er hörte die Worte Dankespflicht, Greisenalter, Vaterherz, traute anfangs seinen Ohren kaum. Von diesem kaltherzigen Streber, den nur Erfolgsanbetung und Neid leiteten, ranzige Variationen über das Motiv Elternliebe – Weihnachtszauber anzuhören, das war doch mehr, als man ertragen konnte.
»Ja, zum Donnerwetter! Hast du dich nur heraufbemüht, um mir mitzuteilen, dass Vater nicht jünger geworden ist? Die Tatsache ist mir nicht unbekannt. Ich weiß auch, dass er längst die Hoffnung aufgegeben hat, mich zu bekehren. Er hat mich abgeschrieben wie eine dubiose Forderung, und das ist hart für ihn, denn es gehört sonst nicht zu seinen Gewohnheiten, zwanzig Jahre lang Geld und Mühe in ein verfehltes Unternehmen hineinzustecken. Und jetzt soll ich ihm als Weihnachtsgeschenk den Defraudanten1 gegenübersetzen, der ihm sein Geld unterschlagen hat? Eine Zeit lang würde er an sich halten, um zuletzt aus irgendeinem lächerlich geringen Anlass doch zu explodieren. Nein, er soll ungestört mit seinen Enkelkindern spielen, ich denke nicht daran, ihm und mir und euch allen den Weihnachtsabend zu verderben! Bitte, sage das auch deiner Frau! Ich komme nächstens mal bei ihr vorbei.«
Es ließ sich nicht viel gegen diese vernünftige Antwort einwenden, aber dem Justizrat war es darum zu tun, nicht so glatt davonzukommen. Er brauchte einen Streit mit Grobheiten, die er opferfreudig einstecken und, mit überlegener Nachsicht zitiert, als Aktivposten buchen lassen konnte. Mit berechneter Schärfe entgegnete er:
»Wenn du so rücksichtsvoll sein willst, brauchst du nur Vater nicht zu widersprechen! Ich meine, du könntest ihm auch mal eine Antwort schuldig bleiben, da du ihm ja, wie du selbst zugibst, manches andere schuldig geblieben bist. Er ist nicht nur um vierzig Jahre älter als du, er hat sich redlich Mühe mit dir genommen, hat dir …«
»Vater? Mühe? Mit mir? Du meinst wohl …«
»Genau, was ich gesagt habe!« schnarrte Rilla streng, innerlich triumphierend über den Erfolg seiner Provokation. »Bis zu deiner Großjährigkeit hat dich dein Vater erzogen …«
»Erzogen sagst du? Wo hast du je gesehen, dass reiche Leute ihre Kinder erziehen? Wie könnten sie die Zeit dazu aufbringen, da sie doch für die Zukunft, für die Laufbahn und das Erbteil ihrer Kinder vorsorgen müssen? Für die Zeit des Werdens gibt es ja bezahlte Kräfte genug, unwissende Bäuerinnen, Hausmeisterstöchter, arme Schlucker, an Hungern und Frieren gewöhnte. Ja, wenn, mein Vater mich erzogen hätte, dann wäre ich auch sein Sohn geworden! Wie hätte der weiche, noch ungeformte Ton der Vaterhand widerstehen können? Aber der böse, verbitterte Mediziner, der sich als Korrepetitor durch das Gymnasium gehungert hatte, wie sollte der mich auf mein Leben, auf die Zukunft, die mein Vater für mich zurechtzimmerte, vorbereiten? Was wusste er denn vom Reichtum, außer dass er ihn hasste? Täglich hatte er mir den Geiz meines Vaters, der ihm um kargen Entgelt seine Zeit abpresste, unter die Nase gerieben. Seine eigene Tüchtigkeit hat er meinem Schlemmerdasein entgegengestellt, geprügelt hat er mich – um seine Wut auszulassen an der Menschensorte, die es so unverdient gut hatte, wie es ihm unverdient schlecht ging.«
Für eine Sekunde verstummte Landau, holte tief Atem und rief dann mit triumphierendem Hohn: »Das ist ja das Fantastische! Gerade die Männer, die nichts von dem friedlichen Einebnen der sozialen Unterschiede hören wollen, die schroffsten, unversöhnlichsten gerade, liefern ihre Kinder dem Einfluss aus dem feindlichen Lager aus! Glaubst du, es könnte auch umgekehrt einer von parfümierten Gecken erzogen werden und doch als tüchtiger Metzgermeister sein Brot verdienen? Da! … Weil wir davon sprechen: du siehst an den zwei Gedecken, dass ich einen Gast erwarte. Ich könnte dir gleich ein Beispiel dafür geben, wie …«
Noch mehr über die pädagogischen Ansichten seines Schwagers zu erfahren, hegte der Justizrat keinerlei Wunsch. Ohne jede Rücksicht auf die Erregung des Doktors fiel er mitten in den begonnenen Satz ein:
»Ich habe deine Vorbereitungen natürlich längst bemerkt und freue mich, meine Frau damit trösten zu können, dass ihr Bruder den Heiligen Abend weder in trauriger Einsamkeit, noch zwischen tuberkulösen Proletarierkindern oder in einer sonstwie unerquicklichen Umgebung verbringen wird. Ich weiß aus meiner Studentenzeit, dass derlei unlegitime Familienfeste sehr vergnügt ausfallen können. Ob du allerdings nicht besser daran getan hättest, deine Kleine schon nachmittags zu beschenken, um den Abend mit deinem greisen Vater zu verbringen, das wollen wir dahingestellt sein lassen.«
Der Doktor bemühte sich, den gleichen, süßlich spöttelnden Ton zu treffen: