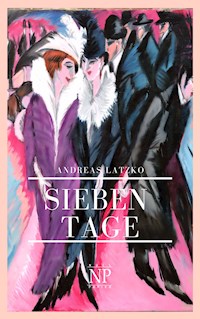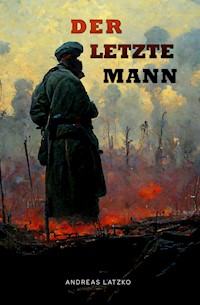Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Null Papier Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Verbrannte Bücher bei Null Papier
- Sprache: Deutsch
Ein Meisterwerk der Antikriegsliteratur. Im Ersten Weltkrieg wird der Autor verwundet und schwer traumatisiert. In sechs eindringlichen Geschichten zeigt er den Irrsinn des Krieges auf. Diese noch 1917 anonym veröffentlichte Sammlung ist die erfolgreichste Veröffentlichung des Autors. In allen kriegsführenden Staaten wurde das Buch umgehend verboten. Die Nazis taten alles daran, um diesen frühen Mahner und Warner vor der Kriegsgeilheit vergessen zu machen. Leider hatten sie Erfolg. Auch Latzko und sein Werk erhielten von Hitler das "Gütesiegel" der Literatur "wider den deutschen Geist." Erst sehr spät nach dem Krieg wurde der im holländischen Exil gestorbene Autor einem breiteren Publikum bekannt. Dennoch erreichte seine Bekanntheit nie die Grade eines Erich Maria Remarque mit seinem "Im Westen nicht Neues." Null Papier Verlag
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 182
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andreas Latzko
Menschen im Krieg
Erzählungen
Andreas Latzko
Menschen im Krieg
Erzählungen
Veröffentlicht im Null Papier Verlag, 2024Klosterstr. 34 · D-40211 Düsseldorf · [email protected] EV: Verlag Rascher, Zürich, 1918 (200 S.) 2. Auflage, ISBN 978-3-962815-39-4
null-papier.de/katalog
Inhaltsverzeichnis
Der Abmarsch
Feuertaufe
Der Sieger
Der Kamerad
Heldentod
Heimkehr
Danke
Danke, dass Sie sich für ein E-Book aus meinem Verlag entschieden haben.
Sollten Sie Hilfe benötigen oder eine Frage haben, schreiben Sie mir.
Ihr Jürgen Schulze
Newsletter abonnieren
Der Newsletter informiert Sie über:
die Neuerscheinungen aus dem Programm
Neuigkeiten über unsere Autoren
Videos, Lese- und Hörproben
attraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehr
https://null-papier.de/newsletter
Freund und Feind zu eigen
Ich weiß gewiss, die Zeit wird einmal kommen, wo alles denkt wie ich.
Der Abmarsch
Es war im Spätherbst des zweiten Kriegsjahres, im Lazarettgarten einer kleinen österreichischen Provinzstadt, die am Fuße bewaldeter Hügel, wie hinter einer spanischen Wand verkrochen, ihr verschlafen friedfertiges Dreinschauen noch immer nicht abgelegt hatte.
Tag und Nacht pfiffen die Lokomotiven, rollten die schwerbeladenen Züge mit singenden, geschmückten Soldaten, mit hochgeschichteten Heuballen, brüllendem Schlachtvieh, sorgfältig verschlossenen, finsteren Wagen mit Munition zur Front hinaus; krochen langsam die anderen heimwärts, gezeichnet mit dem blutenden Kreuz, das der Krieg über Wände und Insassen geworfen. Mit Raseschritten durcheilte die große Wut das Städtchen, ohne seine Ruhe verscheuchen zu können, als hätten die niederen, hell getünchten Häuser mit den zopfig verschnörkelten Fassaden stillschweigend das kluge Übereinkommen getroffen, den anspruchsvollen, lärmenden Gesellen, der da das unterste zu oberst kehrte, vornehm zu ignorieren.
In den Anlagen spielten die Kinder ungestört mit den großen, rostroten Blättern der alten Kastanien, Frauen standen schwatzend vor den Ladentüren, in jedem Gässchen schwebte irgendwo ein Mädchen mit buntem Kopftuch und rieb eine Fensterscheibe blank. Trotz der Spitalfahnen, die auf Schritt und Tritt von den Häusern wehten, trotz der vielen Tafeln, Aufschriften und Wegweiser, die der Eindringling dem wehrlosen Städtchen ins Antlitz geheftet, schien da, kaum fünfzig Kilometer hinter dem Gemetzel, dessen Schein, in klaren Nächten, wie Theaterfeuer über den Horizont zuckte, der Frieden immer noch in Permanenz. Wenn, für Augenblicke, der Strom der schweren, fauchenden Kraftwagen und rasselnden Fuhrwerke versiegte, kein Zug über die Eisenbahnbrücke polterte, und zufällig auch kein Trompetensignal und kein Säbelklirren kriegerisch tat, dann steckte das trotzige kleine Nest blitzschnell sein gutmütig-stumpfsinniges Provinzgesicht auf, um sich vor dem nächsten Generalstabsauto, das mit wichtigtuerischer Schnelle um die Ecke bog, resigniert hinter die schlechtsitzende Soldatenmaske zu verkriechen.
Wohl brummten in der Ferne die Kanonen, als kauerte eine ungeheure Dogge irgendwo tief unter der Erde, sprungbereit den Himmel anknurrend. Das dumpfe Bellen der großen Mörser klang herüber, wie schweres Husten aus der Krankenstube die Wachenden schreckt, die mit rotgeweinten Augen nebenan zum Sterbenden hinüberlauschen. Auch die langen, niederen Häuserreihen zuckten klirrend zusammen, horchten erschüttert auf, so oft dies Husten den Boden krampfte, als läge die Kriegsnot, wie ein Alp, würgend auf der Brust der Welt. Erstaunt blickten die Straßen einander in die Augen, schläfrig blinzelnd im Widerschein der Nachtlämpchen, die drin ihre fröhlich huschenden Schatten über dichtgereihte Betten jagten. Gellende Schreie, Wimmern, Stöhnen sandten die notgepfropften Räume in die Nacht hinaus. Jeder menschliche Laut, der durch die offenen Fenster drang, fiel wie ein wütender Angriff die Stille an, war wilde Anklage gegen den Krieg, der da vorne seine Arbeit tat und zerfetzte Menschenleiber wie Abfall hinter sich warf, alle Häuser mit seinem blutigen Kehricht füllend.
Aber die schönen, schmiedeeisernen Brunnen auf den Plätzen rauschten doch gleichmütig weiter, plauderten mit beruhigender Ausdauer von den Tagen ihrer Jugend, da die Menschen noch Zeit und Sorgfalt für edel geschwungene Linien gehabt, Krieg eine Angelegenheit für Fürsten und Abenteurer gewesen. Aus jedem Schnörkel und jeder Ecke strömte das Märchen, lief auf leisen Sohlen, von Frieden und Behagen flüsternd, wie eine unsichtbare Klatschbase durch alle Gässchen, und die greisen Kastanienbäume nickten zustimmend, strichen mit dem Schatten ihrer gespreizten Finger besänftigend über die erschrockenen Fassaden. So dicht wucherte die Vergangenheit aus den rissigen Mauern, dass jedem, der in ihren Kreis trat, Brunnenrauschen den Kanonendonner übertönte, die Kranken und Wunden besänftigt hinaushorchten vom heißen Lager in die geschwätzige Nacht, bleiche Männer, die man auf wippenden Bahren durchs Städtchen trug, die Hölle vergaßen, aus der sie kamen, und selbst die schwerbepackten Opfer, die im nächtlichen Eilmarsch dröhnend vorbeizogen, milde wurden für eine Wegspanne, als wären sie dem Frieden begegnet und ihrem eigenen, unbewaffneten Ich, im Schatten der Pfeiler und blumengeschmückten Erker. Es erging dem Kriege wie dem Fluss, der von Norden her in tobender Eile aus den Bergen kam, schäumend vor Wut über jedes Steinchen, das ihm den Weg vertrat; – und der am anderen Ende, bei den letzten Häusern, doch sanft gerührt Abschied nahm von der Stadt, ganz gebändigt, ganz leise plätschernd, wie auf Fußspitzen, wie eingeschläfert von all’ der Verträumtheit, die er gespiegelt. Breitspurig trat er ins weite Wiesenfeld hinaus, einen Bogen schlingend um das Garnisonsspital, das im Schatten dickleibiger Platanen wie auf einer Insel stand. Von drei Seiten her mischte sich das Murmeln der trägen Flut in das Rascheln der Blätter, als stimmte der Garten, wenn die Dämmerung auf ihn fiel, mitleidig ein Schlummerlied an für die Geschundenen, die da in Reih und Glied zu leiden hatten, reglementiert bis in den Tod hinein, bis ans Grab, in das man sie, verunglückte Schuhmacher, Klempnergesellen, Bauernknechte und Schreiberseelen, mit großmäuligen Gewehrsalven verscharrte.
Der Zapfenstreich war eben verklungen; die Wache hielt die Runde, stöberte im Schatten der großen Allee drei Nachzügler auf und jagte sie ins Haus.
»Seid’s ös vielleicht Offiziere, was?«, brummte gemütlich polternd der Kommandant, ein stämmiger Landsturmkorporal mit ergrauten Schläfen.
»Mannschaft g’hört ins Bett um neune!«
Und nur um seine Würde zu wahren, fügte er mit schlecht gespielter Bärbeißigkeit die Drohung hinzu:
»Alsdann! Is g’fällig oder net?«
Beinahe hätte er die in solchen Fällen übliche Drohung, dem einen oder anderen Beine zu machen, schon ausgesprochen, aus Gewohnheit; doch konnte er im letzten Moment den Satz noch verbeißen und schnitt ein Gesicht, als hätte er sich verschluckt. Denn die Drei, die nun ergeben dem Mannschaftseingang zuhumpelten, hätten gewiss nichts einzuwenden gehabt gegen das Beinemachen. Sie krochen, zu dritt, auf zusammen zwei Füßen und sechs klappernden Krücken. Als hätten Regisseurhände, ängstlich um Symmetrie besorgt, das lebende Bild gestellt, ging rechts einer, der nur sein rechtes Bein behalten hatte, links sein Pendant, auf dem linken Fuße hüpfend; und in der Mitte schaukelte, zwischen zwei hohen Krücken, der armselige Rest eines Menschenleibes, die leeren Hosenbeine übers Kreuz auf die Brust gesteckt, so kurz, dass der ganze Mann in einer Kinderwiege Platz gefunden hätte.
Mit gesenktem Kopf und geballten Fäusten, wie geduckt unter der Last des Anblicks, starrte der Korporal der Gruppe nach, knurrte einen Fluch, der nicht gerade patriotisch klang, und spie in weitem Bogen zischend durch die Vorderzähne. Als er sich zum Gehen wandte, schlug vom anderen Ende des Gartens, aus der Richtung des Offiziersflügels, schallendes Gelächter an sein Ohr. Versteinert blieb er stehen, zog den Kopf ein, wie aufs Genick geschlagen, und über sein breites, gutmütiges Bauerngesicht huschte ein Schein von unbändigem Hass. Er spie noch einmal aus, um sich zu beruhigen, nahm einen Anlauf und passierte, stramm salutierend, die lustige Gesellschaft.
Die Herren dankten lässig. Sie saßen, – angesteckt von dem Behagen, das wie eine Wolke über dem ganzen Städtchen schwebte, – fröhlich plaudernd auf vier, zu einem Quadrat zusammen geschobenen Bänken vor dem Hause, sprachen vom Krieg und – lachten, wie vergnügte Schulkinder, die freudig von überstandenen Prüfungsängsten schwatzen. Jeder hatte seine Pflicht getan, sein Teil abbekommen und saß nun, im Schutze seiner Wunde, in molliger Erwartung auf Heimurlaub, Wiedersehen, Gefeiertwerden und wenigstens zwei ganze Wochen als unnumerierter Mensch.
Am lautesten lachte der junge Leutnant, den sie Musulmann nannten, wegen seiner mohammedanischen Kopfbedeckung als Offizier eines Bosnjakenregiments. Eine herabsausende Hülse hatte ihm das linke Bein gebrochen und gründlich, denn es lag seit Wochen schon verschient und eingewickelt in starrer Gipshülse, sorgfältig gehegt von seinem Besitzer, der es, auf Krücken gestützt, wie einen fremden, ihm anvertrauten Wertgegenstand mit sich trug.
Auf der Bank gegenüber dem Musulmann saßen zwei Herren: ein Rittmeister – der einzige Aktive in der Gesellschaft – mit einem Querschläger im rechten Arm und ein Artillerieoffizier, in Zivil Privatdozent der Philosophie – daher kurz Philosoph genannt – mit einer schon verheilenden Hasenscharte, die ihm ein Granatsplitter in die Oberlippe gerissen. Diese drei bestritten, mit den zwei Damen auf der Bank, die an der Mauer stand, allein die Unterhaltung; denn der vierte: Landsturmleutnant mit gelichtetem Hinterkopf, bekannter Opernkomponist in Zivil, saß versunken, mit zuckenden Gliedern und unstet irrenden Augen auf seiner Bank, ohne Anteil zu nehmen am Gespräch. Er war vor einer Woche erst eingeliefert worden, mit einer schweren Nervenerschütterung, die er sich auf dem Doberdo-Plateau geholt. In seinem Blick kauerte noch das Grauen. Finster vor sich hinbrütend ließ er willenlos alles mit sich geschehen, ging zu Bett oder saß im Garten, von den anderen wie durch eine unsichtbare Wand getrennt, auf die er stierte. Selbst die unverhoffte Ankunft seiner hübschen, blonden Frau hatte die Vision des grausigen Erlebnisses, das ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, für keinen Augenblick verscheuchen können. Das Kinn auf der Brust, ließ er die geflüsterten Koseworte seiner Frau ohne ein Lächeln über sich ergehen, rückte, wie von einem Krampf gepackt, wie gepeinigt bei Seite, so oft sie, mit unendlich viel Liebe in den Fingerspitzen, ängstlich eine Berührung mit seinen armen, zitternden Händen suchte.
Schwere Tränen rollten über die zärtlichkeitshungrigen Wangen der kleinen Frau, die sich so tapfer durch alle Sperrzonen gekämpft hatte, bis zu dem Spital im Kriegsgebiet – und nun, nach der erlösenden Freude: ihren Mann lebend, unverstümmelt wiedergefunden zu haben, plötzlich einen rätselhaften Widerstand spürte, ein letztes, unerwartetes Hindernis, das sie nicht mehr wegbetteln, nicht wegweinen konnte, und das doch da war, sie unbarmherzig von dem Ersehnten trennte. In qualvoller Ratlosigkeit saß sie lauernd neben ihm, zermarterte sich das Hirn, ohne eine Erklärung finden zu können für die Feindschaft, die aus ihm strahlte. Ihre Augen durchbohrten die Finsternis, ihre Hände gingen immer wieder den gleichen Weg, sich schüchtern vorwärtstastend, um wie versengt, zurückzuzucken, wenn sein gehässiges Ausweichen sie von Neuem in Verzweiflung stürzte.
Es war hart, so den Schmerz verbeißen zu müssen, nicht mit einem vorwurfsvollen Aufschrei ihrem Manne das Geheimnis entreißen zu können, das er in seinem Elend noch so trotzig zwischen sich und seine einzige Stütze schob. Hart war es auch, mit geheuchelter Fröhlichkeit über das glückliche Wiedersehen teilzunehmen an der leichtfertigen Unterhaltung; immer wieder etwas erwidern müssen und nicht die Geduld zu verlieren über das ewige Kichern der anderen. Die freilich hatte es leicht! Wusste den Mann geborgen bei einem höheren Kommando hinter der Front und war der Langeweile ihres kinderlosen Hauses hierher entflohen, in das ereignisreiche Leben des Spitals. Seit sieben Uhr abends saß sie, aufbruchbereit, in Hut und Jacke, ließ sich immer wieder zum Bleiben bewegen und schäkerte lustig drauf los, als wüsste sie nichts mehr von all den Qualen, die sie tagsüber in dem Hause gesehen, an das sie den Rücken lehnte. Die traurige kleine Frau atmete auf, als die Dunkelheit so dicht geworden war, dass sie unauffällig abrücken konnte von der frivolen Schwätzerin.
Und doch war die Frau Major, trotz des aufreizenden Gekutters, der wichtigtuerischen Miene, mit der sie von ihren Schwesternpflichten sprach, durchdrungen von einem Gefühl, das sie – ohne ihr Wissen – hoch über sie selbst emporhob.
Die große Mütterlichkeitswelle, die über alles weibliche hereinbrach, als den Männern die schwere Stunde geschlagen, trug auch sie. Die drei Männer, in deren Kreise sie jetzt mollig in Redensarten plätscherte, hatte sie – wie tausend andere – blutüberströmt, unbeholfen, vor Schmerzen wimmernd gesehen; und etwas von der Freude der Henne, deren Küken flügge werden, durchwärmte ihre Koketterie. Seit die Männer hockend, kriechend, hungernd Monat auf Monat den eigenen Tod austragen, wie Frauen ihre Kinder, – seit Dulden und Warten, passives sich Abfinden mit Gefahr und Schmerz das Geschlecht gewechselt, fühlen die Frauen sich stark, und selbst in ihrer Lüsternheit glimmt noch ein wenig von der neuen Leidenschaft des Bemutterns.
Die traurige blonde Frau, eben erst angekommen aus einer Zone, in welcher der Krieg nur in Gesprächen lebt, ganz auf ihren einzigen Mann eingestellt, litt unter der geschlechtslosen Vertraulichkeit, die sich da im Schatten von Tod und Qualen breit machte, im Lazarettgarten, den die Dunkelheit immer mehr verschlang. Die anderen aber waren daheim im Kriege, sprachen seine eigene Sprache, gemischt aus trotziger Lebensgefräßigkeit, einer paradoxen Milde in den Männern, geboren aus Übersättigung an Rohheit und einer seltsamen, geschwätzigen Kaltblütigkeit der Frau, die so viel von Blut und Sterben gehört, dass ihre ewige Neugier wie Härte und hysterische Grausamkeit klang.
Der Musulmann und der Rittmeister hechelten den Philosophen durch, spöttelten wegwerfend über Wortfuchser, Tüftler und ähnliche Tagediebe und freuten sich kindisch über seine breit lächelnde Verlegenheit vor der Frau Major, die, aus weiblichem Anstand, der wehrlosen Gutmütigkeit des Philosophen ihren Beistand lieh, während ihre Augen voll passionierter Zuneigung zu den anderen hinüberblitzten, die ihre Fäuste patzig im Munde führten.
»Lassen Sie doch den armen Herrn Oberleutnant in Ruh’«, wehrte sie ab mit gurrendem Lachen, »er hat recht. Der Krieg ist scheußlich. Die Zwei ziehen Sie ja doch nur auf!«, zwinkerte sie begütigend hinüber.
Der Philosoph schmunzelte phlegmatisch und schwieg. Der Musulmann gab seinem Bein, das, weiß schimmernd, einzig von ihm sichtbar blieb in der Finsternis, mit leisem Zähneknirschen eine bessere Lage auf der Bank und lachte laut auf:
»Der Philosoph? Ja, was weiß denn der Philosoph vom Krieg, Frau Major? Der is’ ja doch Artillerist! Krieg führt nur die Infanterie. Wissens Frau Major …«
»Hier heiße ich Schwester Engelberta«, fiel sie ein und ihr Gesicht wurde fast ernst für einen Augenblick.
»Pardon, Schwester Engelberta! Artillerie und Infanterie, das is’ nämlich wie Mann und Frau. Wir Infanteristen müssen das Kind auf d’Welt bringen, wann ein Sieg geboren werden soll. D’Artillerie hat nur’s Vergnügen, wie der Mann in der Liebe; fahrt stolz vor, wann’s Kind schon aus der Tauf gehoben wird. Hab ich nicht recht, Herr Rittmeister? Du bist ja jetzt auch Reiter zu Fuß.«
Der Rittmeister stimmte dröhnend ein. Laut seiner summarischen Anschauung gehörten Abgeordnete, die nicht genug Geld fürs Militär bewilligten, Sozialisten und Pazifisten, kurz alles was sprach, schrieb, überflüssige Worte machte und vom G’scheit sein lebte in das gleiche Kapitel Bücherwurm wie der Philosoph.
»Ja, ja«, sagte er mit seiner überschrienen Stimme, »für d’Artillerie is’ so a Philosoph grad’s Rechte. Auf’m Berg oben hock’n und zuschaun, sonst tun’s ja eh nix. Wann’s nit unsere eigenen Leut z’ammschießn! Mit dene Katzlmacher vor uns, sein mir immer leicht fertig worn; aber vor euch Meuchelmörder im Rücken hab ich immer an Mordsrespekt g’habt. Aber jetzt hört’s endlich auf vom Krieg zu reden, sonst geh ich schlafn. Da sitzt man endlich mit zwei reizenden Damen, sieht nach langer Zeit wieder ein G’sicht ohne Bartstoppeln, und Ihr sprichts immer noch von der damischen Schießerei. Herrgott, wie zu mir in’ Lazarettzug das erste blonde Mäderl reinkommen is, mit’m weißen Häuberl auf’m Wuschelkopf, ich hätt’s am liebsten bei der Hand g’nommen und immer nur ang’schaut. Ehrenwort, Frau Major: Das bisl Schießen wird einem höchstens fad mit der Zeit; die Haustierln sind schon ärger; aber’s Ärgste ist das vollkommene Fehlen der holden Weiblichkeit. Fünf Monat lang nix als Männer sehn, – und dann auf einmal wieder so an helles, liebes Frauenstimmerl hören! … Das is’ doch’s Schönste! Dafür lohnt sich’s schon in Krieg zu gehen.«
Der Musulmann verzog sein bewegliches, von Jugend blitzendes Gesicht zu einer Grimasse:
»Das Schönste? … Nein, weißt Herr Rittmeister, wann ich aufrichtig sein soll … gebadet wer’n, dann, mit’n frischen Verband, ins saubere, weiße Bett hinein, und wissen, dass ma sei’ Ruh habn wird für a paar Wochen, … das is’ a G’fühl, wie … Da gibt’s überhaupt kein Vergleich. Aber wieder einmal Damen sehen is’ freilich auch sehr schön.«
Der Philosoph hatte seinen runden, fleischigen Epikuräerkopf schief auf die Schulter gelegt; seine kleinen, listigen Augen bekamen einen feuchten Glanz. Er blickte hinüber, wo ein heller Fleck, in der fast greifbar gewordenen Finsternis, das weiße Kleid der Frau Major vermuten ließ und hub in einem leise singenden Ton, ganz langsam zu erzählen an:
»Das Schönste ist, finde ich, die Stille. Wenn man da oben in den Bergen gelegen ist, wo jeder Schuss fünfmal hin- und hergeworfen wird, und dann ist’s auf einmal ganz still, kein Pfeifen, kein Heulen, kein Donnern, nichts als eine herrliche Stille, der man zuhören kann, wie einem Musikstück – – – Ich habe die ersten Nächte sitzend durchwacht und die Ohren gespitzt auf dieses Schweigen, wie auf eine Melodie, die man von weitem erhaschen will. Ich glaube, ich habe sogar ein wenig geheult, so schön war’s zuzuhören, dass man gar nichts mehr hört!«
Der Rittmeister schleuderte seine Zigarette weg, dass sie, wie ein Komet, funkensprühend durch die Nacht flog und schlug sich klatschend auf den Schenkel.
»Na, also«, rief er höhnisch, »hab’ns das verstanden, Frau Major? Zuhören, dass man nix hört. Seh’ns, das heißt man Philosophie. Ich weiß aber noch was Schöneres, du! Nämlich: nicht zu hören, was man hört. Besonders wann’s so an philosophischen Stiefel zu hören gibt.«
Man lachte, – und der Gehänselte lächelte gutmütig mit. Auch er war ganz durchtränkt von dem Frieden, der aus der schlafenden Stadt in den herbstlichen Garten herüberwehte, und die aggressiven Scherze des Rittmeisters perlten an ihm ab, wie alles, was geeignet gewesen wäre, die Süße der wenigen Tage, die ihn von der Rückkehr an die Front noch trennten, zu mindern. Er wollte seine Zeit ausgenießen, behäbig, mit geschlossenen Augen; wie ein Kind, das ins finstere Zimmer muss.
Die Frau Major beugte sich vor:
»Über das Schönste gehen also die Meinungen auseinander«, sagte sie, und ihr Atem ging rascher, »was war aber das Grässlichste, das Sie draußen erlebt haben? Viele sagen das Trommelfeuer wäre das Grässlichste; viele können den Ersten, den sie fallen gesehen haben, nicht verwinden. Und Sie?«
Der Philosoph, an den die Frage gerichtet war, schnitt ein gequältes Gesicht. Dieses Thema passte so gar nicht in sein Programm. Er suchte noch nach einer ausweichenden Antwort, als ein unverständlicher, röchelnder Ausruf alle Augen in die Ecke zog, in welcher der Landsturmoffizier und seine Frau saßen. Man hatte die beiden fast schon vergessen in der Dunkelheit und wechselte erschrockene Blicke, als der torkelnde Mann mit den erloschenen Augen, die zerbrochene Gliederpuppe, deren Stimme kaum einer kannte, jetzt im krähenden Diskant hastig zu reden anfing:
»Grässlich? Grässlich ist nur der Abmarsch«, rief er. »Man geht, – – – und dass man gelassen wird, das ist grässlich!«
Ein kaltes, würgendes Schweigen folgte seinen Worten; selbst das ewig fröhliche Gesicht des Musulmannes erstarrte in peinlicher Verlegenheit. Das kam so unerwartet, klang so unverständlich und hatte – vielleicht durch das Vibrieren der Stimme aus dem zitternden Leib oder den gurgelnden Nebenton, der wie überschrienes Schluchzen klang – doch alle an der Kehle gepackt und ließ die Pulse schneller schlagen.
Die Frau Major sprang auf. Sie hatte den Mann ankommen gesehen, auf eine Bahre geschnallt, weil ihn das Weinen so hoch schleuderte, dass die Träger nicht anders seiner Herr werden konnten. Irgendetwas unsagbar Hässliches hatte, – so hieß es, – den armen Teufel halb um seinen Verstand gebracht, und die Frau Major durchzuckte jäh die Angst vor einem Tobsuchtsanfall. Sie kniff den Rittmeister in den Arm und rief mit geheuchelter Eile:
»Um Gotteswillen! Da klingelt ja schon die letzte Tramway! Schnell, schnell, gnädige Frau, wir müssen laufen.«
Alle waren aufgestanden; die Frau Major hatte sich in den Arm der unglücklichen kleinen Frau eingehakt und drängte immer hastiger:
»Wir müssen eine Stunde zu Fuß gehen bis zur Stadt, wenn wir die Elektrische verpassen.«
Ratlos, am ganzen Leibe zitternd, beugte die Frau sich noch einmal zu ihrem Mann hinab, um Abschied zu nehmen. Sie fühlte genau, dass dieser Aufschrei ihr galt; dass er einen grimmigen, tödlichen Vorwurf enthielt, den sie nicht begriff. Sie fühlte ihren Mann zurückweichen, sich verkrampfen unter der Berührung ihrer Lippen und schluchzte auf, bei dem grässlichen Gedanken an die endlose Nacht in dem frostigen, verwahrlosten Hotelzimmer, allein mit diesem quälenden Zweifel. Aber die Frau Major zog sie mit sich, zwang sie zum Laufen; ließ sie erst wieder los, als sie schon, an der Torwache vorbei, auf die Straße traten.
Die Herren blickten ihnen nach, sahen die Figuren im Scheine der Straßenlaterne noch einmal auftauchen, horchten dem Sausen der Trambahn nach. Der Musulmann griff nach seinen Krücken, blinzelte dem Philosophen bedeutungsvoll zu und sprach gähnend von Schlafengehen. Der Rittmeister sah neugierig auf den Kranken hinab, fühlte Erbarmen und wollte dem armen Teufel eine Freude machen. Er klopfte ihm auf die Schulter und sagte in seiner burschikosen Art:
»Eine fesche Frau hast, das muss man sagen. Mein Kompliment!«
Im nächsten Augenblick fuhr er erschrocken zurück. Das kümmerliche, zusammengesunkene Häufchen auf der Bank sprang plötzlich hoch, wie emporgeschnellt von einer jäh erwachten Kraft.
»Fesche Frau? Ja, ja. Schneidige Frau!«, kam es geifernd über die zuckenden Lippen, mit einer Wut, die wie brodelnd die Worte schleuderte, »hat keine Träne vergossen beim Einwaggonieren. Waren alle fesch, wie wir abmarschiert sind. Auch die Frau vom armen Dill. Sehr schneidig! Hat ihm Rosen nachgeworfen in den Zug und war erst seit zwei Monaten seine Frau.« – Er kicherte höhnisch und ballte die Fäuste, schwer ankämpfend gegen die Tränen, die ihm in der Gurgel glühten. – Rosen, hehe, und auf Wiedersehen gerufen. So patriotisch waren sie alle! Gratuliert hat unser Oberst dem Dill, weil seine Frau sich so stramm gehalten hat, beim Abmarsch. So stramm, verstehst du, als ging’s zum Manöver.
Torkelnd, auf weit auseinandergespreizten Beinen, stand der Leutnant jetzt aufrecht, stützte sich auf den Arm des Rittmeisters und starrte ihm mit seinen unsteten Augen erwartungsvoll ins Gesicht.
»Weißt du, was ihm geschehen ist, dem Dill? Ich war dabei. Weißt du was?«
Ratlos blickte der Rittmeister auf die anderen. »Geh, komm schlafen. Reg di’ net auf!«, stammelte er verlegen.
Mit einem Triumphgeheul fiel ihm der Kranke ins Wort, keifend, mit unnatürlich hoher Stimme: