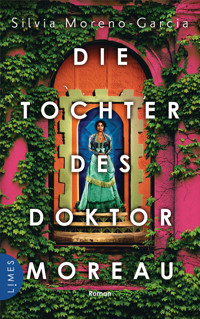12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bedrohliche Séancen, hochentzündliche Filmrollen und ein untoter Okkultist der Nazis – und mittendrin eine ungewöhnliche Protagonistin mit einer Vorliebe für Horrorfilme.
Die kluge Montserrat schlägt sich als Außenseiterin in einer Männerdomäne durch: im mexikanischen Filmbusiness. Der einzige Mensch, der ihr lieb und teuer ist, ist ihr Jugendfreund Tristan, der als Soap-Darsteller unter Auftragsarmut leidet. Als sie und Tristan das Angebot bekommen, einen nie produzierten legendären Horrorfilm zu vollenden, schlagen sie ein. Doch der Filmstreifen ist mit einem dunklen Fluch belegt, der alle ins Unglück stürzt, die an ihm arbeiten ... Und das ist längst nicht alles! Der Geist eines teuflischen Okkultisten der Nazis steht an der Schwelle zum Reich der Lebenden, und Montserrat und Tristan müssen ihn und seine Anhänger um jeden Preis aufhalten.
Nicht verpassen: nach »Der mexikanische Fluch« und »Die Tochter des Doktor Moreau« der neueste Roman der internationalen Sensationsautorin!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 580
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Die kluge Montserrat schlägt sich als Außenseiterin in einer Männerdomäne durch: im mexikanischen Filmbusiness. Der einzige Mensch, der ihr lieb und teuer ist, ist ihr Jugendfreund Tristán, der als Soap-Darsteller unter Auftragsarmut leidet. Als sie und Tristán das Angebot bekommen, einen nie produzierten legendären Horrorfilm zu vollenden, schlagen sie ein. Doch der Filmstreifen ist mit einem dunklen Fluch belegt, der alle ins Unglück stürzt, die an ihm arbeiten … Und das ist längst nicht alles! Der Geist eines teuflischen Okkultisten der Nazis steht an der Schwelle zum Reich der Lebenden und Montserrat und Tristán müssen ihn und seine Anhänger um jeden Preis aufhalten.
Autorin
Die in Mexiko geborene Kanadierin Silvia Moreno-Garcia ist als höchst vielseitige Autorin bekannt. Mit jedem ihrer Romane, darunter der Überraschungsbestseller Mexican Gothic (zu Deutsch »Der mexikanische Fluch«), erfindet sich Moreno-Garcia neu und meistert alle Genres – darunter den Schauerroman, den Noir-Krimi und die Science-Fiction sowie die Fantasy. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, unter anderem mit dem World Fantasy Award, dem Sunburst Award, dem Locus Award und dem British Fantasy Award. Sie lebt in Vancouver, British Columbia, und schreibt als Kolumnistin für die Washington Post.
Silvia Moreno-Garcia
SILBERNE GEISTER
ROMAN
Deutsch von Frauke Meier
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Silver Nitrate« bei Del Rey, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2024 by Silvia Moreno-Garcia
This edition published by arrangement with Del Rey, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
Vignette: Adobe Stock/Illustrator liubov
BL · Herstellung: DiMo
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31219-0V001
www.limes-verlag.de
Für Orrin Grey,den Monstermacher
Das Dokument wurde eingehend untersucht. Wie Harrington gesagt hatte, glichen die Zeichen eher Runen als irgendetwas anderem, doch keiner der Männer konnte sie entziffern, und beiden widerstrebte, sie abzuschreiben, denn sie fürchteten, wie sie zugaben, böse Absichten zu begünstigen, die sich hinter ihnen verbergen mochten.
M. R. James, »Casting the Runes«
ERÖFFNUNGS – SEQUENZ MCMXCIII
1
Ein angeschwollener gelber Mond überzog den Himmel mit einem fahlen Bernsteinton und schien auf eine einsame Gestalt herab. Es war eine Frau, die zwischen zwei Maulbeerfeigenbäumen stand.
Es hatte geregnet, der Boden war schlüpfrig, und das Atmen fiel ihr schwer, als sie auf die Hütte zuging. Der Wald fühlte sich lebendig und gefährlich an, erfüllt von den Geräuschen der Grillen und dem Donnergrollen in der Ferne. Ein leises Trällern war auch zu hören. War das ein Vogel? Die Laute klangen zu hoch.
Die Frau presste eine Hand an die Lippen und starrte die Hütte mit der einladenden Beleuchtung an. Doch diese Oase der Wärme war weit entfernt. Ein Zweig knackte und die Frau sah sich panisch um. Sie fing an zu rennen.
Nun mischte sich das Trippeln ihrer Füße in die Geräusche der Nacht. Sie stürzte voran, zerrte mit beiden Händen verzweifelt an der Tür – dann ein Knall, so laut, es klang wie ein Kanonenschuss –, bis sie es endlich schaffte, sie zu öffnen und in die Hütte zu stürmen. Sofort schloss sie die Tür hinter sich, legte den Riegel vor und trat zurück, wartete mit geweiteten Augen.
Sie fuhr zusammen, als sie das Krachen einer Axt auf Holz hörte. Splitter flogen durch die Luft. Die Frau schrie, wich immer weiter in den Raum zurück, während sich ein Mann den Weg durch die Tür freihackte. Der Schrei war eher ein nerviges Quieken, das die Pegel abrupt in den roten Bereich trieb. Der Mann stand auf der Schwelle und hielt die Axt fest umklammert. Dann rückte er vor. Sein Atem glich einem Keuchen, durchsetzt von lästigem Knacken.
»Schon wieder dämonische Besessenheit?«, fragte Montserrat. Ihre Augen fixierten das VU-Meter, während sie auf den Knien einen Notizblock balancierte.
»Geister«, sagte Paco.
Sie kritzelte auf ihrem Block. »Ich dachte, du hättest es mit Ninjas.«
»Die Ninjas machen wir immer noch, nur nicht gerade jetzt.«
»Ein Ninja-Moratorium.«
Die Frau schrie wieder. Montserrat drückte auf einen Knopf und fror die Bildschirmanzeige ein. Dann drehte sie ihren Stuhl um.
In dem schallgedämmten Raum roch es vage nach dem Lufterfrischer mit Kiefernduft, den die anderen Soundeditoren gern versprühten, um die Tatsache zu übertünchen, dass sie hier drin rauchten. Der ganze Raum war ein ziemlicher Saustall. Die Editoren ließen regelmäßig Pizzakartons und leere Pepsiflaschen im Kontrollraum zurück, zusammen mit dem Geruch von Zigaretten. »Speisen und Rauchen im Kontrollraum verboten«, verkündete ein Schild, das halb unter den diversen Aufklebern verschwand, die die Editoren über die Jahre auf ihm hinterlassen hatten. Theoretisch war diese Ermahnung durchaus sinnvoll, besonders, wenn es um Filme ging. Man will die Arbeitskopie ja nicht mit Fett versauen. In der Praxis wurde von den Editoren im Grunde erwartet, dass sie vor ihren Monitoren aßen. Während der Postproduktion riss man sich ununterbrochen den Arsch auf und versuchte, überzogene Fristen wiedergutzumachen. Die Schneideräume sahen alle wie Kriegsgebiete aus, es sei denn, man musste damit rechnen, dass ein Kunde den Kopf zur Tür hereinstreckte.
Trotzdem hätte sie vielleicht aufgeräumt, hätte Paco sie nicht so überfallen. Zu seinem Pech war dieser spezielle Kontrollraum sehr klein und hatte anders als die größeren Räume keinen Kundenbereich mit Sofa zu bieten. Paco hockte unbehaglich auf einem Stuhl an der Tür, gleich neben einem Stapel Bänder und Vinylplatten. Seiner Haltung nach zu schließen, kämpfte er vermutlich gerade mit einem Krampf.
»Also, was meinst du?«, fragte Paco.
»Ich meine, das ist genau die Art von Mist, mit dem man sich nicht in der Postproduktion herumschlagen sollte. Habt ihr die Szenen in einer Waschmaschine aufgenommen? Der Sound ist grässlich. Die Pegel sind viel zu hoch.«
»Ich weiß, ich weiß. Aber was kann man bei diesem Budget schon erwarten?«
»Das wird mich ein paar Wochen kosten.«
»Ich brauche es in fünf Tagen.«
Montserrat warf ihm einen zweifelnden Blick zu. »Unwahrscheinlich. Mario wird dir das Gleiche sagen.«
»Jetzt komm schon, ich frage nicht Mario, ich frage dich.«
»Und ich will hier drin nicht vom Morgengrauen bis Mitternacht eingesperrt sein, weil du vergessen hast, jemanden anzuheuern, der imstande ist, einen Mikrofongalgen richtig zu halten.«
»Tu mir das nicht an. Videocentro erwartet hundert Einheiten von mir, und wir können keine Duplikate herstellen, wenn das Masterband nichts taugt. Bekommst du hierfür keine Überstunden angerechnet? Das muss doch ein dicker Scheck werden.«
»Schön wär’s«, sagte sie.
Es gab natürlich den jährlichen Bonus, dessen Höhe im Ermessen ihres Auftraggebers lag. Die Vollzeitbeschäftigten bekamen ihr aguinaldo, wie es das Gesetz verlangte, aber Freiberufler wie Montserrat konnten auf Weihnachtsgeld nicht zählen. Sie mussten sich auf die Großzügigkeit ihrer Auftraggeber verlassen. Bei Antares bedachte Mario seine Editoren mit einem Truthahn, einer Flasche billigen Whiskeys und einem Bonus. Großzügig fiel der nie aus – er war mal größer und mal kleiner, je nachdem, wie er gerade gelaunt war –, und das, obwohl sie bei Weitem die beste Soundeditorin bei Antares war. Sie war auch die einzige Frau im Team, abgesehen von der Empfangsdame, was vermutlich der Grund war, warum sie keine Vollzeitstelle bekam, nie ein Anrecht auf aguinaldo hatte und stattdessen von Marios sprunghaftem Temperament abhängig war: Die Filmbearbeitung war eine Männerdomäne. In den Studios gab es ein paar Frauen, die die Texte für die Untertitel und die Synchronisation schrieben. Und es gab ein paar Übersetzerinnen, obwohl das zumeist auch Freiberuflerinnen waren, die nur für ein einziges Projekt geheuert wurden. Aber Editorinnen mit Vollzeitstelle? Die waren so selten wie Einhörner.
»Hör mal, ich habe eine Verabredung zum Mittagessen«, sagte Montserrat, zog ihre Lederjacke vom Haken an der Tür und schlüpfte hinein. »Warum redest du nicht mit Mario, und wir warten ab, was er dazu sagt? Ich würde ja wirklich gern helfen, aber er war ziemlich sauer wegen eines unbezahlten Synchronisationsauftrags …«
»Also, Leute, ich bezahle immer, auch wenn ich mal ein paar Tage zu spät dran bin. Sobald ich diese Videos abliefere, bin ich flüssig, ich schwöre es.«
Montserrat wusste nicht, inwieweit das wahr sein mochte. Paco hatte vor einigen Jahren mit einem Plagiat von Der Exorzist einen kleinen Hit gelandet. Mexikanische Horrorfilme waren dieser Tage selten. Vor einigen Jahren hatte Paco vom aufkeimenden Videomarkt profitiert, aber heute lief es für ihn nicht mehr so gut. Vier Jahre zuvor hatte sich René Cardona III am gleichen Konzept versucht und mit Vacaciones de Terror eine Low-Budget-Kopie eines angesagten amerikanischen Horrorfilms produziert. Zwar war Vacaciones nichts weiter als der unverfrorene Versuch, Chucky – Die Mörderpuppe mit Amityville Horror zu vermischen, aber er konnte immerhin mit einem einigermaßen bekannten Star in Form von Pedro Fernández punkten, dessen Gesangskarriere zumindest ein paar Kinosessel hatte füllen können. Vacaciones de Terror und das obligatorische Sequel hatten sich anständig geschlagen, aber der Markt für hiesige Horrorproduktionen war nicht groß genug, um für gleich zwei Filmemacher und ihre angestrebten Gruselfilmproduktionen zu reichen, und Paco hatte keinen Sänger, dessen Namen er auf Plakate setzen konnte.
Nicht dass es derzeit überhaupt einen Markt für eine Produktion mit halbwegs ordentlichem Budget gegeben hätte. Das Beste, was die meisten Leute sich erhoffen konnten, waren Exploitationsfilme wie Lola La Trailera. Paco war vielleicht ein bisschen besser dran als die meisten mexikanischen Filmemacher, weil es ihm gelungen war, ein paar spanische Finanziers für seine Pläne zu gewinnen, weshalb auch der Großteil seiner Produktionen für den europäischen Markt gedacht war. Ein paar Kopien bekam Videocentro, den Rest verkaufte er nach Italien, Deutschland oder sonst wohin, wo ein bisschen Kohle übrig war. Pacos Arbeit war etwas nahrhaftere Kost, als die meisten anderen dieser Exploitationsgeier zu bieten hatten, lieferte aber dennoch wenig Grund zur Freude.
»Montserrat, Schätzchen, komm schon, du weißt, dass du dich auf mich verlassen kannst. Wie wäre es damit: Ich bezahle dir Überstunden. Ich lege noch … wie viel willst du?«, fragte er, griff in seine Tasche und holte ein Portemonnaie hervor.
»Gott, Paco, du musst mich nicht bestechen.«
»Dann machst du es?«
Montserrat arbeitete bereits seit sieben Jahren für Antares. Sie hatte es nie in eines der beiden großen Filmstudios geschafft, aber man musste schon der Sohn von jemandem sein, um an so einem Ort Editor zu werden. Die Jobs wurden wie ein Ritterschlag durch die STPC und die STIC vergeben. Jetzt, da Estudios América vom Markt war, ging es in der Filmindustrie noch chaotischer zu als vorher und der Kampf um Jobs war mörderisch. Alles in allem war Antares gar nicht so schlecht.
Jedenfalls war es für sie bis zum vorigen Jahr nicht so schlecht gewesen, bis die Firma einen neuen Soundeditor angeheuert hatte. Alle liebten junge Leute und verschmähten die alten. Stellenangebote enthielten immer den Passus »35 oder jünger«, manchmal sogar »30 oder jünger«. Samuel, das neueste Teammitglied, war definitiv unter dreißig. Mario hatte ihm einige Aufträge zukommen lassen, zum Teil, weil seine Jugend auch bedeutete, dass er am schlechtesten bezahlt wurde. Durch Samuel sparte Antares Geld. Und die Folge war, dass Montserrat von mehreren Projekten abgezogen worden war. Statt fünf, manchmal sogar sechs Tage pro Woche arbeitete sie nur noch drei, und sie war überzeugt, bis zum Dezember würde Mario sie auf zwei runterdrücken. Vielleicht würden sie am Ende diesen Auftrag Samuel zukommen lassen.
Verdammt, sie musste einfach mehr Geld verdienen. Ihre Schwester hatte sie nicht um Unterstützung gebeten, aber Montserrat wusste, dass sie Probleme hatte. Seit einem halben Jahr arbeitete Araceli nur noch in Teilzeit; die Krebsbehandlung war zu anstrengend, um die übliche Arbeitslast in dem Steuerberatungsbüro weiterhin zu stemmen, in dem sie beschäftigt war. Montserrat bemühte sich, etwas beizusteuern, wann immer sie konnte.
»Komm mit«, grummelte sie und sah zur Uhr. Sie würde sich verspäten, wenn sie sich nicht bald auf den Weg machte.
Paco und Montserrat gingen durch einen langen, mit raumhohen Spiegeln ausgestatteten Korridor zurück zum Empfang. Die Spiegel sollten angeblich als »Wandschmuck« dienen und der Bude ein wenig Klasse verleihen, aber das Ergebnis wirkte weniger elegant als billig. Der Empfangsbereich selbst war der einzige Teil des ganzen Studios, der halbwegs anständig aussah. Statt schäbiger, ausgebesserter Möbel hatte dieser Raum zwei schwarze Ledersofas vorzuweisen, und hinter einem riesigen Empfangstisch hing ein auffälliges Schild, auf dem mit silbernen Buchstaben »ANTARES« stand, komplett großgeschrieben.
Candy saß hinter dem Tisch. Diese Woche hatte sie neongelbe Fingernägel – sie wechselte häufig die Farbe – und lächelte Montserrat fröhlich an. Candida, die sich gern Candy nannte, kümmerte sich um den Empfang und alle möglichen anderen Dinge. Sie war die Person, die stets im Auge hatte, wer zu welcher Zeit den Schneidetisch nutzte. Eigentlich sollte sie keine Termine vergeben, solange Mario sie nicht damit beauftragte, aber Montserrat übersprang bisweilen die Warteschlange.
»Candy, ist Mario schon von dem Geschäftsessen zurück?«, fragte sie in der Hoffnung, dass die Antwort Ja lauten würde, doch die Rezeptionistin schüttelte den Kopf.
»Nope.«
»Mist«, sagte Montserrat. »Okay, wir machen Folgendes: Candy, kannst du mich morgen für ein bisschen Nachtarbeit einschieben? Plan mich für die ganze Woche ein, beginnend um sieben Uhr in meinem üblichen Raum. Ich muss an Pacos neuestem Film arbeiten.«
»Oh, wie heißt er denn?«, fragte Candy und sah Paco interessiert an.
»Mörderisches Wochenende«, sagte Paco stolz.
»Klingt cool. Aber, Montserrat, ich brauche die Kalkulation dazu, das grüne Formular …«
»Trag mich einfach ein, ehe jemand anderes die Zeiten beansprucht«, sagte sie. »Ich zeige es Mario später und fülle dann das grüne Formular aus.«
Ehe Candy noch eine Frage stellen konnte, winkte Montserrat ihr kurz zum Abschied und ging hinaus.
Sie schüttelte den Kopf über die langen Nächte, die ihr bevorstanden. Zu viele Leute dachten, sie könnten bei der Audiobearbeitung der Filmaufnahmen schludern. Am Ende bekamen sie dann Umgebungsgeräusche, abgeschnittene Tonspuren oder eine schlechte Tonqualität. Außerdem erwarteten sie von ihren Soundeditoren allzu häufig wahre Wunder und Montserrat hatte diese Wunder für erbärmlich wenig Geld zu bewerkstelligen. Und dabei gehörte sie nicht einmal zur Belegschaft, um Gottes willen. Mario hielt nichts davon, Leute in Vollzeit einzustellen, weil es billiger und einfacher für ihn war, sie stundenweise zu engagieren. Auf diese Weise konnte er, wenn er sie gerade nicht brauchte, ihre Arbeitsstunden einfach nach Gutdünken reduzieren, so, wie er es kürzlich bei Montserrat getan hatte.
Das Problem war, dass Montserrat gern für Antares arbeitete. Ein Vollzeitjob bei irgendeiner TV-Serie würde ihr ein sicheres Einkommen bescheren, aber sie würde auch mit viel mehr Leuten zusammenarbeiten müssen. Zwei Audioeditoren im selben Raum und dazu möglicherweise ein vorgesetzter Redakteur und ein Regisseur, der sich ständig in die Arbeit einmischte. Sie kannte jemanden, der ins Tontechnikerfach gewechselt hatte, aber sie verschmähte Filmsets mit all den Technikern und Schauspielern. Kleine Produktionen, Low-Budget-Filme, die sagten ihr zu, weil sie dann häufig allein arbeiten konnte. Sie hatte keinen Bedarf an einem riesigen Team von ADR-Experten, Geräuschemachern und Music Supervisors, die ihr die Luft zum Atmen raubten. Sie wollte sich nicht mit Menschen herumschlagen, auch wenn sie manchmal befürchtete, sie würde irgendwann unter Vitaminmangel leiden, weil sie sämtliche Tageslichtstunden in geschlossenen Räumen verbrachte. Außerdem hatte sie angefangen, mit den Charakteren auf der Leinwand zu reden, so wie ein Kollege, den sie kannte.
Montserrat fragte sich, ob sie nicht einfach mal am Set von Enigma vorbeischauen sollte. Cornelia könnte sie ihren Kontaktpersonen vorstellen und vielleicht ergab sich auch etwas durch Cornelias TV-Sendung. Der Gedanke an einen Schreibtischjob war ihr verhasst, aber vielleicht fand sie ja eine Arbeit auf freiberuflicher Basis, die sie nebenher machen könnte, um ihren Lohn aufzustocken. Recherche. Verwaltungsarbeit. Irgendetwas anderes als Audio-Editing, weil das einfach zu unsicher war: stornierte Aufträge, Klienten, die es sich anders überlegten, oder Komponisten, die ihre Filmmusik zu spät ablieferten, was so viel hieß wie hetzen, hetzen, hetzen.
Außerdem interessierte sich so oder so niemand für den Ton. Der fiel den Leuten nur auf, wenn man Mist gebaut hatte, aber nicht, wenn alles gut lief. Es war ein undankbarer Job, der sie bisweilen zwang, auf einem der Sofas bei Antares drei Stunden zu schlafen, damit sie die Nacht durcharbeiten konnte.
Montserrat schaffte es rechtzeitig zum Restaurant, setzte sich in eine Nische und bestellte Kaffee und ein Stück Torte. Tristán tauchte zwanzig Minuten später auf. Sein Mantel war pflaumenblau, hatte große Knöpfe und einen breiten Gürtel.
Sein Haar sah ein wenig zerzaust aus, und er trug eine Sonnenbrille, die er mit geübtem theatralischem Schwung abnahm, als er sich an den Tisch setzte.
»Tja! An meinem üblichen Zeitungsstand hatten sie keine Benson and Hedges, also musste ich ein bisschen herumlaufen.«
»Ich dachte, du wärst so ein Snob, der nur Importzigaretten kauft.«
»Ich versuche, diesen Monat ein bisschen Geld zu sparen. Dunhill stehen für die nächsten paar Wochen nicht zur Debatte«, erklärte er und holte Feuerzeug und eine Zigarette hervor. »Wartest du schon lange?«
»Ja«, sagte sie. »Du solltest nicht rauchen.«
»Das hält mich schlank, und ich brauche wenigstens ein Laster.«
»Mag sein, aber du sitzt in einem Nichtraucherbereich«, sagte sie und zeigte auf das Schild hinter ihm.
Tristán sah sich um und seufzte. »Und warum hast du gerade diesen Platz für uns ausgewählt?«
»Weil es im Raucherbereich voll ist und mir gesagt wurde, dass wir da auf keinen Fall noch mit reinkönnen.«
»Vielleicht kann ich sie bitten, uns umzusetzen«, sagte er und hob die Hand, um sich die Aufmerksamkeit einer Kellnerin zu sichern.
»Bitte nicht«, erwiderte sie und stocherte in dem Stück Torte herum, mit dem sie beinahe fertig war. Sie hatte damit gerechnet, dass er sich verspäten würde, und war klug genug gewesen, rasch zu bestellen.
»Hallo?«, säuselte er.
Eine Kellnerin drehte sich um, und er bedachte sie mit seinem sorglosen Sechzig-Watt-Lächeln, das nur aus Zähnen bestand. Dieses Lächeln brachte es auf eine Erfolgsquote von siebzig Prozent. Die Kellnerin kam mit einem Notizblock in der Hand näher.
»Möchten Sie bestellen?«
»Ich hätte gern eine Diätcola. Und könnten Sie uns in den Raucherbereich umsetzen?«
»Der ist voll.«
»Wenn ein Tisch frei wird, könnten wir dann umziehen? Wie ist Ihr Name – Mari? Das ist ein schöner Name. Mari, wäre es vielleicht möglich, dass Sie für uns nach einem Tisch Ausschau halten?«, bat er. »Für mich. Als besondere Gefälligkeit. Bitte.«
Er sprach in dieser tiefen, samtenen Tonlage, die er stets nutzte, wenn er etwas wollte. Die Stimme hatte eine Erfolgsquote von neunzig Prozent. Die Kellnerin lächelte ihn an. Montserrat konnte ihr am Gesicht ablesen, dass sie überlegte, ob sie Tristán von irgendwoher kannte. Sie hatte diese neugierige Miene, die die Leute in seiner Gegenwart so oft aufsetzten. Vielleicht würde sie sich später erinnern.
»Also gut«, sagte die Kellnerin errötend.
»Danke, Mari«, entgegnete er.
Tristán Abascal, geborener Tristán Said Abaid, war in Montserrats Alter. Achtunddreißig. Sie waren in demselben Gebäude groß geworden und sie beide hatten Filme geliebt. Aber damit endeten die Gemeinsamkeiten auch schon. Tristán war groß und attraktiv. Nicht einmal jahrelanger Drogenmissbrauch und dieser Verkehrsunfall hatten sein Aussehen ruinieren können. Er war nicht mehr dieser wahnsinnig toll aussehende Junge von früher, aber er machte immer noch eine ziemlich gute Figur. Und obwohl es zehn Jahre her war, seit er in einer Seifenoper aufgetreten war, gab es nach wie vor Leute, die ihn wiedererkannten.
Montserrat hingegen war klein und unscheinbar. Als sie Kinder gewesen waren, hatten die anderen sich über ihr Hinken lustig gemacht. Nach drei Operationen ging es ihrem Fuß deutlich besser, aber er schmerzte, wenn es kalt wurde. Und nun, da sich erste silbrige Strähnen durch ihr Haar zogen, wirkte ihr unscheinbares Gesicht noch unscheinbarer.
»Also, die gute Nachricht ist, dass ich eine passende Bleibe gefunden habe. Sie ist in Polanco und hat genau die richtige Größe«, sagte er mit einem selbstgefälligen Grinsen und wirbelte mit einer Hand seine Sonnenbrille herum. Die Ärzte hatten an seinem linken Auge gute Arbeit geleistet; unter dem Auge war eine blasse Narbe zu sehen, und es war immer noch ein wenig kleiner als das rechte, wirkte ein bisschen schief, außerdem war die Pupille stets etwas stärker geweitet als die andere. Das gab seinem Gesicht einen vage unausgeglichenen Ausdruck, während es zuvor nahezu perfekt symmetrisch gewesen war. Es war nicht schlimm, aber er war sich dessen auch nach vielen Jahren noch sehr bewusst. Er trug das ganze Jahr über eine Sonnenbrille, wohin er auch ging. In den ersten paar Monaten nach dem Unfall hatte er sie sogar in Innenräumen aufgesetzt.
»Wie viel kostet sie?«
Er nannte ihr eine Zahl, und als sie eine Braue hochzog, verwandelte sich das Grinsen in ein breites Lächeln. »Kostspielig, ich weiß. Darum habe ich die Dunhills aufgegeben. Ich brauche jeden Synchronauftrag, den ich kriegen kann. Die Auftragslage ist in letzter Zeit ein bisschen dünner geworden.«
»Ach, bei dir auch? Wir sollten uns ein Lotterielos kaufen.«
»Liquiditätsprobleme?«
»Keine schlimmen. Noch nicht. Aber ich würde Araceli gern helfen, ihre Kosten zu tragen.«
»Wie geht es ihr?«
»Gut. Ich meine, so gut, wie es die Umstände erlauben. Wir hoffen, der Krebs geht in Remission, aber trotz all der Behandlungen und limpias ändert sich nichts.«
»Ich sollte irgendwann mal vorbeischauen und Hallo sagen.«
»Das würde sie sehr freuen.«
Die Kellnerin kam mit seiner Diätcola und einem Glas voller Eis zurück. Tristán bedachte sie mit einem Lächeln, während sie die Cola einschenkte. Er bestellte ein Monte-Cristo-Sandwich und Pommes frites. Sie wusste, dass er in seinem Essen herumstochern und wenig zu sich nehmen würde.
»Ich muss bis zum Dreißigsten raus, und ich habe ein Umzugsunternehmen beauftragt und alles, aber die Schlüssel werde ich schon vorher bekommen. Ich dachte, wir könnten es uns vor dem Umzug ansehen. Wie wäre es mit Freitag?«
»Ich werde vermutlich die ganze Woche wegen eines Eilauftrags nicht von der Arbeit loskommen.«
»Wenn das so ist, kann ich mir dann deinen Wagen leihen? Ich wollte ein paar Kleinigkeiten selbst rüberbringen.«
Montserrat hatte drei Leidenschaften: erstens Horrorfilme, zweitens ihr Wagen. Und an dritter Stelle Tristán.
Sie hatte ihn immer geliebt, schon, als er einfach nur »El Norteñito« gewesen war, das Nordlicht, ein vage verwirrter Knabe aus Matamoros, der einen komischen Akzent hatte. Sie war in Tristáns Küche aufgewachsen und hatte dort gelernt, Fleischbällchen zuzubereiten, wie seine libanesische Mutter es tat. Montserrats Eltern waren geschieden, ihre Mutter selten zu Hause, und ihre Schwester Araceli war eine schreckliche Köchin, also zog sie es vor, bei ihm zu essen.
Sie teilten die überschwängliche Zuneigung von Kindern, die mit offen stehenden Mündern dicht vor dem Fernseher saßen und zusahen, wie Monster Jungfrauen verschleppten. Nachdem seine Zahnspange entfernt worden war, verwandelte sich Tristán in einen süßen Teenager, in den sämtliche Mädchen verschossen waren; auch sie war verknallt in ihn. Etwa zu jener Zeit fing Tristán an, Schauspiel- und Gesangsunterricht zu nehmen. Im Singen war er nicht gut, aber er bekam einen Job als Model für fotonovelas, und er war Statist in mehreren Filmen, die man getrost vergessen konnte, ehe er Rollen bei Televisa ergatterte.
Um 1977 herum, als der Zweiundzwanzigjährige sein Debüt in einer Seifenoper gab, hatte er das kantige gute Aussehen eines Stars, und Montserrats Liebe wurde zu einer stürmischen Leidenschaft, die irgendwann durch seine totale Gleichgültigkeit gedämpft wurde. Sie liebte ihn immer noch, aber diese Liebe war nicht mehr mit der romantischen Sehnsucht jüngerer Jahre verbunden. Inzwischen hatte sie sich sogar eingestanden, dass Tristán bisweilen ein Stück Scheiße sein konnte und mehr als nur ein bisschen kaputt war. Er konnte ein furchtbarer, eigennütziger Scheißkerl sein und seine diversen persönlichen Probleme strapazierten ihre Freundschaft.
Und trotzdem liebte sie ihn.
Wie dem auch sei, trotz ihrer tiefen Zuneigung würde sie ihm nicht ihren Wagen überlassen. Sie straffte sich augenblicklich und stellte ihre Tasse ab.
»Das ist alles, was du wolltest? Dir meinen Wagen leihen?«
»Komm schon, es ist eine Weile her, seit ich dich das letzte Mal gesehen habe. Ich wollte Hallo sagen.«
»Und dir dabei praktischerweise auch gleich meinen Wagen leihen.«
»Es wäre nur eine kurze Fahrt.«
»Nein. Du wirst deine Matratze nicht auf dem Dach meines Autos herumkutschieren, nur um beim Umzug ein bisschen Geld zu sparen.«
Er lachte. »Ich werde meine Matratze nicht auf das Dach deines Wagens schnüren. Komm schon, Momo.«
»Nein. Das war’s, nein. Nimm ein Taxi. Oder lass dich von Yolanda fahren.«
Tristán hatte die Lippen fest zusammengepresst und starrte sie an. Aber sie würde ihm den Wagen nicht geben. Sie hatte ein Auto haben wollen, wie es Simon Templar im Fernsehen gehabt hatte, als sie noch Kinder gewesen waren, einen Volvo P1800. Da sie damals keinen hatte auftreiben können, begnügte sie sich mit einem Volkswagen, der traumhaft lief. Er war weiß, makellos und wurde stets sicher und geschützt auf einem Garagenstellplatz geparkt, den sie gemietet hatte, gerade einen Block von ihrer Wohnung entfernt. Das war zwar nicht der Wagen eines Fernsehhelden, aber es waren ihre kostbaren vier Räder, und sie wollte nicht, dass Tristán das Auto mit seinen Zigaretten verpestete, ob sie nun importiert waren oder nicht.
Die Kellnerin kam und sagte ihnen, sie könne sie jetzt im Raucherbereich unterbringen. Montserrat nahm ihre Tasse Kaffee und er schnappte sich seine Cola. Als sie sich wieder setzten, spielte Tristán erneut mit seiner Zigarettenschachtel. Montserrat streckte eine Hand aus und legte sie auf seine. »Ich würde mich freuen, wenn du aufhören würdest zu rauchen.«
»Ich habe dir doch gesagt, das hält mich schlank.«
»Es ist nicht gut für deine Gesundheit, und denk mal an deine Zähne.«
»Deshalb habe ich Veneers.«
»Tristán.«
»Wir haben uns umgesetzt, damit ich rauchen kann.«
»Wir haben uns umgesetzt, weil du ein sturer Arsch bist«, konterte sie und fauchte ihn dabei fast an.
»Mmm«, machte er, als er die Zigarette anzündete und einen Zug tat. »Yolanda und ich haben uns getrennt, also wird sie mich nirgendwohin fahren.«
Das erschreckte sie. Normalerweise rief Tristán Montserrat an, wenn eine seiner Beziehungen zu Ende ging, und benutzte sie als persönlichen Beichtstuhl.
»Was? Wann?«
»Vor zwei Wochen.«
»Du hast am Telefon kein Wort darüber gesagt.«
»Ich hatte noch überlegt, ob ich es wieder in Ordnung bringen kann. Ich meine, wirklich ernsthaft in Ordnung bringen, nicht nur Blumen und eine Schachtel Pralinen. Therapie vielleicht. Paarberatung.«
»Das ist irgendwie …«
»Ziemlich erwachsen?«, fragte er.
»Ungewöhnlich«, entgegnete sie. »Ich dachte, ihr zwei würdet zusammen an diesem Film arbeiten.«
»Wir haben keinen Kontakt mehr. Und es war so oder so unmöglich, Mittel aufzutreiben. Da muss man um Darlehen betteln und vor dem Conaculta auf die Knie fallen«, sagte er.
»Was hast du getan?«
»Warum denkst du immer, ich hätte was getan?«
»Du hast sie nicht betrogen, oder? Sie war nett.«
»Du hast Yolanda nicht einmal gemocht«, murrte er gereizt.
»Na ja, sie war nett für dich«, räumte Montserrat ein. »Sie war ein bisschen versnobt, aber du magst das.«
»Turtelst du immer noch mit dem Tierarzt mit der grottigen Frisur?«, fragte Tristán. Er klang ein bisschen gehässig, aber sie ließ sich nicht ködern.
»Das ist eineinhalb Jahre her. Und ›turteln‹ ist ein großes Wort. Wenn man gerade zweimal mit jemandem ausgegangen ist, kann man kaum behaupten, man ›turtele‹ mit ihm«, sagte sie ruhig. »Außerdem haben wir gerade über dich und Yolanda gesprochen, nicht über mich.«
»Ich habe sie nicht betrogen«, sagte Tristán und klopfte seine Zigarette auf dem kleinen bernsteinfarbenen Aschenbecher ab. »Wenn du es unbedingt wissen willst, sie wollte heiraten und ein Kind bekommen.«
»Todeskuss«, murmelte Montserrat.
»Vielleicht sollte ich endlich ernst machen und die ganze Geschichte mit Hochzeit und Baby durchziehen.«
»Willst du denn ein Baby?«
»Nein! Aber ich wäre gern glücklich, und manchmal denke ich, ich bin zu kaputt, um mit irgendjemandem zurechtzukommen. Ich werde allein sterben, verrunzelt und hässlich, und meine Katze wird die Überreste fressen.«
»Sei nicht albern. Du hast nicht einmal eine Katze. Außerdem bist du allerliebst.«
»Mein Gott, ich mag es, wenn du mich auf diese Art belügst«, sagte er und grinste durch und durch vergnügt. Er war wirklich ein bisschen zu eitel.
»Ich schätze, jetzt wird mir klar, warum du gesagt hast, dass du eine neue Wohnung brauchst. Und ich dachte, es läge daran, dass deine alte Bleibe ein Kakerlakenproblem hatte.«
»Kakerlaken und Silberfischchen. Ich hoffe, das Gute an dieser neuen Wohnung wird sein, dass ich wenigstens der Insektenplage entkommen kann.«
»Silberfischchen futtern gern Stärke und Zellulose, weißt du?«, sagte Montserrat. »Die werden deine Bücher und deine Fotos fressen. Das sind gefräßige kleine Monster.«
»Darum warst du nie bei mir zu Gast. Das war keine schöne Wohnung. Aber billig war sie«, sagte Tristán seufzend.
Sie wusste, dass er sie vor allem deswegen nicht eingeladen hatte, weil er voll und ganz mit Yolanda beschäftigt gewesen war, und er brauchte Montserrat bestimmt nicht, wenn er gerade von der frischen Blüte einer neuen Beziehung gefesselt war. Wenn er jedoch allein war, hing er an ihr wie festgeklebt. Der Gedanke an Tristáns leichtfertige und unbedachte Art, an seine Verhaltensmuster, ärgerte sie. In sechs Monaten würde er wieder jemandem begegnen und Montserrats Telefonnummer vergessen, bis ihn irgendein Übel befiel oder er anfing, sich zu langweilen.
»Ich muss los«, sagte Montserrat mit einem Blick auf ihre Armbanduhr. Sie faltete ihre Serviette zusammen und legte sie neben die leere Kaffeetasse.
»Wo willst du hin?«
»Ich habe dir ja gesagt, ich habe nicht mal eine Stunde Zeit zum Mittagessen, und du bist zu spät gekommen.«
»Du kannst mich doch nicht allein essen lassen.«
»Ich kann«, sagte sie, schnappte sich ihre Jacke und schlüpfte hinein.
»Was ist mit Heiraten? Soll ich bei Yolanda zu Kreuze kriechen?«
Sie zog ein paar Geldscheine hervor und legte sie auf den Tisch. »Weil du Angst davor hast, alt zu werden und allein zu sein?«, fragte sie. Ihre Stimme war rau, obwohl sie nicht verärgert hatte klingen wollen.
»Ja. Was? Starr mich nicht so an, das ist doch ein guter Grund, oder etwa nicht?«
»Nein«, sagte Montserrat und zog den Reißverschluss ihrer Jacke zu. Er ging ihr auf die Nerven mit diesem verlorenen Kleinjungenblick, dieser verletzten Miene mit den weit aufgerissenen Augen. »Vielleicht triffst du ja in dem neuen Haus jemand Interessanten.«
»Setz dich doch und iss mit mir. Ich wollte noch ein bisschen mehr mit dir reden.«
»Vielleicht lernst du ja, pünktlich zu sein«, entgegnete sie und fing sich einen finsteren Blick und ein verstimmtes Schnauben ein.
Sie schob die Hände in die Taschen und verließ das Restaurant. Als sie zu Antares zurückkam, war der Empfangsbereich nicht besetzt, und auf einem Schild stand: »Bitte klingeln!«, was bedeutete, dass Candy losgegangen war, um sich ein Mittagessen zu holen. Montserrat hatte vor, Marios Büro aufzusuchen, um nachzusehen, ob er wieder da war, aber er lauerte ihr in dem kleinen, schrankartigen Kämmerchen auf, das ihnen als Belegschaftsraum diente. In einer Ecke stand ein kümmerlicher, halb vertrockneter Farn, es gab einen Toaster mit gebrochenem Hebel, den man stets festhalten musste, und eine funktionierende Kaffeemaschine, was auch der Grund war, warum Montserrat den Raum aufgesucht hatte. Sie legte ihre Jacke auf eine Stuhllehne und schenkte sich eine Tasse ein.
Ehe sie Gelegenheit bekam, einen Schluck zu trinken, spazierte Mario herein. Er hatte seine Krawatte beim Mittagessen mit Suppe befleckt. »Was glaubst du eigentlich, wer du bist, dass du einfach ohne meine Zustimmung Zeit für Paco reservierst?«, fragte er.
»Ich habe Candy gesagt, wir füllen das grüne Formular aus, wenn du zurück bist.«
»Das ist nicht deine Aufgabe. Wenn ich nicht da bin, sollst du mit Samuel reden und ihm die Planung überlassen.«
»Ich habe Samuel nicht gesehen.«
»Er war hier, im Büro. Hättest du dich mit ihm abgesprochen, dann hättest du vielleicht gesehen, dass Paco eine überfällige offene Rechnung hat …«
»Schön. Ich fülle das grüne Formular aus.«
»Du musst langsam mal aufpassen. Ich kann kein Geschäft führen, wenn du nur Mist baust. Du bist eine anständige Soundeditorin, aber deine Einstellung ist schrecklich«, sagte Mario und schob sich an ihr vorbei zur Kaffeekanne. Sie hätte beinahe ihren Kaffee verschüttet, als er sie dabei mit dem Ellbogen anstieß.
»Was? Wieso ist meine Einstellung schrecklich?«
»Sie ist schrecklich. Alle beschweren sich über dich.«
»Wer?«
»Samuel, beispielsweise. Er hat letzten Monat ein Seminar zur Teamentwicklung organisiert, und du warst die Einzige, die nicht aufgetaucht ist.«
»Du willst mich doch verarschen, oder? Dieses ›Teamentwicklungsseminar‹ bestand darin, Bier aus sehr großen Gläsern zu trinken und Kellnerinnen in den Hintern zu kneifen. Ich muss nicht mit den Jungs ›Sexistischer Höhlenmensch‹ spielen, um meine Arbeit zu machen.«
»Sexistisch«, sagte Mario und verschränkte die Arme vor der Brust. »Als Nächstes wirst du behaupten, dass du schikaniert wirst, weil wir alle Sexisten sind.«
»Ich werde schikaniert. Du gibst Samuel die besten Jobs und drängst mich an den Rand«, sagte Montserrat, wohl wissend, dass sie sich nicht so aufregen und nicht so offen über die Situation sprechen sollte, aber sie konnte es nicht ausstehen, wenn jemand versuchte, sie niederzumachen. »Komm schon, Mario, wir wissen doch beide, dass du mich verarschst.«
»Siehst du? Genau das meine ich. Man kann einfach nicht mit dir reden, weil du gleich in die Luft gehst«, sagte Mario und verdrehte die Augen. »Es ist, als hättest du an zwanzig von dreißig Tagen im Monat deine Periode.«
»Ich bin nicht das Arschloch, das einen Mordsaufstand wegen eines grünen Formulars macht.«
»So, das war’s. Raus mit dir. Du bist für diese Woche nicht eingeplant«, sagte Mario und zeigte mit einem Finger majestätisch auf die Tür.
»Was? Nein! Ich mache doch diesen Job für Paco.«
»Tust du nicht. Du kannst nächste Woche anrufen und fragen, ob es Schichten für dich gibt. Bis dahin bist du für sieben Tage freigestellt, es sei denn, du entschuldigst dich für dein respektloses Verhalten.«
»Ich habe gar nichts getan!«
Wenn Mario schlechter Laune war, wurde er zu einem erbärmlichen Tyrannen. Sie wusste aus Erfahrung, dass die einzig zielführende Antwort war, den Kopf zu senken und halbherzig um Entschuldigung zu bitten. Das war das, was Samuel und die anderen Jungs taten, wenn Mario grollend durch das Gebäude trampelte. Aber wenn es etwas gab, was sie hasste, dann war es, Schikanen einfach zu schlucken. Jede Faser ihres Körpers wehrte sich gegen den Impuls, zu buckeln, obwohl sie an dem Ausdruck in Marios Augen erkennen konnte, dass er genau das von ihr erwartete. Vielleicht hatte die Bemerkung über Sexismus ihn so wütend gemacht. Aber was es auch war, Montserrat wollte verdammt sein, ehe sie sich von diesem Kerl zur Schnecke machen ließ.
»Also? Wirst du dich jetzt entschuldigen?«
Montserrat knallte ihre Tasse auf den klapprigen Kunststofftisch, an dem sie ihre Mahlzeiten einnehmen sollten. »Ich nehme die sieben freien Tage. Vielleicht bist du ja nicht mehr so ein Arsch, wenn ich zurückkomme«, sagte sie, klemmte sich ihre Jacke unter den Arm und stürmte zur Tür hinaus.
Kaum öffnete sie die Eingangstür, wusste sie, sie hatte Mist gebaut. Sie hätte nicht so auf ihn losgehen sollen. Mario hatte sie in die Falle gelockt. Vermutlich juckte es ihn schon länger, einen Grund zu finden, um sie rauszuwerfen, und sie hatte ihm einen auf dem Silbertablett serviert. Aber daran konnte sie an diesem Tag nichts mehr ändern. Wahrscheinlich überlegte Mario es sich in ein paar Stunden wieder anders. Das tat er gewöhnlich. Sollte er sie nicht am nächsten Morgen anrufen … na ja, scheiße gelaufen.
Mit raschen, wütenden Bewegungen zog sie ihre Jacke an und hastete zu ihrem Wagen. Sie musste sich dringend alternative Einkommensquellen suchen, denn dieser Job brachte es nicht mehr.
2
Tristán hatte inzwischen seit zehn Tagen kein Telefon. Einerseits war das nicht überraschend, denn Telmex war nicht gerade schnell, aber in Anbetracht der Miete, die er für die neue Wohnung hinblätterte, hatte er angenommen, die Dinge würden etwas glatter laufen. Der Hausmeister hatte ihm jedenfalls versichert, er bekäme ein neues Zuhause mit allen Schikanen.
Die Wohnung war nicht gerade der Inbegriff von Luxus. Sicher, sie lag gleich neben Polanco, gehörte aber tatsächlich zu Granada. Tristán sagte sich, das sei genauso gut wie Polanco, nur dass es das nicht war, nicht mit all den Lagerhäusern und den heruntergekommenen Gebäuden ganz in der Nähe. Man musste nicht weit laufen, um ins Reich der neuen Sportwagen und der schicken Restaurants zu gelangen, aber es war dennoch ein paar Blocks entfernt von ihm.
Tristáns Gebäude war grün gestrichen und hatte fünf Stockwerke. Es war renoviert worden, um eine hochklassigere Klientel anzulocken als in den letzten paar Jahren; er hatte nicht den geringsten Zweifel, dass in ein, zwei Jahrzehnten Bauunternehmer kämen und die ganze colonia planieren und neu aufbauen würden, sodass sie so elegant und prachtvoll wäre wie Polanco. Aber bisher hatte sich der Erfolg, den sich der Eigentümer des Gebäudes ausgerechnet hatte, nicht eingestellt.
Doch mehr hätte Tristán sich nicht leisten können. Schon jetzt schröpfte die Wohnung sein Portemonnaie. Er brauchte dringend mehr Jobs.
Und darum benötigte er sein Telefon. Er versuchte, eine Werbekampagne an Land zu ziehen. Immer wieder starrte er verzweifelt auf seinen Pager und lief zu der einen Block entfernten Telefonzelle, um Anrufe zu tätigen.
Das einzig Gute an dieser Situation war, dass die Journalisten es etwas schwerer hatten, an ihn heranzukommen. Der Jahrestag von Karinas Tod stand direkt bevor. Zehn Jahre waren vergangen, seit sie gestorben war. Ein Kerl von einem üblen Revolverblatt hatte ihn vor einigen Wochen angerufen und um ein Interview gebeten. Wie die Dinge lagen, würde Tristán nun wenigstens nicht in Versuchung kommen, mit ihm zu reden.
Trotzdem waren zehn Tage absurd. Tristán erreichte das Münztelefon und wählte die Nummer der Hausverwaltung. Weil dies ein besseres Gebäude sein sollte, gab es nicht die sonst übliche portera in Karoschürze mit Lockenwicklern im Haar, bei der sich die Leute über ihre Probleme beschweren konnten. Hier musste man anrufen.
Das Mädchen im Büro der Verwaltung sagte ihm, es wisse von seinen Telefonproblemen, und nein, es gebe noch nichts Neues darüber, wann sie in Ordnung gebracht würden, und außerdem sei daran so oder so Telmex schuld, also solle er vielleicht besser denen auf die Nerven gehen. Als er darauf hinwies, dass man ihm die Wohnung mit einem für drei Monate kostenlosen Telefonanschluss angeboten habe, erwiderte das Mädchen, dass es seinen Vertrag nicht vor sich habe und dass trotzdem Telmex dafür verantwortlich sei, die Leitung freizuschalten. Vor sich hin murrend, legte er auf und machte sich auf den Weg zurück zu seiner Wohnung. Tristán versuchte, weniger zu rauchen, aber der Frust trieb ihn dazu, vor dem Zeitungsstand innezuhalten und sich eine Packung Zigaretten, ein paar Chiclets und eine Ausgabe der Eres zu kaufen. Er wusste, er sollte sich die Zeitschrift nicht holen. Es würde ihn nur aufregen, wenn er die gut aussehenden Gesichter jüngerer Schauspieler sah, die Rollen ergattert hatten, um die er sich bemüht hatte. Und dann bestand noch die Gefahr, dass sie eine Story über Karina brachten. Aber er war an diesem Nachmittag masochistisch aufgelegt.
Karina. Ein Dreivierteljahr lang schaffte er es, sie aus seinem Gedächtnis zu verdrängen, doch irgendwann gab er auf, holte ihre Fotos hervor – eines hatte er in seiner Brieftasche, aber er besaß noch etliche, die er in einem Schuhkarton aufbewahrte – und verbrachte viel zu viele Stunden damit, sie zu betrachten. Als er jünger gewesen war, hatte er geglaubt, er wäre imstande, diesen Unfall hinter sich zu lassen. Nun konnte er sich immerhin eingestehen, dass das womöglich nie geschehen würde, dass der Schmerz tatsächlich sogar zunahm. Dass er mit jedem Jahr peinigender wurde. Die meisten Leute konnten das nicht verstehen. Ob sie es nun offen sagten oder nicht, sie hielten ihn für schwach, albern, für einen Versager.
Vor den Briefkästen blieb Tristán stehen. Er holte mehrere Briefe heraus und stopfte sie in die Gesäßtasche, ehe er seine Zigarette anzündete und in den dritten Stock hinaufstieg. Erst als er seine Wohnung betreten und seine Jacke auf der Couch deponiert hatte, warf er einen Blick auf die Umschläge und erkannte, dass einer der Briefe ein Willkommensgruß der Verwaltungsgesellschaft war und die anderen beiden nicht an ihn, sondern an Abel Urueta, Apartment 4A, adressiert waren.
Das war ein Name, den man dieser Tage nicht mehr zu hören bekam. Montserrat und Tristán hatten mehr als nur einen Nachmittag geschwänzt, um im Palacio Chino oder im Cine Noble mueganos zu essen und sich Horrorfilme anzusehen, darunter auch die alten Streifen von Urueta. Heutzutage zeigte das Cine Noble Pornos, und der Palacio Chino fiel auseinander, sein goldenes Dekor befleckt von Schmutz und Vernachlässigung. In Mexiko gingen nur noch wenige Menschen ins Kino, fast alles wurde direkt für den Heimvideomarkt produziert, es gab lediglich ein cine de ficheras und billige Komödien, in denen Männer Frauentitten betatschten. La Risa en Vacaciones mit den versteckten Kameras und den seichten Witzen repräsentierte, was derzeit als Unterhaltung galt. Und Abel Urueta, der in den 1950ern bei drei großartigen Filmen Regie geführt hatte, war inzwischen nur noch eine Fußnote in der Geschichte der Unterhaltung.
Beim Anblick des Briefes empfand Tristán etwas, was kindlicher Freude ziemlich ähnlich war. Rasch stieg er die Stufen zum vierten Stock empor und klopfte an die Tür von 4A.
Ein distinguiert wirkender Herr mit einem Mittelscheitel im grauen Haar und einem um den Hals geknoteten Taschentuch öffnete die Tür und musterte Tristán neugierig. Er hatte nie ein Foto von Abel Urueta gesehen, war aber überzeugt, den richtigen Mann vor sich zu haben. Er hatte Augenbrauen wie Stanley Kubrick – ein wenig gewölbt über leuchtenden Augen – und dazu ein schiefes Lächeln, das gut zu Luis Buñuel gepasst hätte.
»Herr Urueta? Es tut mir leid, wie es scheint, ist Ihre Post versehentlich bei mir gelandet«, sagte er und hielt ihm die Briefe hin.
»Dieser verdammte Briefträger«, meinte der alte Mann und schüttelte den Kopf. »Ein Mal gebe ich ihm am Briefträger-Tag kein Geld, und schon tut er, als hätte ich ihm ins Gesicht gespuckt. Tut mir leid, aber ich hatte an dem Morgen kein Kleingeld da. Heutzutage wird man von den Leuten mehr oder weniger ausgeraubt. Es war ein Versehen! Und dieser Kerl steckt meine Korrespondenz immer wieder in jeden beliebigen Briefschlitz, der ihm gefällt.«
»Das tut mir leid. Ich kann Ihnen auch künftig alle Briefe vorbeibringen, die in meinem Briefkasten landen.«
»Das ist nett von Ihnen. Sie müssen der neue Mieter in 3C sein. Die Frau, die früher dort gewohnt hat, hatte so einen Kläffer, der ständig in die Lobby gepisst hat. Und gehustet hat sie auch die ganze Zeit.«
»Dann hoffe ich, ich stelle eine Verbesserung dar.«
»Definitiv. Also, ich bin, wie Sie in Anbetracht der Umschläge vermutlich erraten haben, Abel Urueta«, sagte der alte Mann und streckte die Hand aus.
»Tristán Abascal.«
Sie schüttelten einander die Hände und Abel lächelte. Etwas wie Erkenntnis flackerte in seinen Augen auf.
»Ich kenne diesen Namen. Und dieses Gesicht. Sie sind Schauspieler.«
»Heutzutage vor allem Synchronsprecher.«
»Was für eine Verschwendung, mein Junge! Sie haben das Gesicht eines jungen Arturo de Córdova.«
Tristán, der in der Eile auf seine gewohnte Sonnenbrille verzichtet hatte, empfand zugleich Stolz und eine sonderbare Scheu. Er war es gewohnt, bewundert zu werden – zumindest früher; heute gab es weniger Bewunderung und mehr kritische Analysen –, aber dieses Kompliment aus dem Munde eines Mannes, der tatsächlich mit dem echten Arturo Córdova gearbeitet hatte, berührte ihn zutiefst. Selbst auf dem Höhepunkt seines Schaffens hatte Tristán keine Hauptrollen gehabt. Er war ein Seifenoperndarsteller, ein Statist in diversen bedeutungslosen Filmen, und er hatte sogar eine Zahnpastawerbung gedreht. Filme waren eine andere Welt und für ihn waren die Stars des Goldenen Zeitalters in Zelluloid konservierte Götter.
»Danke. Das bedeutet mir viel. Ich muss sagen, Ihre Filme waren toll, Sir. Geflüster im Glashaus war perfekt«, sagte er und hoffte, sich nicht wie ein Volltrottel anzuhören.
»Sie haben ihn gesehen?«
»Meine Freundin Montserrat und ich, oh … wir lieben Ihre Gruselreihe …«
Ein lautes Pfeifen ertönte, und Abel ächzte genervt, aber er winkte Tristán herein. »Das ist das Wasser für meinen Kaffee. Kommen Sie rein.«
Ohne Tristán eine Gelegenheit zu einer Antwort zu geben, ließ Abel die Tür weit offen stehen und eilte in die Küche. Tristán trat ein, die Hände in den Taschen, und sah sich um. Den Grundriss kannte er bereits durch den Makler, der ihm die Baupläne gezeigt hatte. Dieser Wohnungstyp wurde als »Deluxe« bezeichnet. Hier gelangte man durch die Eingangstür direkt ins Wohnzimmer, rechts lagen Speisezimmer und Küche, während links ein Korridor zum Schlafzimmer, einem als Büro bezeichneten Bereich, einem Flurschrank und einem Badezimmer führen sollte. Tristán lebte in der Variante »Standard«, der preiswerteren Version mit einem Schlafzimmer. Er war in Versuchung gewesen, sich eine größere Wohnung zu suchen – die bisherige, die er sich mit Yolanda geteilt hatte, war wunderbar geräumig gewesen –, aber am Ende hatte die Vernunft die Oberhand behalten. Eine kleine Wohnung mit einer moderateren Miete sollte vollkommen reichen.
Yolanda hatte etliche Möbelstücke behalten, was bedeutete, dass Tristáns neues Zuhause spärlich möbliert war. Abel hingegen hatte offenbar sein ganzes Leben in diese Wände gepackt. Tristán bewunderte das robuste Bücherregal, das überquoll vor lauter Lesestoff, und die Topfpflanzen am großen Fenster. Auf einem Tisch stand eine Remington-Schreibmaschine neben einer Lampe im Tiffanystil. Es gab einen Barwagen mit einem Dekanter und Gläsern, einen Plattenspieler und eine Vase in einem prachtvollen Grünton mit einer Blumendekoration im Art-nouveau-Stil. Abel sammelte allem Anschein nach Antiquitäten, und er besaß haufenweise davon. Außerdem hatte er ein ganzes Regalfach voller Quarzkristalle und Steine. Aufgebrochene Geoden präsentierten ihr funkelndes Innenleben. Ein Mineralienliebhaber. Nein, ein Sammelwütiger.
Er stellte sich vor, wie der Regisseur mit einem Barett auf dem Kopf durch die Stadt ging. Stilvoll, das war er. Tristán war nicht zum reichen Kosmopoliten geboren; stattdessen hatte er sich seine Manieren durch Filme und Seifenopern angeeignet. Hier konnte er das Echte sehen, das Mondäne, und er begaffte begeistert seine Umgebung.
»Möchten Sie eine Tasse Kaffee, Herr Abascal?«
»Tristán, bitte«, sagte er und ging in Richtung Esszimmer. Abel war immer noch in der Küche. Er hörte Tassen und Besteck klappern. »Sicher, ich nehme gern eine Tasse.«
»Das ist Kaffee aus Veracruz. Ich füge eine Prise Salz hinzu, damit er nicht so bitter ist, genau wie unsere Mutter es getan hat. Mögen Sie bitteren Kaffee?«
»Ich mag ihn stark. Meine Mutter ist Libanesin. Wir haben ihn mit Kardamom gewürzt. Ich finde, in den meisten Restaurants schmeckt der Kaffee wie verwässerter Dreck, wenn ich ehrlich bin.«
Abel lachte. Er kam mit einem Tablett ins Esszimmer, auf dem zwei Tassen Kaffee standen, und platzierte eine vor Tristán. Neben dem Kaffee befand sich auf dem Tablett auch ein Teller mit Keksen.
»Ist der Name Tristán Abascal echt oder war das die Erfindung eines Mitarbeiters von Televisa? Arturo de Córdova kam als Arturo García zur Welt, aber sie fanden den Namen zu gewöhnlich. Tristán ist ein ziemlich seltener Name.«
»Der Tristán ist echt, meine Mutter hat mich nach einer Oper benannt. Aber der letzte Name ist erfunden. Ich kam als Tristán Said Abaid zur Welt«, sagte er und nippte an seinem Kaffee.
»So was passiert. Im Showbusiness dreht sich alles darum, Menschen umzugestalten. Aber Sie sagten, Sie hätten Geflüster im Glashaus gesehen?«
»Das Opalherz in einer Flasche und Der Fluch des Gehängten auch. Von dem hat Montserrat sogar ein Poster gekauft. Sie wollte schon seit Jahren eines von Jenseits der gelben Tür, aber es scheint keine zu geben, obwohl uns mal jemand erzählt hat, er hätte eines.«
»Jenseits der gelben Tür«, sagte Abel und sah ihn erstaunt an. »Sie müssen sehr an alten Filmen interessiert sein, wenn Ihnen daran etwas liegt. Er ist nicht einmal fertiggestellt worden.«
»Ich weiß. Montserrat ist ein großer Horrorfilmfan. Sie hat mir davon erzählt.«
»Wer ist Montserrat?«
»Entschuldigung. Montserrat Curiel. Sie ist Soundeditorin. Und meine Freundin.«
»Soundeditorin. Für Filme?«
»Für alles, nehme ich an. Der Kaffee ist recht ordentlich«, sagte er und tippte mit dem Zeigefinger an den Rand der Tasse. Er war es nicht, aber Tristán war bemüht, einen guten Eindruck zu hinterlassen. Wenn es um Zigaretten und Getränke ging, war er eigen. Wichtigtuerisch nannte Montserrat das immer. Wählerisch, pflegte er zu antworten.
Abel hielt ihm den Keksteller hin. Er nahm einen und trank einen weiteren Schluck Kaffee. Da saß er nun und sprach mit Abel über Filmstars der Vergangenheit. Der Regisseur kannte sie alle. Tristán hatte diese Art von Gesprächen stets genossen. Die Anekdoten und Geschichten aus vergangenen Jahrzehnten begeisterten ihn. Er liebte es, mit Germán Robles zu schwatzen, der früher Hauptrollen in achtbaren Filmen gespielt hatte und dann Synchronsprecher wurde; heute nahm er jeden Auftrag an, von dem sprechenden Wagen in Knight Rider bis zur Synchronisierung von Filmen. Genauso freute er sich über jede Begegnung mit Joaquín Cordero, der während des Goldenen Zeitalters ebenfalls Hauptrollen in etlichen Filmen und in jüngster Zeit Väter und Onkel in Seifenopern gespielt hatte.
Die älteren Schauspieler waren freundlicher. Sie hatten nichts dagegen, sich hin und wieder mit Tristán zu unterhalten. Tristáns Altersgenossen hingegen betrachteten ihn wie einen Aussätzigen. Besonders schlimm war das in den ersten Jahren nach dem Unfall gewesen. Er nahm an, einstige Größen und Senioren sähen in ihm keine Bedrohung. Er war ein bisschen wie sie. Die Jungen jedoch sorgten sich um ihre Reputation. Wer wollte schon mit einem Mörder fotografiert werden?
Natürlich hatte Tristán nicht wirklich jemanden ermordet. Er war in einen Autounfall verwickelt gewesen. Danach hatte er sein Auge rekonstruieren lassen müssen und war süchtig nach Schmerzmitteln geworden. Aber die Zeitungen hatten es nicht so mit Feinheiten. Wäre er zuvor nett zur Presse gewesen, dann wären sie ihm vielleicht nicht gleich an die Kehle gegangen. Aber er war nicht immer nett gewesen, und sein Image jugendlicher Ausschweifung, das ihm einst kostenlose Publicity eingebracht hatte, trug ihm nach dem Unfall schlimme Schlagzeilen ein: »Gelage des Partymonsters endet mit Tragödie«, hatte eine der besten gelautet. Hinzu kam, dass Karinas Vater Evaristo Junco ein rachsüchtiges Arschloch war und Tristán die Schuld an dem Unfall gab. Und bedauerlicherweise war Evaristo mit vielen wichtigen Leuten befreundet.
Wer von Evaristo aus dem Fernsehen verbannt wurde, bekam keinen Obstkorb mehr zu Weihnachten.
Tristán aß seinen vierten Keks, als sein Pager losging. Er griff nach ihm und warf einen Blick drauf. Für einen Moment dachte er daran, Abel zu fragen, ob er sein Telefon benutzen dürfe, aber das war vielleicht etwas zu viel des Guten, denn die Nachricht war von Yolanda. Sie hatte beharrlich behauptet, er habe eine CD von ihr, und obwohl Tristán sie nicht hatte, ließ sie nicht locker.
Yolanda fügte Tristáns Rechnung immer neue imaginäre Posten hinzu. Plötzlich war er ihr für dies und das etwas schuldig. Und, okay, gut, Tristán verstand, was dahintersteckte, denn sie hatten einen gemeinsamen Urlaub geplant, und mit ihrer Trennung hatten sie den Urlaub das Klo runtergespült.
Alles, was er sich wünschte, war ein bisschen Ruhe und Frieden, und er nahm an, Yolanda wäre mieser Stimmung. Ihre Trennung war eher stürmisch als gütlich verlaufen. Doch so wenig er mit Yolanda sprechen wollte, war er trotzdem in Versuchung. Das würde ihn wenigstens von Karina ablenken. Heute Abend würde er ihr Bild hervorholen und betrachten. Er musste einfach.
Gott! Vielleicht sollte er besser gar kein Telefon haben. Definitiv sollte er während der nächsten drei Jahrzehnte keine romantische Beziehung mehr haben. Die verbockte er mit einem bemerkenswerten Können.
»Ich muss los, tut mir leid«, sagte Tristán und steckte den Pager wieder an seinen Platz.
»Kein Problem. Vielleicht haben Sie ja Lust, zum Abendessen zu kommen und Ihre Editorenfreundin mitzubringen«, schlug Abel vor.
»Ist das Ihr Ernst?«
»Natürlich. Ich bekomme selten Gelegenheit, mit interessanten jungen Leuten zu schwatzen. Wie wäre es mit Samstag? Gegen vier.«
»Sicher«, sagte Tristán wie aus der Pistole geschossen. Er kam sich vor wie ein Kind, das sich den Bauch mit Süßigkeiten vollgeschlagen hatte, geradezu schwindelig vor Freude.
Sie schüttelten einander die Hände. Dann lief Tristán die Treppe wieder hinunter.
Zwei Tage später beschloss er, Montserrat bei der Arbeit aufzusuchen, statt sie anzurufen, weil sein Telefon immer noch nicht angeschlossen war und weil Montserrat, wenn sie gerade eine ihrer Arbeite-mit-doppeltem-Einsatz-Phasen hatte, einfach das Kabel aus der Dose riss und so tat, als existierte die Welt gar nicht.
Er lungerte im Empfangsbereich von Antares herum und blätterte in einer Zeitschrift, als Montserrat sich bequemte herauszukommen. Sie bedachte ihn mit einem Blick aus schmalen Augen und zupfte an den Ärmelaufschlägen ihrer Jacke, wie sie es stets tat, wenn sie mit Ärger rechnete.
»Ich bin nicht hier, um mir Geld zu leihen«, sagte Tristán und reckte theatralisch die Hände in die Luft. »Ich habe gute Neuigkeiten. Lass uns einen Kaffee trinken.«
»Nein. Du wirst nur wieder zwei verdammte Stunden brauchen, um einen Salat zu essen.«
»Wirklich? Wann hast du das letzte Mal etwas gegessen?«
Montserrat antwortete nicht, aber er wusste, dass sie von einem Cracker und zwei Erdnüssen lebte. Sie hatte sich immer schon alles abverlangt. Als sie Kinder gewesen waren, hatte sie trotz eines schlimmen Fußes schneller laufen können als alle anderen Kinder in der Nachbarschaft. Er nahm an, sie versuchte immer noch, allen davonzulaufen. Tristán war bewusst, dass Soundediting eine Männerdomäne war. Montserrat war tough. Das musste sie sein. Dennoch machte er sich Sorgen, wenn er sah, dass sie sich derart unter Druck setzte und sich bis zur Erschöpfung antrieb.
»Ich habe deinen Wagen vor der Tür parken gesehen. Lass uns zum Tortas Locas fahren.«
»Du wirst dich nicht mit dieser Scheißzigarette in meinen Wagen setzen.«
Tristán seufzte. Er hatte sie gerade anzünden wollen. Vorsichtig steckte er sie in die Packung zurück. »Momo, ich kann doch das Fenster öffnen, wenn dich das stört. Oder willst du lieber in dieses fonda um die Ecke? Vergiss es: Lass uns in ein ordentliches Restaurant gehen. Crêpes im Wings. Das ist besser. Crêpes Suzette. Für Tortillas ist es zu spät.«
»Tristán …«
»Ich wette fünfzigtausend Pesos, dass du nicht mal Milch zu Hause hast.«
»Was?«
Er hatte sich an Montserrats Phasen gewöhnt, fast als hätte er sich einen Mondphasenkalender eingeprägt und wüsste, ob gerade abnehmender oder zunehmender Mond war, ohne zum Himmel aufzublicken. Ihm entging nicht, dass dies für sie eine lange Woche gewesen war. Mit ihren Kopfhörern konnte sie jedes Knacken und Knistern wahrnehmen, wusste aber nicht, ob gerade Dienstag oder Freitag war. Weil das nicht wichtig war, wichtig war nur der Sound.
»Lass uns zum Supermarkt fahren.«
»Um Gottes willen«, murrte Montserrat, aber Tristán wusste, dass er in Hinblick auf den Inhalt ihres Kühlschranks vollkommen richtiglag. Montserrat mochte ihm vorwerfen, er verhalte sich kindisch, aber er lief nicht drei Tage am Stück im selben Shirt herum. Sicher, dieses Mal sah ihr Shirt recht sauber aus, aber die Jeans, die sie trug, waren nicht deshalb zerrissen, weil das so modern war. Es sah eher aus, als wäre Montserrat morgens in die ersten Klamotten gesprungen, die ihr in die Hände geraten waren, und dazu gehörten eben auch Jeans mit Löchern.
Zumindest ihr Wagen war picobello. Montserrat mochte vergessen, Alltagsdinge einzukaufen, aber sie dachte immer daran, den viene-viene zu bezahlen, der auf ihren Wagen aufpasste und ihn wusch, während sie arbeitete. Dieser Wagen wurde so gut bewacht wie das Gold von Fort Knox.
Sie fuhren zum nächsten Supermarkt. Tristán dachte sich, er könnte ebenso gut auch gleich seine eigenen Einkäufe erledigen, und Montserrat seufzte unentwegt vor sich hin, während er die Etiketten sämtlicher Gegenstände überprüfte, die in ihrem Einkaufswagen landeten. Er musste wissen, was er sich einverleibte, allzu bewusst waren ihm die Gefahren zusätzlicher Kalorien und schädlicher Zucker. Und außerdem war da die paranoide Stimme in seinem Hinterkopf, die ihm sagte, Schauspieler sollten sich nicht mit vier Tüten Sabritas zum Abendessen an der Kasse erwischen lassen.
»Also, wie lautet die gute Neuigkeit?«, fragte sie, während er eine Packung Cracker begutachtete.
»Ich habe beim Vorsprechen einen glänzenden Eindruck gemacht, aber es ist noch zu früh, um irgendetwas Definitives über zu erwartende Einkünfte zu sagen. Es wäre auch möglich, dass die Leute einfach nur höflich waren und meine Darbietung doch nicht mochten. Aber vergiss es; das, worüber ich wirklich mit dir reden wollte, ist Abel Urueta.«
»Was ist mit ihm?«
»Er wohnt in meinem Haus.«
Montserrat, die den Einkaufswagen schob, blieb abrupt stehen und drehte sich überrascht zu ihm um. »Urueta? Der Regisseur Urueta?«
»Na klar«, sagte Tristán, griff in den Einkaufswagen und studierte das Etikett einer Packung Instantnudeln, die Montserrat hineingeworfen hatte. »Wie kannst du so etwas essen?«
»Mit einer Gabel«, erwiderte sie trocken.
»Nein, ich meine, wie zum Geier kannst du das essen? Scheiße, Montserrat, geh in ein Feinkostgeschäft, hol dir eine Scheibe Schinken und ein bisschen Käse und mach dir was Richtiges zum Mittagessen. Kein Wunder, dass du Zahnfleischbluten hast. Du hast vermutlich ernährungsbedingte Mangelerscheinungen wie ein Seemann im 17. Jahrhundert. Urueta hat dich und mich zum Abendessen eingeladen. Wir sollten eine Flasche Wein kaufen, die wir ihm mitbringen können.«
Sie schüttelte den Kopf und starrte zu ihm empor. Sogar mit ihren Springerstiefeln reichte Montserrat Tristán kaum bis zur Schulter. Eigentlich sah sie aus wie eine kleine wilde Elfe. Im Augenblick wie eine äußerst schockierte wilde Elfe, der vor Ehrfurcht und Verwirrung der Mund offen stehen geblieben war.
»Ist das dein Ernst?«
»Natürlich. Du isst nicht vernünftig. Das habe ich dir schon eine Million Mal gesagt, und dann beklagst du dich, dass der Zahnarzt …«
»Ich meine das mit Urueta. Du hast ihn getroffen und er hat Abendessen vorgeschlagen?«
»Samstag.«
»Wann hast du ihn getroffen? Wie?«
»Vor ein paar Tagen.«
Sie klappte den Mund auf und wieder zu. Und wieder auf.
»Am Samstag kann ich nicht.«
»Warum nicht? Erzähl mir nicht, du musst arbeiten. Es ist der reine Wahnsinn, was du in letzter Zeit zu tun hattest. Du hast den ganzen Juli und den halben August an deinen Monitoren geklebt.«
»Das war einmal. Außerdem, woher willst du das überhaupt wissen? Du warst den ganzen Sommer zu beschäftigt, um dir Hellraiser 3 mit mir anzusehen, und es gab nur diese eine Sondervorführung im Palacio Chino.«
Sein Liebesleben war im Juli und August implodiert, aber es wäre nicht hilfreich, das jetzt zu erwähnen. Montserrat würde vermutlich denken, dass er kindisch sei. Ihre Lösung für Beziehungsprobleme bestand darin, Anrufe nicht zu erwidern.
»Komm schon, du willst doch am Samstag abhängen. Ich weiß, dass du das willst.«
»Ich brauche die Arbeit«, sagte sie mit dem sturen Gesichtsausdruck, den er so gut kannte. »Mario hat mich wie Scheiße behandelt, und ich kann derzeit nichts ablehnen, oder er wird das gegen mich verwenden und behaupten, ich wäre unzuverlässig. Ich habe mich mit ihm angelegt und das lässt er mich nicht vergessen. Jetzt versuche ich, die Dinge wieder ins Lot zu bringen und bis Dezember nett zu sein, oder ich bekomme keinen Bonus.«
»Du legst dich ständig mit ihm an. Ich wette, er weiß nicht mal mehr, warum er sauer auf dich war.«
»Er weiß es.«
»Du kannst dir doch einen Nachmittag freinehmen.«
»Ich habe Araceli versprochen, dass ich sie zum Krankenhaus fahre. Und danach will sie wahrscheinlich auf dem Mercado de Sonora Kerzen kaufen.«
»Das Zeug taugt nichts.«
»Was taugt schon was?«, grummelte Montserrat und versetzte dem Einkaufswagen einen harten Stoß.
Tristán schob schweigend die Hände in die Jeanstaschen und ging neben ihr her. »Sorry«, sagte er dann.
»Du kannst ja nichts dafür.«
»Ich weiß, dass du viel zu tun hast, aber es wäre gut, auch mal eine Pause einzulegen. Wenn du so weitermachst, verheizt du dich.«
»Ich verheize mich nicht.«
Sie bog nach links ab und wäre beinahe mit dem Einkaufswagen einer anderen Frau kollidiert. Die Frau schimpfte lauthals. Montserrat ging schneller. Vor einer großen Pyramide Zucaritas wurde sie langsamer. Tristán griff nach einer der Schachteln und drehte sie in den Händen hin und her. Gott, das war kaum mehr als eine Packung Zucker.
»Vielleicht kann ich die Kerzen ausfallen lassen und Araceli nur zum Krankenhaus fahren«, sagte sie und blickte ihn unsicher an.
»Gut. Und weißt du was, wir müssen nicht bis zum Abendessen bei dem Kerl bleiben, falls es langweilig ist. Wir können auch die Flasche Wein abliefern, in meine Wohnung gehen und bei Benedetti’s bestellen.«
»Du wirfst mir vor, ich würde nur Mist essen, und dann willst du Pizza bestellen?«
»Du isst nur Mist, aber es ist in Ordnung, Mist zu essen, wenn wir es zusammen tun.«
Sie luden noch mehr Lebensmittel in ihren Wagen. Tristán verkniff sich weitere Kommentare zu Montserrats Einkäufen. An der Kasse starrte er die Zeitschriften auf ihrem Ständer an und fragte sich erneut, ob eine davon eine Story über Karina bringen würde. Er wollte es zwar nicht, aber er zählte die Tage bis zum Jahrestag ihres Todes.