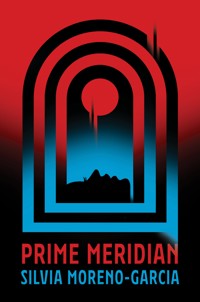9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Die internationale Bestsellerentdeckung »Mexican Gothic« – eine moderne Neuerfindung des Schauerromans, die man gelesen haben muss!
Mexiko, 1950: Ein verstörender Brief führt Noemí in ein gespenstisches Herrenhaus im nebeligen Hochland. Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Ohne zu zögern reist Noemí nach High Place, dem Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemí keine Angst hat – weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemí herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es fast zu spät, um von dort zu entkommen …
»Ein grausam guter Pageturner. 12 von 10 Punkten.« Karla Paul
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 497
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Ein verstörender Brief führt die junge Noemí in ein entlegenes Herrenhaus in den mexikanischen Bergen: Dort lebt ihre frisch vermählte Cousine Catalina, die behauptet, ihr Mann würde sie vergiften. Sofort tauscht Noemí die Cocktailpartys der Hauptstadt ein gegen den Nebel des gespenstischen Hochlands. Denn High Place ist der Sitz der englischen Familie Doyle, in die Catalina überstürzt eingeheiratet hat. Doch das Ansehen der Doyles ist längst verblasst und ihr Herrenhaus zu einem dunklen Ort geworden. Gut, dass Noemí keine Angst hat – weder vor Howard Doyle, dem widerwärtigen Patriarchen der Familie, noch vor Catalinas eitlem Ehemann Virgil. Aber als Noemí herausfindet, was auf High Place vor sich geht, ist es zu spät: Sie ist längst in einem Netz aus Gewalt und Wahnsinn gefangen … Der internationale Sensationsroman »Mexican Gothic« endlich in deutscher Übersetzung!
Autorin
Die in Mexiko geborene Kanadierin Silvia Moreno-Garcia ist als höchst vielseitige Autorin bekannt. Mit jedem ihrer Romane, darunter der Überraschungsbestseller »Mexican Gothic« (zu Deutsch »Der mexikanische Fluch«), erfindet sich Moreno-Garcia neu und haucht Leben in angestaubte Genres – darunter den Schauerroman, den Noir-Krimi und die Science Fiction sowie die Fantasy. Ihr Werk wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter den World Fantasy Award, den Sunburst Award, den Locus Award, den British Fantasy Award etc. Sie lebt in Vancouver, British Columbia, und schreibt als Kolumnistin für die Washington Post.
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Silvia Moreno-Garcia
DER MEXIKANISCHE FLUCH
Roman
Deutsch von Frauke Meier
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Mexican Gothic« bei Del Rey, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2020 by Silvia Moreno-Garcia
This translation is published by arrangement with Del Rey, an imprint of Random House, a division of Penguin Random House LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2022 by Limes in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de nach einer Originalvorlage von Del Rey/Penguin Random House US
Umschlagdesign: Faceout Studio/Tim Green
Umschlagmotive: iStock.com (lambada; CoffeeAndMilk; billnoll); Shutterstock.com (akkara KS; My Portfolio)
BL · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27922-6V002
www.limes-verlag.de
Para mi madre
1
Die Partys im Haus der Tuñóns endeten grundsätzlich spät, und da die Gastgeber besondere Freude an Kostümfesten hatten, war es nichts Ungewöhnliches, die traditionell gekleideten Mexikanerinnen mit Bändern im Haar und ihren folkloristischen Röcken in Begleitung eines Harlekins oder eines Cowboys eintreffen zu sehen. Statt vor dem Haus der Tuñóns zu warten, hatten die Chauffeure ihre eigene Strategie entwickelt. Sie zogen los, um an einem Straßenstand Tacos zu essen oder eines der Dienstmädchen in der Nachbarschaft zu besuchen, ein Werben, so umständlich wie ein viktorianisches Melodram. Einige der Chauffeure scharten sich zusammen, um gemeinsam zu rauchen und einander Geschichten zu erzählen. Ein paar hielten ein Nickerchen. Immerhin wussten sie nur zu gut, dass niemand die Party vor ein Uhr morgens verlassen würde.
Folglich verstieß das Paar, das sich bereits um zehn Uhr abends von der Party entfernte, gegen die Konventionen. Schlimmer jedoch war, dass sich der Fahrer des Mannes entfernt hatte, um sich etwas zum Abendessen zu holen, und unauffindbar war. Der junge Mann sah beinahe verzweifelt aus, während er überlegte, wie es weitergehen sollte. Er hatte einen Pferdekopf aus Pappmaché getragen, eine Entscheidung, die ihm jetzt zu schaffen machte, da er sich mit dieser sperrigen Requisite einen Weg durch die Stadt würden bahnen müssen. Noemí hatte ihn gewarnt, dass sie beabsichtige, den Kostümwettbewerb zu gewinnen, dass sie besser abschneiden wolle als Laura Quezada und ihr Beau; also hatte er einen Riesenaufwand betrieben, der jedoch völlig fehl am Platze gewesen war, da seine Begleiterin das zuvor angekündigte Kostüm gar nicht getragen hatte.
Noemí Taboada hatte verkündet, sie werde eine Jockeymontur samt Reitgerte ausleihen. Das hätte als geschickte und leicht skandalöse Wahl gelten können, zumal sie gehört hatten, Laura wolle sich eine Schlange um den Hals wickeln und als Eva erscheinen. Am Ende hatte Noemí es sich jedoch anders überlegt. Das Jockey-Kostüm war hässlich und kratzte auf der Haut. Also trug sie stattdessen ein grünes Kleid mit applizierten weißen Blumen, hatte sich aber nicht die Mühe gemacht, ihren Begleiter über die Planänderung in Kenntnis zu setzen.
»Was jetzt?«
»Drei Blocks von hier ist eine Hauptstraße. Dort können wir ein Taxi anhalten«, sagte sie zu Hugo. »Sag mal, hast du eine Zigarette?«
»Zigarette? Ich weiß nicht mal, wo ich meine Brieftasche gelassen habe«, antwortete er und strich mit der Hand über seine Jacke. »Außerdem, hast du nicht immer Zigaretten in der Handtasche? Ich würde ja annehmen, dass du zu knauserig bist, dir eigene zu kaufen, wenn ich es nicht besser wüsste.«
»Es macht eben viel mehr Spaß, wenn ein Kavalier einer Dame eine Zigarette anbietet.«
»Ich kann dir heute Abend nicht mal ein Minzbonbon anbieten. Was meinst du, ob ich meine Brieftasche wohl im Haus liegen gelassen habe?«
Sie antwortete nicht. Hugo hatte es nicht leicht mit dem Pferdekopf unterm Arm. Als sie die Allee erreichten, hätte er ihn beinahe fallen lassen. Noemí reckte einen schlanken Arm und winkte ein Taxi heran. Im Wagen war es Hugo dann endlich möglich, den Kopf auf dem Sitz abzulegen.
»Du hättest mir sagen können, dass ich das Ding gar nicht mehr brauche«, murrte er, als ihm das Lächeln auf den Lippen des Fahrers auffiel, von dem er annahm, dass er sich auf seine Kosten amüsierte.
»Du wirkst hinreißend, wenn du verärgert bist«, erwiderte sie, öffnete ihre Handtasche und nahm die Zigaretten heraus.
Hugo sah aus wie der junge Pedro Infante, was einen großen Teil seines Reizes ausmachte. Was den Rest betraf – Persönlichkeit, sozialer Status und Intelligenz –, hatte Noemí sich nicht die Zeit genommen, allzu viel darüber nachzudenken. Wenn sie etwas wollte, dann wollte sie es, und neuerdings wollte sie Hugo, auch wenn sie ihn nun, da sie seine Aufmerksamkeit gewonnen hatte, vermutlich bald fallen lassen würde.
Als sie ihr Haus erreicht hatten, griff Hugo nach ihrer Hand.
»Gib mir einen Gutenachtkuss.«
»Ich muss mich beeilen, aber du kannst trotzdem ein bisschen von meinem Lippenstift haben«, erwiderte sie, nahm die Zigarette und steckte sie ihm in den Mund.
Stirnrunzelnd beugte sich Hugo zum Fenster hinaus, während Noemí nach Hause eilte, den Innenhof durchquerte und sich direkt zum Büro ihres Vaters begab. Wie der Rest des Hauses war auch das Büro in einem modernen Stil gehalten, der wie ein Widerhall des Umstands wirkte, dass der Reichtum des Eigentümers noch recht neu war. Noemís Vater war nie wirklich arm gewesen, doch er hatte aus einer kleinen Färberei eine Goldgrube gemacht. Er wusste, was ihm gefiel, und scheute sich nicht, es zu zeigen: kühne Farben und klare Linien. Die Polster seiner Sessel waren leuchtend rot, und üppig wuchernde Pflanzen bereicherten jeden Raum um einen kräftigen Spritzer Grün.
Die Bürotür stand offen, und Noemí machte sich nicht die Mühe anzuklopfen, sondern trat forsch-fröhlich ein. Ihre hohen Absätze klapperten vernehmlich über den Hartholzboden. Mit den Fingerspitzen strich sie über eine der Orchideen in ihrem Haar, ehe sie sich mit einem lauten Seufzer in den Sessel vor dem Schreibtisch ihres Vaters setzte und die kleine Handtasche auf den Boden warf. Sie wusste auch, was ihr gefiel, und dazu gehörte nicht, frühzeitig nach Hause gerufen zu werden.
Ihr Vater hatte sie hereingewinkt – das Klappern der Absätze hatte ihre Ankunft mindestens so deutlich kundgetan, wie es ein Gruß vermocht hätte –, sie aber nicht angesehen, als wäre er zu sehr damit beschäftigt, ein Dokument zu begutachten.
»Ich fasse es nicht, dass du mich bei den Tuñóns angerufen hast«, sagte sie und zupfte an ihren weißen Handschuhen. »Ich weiß, du warst nicht glücklich darüber, dass Hugo …«
»Hier geht es nicht um Hugo«, fiel ihr Vater ihr ins Wort.
Einen der Handschuhe in der rechten Hand, runzelte Noemí die Stirn. »Nicht?«
Sie hatte um Erlaubnis gebeten, zu der Party zu gehen, aber sie hatte verschwiegen, dass Hugo Duarte sie begleiten würde, und sie wusste, was ihr Vater von ihm hielt. Vater sorgte sich, dass Hugo ihr einen Heiratsantrag machen und sie zustimmen würde. Noemí hatte nicht die Absicht, Hugo zu ehelichen, und das hatte sie ihren Eltern auch gesagt, aber Vater glaubte ihr nicht.
Wie es sich für eine Dame der Gesellschaft gehörte, kaufte Noemí im Palacio de Hierro ein, schminkte ihre Lippen mit Lippenstiften von Elizabeth Arden, besaß einige sehr kostbare Pelze, sprach Englisch mit bemerkenswerter Leichtigkeit, ein Verdienst der Nonnen an der Montserrat – einer Privatschule, selbstverständlich –, und man erwartete von ihr, dass sie ihre Zeit der Muße und der Jagd nach einem Gatten widmete. Folglich musste in den Augen ihres Vaters jede vergnügliche Aktivität auch der Beschaffung eines Gemahls dienen. Was letztlich bedeutete, dass sie sich nicht um des Amüsements willen zu amüsieren hatte, sondern ausschließlich, um einen Ehemann zu erbeuten. Und das wäre auch gut und schön gewesen, würde Vater Hugo mögen, aber der war nur ein Nachwuchsarchitekt, und von Noemí wurde erwartet, nach Höherem zu streben.
»Nein, auch wenn wir darüber später noch werden sprechen müssen«, sagte er zu Noemís Verwirrung.
Sie hatten sich in einem langsamen Tanz gewiegt, als ein Diener ihr auf die Schulter geklopft und sie gefragt hatte, ob sie einen Anruf von Mr. Taboada im Atelier entgegennehmen würde, was ihr den ganzen Abend verdorben hatte. Sie hatte angenommen, Vater hätte herausgefunden, dass sie mit Hugo zur Party gegangen war, und hätte sie aus seinen Armen reißen wollen, um ihr einen Verweis zu erteilen. Wenn es nicht darum ging, was hatte der ganze Wirbel dann zu bedeuten?
»Aber nichts Schlimmes, oder?«, fragte sie in verändertem Ton. Wenn sie wütend war, klang ihre Stimme höher, mädchenhafter, nicht so wohl moduliert wie das Timbre, das sie in jüngsten Jahren perfektioniert hatte.
»Ich weiß es nicht. Du darfst niemandem erzählen, was ich dir gleich sagen werde. Nicht deiner Mutter, nicht deinem Bruder und auch keinem deiner Freunde, hast du verstanden?«, sagte ihr Vater und starrte Noemí an, bis sie nickte.
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück, presste die Hände vor dem Gesicht zusammen und nickte seinerseits.
»Vor einigen Wochen erhielt ich einen Brief von deiner Cousine Catalina. Darin stellte sie wilde Behauptungen über ihren Ehemann auf. In dem Bemühen, zum Grund der Dinge vorzudringen, habe ich Virgil geschrieben. Virgil antwortete mir, Catalinas Verhalten habe sonderbar und verzweifelt gewirkt, er glaube aber, es ginge ihr schon wieder besser. Wir schrieben hin und her, wobei ich darauf bestanden habe, dass es das Beste sei, Catalina, wenn sie wirklich so verzweifelt wäre, wie es den Anschein hatte, nach Mexico City zu bringen, damit sie mit einem Fachmann reden könne. Er widersprach und schrieb, das sei nicht nötig.«
Noemí zog den anderen Handschuh aus und legte ihn in den Schoß.
»Wir sind in einer Sackgasse gelandet. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er nachgibt, aber heute Abend habe ich ein Telegramm erhalten. Hier, du kannst es lesen.«
Ihr Vater griff nach einem Stück Papier auf seinem Schreibtisch und reichte es ihr. Es war eine Einladung an sie, ihre Cousine Catalina zu besuchen. Der Zug fuhr nicht jeden Tag in ihre Stadt, aber er fuhr montags, und zu einer bestimmten Zeit würde ein Fahrer zum Bahnhof geschickt werden, um sie abzuholen.
»Ich möchte, dass du hinfährst, Noemí. Virgil sagt, sie hätte nach dir gefragt. Außerdem glaube ich, das ist eine Angelegenheit, um die sich idealerweise eine Frau kümmern sollte. Es mag sich herausstellen, dass nichts weiter dahintersteckt als Übertreibungen und Eheprobleme. Man kann ja wohl kaum behaupten, dass deine Cousine nicht zu einer gewissen Melodramatik neigen würde. Es könnte also einfach eine Masche sein, um Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.«
»Wenn das so ist, was gehen uns Catalinas Eheprobleme oder ihre Melodramatik an?«, fragte Noemí, wenngleich sie es für unfair hielt, dass ihr Vater Catalina überhaupt als melodramatisch bezeichnete. Sie hatte als junges Mädchen beide Eltern verloren. Infolgedessen sollte man doch wohl mit einigen Turbulenzen und Gefühlswirren rechnen.
»Catalinas Brief war sehr eigentümlich. Sie hat behauptet, ihr Mann würde sie vergiften, sie schrieb, sie hätte Visionen gehabt. Ich behaupte nicht, ein Fachmann für Medizin zu sein, aber das hat gereicht, dass ich mich in der Stadt nach guten Psychiatern erkundigt habe.«
»Hast du den Brief noch?«
»Ja. Hier ist er.«
Noemí hatte Schwierigkeiten, die Worte zu entziffern, und umso mehr, den Sätzen einen Sinn abzuringen. Die Handschrift wirkte unstet und schlampig.
… er versucht, mich zu vergiften. Dieses Haus ist krank vor Fäulnis, stinkt nach Verfall, fließt über vor bösen und grausamen Empfindungen. Ich habe mich bemüht, einen klaren Kopf zu behalten, diese Verderbtheit abzuwehren, aber ich kann es nicht, und ich ertappe mich dabei, den Überblick zu verlieren, über die Zeit wie über meine Gedanken. Bitte. Bitte. Sie sind grausam und herzlos, und sie lassen mich nicht gehen. Ich sperre meine Tür ab, und trotzdem kommen sie; sie flüstern in der Nacht, und ich habe solche Angst vor diesen ruhelosen Toten, diesen Geistern, fleischlosen Dingern. Die Schlange frisst ihren Schwanz, der widerliche Boden unter unseren Füßen, die falschen Gesichter und falschen Zungen, das Netz, über das die Spinne kriecht und die Fäden vibrieren lässt. Ich bin Catalina, Catalina Taboada. CATALINA. Cata, Cata, komm raus zum Spielen. Ich vermisse Noemí. Ich bete, dass ich euch wiedersehe, aber du musst zu mir kommen, Noemí. Du musst mich retten. Ich kann mich nicht selbst retten, wie sehr ich es mir auch wünsche, ich bin gebunden, Stränge wie aus Eisen winden sich durch meinen Geist und über meine Haut, und es ist da. In den Wänden. Es gibt mich nicht frei, also muss ich dich bitten, mich zu befreien, mich loszuschneiden, sie aufzuhalten. Um Gottes willen …
Beeil dich,Catalina
An den Rand des Briefes hatte ihre Cousine weitere Worte, Zahlen und Kreise gekritzelt. Es war bestürzend.
Wann hatte Noemí das letzte Mal mit Catalina gesprochen? Das musste bereits über sechs Monate her sein, vielleicht sogar schon fast ein Jahr. Das Paar hatte die Flitterwochen in Pachuca verbracht, und Catalina hatte angerufen und ihr ein paar Postkarten geschickt, aber sonst war da nicht viel gewesen, auch wenn nach wie vor Telegramme mit Geburtstagsglückwünschen für die Verwandten zur passenden Zeit eintrafen. Es musste auch einen Weihnachtsbrief gegeben haben, ein Weihnachtsgeschenk. Oder hatte Virgil den Weihnachtsbrief geschrieben? Jedenfalls war er ziemlich nichtssagend gewesen.
Sie alle hatten angenommen, Catalina würde ihr Leben als frisch verheiratete Frau genießen und hätte keine Lust, viel zu schreiben. Da war auch irgendetwas wegen des neuen Zuhauses gewesen, dort gab es kein Telefon, was auf dem Land nicht ungewöhnlich war, und Catalina schrieb nun mal nicht gern. Noemí, die mit ihren gesellschaftlichen Verpflichtungen und dem Studium ausgelastet genug war, hatte angenommen, Catalina und ihr Ehemann würden irgendwann nach Mexico City reisen, um sie zu besuchen.
Der Brief, den sie nun in der Hand hielt, war folglich in jeder Hinsicht, die ihr nur einfallen wollte, uncharakteristisch. Er war handgeschrieben, dabei zog Catalina die Schreibmaschine vor; er war weitschweifig, obwohl Catalina sich auf Papier kurz und bündig zu fassen pflegte.
»Das ist sehr seltsam«, räumte Noemí ein. Sie hatte sich innerlich darauf vorbereitet, ihrem Vater zu erklären, dass er übertrieb oder diesen Vorfall nur dazu benutzen wollte, um sie von Hugo Duarte abzulenken, aber das schien nicht der Fall zu sein.
»Gelinde gesagt. Wenn du das liest, dann kannst du dir vermutlich vorstellen, warum ich an Virgil geschrieben und eine Erklärung verlangt habe. Und warum ich so fassungslos war, als er mir sogleich vorwarf, ich sei ein Ärgernis.«
»Was genau hast du ihm geschrieben?«, fragte Noemí und fürchtete, ihr Vater könne grob geworden sein. Er war ein ernster Mann und erwischte die Leute leicht durch seine unbeabsichtigte Schroffheit auf dem falschen Fuß.
»Du musst verstehen, dass es mir keine Freude macht, eine meiner Nichten an einem Ort wie La Castañeda zu sehen …«
»Hast du das geschrieben? Dass du sie in die Irrenanstalt stecken willst?«
»Ich erwähnte, dass das eine Möglichkeit wäre«, entgegnete ihr Vater und streckte die Hand aus. Noemí gab ihm den Brief zurück. »Das ist nicht der einzige Ort, aber dort kenne ich ein paar Leute. Sie könnte professionelle Hilfe benötigen, und die wird sie auf dem Land nicht finden. Und ich fürchte, wir sind die Einzigen, die imstande sind, dafür zu sorgen, dass zu ihrem Besten entschieden wird.«
»Du traust Virgil nicht.«
Ihr Vater lachte heiser. »Deine Cousine hat überstürzt geheiratet, Noemí, und, so könnte man sagen, gedankenlos. Nun bin ich der Erste, der zugibt, dass Virgil Doyle einen charmanten Eindruck macht, aber wer weiß, ob er auch verlässlich ist.«
Ganz unrecht hatte er nicht. Catalinas Verlobungszeit war beinahe skandalös kurz gewesen, und sie hatten kaum Gelegenheit bekommen, mit dem Bräutigam zu sprechen. Noemí erinnerte sich nicht einmal, wie sich die beiden kennengelernt hatten, nur, dass Catalina schon nach wenigen Wochen Hochzeitseinladungen verschickt hatte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Noemí nicht einmal gewusst, dass ihre Cousine einen Liebsten hatte. Wäre sie nicht eingeladen worden, als Trauzeugin vor dem Zivilrichter zu erscheinen, dann hätte sie womöglich überhaupt nicht erfahren, dass Catalina geheiratet hatte.
Diese Geheimnistuerei und die Eile waren bei Noemís Vater nicht gut angekommen. Er hatte ein Hochzeitsessen für das Paar ausgerichtet, aber Noemí wusste, dass Catalinas Verhalten ihn gekränkt hatte. Das war ein weiterer Grund dafür gewesen, dass sich Noemí über Catalinas mangelnde Mitteilungsfreude gegenüber der Familie keine Sorgen gemacht hatte. Ihre Beziehung war derzeit etwas frostig. Sie hatte angenommen, dass in ein paar Monaten Tauwetter einsetzen und Catalina vielleicht im November nach Mexico City kommen würde, um Weihnachtsgeschenke zu kaufen, und alles wäre wieder gut. Zeit, das war nur eine Frage der Zeit.
»Du musst wohl glauben, dass sie die Wahrheit sagt und er sie misshandelt«, resümierte Noemí und versuchte, sich ihren Eindruck von dem Bräutigam ins Gedächtnis zu rufen. Attraktiv und höflich, das waren die beiden Attribute, die ihr in den Sinn kamen, aber sie hatten kaum mehr als ein paar Sätze gewechselt.
»Sie behauptet in diesem Brief nicht nur, dass er sie vergiftet, sondern auch, dass Geister durch Wände gehen. Sag mir, klingt das nach einem vertrauenswürdigen Bericht?«
Ihr Vater stand auf, trat ans Fenster, blickte hinaus und verschränkte die Arme vor der Brust. Das Büro bot einen Ausblick auf die kostbaren Bougainvilleen ihrer Mutter, eine Explosion der Farben, die nun von Dunkelheit verhüllt wurde.
»Es geht ihr nicht gut, so viel ist klar. Und ich weiß auch, dass Virgil, sollten er und Catalina geschieden werden, kein Geld haben würde. Bei ihrer Hochzeit war bereits ziemlich offensichtlich, dass sein Familienvermögen versiegt ist. Aber solange sie verheiratet sind, hat er Zugriff auf ihr Bankkonto. Für ihn wäre es von Vorteil, Catalina zu Hause zu behalten, selbst wenn sie in der Stadt oder bei uns besser aufgehoben wäre.«
»Du meinst, dass er so geldgierig ist? Dass er seinen Wohlstand wichtiger nimmt als das Wohlergehen seiner Frau?«
»Ich kenne ihn nicht, Noemí. Niemand von uns tut das. Und das ist das Problem. Er ist ein Fremder. Er sagt, sie würde gut versorgt werden und es ginge ihr besser, aber nach allem, was ich weiß, könnte Catalina genauso gut derzeit an ihr Bett gefesselt sein und mit Haferschleim gefüttert werden.«
»Und sie ist diejenige mit dem Hang zum Melodramatischen?«, fragte Noemí und inspizierte seufzend ihr Orchideenmieder.
»Ich weiß, wie Verwandte sein können. Meine eigene Mutter hatte einen Schlaganfall und war jahrelang ans Bett gefesselt. Ich weiß auch, dass Familien mit solchen Dingen nicht immer gut umgehen.«
»Was erwartest du nun von mir?«, fragte sie und legte anmutig die Hände in den Schoß.
»Mach dir ein Bild von der Lage. Stell fest, ob sie in die Stadt gebracht werden sollte, und versuche, ihn zu überzeugen, dass das die beste Entscheidung ist, solltest du zu diesem Schluss kommen.«
»Wie mache ich das?«
Ihr Vater grinste süffisant. Dieses Grinsen und die klugen dunklen Augen hatten Vater und Tochter gemeinsam. »Du bist unbeständig. Dauernd änderst du deine Meinung über alles und jedes. Erst wolltest du Geschichte studieren, dann Theaterwissenschaft, und jetzt ist es Anthropologie. Du hast jede vorstellbare Sportart ausprobiert und bist nie bei einer geblieben. Du verabredest dich zweimal mit einem Jungen, und wenn er ein drittes Treffen möchte, rufst du ihn nicht mal zurück.«
»Das ist keine Antwort auf meine Frage.«
»Darauf komme ich gleich. Du bist unbeständig, aber du bist auch stur, wann immer es unpassend ist. Es ist an der Zeit, deine Sturheit und Energie einer sinnvollen Aufgabe zuzuführen. Du hast dich nie auf irgendetwas ganz eingelassen, abgesehen von den Klavierstunden.«
»Und den Englischstunden«, konterte Noemí, doch sie machte sich nicht die Mühe, die übrigen Anschuldigungen zu bestreiten, denn sie probierte tatsächlich regelmäßig neue Verehrer aus und war durchaus imstande, viermal an einem Tag die Kleidung zu wechseln.
Aber schließlich muss man sich mit zweiundzwanzig noch nicht in jedem Punkt festgelegt haben, dachte sie. Das ihrem Vater zu erklären, hatte jedoch keinen Sinn. Er hatte den Familienbetrieb bereits mit neunzehn übernommen. Für seine Verhältnisse befand sie sich auf einem gemächlichen Kurs nach nirgendwo. Er bedachte sie mit einem herausfordernden Blick, und sie seufzte. »Nun gut, ich würde einen Besuch mit Freude in ein paar Wochen …«
»Montag, Noemí. Darum habe ich dich von der Party geholt. Wir müssen Vorkehrungen treffen, damit du am Montagmorgen im ersten Zug nach El Triunfo sitzt.«
»Aber das Konzert findet bald statt«, antwortete sie.
Das war eine schwache Ausrede, und das wussten sie beide. Sie hatte Klavierunterricht erhalten, seit sie sieben Jahre alt war, und zweimal im Jahr trat sie bei einem kleinen Konzert auf. Heute war es, anders als bei ihrer Mutter in jungen Jahren, nicht mehr notwendig, dass junge Damen der Gesellschaft ein Instrument spielten, aber es war eines jener netten kleinen Steckenpferde, die in ihren Kreisen geschätzt wurden. Außerdem mochte sie das Klavier.
»Das Konzert. Es kommt mir wahrscheinlicher vor, dass du Pläne mit Hugo Duarte gemacht hast, ihm gemeinsam beizuwohnen, und nicht willst, dass er sich mit einer anderen Frau verabredet oder dir die Gelegenheit verwehrt wird, ein neues Kleid zu tragen. Zu schade – diese Angelegenheit ist wichtiger.«
»Nur, damit du es weißt, ich habe mir kein neues Kleid gekauft. Ich hatte vor, den Rock zu tragen, den ich schon bei Gretas Cocktailparty anhatte«, verkündete Noemí, auch wenn das nur die halbe Wahrheit war, denn sie hatte in der Tat geplant, mit Hugo hinzugehen. »Schau, die Sache ist die, dass das Konzert nicht meine Hauptsorge ist. In wenigen Tagen beginnt das neue Semester. Ich kann nicht einfach wegbleiben, sonst lassen die mich durchfallen«, fügte sie hinzu.
»Dann sollen sie doch. Du kannst das Semester wiederholen.«
Sie wollte gerade zu einem Protest gegen diese muntere Abfuhr ansetzen, als ihr Vater sich umdrehte und sie fixierte.
»Noemí, du redest ständig von der Universidad Nacional. Wenn du tust, was ich von dir erwarte, dann gebe ich dir die Erlaubnis, dich dort einzuschreiben.«
Noemís Eltern gestatteten ihr, die Universidad Femenina de México zu besuchen, hatten sich aber quergestellt, als sie ihnen erklärt hatte, sie wolle ihr Studium nach dem Abschluss fortsetzen und einen Magister in Anthropologie erwerben. Dazu sei es notwendig, dass sie sich an der Nationaluniversität einschrieb. Ihr Vater hielt das für Zeitverschwendung und unpassend, streunten dort doch all diese jungen Männer durch die Gänge und füllten die Köpfe der jungen Damen mit dummen und lüsternen Gedanken.
Noemís Mutter war ebenso wenig angetan von den modernen Vorstellungen ihrer Tochter. Mädchen sollten einem einfachen Lebensweg folgen, von der Debütantin zur Ehefrau. Noch länger zu studieren hieße, diesen Lebensweg aufzuschieben, eine Schmetterlingspuppe zu bleiben, die ihren Kokon nicht verlassen wollte. Ein halbes Dutzend Male waren sie wegen dieses Themas schon aneinandergeraten, und ihre Mutter hatte listig bekundet, es sei an Noemís Vater, darüber zu urteilen, während ihr Vater sich nie bereitgefunden hatte, dergleichen zu tun.
Umso mehr verblüffte Noemí nun seine Erklärung, und sie bot ihr eine unerwartete Gelegenheit. »Meinst du das ernst?«, fragte sie vorsichtig.
»Ja. Es ist eine ernste Angelegenheit. Ich möchte keine Scheidung als Aufmacher in der Zeitung sehen, aber ich kann auch nicht zulassen, dass jemand unsere Familie zu seinem Vorteil missbraucht. Und schließlich sprechen wir von Catalina«, sagte ihr Vater in milderem Ton. »Sie hat schon genug Schicksalsschläge erdulden müssen und sehnt sich möglicherweise gerade sehr nach einem freundlichen Gesicht. Das könnte am Ende vielleicht alles sein, was sie braucht.«
Catalina hatte nicht nur ein Unglück im Leben ereilt. Erst der Tod ihres Vaters, gefolgt von der Wiederverheiratung ihrer Mutter und einem Stiefvater, der sie oft zum Weinen gebracht hatte. Catalinas Mutter war ein paar Jahre später gestorben, und das Mädchen war anschließend in Noemís Haushalt aufgenommen worden. Der Stiefvater war zu dem Zeitpunkt bereits fort gewesen. Trotz der Wärme, die ihr die Taboadas entgegengebracht hatten, hatten diese Todesfälle tiefe Narben hinterlassen. Später, als junge Frau, war es eine in die Brüche gegangene Verlobung gewesen, die viel Zank und verletzte Gefühle nach sich gezogen hatte.
Da war auch einmal ein ziemlich trotteliger junger Mann gewesen, der Catalina etliche Monate lang umworben hatte und den sie sehr gemocht zu haben schien. Aber Noemís Vater war von dem Burschen wenig begeistert gewesen und hatte ihn verscheucht. Nach dieser gescheiterten Romanze hatte Catalina ihre Lektion wohl gelernt, denn ihre Beziehung zu Virgil Doyle war ein Musterbeispiel der Diskretion gewesen. Aber vielleicht war Virgil auch gewiefter und hatte Catalina gedrängt, über ihre Verbindung zu schweigen, bis es zu spät gewesen war, um eine Hochzeit noch zu verhindern.
»Ich nehme an, ich könnte Bescheid geben, dass ich einige Tage lang fort sein werde«, sagte sie.
»Gut. Wir schicken Virgil ein Telegramm und lassen sie wissen, dass du auf dem Weg bist. Diskretion und Köpfchen, das ist es, was ich brauche. Er ist ihr Ehemann und hat das Recht, Entscheidungen in ihrem Interesse zu treffen, aber wir können nicht untätig bleiben, sollte er sich als unverantwortlich erweisen.«
»Ich sollte dich dazu drängen, das schriftlich festzuhalten … den Teil mit der Universität.«
Ihr Vater setzte sich wieder hinter seinen Schreibtisch. »Als würde ich mein Wort brechen. Und jetzt nimm diese Blumen aus dem Haar und fang an deine Sachen zu packen. Ich weiß, dass du ewig brauchen wirst, um zu entscheiden, was du tragen willst. Was hast du eigentlich dargestellt?«, fragte ihr Vater, der mit dem Schnitt ihres Kleides und ihren blanken Schultern offensichtlich nicht zufrieden war.
»Ich bin als Frühling verkleidet«, entgegnete sie.
»Es ist kalt dort. Nur, falls du die Absicht hast, in irgendetwas dieser Art bei Catalina herumzustolzieren. Du nimmst wohl besser einen Pullover mit«, kommentierte er trocken.
Normalerweise hätte sie ihm darauf eine clevere Antwort erteilt, doch dieses Mal blieb sie außergewöhnlich still. Nun, nachdem sie sich einverstanden erklärt hatte, ging ihr auf, dass sie sehr wenig über den Ort, den sie aufsuchen würde, und die Leute, denen sie begegnen würde, wusste. Dies war keine Kreuzfahrt und keine Vergnügungsreise. Aber sie sagte sich rasch, dass Vater sie schließlich für diese Mission erwählt hatte, und sie würde sie durchführen. Unbeständig? Bah! Sie würde ihrem Vater das Engagement zeigen, das er von ihr erwartete. Vielleicht würde er sie nach erfolgreichem Abschluss der Reise – denn zu versagen kam in ihrer Vorstellungswelt nicht vor – als verdienstvoller und mündiger ansehen.
2
Als Noemí ein kleines Mädchen gewesen war und Catalina ihr Märchen vorgelesen hatte, da hatte sie oft »den Wald« erwähnt, in dem Hänsel und Gretel Brotkrumen ausgestreut hatten und Rotkäppchen einem Wolf begegnet war. Noemí, die in der Großstadt aufwuchs, war erst viel später aufgegangen, dass es Wälder wirklich gab und man sie im Atlas finden konnte. Die Ferien verbrachte ihre Familie in Veracruz im Haus ihrer Großmutter an der Küste, von wo aus nirgends hohe Bäume zu sehen waren. Auch als sie schon erwachsen war, waren Wälder in ihrem Bewusstsein nicht mehr als Bilder, die sie als Kind in einem Märchenbuch gesehen hatte, bunte Farbspritzer mit dunkelgrauen Umrissen.
Folglich dauerte es eine Weile, bis ihr klar wurde, dass sie direkt in einen Wald reiste, denn El Triunfo thronte auf dem Hang eines steilen Berges, der überzogen war mit einem Teppich aus farbenfrohen Wildblumen, Kiefern und Eichen. Noemí sah Schafe umherlaufen und Ziegen den kahlen Felshängen trotzen. Das Silber hatte dieser Region ihren Reichtum eingetragen, und der Talg dieser Tiere hatte geholfen, die Gruben auszuleuchten, und derer gab es viele. Es war alles sehr heimelig.
Je höher der Zug kam und je mehr er sich El Triunfo näherte, desto schroffer wurde die vormals idyllische Landschaft, und Noemí überdachte ihren Eindruck noch einmal. Tiefe Schluchten zogen sich durch das Land, zerklüftete Höhenzüge ragten vor dem Fenster des Waggons auf. Was zunächst ein lieblicher Bach zu sein schien, entpuppte sich als wilder, pulsierender Fluss, der für jeden, der von seinen Strömungen erfasst wurde, den sicheren Tod bedeuten musste. Am Fuß der Berge kümmerten sich Bauern um Haine und Luzernefelder, aber hier gab es keine Feldfrüchte, nur Ziegen, die die Felsen hinauf- und hinunterkletterten. Das Land verbarg seinen Reichtum in der Finsternis und brachte keine Früchte tragenden Bäume hervor.
Die Luft wurde dünner, während der Zug sich den Berg hinaufkämpfte, bis er schließlich stotternd zum Stillstand kam.
Noemí schnappte sich ihre Koffer. Sie hatte zwei mitgenommen und war in Versuchung gewesen, auch ihren Lieblingsschrankkoffer zu packen, war aber dann doch zu dem Schluss gekommen, dass er zu sperrig war. Diesem Zugeständnis zum Trotz waren die beiden Koffer groß und schwer.
Am Bahnhof, der den Namen kaum verdiente, herrschte so gut wie kein Betrieb. Er bestand im Grunde nur aus einem einsamen Gebäude mit quadratischem Grundriss und einer halb schlafenden Frau am Kartenschalter. Drei kleine Jungen spielten Fangen und jagten sich gegenseitig durch die Station, und sie bot ihnen ein paar Münzen an, wenn sie ihr halfen, die Koffer hinauszuschleppen. Freudig griffen sie zu. Sie sahen unterernährt aus, und Noemí fragte sich, wie die Einheimischen nun zurechtkamen, da die Mine geschlossen und die Ziegen ihre einzige Möglichkeit waren, um wenigstens ein bisschen Handel zu treiben.
Auf die Kälte in den Bergen war Noemí vorbereitet. Das unerwartete Element war folglich der leichte Nebel, der sie an diesem Nachmittag empfing. Neugierig beäugte sie ihn, während sie ihre blaugrüne Calotte mit der langen gelben Feder zurechtrückte und auf der Suche nach ihrem Fahrer die Straße musterte. Er war kaum zu übersehen. Ein einzelnes Automobil parkte vor dem Bahnhof, ein grotesk großes Fahrzeug, das sie an mondäne Stummfilmstars aus einer Ära erinnerte, die schon zwei, drei Jahrzehnte zurücklag. Es war die Art von Automobil, die ihr Vater in seiner Jugend hätte fahren können, um stolz seinen Wohlstand zur Schau zu stellen.
Aber das Fahrzeug, das sie vor sich sah, war alt und schmutzig und hätte eine neue Lackierung vertragen. Insofern war es doch nicht die Art von Automobil, die ein Filmstar fahren würde, eher ein Relikt, das aufs Geratewohl aus der Versenkung geholt und auf die Straße geschleift worden war.
Sie nahm an, der Fahrer würde zum Fahrzeug passen, also rechnete sie mit einem älteren Mann am Steuer, aber stattdessen stieg ein junger Bursche in einer Cordjacke aus, der etwa in ihrem Alter war. Er hatte blondes Haar und blasse Haut – sie hatte nicht gewusst, dass Menschen so blass sein konnten; liebe Güte, hielt er sich je in der Sonne auf? Sein Blick wirkte unsicher, und die Lippen schienen stark gefordert zu sein bei dem Versuch, ein Lächeln oder einen Gruß hervorzubringen.
Noemí bezahlte die Jungen, die ihr geholfen hatten, das Gepäck rauszubringen, trat vor und streckte die Hand aus.
»Ich bin Noemí Taboada. Hat Mister Doyle Sie geschickt?«, fragte sie.
»Ja, Onkel Howard bat mich, Sie abzuholen«, antwortete er und schüttelte ihr mit einer schwächlichen Bewegung die Hand. »Ich bin Francis. Ich hoffe, die Reise war angenehm? Ist das all Ihr Gepäck, Miss Taboada? Kann ich Ihnen damit helfen?«, fragte er in rascher Folge. Es schien beinahe, als zöge er es vor, alle Sätze mit einem Fragezeichen zu beenden, statt definitive Aussagen zu treffen.
»Sie können mich Noemí nennen. Miss Taboada klingt so etepetete. Das ist alles, was ich an Gepäck habe, und ja, ich würde mich über ein bisschen Hilfe wirklich freuen.«
Er packte ihre beiden Koffer und wuchtete sie in den Kofferraum. Dann ging er um den Wagen herum, um ihr die Tür zu öffnen. Die Stadt, die bald vor dem Fenster vorüberzog, war eine Ansammlung aus gewundenen Straßen, bunten Häusern mit Blumentöpfen auf den Fensterbänken, massiven Holztüren, langen Treppen, einer Kirche und all den üblichen Elementen, die in einem Reiseführer als »malerisch« bezeichnet werden dürften.
Dennoch war klar, dass El Triunfo in keinem Reiseführer stand. Der Ort verströmte den muffigen Dunst des Verfalls. Die Häuser waren bunt, ja, aber von den meisten Wänden blätterte die Farbe ab, einige der Türen waren verunstaltet, die Hälfte der Blumen in den Töpfen welk, und es rührte sich ganz allgemein nur wenig in dem Städtchen.
Das war nicht so außergewöhnlich. Viele einst blühende Minenorte, die während der Kolonialherrschaft Silber und Gold gefördert hatten, hatten die Arbeit eingestellt, als der Unabhängigkeitskrieg ausgebrochen war. Später, während der friedvollen Porfiriato, hatte man Engländer und Franzosen freudig begrüßt, und die Taschen hatten sich mit den Reichtümern gefüllt, die Bodenschätze einem bescherten. Aber die Revolution hatte diesen zweiten Aufschwung beendet. Es gab viele Orte wie El Triunfo, in denen man sich vornehme Kapellen ansehen konnte, die in einer Zeit erbaut worden waren, als Geld und Bewohner zahlreich gewesen waren; Orte, an denen die Erde nie wieder Reichtum gebären würde.
Doch die Doyles blieben in dieser Gegend, obgleich viele andere sie längst verlassen hatten. Vielleicht, dachte Noemí, hatten sie sie lieben gelernt, auch wenn sie selbst keine Begeisterung dafür aufbrachte, denn es war eine schroffe Landschaft. Es sah gar nicht aus wie die Berge in den Märchenbüchern ihrer Kindheit, in denen die Bäume großartig wirkten und Blumen am Wegesrand wuchsen; es sah nicht aus wie der zauberhafte Ort, an dem Catalina zu leben behauptet hatte. Wie der alte Wagen, der Noemí abgeholt hatte, klammerte sich auch der Ort an den Bodensatz seiner einstigen Pracht.
Francis fuhr eine schmale Straße hinauf, die sie noch tiefer ins Gebirge führte, die Luft wurde rauer, der Nebel dichter. Sie rieb die Hände aneinander.
»Ist es sehr weit?«, fragte sie.
Wieder wirkte er verunsichert. »Nicht so weit«, sagte er gedehnt, als diskutierten sie ein Thema, das sorgfältig erwogen werden wollte. »Die Straße taugt nichts, sonst würde ich schneller fahren. Früher, vor langer Zeit, als die Mine noch in Betrieb war, da waren die Straßen hier alle in einem guten Zustand, sogar in der Nähe von High Place.«
»High Place?«
»So nennen wir es, unser Zuhause. Und gleich dahinter ist der englische Friedhof.«
»Ist er wirklich so englisch?«, fragte sie lächelnd.
»Ja«, antwortete er und umfasste das Lenkrad mit beiden Händen, viel kraftvoller, als sie es nach dem laschen Handschlag erwartet hätte.
»So?«, hakte sie nach und wartete auf eine nähere Erklärung.
»Sie werden es bald sehen. Es ist alles sehr englisch. Na ja, das ist das, was Onkel Howard gewollt hat, ein kleines Stück England. Er hat sogar europäische Erde hergebracht.«
»Hatte er so extremes Heimweh?«
»Allerdings. Ich kann es Ihnen ja gleich sagen, auf High Place sprechen wir kein Spanisch. Mein Großonkel versteht kein Wort, Virgil kommt schlecht damit zurecht, und meine Mutter würde nie auch nur versuchen, einen Satz auf Spanisch zusammenzustoppeln. Ist … ist Ihr Englisch gut?«
»Täglicher Unterricht, seit ich sechs war«, sagte sie und wechselte von Spanisch zu Englisch. »Ich bin überzeugt, ich werde zurechtkommen.«
Die Bäume rückten näher zusammen, und unter ihrem Geäst war es dunkel. Sie war nicht gerade naturbegeistert, nicht wenn es um echte Natur ging. Beim letzten Mal, als sie auch nur in die Nähe eines Waldes gekommen war, hatten sie einen Ausflug nach El Desierto de los Leones unternommen. Sie waren ausgeritten, und ihr Bruder und seine Freunde hatten beschlossen, Schießübungen mit Blechdosen durchzuführen. Das war vor zwei, vielleicht drei Jahren gewesen. Doch diese Gegend war damit nicht vergleichbar. Hier war die Natur wilder.
Sie ertappte sich dabei, argwöhnisch die Höhe der Bäume und die Tiefe der Schluchten abzuschätzen. Beides war beträchtlich. Der Nebel wurde noch dichter, wie sie mit Schrecken bemerkte, und sie fürchtete, sie würden eine falsche Abzweigung erwischen und den halben Berg hinunterstürzen. Wie viele erwartungsvolle Schürfer mochten hier von einer Klippe gefallen sein? Die Berge versprachen mineralische Reichtümer und einen schnellen Tod. Aber Francis schien sich beim Fahren sicher zu fühlen, wie stockend seine Sprache auch sein mochte. Sie hatte für schüchterne Männer nichts übrig – sie gingen ihr auf die Nerven –, aber wen interessierte das schon? Schließlich war sie nicht hergekommen, um ihn oder irgendeinen seiner Angehörigen zu besuchen.
»Wer sind Sie eigentlich?«, fragte sie, um sich von dem Gedanken an Schluchten und Autos abzulenken, die an ungesehenen Bäumen zerschmetterten.
»Francis.«
»Ja, sicher, aber sind Sie Virgils kleiner Cousin? Sein lange verschollener Onkel? Oder ein schwarzes Schaf, über das ich informiert sein sollte?«
Sie sprach auf die drollige Art, die ihr so gefiel und die sie gern bei Cocktailpartys anstimmte – eine Art, mit der sie bei den Leuten stets ziemlich weit kam. Und er antwortete, wie sie es erwartet hatte, und lächelte sogar ein wenig.
»Cousin ersten Grades, eine Generation entfernt. Er ist ein bisschen älter als ich.«
»Das habe ich nie so richtig verstanden. Grad, Generation. Wer führt darüber Buch? Ich denke mir immer, wenn Leute zu meiner Geburtstagsparty kommen, sind wir verwandt, und das ist alles. Kein Grund, die Ahnentafel auszupacken.«
»Das vereinfacht die Sache allerdings«, sagte er, und nun sah sein Lächeln sogar echt aus.
»Sind Sie ein guter Cousin? Ich habe meine Cousins gehasst, als ich klein war. Sie haben mir bei meinen Partys den Kopf in den Kuchen gedrückt, dabei wollte ich diesen ganzen Mordida-Kram gar nicht mitmachen.«
»Mordida?«
»Ja. Man soll einen Bissen von dem Kuchen nehmen, ehe er angeschnitten wird, aber immer drückt einem jemand den Kopf hinein. Ich schätze, so etwas mussten Sie in High Place nicht erdulden.«
»Wir feiern nicht viele Fest in High Place.«
»Der Name klingt nach einer Beschreibung«, sinnierte sie, denn es ging immer noch weiter aufwärts. Hatte diese Straße denn gar kein Ende? Die Räder des Wagens knirschten auf einem heruntergefallenen Ast, dann auf noch einem.
»Ja.«
»Ich war noch nie in einem Haus, das einen Namen hat. Wer macht so etwas heutzutage noch?«
»Wir sind altmodisch«, murmelte er.
Noemí musterte den jungen Mann skeptisch. Ihre Mutter hätte gesagt, er brauche eine eisenhaltigere Nahrung und ein kräftiges Stück Fleisch. So, wie diese dünnen Finger aussahen, musste er wohl von Tautropfen und Honig leben. Außerdem neigte seine Stimme zum Flüstern. Virgil war ihr kräftiger vorgekommen, präsenter. Und auch älter, ganz wie Francis angedeutet hatte. Virgil war irgendwo in den Dreißigern, sein genaues Alter hatte sie vergessen.
Sie holperten über einen Stein oder eine Erhebung in der Straße, und Noemí stieß ein gereiztes »Autsch« hervor.
»Tut mir leid«, sagte Francis.
»Ich glaube nicht, dass das Ihre Schuld ist. Sieht es hier immer so aus?«, fragte sie. »Das ist ja, als würde man in einer Schüssel Milch fahren.«
»Das ist noch gar nichts«, erwiderte er mit einem Lachen. Nun ja, wenigstens entspannte er sich.
Dann, ganz plötzlich, waren sie da. Sie gelangten auf eine Lichtung, und das Haus schien förmlich aus dem Nebel zu springen, um sie mit offenen Armen zu empfangen. Das war so merkwürdig! Baulich sah es mit seinen kaputten Dachschindeln, den kunstvollen Ornamenten und den schmutzigen Erkerfenstern absolut viktorianisch aus. Etwas in dieser Art hatte sie im realen Leben noch nie gesehen; es war so erschreckend anders als das moderne Haus ihrer Familie, die Apartments ihrer Freunde oder die Häuser der Kolonialzeit mit ihren dunkelroten Tezontle-Fassaden.
Das Haus ragte wie ein riesiger, schweigender Gargoyle über ihnen auf. Es hätte wie ein Omen erscheinen können, hätte Bilder von Gespenstern und Spukhäusern wachrufen können, hätte es nicht so müde gewirkt. In einigen Fensterläden fehlten Leisten, und die Ebenholzveranda ächzte, als sie die Stufen zur Tür hinaufstiegen, an der ein silberner Türklopfer von der Form einer Faust an einem Ring befestigt war.
Das ist ein verlassenes Schneckenhaus, sagte sie sich, und der Gedanke an Schnecken erinnerte sie wieder an ihre Kindheit, daran, wie sie im Hof ihres Hauses gespielt und Topfpflanzen zur Seite geschoben hatten, woraufhin die Tiere auf der Suche nach einem neuen Versteck herumgekrabbelt waren. Oder wie sie, trotz der Ermahnungen ihrer Mutter, Ameisen mit Würfelzucker gefüttert hatten. Und dann war da diese freundliche gescheckte Katze gewesen, die unter den Bougainvilleen zu schlafen gepflegt und sich endlos von den Kindern hatte streicheln lassen. Sie konnte sich nicht vorstellen, dass es in diesem Haus eine Katze gab oder irgendwelche Kanarienvögel, die fröhlich in ihren Käfigen tschilpten und die sie des Morgens füttern könnte.
Francis zog einen Schlüssel hervor und öffnete die schwere Tür. Noemí trat in die Eingangshalle und sah sogleich eine Prunktreppe aus Mahagoni und Eiche mit einem Buntglasfenster in der ersten Etage vor sich. Das Fenster zeichnete rote, blaue und gelbe Muster auf einen verblassten grünen Teppich, und zwei geschnitzte Nymphen – eine am Fuß der Treppe neben einem Pfosten, die andere am Fenster – wachten still und stumm über das Haus. Gleich neben dem Eingang hatte einmal ein Gemälde oder ein Spiegel an der Wand gehangen, und der ovale Umriss zeichnete sich immer noch auf der Tapete ab wie ein einsamer Fingerabdruck am Tatort eines Verbrechens. Über ihren Köpfen hing ein neunarmiger Kronleuchter mit vom Alter stumpf gewordenen Kristallen.
Eine Frau kam die Treppe herunter, ihre linke Hand glitt über das Geländer. Sie war nicht alt. Zwar war ihr Haar von silbernen Strähnen durchzogen, doch ihr Körper war zu aufrecht und agil für eine Seniorin. Allerdings luden ihr das strenge graue Kleid und die Härte in den Augen mehr Jahre auf, als sich in ihrem Körper widerspiegelten.
»Mutter, das ist Noemí Taboada«, sagte Francis, als er mit Noemís Koffern die Treppe betrat.
Noemí folgte ihm, lächelte und streckte freundlich die Hand aus, welche die Frau musterte, als hielte sie ihr einen wochenalten Fisch entgegen. Statt sie zu ergreifen, machte die Frau kehrt und stolzierte die Stufen wieder hinauf.
»Ist mir ein Vergnügen«, sagte die Frau, während sie Noemí den Rücken zukehrte. »Ich bin Florence, Mister Doyles Nichte.«
Noemí lag eine spöttische Bemerkung auf den Lippen, aber sie biss sich auf die Zunge, schloss zu Florence auf und ging in ihrem Tempo weiter.
»Danke.«
»Ich führe dieses Haus, daher sollten Sie, falls Sie irgendetwas brauchen, stets zu mir kommen. Wir haben hier unsere eigene Art, die Dinge zu erledigen, und wir erwarten von Ihnen, dass Sie unsere Regeln befolgen.«
»Welche Regeln sind das?«, fragte Noemí.
Sie kamen an dem Buntglasfenster vorbei, auf dem, wie Noemí nun erkannte, eine leuchtende stilisierte Blume dargestellt war. Das Blau der Blütenblätter war mit Kobaltoxid hergestellt worden. Sie kannte sich mit solchen Dingen aus. Das Farbengeschäft, wie ihr Vater es zu nennen beliebte, hatte ihr eine endlose Sammlung chemischer Fakten geliefert, die sie überwiegend ignoriert hatte und die sich doch wie ein ärgerlicher Ohrwurm in ihrem Kopf eingenistet hatten.
»Die wichtigste Regel lautet, dass wir eine ruhige und zurückgezogene Familie sind«, verkündete Florence. »Mein Onkel, Mister Howard Doyle, ist sehr alt und verbringt die meiste Zeit in seinem Zimmer. Sie haben ihn nicht zu stören. Zweitens: Ich bin verantwortlich für die Pflege Ihrer Cousine. Sie braucht viel Ruhe, also dürfen Sie auch sie nicht unnötig stören. Verlassen Sie das Haus nicht allein; man verirrt sich leicht, und es gibt in dieser Gegend viele Schluchten.«
»Sonst noch etwas?«
»Wir gehen nicht oft in die Stadt. Wenn Sie dort etwas zu erledigen haben, müssen Sie mich fragen, dann werde ich Charles anweisen, Sie zu fahren.«
»Wer ist das?«
»Einer unserer Angestellten. Unser Personal ist dieser Tage sehr begrenzt, es sind nur drei Personen. Sie dienen der Familie schon seit vielen Jahren.«
Sie gingen einen mit Teppichboden ausgelegten Gang hinunter, Porträts in schmalen, ovalen Rahmen schmückten die Wände. Die Gesichter längst verstorbener Doyles starrten Noemí über die Grenzen der Zeit hinweg an, Frauen mit Hauben und schweren, voluminösen Kleidern, Männer mit Zylindern, Handschuhen und mürrischen Mienen. Die Art von Menschen, die Anspruch auf das Familienwappen erheben könnten. Blass und blond wie Francis und seine Mutter. Ein Gesicht verschmolz mit dem anderen. Noemí hätte sie nicht auseinanderhalten können, selbst wenn sie genau hingesehen hätte.
»Dies wird Ihr Zimmer sein«, sagte Florence, als sie vor einer Tür mit einem dekorativen Kristallknauf angelangt waren. »Ich sollte Sie warnen, im Haus ist das Rauchen nicht gestattet, nur für den Fall, dass Sie diesem speziellen Laster frönen«, fügte sie hinzu und musterte dabei Noemís schicke Handtasche, als könnte sie hindurchsehen und die Packung Zigaretten erkennen.
Laster, dachte Noemí und fühlte sich an die Nonnen erinnert, die ihre Erziehung überwacht hatten. Sie hatte gelernt zu rebellieren, während sie einen Rosenkranz betete.
Noemí betrat das Zimmer und betrachtete das alte Himmelbett, das aussah, als wäre es einer Schauergeschichte entsprungen; es hatte sogar Vorhänge, die man rundum schließen konnte, um sich einen Kokon zu schaffen und sich vor der Welt zu verkriechen. Francis stellte die Koffer an einem schmalen Fenster ab – dieses Fenster war klar, das extravagante Buntglas fand für Privaträume offenbar keine Verwendung –, während Florence auf einen Schrank mit zusätzlichen Decken deutete.
»Wir befinden uns hoch oben im Gebirge, da wird es sehr kalt«, sagte sie. »Ich hoffe, Sie haben einen Pullover eingepackt.«
»Ich habe einen Rebozo dabei.«
Die Frau öffnete eine Truhe am Fuß des Bettes, holte ein paar Kerzen und den hässlichsten Kerzenhalter hervor, den Noemí je gesehen hatte, ganz aus Silber mit einem Cherub, der sich um den Fuß schmiegte. Dann schloss sie die Truhe wieder und ließ die Fundstücke auf ihr liegen.
»Elektrische Beleuchtung wurde 1909 installiert. Direkt vor der Revolution. Aber in den vier Jahrzehnten, die seither vergangen sind, hat es nur wenige Verbesserungen gegeben. Wir haben einen Generator, und er kann genug Strom produzieren, um den Eisschrank und ein paar Glühbirnen zu versorgen. Doch er ist bei Weitem nicht ausreichend, um das ganze Haus zu beleuchten. Darum sind wir auf Kerzen und Öllampen angewiesen.«
»Ich wüsste gar nicht, wie ich mit einer Öllampe umzugehen habe«, sagte Noemí mit einem leisen Kichern. »Ich habe nie einen Ausflug mit einem Zelt oder dergleichen unternommen.«
»Selbst ein Einfaltspinsel kann das grundlegende Prinzip verstehen«, verkündete Florence und sprach gleich weiter, sodass Noemí keine Chance zu einer Entgegnung erhielt. »Der Boiler ziert sich bisweilen, außerdem sollten junge Leute so oder so nicht so heiß duschen; ein mildes Bad wird reichen. Es gibt in diesem Raum keine Feuerstelle, aber wir haben unten einen großen offenen Kamin. Habe ich etwas vergessen, Francis? Nein? Nun gut.«
Die Frau sah ihren Sohn an, gab aber auch ihm keine Gelegenheit, ihr zu antworten. Noemí hatte den Verdacht, dass nur wenige je eine Chance bekamen, in ihrer Gegenwart den Mund aufzumachen.
»Ich möchte mit Catalina sprechen«, sagte Noemí.
»Heute?«, fragte die Frau.
»Ja.«
»Es ist beinahe Zeit für ihre Medizin. Wenn sie die genommen hat, wird sie bald schlafen.«
»Ich möchte sie nur ein paar Minuten sehen.«
»Mutter, sie ist von so weit her gekommen«, sagte Francis.
Auf diese Einmischung war die Frau offenbar nicht vorbereitet. Florence musterte ihren Sohn mit einer hochgezogenen Braue und faltete die Hände.
»Nun, ich nehme an, in der Stadt mit all dem Hin und Her entwickelt man ein anderes Zeitgefühl«, sagte sie. »Wenn Sie sie unbedingt sofort sehen müssen, dann kommen Sie wohl besser mit mir. Francis, wie wäre es, wenn du dich erkundigst, ob Onkel Howard uns heute beim Abendessen Gesellschaft leisten wird? Ich möchte keine Überraschung erleben.«
Florence dirigierte Noemí einen anderen langen Korridor hinunter und in ein Zimmer mit einem weiteren Himmelbett, einem kunstvollen Frisiertisch mit dreiteiligem Spiegel und einem Schrank, groß genug, dass sich eine kleine Armee darin verstecken könnte. Die Tapete war wässrig-blau und hatte ein Blumenmuster. Kleine Landschaftsgemälde schmückten die Wände, Küstenbilder von großen Klippen und einsamen Stränden, aber es waren keine hiesigen Szenerien. Sehr wahrscheinlich stammten sie aus England, konserviert in Öl und silbernen Rahmen.
Ein Sessel war neben das Fenster gerückt worden, und Catalina saß darin. Sie schaute nach draußen und rührte sich nicht, als die Frau ihr Zimmer betrat. Ihr kastanienbraunes Haar war im Nacken gebunden. Noemí hatte sich innerlich darauf gefasst gemacht, eine schwer von Krankheit gezeichnete Fremde vorzufinden, aber Catalina schien sich seit ihrer Zeit in Mexico City kaum verändert zu haben. Ihre träumerische Natur wurde vielleicht noch von der Kulisse unterstrichen, aber das war auch schon alles.
»Sie sollte in fünf Minuten ihre Medizin verabreicht bekommen«, stellte Florence mit einem Blick auf ihre Armbanduhr fest.
»Dann nehme ich diese fünf Minuten.«
Die ältere Frau schien darüber nicht glücklich zu sein, verließ aber den Raum. Noemí näherte sich ihrer Cousine. Die junge Frau hatte sie bisher gar nicht angesehen und wirkte sonderbar still.
»Catalina? Ich bin’s, Noemí.«
Sacht legte sie eine Hand auf die Schulter ihrer Cousine, und erst da blickte Catalina sie an. Sie lächelte verhalten.
»Noemí, du bist gekommen.«
Sie stellte sich vor Catalina und nickte. »Ja. Vater hat mich geschickt, um nach dir zu sehen. Wie fühlst du dich? Was ist los?«
»Ich fühle mich furchtbar. Ich hatte Fieber, Noemí, ich leide unter Tuberkulose, aber es geht mir schon besser.«
»Du hast uns einen Brief geschrieben, weißt du das noch? Darin hast du seltsame Dinge erzählt.«
»Ich erinnere mich nicht an alles, was ich geschrieben habe«, gestand Catalina. »Ich hatte so hohes Fieber.«
Catalina war fünf Jahre älter als Noemí. Kein allzu großer Altersunterschied, aber mehr als genug, als sie Kinder gewesen waren. Damals hatte Catalina die Mutterrolle übernommen. Noemí erinnerte sich an viele gemeinsame Nachmittage, an denen sie gebastelt und Kleider für Papierpuppen ausgeschnitten hatten, ins Kino gegangen waren oder sie zugehört hatte, während ihre Catalina Märchen spann. Es war ein sonderbares Gefühl, sie so zu sehen, apathisch, abhängig von anderen, wo sie doch einmal alle von ihr abhängig gewesen waren. Es gefiel ihr überhaupt nicht.
»Der Brief hat meinen Vater schrecklich beunruhigt«, sagte Noemí.
»Das tut mir so leid, Liebes. Ich hätte nicht schreiben sollen. Du hast in der Stadt bestimmt viel zu tun. Deine Freunde, deine Studien, und jetzt bist du hier, nur weil ich Unsinn auf ein Stück Papier gekritzelt habe.«
»Mach dir darüber keine Gedanken. Ich wollte herkommen und dich besuchen. Wir haben uns eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Um ehrlich zu sein, ich hatte eigentlich erwartet, dass du uns inzwischen längst besucht hättest.«
»Ja«, sagte Catalina. »Ja, das dachte ich auch. Aber es ist unmöglich, aus diesem Haus rauszukommen.«
Catalina wirkte in sich gekehrt. Ihre Augen, haselnussbraune Pfuhle stehenden Wassers, wurden stumpfer, und ihr Mund öffnete sich, als wollte sie etwas sagen, nur dass sie es nicht tat. Stattdessen holte sie tief Luft, hielt kurz den Atem an, drehte den Kopf und hustete.
»Catalina?«
»Zeit für deine Medizin«, sagte Florence und marschierte mit einer Glasflasche und einem Löffel in der Hand durch das Zimmer. »Nun komm.«
Catalina nahm folgsam einen Löffel ihrer Arznei ein. Danach half Florence ihr ins Bett und zog ihr die Decke bis ans Kinn.
»Gehen wir«, sagte Florence. »Sie braucht Ruhe. Sie können sich morgen mit ihr unterhalten.«
Catalina nickte. Florence brachte Noemí zurück zu ihrem Zimmer, gab ihr einen kurzen Überblick über das Haus – die Küche war in dieser Richtung, die Bibliothek in jener – und sagte ihr, man werde sie um sieben zum Abendessen abholen.
Noemí packte aus, brachte ihre Kleidung im Schrank unter und ging ins Bad, um sich frisch zu machen. Dort fand sie eine antike Badewanne, einen Badezimmerschrank und Spuren von Schimmel an der Decke. Viele der Fliesen um die Wanne herum waren gesprungen, aber auf einem dreibeinigen Hocker lagen frische Handtücher bereit, und der Bademantel, der an einem Haken hing, sah sauber aus.
Sie probierte den Lichtschalter an der Wand aus, aber die Lampe funktionierte nicht. In ihrem Zimmer konnte Noemí keine Lampe mit Glühbirne finden, obwohl es eine Steckdose gab. Sie nahm an, Florence hatte nicht gescherzt, als sie ihr erklärt hatte, sie seien auf Kerzen und Öllampen angewiesen.
Sie öffnete ihre Handtasche und wühlte so lange darin, bis sie ihre Zigaretten gefunden hatte. Eine kleine Tasse, verziert mit halb nackten Cupidofiguren, diente ihr als provisorischer Aschenbecher. Nach ein paar Zügen schlenderte sie zum Fenster, damit Florence keine Gelegenheit bekäme, sich über den Gestank zu beschweren, aber es ließ sich nicht öffnen.
Sie stand da und blickte in den Nebel hinaus.
3
Pünktlich um sieben kehrte Florence zurück und hielt eine Öllampe in der Hand, um ihnen den Weg zu leuchten. Sie stiegen die Treppe hinunter und gelangten in einen Speiseraum, der von einem monströsen Kronleuchter förmlich erdrückt wurde, ganz ähnlich dem in der Eingangshalle, der nach wie vor unbeleuchtet war. Die Tafel mit der passenden weißen Damasttischdecke war groß genug für ein Dutzend Leute. Mehrere Kandelaber standen darauf, in denen lange weiße, spitz zulaufende Kerzen steckten, bei deren Anblick Noemí an eine Kirche denken musste.
Vitrinen säumten die Wände, vollgestopft mit Spitze, Porzellan und vor allem Tafelsilber. Tassen und Teller, auf denen die stolze Initiale der Eigentümer – das triumphale, stilisierte D der Doyles – prangte, Serviertabletts und leere Vasen, die einst im Schein der Kerzen geglänzt haben mussten, waren nun angelaufen und stumpf.
Florence deutete auf einen Stuhl, und Noemí ließ sich darauf sinken. Francis hatte sich bereits ihr gegenüber gesetzt, und Florence nahm ihren Platz an seiner Seite ein. Ein grauhaariges Dienstmädchen kam herein und stellte Schalen mit einer wässrigen Suppe vor ihnen ab. Florence und Francis begannen zu essen.
»Wird uns sonst niemand Gesellschaft leisten?«, erkundigte Noemí sich.
»Ihre Cousine schläft. Onkel Howard und Vetter Virgil könnten später vielleicht noch herunterkommen«, sagte Florence.
Noemí legte die Serviette auf ihren Schoß und aß von der Suppe, wenn auch nicht viel. Sie war es nicht gewohnt, um diese Zeit zu speisen. Der Abend war nicht die richtige Zeit für warme Mahlzeiten; zu Hause gab es Gebäck und Milchkaffee. Sie fragte sich, wie sie mit diesem anderen Tagesablauf zurechtkommen würde. À l’anglaise, wie ihr Französischlehrer zu sagen pflegte. La panure à l’anglaise, sprich es mir nach. Ob es auch Vier-Uhr-Tee geben würde? Oder war es Fünf-Uhr-Tee?
Stumm wurden die Teller abgeräumt, und stumm wurde der Hauptgang serviert, Hühnchen in einer wenig ansprechenden cremeweißen Soße mit Pilzen. Der Wein, den man ihr einschenkte, war sehr dunkel und süß. Sie mochte ihn nicht.
Noemí schubste die Pilze mit der Gabel auf ihrem Teller herum, während sie zu erkennen versuchte, was sich in der Dunkelheit im Inneren der Vitrine befand, die ihr gegenüberstand.
»Die Gegenstände hier sind größtenteils aus Silber, richtig?«, fragte sie. »Stammt das alles aus Ihrer Mine?«
Francis nickte. »Ja, von damals.«
»Warum wurde sie geschlossen?«
»Da waren die Streiks, und dann …«, setzte Francis an, doch seine Mutter hob den Kopf und starrte Noemí an.
»Wir sprechen nicht während des Abendessens.«
»Nicht mal, um ›Gib mir bitte das Salz‹ zu sagen?«, fragte Noemí leichthin und wirbelte ihre Gabel herum.
»Wie ich sehe, halten Sie sich für schrecklich amüsant. Wir sprechen nicht während des Abendessens. So ist das nun mal. In diesem Hause schätzen wir die Stille.«
»Ach, Florence, wir können doch gewiss ein wenig Konversation betreiben. Unserem Gast zuliebe«, ließ sich ein Mann in einem dunklen Anzug vernehmen, der, gestützt auf Virgil, den Raum betrat.
Das Wort alt wäre unzureichend gewesen, um ihn zu beschreiben. Er war uralt, das Gesicht von Runzeln zerfurcht, und nur wenige Haare hafteten noch hartnäckig an seinem Kopf. Sehr blass war er auch, wie eine Kreatur, die unter der Erde lebte. Eine Bodenschnecke vielleicht. Seine Adern, dünne, spinnwebartige Linien in Purpur und Blau, bildeten einen scharfen Kontrast zu seiner fahlen Haut.
Noemí sah zu, wie er zum Kopf der Tafel schlurfte und sich setzte. Virgil nahm zur Rechten seines Vaters Platz, doch sein Stuhl stand in einem Winkel, durch den er halb im Schatten blieb.
Das Dienstmädchen trug keinen Teller für den alten Mann auf, sondern nur ein Glas dunklen Weins. Vielleicht hatte er bereits gegessen und war nur ihretwegen heruntergekommen.
»Sir, mein Name ist Noemí Taboada. Ich freue mich, Sie kennenzulernen«, sagte sie.
»Und ich bin Howard Doyle, Virgils Vater, aber das werden Sie sich bereits gedacht haben.«
Der alte Mann trug einen altmodischen Plastron, sodass sein Hals unter einem ganzen Berg an Stoff verschwand, der mit einer Silbernadel geziert war. An seinem Zeigefinger steckte ein großer Bernsteinring. Während er sie fixierte, fiel ihr auf, dass der Rest von ihm zwar ausgeblichen schien, die Augen aber von einem verblüffenden Blau waren, unbeeinträchtigt von grauem Star, ungetrübt vom Alter. Sie brannten kalt in diesem uralten Gesicht und beanspruchten ihre ganze Aufmerksamkeit, sezierten sie mit ihrem starren Blick bei lebendigem Leibe.
»Sie sind viel dunkler als Ihre Cousine, Miss Taboada«, bemerkte Howard, nachdem er mit der Begutachtung fertig war.
»Pardon?«, fragte sie und glaubte, sich verhört zu haben.
Er zeigte auf sie. »Sowohl Haut als auch Haare. Beides ist viel dunkler als bei Catalina. Ich nehme an, das spiegelt vor allem das indianische Erbe wider, weniger das französische. Sie haben doch ein wenig indianisches Blut, nicht wahr? So wie die meisten Mestizos.«
»Catalinas Mutter stammte aus Frankreich. Mein Vater ist aus Veracruz und meine Mutter aus Oaxaca. Wir sind Mazateken mütterlicherseits. Weshalb die Frage?«
Der alte Mann lächelte mit geschlossenen Lippen, die Zähne blieben verborgen. Aber sie konnte sie sich vorstellen, gelb und schadhaft.
Virgil hatte dem Dienstmädchen ein Zeichen gegeben, und ein Glas Wein wurde vor ihm auf den Tisch gestellt. Die anderen hatten ihr stummes Mahl fortgesetzt. Demnach fand diese Konversation also lediglich zwischen zwei Personen statt.
»Nur eine Beobachtung. Nun, sagen Sie mir, Miss Taboada, glauben Sie wie Mister Vasconcelos, dass es die Pflicht, nein, das Schicksal der Menschen in Mexiko ist, eine neue Rasse hervorzubringen, die alle Rassen einschließt? Eine ›kosmische‹ Rasse? Eine bronzene Rasse? Ungeachtet der Forschung von Davenport und Steggerda?«
»Sie meinen, ihre Untersuchungen in Jamaika?«
»Brillant, Catalina hatte recht. Sie interessieren sich für Anthropologie.«
»Ja«, sagte sie, nicht bereit, mehr als dieses eine Wort zu offerieren.
»Was denken Sie über die Vermischung überlegener und unterlegener Typen?«, fragte er unter Missachtung ihres Unbehagens.
Noemí spürte, dass sich die Augen der ganzen Familie auf sie richteten. Ihre Gegenwart hier auf High Place verströmte wohl den Reiz des Neuen und stellte eine Veränderung des täglichen Einerleis dar. Ein Organismus, eingeführt in eine sterile Umgebung. Sie warteten darauf, zu hören, was sie preisgeben würde, um ihre Worte zu analysieren. Nun, sollten sie ruhig sehen, dass sie die Ruhe bewahren konnte.
Sie hatte Erfahrung darin, mit lästigen Männern fertigzuwerden. Dergleichen regte sie nicht auf. Während diverser Cocktailpartys und Mahlzeiten in Restaurants hatte sie gelernt, dass jegliche Reaktion auf derart ungehobelte Bemerkungen andere nur ermutigte.
»Ich las einmal eine Abhandlung von Manuel Gamio, in der er sagt, dass eine harte natürliche Auslese den indigenen Menschen dieses Kontinents das Überleben möglich gemacht habe und Europäer von einer Vermischung mit diesen Menschen profitieren würden«, sagte sie und berührte ihre Gabel, spürte das kalte Metall unter ihren Fingerspitzen. »Das stellt die ganze Überlegen-unterlegen-Theorie auf den Kopf, nicht wahr?«, fragte sie in einem unschuldigen und doch ein wenig sarkastischen Tonfall.
Dem alten Doyle schien die Antwort zu gefallen. Sein Gesicht wirkte plötzlich munterer. »Seien Sie mir nicht böse, Miss Taboada. Ich habe nicht die Absicht, Sie zu kränken. Ihr Landsmann Vasconcelos, er spricht über die Geheimnisse des ›ästhetischen Geschmacks‹, die dazu beitragen werden, diese bronzene Rasse zu formen, und ich glaube, Sie sind ein gutes Beispiel für diese Art.«
»Welche Art?«
Wieder lächelte er, doch dieses Mal bleckte er förmlich die Zähne, und die waren nicht so gelb, wie sie erwartet hatte, sondern weiß wie Porzellan und unversehrt. Aber das Zahnfleisch, der Teil davon, den sie deutlich sehen konnte, hatte einen ungesunden Purpurton.