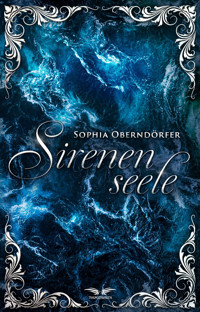
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Traumschwingen Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Für Kayla soll durch ihre Rückkehr nach San Francisco ein neues Leben beginnen, auch wenn sie ihr “neues Leben” bei ihrem verhassten Vater führen muss. Denn dieser lebt für die Wissenschaft und hat für Familie nicht wirklich viel Zeit. Auch Elyan, einer der Schüler an ihrer Schule macht ihr das Leben nicht leichter. Plötzlich kehrt auch noch ihre Großmutter zurück, die sie in ihrer Kindheit schwer misshandelt hat. Um es ihr heimzuzahlen, meldet sich Kayla für ein Forschungsprogramm an, nicht ahnend, dass sie damit nicht nur Elyans Geheimnis auf die Spur kommt, sondern auch dem Geheimnis ihrer eigenen Herkunft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 542
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table of Contents
Title Page
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Epilog
Danksagung
Impressum
Sophia Oberndörfer
Für das Mädchen in mir, das so oft gezweifelt hat,
doch nie aufgegeben hat, an sich zu glauben
Prolog
Meine Finger krallten sich in das Tau der Reling. Das Meer ruhig unter mir, dessen rotbraune Färbung nicht die Spiegelung des bezaubernden Sonnenuntergangs war, sondern Blut. Überall war Blut. Es schwappte an die dunklen Bordwände und hinterließ einen metallischen Geruch. Mir war übel und ich bekam kaum noch Luft.
Speere flogen durch den Himmel wie Sternschnuppen und hinterließen nichts als Tod und Trauer.
Ich wollte hier weg. Ich rang mit meinem Körper, sich sofort von der Stelle zu lösen, den Blick von den Leichen, die im Blut trieben, abzuwenden und mich irgendwo zu verkriechen. Doch ich hatte Angst. Nicht vor den grausamen Bildern, die sich in mein Hirn gebrannt hatten, aber vor ihr. Der gewissenlosesten Person auf dem ganzen Schiff. Wenn ich erwischt wurde, wie ich nichts tat, würde das Ärger bedeuten.
Befehle dröhnten über das Deck. Meistens: »Her mit den Waffen!« oder »Hier rüber!«. Der schlimmste Ausruf war aber immer noch: »Tötet sie alle! Keiner kommt lebend davon!«
Ich löste meine verkrampften Finger und trat einen Schritt zurück.
Plötzlich wurde ich herumgerissen und schmerzhaft an meinen grün und blau geprügelten Ärmchen festgehalten. Nun war kein Entkommen mehr möglich. Eine Fratze von Gesicht fixierte mich und starrte mich mit grässlicher Unerlässlichkeit an.
»Was stehst du hier so unnütz rum? Wieder einmal bist du bloß eine Enttäuschung!«, giftete mich die eisige, rauchige Stimme an.
Ich konnte nichts erwidern und das war wahrscheinlich auch das Beste.
»Mach dich endlich an die Arbeit!«, brüllte mich die Stimme an. Dann fasste sie mein Gesicht mit beide Händen und schaute mir tief in die Augen. Ihre nächste Ansage war gefährlich gelassen und so grausam, dass ich vor Furcht erschauderte: »Entweder du tust, was ich von dir verlange, oder ich werfe dich eigenhändig zu den Sirenen. Du wirst genauso armselig sterben, wie deine Mutter!«
Kapitel 1
Kayla
Ich hasste Abschiede. Abgrundtief. Sie zögerten das Unausweichliche nur hinaus. Das ganze Geplänkel über das Vermissen des anderen, die festen Umarmungen und die Tränen. Ich fühlte mich so schlecht, wenn ich ihnen den Rücken zuwenden musste. Es ließ mich wie einen Verbrecher dastehen, wie jemand der ihnen etwas entriss. Ich konnte ihnen nicht in die Augen schauen. Ich konnte es einfach nicht. Die Hoffnung und Aufmunterung darin war kaum ertragen.
Und auch wenn ich Abschiede hasste, so kannte ich sie gut. Sie waren Teil meines Lebens. Es war nicht das erste Mal, dass ich jemanden gehen lassen oder selbst gehen musste. Es wirkte vertraut, wie einen Menschen, den man immer wieder in seinem Leben traf, obwohl man gehofft hatte, ihn nie wieder zu sehen.
Doch worin ich nicht weniger gut war, waren Wiedersehen. Sie überforderten mich. Wenn ich die Freude meines Gegenübers entdeckte, wurde mir immer ganz unwohl. Ich hatte sofort das Bedürfnis, zu verschwinden. Denn mit dem Wiedersehen kehrte die Vergangenheit und ihre Probleme wieder zurück. Und vor meinen Problemen davonzulaufen hatte ich bis jetzt jedes Mal mit Bestnote absolviert.
Doch leider stand der Entschluss, den nicht ich gefasst hatte, fest. Ich konnte nichts daran ändern und so war es mir nun unmöglich, wegzulaufen.
»Fahr vorsichtig«, bat mich Mom und strich sich eine ihrer dunklen Locken aus dem Gesicht, die sich aus dem unordentlichen Dutt gelöst hatten. Sie wusste zwar, dass ich kein Fan von Umarmungen war, und trotzdem zog sie mich an sich und legte ihre Arme schützend um mich. Es war nicht die Umarmung als solches, sondern die Körpernähe, die ich nicht aushalten konnte.
Wir standen auf der Schwelle des Hauses – die Tür weit geöffnet. Draußen erblühten die letzten Blumen dieses Jahres in voller Blüte. Die Sonne erfüllte den kleinen Garten mit ihrem ganzen Glanz. Der wundervolle Geruch des Spätsommers hing in der Luft und erinnerte mich mit jedem Atemzug an die wenigen schönen Momente mit Alex.
Meine Kopfhörer spielten leise vor sich hin, als wollten sie die Szene untermalen. Sie waren die Filmmusik für meinen Film des Lebens.
Länger als ein paar Sekunden hielt ich es nicht in der Umarmung aus. Steif löste ich mich von Mom, doch sie hielt mich an den Armen fest. In ihren Augen glitzerten Tränen. »Pass auf dich auf, Schatz.« Ihre angenehme, liebliche Stimme, die gerade so viel dünner klang, schickte mir einen Schauer über den Rücken. Sie nickte kaum merklich, um ihren Worten Nachdruck zu verschaffen. Dann ließ sie mich los und ihr verschleierter Blick richtete sich auf den Garten, in der Erwartung, irgendetwas zu sehen, dass sie von diesem Abschied ablenken könnte.
Ich betrachtete das schmale, sonnengebräunte Gesicht. Die zarten Lippen, die dunkeln Brauen, die hohen Wangenknochen und die blassblauen, normalerweise strahlenden Augen. Sie hatte die Arme um ihre zierliche Gestalt geschlungen.
»Ich versuche es«, murmelte ich und war mir angesichts ihrer fehlenden Reaktion nicht sicher, ob sie es überhaupt gehört hatte. Ich schulterte meine große Tasche, griff nach dem letzten Koffer und lief die Auffahrt hinüber zur Straße, an dem mein Ford stand. Ein Geschenk von dem Mann, der mich heute empfangen würde.
Mom folgte mir schweigend, was ich ihr nicht verübeln konnte. Ihr einziges Kind zog aus, sodass sie nun wirklich allein war. Allein in diesem wunderschönen, abgelegenen Häuschen einer kleinen Stadt im Westen der USA. Und obgleich der Garten etwas verwildert war, das Gemäuer einen neuen Anstrich seiner beigen Farbe benötigte und die Ziegel des Dachs über die Jahre immer dunkler geworden waren, war dies mein Zuhause. Der Ort, an dem ich mich wohl und behütet fühlte. Der einzige Ort, der mir je dieses Gefühl gegeben hatte.
Erst jetzt wurde mir so richtig bewusst, was ich zurückließ. Eine Zuflucht, ein Zuhause.
Ich öffnete die Fahrertür und warf die Tasche auf meinen Sitz. Ein Blick nach hinten, wo sich einzelne Beutel und weiteres Gepäck stapelte. Jetzt musste nur noch der kleine Koffer auf die Rückbank, da im Kofferraum kein Platz mehr dafür war.
Ich öffnete also eine Tür weiter und sah in das umgedrehte Gesicht von Alex. Sie grinste mir frech und breit entgegen. »Überraschung!«, rief sie strahlend.
Ein Lächeln zuckte über meine Lippen und meine Augen wurden groß angesichts ihrer Position. Sie hatte sich rücklings in die Fußablage der Rückbank gequetscht, damit sie mich erschrecken konnte.
»Was machst du denn hier?«, fragte ich ungläubig. Alex sollte eigentlich in der Schule sitzen. Neben Fabio und einem leeren Stuhl, nämlich meinem.
Ihr Grinsen wurde noch breiter und sie entblößte ihre makellosen Zähne. »Nach was sieht es denn für dich aus?«, wollte sie wissen.
Ich legte mir Daumen und Zeigefinger ans Kinn und schenkte ihr einen nachdenklichen Blick. »Schule schwänzen?«, schlug ich vor.
Sie schüttelte beleidigt den Kopf, wenn das in ihrer Situation überhaupt ging. »Einer Freundin den richtigen Weg zeigen. Das ist immerhin meine Aufgabe als Freundin! Wenn du mich schon nicht mitnimmst!« Sie sah mich zwar sehr gekränkt an, doch kopfüber sah das ziemlich seltsam aus.
Ich war ihr zutiefst dankbar, dass sie es nicht Abschied oder auf Wiedersehen nannte, denn sie wusste ganz genau, wie sehr ich es verabscheute. »Ich kenne den Weg oder, besser gesagt, weiß das Navi den Weg«, erklärte ich ihr.
Sie sah mich mit diesem Blick an, dessen Aussage ich nur zu gut kannte. ›Du weißt ganz genau wie ich das meine!‹
Sie zwängte sich stöhnend aus dem Schlitz und stieg aus dem Auto. Dicht stand sie vor mir, die Hände mit den fehlerlosen Nägeln in die Hosentaschen gesteckt und ihre ungewöhnlich hellbraunen Augen schienen mich zu durchbohren. Die blonden, sonst so perfekt liegenden Haare vom Auto ein wenig zerzaust, umrahmten das wunderschöne Gesicht, das von Sorge gezeichnet war. »Nein, den kennst du nicht! Den Weg des Lebens meine ich, nicht die poplige Strecke von hier bis nach San Francisco.«
»Das sind 90 Meilen!«, protestierte ich.
Sie rollte zwar mit den Augen, beließ es aber dabei und vertiefte das Thema nicht noch mehr. »Außerdem interessiert sich niemand für Mr. Randings Unterricht!«, griff sie nochmal das Schwänzen auf und ein provozierendes Lächeln kehrte zurück.
Nun verdrehte ich die Augen, weil ihr klar war, dass Biologie eins der wenigen Fächer war, welches ich tatsächlich mochte und sogar noch gut darin war.
»Und wehe ich bekomme keine Nachrichten!«, drohte sie und sah mich ernst an. »Und mindestens fünfmal in der Woche telefonieren.«
Ich schmunzelte. »Klar.«
Damit gab sie sich zufrieden und sah mich aufmunternd an. »Ich…«, sie drehte sich zu Mom um, »…wir sind für dich da. Immer! Das weißt du, Kayla!« Dann öffnete sie die Arme und ließ mir die Wahl, ob ich die Einladung annahm oder nicht. Ganz genau dafür liebte ich sie so sehr. Es würde für sie keinen Unterschied machen, ob ich die Umarmung wollte oder eben nicht. Alex würde mir auch ohne Kuscheln zuzwinkern und es dabei belassen. Sie war für mich dagewesen, als kein anderer da war – nicht mal Mom. Sie hatte mir durch die schlimmste Zeit meines Lebens geholfen, kannte meine Schwächen und Stärken und unterstützte mich bei allem, wie bescheuert die Idee auch klang.
Meine Lippen verzogen sich zu einem glücklichen, dankbaren Lächeln. Dann legte ich meine Arme um sie und drückte sie fest an mich.
»Danke«, flüsterte ich, »Für alles!«
Ich konnte ihr zufriedenes Kichern spüren, das durch ihren Körper zuckte. »Gern geschehen, Kay.« Wir lösten uns voneinander. »Und vergiss nicht!« Sie hob einen Zeigefinger und hielt ihn wie ein Lehrer in die Luft. »Sei mutig und strahle dem Leben entgegen! Du kannst es nicht ändern, nur genießen!«
Ich schenkte ihr ein Lächeln. »Du sagst es.«
Sie nickte grinsend, lief um den Wagen und stellte sich zu Mom auf den Bürgersteig, die immer noch versuchte, sich mit ihren dünnen Armen zusammenzuhalten.
Nachdem ich den letzten Koffer auf die nun freie Bank gehievt hatte, ließ ich mich auf den Fahrersitz plumpsen. Alle Fenster waren hinuntergelassen, damit die Gefahr bei diesen Temperaturen zu ersticken, möglichst gering blieb. Ich startete den Motor und blickte ein letztes Mal zu meiner kleinen Familie.
»Du wirst geliebt, Kayla. Vergiss das nicht!«, bat Mom und zwang sich zu einem Lächeln. Ich nickte nur stumm und versuchte, die aufkommenden Tränen hinunterzuschlucken.
Wir winkten so lange, bis ich um die Kurve gefahren war und sie aus dem Rückspiegel verschwanden.
Meine Haare wehten im kühlen Fahrtwind und ich atmete erleichtert auf. Bei der Hitze eine angenehme Erlösung. Das Radio löste meine Kopfhörer ab.
Die engen, menschenleeren Straßen unserer kleinen, aber feinen Stadt wurden vom breiten, überfüllten Highway abgelöst. Es ging in Richtung Süden – San Francisco im Visier. Sofort kamen mir Alex Worte wieder in den Sinn. Der Weg des Lebens. Eine wunderbare Metapher. Wie sagt man? Er ist steinig und schwer und wird niemals gerade verlaufen? Dann musste ich wohl schon sehr früh abgekommen sein, wenn ich mich nun hier befand. Auf direktem Weg zu dem Mann, der mir das Auto geschenkt hatte. Zu dem Mann, der meiner Mutter die Welt versprochen hatte und ihr dann die Verantwortung seiner eigenen Fehler vorgeworfen hatte. Mein Dad.
Mom war Deutsche und schon in jungen Jahren ausgewandert, um sich hier ihren Traumjob als Übersetzerin zu erfüllen, wo sie Dad traf und sich sofort in ihn verliebte. Warum auch nicht? Er hatte so gut ausgesehen. Damals und auch noch heute, wobei ich ihn das letzte Mal vor vier Jahren gesehen hatte. Ein wirklich hübsch anzusehendes Pärchen waren sie gewesen. Glücklich und zufrieden. Mom hatte ihren Abschluss gemacht und Dad war ein Wissenschaftler und Forscher durch und durch. Die Welt faszinierte ihn und bei der Mutter hatte er die besten Aussichten mal ganz groß rauszukommen.
Doch irgendwann kamen Unstimmigkeiten auf, sodass sie sich entschlossen, dass es wohl das Beste wäre, sich zu trennen. Ich blieb noch ein paar Wochen bei Dad. Nur so lange, bis ich das Schuljahr beendet hätte. Erst dann zog ich zu Mom. Ein Stadtkind plötzlich auf dem Land. Es dauerte eine Weile, bis ich mich so richtig eingelebt hatte, aber mir gefiel das Haus und die freundlichen Nachbarn, die Gemeinschaft der Stadt und das gegenseitige Helfen.
Wäre da bloß nicht die Schule gewesen. Dort liefen, bis auf wenige Außenseiter, nur hochgestylte Schickimicki-Tussen und eingebildete Jungs rum. Ich fühlte mich nicht richtig auf meiner Schule. Und wäre Alex nicht da gewesen, wüsste ich nicht, wo ich jetzt wäre. Erst hatte ich gedacht, dass sie eine von vielen wäre. Dabei musste ich jetzt noch schmunzeln. Sie mit ihrem perfekten und gepflegten Äußeren, doch sie war anders als die anderen. Hilfsbereit, zuvorkommend, aufmerksam und aufopfernd. Eine Freundin. Eine wahrhaft wahre Freundin. Die Erste und Einzige, die ich hier je gehabt hatte. Mit dem größten Herzen, das ich kannte. Sie hatte etwas Mütterliches, etwas Fürsorgliches. Sie war für mich da gewesen, als es niemand anders war. Nicht mal Mom, der wegen ihrem Job nur wenig Freizeit blieb. Sie übersetzte immer noch, doch das brachte gerade so viel ein, um uns über Wasser zu halten. Und die lachhaften Beträge, die uns Dad jeden Monat schickte, brachten die Wut in mir immer wieder zum Kochen.
Ich hätte alles getan, wirklich alles, um nicht zu ihm zurückzukehren. Doch es gab keine andere Möglichkeit, die ich nicht schon doppelt probiert hatte.
***
Knapp zwei Stunden später erreichte ich San Francisco. Oder, besser gesagt, eine seiner kleinen Vorstädte. Das Haus meines Dads lag am Rande der Stadt. Eine richtige Villa, auf einer Klippe direkt am Meer. Groß, geräumig und für mich schon immer zu groß. Der helle Sandstein schien von innen heraus zu strahlen. Die lange Auffahrt, auf der schon zwei schwarze Autos geparkt waren und der blitzblanke Garten, bei dem kein Grashalm einen Millimeter höher war und kein einziger Zweig aus der Hecke herausstach, ließen mich innerlich brodeln. Er lebte hier in Saus und Braus und Mom und ich hatten nur so viel, wie es zum Überleben reichte. Ich schüttelte abfällig den Kopf. Das war nicht der Teil meiner Familie, den ich mochte. Ehrlichgesagt machte es mich richtig zynisch.
Ich parkte breit vor der Ausfahrt und schnappte mir meine Kopfhörer, die mich wortwörtlich überallhin begleiteten. Ich hörte viel Musik, eigentlich den ganzen Tag. Dafür sang ich eher selten. Das lag weniger an meinem fehlenden Talent des Singens oder dem Rhythmusgefühl. Das Problem bestand eher am nicht vorhandenen Mut. Meine größte Angst war, dass mich jemand singen hören könnte. Ich selbst fand eigentlich, dass meine Stimme recht schön klang. Viel Power, viel Gefühl und ein relativ großer Tonumfang. Aber das Singen war für mich eine Art des Ausdrucks. Etwas ganz Persönliches und Intimes. Songs konnten mich durch jede mögliche Gefühlsachterbahn begleiten. Mehr als alles anders. Nichts berührte mich seelisch so extrem, wie die Musik und das behielt ich gerne für mich.
Außerdem war sie meine ganz eigene Therapie. Wenn ich die Musik ausschaltete, wurde es still um mich. Und die Stille war um ein Vielfaches schrecklicher. Sie war mein persönlicher Albtraum.
Ich nahm meine Tasche und ließ den restlichen Kram im Auto liegen. Dann machte ich mich auf den Weg zum Haus. Über zwei Stockwerke erstreckte sich der weiße Riese und ich musste fast die Augen zusammenkneifen, da mich das reflektierende Sonnenlicht blendete.
Der beispiellose Rollrasen erstreckte sich über viele Quadratmeter um das gesamte Anwesen. Von allen beachtlichen Villen auf diesem Hügel, von dem man einen wunderschönen Blick auf San Francisco werfen konnte, war das von meinem Dad das wohl prunkvollste. Dieser Streifen Land war nicht günstig. Im Gegenteil. Allein der Grund und Boden kostete ein halbes Vermögen. Dafür waren der Ausblick und die Zeit, um zum Meer zu gelangen, ein gigantischer Pluspunkt. Fünf Minuten dauerte der Weg hinunter zu dem kleinen Strand. Völlig unbeobachtet und privat, ja fast schon heimelig. Klar hatten die Erbauer dieser Schlösser einen eigenen Zugang unter der Erde mit eingeplant, aber war der Pfad mit den bewachsenen Stufen, den eh niemand benutzte, nicht viel schöner und mysteriöser?
Als ich an der Glastür ankam, die mir einfach übertrieben vorkam mit ihren Verzierungen, stand schon eine Frau zur Begrüßung da. Sie war kleiner als ich, etwas untersetzt und hatte ein freudiges, höfliches Lächeln auf den Lippen. Dennoch war ihr Gesicht von strengen Zügen gezeichnet. Ihre roten Apfelbäckchen zeugten von ihrer Arbeit im Haus.
»Guten Tag, Ms. Hunt. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Anreise?«, begrüßte sie mich und neigte den Kopf ein wenig. Mein Bauch krampfte sich zusammen. Den Namen meines Vaters hätte ich am liebsten so schnell wie nur möglich abgelegt, doch da ich noch nicht alt genug war, musste ich ihn wohl noch ein halbes Jahr über mich ergehen lassen.
»Hallo Alfreda, nenn mich doch bitte Kayla«, bat ich sie freundlich, aber bestimmt, »Ja, die Straßen waren etwas überfüllt, aber sonst ein gutes Durchkommen heute.« Alfreda war die oberste Haushälterin. Nichts in diesem Haus passierte, ohne dass sie davon wusste. Trotzdem war sie sehr verschwiegen und eine treue Seele, die in den Jahren, in denen ich allein bei Dad gewohnt hatte, ein stückweit mein Mutterersatz gewesen war. Und dafür war ich ihr bis heute sehr dankbar. Deshalb fand ich auch, dass die förmliche Anrede übertrieben war. Ja, ich war älter gewesen, aber die Beziehung, die wir beide pflegten, war sensibler als ›Ms. Hunt‹.
»Soll ich Harold Bescheid geben, ihr Gepäck schon aus dem Auto zu holen?«, fragte sie sachlich.
Ich überlegte, warf einen kurzen Blick zurück zu meinem tannengrünen Ford, der neben dem Audi und dem Porsche irgendwie billig aussah, und wendete meine Augen wieder zu Alfreda. »Gerne, aber sie sollen vorsichtig damit sein«, gab ich als Antwort.
Die kleine Haushälterin wirkte zufrieden. »Natürlich.«
Ich richtete meinen Blick nach innen. Kastanienbraunes Parkett bedeckte den Eingang, auf dem kein einziges Staubkorn zu sehen war. Penibel wie immer.
»Ihr Vater erwartet sie in seinem Labor«, fügte sie noch hinzu und wartete keine Erwiderung ab, sondern nickte als Bestätigung, dass ihre Arbeit hier getan war. Dann drehte sie sich um und verschwand hinterm Haus.
Beim Betrachten des weißen Kastens hatte ich nicht das Gefühl von Heimat. Tatsächlich spürte ich gar nichts. Es war nicht das Nachhausekommen, wie schon so viele Male zuvor. Dieses Haus und seine Bewohner hatten nichts an sich, das mich wieder wie zuhause fühlen ließ.
Da stand ich also nun. Gekleidet wie eine Bäuerin im Vergleich mit diesem übertriebenen Luxus. Ich legte den Kopf schief, reckte die Nase und lief durch die große Tür. Der sterile Geruch von Putzmittel und Desinfektion umfing mich. Nichts im Vergleich zu meinem alten Heim, wo es immer nach frischem Lavendel gerochen hatte.
Der kurze Korridor öffnete sich zu einem riesigen Raum, der bis zum obersten Dach reichte. Das Wohnzimmer. Eine gigantische Wohnlandschaft war wie ein U vor dem riesigen Fernseher gestellt. Der beige Bezug war sauber und unbenutzt. Das Haus wäre wunderbar für Partys und rauschende Feiern ausgelegt, wenn sich Dad überhaupt für so etwas interessieren würde.
Rechts an der Wand führte eine breite Treppe aus weißem Marmor hinauf in den ersten Stock, in dem die ganzen Schlafzimmer und Badezimmer untergebracht waren. Geradeaus würde ich nur in die Küche kommen, die mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit genauso aussehen würden, wie der Rest des Anwesens. Leer, unbewohnt, glänzend. Eine weitere Glastür führte in den Garten hinaus.
Alfreda hatte gesagt, dass Dad im Labor war, denn das war auch das Einzige, auf das Dad so richtig stolz war. Es befand sich im Keller und war wie der Teil über der Erde, auf zwei Ebenen verteilt.
Kurz dachte ich darüber nach, einfach hinauf in mein Zimmer zu gehen und mich bis zum Essen zu verschanzen. Wenn es hier etwas wie gemeinsames Essen überhaupt noch gab. Ich konnte mich nur zu gut an die Zeit damals erinnern, als ich immer allein dasaß. Dad war viel zu versunken in seiner Arbeit, sodass er Essen und Trinken aus dem Fokus verlor. Die Wissenschaft war seine persönliche Droge. Wenn Alfreda ihm nicht jeden Tag die Speisen hinuntergebracht hätte, dann wäre er vermutlich schon tot gewesen.
Doch für eine knappe Begrüßung konnte ich mich noch aufraffen, denn meine Koffer und Umzugskartons waren sicher noch nicht oben, also nutzte mir das eh noch nichts.
Ich lief um die schwere Treppe herum und durch eine relativ unscheinbare Tür in der Wand unter den weißen Stufen. Ein geräumiges Treppenhaus kam zum Vorschein, das mit weißem Licht erhellt wurde. Dunkle, rustikale Fichtenbretter führten in einer Kreisbewegung hinab. Das silberne Geländer war blitz und blank gewischt. Nichts deutete darauf hin, dass hier viele Leute auf und ab gingen. Alles wirkte so unbenutzt.
Ich seufzte und wagte mich dann die Stufen hinunter, die keinen Mucks von sich gaben. Kein Knarzen und kein Quietschen. Nicht wie Daheim, wo ich das Gefühl gehabt hatte, das Haus würde atmen, es würde in Frieden mit uns leben.
Ich erreichte das erste Tiefgeschoss und blickte den langen Korridor entlang. Wie im Treppenhaus erleuchteten starke LED-Leuchten das Untergeschoss. Das teure Parkett war auch hier ausgelegt und die weißen Wände waren mit Auszeichnungen, Preisen und Bildern behangen. Es wirkte fast häuslich und das erste Mal, seitdem ich das Anwesen betreten hatte, spürte ich so etwas wie die Persönlichkeit der Villa. Zwar immer noch sehr einfach und steril gehalten, aber dennoch hatte es etwas Familiäres. Oben war es nur wie eine Theaterkulisse, während hier unten das richtige Leben begann. Das Leben des Simeon Hunt.
Den gesamten Gang entlang, der sich viele Meter bis zu einer Ecke erstreckte, führten dutzende unscheinbare Türen in die Lagerräume, Kühlkammern oder auch zu den größeren, kostspieligeren Geräten, die eher selten benutzt wurden.
Ich sah mich nur eine kurze Weile um, bis ich die nächsten Stufen hinunter trabte. Die Etage mit den eigentlichen Laboren. Der Korridor war parallel zum oberen gebaut und sah im Großen und Ganzen auch so aus. Der einzige Unterschied waren die Fenster. Jedes Labor hatte ein eigenes Fenster, durch das man vom Gang in den Raum hinter der Wand blicken konnte. Dadurch konnten Schüler bei gefährlicheren Unterrichtseinheiten von außen zusehen. Soweit der zuständige Laborant den Vorhang nicht zugezogen hatte.
Es fühlte sich an, als wäre ich nie weggewesen. Alles hatte seinen alten Platz, auch wenn ich dazusagen sollte, dass kein Schrank oder Regal den Flur säumte.
Dads Labor befand sich ganz hinten. Ich stiefelte also los. An zahlreichen undurchschaubaren Fenstern und unbeschrifteten Türen vorbei, die alle einander glichen wie Zwillinge. Eigentlich hätte ich erwartet, dass mehr los war. Sonst waren Menschen in weißen Kitteln durch die Gänge geeilt und eine friedliche, zufriedene Atmosphäre hatte den Keller ausgefüllt. Früher war ich gerne hier unten. Vielleicht mochte ich deshalb den Biologieunterricht bei Mr. Randings so. Weil ich einen Großteil meines Lebens in einem Labor aufgewachsen war. Zwischen Erlmeier-Kolben, Reagenzgläsern und gefährlichen chemischen Substanzen. Ich fand es jedenfalls immer spannend und Dads Kollegen hatten mich eingeführt in das aufregende Leben eines Welterkunders. So hatte ich es jedenfalls damals empfunden. Abenteuerlich, halsbrecherisch und ereignisreich. Ich war wirklich wissbegierig gewesen und hatte jedes Wort meiner Lehrer in mir aufgesogen, hatte den viel zu großen Kittel mit Stolz und Ehrfurcht getragen und einem breiten Zahnlückengrinsen.
Doch das war mal, vor vielen Jahren einmal. Nun herrschte nur eine erdrückende Stille, wären da nicht meine Kopfhörer gewesen, und das unangenehme Gefühl der Leere, der Einsamkeit. Nicht nur im Keller, sondern auch in mir. Freudlosigkeit und Niedergeschlagenheit lagen in der Luft.
Doch es konnte ja sein, dass das Team Urlaub hatte. Anders konnte ich mir die Stille hier nicht erklären.
Als ich den Korridor entlangschlenderte, kam ich zur Ecke, die nach rechts führte. Dort hinten lag Dads Büro und sein eigenes riesiges Labor.
Fast wäre ich mit einem großen Mann zusammengestoßen, der um die Kurve gerauscht kam. Seine Augen waren auf das Klemmbrett in seinen Händen gerichtet und wäre ich nicht im letzten Moment zur Seite ausgewichen, hätte ich nun eine Beule an der Stirn.
Der Mann fuhr erschrocken herum und sah mich verdutzt durch seine große runde Brille an. Verwirrung erstreckte sich über sein gesamtes Gesicht. Er blinzelte einmal, zweimal, bevor sich sein Mund zu einem ungläubigen Schmunzeln verzog. »Kayla?«, fragte er völlig überrascht.
Ich hob die Schultern und legte den Kopf schräg, dann nickte ich. »Das bin ich wohl. Hallo Daniel.«
Daniel kam gar nicht aus dem Staunen heraus. »Du bist hier?«
»Wie es scheint«, erwiderte ich und betrachteten den ehemaligen Praktikanten von Dad. Schon krass, was die Zeit mit Menschen anstellte. Ich erinnerte mich noch genau an ihn. Von allen Mitarbeitern war er mir der liebste gewesen. Er war ein staksiger, großer Junge mit derselben großen Brille wie heute gewesen. Seine kaffeebraunen Locken waren ihm immer in den grauen Augen gehangen. Sie erinnerten ein bisschen an Wolle. Weich und kuschelig. Ich fand immer, dass er aussah wie ein richtiger Nerd. Dan hatte den geilsten Humor und zu jeder Zeit gute Laune und einen lustigen Spruch parat. Ich musste zugeben, dass ich mich damals ein wenig in ihn verliebt hatte. Und dass ich ihn so angehimmelt hatte, wenn er mich zu Gesicht bekam, hinterließ noch heute ein heißes Glühen auf meinen Wangen.
Nun, vier oder fünf Jahre später, hatte er einen richtigen Wandel hinter sich. Die Haare waren ganz kurz geschnitten und störten ihn nicht mehr. Die schlimme Akne war von seiner Haut verschwunden und das schwarze einfache T-Shirt spannte sich über die definierten Oberarme. Die Brille ließ ihn irgendwie attraktiver, männlicher und nicht wie einen pubertierenden Jugendlichen aussehen.
Er beäugte mich mit derselben herzlichen Ausstrahlung wie damals.
»Was machst du hier? Wie geht es? Und wie geht es Elise?«, erkundigte er sich. Ich fand es echt süß, dass er versuchte, den altdeutschen Namen meiner Mutter richtig auszusprechen.
»Uns geht es soweit gut, danke. Gab nur ein paar Probleme an der alten Schule«, erklärte ich knapp.
»Schön«, meinte er lächelnd und betrachtete mich, bis ihm auffiel, dass er mich anstarrte. »Ähm, ich muss dann auch los. Ich schätze, du willst zu deinem Dad. Er ist im Labor«, schob er nach und wies mit dem Kopf hinter mich.
Ich nickte. »Na, dann richte deiner Mutter einen Gruß aus. Wir sehen uns.« Und damit war er auch schon davongelaufen. Es hatte fast den Eindruck, als würde er vor mir fliehen.
Einen kurzen Augenblick sah ich ihm noch hinterher, wie er leichtfüßig die Treppe hinaufsprang. Ja, Daniel Shendley hatte sich schon zu einem echten Schnittchen verwandelt. Wäre er nicht Jahre älter als ich. Obwohl ich wusste, dass Alter nur eine Zahl war, wusste ich, dass das zwischen uns nie etwas werden würde. Wir passten einfach vom Typ her nicht zusammen.
Ich setzte meinen Weg fort und nachdem ich dort angekommen war, entdeckte ich Dad durch das Fenster zu seinem Labor. Bestürzt musste ich feststellen, dass er noch schlimmer aussah als damals, als ich ihn verlassen hatte.
Egal wie viel er gearbeitet hatte, so hatte er doch immer auf ein gepflegtes Äußeres geachtet. Jetzt war ich schon fast geschockt darüber, wie er sich hatte gehen lassen. Das Haar, das ihm schon zu den Schultern reichte, war fettig und strähnig. Die Augenringe waren noch dunkler und tiefer geworden und seinen Lippen fehlte jegliche Farbe. Er war blass und wirkte müde, krank. Er ließ die Schultern hängen und die aufrechte, stolze Haltung, die er sich immer bewahrt hatte, war verschwunden. Was war aus ihm geworden?
Er stierte in sein Mikroskop und war ganz mit seiner Probe auf dem Objektträger beschäftigt, den er vorsichtig und konzentriert hin und her schob. Die langen Finger waren dünner geworden und ein Schnitt seiner Nägel war längst überfällig.
Seine Tür war nicht zugesperrt und so setzte ich einen gelangweilten Blick auf und trat nach kurzem Klopfen ein. Langsam sah er auf und drehte den Kopf. Als mich seine ausdruckslosen Augen trafen, trat ein Strahlen in sie.
»Kayla!«, rief er, »Hallo Süße!«
Missbilligend musterte ich ihn. Das konnte er sich wirklich sparen. »Hallo Dad«, erwiderte ich lieblos. Die Freude verschwand aus seinem Gesicht und ein mir nur allzu bekannter Zug legte sich darüber. Es war derselbe Blick, mit dem er Mom angesehen hatte, wenn er ihr wieder nicht richtig zuhören wollte.
»Bist spät gekommen.« Eine Anschuldigung, keine Feststellung. Und trotz des eisigen Tons, der sich plötzlich in seine eigentlich ziemlich warme Stimme gelegt hatte, blieb ich ruhig und gelassen. Ich ließ mich nicht von ihm anmachen. Nicht, wenn er so abfällig mit mir sprach, wie er mit Mom geredet hatte.
»Na, und?«, zischte ich unter zusammengepressten Zähnen. Er hatte sich nie um mich gekümmert, warum sollte es ihn jetzt interessieren? Ich wollte doch auch nicht hier sein.
»Morgen fängt für dich die Schule an«, bemerkte er und widmete sich wieder seiner Probe. Die Aufmerksamkeit galt nicht mehr mir und signalisierte mir gleichzeitig sein fehlendes Interesse.
»Und das sollte mich beunruhigen, weil?«, fragte ich und versuchte, seinen vorwerfenden Ton zu ignorieren.
»Ich dachte, dass du dich vielleicht etwas besser einleben kannst, wenn du wieder nach Hause kommst«, erklärte er.
Ich schüttelte den Kopf und stieß ein belustigtes Stöhnen aus. »Das ist schon lange nicht mehr mein Zuhause.«
»Kayla, sei doch nicht so…«
»Was?«, unterbrach ich ihn, »kindisch? So trotzig? Was erwartest du denn von mir? Dass ich gerne hierher zurückkomme? Dass ich es freiwillig getan hab?« Ich wartete einen Moment. »Ich habe es so lange hinausgezögert, wie es nur ging«, gab ich ehrlich zu. »Warum hätte ich auch früher herkommen sollen? Hm? Du bist doch eh nur hier unten. Was hätte ich tun sollen, als hübsch in meinem Zimmer zu sitzen? Wozu?«
Seine Augen fanden die meinen und ein zorniger Ausdruck legte sich über sein Gesicht. »Du wirst nicht so mit mir reden! Hast du verstanden, Kayla?! Ich bin dein Vater!«
»Ja«, rief ich, »Ja, einer, der nie da war, als ich ihn gebraucht hätte!« Meine Gleichgültigkeit ließ ihn verstummen. Innerlich bebte ich, doch äußerlich musste ich genau diesen Anschein abwerfen. Ich spürte meine Stimme zittern und sprach hoffentlich deutlich genug, dass er es nicht mitbekam. »Einer, der tatenlos zugesehen hat, als Mom und ich jeden Monat gekämpft haben, um über die Runden zu kommen. Du hast einfach zugelassen, was Grandma alles gemacht hat.« Was sie mit mir gemacht hat. Ich spürte die Tränen in meinen Augen brennen, aber ich ließ nicht zu, dass er sie sehen würde. Ich würde ihm nicht zeigen, was wirklich in mir vorging. Wie verletzt ich eigentlich war, wie gebrochen. Wie ich von meiner Vergangenheit terrorisiert war. Mir war bewusst, dass alles nicht so einfach war, aber sein Blick, der an meinem Einschätzungsvermögen zweifelte, machte mich rasend. Doch er würde niemals die Gelegenheit bekommen, diese Emotionen auf meinem Gesicht zu sehen. Ich schluckte die Tränen hinunter und setzte die kalte Maske auf, die so lange perfektioniert worden war.
»Kayla, Süße, es tut mir leid. Ich wollte nicht…«, er stockte und sah mich entschuldigend an. Der Hundeblick, um mich zu besänftigen. Wie oft er Mom damit angesehen hatte, hatte ich irgendwann nicht mehr zählen können. Sie hat ihm jedes einzelne Mal eine Chance gegeben. Zu viele, viel zu viele.
»Ja, mir auch«, sagte ich zwar, obwohl meine Stimme und mein Gesichtsausdruck das Gegenteil bewiesen. Ich meinte es nicht so und das wusste er ganz genau. Trotzdem nickte er, als würde er die Entschuldigung annehmen, die gar nicht existierte.
Ich empfand das Gespräch für beendet, kehrte ihm wortlos den Rücken zu und spazierte mit einer geübten Lässigkeit aus der Tür. Ich hatte nicht so lange gekämpft, um nun daran zu zerbrechen.
»Falls du Hunger hast, kannst du dir was aus der Küche nehmen«, hörte ich ihn noch rufen, bevor die Tür mit einem Klacken ins Schloss fiel. Als ich außer Sichtweite seines Fensters war, ballte ich die Hände zu Fäusten. Ich war innerlich so aufgebracht, wie lange nicht mehr. Schon fast seit… mir lief ein eiskalter Schauer über den Rücken und die schrecklichen Bilder kehrten zurück und ich konnte nichts dagegen tun. Ich musste mich an der kühlen Wand abstützen, da das grausame Zittern meine Beine zum Wanken brachte. Mein Herz pochte rasend schnell in meiner Brust. Ich hatte das Gefühl, keine Luft zu bekommen und holte panisch Luft. Ich hörte das Kratzen von Metall auf Metall, ein gehässiges, genießerisches Lachen. Die Erinnerungen kamen wieder hoch, nahmen meine Gedanken ein und ließen die furchtbaren Gefühle wieder hochkommen. Ich begann zu beben und fühlte mich, als würde ich fallen. Ich sah den Boden immer weiter auf mich zurasen und wartete nur darauf, dass ich mit einem dumpfen Knall aufschlug.
Mit zitternden Fingern tastete ich nach meinem Handy und krallte die Finger in das Gerät, aus Angst, es könnte mir aus den Fingern rutschen. Dann erhöhte ich die Lautstärke meiner Kopfhörer bis zum Anschlag.
Ich redete mir immer wieder ein, zu atmen und den Text in Gedanken mitzusingen. Ich durfte mich nicht von diesen Episoden der Finsternis übermannen lassen! Ich musste kämpfen!
Ich summte die Melodie, die die grausamen Bilder langsam aus meinem Kopf vertrieb. Nur stockend wurde meine Sicht klarer und das Zittern ließ nach, obwohl ich immer noch auf weichen Knien stand.
Als ich das Gefühl hatte, meine Gedanken und meinen Körper wieder unter Kontrolle zu haben, holte ich abgehackt Luft und ließ sie ganz langsam wieder entweichen. Bebend stand ich in dem weißen Licht des Korridors, die Arme um mich geschlungen. Zögernd begannen sich meine Muskeln zu entspannten und erst dann lief ich weiter.
Ich ließ den Keller auf schlotternden Beinen hinter mir, machte einen kurzen Abstecher in die Küche, um mich mit allem Notwendigen auszustatten und schlenderte in versuchter Ruhe die Marmortreppe hinauf in den ersten Stock.
Mein altes Zimmer war schnell gefunden. Es sah noch genauso aus, wie ich es verlassen hatte. Sogar die ganzen Kartons und Koffer, die Harold und seine Truppe hierhergetragen hatten, brachten die Erinnerungen an den Umzugstag wieder hoch. Harold war wie Alfreda der Mann für alles. Während unter Alfreda der ganze Hausmädchenzug stand, war Harold der Typ, der die Männerbrigade anwies. Beispielsweise den begnadeten Koch Jake oder die Gärtner.
Ich verbrachte den restlichen halben Tag mit Auspacken, Essen und dem Telefonieren mit Alex. Sie redete mir gut zu und erzählte von ihrem Tag daheim. Und nachdem ich sie gebeten hatte, sich gut um Mom zu kümmern, hatten wir das Gespräch beendet.
Der Tag neigte sich langsam dem Ende zu. Meine Vorräte, die ich mir aus der Küche genommen hatte, waren schon zur Hälfte weg und niemand sonst war unterwegs. Kein Geräusch im ganzen Haus war zu vernehmen. Zwar hatte sich Dad nicht mal blicken lassen, aber wirkliche Hoffnungen darauf hatte ich sowieso nicht gehegt. Warum auch? Er hatte es damals nicht getan, er würde es heute nicht tun.
Mein Zimmer sah eigentlich ganz gut aus. Es war nicht so groß, wie man es beim Anblick des Hauses hätte vermuten können. Eher klein und fein. Gegenüber der Tür war das riesige Fenster, das die ganze Wandbreite umfasste. Ich hatte den perfekten Ausblick auf San Francisco. Wie nach und nach die Lichter angingen und das Nachtleben erwachte. Unter dem Fenster standen der schlichte weiße Schreibtisch und rechts daneben der Schrank, in dem meine ganzen Klamotten Platz gefunden hatten, trotz seiner sparsamen Größe. Das Bett war wahrscheinlich das einzig wirklich Große hier drinnen. Wenn es anders gewesen wäre, dann hätte ich mich beschwert. So klein mein Zimmer bei Mom auch gewesen sein mochte, so breit war mein Bett dennoch gewesen. Das war das Einzige, worauf ich wirklich Wert legte. Einen guten Schlaf. Es stand gegenüber dem Schreibtisch, gleich links neben der Tür.
Eine weitere Tür führte ins geräumige Badezimmer. Dusche, Badewanne und zwei Waschbecken. Dazu ein schmaler unscheinbarer Schrank zur Verstauung meiner Kosmetik und natürlich einem gigantischen Spiegel über den Waschbecken, der die gesamte Wand ausfüllte.
Doch nun, da ich mich an den weißen Wänden sattgesehen hatte, wollte ich etwas tun. Zum Lesen fehlten mir zum einen die geliebten Bücher, die ich wegen fehlendem Platz und ihrer Sperrigkeit im Koffer nicht mitnehmen konnte und zum anderen die Lust. Also warf ich mir einen Pulli über, packte das Handy in die Hosentasche und verband es mit den Kopfhörern, anstelle der Musikbox, die mich ebenfalls begleitete. Egal wohin.
So ausgestattet verließ ich das Haus. Ich hörte ein ruhiges Piano, das Cover der besten Barbiesongs spielte und spazierte entspannt an den gigantischen Villen vorbei - die eine prunkvoller und luxuriöser als die andere. Die angenehm kühle Abendluft strömte durch meine Lungen und hinterließ ein zufriedenes Lächeln auf meinen Lippen. Die Sonne schickte ihre letzten Sonnenstrahlen übers Meer zu mir hinüber. Ihr Untergang malte purpurne, fliederne und brombeerfarbige Schlieren in den Himmel, während sich ihr helles Glühen auf der dunkeln Meeresoberfläche spiegelte.
Trotz des Pianos hörte ich ein paar Vögel leise zwitschern, die sich in den wenigen Bäumen der Gärten niedergelassen hatten. Weit entfernt klang der Lärm der Großstadt, der auf wundersame Weise in die Geräuschkulisse passte. Normalerweise hätte ich es als störend empfunden, doch jetzt stimmte das Gesamtbild. Es gehörte dazu.
Als ich an der Abzweigung angekommen war, die hinunter zum Meer führte, hielt ich an und sah hinunter. Die schmalen Stufen, die ganz einfach aus der Erde gehoben worden waren, waren kaum zu erkennen, so dunkel war es schon geworden. Wenn ich jetzt hinabsteigen würde, wäre die Wahrscheinlichkeit irgendwo auszurutschen und dann verdreht und mit gebrochenen Knochen dazuliegen bei meinem Glück sehr hoch. Besonders da Dad sowieso nicht nach mir suchen würde und die Stufen ganz unten am meisten bewachsen waren. Außerdem würde ich mich ziemlich lange dorthin setzen und die Zeit aus den Augen verlieren.
Also verschob ich das Treffen mit dem Meer auf morgen Abend und entschied mich, die Runde mit einer kurzen Erkundungstour der Nachbarschaft zu beenden. Einfach umzudrehen wäre doch zu langweilig gewesen.
Ich setzte meinen Weg fort und während ich weitere Kilometer zurücklegte, wurden die übertriebenen Anwesen von gemütlicheren, häuslicheren Bauten abgelöst. Sie besaßen nicht mehr diese kalte Ausstrahlung, sondern einladende, freundliche Farben in Pastelltönen. Hellblau, gereiht an gelb, gereiht an altrosa. Die Gärten wurden kleiner und etwas wilder, familiärer und heimeliger. Überall waren Beete angelegt, in denen sich Gemüse in die Höhe streckte oder Blumen in allen möglichen Farben wuchsen. Dieses Viertel gefiel mir um einiges besser. Die traditionelle viktorianische Bauart der Häuser war wunderschön im Vergleich zu unserem Kasten. Vergiebelt und verwinkelt, mit Türmchen und kleiner Veranda vor dem Eingang, vielen Fenster und meist einer Treppe zur Tür.
Ja das waren wirklich schöne Häuser. Traditionell von außen und modern innen, so würde ich mir mein Haus vorstellen. Es müsste nicht sehr groß sein, oder viel Platz haben. Nur das Nötigste.
Der Umgebung und simplen Pianostücke war es geschuldet, dass ich mich in der Musik verlor. Sie gab mir das Gefühl von Ruhe und Geborgenheit. Etwas, das ich zu schätzen gelernt hatte in den letzten Jahren. Ich hatte es verloren und wiedergefunden. Und das nur durch Alex und Mom.
Die zarten Klänge der Töne verklangen und zurück blieb die kurze Stille zwischen zwei Liedern. Der schlimmste Teil von allem. Mein Handy hatte ein paar Macken, sodass ich es nicht einstellen konnte, dass ein Song in den Nächsten überging, damit die Stille verschwand. Für ein Neues hatte das Geld nie gereicht, und Dad danach zu fragen, hatte ich nie fertig gebracht.
Aber ich musste verwundert feststellen, dass es die Stille nicht gab. Ich nahm die Kopfhörer aus den Ohren und lauschte aufmerksam. Ganz leise hörte ich etwas. Es waren die gedämpften Klänge einer E-Gitarre. Sie waren einfach und sanft und holten etwas in mir hervor, was schon lange nicht mehr da gewesen war – Neugier.
Ich lief los, ließ mich von den bezaubernden Klängen leiten. Zuerst hörte ich das Intro von »See you again« und hatte gleich Flashbacks von »Fast and the furious«. Gänsehaut überflutete meinen Körper. Meine Atmung beschleunigte sich, als ich anfing zu laufen und mein Puls schoss vor Freude in die Höhe, wieder einmal etwas erleben zu dürfen. Obwohl dem Klang einer E-Gitarre zu folgen wohl kaum einem Abenteuer gleichzusetzen war. Die Gitarre ging nun zu der Strophe über und aus den einzeln gezupften Saiten wurden rauen, groben Akkorden, die mit so einer Präzision gespielt wurden, dass ich jede noch so kleine Tonveränderung hören konnte.
Durch dunkle Gassen und über schlecht beleuchtete Straßen führte sie mich. Ich hatte zwar die Orientierung verloren, aber das war im Moment nicht von Bedeutung. Alles, was zählte, war die Gitarre, die so wundervolle Klänge von sich gab. Mein Körper und meine Ohren sehnten sich nach der Musik. Ich wollte sie deutlich hören, wollte ihr lauschen und mich in den Emotionen verlieren, in den Gefühlen der Töne eintauchen. Ich lief, die Melodie als Navi.
Dann, endlich, kam ich zu einem Haus. Es war vollkommen finster, wäre da nicht das Licht, das aus einem offenen Fenster im 1. Stock schien. Die Vorhänge waren zwar zugezogen, doch sie waren so dünn, dass ich die Konturen einer Gestalt erkennen konnte. Es war ein junger Mann, der sich über seine Gitarre beugte. Sein etwas zerzaustes, unordentlich aussehendes Haar fiel ihm wild ins Gesicht. Ich konnte die Schnelligkeit seiner Finger beobachten, die über die Saiten tanzten. Gefangen in dem Moment starrte ich hinauf. Gefangen von seiner Art und Weise, dieses großartige Stück zu spielen, versank ich im Reich seiner Klänge. Im Rhythmus der Musik wiegte ich mich hin und her, mein Fuß klopfte den Takt mit und mein Kopf nickte. Die Melodie durchflutete mich mit einem Gefühl der Zufriedenheit und Zuversicht. Sorglos summte ich ein wenig mit, ohne eine Spur von Angst oder Furcht. Als der Gitarrist zum Solopart kam, kam ich aus dem Staunen gar nicht mehr hinaus. Wie von allein schlossen sich meine Augen. Da waren nur noch ich, die Dunkelheit und die wilden, unzähmbaren Laute der E-Gitarre.
Als die Bridge kam, konnte ich mich nicht mehr zurückhalten. Die kurze Sanftheit, und wie er sich für diesen Moment ein wenig zurücknahm in der Lautstäke und Intensität, brachte mir die Gänsehaut wieder zurück.
Ich stimmte den ersten Ton an und sang ganz leise mit. Nur für mich und diese Nacht. Die Welt bestand aus leuchteten Farben vor meinem Auge, als die Gitarre und ich ein letztes Duett anstimmten. Der Moment wirkte unwirklich und magisch.
Obwohl er sich so sachte in meinen Spaziergang geschlichen hatte, verstummte die Gitarre nun schlagartig. Mein Blick glitt hinauf zu dem Fenster. Der junge Mann saß immer noch dort und bewegte sich nicht. Starr blickte er geradeaus, fast so, als wäre er sich nicht sicher, ob er gerade eine weitere Stimme gehört hatte oder nicht.
Eilig lief ich weiter. Die Beklommenheit in meiner Brust war verschwunden. Ich fühlte mich frei und losgelöst. Meine Seele war glücklich und strahlte. In meinen Ohren tönte immer und immer wieder dieselbe Melodie.
Erst als ich zwei Straßen weiter war, erlaubte ich mir, anzuhalten und die restliche Magie dieses Momentes in mich aufzunehmen, in vollen Zügen zu genießen. Ein wahrlich magischer Augenblick. Wie verzaubert stürzte ich mich auf eine kalte Mauer und atmete tief durch. Mein Mund war zu einem breiten Grinsen verzogen, das solche Freude ausstrahlte, dass es ganz San Francisco hätte erleuchten können.
Ich schlenderte, hüpfte und tanzte mit demselben Grinsen zum Haus meines Dads, wo es schlussendlich verblasste. Wie ich zurückgefunden hatte, war tatsächlich reiner Zufall gewesen, aber es hatte, zugegebener Weise, eine Weile gedauert. Der weiße Quader starrte mich mit seiner gewohnten Ausdruckslosigkeit an. Ich zuckte die Schultern und brachte mich mit der Schlüsselkarte des Hauses hinein. Unser gesamtes Haus besaß ein ausgeklügeltes System von Kameras und zudem waren alle Geräte miteinander verbunden.
Und als ich das Haus betrat, sprang ich die schweren Stufen zu meinem Zimmer empor und ließ mich auf mein Bett fallen. Sofort kamen mir wieder die Erinnerungen des unglaublichen Gitarrenspielers ins Gedächtnis, sodass ich ungewollt grinsen musste. Im Stillen dankte ich ihm für sein Lied, das mich belebt hatte. Genau das, was ich an solch einem Tag gebraucht hatte.
Jetzt konnte ich wahrhaftig einschlafen und es würde ein guter Schlaf werden!
Kapitel 2
Kayla
Der nächste Tag war gleichzeitig mein erster Schultag und dementsprechend musste ich mich aus dem Bett quälen. Die Decke war so kuschelig und die Kissen riefen mit süßen, verlockenden Stimmen nach mir. Die Sonne schickte ihren warmen Strahlen durch das offene Fenster, als würde sie mich aufmuntern wollen. Was leider nicht half. Meine Gedanken kreisten um Mom und Alex. Vor allem aber um meine bevorstehende Zeit hier. Ich musste nur den Abschluss machen und dann war ich weg. Schneller als Dad sich für einen einzigen Fehler entschuldigt hätte.
Ich schlurfte die Stufen hinunter und verschwand in der Küche. Leere. Wie immer. Ich holte mir unbeeindruckt etwas aus dem Kühlschrank und setzte mich an den riesigen, aus Eichenholz gefertigten Tisch. Er war in demselben Stil gehalten, wie die Stufen hinunter in den Keller. Rustikal und robust. Die mit bordeaux gefärbtem Leder überzogenen Stühle waren ordentlich herangeschoben und es wirkte, als hätte hier seit Ewigkeiten keiner mehr gegessen. Nun, dann würde ich diese Zeitspanne mal unterbrechen. Ich schlürfte das Müsli, obgleich ich eigentlich gar keinen Hunger empfand, und trank leblos den Kakao, der im Gegenteil zu daheim fad schmeckte. Meine Laune sank noch tiefer, als sie schon war. Die große Küche war nur durch eine Insel vom Esstisch getrennt, vor der einige Cocktailstühle standen.
Doch dann hörte ich etwas. Die Schiebetür der Küche wurde aufgezogen und herein kam Dad. Der Löffel stoppte vor meinem Mund. Wir beide betrachteten uns einen Moment, ohne uns zu rühren. Dann blinzelte er, nahm sich eine Tasse Kaffee und setzte sich mir gegenüber. Es hatte den Anschein, als würde er versuchen, ein ganz normaler Dad zu sein, der seiner Tochter frühs noch einen schönen Schultag wünschte. Er hatte sich gewaschen und den weißen Kittel gegen einen mintgrünen Pullover getauscht. Seine Haare waren gebürstet und die Augenringe waren etwas heller geworden. Seine Augen waren auf den Tisch gerichtet und er saß entspannt zurückgelehnt. Das jedenfalls sollte seine Körpersprache aussagen. Ruhe. Aber wir beide wussten, dass die Situation so angespannt war, wie ein reißfester Faden, kurz vor dem Reißen.
Ich ließ mich nicht beirren und löffelte mein Müsli.
»Gut geschlafen?«, fragte Dad, ohne seinen Blick vom Tisch zu heben.
»Ja.« Ich hatte keine Lust auf irgendein inhaltsloses Gespräch. Morgens war mir nicht nach Reden. Das war schon immer so.
»Schön«, murmelte er und erst jetzt sah er mich an. »Du weißt wohin?«
»Ja.« Den Schulweg hatte ich in den Jahren, als ich noch hier gewohnt hatte, verinnerlicht, sodass ich ihn wahrscheinlich auch im Schlaf hätte finden würde. Ob ich wohl noch alte Mitschüler treffen würde?
»Kayla, wenn es etwas gibt, über das du reden willst, kannst du immer mit mir reden. Ich hoffe, das weißt du«, meinte er und legte den Kopf schräg.
»Ja.«
Er atmete hörbar ein und sah mich mit einem unergründlichen Blick an. Wahrscheinlich versuchte er, herauszufinden, was in mir abging. Nur würde er mit jeder Minute nur noch verzweifelter werden.
»Dein Essen steht schon fertig in der Küche«, eröffnete er mir.
»Ja.« Ich ließ den Löffel sinken und sah in seine verwaschen grünen Augen, die er mir vererbt hatte. Aufrichtigkeit lag in ihnen. Er sah es als Wiedergutmachung.
»Hast du es selbst gemacht oder Jake?«, wollte ich mit gleichgültiger Stimme wissen. Es war mir so egal, wer mir mein Essen gemacht hatte, ich hätte es mir auch selbst zubereitet, aber das interessierte mich schon. Jake, der verrückte Koch des Hauses, kreierte die leckersten und mit Abstand besten Gerichte der Welt. Dagegen musste sich sogar Mom ins Zeug legen, um mitzuhalten.
»Ich«, antwortete Dad und ein Anflug von Stolz lag auf seinem Gesicht. »Jake und der Rest sind unterwegs auf Forschungstour. Sie kommen erst in ein paar Tagen wieder. Deshalb ist es auch so ausgestorben ruhig hier.«
Ich musste zugeben, dass ich mich wirklich gefragt hatte, wo alle waren. Danach gefragt hätte ich nicht. Aber nun, da ich meine Antwort hatte, musste ich das auch nicht mehr.
Nachdem mein Kakao ebenfalls leer war, stand ich wortlos auf und brachte das Geschirr in die Küche. Ich spürte Dads Blick auf mir und wünschte, er wäre unten geblieben. So wie ich ihn nicht leiden konnte, so war er immer noch mein Dad. Ob ich es wollte oder nicht. Man konnte sich seine Familie eben nicht aussuchen. Ich nahm mir vor, auf dem Friedensweg zu bleiben und die Situation zu akzeptieren, so wie sie war. Ich konnte es nicht ändern. Fertig. Doch nur so lange, wie er das auch tat und bis ich endlich ausziehen konnte. Anders würde es nur stressiger werden. Und noch mehr Stress in meinem Leben konnte ich gerade echt nicht gebrauchen. Zudem musste ich leider zugeben, dass ein wenig Abstand zu meiner Heimatstadt nicht das Schlechteste war. Einer von wenigen Gründen, warum ich hierhergekommen war. Auch wenn Dad sich Mühe gab, so zu wirken, als ob er mich gerne dahatte, hatte ich dennoch das Gespräch zwischen ihm und Mom mitbekommen. Ich konnte ihre verzweifelte Stimme noch immer hören. ›Sie ist deine Tochter!‹ Und Dad hatte erst nach langem Gerede eingewilligt, mich hier aufzunehmen.
Jetzt stand ich da. In einem trostlosen Haus, umgeben von Menschenleere und einem Dad, der mich nicht hier haben wollte. Das waren doch wundervolle Aussichten.
Ich schnappte mir die Box, die stark nach meinem Essen aussah, hielt sie zum Beweis für Dad in die Luft und verließ den Raum.
Eine viertel Stunde später etwa stieg ich in meinen tannengrünen Ford und ließ das Haus hinter mir. Die Musik des Radios brachten es fertig, mich ruhiger werden zu lassen. Zwar spürte ich dieses unangenehm ziehende Bauchgefühl, wenn ich aufgeregt war, aber es war alles noch im grünen Bereich. So fuhr ich über die überfüllten Straßen von San Francisco ins Herz der Stadt.
Ich fand einen passenden Parkplatz vor dem Eingang. Nachdem ich ausgestiegen war und mir meine Tasche mit Dads Essen genommen hatte, sah ich mich um. Es sah aus wie damals. Der weitläufige Parkplatz wurde nur stellenweise von ein paar Bäumen beschattet und somit knallte die ganze Kraft der Sonne drauf. Die Schule selbst war ein geziegeltes Gemäuer auf drei Stockwerke und mit vielen großen Fenstern, von denen ich immer das Getümmel der Straße beobachtet hatte, wenn mir langweilig gewesen war. Deshalb hatte ich mich auch immer ans Fenster gesetzt.
Und wie ich mich jetzt so umsah, konnte ich noch keine mir bekannten Gesichter erkennen. Zum Glück, denn ich war nicht ganz so scharf drauf, alte Bekannte wiederzusehen. Alte Probleme und so. Ich mochte die Schule und die Lehrer, ja, aber die Schüler konnten mir gestohlen bleiben.
Ich ignorierte die neugierigen Blicke von weiteren Studenten und betrat das Gebäude. Der Boden war aus marmoriertem Stein und typische Spinde säumten den Korridor. Das Büro des Direktors war nach nur kurzer Zeit gefunden und ich musste feststellen, dass es einen neuen gab. Der alte Direktor war wohl in Rente gegangen und nun hätten wir da Mr. Andersen. Ein freundlicher, groß gewachsener Mann mit charmantem Lächeln. Ich entschied mich, gleich nach der Begrüßung, ihn zu mögen.
Nachdem das Organisatorische geklärt war, konnte ich mich auch schon auf die Suche nach meinem Spint machen. Dort angekommen, packte ich Essen und ein paar Bücher hinein und klebte ein einziges Bild hinein, das nun auf der ganzen Länge der Tür irgendwie verloren wirkte. Es zeigte Alex und Mom, die ihre Arme um mich gelegt hatten. Soweit ich mich erinnerte, war dies eins meiner liebsten Bilder. Einfach und allein aus dem Grund, weil es sehr bald, nachdem ich umgezogen war, gemacht worden war. Mom war noch voller Elan und Zuversicht. Sie war stolz, zu sehen, dass es mir nach den anfänglichen Schwierigkeiten gut ging. Und Alex mit ihrem gewohnt breiten Grinsen, das nichts auf der Welt aus ihrem Gesicht wischen könnte. Sie war der Optimismus in Person, und ließ trotzdem noch genug Platz für realistische Gedanken.
Tja, und dann war da ja noch ich. Mein freudiges Lächeln, in dem so viel Hoffnung lag. Ich hatte damals wirklich gedacht, dass alles nur noch gut werden konnte. Das Foto war in einer Zeit aufgenommen worden, wo ich mir noch keine Gedanken über mein Leben und die Konsequenzen meines Tuns machen musste. Dort, wo ich immer einen Ausweg gehabt hatte. Es war entstanden, als es noch keine bedeutsamen Probleme gegeben hatte. Nie im Leben hätte ich damit rechnen können, was in den nächsten Jahren folgte. Selbst heute konnte ich es immer noch nicht glauben. Ich hatte gedacht, dass ich nach Grandma alles Übel überstanden hatte. Wie ich mich getäuscht hatte! Naiv wie ich war, hatte ich an eine Glänzende Zukunft geglaubt und dass jeder Mensch einen Funken Gutes in sich hatte. Wie grausam die Menschen waren, wie sie alles nur zu ihrem Vorteil nutzten und wie sie sich verstellen konnten, war mir nicht in den Sinn gekommen. Dafür musste ich schmerzhaft lernen, wie sie wirklich waren.
Und genau deshalb war ich so glücklich, eine Freundin wie Alex an meiner Seite gehabt zu haben, die mich durch alle Höhen und Tiefen, vor allem die endlosen Abgründe, begleitet hatte. Was hätte ich nur ohne sie getan? Ich wusste es nicht. Ob ich meine Hoffnung tatsächlich aufgegeben hätte? Schwer zu sagen.
Ich warf einen letzten Blick auf das Foto und schloss dann die Tür. Meine Augen wanderten durch den Korridor und fielen auf ein paar Mädchen, gegenüber von meinem Spint. Das eine war hochgewachsen und sehr dünn, trug eine große Brille und ihr langes wallendes Haar reichte ihr über den gesamten Rücken. Sie hatte die Schultern nach vorne gezogen und die Arme um ihre Tasche geschlungen. Ihre abgenagten Nägel krallten sich in den Stoff. Die anderen vier aufgetakelten Mädels standen vor ihr und hatten ein zufriedenes Lächeln auf den übermalten Lippen. Keines von ihnen kam mir auf den ersten Blick bekannt aus. Vielleicht die eine aus der Vierergruppe, aber das war auch nur eine Vermutung.
»Was willst du?«, drang die schrille und sehr quietschende Stimme der Vordersten über den Gang. »Ich habe dich so schwer verstanden. Du musst deutlicher reden, wenn du etwas willst. O-o-oder w-w-wolltest du g-gar nichts?« Sie schenkte dem schmalen Mädchen das unschuldigste Lächeln, das ich jemals gesehen hatte.
»G-g-gib mir d-d-die Sch-Schlüssel«, bat diese vorsichtig. Ihre Stimme war hell, klar und sehr fein.
»Den Sch-Sch-Schlüssel? Welchen Schl-Schlüssel?«, fragte sie mit zusammengekniffenen Augen und blickte drein, als hätte sie tatsächlich keine Ahnung, wovon sie sprach.
Innerlich seufzte ich auf. Wenn es etwas gab, dass ich verabscheute, dann waren es die Leute, die sich auf Kosten anderer bereicherten. Menschen, die die Schwächen anderer ins Lächerliche zogen.
Das Mädchen kämpfte mit sich. Ihr Brustkorb hob und senkte sich schnell und sie schob die große Brille mit zitternden Fingern höher auf ihre Nase. Sie holte tief Luft und unterdrückte mit aller Kraft die aufkommenden Tränen. »Betti, g-gib mir m-m-meine Sch-Sch-Schlüssel!«, bat sie noch einmal. Ich bewunderte den höflichen und zurückhaltenden Ton, den sie trotz des Hohns an den Tag legte.
Ein hässliches Lächeln legte sich auf Bettis Gesicht und ihre Freundinnen kicherten leise.
Ich konnte mich noch genau daran erinnern, selbst in dieser Situation gewesen zu sein. Wie die neuen Mitschüler mich verarscht hatten und wie ich mir gewünscht hatte, jemanden zu haben, der für mich einstand. Jemanden wie Alex, die für mich aufgestanden war.
Einen kurzen Moment lang überlegte ich, einfach weiterzugehen. Mich meinen Sachen zu widmen, doch Betti setzte noch einen drauf: »Wie heißt Zauberwort?« Sie legte ihre Hand ans Ohr mit Perlensteckern und lauschte. Wartend sah sie das stotternde Mädchen an. »Das mit zwei T!«
Sie setzte zum ›Bitte‹ an, doch ich kam ihr zuvor. Dieses Verhalten kotzte mich wirklich an und die Erinnerungen, dass das damals auch ich hätte sein können, machte mich fertig.
»Flott!«, befahl ich mit kaltem Ausdruck, dessen Hintergrund ich ganz schnell in die hinterste Ecke meines Seins verbannte, und stellte mich an die Seite des armen Mädels. Meine Stimme war stark und ruhig. Dennoch wusste ich, dass ich gerade die Attraktion des gesamten Gangs geworden war. Der kurz verunsicherte Blick von Betti traf auf meine ungerührte Maske.
»Was?«, rief sie eine Tonlage höher.
»Ich sagte, du sollst ihr den Schlüssel geben! Jetzt!«, wiederholte ich ungeduldig.
»Was willst du denn jetzt? Kümmere dich um deinen eigenen Scheiß!«, rief sie und versuchte, ihre Verwirrung mit einem Lachen zu überspielen.
Ich stieß ein belustigtes Schnauben aus. »Habe ich schon. Jetzt gib ihr die verdammten Schlüssel!«
»Wie redest du eigentlich mit mir?«, fragte sie hysterisch, als wäre sie von adeliger Abstammung. »Weißt du eigentlich, wer ich bin?«
»Nein, aber du wirst es mir wohl gleich voller Stolz erzählen«, konterte ich gelangweilt und zuckte mit den Schultern. Diese Meine-Eltern-sind-im-Vorstand-Nummer konnte sie sich sonst wohin schieben.
»Nicht«, wisperte das Mädchen neben mir fast lautlos. Ihre so schon helle Haut war noch blasser geworden. Umher stehende Schüler sahen voller Neugierde und Spannung zu uns hinüber.
»Ich bin Betti Andersen!«, eröffnete sie mir, obwohl ich für einen Moment tatsächlich gedacht hatte, dass meine Erwiderung ihr den Spaß verdorben hatte. Und? Was hatte ich gesagt? Die Tochter des Direktors. »Die Tochter des Direktors!«, schleuderte sie mir noch entgegen und rümpfte die Nase. Ein Funken Überlegenheit glitzerte in ihren Augen auf.
»Und das sagt mir jetzt was genau über dich?«, wollte ich lächelnd wissen. Was interessierte es mich denn, wer ihr Vater war?
Für einen Augenblick schien Betti zu sehr damit beschäftigt zu sein, meine, in ihren Augen haltlosen Bemerkungen, zu verarbeiten, als etwas zu antworten.
»Also Schlüssel her, jetzt!«, forderte ich erneut und streckte die Hand nach ihr aus.
»Du fliegst von der Schule!«, rief sie.
Ich zuckte ungerührt mit den Schultern. »Dann werde ich mich persönlich bei dir bedanken müssen, dass ich nicht noch länger hierbleiben muss!«
»Du wirst hier niemals Freunde finden, so wie du aussiehst!«, spukte sie aus und ihr abschätziger Blick wanderte über meinen Körper und Kleidung. Der prompte Themenwechsel und die Beleidigung zwischen den Zeilen sollten mich wohl aus dem Konzept bringen. Wenn sie nur wüsste, dass es mir so am Allerwertesten vorbeiging, was jemand anderes über meine Figur oder meinen Stil dachte. Diese Gedanken hatten schon vor langer Zeit ihre Wirkung verloren und damit ihr Ende gefunden. Zusätzlich musste ich zugeben, dass man mich heutzutage mit herzlich wenig so richtig verletzten oder packen konnte. Emotional gesehen. Dazu gehörten meine Familie und meine Vergangenheit. Mit dem Rest kam ich sehr gut zurecht.
Als Betti merkte, dass keiner ihrer Versuche bei mir Wirkung zeigte, reckte sie das Kinn, das sie definitiv von ihrem Vater geerbt hatte, um gleich einen halbwegs würdevollen Abgang zu machen.
»Bist du nicht die Tochter dieses verrückten Wissenschaftlers?«, fragte eine andere der Gruppe, bei der ich mir immer noch nicht sicher war, ob ich sie nicht doch kannte. Aber nun, da sie meinen Dad ansprach, musste sie mich ja in irgendeiner Weise erkannt haben.
Ich zuckte wieder gleichgültig mit den Schultern und legte den Kopf schief. »Möglich. Ich definiere mich nicht über meine Eltern«, gab ich als Antwort. Ich hasste es abgrundtief, wenn man mich nur durch meine Eltern oder Familie charakterisierte. Ich war auch ein Mensch ohne sie. Wenn andere meinen Vater für verrückt hielten, dann sollten sie das eben denken. Aber sie sollten es schleunigst vermeiden, mich mit meinem Vater zu vergleichen.
Wie die Stille der Ideenlosigkeit zeigte, machte ihnen das Streiten mit mir wohl keinen Spaß. Betti wollte schon losstolzieren, da stellte ich mich ihr in den Weg. Trotz des Größenunterschieds hatte sie genug Respekt vor mir, anzuhalten. Verhasst blickte sie auf mich hinunter.
»Die Schlüssel! Wir wollen ja nicht, dass dein Dad erfährt, dass seine geliebte Tochter stiehlt, was?«, drohte ich gerade so laut, dass sie es hörte.
Ihre Augen wurden groß, als sie checkte, dass ich ernst meinte, dann kniff sie die Augen zusammen und ließ den Schlüssel in meine offene Hand fallen. Darauf stiefelte sie samt ihrer dreiköpfigen Mannschaft davon.
Ich konnte spüren, wie die Anspannung des schmalen Mädchens neben mir abfiel. Ihre Augenlider schlossen sich kurz, dann atmete sie tief ein. Ihre haselnussbraunen Augen fanden die meinen.
»D-Danke«, hauchte sie, als ich ihr den Schlüssel in die Hand drückte.
»Nichts zu danken«, meinte ich und raffte mich zu einem aufmunternden Lächeln auf. Sie huschte zu ihrem Spint, der neben meinem lag. Was ein Zufall. Wieso fühlte sich das grad wie in einem Film an?





























