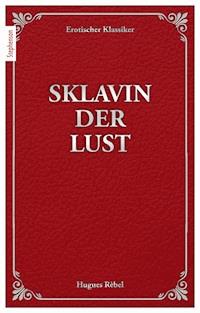
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl Stephenson Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
"Das vorliegende Erotikon nimmt in der Geschichte der erotischen Literatur eine Sonderstellung ein: unseres Wissens ist es das einzige Buch dieser Gattung, das jene Aspekte der sogenannten Plantagenkultur des 19. Jahrhunderts behandelt, die im einschlägigen Schrifttum sonst kaum gestreift wurden: die sexuellen Ausschweifungen einer aristokratischen Herrenschicht, welche zu ihren aus einer mißverstandenen Feudalgesellschaft übernommenen Herrenrechten sich auch noch die völlige Verfügungsgewalt über die Klasse von Menschen anmaßte, der sie ihren Reichtum in erster Linie verdankten." …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Titelbild steht in keinem Zusammenhang mit dem Inhalt des Buches.
eBook-Ausgabe 01/2016 © Carl Stephenson Verlag GmbH & Co. KG, Schäferweg 14, 24941 Flensburg Alle Rechte vorbehalten einschließlich der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Medien E-Mail: [email protected] Internet: www.stephenson.de Besuchen Sie uns auf www.stephenson.de Ein großes erotisches Verlagsprogramm erwartet Sie dort. eISBN 9783798607842
Sklavin der Lust
Vorwort
Das vorliegende Erotikon nimmt in der Geschichte der erotischen Literatur eine Sonderstellung ein: unseres Wissens ist es das einzige Buch dieser Gattung, das jene Aspekte der sogenannten Plantagenkultur des 19. Jahrhunderts behandelt, die im einschlägigen Schrifttum sonst kaum gestreift wurden: die sexuellen Ausschweifungen einer aristokratischen Herrenschicht, welche zu ihren aus einer mißverstandenen Feudalgesellschaft übernommenen Herrenrechten sich auch noch die völlige Verfügungsgewalt über die Klasse von Menschen anmaßte, der sie ihren Reichtum in erster Linie verdankten. Für den sittenkundlich Interessierten ist das Phänomen der Negersklaverei im Süden der Vereinigten Staaten wie in manchen mittelamerikanischen Gebieten nicht auf den ersten Blick durchschaubar.
Die Negersklaven, die mit Gewalt in ihrer afrikanischen Heimat aufgebracht und unter oft äußerst unmenschlichen Umständen – mit schweren Ketten im Zwischendeck von Handelsschiffen zusammengeschlossen – in die Südstaaten der Amerikanischen Union transportiert wurden, fanden nicht nur in der Rodung und Bewirtschaftung der ausgedehnten Pflanzungen von Louisiana, Virginia und den übrigen Gebieten der späteren Konföderation Verwendung, sondern sie dienten auch der persönlichen Unterhaltung und Befriedigung ihrer Herren, einer Gesellschaft von ebenso großsprecherischen wie ungebildeten Möchtegern Aristokraten, die sich auf das alte europäische Feudalsystem beriefen, ohne es auch nur im entferntesten mit den kulturellen Leistungen desselben aufnehmen zu können. Einerseits war das gesellschaftliche Leben jener Gesellschaftsschichten, die etwas zählten, an der Oberfläche völlig entsexualisiert. Alles, was für die sogenannte Viktorianische Epoche des 19. Jahrhunderts Geltung hatte, galt – um etliche Jahrzehnte vorverlegt – noch viel mehr für eine zumindest dem Namen nach zumeist puritanische Pflanzergesellschaft. Das heißt, daß die Töchter dieser pseudoaristokratischen Familien natürlich völlig ahnungslos den Schrecken ihrer Hochzeitsnacht entgegengingen, nachdem man ihnen vorher sorgfältig eingeimpft hatte, sich gegen das „tierische Verlangen“ der Männer zur Wehr zu setzen; daß man von vornherein annahm, daß Frauen an dem Sexualakt keinen Gefallen finden könnten, sondern diesen lediglich um künftiger Mutterfreuden willen auf sich zu nehmen hätten und was derlei Paradox eines sexualfeindlichen Jahrhunderts mehr waren.
Andrerseits aber erlegten sich die Männer in dieser durch und durch patriarchalen Gesellschaft nicht den geringsten Zwang auf, ihre unzweifelhaft sehr regen sexuellen Gelüste an ihrem weiblichen Eigentum, den Negersklavinnen, nach Belieben zu stillen. Eine Negerin, die Anspruch darauf erhoben hätte, über ihren Körper wenigstens in dieser Hinsicht frei zu verfügen, wäre unweigerlich durch ein barbarisches Strafsystem gefügig gemacht worden. Es galt als ein selbstverständliches Herrenrecht sowohl der Pflanzer selbst als auch ihrer Söhne, Freunde und Gäste, die sexuellen Dienste jeder beliebigen Sklavin in Anspruch zu nehmen. Weigerungen wurden prinzipiell bestraft. Der Verfasser dieses Werkes war ein zu dieser Zeit vielgelesener und äußerst populärer Schriftsteller, Hugues Rebel, der durchaus kompetent erscheint, zu dem Thema der amerikanischen Pflanzerkultur Authentisches auszusagen. Hatte er doch selbst während eines mehrjährigen Aufenthalts in New Orleans hinlänglich Gelegenheit, die Schwächen und Mängel dieses Systems zu studieren.
Das Resultat dieses Aufenthalts sind „The memoirs of Dolly Morton“. Zweifellos wurde das Werk ursprünglich französisch geschrieben, doch ist es uns – wie so viele unersetzliche Erotika des 19. Jahrhunderts, in der ursprünglichen Ausgabe nicht zugänglich geworden.
Der vorliegenden Übersetzung aus dem Englischen liegt eine Ausgabe des Verlagshauses Carrington zugrunde, die aus dem Jahr 1892 datiert. Dieser ebenso unternehmungslustige wie mutige Verleger unterhielt in Paris ein Verlagshaus, das sich vorwiegend mit dem – zum Großteil bibliophilen – Druck erotischer Werke beschäftigte, die sonst vermutlich ein für allemal verloren gegangen sein würden.
Für den sittenkundlich interessierten Leser bedeuten die „Memoiren der Dolly Morton“ zweifellos einen äußerst wertvollen Beitrag zur Sittengeschichte der amerikanischen Pflanzerkultur. Ermöglicht es doch wie kein zweites Buch aus diesem Kulturraum einen Blick hinter die Kulissen einer Gesellschaft, deren an der Oberfläche puritanische Moral einen Sumpf brodelnder Begierden und perverser Ausschweifungen zu verdecken suchte.
Als ich im Sommer des Jahres 1866 kurz nach Beendigung des Bürgerkrieges geschäftlich in New York weilte, nachdem ich etliche Wochen in Nova Scotia zugebracht hatte, machte ich eine höchst bemerkenswerte Bekanntschaft, die es verdient, für die Nachwelt festgehalten zu werden. Ich wollte mich von New York nach Liverpool einschiffen, um nach Schottland zurückzukehren und mußte etliche Tage auf mein Schiff warten. Damals war ich eben 30 Jahre alt geworden, ein großer starker Kerl, und ziemlich abenteuerlustig. Ganz und gar kein Kind von Traurigkeit und hinter den Weiberröcken her, wo immer ich welche fliegen sah. Natürlich erfreute ich mich beim schönen Geschlecht der allergrößten Beliebtheit. Ich machte während meines Aufenthalts in New York etliche recht interessante nächtliche Streifzüge, wagte es aber nicht, mich mit einer der zahlreichen Prostituierten einzulassen, die die Nachtlokale am Broadway bevölkerten. Gute Freunde hatten mich eindringlich davor gewarnt, nicht nur wegen der Krankheiten, die diese Weibspersonen vielfach mit sich herumschleppen, sondern auch wegen ihres Hangs zum Diebstahl und allen möglichen Verbrechen.
Eines Nachmittags, als ich so gegen fünf durch den Central Park schlenderte, lernte ich hingegen eine recht erstaunliche junge Frau kennen, die der Demimonde angehörte, ohne daß man dies auf den ersten Blick bemerkt hätte. Nie zuvor hatte ich ein käufliches Frauenzimmer von soviel Anmut und Distinktion gesehen wie dieses.
Von der Hitze des Tages ermüdet, setzte ich mich unter einer mächtigen Rotbuche auf eine Bank, um auszuruhen. Es war ein herrlicher Augusttag. Die Sonne strahlte hell durch das dichte Geäst der Bäume und auf den breiten Kieswegen promenierten Kindermädchen aller Farben und Rassen mit ihren kreischenden, schreienden und lachenden Schützlingen.
Ich sah mich ein wenig in meiner Nachbarschaft um und entdeckte schließlich auf einer der benachbarten Bänke eine reizende junge Frau, die anscheinend in ein Buch vertieft war. Sie mochte vielleicht 25 Jahre zählen und hatte, soweit ich dies von hier aus feststellen konnte, eine prächtige Figur. Ihr goldbraunes Haar war kunstvoll aufgesteckt und das rosafarbene Hütchen, das sie dazu trug, war von einer erstklassigen Modistin gemacht. Alles an ihr wirkte reizend, und ich starrte sie unwillkürlich länger an, als es sich schicken mag. Sie bemerkte es schließlich, denn sie wandte mir ihr Gesicht zu. Aber anstatt ihren Unwillen zu zeigen, wie es eine Dame der New Yorker Gesellschaft zweifellos getan haben würde, lächelte sie mir freundlich zu und winkte, ich möge näher kommen. Ich war einigermaßen verblüfft, denn ich hätte nicht im Traum gedacht, daß sie der Demimonde angehöre. Aber sie gefiel mir und ich war auch neugierig, sie kennenzulernen, wenn möglich so nahe, wie dies sich nur überhaupt zwischen Mann und Frau machen läßt.
Also erhob ich mich von meiner Bank und ging zu ihr hinüber, um sie mit einer höflichen Verbeugung zu begrüßen. Sie rückte ein wenig beiseite, um mir Platz zu machen und lächelte mir zu. Ich musterte sie aufmerksam und fand, daß sie in der Nähe noch hübscher wirkte. Auch ihre Gesellschaft war recht angenehm. Sie sprach distinguiert und ganz wie eine Dame, wenn sie auch natürlich diesen gewissen amerikanischen Akzent hatte. Ihre Augen waren groß und von einem durchsichtigen Blau, ihre Haut zart und frisch, wie die eines ganz jungen Mädchens und ihr voller Mund sehr schön geschnitten. Wir plauderten eine ganze Weile und ich begann mich lebhaft für diese hübsche kleine Person zu interessieren, die mir ein freundlicher Zufall in den Weg geführt hatte. Ich beschloß sie zu begleiten und wenn möglich, die Nacht mit ihr zu verbringen.
Sie hatte sofort bemerkt, daß ich ein Engländer war und sagte, sie habe noch niemals einen Engländer kennengelernt. Nachdem wir eine Weile geplaudert hatten, erkundigte ich mich sehr höflich, ob ich sie zum Essen einladen dürfe. Sie schien davon recht angetan und so spazierten wir einträchtig durch den Park und zu einem hübschen kleinen Restaurant, wo wir uns ein exquisites Dinner servieren ließen.
Danach tranken wir noch eine Flasche Champagner miteinander. Es war noch ziemlich früh und weil ich mich von meiner neuen Freundin nicht trennen wollte, lud ich sie ein, mit mir eines der zahlreichen Broadway Varietés zu besuchen. Sie willigte ein und gab sich überhaupt so zutraulich, wie ich mir dies nur wünschen konnte.
Sie erzählte mir, daß sie Dolly heiße. Wir wurden während der übrigens recht amüsanten Vorstellung so vertraut miteinander, daß sich alles weitere von selbst ergab.
Ich nahm einen Wagen, um sie nach Hause zu bringen. Sie wohnte in einem hübschen Viertel, etwa drei Meilen vom Broadway entfernt, in einem hübschen einstöckigen Gebäude mit einer rosenumrankten Veranda und einem sorgfältig gepflegten Garten, in dem schwül duftende Mondrosen und Feuerlilien blühten.
Die Tür wurde von einem niedlichen Quateronenmädchen geöffnet, das uns in den Wohnraum führte und sich, nachdem es die Vorhänge zugezogen und die Gasflammen angezündet hatte, respektvoll entfernte.
Ich bemerkte, daß der Raum, in den eine Flügeltür führte, sehr hübsch eingerichtet war. Ein schöner Orientteppich bedeckte den Boden und die schweren Vorhänge waren aus altrosa Brokat. Auch entdeckte ich etliche sehr schöne Kupferstiche in geschmackvollen Rahmen sowie in einem offensichtlich alten Schrank eine Sammlung von kostbarem Chinaporzellan.
Meine Gastgeberin bot mir einen Platz auf dem Diwan an und entschuldigte sich für einen Augenblick. Sie verschwand durch eine Tür am andern Ende des Raumes. Ich bemerkte, daß dahinter ihr Schlafzimmer lag. Als sie wiederkam, hatte sie sich umgezogen und trug ein sehr verführerisches Negligé aus beinahe durchsichtigem Musselin. Ihr Haar umfloß aufgelöst ihre Schultern. Das Gaslicht verlieh ihrer Haut einen merkwürdigen Bronzeschimmer. Sie sah so bezaubernd aus, daß ich sie sofort in meine Arme nahm und ihr einen leidenschaftlichen Kuß gab. Ich bemerkte, daß ihre Lippen sich sofort öffneten, als meine Zunge dazwischen einzudringen suchte. Meine Hand verirrte sich unter dem Hauch von Negligé, und weil ich sonst kein Hindernis fand, war es nur eine Frage von Augenblicken, daß wir uns im prächtigsten Liebesspiel befanden.
Sie war wirklich eine reizende kleine Person. Ihre Haut war samtweich und ihr Fleisch fest wie das eines ganz jungen Mädchens. Ihre Brüste waren rund und wohlgeformt wie Äpfel, und die Spitzen daran sprangen steif und rosig vor. Ihr Hinterteil war hübsch gerundet und das Haar am Ansatz ihrer Schenkel so weich wie Seide.
Sie entzog sich mir schließlich mit einem kleinen Lächeln und schenkte mir ein Glas Cognac ein. Wir plauderten eine Weile miteinander und dann begaben wir uns in ihr Schlafzimmer, das nicht minder hübsch eingerichtet war als der Salon. Es dauerte nicht lange, so befanden wir uns inmitten der schönsten Aktion. Mein Oberkörper lastete auf ihren Brüsten, mein Mund verschloß den ihren, und mein Liebesinstrument war bis zu seinen Wurzeln in sie getaucht. Ich umklammerte mit den Händen ihre rosigen Hinterbacken und verwendete all meine Energie darauf, sie unter meinen machtvollen Stößen wollüstig stöhnen und seufzen zu lassen.
Ich war groß und kräftig gebaut und sie eher zart. Aber sie war eine leidenschaftliche Geliebte und tat ihr Bestes, um mich glücklich zu machen. Es war nicht ihre Schuld, daß sie schließlich völlig außer Atem geriet und halb ohnmächtig in meinen Armen lag.
Als sie sich wieder erholt hatte, meinte sie mit einem kleinen Lachen: „Du lieber Himmel, bist du groß und stark. Ich glaube, daß ich kaum je so einen kräftigen Mann gehabt habe. Wirklich, ich glaube, du zerreißt mich. Aber ich mag es so …“
Ich lächelte und sagte gar nichts, sondern hielt sie in meinen Armen fest und streichelte ihre kühle, zarte Haut, bis ich zum zweiten Angriff bereit war. Ich bat sie, sich außerhalb des Bettes auf alle Viere niederzulassen und ging daran, sie von hinten zu erobern.
Ich hatte seit mehr als einem Monat keine Frau mehr gehabt und war nun beinahe unersättlich. Nachdem sie sich etliche Minuten lang wacker gehalten und jeden meiner Stöße mit einem Gegenstoß beantwortet hatte, überkam uns die Ekstase der Lust beinahe gleichzeitig und wir stürzten miteinander auf den weichen Teppich, der das Bett umgab. Dort blieben wir eine Weile schwer atmend liegen, ehe wir uns wieder zwischen den kühlen Linnen des Bettes ausstreckten. Aber es dauerte nicht lange, so war meine Waffe, von der Nähe ihres warmen, weichen Körpers erregt, wieder kampfbereit, und diesmal nahm ich sie, indem ich mich hinter sie legte und meinen Leib gegen die kühlen festen Backen ihres Hinterteils preßte. Ich trieb mein noch immer kraftstrotzendes Instrument zwischen ihre Schenkel, und in dieser Haltung schliefen wir dann auch ein.
Ich erwachte gegen halb acht und fand meine reizende Gefährtin noch im festen Schlaf. Sie lag auf dem Rücken, und ihr langes Haar, das im Morgenlicht golden schimmerte, floß über die weißen Kissen. Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, zog ihr sanft die Decke fort und rollte ihr sehr hübsches Nachthemd bis an ihr Kinn hinauf, um sie bei Tageslicht zu betrachten. Sie bewegte sich ein wenig, erwachte aber nicht unter meinen bewundernden Blicken.
Wirklich, sie war das hübscheste Mädchen, das ich seit langem gesehen hatte. Ihre Haut war so weiß wie Milch und ohne den geringsten Makel. Ihre kleinen Brüste, die sich unter ihren tiefen Atemzügen hoben und senkten, standen steil nach oben, und die Haut spannte sich glatt und faltenlos über ihrem Leib. Offensichtlich hatte sie nie ein Kind gehabt. Sie hielt ihren rechten Schenkel ein wenig angezogen, so daß ich einen Schimmer des rosigen Tales erhaschen konnte, das sich im Schatten ihres goldigen Haarkräusels hinzog.
Kein Wunder, daß mein Liebespfahl sich beim Anblick solcher Reize in voller Kraft erhob. Ich weckte meine Schöne, indem ich sanft gegen ihr Pförtlein pochte, und sie schlug die Augen auf und sah mich lächelnd an.
„Ah, ich sehe schon, du hast ein Morgenopfer besonderer Art vorbereitet“, meinte sie heiter. „Gut, mein Freund, du sollst mich nicht müßig finden.“
Sie breitete ihre Schenkel aus und in wenigen Sekunden hatte ich ihr einen leidenschaftlichen Morgengruß dargebracht, der sie und mich in Wonne schwimmen ließ. Sie schien mir heute noch reizvoller als während der Nacht, und die laszive Art, in der sie ihre Lenden bewegte, versetzte mich in einen wahren Taumel von Entzückungen. Sie schien tatsächlich Gefallen an meinen Umarmungen zu finden. Ich bemerkte es an ihrem verschleierten Blick und den halb geöffneten Lippen, denen die leidenschaftlichsten Seufzer entflohen.
Später plauderten wir eine ganze Weile, und ich bemerkte, daß sie recht intelligent war und den Fragen des Tages sehr aufgeschlossen gegenüberstand. Nach einer Weile kamen wir auch auf den Bürgerkrieg zu sprechen und ich fragte sie, wem ihre Sympathien gälten.
„Ich bin eine Nordstaatlerin“, sagte sie, „so war ich natürlich immer für den Norden. Ich bin sehr glücklich darüber, daß die Südstaatler geschlagen und die Neger freigelassen wurden. Sklaverei ist eine schreckliche Sache und ein Unglück für das ganze Land.“
„Aber“, gab ich zur Antwort, „ich habe oft gehört, daß die Neger während der Sklaverei besser daran waren als heute, wo sie für sich selbst einstehen müssen.“
„Immerhin sind sie heute frei, und das allein zählt“, sagte Dolly entschieden. „Natürlich stehen die Dinge heute noch nicht zum Besten, aber mit der Zeit wird sich das schon ändern.“
„Ich habe immer geglaubt, daß es den Sklaven nicht schlecht ergangen ist“, warf ich ein.
„Das stimmt in einzelnen Fällen“, gab sie zur Antwort, „aber in den meisten übrigen war Sklaverei ein schreckliches Los. Es gab nicht die geringste Sicherheit für diese armen Leute.
Immer liefen sie Gefahr, verkauft zu werden, wobei sie oft die Trennung von ihren Gatten und Kindern in Kauf nehmen mußten. Viele Plantagenbesitzer haben ihre Neger abscheulich behandelt, indem sie sie hart arbeiten ließen und schlecht ernährten. Gar nicht zu reden von den Auspeitschungen, die dort zu den Alltäglichkeiten gehörten. Dazu kam, daß die Sklaven nicht das mindeste Recht auf ihre persönliche Würde hatten. Hübsche Frauen konnten nicht einmal dann tugendhaft bleiben, wenn sie es wollten. Sie wurden gezwungen, sich nach Belieben ihren Herren oder deren Gästen hinzugeben, und wenn ein Mädchen sich dem widersetzte, wurden es entsetzlich ausgepeitscht.“
„Oh, da mußt du dich aber irren“, protestierte ich nun doch einigermaßen konsterniert.
Aber sie hatte sich in Eifer geredet. „Keine Spur, mein Lieber. Ich weiß ganz genau, wovon ich spreche. Vor dem Krieg habe ich selbst in einem Sklavenstaat gelebt und hatte genügend Gelegenheit, alles über die Sklaverei zu erfahren.“
„Wurden Frauen häufig geschlagen?“ erkundigte ich mich, von dieser Vorstellung ernsthaft schockiert. Ich konnte mir nicht vorstellen, daß es Männer geben sollte, die tatsächlich so grausam waren, so zarte Geschöpfe wie Frauen auszupeitschen, selbst wenn sie eine schwarze Haut hatten und nur Sklavinnen waren.
„Natürlich“, gab sie ruhig zur Antwort. „Ich glaube, es gab im ganzen Süden keine Plantage, wo die Sklavinnen nicht gepeitscht worden wären. Natürlich waren die Verhältnisse recht verschieden. Es hing vom Temperament und den Launen des jeweiligen Besitzers ab, wie die Sklaven in dieser Hinsicht behandelt wurden. Das Schlimmste war, daß durch diese Auspeitschungen, die immer von Männern vollzogen wurden, das Schamgefühl der jüngsten Mädchen schon im Keim erstickt wurde. Sie fanden schließlich schon gar nichts mehr dabei, daß man ihnen in Gegenwart von oft völlig Fremden die Röcke aufhob und sie auf die bloße Kehrseite schlug.“
„Wurden die Frauen immer auf das Hinterteil geschlagen?“ erkundigte ich mich, nunmehr ernsthaft interessiert.
„Manchmal wurden sie auch auf den Rücken geschlagen“, antwortete meine Gastgeberin, „aber zumeist hatte das Hinterteil solche Züchtigungen auszuhalten. Man verwendete die verschiedensten Instrumente dazu, je nach der Schwere des Vergehens. Manchmal begnügte man sich auch mit der bloßen Hand, doch zumeist trat ein Haselstock oder auch ein Lederriemen in Aktion. In ganz außergewöhnlichen Fällen wurde ein sogenanntes Paddel verwendet.“
„Wie, ein Schiffspaddel?“ fragte ich ungläubig.
Sie lächelte flüchtig. „Nun, nicht ganz natürlich. Es war ein flaches rundes Holzstück an einem langen Stiel, das den Vorteil hatte, die Haut nicht zu verletzen, wenn es auch entsetzlich weh tat. Der Stock hinterließ allerdings tiefere Narben, wenn er ernsthaft angewandt wurde. Es gab noch ein schreckliches Instrument, den sogenannten Kuhschwanz, aber der wurde bei Frauen kaum angewendet, weil er die Haut verdorben und so den Wert der Sklavin gemindert hätte.“
„Du scheinst wirklich alles darüber zu wissen“, gab ich zu. „Aber sag mir bloß, wie bist du als Nordstaatlerin dazu gekommen, in einem Sklavenstaat zu leben?“
„Ich habe geholfen, eine Untergrundstation zu führen. Aber du weißt natürlich gar nicht, was das ist“, fügte sie hinzu.
Ich mußte gestehen, daß ich dies ebenso wenig wußte, wie gewisse andere Details aus der amerikanischen Geschichte. Sie lächelte mir flüchtig zu und fuhr fort: „Untergrundstationen waren Häuser, in denen Absolutisten entflohene Sklaven verbargen und sie mit dem Nötigsten zur Fortsetzung ihrer Flucht versahen. Absolutisten bildeten eine Partei, die für die Abschaffung der Sklaverei stimmte. Es gab in einigen Südstaaten solche Stationen. Die Flüchtlinge kamen in der Nacht und wurden von einer Station zur nächsten weitergeschleust, bis sie schließlich in einen Staat kamen, in dem die Sklaverei schon abgeschafft war. Das Ganze war nicht ungefährlich, weil es gegen die Gesetze verstieß. Wer dabei erwischt wurde, mußte mit langen Gefängnisstrafen und Zwangsarbeit rechnen. Im übrigen waren alle Weißen gegen die Absolutisten, nicht nur die Sklavenbesitzer, sondern auch die armen Teufel, die keinen Dollar für einen Neger hätten aufbringen können. Es geschah oft, daß Absolutisten in die Hand der Lynchjustiz fielen. Dann wurden sie geteert und gefedert oder ausgepeitscht.“
„Hast du je Schwierigkeiten bekommen?“ erkundigte ich mich, von den Details ihrer Erzählung fasziniert.
Ihr süßes Gesicht verdüsterte sich. „Und ob ich in Schwierigkeiten geraten bin. Mein ganzes Leben ist dadurch aus der Bahn geworfen worden“, stieg sie hervor. „Oh, wie ich diese Südstaatler hasse, diese grausamen Unmenschen“, fügte sie bitter hinzu.
Ich war über diesen plötzlichen Ausbruch höchst erstaunt und bat sie, mir doch ihre ganze Geschichte zu erzählen.
Sie überlegte einen Augenblick und sagte dann: „Ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, aber dir will ich sie erzählen, weil du ein Engländer und mir recht sympathisch bist. Nur ist diese Geschichte viel zu lang für jetzt. Wenn du willst, komm heute zum Abendessen und ich werde dir alles berichten, was es zu berichten gibt.“
Ich war über diese Einladung sehr erfreut und versprach, bestimmt zu kommen. Wir plauderten noch eine Weile, dann klopfte es und das Quateronenmädchen von gestern kam und brachte Tee und Toast für uns. Meine reizende Gesellschafterin stand auf und sagte zu dem Mädchen: „Gib mir meinen Schlafrock, Mary!“
Das Mädchen gehorchte, und Dolly wandte sich, nachdem sie in das spitzenbesetzte Kleidungsstück geschlüpft war, mir wieder zu.
„Mary ist 24 Jahre ihres Lebens Sklavin gewesen,“ sagte sie ernsthaft. „Wenn du sie darüber befragen willst, wird sie dir bestimmt wahrheitsgemäß antworten. Sie ist ganz und gar nicht scheu, nicht wahr, Mary?“
Die Quateronin, ein hübsches, zutrauliches Geschöpf, lächelte über das ganze Gesicht und zeigte zwei Reihen prächtiger weißer Zähne.
„Oh nein, Miß Dolly“, sagte sie, „Mary gar nicht scheu.“
„Schön, Mary, dann berichte diesem Gentleman, wo du herkommst und wie es dir ergangen ist“, wandte sie sich an das Mädchen.
Sie antwortete ohne Zögern. „Ich von Major Bascombes Plantage in Alabama, jawohl! Waren 150 Fieldhands dort und 12 Hausmädchen. Ich eines der Hausmädchen, Sah“, fügte sie mit einem gewissen Stolz hinzu.
„War dein Herr ein guter Herr?” erkundigte ich mich.
Sie schob ihre Unterlippe ein bißchen vor. „Well, Sah, er nicht schlimmer Massah. Wir gutes Essen bekommen und nicht hart arbeiten. Aber sehr streng gewesen. Hat oft geschlagen Sklaven auf der Plantage.“
„Bist du je geschlagen worden?“
Mary starrte mich an, als ob ich eben etwas höchst Törichtes gesagt hätte. „Natürlich ich geschlagen, Sah, oft, viel,“ gab sie im selbstverständlichsten Ton der Welt zur Antwort. „Erstesmal geschlagen, wenn ich sieben Jahre alt, letztes mal eine Woche ehe Präsident die Sklaven freigesetzt.“
„Und war es schlimm für dich?“
„Oh ja, sehr schlimm. Als kleines Mädchen ich mit bloßer Hand geschlagen, später immer mit Riemen oder Haselstock. Und zweimal ich Paddel gehabt. War ganz entsetzlich.“
„Wer pflegte die Frauen zu schlagen?“
„Hat Aufseher gemacht meistens. Aber manchmal auch Massah selbst. War ein eigener Raum nur dafür. Wenn Mädchen oder Frau geschlagen, sie sofort hingehen und auf Bank legen. Andere Sklaven sie festbinden, dann ihre Kleider aufheben und Aufseher sie schlagen.“
„Hat es sehr weh getan?“ wollte ich wissen.
„Oh ja, schrecklich weh! Manchmal geschlagen bis Blut kam.“ Hier mischte sich Dolly wieder ins Gespräch. „Wenn das passierte“, sagte sie, „blieben die Narben meist für das ganze Leben. Mary hat zahlreiche Narben auf ihrer Hinterseite. Zeig sie dem englischen Herrn“, wandte sie sich an ihr Mädchen. „Beweise die Wahrheit dessen, was du ihm berichtet hast. Er sieht noch immer reichlich ungläubig drein.“
Das Mädchen zögerte nicht im geringsten und hob ihre Röcke auf, wobei sie mir gleichzeitig ihre Kehrseite präsentierte. Sie trug keine Hose – Negerinnen lieben es offenbar nicht, Hosen zu tragen – und ich bemerkte deutlich, daß ihre Hinterseite von regelmäßigen, feinen weißen Narben bedeckt war.
Du lieber Himmel, war das ein Anblick. Alle Negerinnen haben von Natur eine starke Hinterseite mitbekommen und weil Mary an sich ziemlich üppig war, schien auch ihr Hintern recht einladend. Die beiden festen Halbkugeln bildeten zusammen mit den starken Schenkeln eine Herausforderung für jeden Mann. Ihre Haut war von der Farbe heller Milchschokolade, und ich bemerkte die langen hellen Linien deutlich, die sich darin abzeichneten.
Sie schien sich in ihrer Position nicht schlecht zu gefallen, denn sie machte keine Miene sich wieder zu bedecken, bis Dolly in sanftem Ton sagte: „Das genügt, Mary!“
Darauf erst ließ sie ihre Röcke fallen und verließ mit einem breiten Lächeln das Zimmer.
„Nun“, fragte Dolly, „hast du dich überzeugt, mein Freund? Übrigens hat auch ihr Rücken Narben. Als sie 15 war, hat der älteste Sohn ihres Herrn sie in Besitz genommen, und danach ist sie noch durch die Hände der beiden jüngeren Söhne gegangen. Aber selbst das bewahrte sie nicht vor der Peitsche. Sie hat mir erzählt, daß einer der jungen Herren sie manchmal in sein Ankleidezimmer rief, wenn ihre Hinterseite noch die blutigen Spuren einer Auspeitschung zeigte, um sich so an ihr zu delektieren. Ich habe noch eine Negerin in meinen Diensten. Sie stammt aus Süd Carolina und sieht noch viel ärger aus.“
Dolly wandte sich ihrem Tee zu und meinte, nachdem sie einen Schluck des aromatisch duftenden Getränks genommen hatte: „Nun, glaubst du noch immer, daß die Sklaverei eine gute Sache ist?“
„Beim Himmel, nein“, rief ich, ernstlich erschüttert durch das, was ich eben zu hören bekommen hatte.
Die Tatsachen, die ich von Dolly und der Quateronin erfahren hatte, beunruhigten mich nicht wenig. Im übrigen muß ich gestehen, der Anblick von Marys einladendem Hinterteil hatte meinen Appetit schon wieder in eine ganz bestimmte Richtung gelenkt. Ich mag es nun einmal gerne, mit der hübschen Kehrseite eines Mädchens konfrontiert zu werden, wenn ich auch weit davon entfernt bin, diese reizenden Rundungen in der Manier eines Sklavenhalters zu behandeln. Für den Augenblick bemächtigte ich mich jedenfalls meiner reizenden Bettgefährtin und eroberte sie zum dritten mal und mit großem Vergnügen, das sie wieder zu teilen schien. Danach erfrischte mich eine Tasse Tee, ehe ich aufstand, um zu baden.
Ich verabschiedete mich von Dolly und versprach, um sieben pünktlich zu erscheinen. Ich gab ihr einen Kuß und einen ganz stattlichen Betrag als Zuschuss für das bevorstehende Dinner. So kehrte ich gutgelaunt in mein Hotel zurück, wo ich von den Strapazen der Nacht ausruhte und die Vorfreude auf den kommenden Abend genoß.
Ich konnte es kaum erwarten, bis ich das hübsche weiße Häuschen wieder betrat. Einmal war ich auf Dollys Geschichte neugierig und zum anderen hatte ich die Absicht, auch diese Nacht mit ihr zu verbringen.
Sie schien glücklich, mich wiederzusehen. In ihrem duftigen weißen Kleid sah sie entzückend aus. Wir nahmen ein ausgezeichnetes Mahl in ihrem Salon ein und leerten eine Flasche importierten Burgunder, den sie zur Feier des Tages hatte servieren lassen.
Mary, die reizend aussah, bediente uns, und als wir uns nach dem Essen in den angrenzenden Raum zurückzogen, servierte sie uns noch einen ausgezeichneten türkischen Mokka, ehe sie uns verließ. Dolly setzte sich anmutig auf der Chaiselongue zurecht, wobei sie nicht versäumte, mich ihre in hübschen Silberpantoffeln steckenden Füße bewundern zu lassen. Ich entzündete eine Zigarre und setzte mich in ihrer Nähe in einen Armstuhl. Dann begann sie mit ihrer Geschichte, die wirklich sehr abenteuerlich war.
Wir waren damit noch lange nicht zu Ende, als sie mir gegen Mitternacht einen leichten Imbiß servieren ließ. Aber mich interessierte ihre Geschichte so sehr, daß ich beschloß, sie solange aufzusuchen, bis ich alles von ihr erfahren hatte. So habe ich nach und nach, unter recht erfreulichen Umständen, ein plastisches Bild von den Zuständen und den sozialen Verhältnissen in den ehemaligen Sklavenstaaten bekommen.
Dollys Schicksal wendete sich in der Folge übrigem, noch zum Guten. Ich blieb etwa drei Wochen in New York und sah meine reizende Freundin fast täglich, nicht nur, weil sie eine ausgezeichnete Liebhaberin war, die meine Sinne in Aktion zu halten wußte, sondern vielmehr weil ich sie aufrichtig gern hatte und von Herzen wegen ihres Mißgeschicks bedauerte. Es war ihr wirklich übel mitgespielt worden.
An dem Tag, da ich New York verließ, verabschiedete ich mich von ihr und gab ihr meine Adresse. Ich wollte mit ihr in Verbindung bleiben. Sie schien über unseren Abschied ehelich betrübt, denn sie hatte Tränen in den Augen und ihre Stimme zitterte, als sie mir Lebewohl sagte. Mein Schiff stach am nächsten Tag in Richtung Schottland in See. Wir hatten eine stürmische Überfahrt und landeten schließlich in Liverpool. Ich reiste geradewegs von dort nach Hause und nahm mein normales Leben wieder auf. An Dolly dachte ich nur noch selten. Es ist ja zumeist so, daß man in einer veränderten Umgebung seine Freunde aus den Augen verliert. Doch nach sechs Monaten etwa erreichte mich ein Brief von Dolly, in dem sie mir hocherfreut mitteilte, daß sie demnächst heiraten werde, einen wohlhabenden Geschäftsmann, der ihrer Beschreibung nach einen recht liebenswürdigen Charakter haben mußte. Allerdings schrieb sie nicht, ob sie in ihn verliebt sei. Ich kann mir vorstellen, daß sie ihn auch genommen haben würde, ohne in ihn verliebt zu sein. Was hätte ein Mädchen wie sie auch tun können, um ihre Zukunft sicherzustellen?
Ich war jedenfalls hocherfreut, dies zu erfahren. Sie war ein bezauberndes Frauenzimmer, wenn auch ein wenig schwach in ihrem Charakter.
Bestimmt würde sie den Mann, der sie zu seiner Frau machen wollte, zufriedenstellen. Sie hatte schließlich das unschätzbare Talent, eine angenehme Atmosphäre um sich zu verbreiten, wußte mit Anstand ihr Haus zu führen und war für ein Mädchen ihres Standes außerordentlich gebildet. Kurz, sie hatte alle Anlagen, die sie zu einer Dame prädestinierten, und ich war froh, daß sich ihr Schicksal nun endlich zum Besseren wenden sollte.
Ich schrieb ihr also einen sehr herzlichen Brief, um sie zu beglückwünschen, und schickte ihr ein großzügiges Hochzeitsgeschenk, das zugleich eine Art Dank für die reizenden Stunden sein sollte, die ich in New York mit ihr verbracht hatte. Sie bedankte sich sehr herzlich dafür, doch seither habe ich nichts mehr von ihr gehört. Immerhin hoffe ich sehr, daß sie glücklich geworden ist. Das bedauernswerte, liebenswürdige Mädchen verdiente nach allem Mißgeschick, das ihr ohne eigene Schuld zugestoßen war, wirklich ein Happyend.
Doch nun zu ihrer Geschichte, die den geneigten Leser zweifellos interessieren wird. Ich gebe sie im folgenden so, wie ich sie von ihr gehört habe, wieder.
Kapitel 1
Mein Name ist Dolly Morton. Ich bin eben 26 Jahre alt geworden. Geboren wurde ich in Philadelphia, wo mein Vater als Bankangestellter lebte. Ich war seine einzige Tochter. Nach dem Tod meiner Mutter, – ich erinnere mich nicht mehr an sie, weil sie starb, als ich ganze zwei Jahre alt war – wurde ich ganz allein von meinem Vater erzogen. Er verdiente nicht besonders gut, aber er verstand es, dafür zu sorgen, daß ich eine gute Ausbildung erhielt. Ich sollte ursprünglich Lehrerin werden.
In seiner Art war mein Vater ein stiller ernster Mann, der seine Gefühle hinter einer permanenten Strenge tarnte. Er hielt mich in der Furcht des Herrn, wie er es nannte, und niemals erwies er mir irgendwelche Zärtlichkeiten, nach denen ich um so mehr verlangte, als mir auch jene von seiten einer liebenden Mutter fehlten.
Seine Erziehung war außerordentlich streng. Wann immer ich irgend eine dieser kleinen kindlichen Sünden verbrochen hatte, legte er mich übers Knie, zog mir die Hosen herunter und schlug mich mit einem Lederriemen.
Diese Art der häuslichen Züchtigung war im 19. Jahrhundert eine absolute Selbstverständlichkeit. Die Erziehungsmethoden waren durchaus von dem Bibelzitat ‘Wer sein Kind liebt, schont die Rute nicht’ beherrscht. Es blieb erst einer späteren Generation vorbehalten, die Gefahren dieser Erziehung mittels Rohrstock und Ruten zu erkennen. In zahllosen Fällen wurde dadurch nämlich nachweislich ein Hang entweder zur passiven oder zur aktiven Flagellomanie erzeugt. Das prominenteste Beispiel dieser Art ist bekanntlich der Aufklärungsphilosoph Jean Jaques Rousseau, der in seinen Bekenntnissen selbst beschrieb, daß die Erziehungsmethoden seiner Gouvernante in ihm diese verhängnisvolle Neigung erweckt hätten.
Ich war ein rundliches Mädchen mit einer zarten Haut und äußerst schmerzempfindlich. Meist gebärdete ich mich bei solchen Anlässen wie eine Verrückte. Ich schrie und weinte und flehte um Gnade, die ich niemals erhielt. Ich habe es nie erlebt, daß mein Vater sich von meinen Bitten beeindrucken ließ. Er fuhr vielmehr ganz ruhig fort, meine Hinterseite zu bearbeiten, bis sie wie Feuer brannte. Ich flüchtete in meinem Schmerz meist zu unserer alten Haushälterin, die meine Amme gewesen war. Sie tröstete und liebkoste mich und fand dann immer einen besonderen Leckerbissen, der mich für die ausgestandenen Schmerzen entschädigen sollte.
Alles in allem führten wir ein einsames Leben. Wir hatten keine Verwandten, und Vater machte sich nichts aus Bekanntschaften. Auch hatte ich keine Freundinnen meines Alters. Trotzdem war ich ein fröhlicher Mensch.
Die Jahre vergingen ruhig und ohne besondere Ereignisse. Ich wurde 18 und war damit voll erwachsen. Ich hatte eine gute Figur und sah recht hübsch aus, wie ich an den bewundernden Blicken der Männer bemerkte, wenn ich über die Straße ging. Allmählich begann ich gegen das langweilige Leben, das mein Vater mir auferlegte, zu rebellieren. Aber der behandelte mich noch immer wie ein Kind, und auch seine Erziehungsmethoden hatten sich nicht geändert. Ja, er versicherte mir, daß er fortfahren würde, mich zu schlagen, bis ich 20 Jahre alt sei.
Natürlich bedeutete das für ein erwachsenes Mädchen eine arge Erniedrigung, zumal ich romantisch geworden war und von einem Liebsten träumte. Doch trotz der strengen väterlichen Zucht blieb ich ein rebellisches Mädchen. Ich muß zugeben, daß die Bestrafungen, denen ich oft genug ausgesetzt war, einigermaßen redlich verdient waren.
Kurz nachdem ich 18 geworden war, trat in meinem Leben eine bedeutsame Veränderung ein. Mein Vater starb innerhalb weniger Tage an einer Lungenentzündung. Dadurch war ich Vollwaise geworden – übrigens ohne einen besonderen Schmerz über diesen Verlust zu empfinden. Mein Vater war mir immer etwas fremd geblieben, und niemals hatte er sich für meine Wünsche und Hoffnungen interessiert. Dazu kam, er ließ mich in einer mehr als prekären Situation zurück. Er hatte einige Schulden hinterlassen, und natürlich drängten die Gläubiger auf Zahlung. Ich hatte kein Geld, und so wurde die Einrichtung des Hauses, in dem wir bisher gelebt hatten, versteigert. Das Ende vom Lied war, daß mir kaum ein Cent zum Leben übrig blieb, ganz abgesehen davon, daß ich nicht einmal ein Heim hatte.
Einen Monat lang lebte ich mit meiner alten Amme zusammen. Die Gute war rührend um mich besorgt und tat alles, um mir meine Lage zu erleichtern. Aber sie mußte für sich selbst sorgen und eine neue Stelle suchen. Es wäre schlimm um mich bestellt gewesen, wenn nicht eine liebenswürdige Dame, die von meinen Schwierigkeiten gehört hatte, mich in ihr Haus aufgenommen hätte.
Sie hieß Ruth Dean und war ungefähr 30, als ich sie kennenlernte. Sie gehörte den Quäkern an, die sich die Gesellschaft der Freunde nennen. Natürlich war sie eine Jungfrau, hatte keine Liebhaber und lebte in einem großen Haus etwa zwei Meilen vor der Stadt. Ihr recht ansehnliches Vermögen verwendete sie für karitative Zwecke. Ihre Zeit war angefüllt mit Werken der Nächstenliebe. Sie war bereit, jedem zu helfen, der Hilfe nötig hatte. Schön war sie nicht, aber sie wirkte recht anziehend: eine hochgewachsene, schlanke Frau mit großen ernsthaft blickenden Braunaugen und kastanienbraunem Haar, das sie in einem schlichten Knoten aufgesteckt trug. Ihr Gesicht war fein geschnitten, aber ganz ohne Farbe, obwohl sie recht gesund und sehr ausdauernd war. Der allzeit ernste Ausdruck ihres Gesichts richtete zwischen ihr und ihrer Umwelt gewissermaßen eine Mauer auf. Ich habe diese Frau niemals, solange ich bei ihr war, wirklich lachen hören. Sie war im übrigen eine der besten Frauen, die je gelebt haben. Mir war sie eine wirkliche Freundin. Vom ersten Tag an behandelte sie mich höchst liebenswürdig als ihren Gast. Sie wies mir ein hübsch eingerichtetes Zimmer an, in dem ich sowohl wohnen als auch schlafen konnte, und die Dienstboten, die sie hatte, behandelten mich mit Respekt.
Miß Dean unterhielt eine ausgedehnte Korrespondenz in allen Teilen der Staaten. Nun kam mir meine Erziehung insofern zugute, daß ich ihr einen Teil der Schreibarbeiten abnehmen und ihr bei ihren Wohltätigkeitsaktionen behilflich sein konnte. Sie beschäftigte mich schließlich als ihre Sekretärin und zahlte mir ein kleines Gehalt, das ich für mich verbrauchen konnte, während sie für alles andere sorgte. Sie bestellte sogar meine Kleider und die Wäsche, die ich trug. So hatte sich meine Lage recht vorteilhaft geändert. Ich war sehr zufrieden, um so mehr als Miß Dean mich niemals tadelte oder schalt, sondern von einer angenehmen gleichbleibenden Freundlichkeit war.
Ich empfand mit der Zeit für sie die Zuneigung einer jüngeren Schwester, und ihr ging es ähnlich. Sie lobte meine Figur und mein Gesicht und war darauf bedacht, mich immer hübsch herauszuputzen. So hatte ich bald einen Schrank voll duftiger Spitzenwäsche und recht hübscher Kleider. Sie selbst war dagegen recht bescheiden ausgestattet und trug Tag um Tag nichts anderes als das schmucklose Kleid einer Quäkerin. Ich habe sie nie anders als in einem taubengrauen oder auch malvenfarbenen, ganz einfachen Gewand gesehen.
Sie war natürlich eine Gegnerin der Sklaverei und somit Mitglied der Partei der Absolutisten. So gab sie große Summen aus, um entflohenen Negern zu helfen. Auch stand sie mit Freunden aus dem Süden in Verbindung, die Untergrundstationen errichtet hatten. Häufig nahm sie entflohene Sklaven beiderlei Geschlechts in ihr Haus auf und behielt sie da, bis sie ihnen eine Stellung verschaffen konnte. Sie mußte sich dabei keine Heimlichkeiten auferlegen, denn in Pennsylvania war die Sklaverei schon abgeschafft.
Zwei Jahre vergingen, ohne daß etwas Besonderes passiert wäre. Ich war zufrieden und glücklich, hatte eine Anzahl von gleichaltrigen Freunden und eine Vielzahl unschuldiger Vergnügungen. Meine mütterliche Freundin ging niemals zu irgendwelchen öffentlichen Unterhaltungen und führte ein äußerst strenges Leben. Doch empfing sie häufig Gäste in ihrem Haus und ich war sehr oft eingeladen. Unter den Brüdern der Mädchen, mit denen ich verkehrte, hatte ich bald etliche treue Bewunderer, aber an keinen von ihnen verlor ich mein Herz.





























