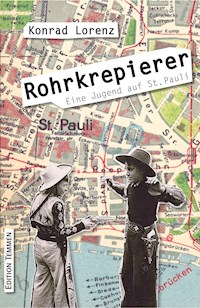7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der Verhaltensforscher und Nobelpreisträger erzählt bewegende, amüsante und aufschlussreiche Episoden aus seinem Leben, in dem Tiere und insbesondere Hunde immer eine große Rolle gespielt haben. Er stellt sich sogar die Frage »Welcher Hund passt zu wem?«. Seine Erinnerungen und Gedanken sind nach wie vor eine Quelle der Inspiration und Information für alle Tierfreunde und Hundeliebhaber. Und eine Bestätigung dafür, dass die Liebe zu einem Tier nicht abwegig, sondern ein »wundervoller Seelenzustand« ist, wie es eine Leserin beschreibt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 198
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Auf sehr verschiedene Weise kann der Mensch auf den Hund kommen; zum Beispiel durch das Finanzamt, durch Verschwendung, Trunksucht, Faulheit oder Fehlspekulation an der Börse. Wie der Mensch jedoch auf den leibhaftigen Hund gekommen ist – diese Geschichte erzählt der bekannte Verhaltensforscher Konrad Lorenz auf den nachfolgenden Seiten mit viel Humor und gewürzt mit eigenen Erlebnissen. In grauer Vorzeit, so erfährt der Leser, schlossen sich die Vorfahren des Hundes mit den Menschen zu einer Art Lebens- und Interessengemeinschaft zusammen, die sich im Verlauf der Jahrtausende zu einer der innigsten Freundschaften zwischen dem homo sapiens und einem tierischen Wesen vertiefte. Aus uralten Instinkten erklärt Lorenz das Verhalten unseres treuen vierbeinigen Hausgenossen, das manchmal fast menschlich anmutet, aber den Hundeliebhaber auch oft durch Reaktionen erschreckt, die ihm unverständlich, ja vielleicht sogar unheimlich erscheinen. Jede Hunderasse, aber auch jeder einzelne Hund haben einen eigenen (und oft eigensinnigen) Charakter, den nur entschlüsseln kann, wer die Entwicklungsgeschichte und Verhaltensformen dieser Tierart kennt.
Konrad Lorenz
So kam der Mensch auf den Hund
Wie es gewesen sein könnte
Durch das hohe Steppengras ziehen Menschen, eine kleine Schar unbekleideter wilder Gestalten. In den Händen tragen sie Speere mit Knochenspitzen, einige haben sogar Pfeil und Bogen. Wohl gleichen sie körperlich den Menschen unserer Tage, aber ihr Benehmen mutet tierhaft an, rastlos und ängstlich blicken ihre dunklen Augen, genau wie bei einem scheuen Wild, das dauernd auf der Hut sein muß. Das sind noch keine freien Menschen, keine Herren der Erde, sondern Gejagte, die in jedem Dickicht Gefahren fürchten müssen.
Die Stimmung ist gedrückt. Stärkere Verbände hatten sie jüngst gezwungen, das ursprüngliche Jagdgebiet zu verlassen und weit nach Westen in die Steppe auszuweichen, in unbekanntes Land, das viel mehr Raubtiere hat als die einstige Heimat. Obendrein war vor wenigen Wochen der alte erfahrene Jäger, der die Schar führte, einem säbelzähnigen Tiger zum Opfer gefallen. Daß der Räuber später an einem Speerstich zugrunde ging, war kaum ein Trost in dem Unheil.
Am meisten litt die Horde unter Schlafmangel. In der alten Heimat hatten alle am Feuer geschlafen, das in einem weiteren Gürtel auch die lästigen Goldschakale1 umlagerten; dadurch ersparte man Wachen, da die Schakale schon von weither das Nahen eines Raubtieres anzeigten. Freilich waren sich jene primitiven Menschen dieses Nutzens nicht bewußt. Wenn sie auch nicht gerade einen Pfeil verschwendeten, so scheuchten sie doch mit Steinwürfen den Schmarotzer, der sich an das Feuer wagte.
So ziehen sie dahin, müde und schweigsam. Die Nacht wird bald einfallen, aber die Horde hat noch immer keinen Platz gefunden, der für ein Lagerfeuer taugte, um endlich die karge Beute des Tages, ein Stück Wildschwein, den Rest vom Mahle eines Säbelzahntigers, zu braten.
Plötzlich, gleich verhoffenden Rehen, wenden alle die Köpfe gespannt in die nämliche Richtung: Sie haben einen Laut gehört. Der konnte nur von einem wehrhaften Tiere sein, denn die Gejagten haben gründlich gelernt, sich still zu verhalten. Und wieder dieser Laut. Ja, es ist ein Schakal, der da schreit. Seltsam bewegt steht die Horde und lauscht dem Gruß aus besseren und weniger gefährlichen Zeiten. Und dann tut der junge, hochstirnige Leiter der Horde etwas den anderen Unverständliches: Er trennt ein Stück von der Beute ab und wirft es auf den Boden. Möglich, daß sich die anderen ärgern, sie leben schließlich nicht so im Überfluß, daß man den Braten in der Steppe verstreuen dürfte. Wahrscheinlich wußte der Junge selbst nicht, weshalb er es tat, er handelte offenbar gefühlsmäßig, vielleicht wünschte er, die Schakale näher bei sich zu haben. Jedenfalls legte er noch öfters ein Stückchen Wildschwein auf die Spur. Begreiflich, daß die anderen dies für einen üblen Scherz nahmen und der Hordenleiter sich nur mit Mühe des Grimmes der Hungrigen erwehren konnte.
Schließlich saßen sie aber doch alle am Feuer, und mit der Sättigung überkam wieder der Friede die aufgebrachte Schar.
Mit einem Male hört man das Heulen der Schakale. Sie haben die ausgelegten Stücke gefunden und nähern sich auf der Spur dem Lager. Da sieht einer fragend nach dem Hordenführer, steht dann auf und legt in einiger Entfernung Knochen nieder, dort, wohin gerade noch der Feuerschein reicht. Ein bedeutendes Ereignis: die erste Fütterung eines nützlichen Tieres durch den Menschen.
Heute darf die Horde ruhig schlafen, denn die Schakale umschleichen das Lager, sie sind verläßliche Wächter. Und als am anderen Morgen die Sonne aufgeht, ist die Menschenhorde gut ausgeruht und vergnügt. Von diesem Tage an wird kein Stein mehr nach einem Schakal geworfen …
Viele Jahre sind vergangen, viele Generationen. Die Schakale sind zahmer, furchtloser geworden. In größeren Scharen umlagern sie die Plätze der Menschen, die jetzt sogar Wildpferde und Hirsche erlegen. Die Schakale haben auch ihre Lebensweise geändert: Während sie früher nur nächtens umherzogen, tagsüber aber tief versteckt im Dickicht ruhten, sind die Stärksten und Klügsten zu Tagtieren geworden und folgen dem jagenden Menschen auf seinen Beutezügen.
Und da mag es denn einmal geschehen sein, daß die Horde die Spur einer trächtigen Wildpferdstute aufgenommen hat, die durch eine Speerwunde in ihrer Flucht behindert wurde. Die Jäger sind sehr erregt, zumal die Kost seit langem schmal ist. Daher folgen auch die Schakale hungriger als sonst, da sie bei den Mahlzeiten der Menschen meist leer ausgegangen waren.
Die Stute, geschwächt von ihrer Trächtigkeit und vom Blutverlust, greift zu einem uralten, ihrer Art angeborenen Mittel: Sie legt einen »Widergang« an, das heißt, sie kehrt auf ihrer Spur kilometerweit zurück und wendet sich an einer buschigen Stelle scharf rechts von der Fährte ab. Oft schon hat dieser instinktive Kunstgriff ein Tier dem Jäger entzogen. Auch jetzt stehen die Jäger ratlos dort, wo im harten Steppenboden die Fährte scheinbar endet.
Die Schakale ziehen den Menschen nach, in gehörigem Abstand, denn sie wagen sich noch nicht in die Nähe der lärmenden, aufgeregten Jäger. Und sie folgen der Spur des Menschen, nicht der des Wildes. Begreiflicherweise hat ja der Schakal kein Interesse, die Fährte eines Wildpferdes zu verfolgen, da es ja für ihn nicht als Beute in Frage kommt. Diese Schakale aber haben wiederholt Teile großer Jagdtiere vom Menschen zu fressen bekommen, und ihr Geruch hat dadurch eine neue Bedeutung für sie erlangt, sie haben auch schon eine feste Gedankenverbindung zwischen einer starken Blutspur und der Aussicht auf baldige Beute gebildet.
Heute sind die Schakale besonders hungrig und erregt, die Blutspur ist frisch, und so ereignet sich etwas Neues für die Beziehung zwischen dem Menschen und seinen Trabanten. Die alte, grauschnäuzige Hündin, die geistige Führerin des Rudels, bemerkt, was die Menschen übersehen hatten, nämlich das Abzweigen der Blutspur. So biegen die Tiere an jener Stelle ein und folgen selbständig der Schweißfährte. Die Menschen haben inzwischen erfaßt, daß das Wild einen Widergang angelegt hat, und sind umgekehrt. An der Abzweigung angelangt, hören sie seitwärts die Schakale heulen. So finden sie rasch die Richtung und alsbald auch die Spur, die von den vielen Tieren im Steppengras hinterlassen wurde. Und nun ist zum ersten Male die Reihenfolge hergestellt, in der Mensch und Hund seit jenem Tage dem Wilde folgen: erst der Hund, dann der Jäger. Schneller als den Jägern gelingt es den Schakalen, das Wildpferd einzuholen und zu stellen. Wenn Hunde ein größeres Wild »stellen«, so spielt offenbar folgender psychologischer Mechanismus eine wesentliche Rolle. Der verfolgte Hirsch, Bär oder Eber, der zwar vor dem Menschen flieht, sich dem Hunde allein aber ohne weiteres zum Kampfe stellen würde, vergißt offenbar im Zorn über die Annäherung des frechen kleinen Feindes den viel gefährlicheren Verfolger. Das müde Wildpferd, das den Goldschakal nur als feigen Kläffer kennt, stellt sich zornig zur Verteidigung und schlägt wild mit dem Vorderhuf nach einem, der sich zu weit herangewagt hat. Schwer atmend tritt es im Kreise, nimmt jedoch die Flucht nicht wieder auf. Die Menschen nun hören den Lärm der Schakale, sie bemerken, daß er an derselben Stelle bleibt, der Führer gibt das Signal, die Jäger verteilen sich lautlos nach allen Seiten und umzingeln die Beute. Im Augenblick scheint es, als wollten die Schakale auseinanderstieben; aber sie beruhigen sich wieder, weil niemand sie ansieht. Die kleine Führerin des Rudels hat jede Furcht verloren, wütend bellt sie das Wildpferd an, und als dieses schließlich von einem Speer durchbohrt niederbricht, graben sich ihre Zähne gierig in die Kehle des Opfers. Erst da der Leiter der Menschenhorde sich zu dem toten Tier niederbeugt, weicht sie einige Schritte zurück. Der Hordenleiter, vielleicht der Urururenkel dessen, der zum ersten Male ein Beutestück für die Goldschakale zurückgelassen hat, schlitzt den Bauch der noch zuckenden Beute auf, zerrt roh ein Darmstück heraus, schneidet es ab, und ohne den Schakal direkt anzusehen, ein Akt höchsten intuitiven Taktgefühls, wirft er das Stück, wiederum taktvoll, nicht unmittelbar nach dem Tiere, sondern seitwärts daneben hin. Die graue Leiterin prescht scheu etwas zurück, als aber der Mensch keine Drohgebärde macht, sondern einen freundlichen Ton hören läßt, den die Schakale schon oft am Rande des Lagerfeuers gehört haben, stürzt sie heftig auf das Darmstück zu. Und als sie eilig, schon kauend, mit der Beute im Fang sich zurückziehen will und nochmals ängstlich nach dem Menschen schielt, bewegt sich ihr Schwanz in kleinen raschen Schlägen von rechts nach links. Zum ersten Male hat ein Schakal den Menschen angewedelt; damit war ein weiterer Schritt zum Haushund hin getan.
Tiere, selbst so kluge, wie es hundeartige Raubtiere sind, erwerben eine völlig neue Verhaltensweise nie durch plötzliche Eingebung, sondern durch assoziative Gedankenverbindungen, die sich erst nach mehrfacher Wiederholung einer Situation bilden. Monate mögen vergangen sein, ehe diese Schakalhündin wieder bei Verfolgung eines verwundeten Wildes, das Widergänge anlegte, auf der Spur vor dem Jäger herlief. Vielleicht war es erst ein späterer Nachfahre, der regelmäßig und bewußt die Jäger leitete und das Wild stellte.
An der Grenze zwischen älterer und jüngerer Steinzeit scheint der Mensch ansässig geworden zu sein. Die ersten Häuser, die wir kennen, sind Pfahlbauten, die aus Sicherheitsgründen in das Flachwasser der Seen und Flüsse, ja sogar der Ostsee, gebaut wurden. Wir wissen, daß zu jener Zeit der Hund bereits zum Haustier geworden war. Der Torfspitz, ein kleiner, spitzähnlicher Hund, dessen Schädel zuerst in den Resten von Pfahlbauten an der Ostsee gefunden wurde, zeigt zwar noch deutlich seine Abkunft vom Goldschakal, doch sind auch Merkmale echter Domestikation nicht zu übersehen. Wesentlich ist, daß es damals wilde Goldschakale, die gewiß im älteren Diluvium weiter verbreitet waren als heute, an der Ostseeküste nicht mehr gab. Der nach Westen und Norden vordringende Mensch hat also wahrscheinlich halbzahme Rudel von Goldschakalen, die seinem Lager folgten, ja vielleicht schon weitgehend domestizierte Hunde, an die Küste der Ostsee mitgebracht.
Als dann der Mensch dazu überging, seine Behausung auf Pfählen ins Wasser zu stellen, und als er auch den Einbaum erfand, wurde zweifellos eine Änderung der Beziehungen zwischen ihm und seinen vierbeinigen Trabanten notwendig. Denn diese konnten nun nicht mehr das menschliche Heim von allen Seiten umlagern. Es ist anzunehmen, daß damals die Menschen, gerade beim Übergang zum Pfahlbau, besonders zahme, auf der Jagd bewährte und deshalb wertvolle Exemplare der noch kaum domestizierten Goldschakale mitnahmen und dergestalt zu »Haus-Tieren« im eigentlichen Sinne machten.
Noch heute können wir bei verschiedenen Völkern verschiedene Typen der Hundehaltung feststellen. Der ursprünglichste ist der, bei welchem eine größere Zahl von Hunden, die nur in verhältnismäßig loser Bindung zum Menschen stehen, die Siedlung umlagern. Einen anderen finden wir in jedem europäischen Bauerndorf: Einige Hunde gehören zu einem bestimmten Haus und hängen einem bestimmten Herrn an. Es ist denkbar, daß sich dieser Typus mit der Entstehung des Pfahlbaues entwickelt hat. Die geringere Anzahl von Hunden, die man im Pfahlbau unterbringen konnte, förderte natürlich die Inzucht, womit jene erblichen Veränderungen begünstigt wurden, welche das eigentliche Haustier ausmachen. Für derlei Annahmen sprechen zwei Tatsachen: erstens, daß der Torfspitz mit seinem gewölbteren Schädel und der kürzeren Nase zweifellos eine Domestikationsform des Goldschakals ist, und zweitens, daß die Knochen dieser Form so gut wie ausschließlich mit den Überresten von Pfahlbauten gefunden wurden. Die Hunde der Pfahlbauern müssen auch soweit zahm gewesen sein, daß man sie veranlassen konnte, entweder in einen Einbaum zu steigen oder das trennende Wasser schwimmend zu überqueren und auf einem Laufsteg emporzuklettern. Irgendein nur halbzahmer, das Lager umstreunender Köter würde nämlich dies um keinen Preis wagen, ja selbst einem Junghund meiner Zucht muß ich geduldig zureden, ehe er zum ersten Male in mein Kanu steigt oder das Trittbrett eines Eisenbahnwagens erklimmt.
Die Zahmheit des Hundes war möglicherweise schon erreicht, als die Menschen Pfahlbauten errichteten, oder aber sie ist zu jener Zeit erst entstanden. Es ist denkbar, daß einmal eine Frau oder ein »puppenspielendes« Mädchen einen verwaisten Welpen im Kreise der menschlichen Familie großgezogen hat. Vielleicht war dieses Hundekind das einzig überlebende eines Wurfes, der vom Säbelzahntiger erbeutet wurde. Der Welpe weint, aber kein Mensch kümmert sich darum, da man damals noch starke Nerven hatte. Aber während die erwachsenen Männer in den Wäldern jagen und die Frauen mit Fischfang beschäftigt sind, geht so eine kleine Pfahlbauerntochter dem Weinen nach und findet schließlich in einer Höhlung das Hundekind, das ihr furchtlos entgegenwackelt und an den vorgestreckten Händen zu lecken und zu saugen beginnt.
Das rundliche, weiche und wollige Tier hat sicher schon in der Tochter der früheren Steinzeit den Drang ausgelöst, es auf den Arm zu nehmen, zu herzen und endlos herumzuschleppen, nicht anders als in einer Tochter unserer Tage. Denn die Triebe der Mütterlichkeit, denen solche Handlungen entspringen, sind uralt. Und auch die kleine Steinzeittochter hat, zunächst nur in spielerischer Nachahmung dessen, was sie die älteren Frauen tun sah, dem Hund zu essen gegeben, und die Gier, mit welcher das Hundekind sich auf alles Gebotene stürzte, hat sie nicht weniger gefreut als unsere Mütter und Frauen, wenn das Essen den Gästen gut schmeckt. Kurz, das Entzücken ist groß, und als die Eltern heimkehren, finden sie, zwar erstaunt, keineswegs aber begeistert, einen kleinen vollgefressenen Schakalhund. Natürlich will der rauhe Krieger den Welpen gleich ins Wasser werfen. Aber die Tochter weint und hängt sich schluchzend an des Vaters Knie, so daß er stolpert und das Hundekind fallen läßt. Als er es wieder ergreifen will, ist es schon im Arm der Tochter geborgen, die zitternd und tränenüberströmt in der fernsten Ecke des Raumes steht. Da auch Steinzeitväter ihren kleinen Töchtern gegenüber nie ein steinernes Herz besessen haben, darf der Welpe bleiben.
Dank dem reichlichen Futter ist er bald zu einem überdurchschnittlich großen und starken Tier herangewachsen. Ist er vorerst in kindlicher Anhänglichkeit der Tochter getreulich überallhin nachgelaufen, so macht sich seit seiner körperlichen und geistigen Reife eine Wandlung in seinem Verhalten bemerkbar: Obwohl der Vater, der Häuptling der Kolonie, sich kaum um den Hund kümmert, folgt dieser mählich immer mehr dem Manne, nicht dem Kinde nach. Es ist eben die Zeit gekommen, da sich das Tier, wäre es in freier Wildbahn, von der Mutter lösen würde. Hat die Tochter bisher im Leben des Welpen die Rolle der Mutter gespielt, so fällt nun dem Familienvater die des Rudelleiters zu, dem allein die Gefolgschaftstreue des erwachsenen Wildhundes gehört. Zuerst ist dem Manne diese Anhänglichkeit lästig, doch bald sieht er ein, daß der völlig zahme Rüde zur Jagd viel brauchbarer ist als die halbwilden Schakale, die draußen am Ufer vor der Siedlung herumlungern, sich immer noch vor dem Jäger fürchten und häufig gerade dann davonlaufen, wenn sie ein Wild stellen und festhalten sollen. Aber auch diesem gegenüber ist der Rüde schneidiger als seine ungezähmten Genossen, da sein im Pfahlbau geschütztes Leben ohne bittere Erfahrungen mit großen Raubtieren geblieben ist. So wird der Hund bald der Liebling des Häuptlings, sehr zum Kummer der kleinen Tochter, die den Spielgefährten von einst nur dann zu sehen bekommt, wenn der Vater daheim ist, und Steinzeitväter waren oft lange Zeit fort.
Im Frühling aber, zur Zeit, da die Schakale Junge haben, kehrt der Vater eines Abends mit einem Fellsack heim, in welchem es zappelt und quietscht. Und als er ihn öffnet – laut jubelt da die Tochter, weil vier Wollknäuel vor ihre Füße kollern. Nur die Mutter blickt ernst und meint, zwei hätten auch genügt …
Ob sich das alles so zugetragen hat? Nun, es ist keiner von uns dabeigewesen … Aber nach allem, was wir wissen – ja, es könnte so gewesen sein. Allerdings wissen wir nur sehr wenig, das soll nicht verhehlt werden, wir wissen nicht einmal mit völliger Sicherheit, ob es ausschließlich der Goldschakal gewesen ist, der sich in der geschilderten Weise den Menschen angeschlossen hat. Es ist sogar recht wahrscheinlich, daß an verschiedenen Orten der Erde verschiedene größere und wolfsähnliche Schakalarten in dieser oder ähnlicher Weise zum Haustiere geworden sind und sich späterhin auch miteinander vermischt haben – wie ja überhaupt sehr viele Haustiere von mehr als einer wilden Ahnenform abstammen. Ganz sicher aber ist der Stammvater unserer meisten Haushunde nicht der nordische Wolf, wie früher ganz allgemein angenommen wurde. Es gibt nämlich einige wenige Hunderassen, die, wenn nicht ausschließlich, so doch zum größten Teil wolfsblütig sind. Die aber liefern gerade durch ihre Eigenart den besten Beweis dafür, daß jene nicht vom nordischen Wolfe abstammen. Diese nicht nur äußerlich, sondern wirklich wolfsähnlichen Hunderassen – Eskimo- und Indianerhunde, Samojeden, russische Laikas, Chow-Chows und einige andere – entstammen sämtlich dem hohen Norden. Keiner von ihnen ist ganz rein lupusblütig: Es ist mit ziemlicher Sicherheit anzunehmen, daß die weiter und weiter nach Norden vordringenden Menschen bereits domestizierte, schakalblütige Hunde mit sich geführt haben, aus denen dann durch ständig wiederholte Einkreuzung von Wolfsblut die genannten Rassen hervorgegangen sind. Über die seelische Eigenart der wolfsblütigen Hunde werde ich noch viel zu sagen haben!
Wurzeln der Herrentreue
Die Anhänglichkeit eines Hundes entstammt zwei voneinander grundsätzlich verschiedenen, triebmäßigen Quellen. Größtenteils ist sie, vor allem bei unseren europäischen Rassen, Folge jener Bindungen, die den jungen Wildhund an das Elterntier fesseln, die aber beim Haustier als Teilerscheinung einer allgemeinen Verjugendlichung dauernd erhalten bleiben. Die andere Wurzel der Anhänglichkeit liegt in der Gefolgschaftstreue, mit welcher der Wildhund an der Person des Rudelleiters hängt, aber auch in der persönlichen Liebe, welche die Rudelgenossen untereinander verbindet.
Diese zweite Wurzel ist bei allen wolfsblütigen Hunden stärker als bei den Schakal-Abkömmlingen, da im Leben des Wolfes der Zusammenhalt des Rudels eine bedeutend größere Rolle spielt.
Nimmt man ein Jungtier einer nicht domestizierten Hundeart zu sich und zieht es wie einen Haushund in der menschlichen Familie auf, so kann man sich leicht davon überzeugen, daß die Jugendanhänglichkeit des wilden Tieres identisch ist mit jenen sozialen Bindungen, welche die meisten unserer Haushunde zeitlebens bei ihrem Herrn halten. Ein solcher junger Wolf ist zwar scheu, drückt sich gern in finsteren Winkeln herum, hat Hemmungen, einen freien Platz zu überqueren, schnappt leicht zu, wenn Fremde ihn streicheln wollen – er ist von Geburt an ein »Angstbeißer« –, dem Herrn gegenüber verhält er sich jedoch in allen Punkten wie ein junger Hund, auch was die Anhänglichkeit betrifft. Handelt es sich um ein Weibchen, das auch in freier Wildbahn normalerweise einen männlichen Leitwolf als »vorgesetzte Dienststelle« anerkennen würde, mag es unter Umständen einem begabten Erzieher gelingen, in diese Stellung hinüberzuwechseln und dergestalt sich die Anhänglichkeit dauernd zu sichern. Handelt es sich aber um einen Rüden, gibt es für den Herrn regelmäßig bittere Enttäuschungen: Sobald das Tier nämlich voll erwachsen ist, sagt es dem Menschen plötzlich den Gehorsam auf und macht sich unabhängig. Es wird zwar dem bisherigen Herrn gegenüber nicht bösartig, es behandelt ihn als Freund, keineswegs jedoch als ehrfurchtgebietenden Herrscher, ja es versucht vielleicht sogar, seinen Herrn zu unterjochen und sich zum Spitzentier, zum Leitwolf aufzuschwingen. Bei der Gefährlichkeit des Wolfsgebisses geht dies häufig nicht ganz unblutig ab.
Ähnliche Erfahrungen machte ich mit meinem Dingo. Er war gewiß nicht aufsässig, auch versuchte er nicht, mich zu beißen, als er jedoch die volle Reife erlangt hatte, fand er eine höchst eigenartige Weise, mir seinen Gehorsam aufzukündigen. Als Jungtier unterschied er sich in seinem Verhalten überhaupt nicht von einem Haushund. Hatte er etwas angestellt und war er dafür bestraft worden, sah man auch ihm das schlechte Gewissen an, auch er suchte den erzürnten Menschen zu versöhnen und seine Liebkosung zu erbetteln. Als er aber etwa eineinhalb Jahre alt geworden war, nahm er zwar immer noch jede Strafe ohne Widerrede hin, das heißt ohne zu knurren oder sich zu widersetzen, war jedoch die Sache vorbei, schüttelte er sich, wedelte mich freundlich an, wollte spielen, kurz, er war in seiner Stimmungslage von der Strafe nicht im geringsten beeinflußt und ließ sich durch sie nicht im leisesten davon abhalten, beispielsweise wieder zu versuchen, eine meiner schönen Enten umzubringen.
Im selben Alter verlor er jede Neigung, mich auf meinen täglichen Spaziergängen zu begleiten, er lief einfach weg, ohne sich um meine Rufe zu kümmern. Dabei war er, um dies nochmals zu betonen, mir durchaus freundschaftlich gesinnt und begrüßte mich, sooft wir einander trafen, freudig mit allen bei einer Hundebegrüßung üblichen Zeremonien. Man darf eben von einem wilden Tier niemals erwarten, daß es den befreundeten Menschen anders behandelt als einen Artgenossen. So brachte mir denn jener Dingo wohl die herzlichen Gefühle entgegen, die ein solches Tier in erwachsenem Zustande einem anderen entgegenbringt, nur gehörten eben die der Unterwürfigkeit und des Gehorsams nicht dazu. Im Gegensatz zu diesen Wildhunden verhalten sich alle höher domestizierten Hunde, die, wie wir noch sehen werden, vorwiegend aureusblütig sind, während ihres ganzen Lebens zum menschlichen Herrn so, wie die Jungen jener zum älteren Tier.
Wie so ziemlich sämtliche Charakterzüge, ist auch die persistierende Kindlichkeit ein Vorzug oder ein Fehler. Hunde, denen sie völlig mangelt, mögen in ihrer Unabhängigkeit tierpsychologisch interessant sein, doch erlebt ihr Herr an diesen »Strawanzern« wenig Freude. Im späteren Alter können sie unter Umständen auch recht gefährlich werden; da ihnen nämlich die typische Unterwürfigkeit fehlt, »finden sie einfach nichts dabei«, einen Menschen ebenso derb zu beißen und zu schütteln wie einen ihresgleichen.
Obwohl, wie gesagt, die dauernde Jugendanhänglichkeit bei den meisten Haushunden die eigentliche Quelle der Herrentreue ist, kann eine extreme Übertreibung auch zu gegenteiligen Folgen führen: Solche Hunde sind dann zwar ihrem Herrn unleugbar anhänglich – aber jedem anderen Menschen auch! Ich habe diesen Hundecharakter einmal mit dem gewisser verwöhnter Kinder verglichen, die zu jedem Menschen »Onkel« sagen und in distanzloser Vertraulichkeit ihre Liebesbezeigungen auch jedem Fremden aufdrängen. Dabei ist es nicht etwa so, daß ein solches Tier seinen Herrn nicht kennt, nein, es freut sich herzlich, ihn gelegentlich wiederzusehen, ist aber unmittelbar hernach sogleich bereit, mit jedem beliebigen Menschen zu gehen, der freundlich zu ihm spricht oder gar mit ihm spielt. Als Kind bekam ich einmal von einem liebevollen, aber wenig tierverständigen Verwandten einen Dackel, ein wahres Zerrbild eines Hundes. Kroki, so hieß das Tier – es sah nämlich von allen käuflichen Lebewesen jenem Krokodil noch am ehesten ähnlich, welches ich zuerst geschenkt bekam, das ich aber mangels der nötigen Heizvorrichtungen nicht halten konnte –, Kroki war besessen von einer überquellenden, die ganze Welt umfassenden Menschenliebe; leider war es ihm vollkommen gleichgültig, wer jeweils diese Welt repräsentierte. Nachdem wir anfangs das treulose Vieh immer wieder aus den verschiedensten Häusern, in die es gelaufen war, heimgeholt hatten, resignierten wir und vermachten Kroki einer hundefreundlichen Cousine, die in Grinzing wohnte. Dort führte Kroki ein merkwürdiges, unhündisches Dasein: Er schlief einmal bei dieser, das andere Mal bei jener Familie, wurde gestohlen und wieder weiterverkauft (möglicherweise war es immer derselbe Dieb, dem der menschenfreundliche Hund zu gutem Verdienst verhalf) – kurz, wer das andere Ende der Leine in die Hand nahm, war geliebt und Gebieter …