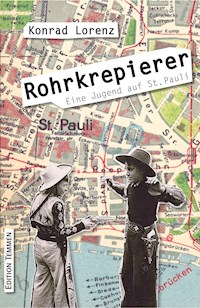9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: dtv bibliothek
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Ein Leben in einer Arche Noah. Berühmt geworden ist er als der »Gänsevater«: der Mediziner, Zoologe und Pionier der Verhaltensforschung Konrad Lorenz. Sein Haus war bevölkert von Wildgänsen, Kakadus, Singvögeln, Hunden, Kapuzineraffen und Fischen. Als Tierfreund und Wissenschaftler zugleich erzählt Konrad Lorenz voller Einfühlungsvermögen, unsentimental, selbstironisch, witzig und herzerwärmend von seinen Erlebnissen mit den Hausgenossen und verknüpft damit Beobachtungen, vielfältige Informationen und Betrachtungen darüber, wie Tiere wirklich sind und was Menschen im Umgang mit ihnen falsch machen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Ähnliche
Konrad Lorenz
Er redet mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen
Mit einem Vorwort von Patrick Bahners
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
VorwortKonrad Lorenz (1903–1989)
Konrad Lorenz, um 1980 (ullstein bild – Interpress Paris)
»Ich möchte Konrad Lorenz sein.« Diese Antwort gab der Dichter W. H. Auden, als ihn eine englische Sonntagszeitung im Dezember 1963 nach seinen Tagträumen befragte. Auden musste nicht erklären, wer das war, in den er sich hineinversetzen wollte. Lorenz, der gerade seinen sechzigsten Geburtstag gefeiert hatte, war eine internationale Berühmtheit. Er galt als der Begründer einer neuen wissenschaftlichen Disziplin, der Verhaltensforschung, von der man sich, ähnlich wie ein halbes Jahrhundert zuvor von der Psychoanalyse, revolutionäre Aufschlüsse über die Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Innenlebens versprach. 1973 erhielt er für diese Pionierarbeiten gemeinsam mit seinem niederländischen Freund Niko Tinbergen und seinem österreichischen Landsmann Karl von Frisch den Nobelpreis für Medizin.
Konrad Lorenz, der 1903 in Wien geborene Sohn eines berühmten Professors der Orthopädie mit Patienten auf beiden Seiten des Atlantiks, hatte wie Sigmund Freud in Wien Medizin studiert. Und wie Freud die Leiden seiner Patienten auf verschüttete Erfahrungen der frühen Kindheit zurückführte, mit denen er gleichzeitig so etwas wie eine Gattungserinnerung auszugraben behauptete, so wandte sich Lorenz dem Tier zu, um in die Vorgeschichte des Bewusstseins hinabzusteigen – auf der Suche nach elementaren Automatismen der Orientierung von Lebewesen unter ihresgleichen, die das Bewusstsein teilweise verdeckt und teilweise ersetzt. Dem Unbewussten bei Freud entspricht bei Lorenz der Instinkt. Das »sogenannte Allzumenschliche«, also das Verdrängte und Peinliche, erläuterte Lorenz in dem hier in 48. Auflage vorgelegten, erstmals 1949 erschienenen Buch ›Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen‹, sei »fast immer das Vor-Menschliche«, das, »was wir mit den höheren Tieren gemeinsam haben«.
Die Bewegungen der Tiere, auf der Suche nach Nahrung und beim Werben um den Partner, auf der Flucht vor dem Feind und beim Angriff auf den Feind, nahm Lorenz, wie es der Altphilologe Walter Burkert formulierte, »als vereinfachte Modelle unseres eigenen Benehmens und Erlebens«. Von der Theorie des Aggressionstriebs, die Lorenz 1963 in dem Buch ›Das sogenannte Böse‹ entfaltete, ließ sich Burkert für sein Buch ›Homo Necans‹ inspirieren, eine Untersuchung der Bedeutung des Opfers in der Menschheitsgeschichte. Das von Burkerts Begriff des Modells betonte konstruktive Moment der Verhaltensforschung spielte Lorenz in seinen eigenen Einlassungen zur Methode systematisch herunter. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nicht: Im Titel dieses Buches vergleicht er sich mit einem abgewandelten Zitat aus dem 1. Buch der Könige mit König Salomo, der biblischen Verkörperung der Weisheit. Der Königsweg des neuen Salomo war die Beobachtung.
Lorenz wollte keine Modelle bauen, er wollte nur sehen – und gesehen werden. Der Film, der Krähenflug und Hahnenkämpfe festhält, wurde zum wesentlichen Erkenntnismittel der Verhaltensforschung, und in den Filmen, die für das junge Fach Werbung machten, kam immer auch der Forscher ins Bild, der teilnehmende Beobachter.
Die Zeitungsleser, die 1963 davon erfuhren, dass es der Traum W. H. Audens war, Konrad Lorenz zu sein, hatten daher zu diesem Namen nicht bloß das Zeitungswissen über einen Bestsellerautor und gefeierten Wissenschaftler parat. Ihnen stand ein Bild vor Augen: ein stattlicher Mann, mit funkelnden Augen, markanter Nase, charaktervollem Kinn und kräftigem Bartwuchs, an der Spitze einer Gänsekolonne oder in der Mitte eines Dohlenschwarms. Salomo redete laut Luthers Übersetzung »vom Vieh, von Vögeln, vom Gewürm und von Fischen«. Lorenz redete mit den Tieren. Denn er lebte mit ihnen, schon seit seiner Kindheit. Als Student hatte er in der väterlichen Villa in Altenberg bei Wien eine Vogelkolonie angesiedelt.
Die wissenschaftlichen Institute, die für ihn gegründet wurden, wie das Max-Planck-Institut für Verhaltensphysiologie am Eßsee in Oberbayern, waren nur temporäre Gehäuse für diese Lebensgemeinschaft. Der Forscher Lorenz bekam so viel Auslauf, wie er für seine Forschungsobjekte verlangte. Er lebte wie ein Tier, wie Filme und Fotos beweisen: Zwar konnte er nicht den Dohlen hinterherfliegen, dafür aber den Graugänsen voranwatscheln. In seinem Vorwort zu dem hier vorliegenden Buch legt Lorenz dar, dass die »unmittelbare Vertrautheit mit dem lebenden Tier« nur durch »unmenschliche Geduld des Beobachters« erworben werde. Ein normaler Mensch hätte nicht wie Lorenz leben können. Sich auszumalen, Konrad Lorenz zu sein: das hieß, von der Rückkehr zur Natur zu träumen – im Namen und im Dienste der Wissenschaft. Der Wille zum Wissen legitimierte den Wunsch nach Regression: Diese Ambivalenz ist der poetische Witz von Audens Tagtraumbild. Altenberg und das Max-Planck-Dorf Seewiesen waren Exklaven, Kolonien der Natur in der Zivilisation, die das Land nicht urbar machten, sondern wieder verwildern ließen.
Dieser mythologischen Deutung des Projekts der Verhaltensforschung hat Lorenz selbst die Stichworte geliefert. Im ersten Kapitel schildert er einen Moment des Wiedererkennens: wie er »an einem trüben Vorfrühlingstage« am Donauufer eine Gans aus einer fliegenden Schar Graugänse, die »zweite im linken Gliede der dreieckigen Phalanx«, als den Gänserich identifizierte, den er auf den Namen Martin getauft hatte. Im zeitlosen Präsens fixiert er, was er in diesem Moment empfunden haben will. »Ich staune zutiefst, dass es möglich war, mit einem frei lebenden Vogel in so vertrauten Verkehr zu treten, und ich empfinde diese Tatsache als etwas seltsam Beglückendes, als sei durch sie ein kleiner Teil der Vertreibung aus dem Paradiese rückgängig gemacht worden.« In der Illustrierung seines Forscherlebenswerks mit Bibelanspielungen geht Lorenz hier noch einen Schritt hinter Salomo zurück. An der gleichen Stelle lässt er die Leser wissen, dass er nur denjenigen Gänsen einen Namen gab, die er selbst aufzog; die anderen erhielten Nummern. In seiner kleinen Welt ist er der erste Mensch; laut dem Buch Genesis hatte Adam von Gott das Recht erhalten, die Tiere zu benennen.
1951 wurde Lorenz in einer Schweizer Zeitung mit der Maxime zitiert, dass der Satz »Aller Anfang ist schwer« in der Wissenschaft umzukehren sei. »Wenn es einem gegeben ist, ein neues Gebiet zu erschließen, so ist der Forscher zunächst selber der Laie. Eine junge Wissenschaft ist aus diesem Grund dem Laien immer leichter darzustellen als eine alte, die mit Bergen traditionellen Wissens beladen ist.« Das Buch von 1949 bewahrt diesen Zauber des Beginnens. Die Anfangsgründe der Verhaltensforschung werden in flaumfederleichter Form dargestellt, in Tiergeschichten, Geschichten von bestimmten Tieren, das heißt Individuen, die Lorenz mit Namen versehen hat. Am berühmtesten ist »das Gänsekind Martina«, die Lebensgefährtin des Gänserichs Martin, bei der Konrad Lorenz die Stelle der Mutter vertrat, weil er das erste bewegliche Etwas gewesen war, das sie sah, als sie schlüpfte.
Das Buch bezeichnet auch einen Neuanfang im bürgerlichen Leben des Verfassers. 1940 war er an die Universität Königsberg berufen worden, als Ordinarius für Psychologie, dessen Ahnenreihe auf Immanuel Kant zurückgeführt wurde. Im Jahr darauf wurde er zur Wehrmacht eingezogen; er diente als Heerespsychologe und Militärarzt. 1948 kehrte er nach vier Jahren in sowjetischer Kriegsgefangenschaft nach Österreich heim. Er war ohne Anstellung und besann sich auf sein erzählerisches Naturtalent, das sich auch bei seinen Vorträgen im Kriegsgefangenenlager bewährt hatte. Für einige Kapitel, auch die Geschichte Martinas, griff er auf Zeitungsartikel aus der Vorkriegszeit zurück.
Lorenz verstand die Verhaltensforschung als Fortentwicklung der Evolutionslehre Charles Darwins. Die fixen Bewegungsmuster (»Instinkthandlungen«), die Tinbergen und Lorenz entdeckten, sahen sie wie Organe an: als Ergebnisse natürlicher Auslese, die mindestens früher einmal der Erhaltung der Art gedient hatten. Lorenz publizierte seine epochemachenden Aufsätze Mitte der dreißiger Jahre. Dass sie ihm keine Förderung im österreichischen Wissenschaftssystem eintrugen, führte er auf den Widerstand der katholischen Kirche gegen den Darwinismus zurück. Mit Erfolg bewarb er sich in Deutschland um ein Stipendium der Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft, der Vorgängerorganisation der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Am 28. Juni 1938, nach der Annexion Österreichs, reichte der Privatdozent Lorenz seine Bewerbung um Aufnahme in die NSDAP ein; der Antrag wurde angenommen. Auf dem Antragsformular rühmte sich Lorenz, er habe seine akademische Lehre in den Dienst einer »wirklich erfolgreichen Werbetätigkeit« für den Nationalsozialismus gestellt. Er dürfe »wohl sagen, dass meine ganze wissenschaftliche Lebensarbeit, in der stammesgeschichtliche, rassenkundliche und sozialpsychologische Fragen im Vordergrund stehen, im Dienste Nationalsozialistischen Denkens steht«.
Anders als diese Selbstauskunft suggeriert, haben Fragen der Eugenik und die Kategorie der Rasse für die Schriften von Lorenz aus der Zeit vor 1938 keine besondere Bedeutung. Die Aufsätze aus seiner aktiven nationalsozialistischen Phase sind Gegenstand einer wissenschaftshistorischen und erinnerungspolitischen Debatte, die seit der Zuerkennung des Nobelpreises nicht abgerissen ist. Das hat seinen Grund in der Sache. Eine Affinität zur nationalsozialistischen Weltanschauung begründete – tief unterhalb politischer oder konfessioneller Einstellungen – ein Hauptgedanke der Verhaltensforschung Lorenz’scher Prägung. Mit einer Radikalität, in der ihm kaum ein Kollege folgte, bestand Lorenz zeitlebens auf dem kategorischen Unterschied von angeborenen und erlernten Eigenschaften. Die gesamte Zivilisation konnte unter dieser Prämisse negativ bewertet werden, als Resultat des Verlusts der naturgegebenen Sicherheit instinktgesteuerten Verhaltens.
In diesem Sinne nahm Lorenz 1940 in einem Aufsatz über ›Durch Domestikation verursachte Störungen arteigenen Verhaltens‹ eine »noch schärfere Ausmerzung ethisch Minderwertiger« als vermeintlich wissenschaftlich gebotene Aufgabe der »Rassenpflege« in Aussicht. Die Domestikation, die Verwandlung von Wildtieren in Haustiere, sah er als Überlistung der natürlichen Selektion und als Menetekel einer Entartung des Menschengeschlechts. Für diese Gefahr fand er das hässliche Wort der »Verhausschweinung des Menschen«. Hier schlug der Primitivismus der Verhaltensforschung, ihr methodisches Interesse am Vormenschlichen, in die Vision einer Barbarisierung der Gesellschaft um. Allerdings hatte auch Sigmund Freud 1932 in einem Briefwechsel mit Albert Einstein den Prozess der Zivilisation, der auch »körperliche Veränderungen« mit sich bringe, mit der »Domestikation gewisser Tierarten« verglichen. Die Befürchtung, dass alles Lernen der Menschen die Verkümmerung der Instinkte nicht kompensieren könne, bildet den apokalyptischen Horizont der kulturkritischen Bücher wie ›Die acht Todsünden der zivilisierten Menschheit‹, die dem 1989 verstorbenen Lorenz im Alter eine ungeheure Resonanz einbrachten. Nicht mehr der Rassenpflege, sondern dem Umweltschutz galten nun seine Ratschläge.
Die skeptische Einschätzung der Domestikation bleibt für die Sicht der Beziehungen von Mensch und Tier bestimmend, die Lorenz in ›Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen‹ ausbreitet. Der Autor will demonstrieren, dass er seine eigenen Tiere in Freiheit gehalten hat, und warnt vor sentimentalen Missverständnissen bei der Anschaffung von Haustieren. Die fundamentale Gesellschaftskritik, die Lorenz wenige Jahre vor 1949 an die Pathologie der Domestikation geknüpft hatte, schimmert nur noch im Kapitel über die Hundezucht mit der Schiller-Überschrift »Treue ist doch kein leerer Wahn« durch. Das Kapitel ist die Skizze zu einem Buch, das ein Jahr später erschien und ebenfalls ein Klassiker der Tierliteratur werden sollte: ›So kam der Mensch auf den Hund‹. Lorenz nimmt hier für die Verhaltensforschung in Anspruch, dass sich die von ihr postulierten Unterschiede der Instinktausstattung auch im körperlichen Erscheinungsbild der Tierarten zeigen. Er beschreibt zwei Großfamilien von Hunderassen, die Lupushunde, in deren Adern das Blut ihrer wölfischen Ahnen unvermischt pulsiere, und die Aureushunde, die nicht vom Wolf abstammen sollen, sondern vom Schakal, den sich die Jägerhorden der Steinzeit als Abfalljäger und Lagerwächter zugelegt hätten. Diese Hypothese der doppelten Stammeslinie der Hunde darf im Lichte der genetischen Forschung heute als widerlegt gelten.
Wenn Lorenz den »Treueid« des Wolfshunds, der »zwar dein Freund bis in den Tod, aber niemals dein Sklave« ist, der sprichwörtlich »hündischen« Unterwürfigkeit des gewöhnlichen Haushunds gegenüberstellt, scheint diese Taxonomie der Verhaltenstypen von zeitbedingten Moralvorstellungen kontaminiert. Dabei gibt Lorenz im gleichen Buch in der Dokumentation des Settings seiner Forschungen die besten Gründe dafür, dass Menschen sich Tiere nicht einfach zum Beispiel nehmen können. Nicht moralisches, nur »moralanaloges« Verhalten kann den Tieren zugeschrieben werden: Sie wissen nicht, was sie tun. Die Verhaltensforschung von Lorenz »ließ Tiere unmittelbar verständlich werden«, wie Walter Burkert schrieb, aber ohne Einfühlung, ausschließlich durch Beobachtung und Beschreibung. Ihre Modelle, mochte der Zungenschlag ihres sprachgewaltigen Erfinders gelegentlich auch anderes nahelegen, waren nicht normativ zu gebrauchen.
Die Evidenz, die unmittelbare Verständlichkeit, welche die neue Wissenschaft der Verhaltensforschung für ein großes Publikum in der Nachkriegszeit hatte, dürfte mit einem Überdruss am Normativen zu tun haben, mit der Skepsis gegenüber gewaltsam angeordneten Verhaltensumstellungen, die ein Ergebnis des katastrophalen Sozialexperiments des Nationalsozialismus war. Verhalten ist ein Alternativbegriff zum Handeln. Die Verhaltensforschung berichtete aus einer Welt, in welcher der Wille nicht viel ausrichten konnte. Dass diese Perspektive auch der Entlastung dienen konnte, liegt im Rückblick auf der Hand. Mitten in der Welt der manischen Wiederaufbauarbeit präsentiert ›Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen‹ das Selbstbild eines Wissenschaftlers, der sein Werk nur verrichten konnte, weil er sich als »sehr fauler Mensch« zu erkennen gab.
Konrad Lorenz zu sein: Der Leser des Buches begreift heute noch, wie dieser Traum sich verbreiten konnte. Der Autor selbst stellt sein Leben als einen Tagtraum dar, der Wirklichkeit geworden ist. »Glückliche Wissenschaft, in der ein wesentlicher Teil der Forschung darin besteht, dass man nackt und wild in Gesellschaft einer Schar Wildgänse in den Donau-Auen herumkriecht und schwimmt.«
Patrick Bahners
Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen
Über Fabrikationsfehler
Ein reumütiges Vorwort zur zweiten Auflage der Originalausgabe
Wir, das heißt der Autor, der nie vorher ein Buch geschrieben hatte, die Verlegerin, die eigentlich Juristin und sekundär Buchdruckerin ist, die noch nie ein Buch verlegt hatte, und schließlich der Lektor, der es zwar faustdick hinter den Ohren hat, aber der einzige literarische »Professional« unter uns dreien ist, haben voriges Jahr an einem gemütlichen Abend, da man über gute und schlechte Tierbücher diskutierte, beschlossen, dieses Büchlein zu fabrizieren. Wir sind herzlich stolz auf unser Produkt, wollen uns aber nicht verhehlen, daß es einige Fehler hat.
Da ist zum Beispiel gleich der Titel: »Er redete mit dem Vieh, den Vögeln und den Fischen«! Er kann offenbar mißverstanden werden, denn einer meiner Leser schrieb mir, er habe das Buch, ein Weihnachtsgeschenk, beinahe wieder weggelegt, da er sich durchaus nicht darüber habe klar werden können, zu welcher Kategorie der Angeredeten er sich selbst rechnen solle.
Dann die Sache mit dem Titel des vierten Kapitels, »Drei Raubtiere im Aquarium«: Wer genau nachzählt, wird finden, daß es nur zwei sind, die Gelbrand- und die Libellenlarve. Den dritten Räuber, den Hecht, hat der Lektor gestrichen, weil er zu lang war (der Hecht, nicht der Lektor). Die Kapitelüberschrift hat er aber unverändert stehen lassen, so war denn ein Raubtier zu wenig. Ich habe schreckliche Folgen befürchtet. Zum Glück aber hat nur ein einziger Leser den kleinen Fehler bemerkt: ein wegen seiner Gründlichkeit weithin bekannter Gelehrter.
Auch ist da die schreckliche Geschichte mit den Goldhamstern, die man frei im Zimmer laufen lassen kann, weil sie – laut Buch – nicht nagen und nicht klettern. Mir schwante schon Schlimmes, als ich unmittelbar nach der Drucklegung unseres Büchleins ein Goldhamsternest auf einem hohen Maria-Theresien-Kasten und in einem Briefordner gefunden hatte. Ein dicker alter Hamstermann hatte das Papier als vorzügliches Nistmaterial erkannt, eine wundervolle Stemmkamin-Technik ausgebildet, mit der er zwischen Kasten und Wand emporklettern konnte, hatte schließlich in das Briefbündel einen zentralen, kugelförmigen Hohlraum genagt und mit der so gewonnenen Papierwolle das Nest wohnlich eingerichtet. Von den in jenem Ordner mittezu liegenden Briefen war nur noch eine Art Rahmen vorhanden; nach außen zu wurden die runden Löcher kleiner – in einer Kurve, die sich nicht nur der darstellende Geometriker leicht rekonstruieren kann –, und nur die ersten und die letzten Briefe waren unversehrt. Zuschriften aus dem Kreise meiner lieben Leser, die, nach einigen mich ehrenden Äußerungen, den allgemeinen Wert des Buches betreffend, auf das Kapitel Goldhamster überleiten, lege ich grundsätzlich sofort weg: ich weiß, was nun kommt! Ich selbst habe die Goldhamster wieder in ihre Käfige verbannt, nicht wegen des Briefordners – etwas anderes haben sie bisher wirklich nicht gefressen –, sondern weil sie die Wüstenspringmaus gefährden würden, die seit einiger Zeit frei in meinem Zimmer haust. Leider hat beim letzten »Gründlichmachen« meine Frau im Nest besagten Nagetieres als schwer inkriminierende Corpora delicti rote und blaue Wolle vom Teppich gefunden (von dem großen Perserteppich mit den ursprünglich dunkelgrünen, inzwischen hell gelblichgrün gewordenen Tupfen: vgl. Seite 32). So wird entweder der Teppich oder die Maus aus meinem Zimmer müssen, ich bin mir noch nicht ganz klar, wer von beiden.
Schließlich habe ich mich gerade in den letzten Tagen über Aquarien so geärgert, daß mir der Titel des zweiten Kapitels ›Etwas, das keinen Schaden macht: das Aquarium‹ geradezu aufreizend vorkommt. Neulich ist nämlich an einem Hundertliterbecken heimlich und nächtlicherweile eine Scheibe gesprungen, so daß das Zimmer überschwemmt wurde, und vorgestern um fünf Uhr früh haben meine drei Durchlüftungspumpen gleichzeitig ihre Tätigkeit eingestellt. Bis wenigstens eine wieder hergestellt war, habe ich sieben Stunden mit den Pumpen und um die Wette mit dem Ersticken einer zahlreichen Brut halbwüchsiger Cichliden (Etroplus maculatus) gekämpft. Es stehen zwar genug ausdrückliche Warnungen in meinem Buch, daß man nicht zu viele Fische in ein Becken pferchen soll, keinesfalls aber mehr als dem biologischen Gleichgewicht des Aquariums entspricht. In jenem Behälter waren leider halt rund dreihundert kleine Etroplusserln von zwei bis drei Zentimeter Länge, während höchstens ihrer dreißig hinein gehören. So bot die Arbeit des Pumpenreparierens einige Parallelen zu der eines Chirurgen, der mit einem stark blutenden, aber unauffindbaren Gefäß kämpft. Aber morgen, ich schwöre es, werden die überzähligen zweihundertsiebzig Fischkinder in verschiedene Wiener Zierfischhandlungen abgeschoben.
Nach all diesen Erfahrungen bin ich über die Kapitelüberschriften so erbost, daß ich mir zwei Buchfinken angeschafft habe, weil das neunte Kapitel heißt ›Schaff dir keinen Buchfinken an‹. Es sind zwei süße kleine Kinder, die meine Mitarbeiterin, Dr. Ilse Prechtl-Gilles, aufgezogen hat, um experimentell über die Bettel-Reaktionen junger Singvögel zu arbeiten. Vorläufig sind die Vögelchen reizend zahm und sehr nett. Dies zum Trost für diejenigen Vogel-Liebhaber unter meinen Lesern, die mir vorwurfsvolle Briefe zur Verteidigung des Buchfinken geschrieben haben!
Trotzdem ist natürlich eigentlich doch alles wahr, was in dem Buch steht – relativ genommen. Also lassen wir es genau so stehen, wie es in der ersten Auflage zu lesen ist[1] – justament! Freilich heute könnte man manche dieser Sätze nicht mehr schreiben – die Hecken sind gerodet, die Felder vergiftet, unser Vogelbestand ist gefährdet. Darum sollte heute zum Beispiel niemand mehr einen Jungvogel aus dem Nest nehmen.
Vorwort
Was ich im Zorn vollbracht,
wuchs voll Pracht
über Nacht – und ward verregnet.
Was ich aus Lieb’ gesät,
keimte stet,
reifte spät – und ist gesegnet!
Peter Rosegger
Um Tiergeschichten schreiben zu können, muß man von einem warmen und echten Gefühl für die lebende Kreatur ergriffen sein. Man darf mir zugestehen, daß ich das bin; aber: Die schönen Verse Peter Roseggers sind mir nicht deshalb eingefallen, weil dieses Buch fürs erste meiner Liebe zum lebenden Tier entsprungen ist, sondern meinem Zorn über Bücher, die vom Tiere handeln. Denn ich muß gestehen: Wenn ich je in meinem Leben irgend etwas im Zorn vollbracht habe, dann war es die Niederschrift dieser Tiergeschichten.
Zorn worüber? Über die vielen, unglaublich schlechten, verlogenen Tiergeschichten, die heute in allen Buchhandlungen angeboten werden; Zorn über die vielen Schreiberlinge, die vorgeben, vom Tier zu erzählen, es aber gar nicht kennen. Wer eine Biene den Rachen aufreißen und schreien, wer Hechte im Kampf einander an der Gurgel packen läßt – der beweist, daß er nicht einmal eine blasse Vorstellung vom Aussehen jenes Tieres hat, das er aus eigener Anschauung und Liebe zu beschreiben vorgibt. Wenn einige Auskünfte der zuständigen Züchterverbände genügten, um ein Tierbuch abzufassen, wären Leute wie etwa der ältere Heck, Bengt Berg, Paul Eipper, Ernest Seton Thompson oder Wäscha Kwonnesin Narren, da sie ein ganzes Leben an die Erforschung der Tiere gewandt haben. Es ist nicht abzusehen, wieviel Irrtum von solch verantwortungslos geschriebenen Tiergeschichten unter die Leser, vor allem unter die lebhaft teilnehmende Jugend, getragen wurde.
Man wende nicht ein, Fälschungen seien legitime Freiheiten der künstlerischen Darstellung. Gewiß, Dichtern ist es erlaubt, wie jeden anderen Gegenstand, so auch das Tier nach den Notwendigkeiten dichterischer Verfahrensweise zu »stilisieren«: Rudyard Kiplings Wölfe und Panther, sein unvergleichlicher Mungo Rikkitikkitavi sprechen wie Menschen, Waldemar Bonsels Biene Maja vermag sogar förmlich und höflich zu sein wie sie.
Solche Stilisierungen sind nur dem erlaubt, der das Tier wirklich kennt. Auch der bildende Künstler ist nicht dazu verhalten, das Objekt seiner Darstellung mit wissenschaftlicher Genauigkeit wiederzugeben. Aber dreimal wehe ihm, wenn er dies nicht kann und die Stilisierung nur zum Deckmantel dieses Unvermögens benutzt.
Ich bin Naturwissenschaftler, nicht Künstler. Ich werde mir daher durchaus keine Freiheiten und »Stilisierungen« gestatten. Übrigens glaube ich, daß es dieser Freiheiten gar nicht bedarf, daß es vielmehr genügt, sich wie bei streng wissenschaftlichen Arbeiten so auch hier bloß an die Tatsachen zu halten, will man dem Leser aufschließen, wie schön das Tier ist. Denn die Wahrheiten der organischen Natur sind von liebenswürdiger und ehrfurchtgebietender Schönheit, und sie werden immer schöner, je tiefer man in ihre Einzelheiten und Besonderheiten eindringt. Es ist unsinnig zu meinen, die Sachlichkeit der Forschung, das Wissen, die Kenntnis der natürlichen Zusammenhänge schmälerten die Freude am Wunderbaren der Natur. Im Gegenteil: Der Mensch wird um so tiefer und nachhaltiger von der lebendigen Wirklichkeit der Natur bewegt werden, je mehr er über sie weiß. Es gibt keinen guten und erfolgreichen Biologen, der nicht aus inniger Freude an den Schönheiten der lebendigen Kreatur zu seinem Lebensberufe gelangt wäre und dem das Wissen, das ihm aus diesem Berufe zuwuchs, nicht auch wieder die Freude an Natur und Arbeit vertieft hätte. Und mehr noch als für alle anderen Zweige der Lebenskunde gilt dies für das Forschungsgebiet, dem ich selbst meine Lebensarbeit gewidmet habe, nämlich die Erforschung des Verhaltens der Tiere. Diese verlangt eine so unmittelbare Vertrautheit mit dem lebenden Tier, aber auch eine so unmenschliche Geduld des Beobachters, daß das theoretische Interesse am Tier allein nicht hinreichte, die Ausdauer zu unterhalten, wäre die Liebe nicht, die gerade im Verhalten von Mensch und Tier das Verwandte, das sie fühlte, nun auch zu sehen vermag.
So darf ich hoffen, daß mir dieses Buch zuletzt doch nicht verregnet wird; wenn ich es auch eingestandenermaßen im Zorne vollbracht habe, so entstammte doch dieser Zorn selbst jener Liebe!
Altenberg, im Sommer 1949
Konrad Lorenz
Ärger mit Tieren
Warum ich zuerst von den Schattenseiten des Zusammenlebens mit Tieren erzähle? Weil das Maß der Bereitschaft, diese Schattenseiten zu ertragen, Opfer zu bringen, auch ein Maß der Tierliebe ist. Unsterbliche Dankbarkeit meinen geduldigen Eltern, die nur den Kopf schüttelten oder nachgiebig seufzten, wenn ich als Schüler oder junger Student schon wieder einen neuen und voraussichtlich schadenstiftenden künftigen Hausgenossen heimbrachte. Und was hat meine Frau im Laufe der Jahre er- und geduldet! Denn wer dürfte wohl seiner Gattin zumuten, daß eine zahme Ratte in der Wohnung frei herumläuft, aus den Bettüchern nette kleine Scheibchen nagt, um damit ihr Nest zu tapezieren? Oder, daß ein Kakadu von der Wäsche, die zum Trocknen im Garten hängt, sämtliche Knöpfe abbeißt? Oder, daß eine zahme Wildgans im Schlafzimmer nächtigt, welches sie morgens durch das Fenster fliegend verläßt? (Wildgänse sind nicht zimmerrein!) Oder: Was würde eine andere Frau sagen, wenn sich herausstellt, daß die hübschen blauen Tupfen, mit denen Singvögel nach dem Genuß von Holunderbeeren sämtliche Möbel und Vorhänge verziert haben, absolut nicht »herausgehen«? Was würde sie sagen, wenn … und so weiter über zwanzig Seiten!
Man wird mich fragen: Ist denn das alles unbedingt notwendig? Und meine Antwort wird ein lautes und deutliches Ja sein. Gewiß kann man Tiere auch in durchaus salonfähigen Käfigen halten, kennenlernen jedoch kann man höhere und geistig regsamere Tiere nur dann, wenn sie sich frei bewegen dürfen. Wie arm, ja innerlich verstümmelt, ist so ein käfiggewohnter Halbaffe, Affe oder größerer Papagei, und wie unglaublich regsam, unterhaltend und interessant ist dasselbe Tier in völliger Freiheit! Auf Schaden und Ärger muß man sich allerdings dann auch gefaßt machen. Höhere Tiere in unbeschränkter Freiheit zu halten war schon aus rein methodisch-wissenschaftlichen Gründen seit jeher meine Spezialität, wie denn auch ein sehr erheblicher Teil meiner Forschungen an freilebenden, zahmen Tieren durchgeführt wurde. Das Käfiggitter hat in Altenberg eine umgekehrte Rolle gespielt als sonst: Es hatte zu verhindern, daß die Tiere ins Haus oder in den Vorgarten kamen. Auch war es ihnen strengstens »verboten«, sich innerhalb des Drahtgitters aufzuhalten, das die schönen Blumenbeete umgab. Aber wie für kleine Kinder hat auch für solche klugen Tiere alles Verbotene eine magische Anziehungskraft. Außerdem verlangten die reizend anhänglichen Wildgänse menschliche Gesellschaft. So kam es denn immer wieder vor, daß, ehe man sich’s versah, zwanzig oder dreißig Wildgänse auf den Blumenbeeten weideten oder, noch schlimmer, mit lautem Begrüßungsgeschnatter in die Veranda einfielen. Nun ist es ungemein schwer, einen Vogel, der fliegen kann, aber den Menschen nicht fürchtet, von einem bestimmten Orte fernzuhalten. Da helfen das wildeste Geschrei, die heftigsten Bewegungen der Arme nicht. Als einziges noch wirksames Schreckmittel jedoch blieb ein riesiger, knallroter Garten-Sonnenschirm. Gleich einem Ritter mit eingelegter Lanze sprengte meine Frau, den gefalteten Sonnenschirm unterm Arm, auf die Wildgänse zu, wenn sie wieder einmal die eben gesetzten Blumen abzuweiden begannen, stieß einen kriegerischen Schrei aus und öffnete mit einem Ruck den Schirm. Das war selbst unseren Gänsen zuviel, und sie erhoben sich rauschend in die Lüfte. Leider machte mein Vater alle gänseerzieherischen Maßnahmen meiner Gattin weitgehend zunichte. Der alte Herr liebte die Graugänse sehr, besonders wegen des ritterlich-mutigen Verhaltens der Gänseriche; so ließ er es sich nicht nehmen, die Gänse täglich zur Jause in die Veranda einzuladen. Da er zu jener Zeit schon ziemlich schlecht sah, merkte er von den materiellen Folgen eines solchen Gänsebesuches nur dann etwas, wenn er unmittelbar hineintrat. Als ich eines Tages zur Vesperzeit in den Garten ging, fand ich zu meinem Erstaunen fast gar keine Gänse. Schlimmes ahnend, lief ich nach dem Arbeitszimmer meines Vaters, und siehe da: Auf dem wundervollen Perserteppich standen vierundzwanzig Gänse um meinen alten Herrn versammelt, der an seinem Schreibtisch Tee trank, ruhig in der Zeitung las und ein Stück Brot nach dem andern den Gänsen hinhielt. Diese waren in dem ihnen fremden Raum etwas nervös, was sich unangenehmerweise merkbar auf ihre Darmtätigkeit auswirkte. Denn wie auch andere Tiere, die viel Pflanzenfasern verdauen müssen, haben die Gänse einen sehr ausgebildeten Blinddarm, in welchem die Zellulose von Zellstoff spaltenden Bakterien für den Körper verwendbar gemacht wird. In der Regel kommt auf etwa sechs bis acht normale Ausleerungen des Darms eine des Blinddarminhalts, der einen eigenartig strengen Geruch und eine dunkelgrüne, sehr kräftige Farbe hat. Ist nun eine Wildgans ängstlich und nervös, folgt ein Blinddarmklacks auf den anderen. Seit diesem Gänsebesuch sind mehr als elf Jahre vergangen; die dunkelgrünen Tupfen auf dem Teppich sind inzwischen hell gelblichgrün geworden.
So lebten denn die Tiere zwar in völliger Freiheit, aber doch unserem Hause vertraut. Sie haben immer nur zu uns, nie von uns gewollt. Ruft man anderswo: »Der Vogel ist aus seinem Käfig entkommen, macht rasch die Fenster zu«, heißt es bei uns: »Um Gottes willen, schließt die Fenster, der Kakadu (Rabe, Mongozmaki, Kapuzineraffe) will herein!« Die schönste Anwendung der »verkehrten Gitterwirkung« hat meine Gattin gefunden, als unser ältestes Kind noch sehr klein war. Wir hielten damals gerade einige große und wehrhafte Tiere, Kolkraben, zwei große Gelbhaubenkakadus, zwei Mongozmakis und einen Kapuzineraffen, die man, besonders die Raben, nicht gut mit dem Kinde allein lassen konnte. So baute denn meine Frau kurzerhand im Garten einen großen Käfig und stellte – die Gehschule hinein!
Die Fähigkeit und Neigung, Schaden zu stiften, steht bei höheren Tieren leider in geradem Verhältnis zu ihrer geistigen Höhe. Daher kann man vor allem die Affen nicht dauernd unbeaufsichtigt frei laufen lassen. Bei Halbaffen jedoch, vor allem bei dem reizenden Mongozmaki, der uns so viele Jahre ein lieber und erheiternder Hausgenosse war, ist dies möglich, da sie noch kein sachlich forschendes Interesse an häuslichen Einrichtungsgegenständen haben. Echte Affen hingegen, und zwar schon die stammesgeschichtlich tieferstehenden Neuweltaffen (Platyrrhinae), interessieren sich brennend für jeden ihnen neuen Gegenstand und »experimentieren« mit ihm. So interessant das nun vom tierpsychologischen Standpunkt sein mag, für den Haushalt ist dies auf die Dauer finanziell nicht tragbar. Hierfür nur ein Beispiel.
Als junger Student hatte ich in der Wiener Stadtwohnung meiner Eltern einen prächtigen, großen gehaubten Kapuziner (Cebus Fatuellus), ein Weibchen namens Gloria. Sie bewohnte einen sehr geräumigen Käfig in meinem Schlaf- und Studierzimmer. War ich zu Hause und konnte sie beaufsichtigen, durfte sie im Zimmer frei herumlaufen; mußte ich fortgehen, sperrte ich sie in den Käfig, in dem sie sich ungemein langweilte und alles daransetzte, möglichst schnell frei zu kommen. Als ich eines Abends nach längerer Abwesenheit heimkehrte und den Knopf am Lichtschalter drehte, blieb alles dunkel wie zuvor; doch Glorias kichernder Gesang, der nicht aus dem Käfig, sondern von der Vorhangstange herab ertönte, ließ keinen Zweifel über Ursache und Urheberschaft der Stromstörung zu. Als ich mit einer brennenden Kerze wiederkam, bot sich meinen staunenden Augen folgender Tatbestand: Gloria hatte die schwere bronzene Nachttischlampe von ihrem Standort herab und quer durch das Zimmer geschafft (dabei den Stecker unglücklicherweise nicht aus der Wand gezogen), auf das oberste Aquarium, ein Seewasserbecken, hinaufgewuchtet und wie mit einem Rammbock die dicke Deckscheibe eingeschlagen, so daß die Lampe in der Flut versank. Daher also der Kurzschluß! Hierauf, oder auch schon vorher, hatte Gloria das überaus schwer zu öffnende Schloß meines Bücherschrankes aufgesperrt, bei der Kleinheit des Schlüssels eine erstaunliche Leistung, hatte von Strümpeis ›Lehrbuch der inneren Medizin‹ Band 2 und 4 herausgenommen, auf den Aquarienständer getragen, dort in winzige Fetzen zerrissen und diese restlos in das Becken gefüllt. Am Boden lagen nur die leeren Einbände, jedoch keine Papierschnitzel. Im Becken saßen traurige Seeanemonen, die Tentakel voller Papier …
Das Interessante an diesem Vorfall war die strenge Sachbezogenheit dieses »Experimentierspieles«: Der Affe muß sich also erhebliche Zeit mit der einen Aufgabe beschäftigt haben; schon rein körperlich war die geleistete Arbeit für ein so kleines Tier anerkennenswert. Nur etwas teuer!
Was steht diesem nicht enden wollenden und auch sehr kostspieligen Ärger mit freilebenden tierischen Hausgenossen an Positivem gegenüber?
Nicht zu reden von den methodischen Gründen, die es für gewisse tierpsychologische Untersuchungen notwendig machen, ein seelisch gesundes, von den schädlichen Einwirkungen der Gefangenschaft unbeeinflußtes Versuchstier zu haben, gewährt das freilebende Tier, das fort könnte und doch dableibt, und zwar aus Anhänglichkeit zu mir dableibt, einen unnennbaren Reiz. Wenn ich auf einem Spaziergang in den Donauauen den sonoren Ruf des Raben höre und auf meinen antwortenden Ruf der große Vogel hoch droben am Himmel die Flügel einzieht, in sausendem Falle herniederstürzt, mit kurzem Aufbrausen abbremst und in schwereloser Zartheit auf meiner Schulter landet, so wiegt dies sämtliche zerrissenen Bücher und sämtliche leergefressenen Enteneier auf, die der Rabe auf dem Gewissen hat. Der Zauber des Erlebnisses schwindet auch