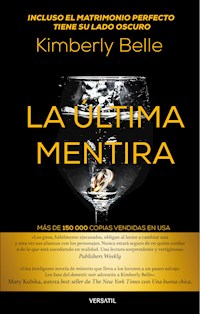8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
„Einer der besten Thriller der Saison.“ New York Post.
Ein Kind wird vermisst. Der Albtraum einer Mutter: Am frühen Morgen steht die Polizei bei Kat vor der Tür. Ihr achtjähriger Sohn Ethan, den sie am Tag zuvor ins Feriencamp gebracht hat, ist verschwunden. Kat macht sich sofort ins Ferienlager auf. Mitten in der Nacht, als ein Brand ausbrach, ist ihr Sohn offenbar entführt worden. Doch aus welchem Grund? Sofort verdächtigt Kat ihren Exmann – aber dann ergibt sich eine andere Spur. Könnte eine Verwechselung vorliegen? Kat weiß nur eines: Ihr Sohn schwebt in höchster Gefahr ...
„Ein packender Roman – Kimberly Belle schafft es brillant, Spannung zu erzeugen. Die Leser werden es mögen, zwei sehr unterschiedliche starke Frauen kennenzulernen.“ Publishers Weekly.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 417
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über Kimberly Belle
Kimberly Belle hat im Marketing gearbeitet, bevor sie freie Autorin wurde. Sie lebte lange Zeit in den Niederlanden und pendelt nun zwischen Atlanta und Amsterdam.
Kathrin Bielfeldt ist Texterin und Übersetzerin und spricht fünf Sprachen. Sie hat unter anderem Romane von Elisabeth Elo, Pete Dexter und James Sallis ins Deutsche übertragen.
Informationen zum Buch
»Einer der besten Thriller der Saison.« New York Post.
Ein Kind wird vermisst. Der Albtraum einer Mutter: Am frühen Morgen steht die Polizei bei Kat vor der Tür. Ihr achtjähriger Sohn Ethan, den sie am Tag zuvor ins Feriencamp gebracht hat, ist verschwunden. Kat macht sich sofort ins Ferienlager auf. Mitten in der Nacht, als ein Brand ausbrach, ist ihr Sohn offenbar entführt worden. Doch aus welchem Grund? Sofort verdächtigt Kat ihren Exmann – aber dann ergibt sich eine andere Spur. Könnte eine Verwechselung vorliegen? Kat weiß nur eines: Ihr Sohn schwebt in höchster Gefahr.
»Ein packender Roman – Kimberly Belle schafft es brillant, Spannung zu erzeugen. Die Leser werden es mögen, zwei sehr unterschiedliche starke Frauen kennenzulernen.« Publishers Weekly
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Kimberly Belle
Solange du noch lebst
Thriller
Aus dem Amerikanischen von Kathrin Bielfeldt
Inhaltsübersicht
Über Kimberly Belle
Informationen zum Buch
Newsletter
Kat
Kat +++ 3 Stunden und 13 Minuten vermisst +++
Kat +++ 3 Stunden und 23 Minuten vermisst +++
Stef +++ 3 Stunden und 33 Minuten vermisst +++
Kat +++ 4 Stunden und 56 Minuten vermisst +++
Kat +++ 5 Stunden und 7 Minuten vermisst +++
Stef +++ 5 Stunden und 13 Minuten vermisst +++
Kat +++ 5 Stunden 24 Minuten vermisst +++
Kat +++ 5 Stunden und 57 Minuten vermisst +++
Stef +++ 6 Stunden und 58 Minuten vermisst +++
Kat +++ 7 Stunden und 7 Minuten vermisst +++
Kat +++ 7 Stunden und 28 Minuten vermisst +++
Stef +++ 7 Stunden und 32 Minuten vermisst +++
Kat +++ 8 Stunden und 34 Minuten vermisst +++
Stef +++ 8 Stunden und 54 Minuten vermisst +++
Kat +++ 9 Stunden und 6 Minuten vermisst +++
Stef +++ 9 Stunden und 28 Minuten vermisst +++
Stef +++ 11 Stunden und 28 Minuten vermisst +++
Kat +++ 13 Stunden und 56 Minuten vermisst +++
Stef +++ 28 Stunden und 37 Minuten vermisst. +++
Kat +++ 32 Stunden und 4 Minuten vermisst +++
Stef +++ 35 Stunden und 30 Minuten vermisst +++
Kat +++ 41 Stunden vermisst +++
Stef +++ 54 Stunden und 53 Minuten vermisst +++
Kat +++ 55 Stunden und 23 Minuten vermisst +++
Stef +++ 55 Stunden und 34 Minuten vermisst +++
Kat +++ 55 Stunden und 42 Minuten vermisst +++
Stef +++ 55 Stunden und 51 Minuten vermisst +++
Kat +++ 55 Stunden und 53 Minuten vermisst +++
Stef +++ 56 Stunden und 31 Minuten vermisst +++
Kat +++ 56 Stunden und 58 Minuten vermisst +++
Stef +++ 56 Stunden und 59 Minuten vermisst +++
Kat +++ 57 Stunden und eine Minute vermisst +++
Stef +++ 57 Stunden und 19 Minuten vermisst +++
Kat +++ 57 Stunden und 44 Minuten vermisst +++
Stef +++ 57 Stunden und 59 Minuten vermisst +++
Kat +++ 58 Stunden und 27 Minuten vermisst +++
Stef +++ 58 Stunden und 29 Minuten vermisst +++
Kat +++ 58 Stunden und 37 Minuten vermisst +++
Stef
Kat
Ethan
Danksagungen
Impressum
Kat
Während auf meinem Handy summend die ersten geschäftlichen E-Mails eingehen, scheuche ich Ethan durch sein morgendliches Programm. Los, aufstehen! Zieh dich an! Meine Güte, nun putz dir schon die Zähne und kämm dich! All seine acht kleinen Lebensjahre lang ist mein Sohn bereits ein Morgenmuffel, und ich war als Mutter noch nie sonderlich geduldig, noch nicht einmal zu der Zeit, in der ich noch keine Chefin hatte, die auf die Sekunde kontrolliert, wann ich aus dem Fahrstuhl trete.
Natürlich haben auch nicht berufstätige Mütter jede Menge Stress, Ethan und mich einte damals aber zumindest, dass wir beide auf Zehenspitzen um das Porzellan herumschlichen, das Andrew überall zerschlagen zurückließ. Doch über die letzten sechs Monate, seit meiner Trennung, sind wir in diesen Modus verfallen. Ethan trödelt, ich meckere.
»Komm, Kleiner, wir müssen los.«
Sein Haar ist immer noch dort verwuschelt, wo er mit dem Kopf auf dem Kissen gelegen hat. Das T-Shirt ist verknittert und hat Flecken, also hat er es wahrscheinlich aus dem Haufen schmutziger Wäsche gezogen. Mein Sohn ist ein dickfelliger Chaot. Er ist unorganisiert und sieht mehr als nur ein bisschen merkwürdig aus. Seine Ohren sind zu groß, seine Locken zu widerspenstig, und seine Brille, die ständig von Fingerabdrücken übersät ist, scheint nie gerade auf seiner Nase zu sitzen.
Doch ich liebe ihn aus tiefstem Herzen – nicht trotz all seiner kleinen Schrullen, sondern gerade deswegen. Denn wenn es eine Sache gibt, die ich von Andrew gelernt habe, dann die, dass man nicht nur eine Seite eines Menschen lieben kann. Man muss alle Seiten lieben.
Ich scheuche ihn die Stufen hinunter. Unser kleines Haus ist keine große Sache, doch Scheidungen sind kostspielig, und jedes Mal wenn mein Anwalt meint, wir stünden kurz vor einer Einigung, kommt Andrew mit einer weiteren, blödsinnigen Forderung. Der antike Beistelltisch, den wir auf unserer Hochzeitsreise gekauft haben. Ein Paar Kerzenleuchter aus Kristall, die ihm vor ewigen Zeiten kaputt gegangen sind. Die Negative von Ethans Babyfotos. Solange er nicht Ethan will, gebe ich jeder seiner verdammten Forderungen nach.
Vor dem Wagen bleibt Ethan total verschlafen stehen. »Worauf wartest du? Steig ein.«
Er rührt sich nicht. Ich werfe einen Blick auf mein Handy – kurz vor halb sieben.
»Ethan.« Als er nicht reagiert, rüttele ich ihn leicht an der Schulter. »Komm, Liebling. Steig in den Wagen, sonst verpassen wir den Bus.«
Der Bus wird in genau dreiunddreißig Minuten von einem Parkplatz am anderen Ende der Stadt abfahren. Das Ziel: Dahlonega, eine alte Goldgräberstadt, eine Stunde nördlich von Atlanta. Ethans Klasse wird durch Minen stapfen, die sechzig Meter unter der Erde liegen, nach Gold und Halbedelsteinen suchen und in einer Hütte unter den Sternen schlafen. Als er mir vor einem Monat die Einverständniserklärung mit nach Hause brachte, hielt ich es zunächst für einen Aprilscherz. Welcher Lehrer fährt freiwillig mit einer Busladung Zweitklässler auf einen Ausflug mit Übernachtung?
»Aber das machen wir jedes Jahr«, versicherte mir Miss Emma, als ich sie danach fragte. »Wir übernachten in den Räumlichkeiten des YMCA-Sommer-Camps, da kann uns nichts passieren. Auf fünf Schüler kommt eine Lehrerin oder Begleitperson. Die Schüler freuen sich schon das ganze Halbjahr darauf.«
Diese Ansprache hatte sie schon jeder Helikopter-Mutter der Zweitklässler gehalten, doch bei mir lag sie daneben. Ich machte mir keine Sorgen um Ethans physische Sicherheit, sondern um die emotionale. Ethan hat einen IQ von 158, und dieses Begabungsniveau zieht einige sehr spezielle Herausforderungen nach sich. Er ist ein brillanter Junge, in sozialer Hinsicht jedoch sehr unbeholfen. Ein analytischer Denker, der ständig nach Stimulation verlangt. Ein unersättlicher Lerner mit einem unendlichen Strom an Fragen. Seine Welt ist so anders als die seiner Gleichaltrigen, was Ausdrucksweise, Interessen und die Art zu denken angeht, dass es quasi keine Berührungspunkte gibt. Inzwischen geht er seit zwei Jahren auf die Cambridge, hat jedoch noch nie einen Freund mit nach Hause gebracht. Keine Verabredungen, keine Übernachtungen. Nichts.
Doch seine Klasse beschäftigt sich seit dem Frühjahr mit den Minen, und Miss Emma hat sein Gehirn, das einem Fass ohne Boden gleicht, mit Geschichten über hydraulische Schleusen und einem Netzwerk an unterirdischen Tunneln gefüllt. Es sind Berggold-Lagerstätten, klärt mich mein Sohn auf, und bis heute Morgen wollte er sich die unbedingt persönlich ansehen, obwohl er bisher noch nie allein unter einem anderen Dach geschlafen hat als Andrew und ich. Er bettelte so lange, bis ich nachgab. Ich warf meine Sorgen über Bord und unterschrieb das Formular.
Ethan klettert auf den Rücksitz, und ich werfe ihm einen erdnussfreien Müsliriegel zu, den er ignoriert.
»Was ist los, Kleiner? Ist dir übel?«
»Nein.« Er blickt auf den Riegel und verzieht das Gesicht. »Hab einfach keinen Hunger.«
»Na, iss ihn trotzdem. Du brauchst doch Energie für all diese Stufen, runter in die Minen und wieder raus.« Den zweiten Satz sage ich ganz bewusst, um wieder etwas von der ursprünglichen Begeisterung zu wecken.
Doch mein Sohn hat mich durchschaut und sieht mich auf seine typische Art an. Gesenktes Kinn. Gerunzelte Stirn. Mit leicht verdrehten Augen. Dann seufzt er tief.
»Du hast doch morgens immer solchen Kohldampf. Warum heute nicht?«
»Ich weiß nicht.« Seine Brille rutscht ihm herunter, und er zieht die Nase kraus, um sie wieder hochzuschieben. Sie sitzt zu locker, und das künstliche Schildpatt ist zu schwer für seinen Kopf. Ethan ist acht Jahre alt, doch er ist so klein, dass er überall als sechs durchgeht. Ein weiterer Nachteil, mit dem er klarkommen muss. »Hab einfach keinen.«
Du musst aufhören, ihn so zu verhätscheln. Ich höre Andrews Stimme so deutlich, als würde er neben mir sitzen. Sonst härtet er nie dagegen ab.
Du musst. Er nie. Das ist eine von Andrews hervorstechenderen Fähigkeiten: Er ist ein Experte darin, anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Und das macht er schon seit Jahren.
Doch Andrew ist nicht hier, und ich muss zur Arbeit. Ich kann mir meine Hälfte des Schulgeldes für die Cambridge Classical Academy nicht leisten, wenn sich diese Scheidung immer weiter hinzieht und mir der Stapel Rechnungen neben dem Toaster genauso viel Angst einjagt wie Ethan die Monster unter seinem Bett. Meine Chefin hat keine Kinder. Sie versteht nicht, dass Ethans kleines Einsteingehirn länger braucht als andere, um die Pros und Contras abzuwägen. Ich brauche diesen Job, und deshalb muss ich Ethan jetzt in diesen Bus setzen. Ich lasse den Wagen an und fahre rückwärts aus der Einfahrt.
Den ganzen Weg zur Schule betrachte ich im Rückspiegel Ethans Miene und wünsche mir nicht zum ersten Mal, dass die Trennung zwischen seinem Vater und mir weniger explosiv gewesen wäre; dass unsere Kommunikation nicht schriftlich ablaufen müsste, mit einem Bannkreis von fünfzig Metern. Das Kontaktverbot macht eine gemeinsame Erziehung nicht gerade leichter.
Ich drehe das Gerede in der morgendlichen Radiosendung ab. »Liebling, bitte sag’s mir. Was ist los? Was stimmt nicht?«
Sein Blick schweift kurz zu meinem herüber und gleitet dann wieder fort. Er zuckt die Achseln, obwohl er die Antwort kennt. Ethan kennt immer die Antwort.
»Machst du dir Sorgen wegen der anderen Kinder?«
Er runzelt die Stirn, und ich weiß, dass ich einen Nerv getroffen habe.
»Ärgert dich wieder jemand?«
Ich sage absichtlich nicht mobben, das Wort, das seine Lehrerin immer umgeht, genau wie den Namen des kleinen Scheißkerls – obwohl wir beide wissen, von wem die Rede ist. Miss Emma hat versucht, das, was auch immer da passiert ist, als albernen Zank abzutun, den sie angeblich unter Kontrolle hat. Doch das ist Teil des Problems. Sie tut sämtliches Mobbing als belangloses, albernes Gezanke ab, selbst wenn die Sache blutig wird.
»Wenn du mir erzählst, was passiert ist, kann ich dir helfen, das in Ordnung zu bringen. Ich werde mit Miss Emma sprechen. Miss Emma und ich sind auf deiner Seite, weißt du? Wir wollen helfen.«
»Es ist nichts, okay? Niemand ärgert mich.«
»Machst du dir Sorgen, so weit von Zuhause fort zu sein?«
Ethan schaut stirnrunzelnd in den Rückspiegel.
»Weil das nicht nötig ist. Miss Emma wird gut auf dich aufpassen.«
Keine Antwort. Er sackt in seinem Sitz zusammen, seine Handflächen umschließen seine Ellenbogen, die Fingerspitzen tippen in einem nervösen Rhythmus auf die Haut – eine Angewohnheit, wenn er nicht über etwas reden will.
Den Rest der Fahrt legen wir schweigend zurück.
Als wir endlich durch die von Bäumen gesäumte Einfahrt auf den Parkplatz der Cambridge Classical Academy zusteuern, brauche ich keinen Blick auf das Armaturenbrett zu werfen, um zu wissen, dass es deutlich nach sieben ist. Die Yoga-gestrafften Mütter stehen auf dem Rasen herum, kreischende Kinder schwirren in Kreisen um ihre Beine, Miss Emma läuft auf und ab, das Handy ans Ohr gedrückt. Ihre verkniffenen Gesichter sagen alles.
Zu spät.
Ich halte in der ersten Parkbucht, die ich sehe, bremse mit quietschenden Reifen und steige aus.
»Tut mir leid!«, rufe ich über das Dach meines Wagens hinweg. »Wir sind da. Tut mir leid.«
Ethan klettert von der Rückbank und hält kurz inne, um die Kinder zu beobachten, die über den Rasen rennen. Seine Gedanken stehen ihm deutlich ins Gesicht geschrieben, seine Sehnsucht ist so offensichtlich, dass man sie fast greifen kann. Mein wundervoller, kluger kleiner Sohn wünscht sich nichts sehnlicher, als dazuzugehören, und ich habe keine Ahnung, wie ich ihm dabei helfen kann.
Mit einem Seufzer greift er hinter sich in den Wagen und schultert seinen Rucksack. Ich tippe ihn an. »Hey, ich habe eine Überraschung für dich.«
In seinem Blick liegen Zweifel. Ethan weiß, dass es finanziell bei uns gerade sehr eng ist und Überraschungen für besondere Gelegenheiten reserviert sind. »Was für eine Überraschung?«
Ich öffne den Kofferraum. Er legt den Kopf zur Seite und späht um den Rand der Klappe. Als sein Blick zu mir zurückkehrt, hat er große Augen. »Du hast mir den Mumienschlafsack gekauft?«
Ich lächle. »Ich habe dir den Mumienschlafsack gekauft.« Den, den er sich sehnsüchtig gewünscht hatte, als er ihn bei Walmart entdeckt hatte. Nicht, weil er eine Kapuze und ein integriertes Kissen hat, sondern wegen der versteckten Tasche für den zerlumpten Rest seiner Babydecke, ohne die er nicht schlafen kann, die aber keiner seiner Klassenkameraden sehen soll. »Das Du-weißt-schon-was ist drin, in der Reißverschlusstasche.«
Das Lächeln, das auf seinem Gesicht erstrahlt, ist jeden hart verdienten Penny wert.
»Gefällt er dir?«
Er greift hinein und drückt die Rolle mit beiden Händen fest an sich. Sie ist so groß, dass er damit aussieht wie ein Zwerg, der gleich hintenüberkippt. »Der ist super!«
»Prima. Dann brauchst du ja das andere Ding gar nicht, was ich dir mitgebracht habe.«
Seine Augen verengen sich zu Schlitzen. »Was für ein anderes Ding?«
Ich greife in den Wagen, in meine Tasche auf der Mittelkonsole, und ziehe eine abgenutzte Lederhülle heraus.
Ethan erkennt sie, und sein Gesicht leuchtet begeistert auf. »Der Kompass deines Uropas?«
Oder, genauer gesagt, sein Landvermessungs-Kompass. Er stammt aus der Mitte des achtzehnten Jahrhunderts, mit zwei gegenüberliegenden, ausklappbaren Messing-Visieren, mit denen mein Urgroßvater das bewaldete Land entlang der Grenze zwischen Tennessee und Kentucky vermessen hat. Er ist dank dem Netz an Kratzern und dem Riss im Glas in der Nord-Ost-Ecke wahrscheinlich nicht viel wert, doch da es das Letzte ist, was meine Mutter mir vor ihrem Tod geschenkt hat, hänge ich sehr daran.
Mein Sohn schnappt ihn sich und presst ihn mit beiden Händen an den Mumienschlafsack. »Ich werde gut drauf aufpassen, Mom. Das verspreche ich.«
»Nur, dass das klar ist: Ich schenke ihn dir nicht – noch nicht. Aber du kannst ihn dir für ein paar Tage ausleihen, wenn du meinst, dass er dir das Wegsein von Zuhause ein bisschen erleichtert.« Ich beuge mich zu ihm hinunter und sehe ihm in die Augen. »Und, ganz ehrlich: Mir geht es auch besser, wenn ich weiß, dass du ihn hast. Wenn du dich verirren solltest, kannst du ihn benutzen, um den Weg zurück zu finden.«
Er grinst mich fröhlich an. »Ich verirre mich nicht.«
»Ich weiß, aber nimm ihn trotzdem mit.«
Hinter uns startet der Motor des Busses mit einem lauten Donnern, ein schnittiges, schwarzes Gefährt, das besser zu einem Rockstar und seiner Entourage passen würde als zu ein paar Dutzend kreischender Achtjähriger. Die meisten von ihnen sind bereits eingestiegen und geben uns hinter getönten Scheiben aufgeregt zu verstehen, dass sie schon längst losgefahren sein müssten. Miss Emma dreht sich um und schaut in unsere Richtung. Ethans und ihre Blicke treffen sich, und sie lächelt und hebt fragend beide Hände. Kommst du mit oder nicht?
Wir sammeln seine Sachen zusammen und hasten über den Rasen.
Am Rande des Parkplatzes gehe ich in die Hocke, auf Augenhöhe mit Ethan. Wir machen es kurz. Ein schneller, sachlicher Abschied, besser für ihn und auch für mich. »Sei brav. Hör auf Miss Emma und die Begleiter.« Ich rücke seine Brille zurecht und zupfe an seinem verknitterten Kragen. »Und amüsiere dich prächtig.«
Er lächelt mich mit zusammengekniffenen Lippen an. »Das schaffe ich ganz bestimmt.«
Ich denke an das erste Mal zurück, als ich ihn im Arm hielt, im Kreißsaal des Krankenhauses. Er war so winzig, so rosa, so klebrig und so zerbrechlich. Ich weiß noch, wie er zu mir aufblickte und wie sein kleiner Mund sich an meinem Arm öffnete und schloss, wie bei einem Fisch, und wie diese erste Welle der Mutterliebe mir den Atem raubte. Die Hoffnungen, Vorsätze und Ängste von damals – sie sind nichts gegen das, was ich jetzt fühle.
»Gott, ich werde dich vermissen.« Ich ziehe ihn an mich und drücke ihn einmal so fest an mich, dass er sich nicht aus meiner Umarmung herauswinden kann. Ich atme seinen vertrauten Duft ein – Shampoo, Waschmittel und dieser ganz leichte Hauch von stinkendem Welpen.
»Bist du soweit, Ethan?« Miss Emma hält ihm die Hand hin. Sie sieht mich an und lächelt. »Wir passen gut auf ihn auf, das verspreche ich.«
Ich nicke, überlasse ihn ihr und sage mir, dass er schon klarkommen wird. Man wird sich um Ethan kümmern und auf ihn aufpassen. Vielleicht findet er ja außerhalb des geregelten Schulalltags sogar einen Freund.
Bitte, lieber Gott, lass ihn einen Freund finden.
Mit einem letzten Winken schiebt Miss Emma meinen Sohn zum rumpelnden Bus. Stunden später ist es dieser eine Augenblick, zu dem ich ständig wieder zurückkehre, die Bilder immer und immer wieder vor meinem geistigen Auge abspiele.
Kat +++ 3 Stunden und 13 Minuten vermisst +++
Noch vor dem Morgengrauen werde ich durch Geräusche vor meiner Haustür wach und denke dabei als Erstes an Andrew. Nicht an den liebevollen, charmanten Andrew, der im Supermarkt seinen kleinen Finger um meinen wickelte oder der jeden Sonntag mein Auto wusch, sondern an die betrunkene, dominante Version, die im Verlauf unserer Ehe immer öfter zu Tage trat.
Ich ziehe mir das Kissen über den Kopf und warte darauf, dass sich sein Protestgebrüll durch das Holz meiner Schlafzimmertür bohrt. Kat, ich kann das in Ordnung bringen. Warum lässt du es mich nicht in Ordnung bringen?
Doch Andrews Stimme dringt nicht zu mir durch. Nur ein stetiger Regen, der auf das Dach trommelt.
Ich schiebe das Kissen beiseite und werfe einen Blick auf die Schalttafel an der gegenüberliegenden Wand, einer Alarmanlage, die ich installiert hatte, nachdem in meinem Haus Dinge angefangen hatten zu wandern. Meine gerahmten Fotos, die plötzlich schief an der Wand hingen. Ein Stapel Papiere, durcheinander und verschoben. Der gewebte Wollteppich, der unter den Füßen des Sessels hervorgezogen war. Das war Andrews Art, mich zu quälen, mich wissen zu lassen, dass er immer noch derjenige war, der am längeren Hebel saß, obwohl er keinen Hausschlüssel mehr hatte. Vor sechs Monaten hörte es auf, an dem Tag, an dem ein Richter des DeKalb Countys eine Anordnung unterzeichnete, nach der Andrew sich fünfzig Meter von unserem Haus fernhalten musste. Nur zur Sicherheit rammte ich das Schild einer Sicherheitsfirma neben der Haustür in den Boden. Dieses Haus wird von ADT gesichert, Arschloch. Versuch’s nicht mal!
Am roten Schein der Lampe sehe ich, dass die Alarmanlage scharf geschaltet ist, doch einem erneuten Pochen unten an der Tür entnehme ich, dass Andrew, wie gewohnt, fest entschlossen ist, mich aus dem Bett zu holen. Die Bannmeile ist theoretisch eine gute Sache, doch bisher hat sie sich als wirkungslos erwiesen. Aus Erfahrung weiß ich, dass Andrew längst wieder verschwunden sein wird, wenn die Polizei eintrifft. Als ich nach meinem Telefon greife, fällt mir ein, dass ich es unten in der Küche liegengelassen habe.
Von unten ertönt weiteres Klopfen, fünf feste Fausthiebe.
Normalerweise wäre dies der Moment, in dem Ethan mit zerzausten Locken in mein Zimmer gestolpert käme. Ich hatte versucht, das Theater zwischen seinem Vater und mir von ihm fernzuhalten, doch es hatte so viele Momente wie diesen gegeben, dass ich mich fragte, ob unsere ständigen Streitereien nicht doch Narben bei ihm hinterlassen hatten.
Während ich die Bettdecke zurückschlage und aufstehe, mache ich mir darüber Gedanken, dass Andrews Krawall die Nachbarn weckt. Dass es sich um etwas ganz anderes handeln könnte, kommt mir gar nicht in den Sinn.
Dann öffne ich die Schlafzimmertür.
Der Flur in der oberen Etage, der normalerweise von dem gedämpften gelben Schein der Straßenlaterne beleuchtet wird, ist in rot und blau blitzendes Licht gehüllt. Die Farben flackern über die Wände, die Decke und katapultieren mich förmlich über den Teppich. Ich stolpere über einen überquellenden Wäschekorb und Ethans Turnschuhe und kann gerade noch verhindern, dass ich die Treppe herunterstürze. Ich nehme zwei, drei Stufen auf einmal, meine Knie sind plötzlich weich vor Panik. Es ist mitten in der Nacht, mein Sohn ist viele Meilen weit entfernt, und in meiner Einfahrt steht ein Streifenwagen.
Gott, vergib mir, aber ich bete, dass es etwas mit Andrew zu tun hat.
Er hatte einen Unfall. Er wurde verhaftet.
Nur, bitte, lieber Gott, lass Ethan nichts passiert sein.
Unten am Treppenabsatz wird das längliche Fenster neben der Tür komplett von einem Mann ausgefüllt. Er ist riesig, über einsneunzig, mit breiten Schultern und dieser Art massiger Gestalt, die man vom Kickboxen und Hanteltraining bekommt. Unsere Blicke treffen sich, und mir sträuben sich die Nackenhaare.
Er drückt seine Dienstmarke gegen das Fenster. »Brent Macintosh, Atlanta Police Department. Ich suche eine Kathryn Jenkins.«
Ich stehe wie versteinert da. Wenn ich die Tür öffne, wenn ich bestätige, dass ich Kathryn Jenkins bin, dann wird er mir etwas mitteilen, das ich nicht hören möchte. Eine gefühlte Ewigkeit ist es still, und ich höre nur meinen eigenen Atem, rau und stoßweise.
Er trägt keine Uniform, aber dunkle Kleidung. Dunkles Hemd, dunkle Hose, der Stoff so nachtblau wie der Himmel hinter ihm. »Ma’am, sind Sie Kathryn Jenkins?«
Ich räuspere mich und nicke. »Man nennt mich Kat.«
Er steckt seine Dienstmarke in die Tasche und tritt zurück, um den Blick auf seinen Streifenwagen in meiner Einfahrt freizugeben. Die Warnleuchte färbt die Regentropfen rot und blau, bunte Punkte, die durch den Himmel wirbeln wie in einem Kaleidoskop. »Würden Sie bitte die Tür öffnen?«
Ich schalte das Licht im Flur an, drehe das Schloss, ziehe am Türgriff, und eine kreischende Sirene durchschneidet die Luft. Oh, verdammt, denke ich in der halben Sekunde, bevor mein Körper reagiert, ich zur Schalttafel gehe und den Code eingebe. Ich brauche drei zitternde Anläufe, bis die Zahlenfolge stimmt.
Die Stille, die sich über das Haus legt, ist so intensiv, dass sie wie ein ganz anderer Ton in meinen Ohren klingt.
»Ist Ihr Sohn, Ethan Maddox, bei Ihnen?«
»Nein.« Mein Herz setzt kurz aus. »Er ist auf einer Klassenreise.«
»Dann tut es mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Sohn von Camp Crosby als vermisst gemeldet wurde.«
Meine Ohren rauschen. Mein Gehirn hat alle seine Worte beiseitegeschoben – bis auf das wichtigste.
»Ethan wird vermisst?« Ich brauche von diesem Mann eine Erklärung.
»Ethans Lehrerin hat gegen zwei Uhr dreißig alle Kinder einmal durchgezählt und festgestellt, dass Ethan fehlt. Sie und eine Begleiterin haben die nähere Umgebung abgesucht, und als sie keine Spur von Ihrem Sohn fanden, haben sie um drei Uhr sieben die Polizei alarmiert. Das Lumpkin County Sheriff’s Office traf kurz danach dort ein und leitete auf dem Camp eine organisierte Suche ein. Bisher haben sie Ihren Sohn noch nicht gefunden.«
»Ich bin sicher, er … er ist wahrscheinlich nur … ins Badezimmer gegangen und hat den Rückweg nicht gefunden.«
»Das ist eine ihrer Szenarien. Ein Stadtkind kann sich im Wald leicht verlaufen, besonders im Dunkeln.«
»Wie … wie lauten die anderen Szenarien?«
»An diesem Punkt können sie nichts ausschließen.«
Ich stelle mir meinen Sohn vor, dort draußen im dunklen Wald, dunkler als im Albtraum, und mir wird kurz schwindelig. Ethan schläft immer noch mit einem Nachtlicht. Er besteht darauf, dass seine Zimmertür einen Spalt offen und das Licht im Flur angeschaltet bleibt, damit es über den Teppich bis zum Fußende seines Bettes reicht. Ich stelle ihn mir vor, dort draußen in der Dunkelheit, und spüre förmlich seine Panik.
Jede Mutter hat diese heimlichen Ängste, dass ihrem Kind etwas zustoßen könnte, die sie in dunklen Stunden beschleichen. Wir beschwichtigen uns damit, dass wir es als unmöglich abtun. Uns passiert das nicht, reden wir uns ein. Nicht unseren Kindern. Wir schieben diese Ängste in die hinterste Ecke unseres Bewusstseins, um überhaupt damit umgehen zu können.
Ich reagiere mit weichen Knien und Atemnot. Mir wird übel.
Ethan wird vermisst!
Die Worte drehen sich in meinem Kopf, begleitet von Bildern – Ethan im stockdunklen Wald, ein Rudel wilder Tiere um ihn herum. Ist er verletzt? Ist er bei Bewusstsein?
Mit einem Ruck richte ich mich auf.
Der Polizist tritt ein, schließt die Tür mit einem leisen Klick und stützt mich am Ellenbogen. »Sie sollten sich erst einmal setzen.«
»Wie lange sucht man ihn schon?« Meine Stimme ist schrill, hysterisch. »Wie lange?«
Er wirft einen Blick auf die Armbanduhr. »Seit knapp drei Stunden. So lange versuchen wir Sie auch schon zu erreichen.«
»Drei Stunden! Drei … Wie viele Leute?«
»Die genaue Anzahl kenne ich nicht, Ma’am, aber ein vermisstes Kind hat bei uns allerhöchste Priorität. Wenn sie nicht genug Leute haben, holen sie sich Freiwillige aus den Nachbarbezirken. Mitten in der Nacht dauert es ein bisschen länger, einen Suchtrupp zusammenzustellen, doch der Sheriff weiß, was er tut, und seine Jungs kennen diese Wälder wie ihre Westentasche.«
Wenn das stimmt, wenn der Sheriff und seine Jungs jede Höhle und jeden umgefallenen Baum kennen, hätten sie ihn dann nicht schon längst gefunden?
»Entschuldigung, dass ich Sie das fragen muss, Ma’am, aber wann sind Sie gestern Abend nach Hause gekommen?«
Vielleicht ist es der Schlafmangel oder der Schrecken, denn ich verstehe seine Frage nicht. »Was?«
»Gestern Abend.« Sein Blick wandert über meine Schulter den Flur hinunter. »Wann sind Sie gestern Abend nach Hause gekommen, und gibt es irgendjemanden, der bezeugen kann, wo Sie sich aufgehalten haben?«
Als ich begreife, was er sagt, schnürt sich mir die Kehle zu: Er fragt nach meinem Alibi. Mein Kind hat sich meilenweit entfernt in einem Wald verlaufen, und man schickt diesen Mann, um mich zu beschuldigen, es entführt zu haben.
»Ich habe bis kurz vor neun Uhr abends gearbeitet«, sage ich. »Danach bin ich direkt nach Hause gefahren. Seitdem bin ich hier. Sie können bei der Sicherheitsfirma nachfragen, wenn Sie mir nicht glauben. Ich bin sicher, dass sie Aufzeichnungen darüber haben, wann ich die Anlage aus- und wieder angeschaltet habe.«
Dann wird mir etwas anderes klar. »Oh, mein Gott! Glauben Sie, jemand hat ihn entführt?«
»Nicht notwendigerweise, doch nachdem wir Sie nicht erreichen konnten, musste ich Sie das fragen.« Sein Tonfall ist fast entschuldigend. »Der Sheriff hätte Sie gern so schnell wie möglich oben in Dahlonega. Wissen Sie, wie Sie dorthin kommen, oder soll ich Ihnen die Adresse aufschreiben?«
Ich schnelle herum und eile den Flur hinunter, während der Bademantel um meine Knöchel flattert. In der Küche krame ich in dem Durcheinander auf dem Tresen nach meinem Handy und sehe, nachdem ich es aktiviert habe, siebenundzwanzig verpasste Anrufe.
Eine gute Mutter hätte das Handy neben dem Bett liegen gehabt, wenn ihr Sohn unterwegs wäre. Sie hätte es in dem Moment mitbekommen, in dem ihr Sohn im Wald verschwunden wäre. Sie hätte es gewusst.
»Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Einen Freund oder jemanden aus der Familie, der Sie dorthin fahren kann?« Der Polizist steht in der Küche. Sein Blick streift im Halbdunkel durch die unordentliche Küche einer berufstätigen Mutter und eines chaotischen Achtjährigen. Schmutziges Geschirr stapelt sich in der Spüle, und auf dem Küchentresen liegen Papierstapel. Ich schüttele den Kopf, nicke dann und schüttele wieder den Kopf. Ich bin Einzelkind, habe keine Eltern mehr, und die Menschen, die ich anrufen könnte, wohnen auch nicht in der Gegend. Highschool-Freunde von damals, in der kleinen Stadt am obersten Zipfel von Tennessee. Lucas, in jeder Hinsicht mein Bruder, nur nicht blutsverwandt. Izzy – die einzige Freundin, die ich aus der Zeit vor der Scheidung behalten habe – ist gerade mit ihrem neuesten Liebhaber, Tristan oder Tanner, auf einem Segeltörn zu den Britischen Jungferninseln. Der Einzige, der bleibt, ist Andrew.
Und er kommt absolut nicht infrage.
Ich lasse mein Handy klappernd auf den Tresen fallen und renne zur Gartentür. Der Schlüsselhaken neben der Schalttafel der Alarmanlage ist leer. Ich fahre mit der Hand darüber, nur, um sicherzugehen. Keine Schlüssel. Ich schalte das Licht an, suche auf dem Boden danach und befördere Ethans Schulranzen, seine Jacke, die er immer vergisst aufzuhängen, und ein Paar pinkfarbene Fell-Slipper mit einem Tritt beiseite. Da sind sie auch nicht.
Wo sind sie?
Eine weitere Welle der Panik überrollt mich. Ich muss nach Dahlonega, sofort. Ich muss in diesen Wäldern sein und Ethans Namen rufen, bis mein Hals rau ist. Ich muss ihnen helfen, meinen Sohn zu finden.
Ich fahre herum und pralle gegen den wuchtigen Körper des Cops. Er weicht zurück, um mich durchzulassen, und sagt etwas, das auf meine durchdrehenden Gedanken wie Fahrstuhlmusik wirkt – Hintergrundgeräusche, ohne dass eine einzige Note hängenbleibt.
Ich muss meine Schlüssel finden. Verdammt, denk nach.
Zurück in der Küche krame ich in meiner Handtasche und werfe den Inhalt achtlos auf den Tresen. Mein Portemonnaie, eine abstruse Menge zusammengeknüllter Quittungen, Pfefferminzbonbons, aber keine Schlüssel.
Der Cop redet immer noch, irgendetwas darüber, dass ich mich beruhigen solle. Ich kann in seiner Anwesenheit kaum denken. Ich raufe mir die Haare, presse meine Augen zusammen, versuche, seine Stimme auszublenden und mich daran zu erinnern, wo ich die verdammten Schlüssel gelassen habe. Ich bin gestern Abend hereingekommen, habe meine Handtasche dabei und – ich schiebe mich an dem Cop vorbei, reiße den Kühlschrank auf, und da glitzert das metallene Bündel im goldenen Licht der Kühlschranklampe.
Ich greife danach, bin jedoch nicht schnell genug. Ein langer Arm greift an mir vorbei, und die riesige Faust des Polizisten umschließt die Schlüssel, bevor ich sie erreichen kann.
Ich werfe die Tür zu, drehe mich auf dem Absatz um, und plötzlich ist mir alles zu viel.
Die Schultern des Cops entspannen sich, und er steckt die Schlüssel in die Hosentasche. »Ziehen Sie sich an. Achten Sie darauf, bequeme Kleidung anzuziehen und Turnschuhe. Packen Sie eine kleine Reisetasche mit dem Notwendigsten. Packen Sie auch eine Tasche für Ethan und stecken sie alle Spielsachen und Kuscheltiere ein, die er vielleicht gern hätte, wenn wir ihn finden.« Er nimmt mein Handy vom Tresen und wedelt damit vor seinem Ohr herum. »Wo ist das Ladegerät für dieses Ding?«
Ich bin so entsetzt, dass ich nur antworten kann: »Oben, glaube ich.«
»Packen Sie es auch ein. Sowie Sie fertig sind, fahren wir los.«
Kat +++ 3 Stunden und 23 Minuten vermisst +++
In meinem Viertel in Ost-Atlanta ist es nicht ungewöhnlich, dass mitten in der Nacht Streifenwagen durch die Nachbarschaft rollen. Die Leute in meiner Straße sind hartgesottene kettenrauchende Frauen, die Fremden mit der Faust drohen, fette Männer mit Goldzähnen und verblassten Tätowierungen auf den Armen, Teenager mit Sackhosen, die auf dem Bürgersteig zusammen mit Kids abhängen, die noch zu jung zum Rauchen sind. Die Häuser sind heruntergekommen und schäbig, die Vorgärten von Unkraut überwuchert. Ich hatte gedacht, die Ehe mit Andrew würde mich vor solch einer Gegend bewahren, doch dank der unzähligen, hinterlistigen Nebelwände, die Andrew errichtet hatte, um dahinter sein Geld und die Unternehmenswerte zu verstecken, bin ich wieder hier gelandet.
»Wie geht es Ihnen?«, fragt der Cop, und ich schrecke auf. »Tut mir leid, ich wollte Ihnen keine Angst einjagen.«
»Wie kommt es, dass Sie keine Uniform tragen?« Die Frage hört sich unsicher an. Mein Hals ist ausgetrocknet.
»Weil ich kein Streifenpolizist bin. Ich bin Detective und habe Nachtschicht.«
»Ist das hier dann nicht ein bisschen unter Ihrem Niveau?«
»Was, ein vermisstes Kind?«
»Nein. Mich den ganzen Weg nach Dahlonega zu fahren. Wie weit ist es, achtzig Kilometer?«
Ohne seine Augen von der Straße zu nehmen, sagt er: »Eher hundert.«
Angesichts dieser weiten Strecke fühle ich mich unwohl. Sieht er mich immer noch als Verdächtige? Hat er mir angeboten, mich zu fahren, um in meiner Nähe zu bleiben und mich im Auge zu behalten? Ich versuche, meinen Argwohn beiseitezuschieben, doch seit der Sache mit Andrew kann ich mich auf meinen einst so scharfen Instinkt nicht mehr verlassen. Wer weiß schon, warum irgendwer irgendetwas tut?
Und Andrew – hat ihn jemand angerufen? Hat auch bei ihm ein Beamter an die Tür getrommelt und ihn aus dem Bett geholt? Bei dem Gedanken daran, ihn wiederzusehen, uns im Camp nach Monaten wieder gegenüberzustehen, werde ich noch unruhiger.
Ich krame in der Tasche zu meinen Füßen und suche nach dem Handy. »Ich muss Lucas anrufen.«
Der Detective streckt die Hand nach dem Lautstärkeregler aus und stellt das Funkgerät leiser, das bis dahin die gesamte Zeit in unregelmäßigen Abständen Polizeidurchsagen von sich gegeben hat.
Bei den ersten drei Versuchen lande ich auf der Mailbox. Schließlich, nach dem vierten Klingeln, kriecht Lucas’ tiefe, rauchige Stimme durch die Leitung. »Was ist los? Wieder Andrew?«
»Nein, es geht um Ethan.« Als ich seinen Namen ausspreche, versagt mir fast die Stimme. »Er wird vermisst.«
»Was meinst du damit, er wird vermisst? Von wo wird er vermisst?«
»Von der Hütte, wo er mit seiner Klasse untergebracht ist. Er ist auf dieser Klassenfahrt nach Dahlonega. Seine Lehrerin hat alle Kinder durchgezählt, und er war nicht da.« Eine neue Welle der Panik überkommt mich. »Er ist inzwischen seit drei Stunden fort, Lucas.«
Es raschelt, eine Matratzenfeder quietscht, und ich sehe ihn vor mir, wie er im Süden von Knoxville auf der Bettkante sitzt, in einem Haus kaum größer als meines. Lucas arbeitet im Baugewerbe, was seit der geplatzten Immobilienblase bedeutet, dass er so ziemlich jede Arbeit übernimmt, um ein paar Dollar zu verdienen. Er arbeitet als Schweißer, Maurer, Schreiner, Dachdecker, Maler, Elektriker, Gartenbauer, Installateur, Handlanger und Alleskönner.
Er ist außerdem ein Ex-Marine, ausgebildet im Such- und Rettungsdienst. Er kann jedes Tier in jedem Wald aufspüren. Wenn er jetzt losfährt, kann er in gut drei Stunden dort sein.
Im Hintergrund hört man eine verschlafene Frauenstimme, die er bittet, still zu sein. Lucas ist ein gutaussehender Mann. Er hat immer eine Frau in seinem Bett, wenn auch selten dieselbe. Noch mehr Rascheln, dann das Klicken einer Tür. »Okay, erzähl mir, was passiert ist. Fang ganz vorne an.«
»Mehr weiß ich nicht. Ethan war dort – und nun ist er weg. Die Polizisten suchen nach ihm.«
»Wie viele Polizisten?«
»Das weiß ich nicht.«
»Haben sie die Hunde angefordert?«
»Ich weiß es nicht.« Panik steigt in mir auf, wie ein Schrei.
»Okay, ich bin auf dem Weg. Wo bist du gerade?«
Ich sehe mich nach Straßenschildern um. Inzwischen sind wir auf dem belebten Highway der Stadt. Weiter vorn leitet uns ein grünes Schild Richtung Norden nach Cumming.
»Wir fahren gleich auf die SR 400, also dauert es noch ungefähr eine Stunde, nicht wahr?« Der Detective nickt. »Ja, er sagt, noch eine Stunde.«
»Wer ist ›er‹?«
»Der Detective, der zu mir nach Hause gekommen ist. Er fährt mich jetzt.« Ich weiß, dass er mir seine Dienstmarke gezeigt und seinen Namen genannt hat, als er vor der Haustür stand, doch nichts davon ist hängengeblieben. Ich nehme das Handy vom Ohr.
»Entschuldigen Sie bitte, aber ich habe Ihren Namen vergessen.«
Der Polizist wirft mir einen Seitenblick zu. »Detective Brent Macintosh, Atlanta Police Department.«
Ich wiederhole die Worte für Lucas. »Ich verlasse jetzt das Haus«, antwortet er.
Erleichterung macht sich in mir breit. »Glaubst du, dass Ethan … ins Badezimmer gegangen ist und den Weg zurück nicht gefunden hat?«
»Dafür ist er zu intelligent«, sagt Lucas, und ich zucke zusammen, obwohl ich weiß, dass er recht hat. »Hör zu, er kann nicht weit sein, wo auch immer er ist.«
Auf der anderen Seite der Windschutzscheibe schlagen die Scheibenwischer in einem frenetischen Rhythmus hin und her, bekommen das Glas jedoch nicht schnell genug klar. Ich denke an die Gefahren, die von einem Regenschauer im Gebirge ausgehen können – durchweichter Boden, so sumpfig wie Treibsand, Schlammlawinen, die alles in ihrem Weg mit sich reißen.
»Es ist immer noch dunkel draußen, Lucas.«
»Ich weiß.«
»Und es gießt in Strömen. Er wird klatschnass sein.«
»Ich komme so schnell ich kann.«
»Okay.« Ich zwinge mich, ruhig zu atmen und die Panik zu unterdrücken. Lucas ist einer, der Dinge in Ordnung bringt.
»Mit wem hast du sonst noch gesprochen?«
»Mit niemandem. Du bist der Erste.«
Ich weiß, dass er eigentlich danach fragt, ob ich Andrew angerufen habe. Der Mann, von dem Lucas annahm, dass er der Grund für diesen Anruf gewesen sei. Lucas war nie ein großer Fan von Andrew.
Ich seufze. »Ich rufe ihn morgen früh an, falls sie Ethan bis dahin immer noch nicht …«
»Sie werden ihn finden«, sagt Lucas mit einer Stimme, die Sicherheit und Entschiedenheit ausstrahlt. »Und wenn nicht sie, dann ich.«
Ich atme schwer aus, ein tiefer Seufzer der Erleichterung. Das waren die Worte, auf die ich gewartet habe.
Dass Ethan etwas Besonderes ist, weiß ich, seit er mir im Alter von zehn Monaten und drei Tagen seine Milchflasche gab und sagte: »Nein, ich will Saft.« Vier Worte, keine ungewöhnlichen, sondern ein ganzer Satz. Subjekt, Prädikat, Objekt. Für ein Baby seines Alters außergewöhnlich.
Andrew bestand darauf, dass wir ihn testen lassen sollten sowie die Psychologin das für möglich hielt, im Alter von zwei Jahren. Ich werde nie Andrews Gesicht vergessen, als diese Frau, eine prüde Dame mit Perlenkette, uns mitteilte, dass Ethan IQ im Hochbegabten-Bereich lag. Plötzlich war es Andrew egal, dass sein Kleinkind sich für die Paarungsrituale von Pinguinen begeisterte oder der einzige Weg, den Tobsuchtsanfall seines Zweijährigen zu beruhigen, darin bestand, Musik von Bach einzuschalten. Ethans schräge Marotten hatten eine Erklärung – eine, mit der man vor aller Welt angeben konnte.
»Mein Sohn ist hochbegabt«, brüstete sich Andrew vor unseren Freunden, seinen Tennispartnern, dem Fremden hinter ihm an der Supermarktkasse, und das so laut, dass möglichst viele es mitbekamen. Er ist immer schon laut gewesen, doch wenn er prahlt, dreht er gern noch ein bisschen auf. »Nein, ich meine ernsthaft brillant. Mit einem IQ von 158, nur zwei Punkte weniger als Einstein. Die Psychologin sagt, es sei erblich.«
Natürlich meinte Andrew damit sich selbst. Sein Sohn hatte die Intelligenz von ihm.
»Ethan ist hochbegabt«, sage ich jetzt zu Detective Macintosh. »Mein Sohn ist nicht gerade ein Naturbursche, aber Lucas hat recht – er ist klug genug, um zum Badezimmer zu gehen und zurück – der Kompass!«
Der Detective sieht mich kurz an. »Was für ein Kompass?«
»Ich habe ihm heute Morgen einen Kompass mitgegeben. Na ja, es ist ein alter Landvermesser-Kompass, doch er funktioniert, und Ethan weiß, wie man ihn bedient.« Hoffnung macht sich in meiner Brust breit. »Wenn er sich verirrt, kann er ihn benutzten, um seinen Weg zurück zu finden.«
»Oder seinen Weg hinaus.«
»Hinaus aus dem Wald?« Ich schüttele den Kopf. »Sie kennen meinen Sohn nicht, er würde gar nicht erst in den Wald hineingehen. Er hat Angst im Dunkeln.«
»Denken Sie daran, all das auch dem Sheriff zu erzählen, wenn wir dort ankommen. Er wird versuchen, sich in Ethan hineinzuversetzen, um besser nachvollziehen zu können, wie er denkt.«
Inzwischen ist es fast sechs Uhr. Der Himmel ist nicht mehr tiefschwarz, sondern metallgrau, tiefhängende Wolken sperren die Morgendämmerung aus. Die meisten der großen Lkws und Pendler fahren in die entgegengesetzte Richtung – in die Stadt –, so dass die Straßen Richtung Norden relativ frei sind. Auf beiden Seiten ragen die Berge wie Ungeheuer über uns empor, schwarze Bergkämme verlieren sich in dichten Nebelschwaden.
Alles wird gut, sage ich mir und wiederhole die Worte immer und immer wieder, wie ein Mantra. Ethan hat sich nur verlaufen. Man wird ihn bald finden.
»Wie lange brauchen wir noch?«
Der Detective schaut auf das Navi. »Noch ungefähr vierzig Minuten.«
Im Dämmerlicht des Wagens sieht er jung aus, fast jungenhaft, doch sein Gesichtsausdruck ist der eines Menschen, der schon alles gesehen hat. Und als Detective in einer Stadt wie Atlanta, die regelmäßig unter den zwanzig gefährlichsten Städten Nordamerikas rangiert, hat er das vermutlich auch.
Das Funkgerät gibt plötzlich Geräusche von sich und verstummt dann wieder. Seit wir Atlanta verlassen haben, geht das schon so, Krächzen in unregelmäßigen Abständen und Stimmen aus dem Nichts, die verschlüsselte Mitteilungen von sich geben.
»Was haben sie gesagt?«
»Die Hunde haben noch keine Witterung aufgenommen, oder zumindest haben sie keine frische Fährte.«
»Was für Hunde?«
»Personenspürhunde, Fährtenhunde. Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber ein gut ausgebildeter Diensthund kann jemanden wesentlich schneller finden, als Menschen es können, und sie benötigen dafür kein Licht.«
»Ethan ist seit fast vier Stunden verschwunden. Warum brauchen sie so lange?«
Der Detective blickt kurz zu mir herüber. »Ihr größtes Problem ist die Verunreinigung der Duftspur. Die Hunde sind darauf abgerichtet, menschliche Gerüche voneinander zu unterscheiden, was bedeutet, dass sie den Geruch Ihres Sohnes von dem anderer Kinder unterscheiden können, doch sie brauchen eine Weile, bis sie die richtige Witterung aufnehmen und die frischeste Fährte finden.« Er deutet über das Armaturenbrett hinweg auf die wirbelnden Wischblätter. »Der Regen hilft auch nicht gerade.«
Es hat sich so richtig eingeregnet. Kein Sonnenstrahl. Keine Fetzen blauer Himmel. Nur dunkle Wolken und strömender Regen.
»Warum, weil man dann nicht so gut sieht?«
»Nein, weil er es schwieriger macht, etwas zu riechen. Diensthunde sind extrem leistungsfähig, doch sie können nichts riechen, was weggespült wurde. Wind bedeutet auch nichts Gutes, genauso wie kalte Luft, die einen Aufwind erzeugt, wenn sie auf feuchten Boden trifft. Die Hundetrainer wissen, wie sie mit solchen Wetterbedingungen umgehen, und berechnen das beim Einsatz der Hunde mit ein, aber dieses Wetter macht ihnen die Arbeit nicht gerade leichter.«
Das Funkgerät erwacht wieder zum Leben, und ich halte den Atem an, lehne mich vor, gleichermaßen elektrisiert von Hoffnung und Furcht. Ich strenge mich an, die Worte über die Geräusche des Regens und der Scheibenwischer hinweg zu verstehen, doch die Nachricht wird durch statisches Rauschen verzerrt. Ich suche im Gesichtsausdruck des Detectives nach Hinweisen. Seine Augen verengen sich.
»Sie bitten um eine Beschreibung von Ethans Rucksack.«
»Warum? Haben sie ihn gefunden?«
»Sieht so aus, als suchten sie den Rucksack und bräuchten eine Bestätigung der Beschreibung. Je mehr Identifizierungsmerkmale Sie geben können, desto besser.«
»Der Rucksack ist hellblau und schwarz, mit einem Angry Bird vorne drauf. Ethans Vor- und Nachname sind mit einem Edding auf die Innenklappe geschrieben worden.«
Der Detective gibt meine Antwort weiter, zusammen mit dem, was ich ihm über den Kompass erzählt habe. Die knackende Stimme erwidert etwas, und der Detective schaut mich an. »Gibt es noch etwas, mit dem man Ihren Sohn orten könnte? Ein Handy, ein iPhone, Computerspiel-Geräte, irgendwie so was?«
»Nein. Ethan besitzt kein Handy, und ich möchte nicht, dass er Computerspiele spielt. Er darf mein altes iPad benutzen, aber nur zu Hause.«
Der Polizist wiederholt meine Antwort für das Funkgerät, und es folgt eine lange Pause mit statischem Rauschen.
»Verstanden«, sagt die Stimme und verstummt.
Der Detective hängt das Headset an den Haken. »Wir hätten gern Zugang zu Ihrem Haus, um an das iPad zu kommen, falls er übers Internet mit jemandem Kontakt aufgenommen hat. Sie möchten sich auch gründlich in seinem Zimmer umsehen.«
»Weswegen?«
»Aus demselben Grund, aus dem sie eine lange Liste an Fragen für Sie haben – um sich in Ihren Sohn hineinzuversetzen. Um herauszufinden, ob es in seinem Leben etwas gab, das mit seinem Verschwinden zu tun haben könnte. Und bevor Sie wieder schwarzsehen, die Tatsache, dass er seinen Rucksack mitgenommen hat, ist ein gutes Zeichen. Es bedeutet, dass er vorbereitet gewesen ist.«
Ich schüttele den Kopf, vom genauen Gegenteil überzeugt. »Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Ethan mitten in der Nacht fortgeht. Er würde die Hütte niemals verlassen, nicht ohne ausdrückliche Erlaubnis seiner Lehrerin. Was ist mit Miss Emma und den Begleitern? Was ist mit den Kindern? Jemand muss doch etwas gesehen haben?«
»Das wären genau die Fragen, die ich der Lumpkin County Police an Ihrer Stelle stellen würde. Wie Ethan bei all den Menschen, unter denen er sich befand, überhaupt verschwinden konnte.«
Und genau an dieser Stelle taucht mein Verstand wieder in jene Dunkelheit ab, vor der mich der Detective gewarnt hat. Warum hat Ethan nicht geschrien und die Begleiter alarmiert? Ist er schreiend und um sich tretend fortgeschafft worden oder bedroht von einer Schusswaffe freiwillig mitgegangen? Wie kommt es, dass keines der Kinder etwas gehört hat?
Detective Macintosh ist inzwischen abgebogen und folgt nun weiter den langgezogenen Kurven des US-19 nach Dahlonega. Der Highway ist hier schmaler; Schlaglöcher und dunkle Pfützen, in denen die Reifen hängenbleiben, bringen uns ins Schleudern und gefährlich nahe an die Leitplanken.
»Und die zweite Frage?«, sage ich, nachdem wir wieder sicheren Boden unter den Reifen haben.
Langsam und mit Bedacht sagt der Detective: »Die zweite Frage lautet: Wer möchte gern mehr Zeit mit Ihrem Sohn verbringen? Denn je länger Ethan vermisst wird, je länger er unauffindbar bleibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er sich nicht verlaufen hat.«
Stef +++ 3 Stunden und 33 Minuten vermisst +++
Ich blicke mit zusammengekniffenen Augen in die Dunkelheit unseres Schlafzimmers und brauche mich nicht umzudrehen, um zu wissen, dass ich allein im Bett bin. Kein Geräusch von Sam, der seine Zähne putzt oder auf der Suche nach seinen Trainingsklamotten lautstark in seinem Kleiderschrank herumwühlt, was nur bedeuten kann, dass er bereits unten ist. Mein Mann ist ein guter Mensch und ein fabelhafter Bürgermeister von Atlanta, doch zu Hause lebt er wie auf seinem eigenen Planeten, auf dem er seine Morgenrituale ohne Rücksicht auf die noch Schlafenden durchzieht. Wenn er immer noch im Zimmer wäre, würde ich ihn hören.
Ich rolle mich zu meinem Nachttisch und blicke auf die Uhr – drei nach sechs. Zwölf Minuten bevor mein Wecker losgeht, woraufhin ich normalerweise durch den Flur zu Sammys Zimmer schlurfe, damit er sich für die Schule fertig macht. Anders als sein Vater schläft Sammy wie ein Stein. Ihn aus dem Bett zu bekommen fühlt sich manchmal an, wie ein Kamel durchs Nadelöhr zu ziehen – unmöglich.
Doch heute Morgen ist Sammys Bett leer. Sam und ich haben uns einen gemeinsamen Tag freigenommen, was selten vorkommt. Kein endloser Stau in der Warteschlange vor der Schule für mich. Keine Meetings mit Geldgebern, Wahlkundgebungen oder sich anbiedernden Mitgliedern des City Councils für ihn. Und was am besten ist, kein Josh, Sams ständig erreichbarer Stabschef, der anruft, SMS schreibt oder in den denkbar ungünstigsten Momenten stört. Nur Sam und ich und endlose Stunden des Müßiggangs.
Himmlisch.
Ich fahre mit einer Hand über Sams Seite der Matratze und über Bettlaken, die schon längst ausgekühlt sind. Es gab einmal eine Zeit, in der Sam und ich bis zum Mittag in diese Laken eingewickelt waren. Zugegebenermaßen war das vor Sammy und vor dem Zeitpunkt, an dem Sam für das Amt des Bürgermeisters kandidiert und mit überraschender Mehrheit gewonnen hat. Ich vermisse diese Tage wirklich.
Ich will gerade auf die Taste drücken, um die Jalousien hochzufahren, als sich die Schlafzimmertür öffnet und Sam hereinkommt. Er hält etwas in der Hand, und seine einstige Footballspieler-Statur zeichnet sich als Silhouette vor dem goldenen Schein des Flurlichts ab. Sam schleicht sich barfuß und in Pyjamahosen ins Zimmer, und in seiner Hand klappert eindeutig Porzellan. Er flucht leise.
»Ist schon in Ordnung. Ich bin wach.«
Ich schalte eine Lampe an, und die Schatten im Schlafzimmer nehmen Gestalt an. Die Kommode an der gegenüberliegenden Wand. Der gepolsterte Sessel vor dem deckenhohen Fenster. Sam, der sich mit zwei dampfend heißen Kaffeebechern in einer Hand dem Bett nähert. Der Geruch zieht mich in den Bann, genau wie sein Lächeln – warm, aufrichtig und verführerisch.
Mit der freien Hand nimmt er einen Becher und gibt ihn mir. »Extra stark mit einem winzigen Schuss Kokosmilch.«
Ein perfektes Beispiel, warum man Sam zum Bürgermeister gewählt hat – seine Fähigkeit, einem genau das zu geben, was man möchte, bevor man überhaupt weiß, dass man es will. Der erste Schluck wirkt wie ein willkommener und stimulierender Kick.
»Wenn ich ehrlich bin, war ich etwas ungehalten, als ich allein aufgewacht bin, aber hiermit ist dir offiziell verziehen. Das ist perfekt, danke.«
»Also, ich habe mir etwas überlegt …«, sagt er, setzt sich ans Fußende des Bettes und legt eine Hand auf mein Bein. »Warum mieten wir uns nicht zwei Fahrräder und radeln die BeltLine entlang? Wir könnten am Ponce City Market zu Mittag essen und Cupcakes in Saint-Germain und dann den Rest des Nachmittags einen Kneipenbummel machen. Es soll ein wundervoller Tag werden. Was meinst du?«
»Ich dachte, wir wollten heute für uns bleiben, nur du und ich.«
Das ist das Einzige, um das ich gebeten habe. Einen Tag ohne Verpflichtungen. Ohne Verabredungen und ellenlangen To-do-Listen. Nach vier Jahren Irrenhaus – und mit den nächsten vier Jahren, die uns drohen – ist das, finde ich, nicht zu viel verlangt.
»Du, ich, Sonnenschein und Cocktails«, sagt Sam. »Was gefällt dir daran nicht?«
»Die Tausende von Wählern, die dich erkennen werden, die dir alle auf die Schulter klopfen und ein Selfie mit dir machen möchten. Das gefällt mir nicht. Und ich kenne dich. Du sagst nie irgendwem, er solle sich vom Acker machen, nicht, wenn es dich eine Stimme kosten könnte. Der Tag würde überhaupt nicht uns allein gehören.«
Sam gibt sich achselzuckend geschlagen. »Okay. Was würdest du denn gerne tun?«
»Was stimmt denn nicht an dem, was wir gerade tun?«
»Überhaupt nichts.« Er schweigt, heuchelt Verwirrung. »Was genau tun wir denn gerade?«
»Absolut gar nichts.«
Sams Stirn legt sich in Falten. Mein Mann lebt nach dem Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Prinzip. Er tut sich schwer mit der Vorstellung, gar nichts zu tun – weswegen er es ja so dringend nötig hat.
»Wie wär’s denn mit den Cupcakes?«, fragt er.
»Dafür gibt es den Lieferservice.«
»Du schlägst also vor, dass wir … was genau tun?«
»Den ganzen Tag zuhause im Pyjama herumlümmeln. Die Zeitung lesen und im Bett Cracker essen. Nichts zu tun, uns nicht anzuziehen, außer vielleicht, um auf einer Luftmatratze auf dem Pool zu treiben. Alles und jeden zu ignorieren, abgesehen von uns. Komm, sei ehrlich. Klingt das nicht herrlich?«