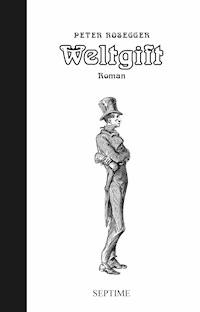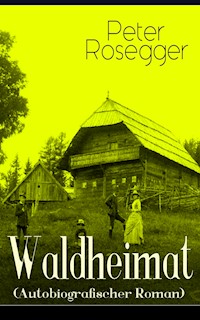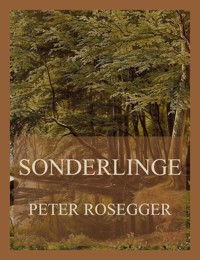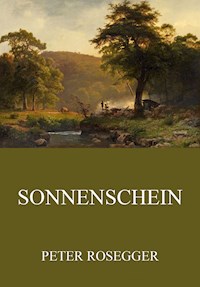
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In seiner unnachahmlichen Art erzählt Rosegger wieder von den lieb gewonnenen Schildbürgern, die versuchen dem mißlungenen und ohne Fenster gebauten Rathaus Licht einzuhauchen ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 491
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sonnenschein
Peter Rosegger
Inhalt:
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Sonnenschein
Vorwort
Onkel Sonnenschein
Frühling
Der junge Geldmacher
Der Kinderkittel
Die Magd mit dem zugenähten Kittelsack
Die Sonnseitige und der Schattseitige
Der Vagabunden-Franz
Drei Mittagsessen
Die Geschichte vom Schmied und seiner Liebe
Die Häuselschnecke
Reich
Zwei, die sich nicht mögen
Zwei, die sich mögen
Heilige Wunder
Der Mann mit den sechs Händen
Der Lachenmacher
Der liebe kleine Gott geht durch den Wald
Der Fremde im Vaterhause
Die Fahnelträgerin
Ums Dirndl
Am Tage der Sonne
Sonnenschein, P. Rosegger
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849653118
www.jazzybee-verlag.de
Peter Rosegger – Biografie und Bibliografie
Namhafter österr. Volksschriftsteller, geb. 31. Juli 1843 in Alpl bei Krieglach in Obersteiermark als Sohn armer Bauersleute, verstorben am 26. Juni 1918 in Krieglach. Erhielt nur den notdürftigsten Unterricht und kam, weil er für einen Alpenbauer zu schwach war, mit 17 Jahren zu einem Wanderschneider in die Lehre, mit dem er mehrere Jahre lang von Gehöft zu Gehöft zog. Dabei kaufte und las er, von Bildungsdrang getrieben, Bücher, namentlich den »Volkskalender« von A. Silberstein, dessen Dorfgeschichten ihn so lebhaft anregten, daß er selbst allerlei Gedichte und Geschichten zu schreiben anfing. Durch Vermittelung des Redakteurs der Grazer »Tagespost«, Svoboda, dem R. einige Proben seines Talents zusandte, ward ihm endlich 1865 der Besuch der Grazer Handelsakademie ermöglicht, an der er bis 1869 seiner Ausbildung oblag; später wurde ihm zu weitern Studien vom steirischen Landesausschuß ein Stipendium auf drei Jahre bewilligt. Er ließ sich dauernd in Graz nieder, wo er seit 1876 die Monatsschrift »Der Heimgarten« herausgibt, und wo der freundschaftliche Verkehr mit Hamerling, der auch seinen Erstling mit einem Vorwort in die Literatur einführte, auf seine Bildung bestimmend einwirkte. Seiner ersten Veröffentlichung: »Zither und Hackbrett«, Gedichte in obersteirischer Mundart (Graz 1869, 5. Aufl. 1907), folgten: »Tannenharz und Fichtennadeln«, Geschichten, Schwänke etc. in steirischer Mundart (das. 1870, 4. Aufl. 1907), dann fast jährlich gesammelte Schilderungen und Erzählungen, die vielfach aufgelegt wurden (meist Wien), nämlich: »Das Buch der Novellen« (1872–86, 3 Bde.); »Die Älpler« (1872); »Waldheimat«, Erinnerungen aus der Jugendzeit (1873, 2 Bde.); »Die Schriften des Waldschulmeisters« (1875); »Das Volksleben in Steiermark« (1875, 2 Bde.); »Sonderlinge aus dem Volk der Alpen« (1875, 3 Bde.); »Heidepeters Gabriel« (1875); »Feierabende« (1880, 2 Bde.); »Am Wanderstabe« (1882); »Sonntagsruhe« (1883); »Dorfsünden« (1883); »Meine Ferien« (1883); »Der Gottsucher« (1883); »Neue Waldgeschichten« (1884); »Das Geschichtenbuch des Wanderers« (1885, 2 Bde.); »Bergpredigten« (1885);»Höhenfeuer« (1887); »Allerhand Leute« (1888); »Jakob der Letzte« (1888); »Martin der Mann« (1889); »Der Schelm aus den Alpen« (1890); »Hoch vom Dachstein« (1892); »Allerlei Menschliches« (1893); »Peter Mayr, der Wirt an der Mahr«, (1893); »Spaziergänge in der Heimat« (1894); »Als ich jung noch war« (Leipz. 1895); »Der Waldvogel«, neue Geschichten aus Berg und Tal (das. 1896); »Das ewige Licht« (das. 1897); »Das ewig Weibliche. Die Königssucher« (Stuttg. 1898); »Mein Weltleben, oder wie es dem Waldbauernbuben bei den Stadtleuten erging« (Leipz. 1898); »Idyllen aus einer untergehenden Welt« (das. 1899); »Spaziergänge in der Heimat« (das. 1899); »Erdsegen. Vertrauliche Sonntagsbriefe eines Bauernknechtes«, Kulturroman (das. 1900); »Mein Himmelreich. Bekenntnisse, Geständnisse und Erfahrungen aus dem religiösen Leben« (das. 1901); »Sonnenschein« (das. 1901); »Weltgift« (das. 1903); »Das Sünderglöckel« (das. 1904); »J. N. R. J. Frohe Botschaft eines armen Sünders« (das. 1904; neu bearbeitete Volksausgabe 1906); »Wildlinge« (das. 1906). Diese Werke erschienen auch mehrmals gesammelt (zuletzt in Leipzig). In steirischer Mundart veröffentlichte R. noch: »Stoansteirisch«, Vorlesungen (Graz 1885, neue Folge 1889; 4. Aufl. 1907); ferner in hochdeutscher Sprache: »Gedichte« (Wien 1891), das Volksschauspiel: »Am Tage des Gerichts« (das. 1892), »Persönliche Erinnerungen an Robert Hamerling« (das. 1891) und »Gute Kameraden, Erinnerungen an Zeitgenossen« (das. 1893). Genaue Kenntnis des Dargestellten, Gemüt und Humor zeichnen die Erzählungen Roseggers aus; seine Stärke liegt in der kleinen Form der Skizze und kurzen Erzählung; in eine Reihe solcher hübschen kleinen Bilder zerfallen auch die besten seiner größern Romane, wie »Jakob der Letzte«, »Der Waldschulmeister«. Vgl. Svoboda, P. K. Rosegger (Bresl. 1886); Ad. Stern, Studien zur Literatur der Gegenwart (Dresd. 1895); O. Frommel, Neuere deutsche Dichter in ihrer religiösen Stellung (Berl. 1902); Hermine und Hugo Möbius, Peter R. (Leipz. 1903); Seillière, R. und die steirische Volksseele (deutsch von Semmig, das. 1903); Kappstein, Peter R., ein Charakterbild (Stuttg. 1904); Latzke, Zur Beurteilung Roseggers (Wien 1904).
Sonnenschein
Vorwort
Sonnenschein – welch glänzender Titel! Ich bewundere meinen Mut, der ihn schrieb auf dieses Buch, dessen, wenn auch zumeist heiterer Inhalt mit der Sonne wohl kaum etwas anderes gemein haben kann, als vielleicht eine Anzahl Bündel warmer Strahlen, einige Flecken, einmal eine Sonnenfinsternis und darunter ziehende Wolken. Aber schau mein Leser, die Finsternis kommt von unserem Erdschatten und geht vorüber. Die weißen Wolken gehören zur Sonne, sie erhöhen ihr Licht oder hauchen eine lauschige Dämmerung über die Landschaften der Seele. So wird die Heiterkeit des Buches von absichtlichen und Wohl auch unabsichtlichen Schatten durchzittert werden.
Ich empfinde nur allzuoft die Unzulänglichkeit meiner Kraft. Ein starkes Talent aber fühle ich in mir, eines, das jeder haben soll, der da sein Licht leuchten lassen will: das Talent, an Gott und an die Menschen zu glauben, den Sieg der Freude zu erhoffen und zu lieben den Sonnenschein, der vom Himmel kommt. Hätte jemand alle Fähigkeiten, aber diese nicht, so müßte er sich zurückziehen in eine dunkle Höhle und schweigen. Die Wahrheit dieser Erde ist ernst und oft trüb, aber sie verträgt es recht gut, von ein bißchen Poesie beleuchtet zu werden, ohne daß sie unwahr wird. Die Welt ist reich an Niedertracht und sie ist reich an Größe und Schönheit. Nur darauf kommt es an, was wir Poeten liegen lassen oder auflesen.
Ich entscheide mich für das Bessere. Und so will ich dir, mein Leser, in diesem Buche etwas Frohes, Liebes geben. Nimmst du es an, so bringe nur auch eine gute Stimmung mit. Ich möchte nicht, daß es mir am Ende so erginge wie jenen klugen Schildbürgern, die den Sonnenschein sackvollweise tragen wollten in ihr Rathaus, das keine Fenster hatte.
Onkel Sonnenschein
Ein Tagebuch.
Ach, die reizenden Zeitgenossen! Wie barmherzig sie einem ins Gesicht lügen. »Vortrefflich sehen Sie aus. In der Tat, Sie sehen – unberufen – viel besser aus als das letztemal! Kein Vergleich!«
Danke schön für die freundliche Erinnerung. Weiß zwar ohnehin, daß ich krank bin.
Mein gütiger Arzt pflegte immer zu sagen: »Schwächliche und kränkliche Leute werden älter als starkgesunde, weil sie auf ihre Gesundheit nicht sündigen.« Seit einiger Zeit bringt er den Trost in anderer Form. »Bei gewissenhafter Diät läßt sich immer noch ein Weilchen gewinnen.«
Wie alt ich bin? Just in den besten Jahren. In den besten! Ich spüre es in allen Gliedern. Mindestens fünfzig Jahre hätte ich noch auf dem Kerbholz, wenn's der Ewigkeit-Herr nicht übers Knie abbricht und ein Kreuzl draus macht. Aber mein eigener Adam will mir untreu werden. Ich hätte ihn zu sehr vernachlässigt, hätte es allfort mit der Seele gehalten. Wenn die Seele lustig sein wollte, habe der Leib Wein trinken müssen und den Katzenjammer bestreiten; wenn der Seele ums Lieben war oder ums Hassen, habe sie Feuer in den Leib geworfen, daß er sich verzehrte. Und wenn sie, diese herrische Seele, in langen Nächten ihre närrischen Gedankenfäden spann und wob, mußte der arme Leib dabei hocken, zusammengekauert, schlafdurstig und gebrochen. Man möge nur einmal andere, etwa vierfüßige Leiber betrachten, die ließen sich derlei Knechtungen nicht gefallen, die stampften mit ihren vier Pfoten das bißchen Seele einfach in den Dreck – basta. Aber, so opponiert der Leib weiter, nun wäre seine Geduld zur Rüste, er wolle zusperren vor Torschluß, und ich könnte mit der obdachlosen Seele gerade einmal davonfliegen, in den Himmel hinauf zu den so begeistert besungenen Göttern oder – anderswohin.
Jeden Tag mehrmals deutet er mir das an, der unliebenswürdig gewordene Körper. Ich glaube, es ist sein Ernst. Zum Satan, mir ist aber die Sache nicht gleichgültig. Ich bin noch nicht satt und ich mag die fragenden Blicke meiner Kinder, das heimliche Flennen meines Weibes nicht aushalten. Was hilft's? Ich will ins klare kommen. Muß es sein, na, Dagobert, dann fangen wir langsam an, einzupacken. Morgen will ich meinen Arzt an der Gurgel packen: Blut oder Wahrheit! Der soll mir nicht auskneifen. Heute will ich mich noch der lieben Unwissenheit freuen. Sie macht ja glücklich, sagt man. Wenn ich dem Spiegel glauben wollte! Diese Grobiane mit den blutleeren Quecksilberrücken zeigen ja allemal um mindestens fünfundzwanzig Prozent zu jämmerlich.
*
Sapperlot, Dagobert, was ist denn das für eine Aufführung? Siebenschläfer! Schickt es sich auch, am Tage der Urteilsverkündung so sorglos zu schlafen? – Mehr als Sterben kann mir nicht leicht passieren. Das dürfte abends mein letzter Gedanke gewesen sein. Das wäre schon gar schön, wenn dieses Leben mit seinen täglichen zehn Plagen kein Ende hätte! Da müßten alle Wissenschaften und anderen kulturellen Kräfte schnell zusammenhalten, um einen ausgiebigen Tod zu erfinden. Das wäre die größte Errungenschaft des Jahrhunderts, der Erfinder des Todes würde unsterblich weiden, und die künftigen Kalender würden eine Zeitrechnung einführen: »Seit der Erfindung des Todes so und so viele Jahre.«
Meinem Doktor Balsam hätte es wohl zuzutrauen sein mögen, wenn ihm nicht Kain zuvorgekommen wäre. Er macht sich ein Vergnügen daraus, dem Patienten, der ihn darum fragt: zu versichern: »Lieber Freund, ich kann Ihnen zu Ihrer vollsten Beruhigung mitteilen, daß Sie keine drei Monat' mehr leben!« Und er hält Wort! Mir ist kein Fall bekannt, daß ein Kranker sich gestattet hätte, das Maximum zu überschreiten. Und zu diesem verläßlichen Mann will ich nun gehen. Wenn er auch heute wieder Hypochonder zu mir sagen sollte, dann schreibe ich mich von jetzt ab: Dagobert Hypochonder, und ein Manupropria dazu, so groß wie der Schweif eines Lindwurms.
*
Ich war schon bei ihm. Ich komme schon zurück. Ich weiß es schon.
Im Vorzimmer habe ich eine volle Stunde warten müssen. Da gab es genügend Zeit zum Sichausschnaufen von der Treppe, die nicht weniger als dreizehn Stufen hat. Meine Mitwartenden hatten es alle so dringend, hineinzukommen und gesund zu werden. »Bitte,« habe ich gesagt, »will schon warten.« Diese Wartezimmer der Ärzte! Jodoformduft, schwellende Sammetsessel und Spucknapf daneben. Und Teppiche, daß sich die Bakterien passabel einnisten können. Alles luftdicht verschlossen, natürlich, weil die lieben Kranken kein offenes Fenster vertragen können und es vorziehen, die ausgeatmete Luft der Mitkranken in sich zu saugen, als den frischen freien Tageshauch zu trinken. Ob das Ordinationszimmer wohl allemal soviel gutmacht, als das Wartezimmer schadet? Auf dem runden Tisch lagen illustrierte Zeitschriften herum, abgegriffen und schmutzig, auch ein alter Jahrgang der »Fliegenden Blätter« war vorhanden. Da kann man sich ja unterhalten. Hätte mich auch. Guten Morgen! sagten seine Schergen, als sie in die Zelle traten, um den Delinquenten zum Galgen zu führen. – Sah der freundliche Doktor Balsam, als er die Tür öffnete, meine werte Person und bedeutete den übrigen höflich, er müsse mit mir die Reihenfolge stören, denn ich wäre nicht in der Lage zu warten.
Im Ordinationszimmer mußte ich mich auf das rote Sofa setzen. Der Doktor steht hoch, stramm vor mir da, stemmt den Arm in die Seite, strotzt vor Behagen. Man sieht es, wieviel Gesundheit der zu vergeben hat. Dann setzt er sich mir gegenüber, legt seine wulstige Hand aus meine abgezehrte und sagt: »Es steht ja recht leidlich, nicht wahr?«
Ich entziehe ihm die Hand, klammere die Finger ineinander und beginne mein banges Anliegen vorzubringen: »Doktor! Ich will auf die Polizei, wo die gefundenen Sachen abgegeben werden. Ich habe meine Geduld verloren. Schon zwei Jahre lang so krank sein –« Da versagte der Atem.
»Sind Sie denn wieder so gelaufen?« fragt er mit aller erheuchelten Einfalt.
»Sie müssen mich heute noch einmal untersuchen, Doktor, und zwar gründlich. Ich glaube – mit mir ist's aus.«
»Ei, warum nicht gar!« lacht er auf.
»Ich will es nun gerade einmal wissen, wie es steht« Ich will mein Haus bestellen.«
»Das soll jeder bestellen und jederzeit bestellt haben. Sie sagten mir doch, daß Sie schon vor Jahren, in gesunden Tagen, das Testament gemacht haben.«
»Sapperlot, ja! Ein Mann mit regelmäßiger Frau, dito Kindern wird viel Testament machen! Dahin stünde nichts mehr im Wege, Doktor. Allein die Familie – sie will vorbereitet sein. Und mich wird die Wahrheit nur stärken, so wie mich die Ungewißheit lahm gemacht hat und noch verrückt machen würde. Helfen können Sie mir nicht, Herr. Alles, was Sie mir tun können, was ich von Ihnen verlange: Prüfen Sie nochmals genau meinen Zustand und sagen mir, wie es steht.«
Er fühlt mir den Puls. Es pocht sein eigenes Blut an den Fingerspitzen, »Sie sind heute etwas aufgeregt. Das Fieber ist mäßig. Entkleiden Sie einmal den Oberkörper.«
Und dann beginnt er das bekannte Spiel. Er klopft an der Brust und horcht. Er klopft am Schlüsselbein, hinter den Achseln, an den Seitenrippen, legt seine bebartete Wange dran und horcht. Kein Wort sagt er. An einzelne Stellen legt er neuerdings sein Blatt und klopft. Ein Mehlsack kann nicht tonloser sein. Er befiehlt, tief Atem zu holen, und legt wieder sein kaltes Ohr an. Dann richtet er sich auf und sagt: »Na!« Sonst nichts. Bei der gebückten Stellung ist ihm das Blut ins Gesicht gekommen.
»Wie steht's?« frage ich etwas kleinlaut.
»Ich kann nur wiederholen, daß Sie sehr acht geben müssen.« »Geben Sie mir Monate? Wochen?«
Da sagt der Doktor: »Und wenn jetzt der gesundeste Mensch vor mich tritt und will wissen, wieviel Lebenszeit ich ihm gebe, so sage ich: »Herr, nicht einen Tag. Das menschliche Leben ist wie ein Schatten, heißt es in der Schrift.«
»Um Bibelsprüche zu hören, geht man nicht zum Arzt.«
»Allerdings muß ich Ihnen sagen, Herr Dagobert, daß Ihr Übel in ein neues Stadium getreten ist. Doch wenn es nicht weiter greift. – Um ein, zwei Wochen, gottlob, handelt es sich noch nicht.«
»Also um Monate?«
Er schweigt.
»Ich danke Ihnen, Doktor. Eine größere Deutlichkeit will ich Ihnen ersparen. Sie können sehen, daß mein Puls jetzt nicht anders geht wie vor einigen Minuten.«
Jetzt springt er über auf den Buchbinder Artor. »Sie wissen, daß der Mann an einem schweren Herzleiden laboriert. Wenn er in vierundzwanzig Stunden noch lebt, so hat die medizinische Wissenschaft einen beispiellosen Erfolg zu verzeichnen. Vierundzwanzig Stunden, sage ich! Dagegen werden Sie noch ein Methusalemalter erreichen.«
Mit diesem Trost war die Ordination geschlossen.
Den Heimweg trat ich durch die Gärten an. Der Herbstsonnentag schlief über den gilbenden Birken, von welchen manches Blatt träumerisch niedertänzelte auf die Astern. Der Herbst tat »Dukatenzählen«. – Nur noch Monate.
In meinem Leben nie hatte ich mich so leicht getragen als auf diesem Gang. Ich fühlte keinen Körper mehr, es war, als ob ich ihn beim Arzt vergessen hätte. Ein paar Bekannte, die mir begegneten, schauten durch mich in die leere Luft, ich glaube, einer ist sogar mitten durch mich hindurchgeschritten und hat über die Gelsen geschimpft.
– Wie ich um die Straßenecke komme, ist in der Wohnung des Buchbinders Artor ein ungewöhnlicher Lärm. Türen gehen auf und zu, und mehrere Kinder weinen laut und so kläglich, daß mir übel wird. Er ist tot, der Vater, der Ernährer. – Nur noch Monate, Dagobert, und auch aus deinem Hause wird ein solches Weinen dringen.
Die Stufen zu meiner Wohnung hinauf erinnerten mich wohl daran, wieviel Erde noch an meiner Seele klebt. Im Zimmer helle Klänge. Das Goldköpfel griff in die Saiten und sang: »holder Mai, du lieber Knabe!« Der größere Junge lauerte über dem Buch: »Mythologie der Hellenen.« Der Kleinste, der mit Mutters Schere aus Papier just einen Altar schnitzte, ließ das Spiel und packte mich jubelnd am Bein, dem zitternden, wankenden. Gepfropft voll ist die Welt vor Schönheit und Freude ... Mein Weib kam mir ruhig entgegen, aber ihr forschender Blick! Diese stumme, flehende Frage – sie ging mir durch Mark und Bein.
»Es ist wie im Juli,« sagte ich, dabei fröstelte mir. »Konrad, höre, Maikäfer bin ich keiner!« Denn der Kleine wollte mir vor Vergnügen über meine Heimkehr das Bein ausreißen.«
*
Der Tag war vorüber. Schon im Bette liegend, verglich ich den Morgen und den Abend – das Nichtwissen und das Wissen. Jetzt erst. Jetzt erst. – Meine Leutchen schliefen in der Nebenstube. Ich rang mit dem abscheulichsten Schmerze, der je seinen Zahn zerfleischend in ein Wesen geschlagen hat. – Sterben müssen! So früh, so lebensdurstig noch. Für immer und ewig von Weib und Kind gerissen. – Und unschuldig! Was hatte ich denn getan, als gelebt? – Wenn ein Mensch den anderen tötet, da durchglüht es die ganze Gesellschaft, und sie rastet nimmer, bis Gerechtigkeit gewaltet hat. Die Richter zittern vor der Möglichkeit eines Irrtums, vor einem Justizmord schreit die ganze Menschheit auf, als wäre sie ins Herz getroffen. Und ein Wesen mit demselben Rechtssinn wird langsam, bei vollem Bewußtsein hingemordet, und fromme Leute nennen das Ratschluß Gottes. Nennen es so, ist ihnen völlig recht und mucksen nicht unter dem Beile der grausamen Henkerin Natur. Man sollte doch lieber das Frommsein lernen anstatt andere Künste. – Die Fäuste wollte ich aufmachen und die Hände zum Gebet zusammenlegen; aber sie krampften sich wieder zur Faust.
Gegen Mitternacht kam der Brustkrampf. Qualvoll – Stunde um Stunde. Aller Trutz, alle Liebe war dahin, das ganze Leben bestand nur aus einem Wunsch: tot zu sein.
Durch die Fenster schien der Mond und legte seinen Silberäther auf das Bildnis meines Großvaters. Das hub leise an zu sprechen: »Du sollst nicht trotzig sein, Kind, der treue Gott ist's, der mit einer Laterne dir den letzten Weg erhellt, während andere, die sorglos hintanzen, plötzlich in die Grube stürzen. Du wirst nicht auf fremden Wegen zusammenbrechen, sondern im Kreise der Deinen einschlafen, du wirst nicht erst lebenssatt und seelenleer sterben, nachdem du schon lange die Leiche an dir herumgetragen. Das Beste hast du gelebt, die sonnige Jugend, die fruchtbare Manneszeit. Um dich vor dem Greisenalter zu retten, führt er dich hinüber so sachte und sanft, wie du jeden Abend einschlummerst. Und noch Gelegenheit zu haben, mit Ruhe und Bedacht zu schlichten, den Verbleibenden manches ratende Wort zu geben, manche Herzensangelegenheit zu ordnen. Dich beängstigt kein möglicher Verlust, dich erregt kein Gewinn. Im müden Körper Seelenfrieden. Sei doch dankbar, Kind.«
Also du meinst, Großpapa, daß ich mir aus dem Sterben ein Vergnügen machen soll. Gut. Ich werde frühen Feierabend halten und vom Sofa aus den Meinen behaglich zusehen. Arbeitet, sorget, kümmert euch, kränket euch – ich tue nicht mehr mit, ich habe jetzt ein wichtigeres Geschäft und bitte, mich nicht zu inkommodieren. Ich will bequem sterben.
Diesen Gesellen muß ich mir einmal recht angelegentlich in die Seele prägen, damit er im nächsten Leben gleich herzunehmen ist. Denn auch der Bildhauer muß in mein Inventar der Ewigkeit. Also halte still, Roderich Steinschnabel, alter Kerl mit den schwarzen Moseslocken und dem zweischweifigen Paulusbart! Das lebenglühende Gesicht mit den breiten Wangenknochen, auf denen immer die zwei sonnigen Scheibchen einer Freude sind. Wenn bei deiner Mutter Tod damals die hellen Tropfen nicht herabgerieselt wären, man hätte die Miene für ein seliges Lachen halten müssen. So vergnügt blüht es um die stattliche Nase und auf der breiten Stirn und um die buschigen Brauen, die wie zwei kühngeschwungene Bärte wuchern. Und dieser immer sprühende Phosphor des Auges! Wenn die Seele losbricht und das ungefüge, oft unklare Wort nicht ausreicht, so spricht er mit seinen Augenflammen, dieser glühende Mensch. Zwei italienische Blutstropfen hat er in sich und eine heidnische Seele. Alles ist gut, lautet sein Bekenntnis, mit Ausnahme von zwei Dingen. Die Steine des Anstoßes sind ihm die fabrikmäßig erzeugten Grabobelisken auf unseren Friedhöfen, und kein Märtyrer kann schwerer an seinem Kreuze tragen, als mein Steinschnabel an den gußeisernen Grabkreuzen trägt. In seinem Skizzenbuche keimt es immer, in seiner Werkstatt wachsen die weißen, heiteren Marmorgestalten, und sein Lebenszweck besteht darin, unsere Friedhöfe mit Schönheit zu schmücken.
»Denke dir, Dagobert!« kommt er heute lachend zu mir herein, »die Baronin hat meine Psyche abgelehnt. Sie wolle mir die Arbeit vergüten, habe sich aber entschlossen, auf die Familiengruft ein Ecce-homo-Bild stellen zu lassen, O Freund, wie anbetungswürdig groß ist doch die Einfalt!«
»Die Psyche wird wohl noch Anwert finden,« will ich ihn trösten.
»Zum Beispiel?«
»Zum Beispiel der Buchbinder Artor. Der wird ja doch auch bißchen ein Grabmal haben wollen.«
»Der Artor? Ist er denn gestorben?«
»Gestern mittag.«
Steinschnabel schüttelt das große mähnige Haupt und sagt nachdenklich: »Merkwürdig, was es doch für Leute gibt. Gestern mittag ist er gestorben, und heute morgen sitzt er am offenen Fenster und putzt seine Brillen.«
»Ich sage dir, gestern mittag ist er gestorben.«
»Und ich sage dir, heute morgen putzte er seine Brillen.«
»Dann ist dieser Mensch pflichtvergessen. Der Arzt hatte ihm keinen Tag mehr gegeben.«
»Dann ist der Arzt ein Schmutzian. Die Tage reichen für alle, und jeder nehme sich ihrer, soviel er tragen kann.«
»Nein, ich hatte doch die Kinder weinen gehört, gestern, als er gestorben war.«
»Dieses Geheimnis will ich dir offenbaren,« sagt Steinschnabel. »Denn das Heulen ist auch anderen aufgefallen. Der Älteste hatte Geburtstag und bekam von der Frau Godl Lebkuchen. Die Hauskatze scheint dem Ältesten wohlgewogen zu sein, wollte den Festtag auch mitfeiern und fraß die Lebkuchen auf. Wie dann die Kinder eiern gehen wollten und nichts mehr da war, haben sie geheult, man kann's ihnen nicht verdenken.«
Muß gestehen, dieses Ereignis hat mich angenehm berührt. Den Lebkuchen will ich ersetzen, und Doktor Balsam irrt sich hoffentlich öfter.
»Wie weit bist du denn mit deiner Psyche?«
Sie kraucht bereits aus der Puppe hervor.«
»Kraucht sie?«
»In einem Monat kann sie flügge sein.«
»Schon? – Höre, Steinschnabelchen, vielleicht machen wir zwei ein Geschäft mitsammen. Wir sprechen noch davon.«
Denn es trat Frau Radegunde ein, mein flachsblondes Gespons mit dem hellen Rundgesicht und dem taubengrauen Kleid. Mein Weib und Steinschnabel sind wie Tag und Nacht. Ein bewölkter Tag und eine sternhelle Nacht. Denn Radegunde ist vielfach bewölkt; wettert's nicht, so regnet's, und regnet's nicht, so tröpfelt's. Wenn sie bisweilen auf zwei Tage zu ihrem alten Vater verreist, so halten es die Kinder und ich wie die Mäuse, wenn die Katze nicht daheim ist, da ist alles erlaubt. Das heißt, auf einer gewissen Ordnung bestehe ich. Wenn zum Beispiel bei Tisch der Konrad oder einer der anderen in die Suppenschüssel steigen will, so muß er vorher Schuhe und Strümpfe ausziehen, daß sie nicht naß werden. Aber nur am ersten Tage geht's so fidel her, am zweiten zählen wir schon sehnsüchtig die Stunden, bis sie heimkommt. Sogar die Dienstmagd wird nervös, wenn sie ein paar Tage die gnädige Frau nicht greinen hört. Der Wind treibt eben die Mühle, und wenn ich allein die Herrschaft führe, so ist nach acht Tagen das ganze Haus korrumpiert. Viel zu gut wäre ich, sagen die Leute; Radegunde weiß das besser – zu bequem bin ich, zu gleichgültig, zu patschig, kurz, um es mit einem einzigen allgemein verständlichen Worte auszudrücken – zu faul. Schleifen soll's, aber treten wolle ich nicht; dieses Sprichwort hat sie vom Scherenschleifer, sowie sie überhaupt gern drastische Bilder aus dem Leben nimmt, um mich zu kennzeichnen. – Nun, das alles war einmal, ist aber leider nicht mehr. Umwölkt ist die flachsblonde Kleine freilich noch, aber es donnert nicht mehr. Wie wenn es leise tauen täte am nebelichten Herbsttag, so ist es. So still traurig, so liebreich mit mir, daß einem angst und bange wird. Ich fürchte, sie weiß alles, ahnt es vielleicht schon länger als ich, wie es mit mir steht. Na, die soll mich erst kennen lernen! Ich mach's wie der Buchbinder und lasse mich von keinem Doktor Balsam, oder er möge heißen wie immer, auf den Kirchhof komplimentieren.
Steinschnabel war langsam von der Bank aufgestanden und hatte ihr mit leuchtendem Aug' entgegengelacht. Sie sagte nur: »Soviel sprechen soll er nicht.« Da gab mir der Freund einen erklecklichen Händedruck, grüßte die Frau mit einem leichten Scherzwort und ging weg.
Sie hat recht, ich spreche zu viel. Wenn sie mein Tagebuch zu Gesicht bekäme, dann wäre es auch dran, daß ich zuviel schreibe. Was bliebe mir schließlich übrig, als zu singen! Sie brummt, wenn ich einmal einen Vierzeiler summe, merke aber, daß es ihr heimlich wohltut. Und vollends scherzen! Sonst ist sie doch ein Feind von Kindereien bei Erwachsenen. Sie denkt wohl, je schlechter der Witz, je besser das Befinden. Und lacht und kraut mir mit zarten Fingern das Haar und lobt mich, daß ich ein liebes Lamm sei und ist so dankbar, daß ich wohler bin.
Ich Hab' sie getäuscht auf muntere Art, Das Klagen mir, ihnen die Tränen erspart. Ich habe des Lebens buntes Panier Noch einmal entfacht mit froher Begier. Doch in den Nächten, einsam und still. Da hab' ich beweint mein verwegenes Spiel. Wie warm mein Leben, wie kalt das Grab –
An dieser Stelle hat sie mir das Büchlein richtig abgefangen, nachdem sie vorher mein Geheimnis Zeile für Zeile über die Achsel her gelesen. Dann ist eins geflennt worden.
Also auch das nicht. Ja, womit soll man sich denn eigentlich die Zeit vertreiben? – Kaum ein paar Monate noch, und die Zeit sich nicht zu vertreiben wissen. Welch ein Unglück, wenn Doktor Balsam mir hundert Jahre verschrieben hätte!
Eigentlich eine recht lange Zeit gab's, da ich unseres Herrgotts Spaß nicht verstanden habe. Das Leben, ich hatte es schrecklich ernst genommen. Mit grausamer Wichtigmacherei habe ich die kindischen Pläsierchen genossen oder ihnen nachgejagt, schwitzend und keuchend. Konrad, kleiner, mit deinem Seifenblasenspiel betreibst du ein viel vernünftigeres und sachlicheres Lebensglück, als ich es getan. Denn du plagst dich nicht dabei, freuest dich redlich an den bunten Kugeln, weißt, daß es Seifenblasen sind, und freuest dich sogar, wenn sie zerplatzen. »Wenn ihr nicht werdet wie die Kindlein!«
Ja, ja, bibelfest, das bin ich. Der Mensch braucht notwendig wie das Stück Brot einen Herrgott, dem er die Schuld geben kann, wenn er selber dumm ist. Freilich ist es einem gescheiten Herrgott schwer zu verzeihen, wenn er dumme Menschen erschafft – ich hätte, meint der Bildhauer, nämlich gerade noch so viel Religion, daß sie knapp ausreicht, um Gott zu lästern.
Die Stimmungen fliegen wie die Wolken im Herbstwind. Und schwankende Rohre, sagt Steinschnabel, brechen nicht« Jetzt frostiger Schatten, jetzt wieder Sonnenschein. Und wenn nur die Schmerzen schlummern, will man schon jauchzen vor lauter Wohlbefinden. Das Kranksein, so empfinde ich's in diesem Augenblick, hat auch sein Gutes. Mancher genießt das Leben nur halb, solange er es ganz hat, und genießt es erst ganz, wenn er's nur halb besitzt.
Eben läuten die Glocken für den Buchbinder. Diesmal ist es nicht die Katze, diesmal ist es der Tod. Doch schön, wenn man sich auf einen Arzt verlassen kann.
Und mich will er auch schon fort haben, der liebe Doktor Balsam. Die Riviera, meint er, oder wenigstens Arco am Gardasee, Den Winter über. Da habe ich ihm heute bedeutet: »Gelehrter Herr! Wenn Ihr keine anderen Anekdoten mehr wisset, als wie man einmal einen Todkranken in die Fremde geschleppt hat, damit er dort in einem Hotelzimmer unter Kellnerfräcken ruhig versterben kann, dann – mit Verstattung – seid Ihr mir nicht mehr ergötzlich genug.«
Ich hätte ihm noch gern mehr und Erklecklicheres gesagt, da setzte sein Verbündeter ein, der Brustkrampf, und erstickte die Sachen, die ihm vermeint gewesen.
Später unterhielt ich mich mit Radegunde über das merkwürdige Begräbnis des Kommerzienrates. Und unser kleiner Konrad setzte sich seine größten Augen ein – der will sie sicherlich wieder nachahmen, die erhabene Feierlichkeit. – Hundert Leute in auswendiger Trauer, die »Pompfunebre« mit dem Leichenwagen aus Sammet und Spiegelglas, sechs Rappen daran mit Silberbeschlag, auf den Rappen sechs schwarze Reiter, mit Silber betreßt. Die hohe Geistlichkeit im Trauerornat. Beflorte Sänger und Musikanten, drei Kranzwagen und was eben alles dazu gehört, um einem Kommerzienrat ins Grab hinein das Kompliment zu machen. Nur eine Kleinigkeit fehlte. Aus Versehen war an einer Bahnstation der Waggon abgekoppelt worden, in dem der Sarg stand, und so hat sich zu dem feierlichen Begräbnis die Leiche nicht eingefunden. Ner Herr Rat hatte nämlich auch die Mode mitgemacht, nach Italien sterben zu gehen, wie man dahin seine Hochzeitsreise tut, und so hatte er nun auf dem Rückweg den Anschluß versäumt.
»Ist es euch ein Vergnügen, dann können wir's auch so machen.«
Radegunde gab mir eins – ein ganz leichtes – auf die Wange und kramte am Nähtisch herum. Da merkte ich, wie die Sterbenden unbarmherzig sind. Es wird schwer halten, mit ihr das Notwendige zu besprechen. Da wird Steinschnabel mittun müssen.
*
Was dies Leben mir beschieden, Es war gut, ich bin's zufrieden. Könnt ich eines noch erwerben: Nur daheim, daheim zu sterben. Nicht auf fernen Wanderswegen Möcht ich mich zur Ruhe legen. Nirgends auf der ganzen Erde Als daheim am eigenen Herde.
Vor des Todes grausen Schrecken Will ich nimmer mich verstecken. Wenn aus Augen, schmerzbefeuchtet, Liebe mir zu Bette leuchtet. Wenn die Meinen mich umgeben, Atmend mein entschwindend Leben, Und aus gottergebnem Sterben Meines Herzens Frieden erben.
»Das gefällt mir recht gut,« sagte Steinschnabel, als ich ihm dieses Gedicht zu lesen gegeben, »nur in der achten Zeile hapert's, da hast du eine Silbe zuviel gespendet.«
Ich war nachgerade empört. Erst später kam es mir, daß er mit der Versmesserei die Rührung wird haben verbergen wollen. Denn dieser Schwächling kann keine Traurigkeit vertragen. Und ich? Ich weiß mir oft gar nichts Lustigeres, als traurig zu sein.
*
Bisweilen sieht man in der Nacht mehr als am Tage. Sie kommen alle, die Gedanken, denen lebensfrohe Leute auszuweichen pflegen, und die Bekannten, die vor uns schlafen gegangen sind. Sie machen ihre Einladung. Frau Hofrat muß auch jetzt noch ihre Schleppe haben und zerrt das Bartuch nach, und mit dem Japanischen fächelt sie gar kokett, dabei mit Recht ihr Antlitz verdeckend. Und draußen auf dem Meere gleiten die unzähligen Schiffe der ewigen Dunkelheit zu.
O Nacht, du heilige Urwesenheit! Wenn Gottes zornige Hand einst die Ampeln vom Himmelsgewölbe reißt, was vor allen Lichtern war, wird nach allen Lichtern sein – die Nacht. Der schlaflose Kranke in dunkler Stube hat Gelegenheit, sich bei Zeiten mit ihr vertraut zu machen.
*
Allerseelen! Ich bin auf den Friedhof gefahren zu meinem Grabe. Vom Eingange die Ecke links. Heute wildes Gekraute, vom Reif welk gesengt, wie gekocht auf der Erde liegend. Wenn wieder Allerseelen kommt, wird hier ein schönes Blumenbeet sein, in blauen Glastulpen brennende Kerzen. Davor kniet eine junge, schwarzgekleidete Frau, mit schwarz behandschuhter Hand ein weißes Tüchlein ins Gesicht pressend. – Dann kommen die Kinder, daß sie auch ein Vaterunser beten sollen. Mit munteren Augen und frischen Wangen denken sie dabei an Roß und Wagen, an Taschenfeitel und Mundharmoniken und an die Weidengerten, die sie sich auf dem Heimweg schneiden werden. – Ob die Seele nicht hinüberspringen könnte vom modernden Leib auf den leblustigen Knaben? Vielleicht. Fliegt nicht auch der Vogel, wenn der Baum umgehauen wird, auf einen anderen über? Wahrscheinlich stehe ich dann selbst an meinem Grabe und denke: da unten ruht mein Vater.
Wie es auch sei, am besten, daß es nicht nach Menschenwitz und Menschenwillen geht – da wäre es sicherlich verfahren.
*
Heute bin ich zum Steinschnabel in die Werkstatt gefahren. Denn die Nacht war wieder schlimm gewesen, aber ich will die Plagen nicht immer aufschreiben, sie graben sich schon selber ein. Das stete Sandbrünnlein in der Uhr rieselt ganz zart, und doch schüttert davor mein ganzer Leib, als stünde er an einem donnernden Wasserfall.
Die Hammerschläge der Steinmetze klingen, und ich stehe mitten im Olymp. Die Weißen Göttergestalten ringsum warten nur auf ein schönheitsfrohes Geschlecht, um herauszutreten ins Leben, in die Kirchen und Tempel, auf die Straßen und Friedhöfe. In einem besonderen, lichten Raum mit Glaswänden arbeitet der Meister. Er hat den grauen Linnenkittel an und das weiße Käppchen auf, unter welchem zu allen Seiten das Löwengelock hervorquillt, grau vor Gipsstaub. Er steht an seiner Psyche, der Mädchengestalt mit den Schmetterlingsflügeln. Alle Sprödigkeit des Materials ist überwunden, in leuchtender Schönheit, zart und schmiegsam schwebt sie, man glaubt Wärme aus diesen Gliedern hervorströmen zu fühlen.
»Ich brauche sie nur zu küssen,« sagt Steinschnabel, »und sie ist lebendig.«
Er wurde bei dieser geplanten Lebenserweckung leider gestört. Obschon die Steinmetze im Vorraum laut riefen, der Meister sei augenblicklich nicht zu sprechen, trippelte es doch herein, das Blondlockel. Ein kleines Herrchen war's, die nagelneuen, gestreiften Hosen an den Knöcheln waren aufgestülpt, aus den kurzen Hemdärmeln standen weit die steifen Manschetten mit mächtigen Perlmutterknöpfen hervor, der hohe Hemdkragen schraubte den kleinen, wohlrasierten Kopf empor. Auf dem Näschen ritt ein goldener Zwicker. Das ganze eckige Kerlchen schaukelte ein wenig. Mit seitlings gehobenem und rechtwinklig gekrümmtem Arm reichte er die Hand und näselte: »'n Tag, Meister, 'n Tag!« Und dann begann er Spreu zu sprechen, kurzgehackten, spießigen Spreu. Das Korn darin war, daß er ein schönes, sinnreiches Grabmal wünsche für seine verstorbene Schwiegermama. Er denke sich aufs Grab schwarze Marmorplatte, weißes Hautrelief: lebensgroßes Totengerippe mit Hippe und Sanduhr.
»Kolossal sinnig, nicht wahr?«
»Für Frau Schwiegermama. Gewiß,« spottete mein Steinschnabel, und sein Auge blinzelte unter dem Busch. »Gut, will die Arbeit besorgen. Der Stein soll wohl recht schwer sein?«
»He, he. Charmante Dame gewesen,« lächelte der Herr, Damit war das Geschäft abgemacht.
Als das Gigerl davon war, sagte ich zum Meister: »Mensch, wie kannst du eine solche Arbeit übernehmen?«
»Ich habe sie ja nicht übernommen,« lachte Steinschnabel. »Dieses lebensgroße Totengerippe werden meine Lehrjungen herstellen.«
Die »charmante Dame« hatte dem Herrn Schwiegersohn nämlich eine halbe Million hinterlassen. Nicht jede Schwiegermama ist so liebenswürdig. Doch begreift man, daß auf solch ein Grab nicht etwas Sinnbildliches taugt, das durch einen Kuß lebendig wird.
»Schnabel,« sagte ich endlich, »weil wir schon bei Sanduhr und Hippe sind, ich komme heute mit einem großen Anliegen zu dir. Die Sache – du gestattest schon, daß ich mich auf den Balken setze und an die Wand lehne,« denn mir war zum Umsinken. »Die Sache ist die. Ich habe, wie du weißt, drei Kinder.«
Er zählte lustig an den Fingern ab: »Richard – Konrad – Frida. Es stimmt.«
»Nun höre. Ich tue nicht lange um, Freund. Meine Kinder werden einen Vormund brauchen. Wen soll ich mir denken als den Beschützer meiner Familie? Es kann kein anderer sein als du.«
Er hatte sich mir gegenübergesetzt, trommelte mit den Fingern auf dem Balken, schaute mich an und sagte: »So, so! Hm, hm!« Und setzte ruhig und leise bei: »Wann erwartest du denn schon?«
Diese Bemerkung in dieser Form machte mich verwirrt, da verbesserte er sich rasch: »Ah, ja so! Ich bin zerstreut. Dachte an Gevatterschaft.«
An die Mauer hingesunken, trocknete ich mir mit dem Taschentuch die feuchte Stirn: »Du siehst ja, wie es mit mir steht.«
Er faßte meine Hand. Das Feuer seines Auges glühte warm auf mich her. »Dagobert, wenn es dich beruhigt: Wo du mich brauchen kannst im Leben oder im Tod, ich stehe zu deiner Verfügung. Hast du aber in dieser von dir bemerkten Angelegenheit mit deiner Frau gesprochen? Ich meine, ob es ihr wohl recht sein würde? Mir scheint nämlich, und du mußt es ja auch schon wahr getan haben, daß der Bildhauer Steinschnabel nicht ihr besonderer Günstling ist.«
»Ach Gott, Roderich, du kennst ja ihre Art. Allerdings, der Sache wegen gesprochen habe ich mit ihr noch nicht. Wenn ich vom Sterben rede, da hält sie mir nicht stand, da zankt sie, daß man Gott nicht versuchen solle, und behauptet, daß ich sie weit überleben würde. Wenn sie wüßte, was mir der Arzt gesagt hat! Glaubt ihr denn, ich hätte nicht den Drang, mich darüber auszusprechen? Ihr müßt es doch so gut wie ich selbst merken, was es bei mir geschlagen hat. Was soll denn diese verdammte Vertuscherei! Verneint mein Leiden, wenn ihr könnt, mir ist's recht, ich lebe gern, Gott weiß es. Und wenn ihr das nicht könnt! Laßt mich die furchtbare Wahrheit doch nicht so allein tragen!«
Weil ich keuchend und mit gerungenen Händen vor ihm niedersinke, so richtet er mich erschrocken auf: »Um Gottes willen, Dagobert, welche Erregung! Deine lebhafte Phantasie –«
»Laß die Phantasie. Höre, was Doktor Balsam gesagt hat. Er tat's auf mein Bitten, nach einer gewissenhaften Diagnose. Weißt du, was er gesagt hat? Daß ich nach zwei Monaten sterben muß.«
»Das hätte er dir gesagt?«
»Der eine Monat ist schon vorüber.«
»Verzeihe, lieber Freund,« sprach hierauf Steinschnabel, »so redet kein Arzt zum Kranken. Er mag gesagt haben, daß dein Leiden noch ziemlich lange dauern kann, daß es überhaupt schwer heilbar sei, ja daß man unter Umständen gefaßt sein müsse, schon in wenigen Monaten das Los aller Erdenkinder –«
»Und das ist nicht genug? Ist es nicht genug, wenn der Arzt so zum Kranken spricht? Ein Tor, der's nicht versteht.«
»Übrigens,« sagte der Bildhauer und legte seine Hand auf die meinige. »Es ist ja nicht zu leugnen, daß du krank bist. Aber ist denn noch nie ein Schwerkranker gesund geworden? Hat sich noch nie ein Arzt geirrt?«
»Darum,« war mein Geständnis, »habe ich die letzte Hoffnung auch noch nicht aufgegeben. Ohne jeden Funken von Hoffnung lebt selbst der Resignierteste nicht einen Tag. Weil es aber weitaus wahrscheinlicher ist, daß mein Leiden gewöhnlichen Verlauf nimmt, so muß ich eben mein Haus bestellen. Und du sollst mich beruhigen und sagen, daß du im Fall meines Todes die Vormundschaft über meine drei Kinder übernimmst.«
Er drückte mir frisch die Hände: »Abgemacht.« –
Es ist ja nicht zu leugnen, daß du krank bist. Auch der Schnabel sagt's. Na ja. Schwerkranke, die im Bette liegen, das ist in Ordnung. Aber Schwerkranke, die umherwandeln wie ein Schatten ohne Mann, das sind Gespenster.
Allerlei muß der Mensch lernen, seines Fortkommens wegen, warum nicht auch die Kunst zu sterben. Der richtige Kursus dauert achtzig oder neunzig Jahre lang. Dann kann man's und schickt sich willig drein. Mancher Arme, Verlassene kann es schon früher, obschon es für ihn auf Erden immer noch zu hoffen gebe, während beim blasierten Reichen alles aus ist. Nicht leben können und nicht sterben wollen – das muß eine Hundeexistenz sein. Ich hätte noch soviel zugute gehabt.
Und immer solche Gedanken! Seltsam, daß bei einer Aufbahrung das Vorzimmer unheimlicher ist als der Raum, wo die Leiche liegt. Und daß an einem Toten die Kleider das grauenhafteste sind. Also nur das Drum und Dran.
In meiner Kindheit machte es mir den größten Spaß, Gestorbene anzuschauen und Leichenbegängnisse mitzumachen. Die Totenschädel auf dem Traueraltare lachen so lustig. – Das ist die göttliche Einfalt des Kindes. Später ist man »tief gerührt« oder gar »erschüttert«. Und man jammert sich in eine flotte Desperation hinein, die eher ein Vergnügen als ein Leid genannt werden könnte. Es kommt nicht selten vor, daß Fernerstehenden ein Todesfall viel ungeheuerlicher erscheint als den nächsten Angehörigen. Und daß sie sich dann ordentlich wundern, diese in ruhiger Gelassenheit zu finden. – Wo also ist die Schrecknis des Todes, wenn nicht in nächster Nähe?
»O Tod!« rief jener Pfarrer aus bei der Leichenrede, »o Tod, wo ist dein Stachel?«
Ein Handwerksbursche, der sich hinter dem Strauche barg, antwortete: »Lassen Sie das, Hochwürden. Wir brauchen es nicht zu wissen.«
*
Es ist Winterszeit, und ich komme rasch zur Tiefe. Der Gang durch die drei Zimmer bedeutet eine Fußreise, vor deren Antritt ich das Testament machen würde, wenn es nicht schon geschehen wäre. Die Füße wollen den Körper nicht mehr tragen, und er ist doch so leicht geworden. Schwer ist nur das Herz.
*
Wenn ich des Morgens erwache, fällt mein Blick auf das marmorne Haupt meines geliebten Friedrich Schiller, den ich mir nicht als Greis denken kann. Wer jung stirbt, hinterläßt der Welt ein ewiges Bild der Jugend.
Mein Sterbezimmer hat mir die Radegunde schon vorwegs ausgestattet mit schönen Bildwerken, mit grünen Blatt- und Nadelsträuchern, mit frischen Blumen.
»Mitten im Dezember ein Garten, der auf die Bahre wartet.« Das Wort muß mir entschlüpft sein, denn nun brach das Wetter los. – Ob ich denn alles mißdeuten müsse? Dieweilen sie mir das Zimmer angenehm machen wolle, glaube man, sie bereite schon auf den Tod vor? Ob sie denn noch nicht genug gepeinigt sei? – Und weinte zum Herzbrechen. – Da habe ich zu mir gesagt: Schlechter Kerl! Tut sie nicht alles, daß dir wohl sei, daß du getröstet seiest? Fällt nicht durch die Fenster Luft und Sonnenschein, aber so, daß mein Haupt beschützt bleibt? Rückt sie mir nicht täglich hundertmal die Kissen, die Sessel zurecht? Stehen nicht beständig Labsale bereit? Kommt eine Zeitung, ein Buch unaufgeschnitten auf den Tisch? Verliert sich ein Sacktuch, ohne daß ein anderes schon bereit ist? Und trällert sie, die sonst so ernste, nicht ein heiteres Liedel, während sie vielleicht aufschreien möchte vor Bange? – Und du? Du wirst nicht müde, sie zu quälen mit deinen Todesphantasien. Hast du nicht in niedrigsten Volksschichten Familienväter gesehen, die sterbend noch die Ihrigen beruhigen und trösten und bis zum letzten Atemzug leugnen, daß sie sterben. Jämmerlicher Mitleidshascher! Wo du froh sein solltest, daß dein tapferes Weib nicht mit Klagen, vielmehr mit stetem Sorgen und Wohltun ihr Mitleid beweist!
Heute. Sie meint, ich schlafe, rückt mir leise die Klingel nahe und entfernt sich auf Zehenspitzen ins Nebenzimmer Zu ihrem Nähtisch. Aber ich wache und rufe: »Gunde!«
Sofort ist sie am Bette.
»Wo sind die Kinder?«
»Richard und Frida sind in der Schule,« berichtet sie.
»Und Konrad?«
»Der? Ich weiß nicht. Ich glaube, im Stöckel ist er.«
Das Stöckel ist eine Art Gartenhaus und Rumpelkammer, wo Geräte aufbewahrt sind und alte Gewandtruhen stehen.
»Was macht er im Stöckel? Er wird sich erkälten.«
»Weißt du, er ist ein guter, dummer Junge. Von der Kirche hat er's –«
Da klingelt es. Ein angenehmer Besuch. Der Steuerbote. Er bringt eine Vorladung. Es sei im Einbekenntnis wieder einmal was nicht in Ordnung. Möglich! Ich habe bei dem letzten Einbekenntnis gleich die Betriebskosten des kommenden Jahres abgezogen, fünfhundert Kronen fürs Begräbnis. Daran haben die Herren natürlich wieder was auszusetzen.
»Frau,« sagte ich nachher. »Ich werde den Steinschnabel bitten müssen, daß er für mich den Gang macht.«
Weil sie darauf nichts sagt, sondern sachte mein Gewand herrichtet, falls ich das Aufstehen versuchen wolle, so fahre ich fort: »Sage mir einmal, Gunde, hast du gegen den Schnabel etwas?«
Die Hosen über den Arm gelegt, steht sie da und schaut mich an. »Ich? Gegen den Bildhauer? Wie meinst du das?«
»Ich meine, weil wir ihn noch öfter zu brauchen haben werden. Ein herzensguter Mensch. Man kann sich auf ihn verlassen. Man kann ihm schon was anvertrauen. Ich sage dir, Gunde, der Schnabel ist ein braver Kerl, durch und durch!«
Fast betroffen antwortete sie: »Mein Gott, das hat ja niemand bestritten.«
»Siehe, das freut mich, Weib, daß du nichts gegen ihn hast. Ich meine, daß er dir nicht zuwider ist. Möglich, daß wir ihn vielfach brauchen werden. Wenn's mit mir noch lange so fortgeht – es dürften uns auch Veränderungen nicht ganz unvorbereitet treffen. Wenn ich einem meine Familie anvertrauen wollte, so wäre es der Schnabel.«
»Nun gut,« sagte sie, »wenn du stirbst, so soll Steinschnabel der Kinder Vormund sein.« Und ging zur Tür hinaus.
Hart und kalt wie Eisen hat mich das Wort getroffen. – Habe ich es nicht selber hervorgelockt? Kranke sind Egoisten, aber solche, die nicht mehr wissen, was sie wollen.
*
Weil der kleine Konrad heute wieder im Stöckel war, so wollte ich doch einmal sehen, was er dort treibt. Das muß ein besonderes Kinderspiel sein! Eine Beschäftigung, die ihn den Frost nicht fühlen läßt.
In den großen Filzpatschen und dem langen Schlafrock aus Wolle, den mir meine Gunde genäht hat, siffelte ich hinüber.
Unterwegs im Hof begegnet mir Richard, der gerade aus dem Gymnasium kommt, bei meinem Anblick hinter der Ecke abbiegen will, endlich aber doch auf mich zugeht. Er hat ein krebsrotes Gesicht und reibt mit der Faust an den Augen herum. Er getraue sich nicht zur Mutter, sie werde ihm das Mittagsmahl entziehen und Strafaufgaben verordnen. Denn er habe wieder einen Zensurschein bekommen.
Wacker, Junge! Nur gesunde und aufgeweckte Knaben bekommen Zensurscheine. Aus einem fleißigen Schüler ist noch selten ein bedeutender Mann geworden. Genies waren stets leichtsinnige Studenten. Nur so fort, junger Mann! – Just laut ausgerufen habe ich diese pädagogischen Grundsätze nicht, aber gedacht habe ich sie mit aller Redlichkeit. »Gib her den Wisch!« sage ich und stecke ihn in die Tasche. »Ich werde ihn schon unterschreiben.«
Er hüpft munter davon, und ich habe ihm wieder einen Tag der seligen Jugendzeit gerettet. Im Griechischen hatte der Junge das Malheur. Daß doch ein siebenfaches Blitz-Kreuz-Donnerwetter dieses verdammte Griechisch einmal aus unseren Schulen hinausfege!
Über die Schulnot der Kinder habe ich mich ja immer getröstet. Die Schwerlernenden sind gewöhnlich selbständige Naturen, für äußere Einflüsse wenig empfänglich. Leute, die mit der Theorie nicht viel anzufangen wissen, sind die eigentlichen Tatmenschen. Ich glaube, Richard ist beim unrichtigen Tor hinein. Er gehört in die Realschule.
Steinschnabel wollte sogar, daß dem Knaben, nachdem ihm schon einmal das Leben geschenkt worden sei, auch die Jugend geschenkt würde. Man soll, ist seine Meinung, die zwölfjährigen Knaben in den Wald hinausjagen, wo sie sich selber ihre Nahrung und ihre Felle erjagen müßten. Dabei würden sie tüchtiger als auf allen papiernen Hochschulen und wüßten, was Leben heißt. Das wird nicht wahr sein. Ich bin ein ganz papierner Mensch und weiß doch, was Leben heißt. Allerdings erst, seit es sterben heißt.
Wie glücklich ist doch noch der Konrad in seinem achten Lebensjahre! Aber im Stöckel ist es mäuschenstill. Ganz leise öffne ich ein Spältchen die Tür, um zu gucken, worin denn der Knabe so vertieft sein könne. Nun, da habe ich's gesehen. An der Wand über der alten Truhe steht hübsch aufrecht eine Blechpfanne. Sie wird meinen Vorfahren die Schmalznocken geröstet haben, ist aber jetzt vom Rost zerfressen. Auf dem schuppigen Boden dieser Pfanne ist mit Kreide eine Figur gezeichnet, eine Art Dreieck mit zwei Ringlein an der oberen Ecke. In den Ringlein Punkte, Augen, Nase und Mund darstellend, und das ganze eine Kopie der Maria mit dem Christkind von Zell. Auf der Truhe an beiden Seiten der Pfanne zwei brennende Kerzen. Zwischen diesen ist noch ein mit dem Sacktüchlein verhülltes Geheimnis. Und davor steht mein Konrad im Priesterornat aus Goldpapier. Die Arme leicht ausgestreckt, murmelt er Gebete. Tief versunken in seine Andacht. – Jetzt hob er sein verzücktes Auge zur Pfanne empor, jetzt machte er eine tiefe Kniebeugung, jetzt zog er feierlich das Sacktuch weg, und was enthüllt dastand – es war die Pfefferbüchse von der Küche. Als dieses geschehen war, faltete der kleine Zelebrant die Händchen und sprach leise und langsam: »Heilige Maria, Mutter Gottes! Lasse uns unseren lieben Vater wieder gesund werden!«
Da wäre ich wohl am liebsten hingestürzt und hätte ihn an die Brust gerissen. Nein. Leise habe ich die Tür wieder angelehnt, dann bin ich niedergekniet im Schnee, und wie der Knabe drinnen für den Vater die Messe las, so hat hier der Vater ein Gebet getan zu dem allmächtigen Gott für das Kind.
*
Es ist doch eigentlich merkwürdig, daß der eine stirbt und der andere leben bleibt. Dieser sieht jenen daliegen, eiszapfenkalt auf dem Schragen und frißt sein Heu mit demselben Appetit als früher, solange noch ihrer zwei waren. Die Liebe, wenn eine vorhanden ist, tut einen Schrei, im übrigen getröstet er sich und denkt an seinen Vorteil. Täglich Todesnachrichten, Leichenzüge, links und rechts sinken sie hin, die Bekannten – der Überlebende trottet seine gewohnten Wege und bleibt der windige Kleinigkeitskrämer.
Das alte Ehepaar im dritten Stock. Sie hatten doch achtundvierzig Jahre lang füreinander gelebt. Er ringt mit dem Tode, die Frau hockt weinend daneben, muß zuschauen bei seinem Sterben und kann nicht helfen. Sie hatten stets ihre gemeinsame Liebe und ihr gesondertes Geld im Kasten. Nun sehe ich rabenschwarz, Gott verzeihe mir! – Sie labt ihn mit Essig, betet laut und merkt, daß sein Leib sich krampft und sein Auge starr wird. Sie eilt zur Lade um das Sterbelicht, da kommt ihr zufällig sein Kassenschlüssel in die Hand. Da ist er, denkt sie, für alle Fälle, und verbirgt ihn in ihrer Tasche. Dann krampft sie ihm das Kerzenlicht zwischen die Finger und horcht, ob er noch atmet. Als es aus seinen Mundwinkeln hervorschäumt, stockt ihr Gebet. Dann fährt sie mit dem Tuch über sein Antlitz, da sind auch gleich die Augenlider zu. Sie horcht. Nichts mehr. Sie huscht eilig zu seiner Kasse. Die Leiche ist noch kaum kalt, so nahen die Notare. Der Staat wie die Familie haschen mit gleicher Gier nach dem Glücksfall, und eins sucht das andere zu überlisten. Ist es gut bestellt, dann kommt die pompöse Trauer. Er war so gut, sie sind ihm so dankbar und können sich verlassen auf den Tod, der keinen wieder aufwachen läßt. – Nein, ein solches Totsein möchte ich nicht erleben.
Der Himmel hat mich vor dem Unangenehmsten behütet – als reicher Mann zu sterben. Es muß eine wahre Kalamität sein, das, was man mit Sorgen erworben, mit Schmerzen geliebt hat, von dem man weiß Gott was für Freude und Lust erhofft hat, auf einmal fremden Klauen überlassen zu müssen. Vor dem letzten Beraubtwerden schützt keine Polizei. Und nicht zu wissen, ob die klagenden Hinterbliebenen Freudentränen weinen oder Trauertränen lachen. Bei den Armen geht es redlicher her, wird geweint, so ist es echt, wird gelacht, so ist es auch echt – und der im Sarg ist stillvergnügt.
Wenn man nur schon so weit wäre! Wenn bloß einmal das mit dem Schnabel in Ordnung ist!
Mein Testament. Es sind herzensgute Worte drin, und doch – und doch – Ziffern wären besser. Gott und der Schnabel, die werden's schon machen.
*
In der Jugend studiert man Erwachsene, um klug zu werden. Im späteren Leben studiert man Kinder, um glücklich zu werden. Mein Siechtum gibt mir Muße, von der Einfalt Weisheit zu lernen. Wenn das Kind eines zerbrochenen Spielzeugs wegen weint, so können wir lachen. Das ist Überlegenheit. Wenn die Flammen auf unseren Dachfirsten prasseln, so jubeln die Kinder. Das ist auch Überlegenheit. Werdet wie die Kinder. Und steht es nicht irgendwo geschrieben, daß der Umgang mit Kindern gesund machen kann? Die Welt bedarf Männer, das Haus Kinder und der Sterbende lechzt nach einem Jungbrunnen.
In gesunden Tagen habe ich an meinen Kindern viel gesündigt. Die Kleinen wollten zu mir. »Kinder, ich habe keine Zeit!« Sie wollten mit mir spielen. »So laßt mich doch, es kommt Besuch!« Sie bitten, daß ich ihnen Märchen erzähle. »Aber Rangen, ihr seht ja, daß ich schreibe!« Immer für Fremde, nie für die, deren Kreis noch so klein ist, die niemanden haben als Vater und Mutter. Auf den Abend werden sie vertröstet. Sie bestehen darauf mit hartnäckiger Sehnsucht. Der Abend kommt. »Ich bin müde, und ihr gehört ins Bett! Am Sonntage wollen wir miteinander spazieren gehen.« Sie ergeben sich betrübt, zählen die Stunden bis zum Sonntag, bauen so zuversichtlich auf das Versprechen, als ob sie noch nie getäuscht worden wären. Am Sonntage wird man von Bekannten zu einem Essen geladen und sagt zu. So betrügst du das Kind um dich und dich um das Kind. Man kann unter einem Dache wohnen und doch um mehr als ein Weltmeer voneinander getrennt sein. Schicke deinen Sohn nach Australien, und du wirst die Bande, die dich an ihn knüpfen, inniger fühlen, als wenn euch eine zolldicke Zimmertür trennt. Freilich ist die Tür nur dünn, aber sie geht nicht auf. Eltern sind ihren Kindern lange nicht immer so treu, als sie glauben. Auf einmal sind diese erwachsen, und jetzt geht das Verwundern an über das Entfremdetsein der Kinder und daß es überhaupt keine Kinder mehr gebe.
Frida, das Mädel, ist stets die kleine würdige Schwester. Sie bemuttert die Knaben, brummt mit ihnen; ist anderseits wieder bereit, die Sünden der Brüder auf sich zu nehmen, wenn ein Strafgericht droht.
Von meiner Seite droht selten eins. Selbst als vor einigen Tagen die Gebrüder Dagobert gemeinsam eine Katze totwürgten, empfand ich zwar das Bestialische dieser Tat, polterte auch einige Flüche und Sittenregeln hervor, aber eigentlich zornig konnte ich nicht werden. Manchmal lechze ich nach einem jener Zornausbrüche, die in früherer Zeit mich oft so sehr erleichtert und erfrischt haben. Aber es glüht nichts mehr.
Radegunde jagte die Katzenmörder dreimal ums Haus herum, warf ihnen dann einen alten Handkorb nach, in dem sie das Tier zum Abdecker tragen sollten. Sie weigerten sich, es zu tun, sie vermochten eingestandenermaßen ihr Opfer nicht anzusehen, ein richtiges Verbrecherschauern ging über ihre Rücken.
»Ihr bösartigen Buben!« rief die Mutter ihnen zu, »als Merks werdet ihr mir drei Wochen lang täglich um diese Stunde ein Vaterunser beten!«
»Für die Katz?!« rief Steinschnabel dazwischen, der dem Auftritt beiwohnte. »Darf ich mich in den Handel mischen?«
»Und ob! Du bist ja künftig der Erzieher.«
»Ihr werdet die Jungen doch nicht mit dem Gebet des Herrn strafen wollen! – Laßt mich machen!«
Er rief die Knaben vor. Und welch eine Miene! Das Sonnenleuchten seiner Augen wurde zu förmlichen Blitzen, die jeden Augenblick einschlagen konnten. »Warum habt ihr das arme Tier getötet?«
Sie schwiegen, ließen die Köpfe hängen. Sie wüßten nicht warum.
»Böse Buben! Zur Strafe werdet ihr eine ganze Woche lang das Vaterunser nicht in den Mund nehmen. Verstanden das?«
Sie huben an zu brüllen. Konrad, der gewohnt war, allemal vor dem Schlafengehen mit frommer Innigkeit das Vaterunser zu beten, kniete nieder: »Lieber Onkel, verzeihe uns!«
Der Onkel wandte sich mit strenger Miene ab. Und zu uns: »Auch die Alten können sich's merken und es gelegentlich ihrem Beichtvater erzählen.«
*
Also ist es, daß mir die Krankheit meine Kinder näher führt. Aber mein Zustand scheint ihnen selbstverständlich, und sie haben keine Traurigkeit.
Gestern kam Onkel Steinschnabel – jetzt ist er natürlich schon immer der Onkel – und brachte dem Konrad ein sonderbares Spielzeug mit. Eine Sanduhr. Bei einem Antiquitätenhändler soll er sie erstanden haben, er bedurfte sie als Modell zur Sanduhr am Denkmal für jene »charmante Dame«. Das Dinge hat sehr zierlich geschnitzte Säulchen aus Elfenbein und zwei Glastrichter, die mit den engen Ausmündungen aneinanderstehen, so daß der feine, gelbe Sand, der im oberen Trichter ist, durch den engen Hals in den unteren läuft. Der Knabe hatte das laternenförmige Ding, das an allen acht Ecken mit niedlichen elfenbeinernen Totenschädelchen geziert ist, auf den Tisch gestellt und betrachtete den lebendigen Sand. Oben am Rande wie in der Tiefe rieseln die Körnchen ineinander, unversiegbar rinnt das dünne trockene Brünnlein hinab, und kaum merkt man, daß im oberen Trichter der Sand in sich zusammensinkt, während der im unteren sachte ansteigt. »Wie lange denn, Onkel?« fragte der Knabe.
»Bis abends neun Uhr ist's abgelaufen,« antwortete Steinschnabel. Durch Mark und Bein ging mir das Wort. »Und dann?« fragte der Knabe.
»Das sollst du sehen,« sagte der Schnabel. Die Kleinen umkreisen ihn jubelnd, geben aber doch immer ein bißchen acht, daß das Sonnenleuchten seines Auges nicht plötzlich zum Blitze wird. Dieses helle, ewig frohe Auge durchleuchtet gleichsam die ganze Wohnung, bis ins Gemach der Frau hinein. Er spielt mit den Kindern, als ob er selbst eins wäre, und was ihnen an Schabernack nicht einfällt, das fällt ihm ein. Sind sie müde vom Tollen, so setzen sie sich zusammen, und er erzählt ihnen Märchen oder Schwänke, daß alle wie die hellen Glöcklein lachen. Selbst Gunde, die ernsthafte, läßt bisweilen ihre Hand mit der Nähnadel auf dem Knie ruhen und betrachtet die Gruppe wohlgefällig. Mit dem Schnabel spricht sie wenig und er mit ihr nicht viel, aber manchmal schauen sie sich doch offen an, wenn auch sehr kurz, nur so blitzartig. Mich dünkt immer, zwischen ihnen ist noch nicht ganz das Vertrauen, wie es zwischen Freunden sein soll.
Ich bringe an diesem Tage etwas in Anregung.
Meine Gestalt richte ich auf, soweit es noch gehen will, so stelle ich mich vor ihn hin.
»Schnabel, sieh mich an. Glaubst du denn nicht, daß sich der Dagobert noch rechtzeitig um ein bißchen Unsterblichkeit umsehen soll?«
»Aber versteht sich, wozu ist man denn Philosoph!«
»Nun also. Warum zögerst du denn immer noch, mir einen Antrag zu machen? Wenn so ein Kerl schon in Fleisch und Knochen nicht halten will, so stellen wir ihn einfach aus Stein her.«
»Wirklich?« lachte er mich an. »Wäre es dir angenehm? Wird es dich nicht zu sehr ermüden? Wir können ja ganz kurze Sitzungen halten, und jeden zweiten Tag.«
»Gedenke der Sanduhr! Spute dich.«
»Wir wollen uns vortrefflich dabei unterhalten.«
»Na, weißt du, der Unterhaltung wegen gerade nicht, so gut du dich auf Kurzweil verstehst. Man sollte dich ja geradezu einsperren, du lieber Zeitvertreiber und Lebensverkürzer! Doch in diesem Fall ist's anders. Wenn einer weiß, die Witze sollen nur verhüten, daß die Visage des Modells nicht ganz in Apathie versumpft, dann zündet das Feuerwerk nicht.«
»Das ist abzuwarten. In der nächsten Woche beginnt die Schöpfung. Gott nahm Lehm. Material zweiter Güte. Wir wollen es mit Carrara-Marmor versuchen.«
»Sage mir, Vertrauter, hast du einen größeren Vorrat von dieser Gattung Geist? – dann lieber nicht. Wisse, allzuviel Spiritus ist Kranken nicht zuträglich.«
»Und schon gar, wenn es Fusel ist, nicht wahr? Na, Freund, du sollst nur nahrhaftes Getränk haben. Milch, wie ein Säugling an der Mutterbrust. Kind, altes, launenhaftes! Zeige deinem himmlischen Vater nur noch einmal ein frohes Gesicht.« Er nahm meinen Kopf zwischen seine Hände, von Aug' zu Aug' ging ein Strahl, der mein ganzes Wesen warm durchrieselte.
»Sei doch wieder einmal ein ganzer Mensch!« sprach er weiter, »erhebe dein Herz, und das Schicksal hat keine Macht über dich. Schau doch. Ob es Glück oder Unglück um dich gibt, das kommt auf dich selber an. Nach dem, wie du bist, gestaltet sich dein Geschick. Gewöhne dir doch einmal das Wünschen ab und die Ungeduld nach der Gesundheit. Verzichte gelassen auf sie, vielleicht hast du sie dann.«
»Mir schwillt das Herz bei deinen Worten!« rief ich entzückt aus.
»Das soll's aber nicht. Schwellen soll's nicht. Ich gedenke dir eine leidenschaftslose Heiterkeit ins Gesicht zu meißeln, dann sollst einmal sehen, was du für ein Bursche bist.«
Beim Abendessen ging's wieder gemütlich zu. Ich fühlte mich wohler als gewöhnlich, mein Weib legte mir das beste Stück Kalbsbraten auf den Teller und bat den Onkel, sich selber zu bedienen. Die Knaben stritten lustig über Raben. Richard behauptete, die Raben wären schwarz, Konrad versicherte, sie seien weiß. Der Schnabel schlichtete den Streit, Konrad habe recht, denn es gebe auch weiße Raben – wenigstens im Sprichwort. Richard hätte übrigens auch nicht ganz unrecht, weil die schwarzen Raben in der Mehrzahl seien.
Plötzlich wandelte mich eine Ohnmacht an; mein Weib bettete mich auf das Sofa und hielt mir ein in Weinessig getauchtes Tuch vor die Nase.
»Onkel!« rief Konrad, »die Sanduhr ist abgelaufen.«
Auf dem Schranke stand sie, wie ein Laternlein anzusehen, in dem kein Licht ist. Der obere Trichter war leer, der untere voll. – Aller Augen schauten hin, Konrads blickten erwartungsvoll auf den Onkel.
»Ist sie abgelaufen?« sagte dieser.
»Ja, Onkel, sie ist abgelaufen.«