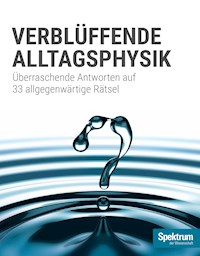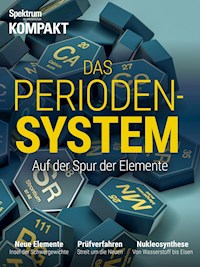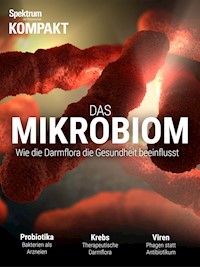5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Spektrum der Wissenschaft
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: Spektrum Spezial - Biologie, Medizin, Hirnforschung
- Sprache: Deutsch
Aus ihrer Erfahrung wissen Hirnforscher besser als andere, dass der Mensch sein Gehirn im Letzten vielleicht nie verstehen wird und auch nie wird nachbauen können. Dem Ideenreichtum und der Akribie, mit denen sie unser komplexestes Organ trotzdem zu ergründen versuchen, gebührt Hochachtung. Im vorliegenden Heft erfahren Sie von spektakulären Studien, mit denen Wissenschaftler auf teils völlig unterschiedliche Weise der Organisation und Arbeitsweise unseres Gehirns näherzukommen trachten. Sie erfassen so unter anderem den zellularen Aufbau unseres Orientierungssystems oder gehen der Frage nach, wie sich das Gehirn von Erwachsenen wieder plastisch und offen für neue Erfahrungen machen lässt. Andere Untersuchungen befassen sich mit dem Einfluss der Darmflora auf das Gehirn und wie man diese Erkenntnisse nutzen kann, um Krankheiten und Defekte mildern zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
EDITORIALTIEFE EINBLICKE INS KOMPLEXESTE ORGAN
Von Adelheid Stahnke, Redakteurin dieses Hefts
Der 2008 verstorbene russische Literaturnobelpreisträger Alexander Solschenizyn schrieb einmal eine kleine Geschichte über eine Begegnung mit einem verirrten Entenküken. Er nimmt es hoch – eine Hand voll Flaum. Und doch: »... niemals ... werden wir so etwas im Glaskolben zu Stande bringen – und selbst wenn man uns die Federn und die Knöchelchen dazugibt ...«
Ähnliches mag Hirnforschern manchmal in den Sinn kommen. Aus ihrer Erfahrung wissen sie besser als andere, dass der Mensch sein Gehirn im Letzten vielleicht nie verstehen wird und auch nie wird nachbauen können. Dem Ideenreichtum und der Akribie, mit denen sie unser komplexestes Organ trotzdem zu ergründen versuchen, gebührt Hochachtung. Im vorliegenden Heft erfahren Sie von spektakulären Studien, mit denen Wissenschaftler auf teils völlig unterschiedliche Weise der Organisation und Arbeitsweise unseres Gehirns näherzukommen trachten.
Aus menschlichen Stammzellen züchten sie etwa Minihirne, die ähnliche Strukturen wie bei Embryonen ausbilden (S. 6). Oder sie machen Hirngewebe durchsichtig, um die neuronale Verdrahtung zu erkennen (S. 14). Einige blicken mit raffinierter Technik so tief in das Organ hinein, dass sie die zellulären Grundlagen des räumlichen Ortungssystems erfassen – Arbeiten, die 2014 mit einem Nobelpreis honoriert wurden (S. 48).
Andere Forscher konzentrieren sich auf noch höhere Ebenen. So können Sie ab S. 58 lesen, wie man dem Sinn des Träumens auf die Spur kommen kann. Selbst der Zugewinn an Hirnfunktionen im Verlauf der menschlichen Evolution lässt sich mit modernen Techniken nachvollziehen (S. 68).
All diese Untersuchungen entstammen der einzigartigen Findigkeit von Menschengehirnen. Dabei sind die Grenzen unserer Erkenntnisfähigkeit noch lange nicht erreicht. Und stets werfen die Fortschritte eine Menge unerwartete neue Fragen auf, was sicherlich auch Solschenizyn begrüßt hätte. Die Hirnforschung bleibt spannend!
Eine interessante Lektüre wünscht Ihnen
Ihre
INHALT
EDITORIAL
AUFBAU
ORGANOIDE
MINIGEHIRNE AUS DEM LABOR
Unter geeigneten Kulturbedingungen bilden menschliche Stammzellen wenige Millimeter große Gebilde aus – mit Strukturen, die Bereichen des fötalen Gehirns ähneln.
Von Jürgen A. Knoblich
TRANSPARENZ
DAS DURCHSICHTIGE GEHIRN
Die störenden lichtbrechenden Lipide lassen sich auswaschen, wenn die übrigen Hirnstrukturen zuvor mit speziellen Hydrogelverfahren stabilisiert wurden.
Von Karl Deisseroth
FUNKTION
DRAINAGE
NÄCHTLICHE GEHIRNWÄSCHE
Vor allem während des Schlafs spült das glymphatische System mit dem Liquor gefährliche Abfallprodukte aus dem Gehirn.
Von Maiken Nedergaard und Steven A. Goldman
MIKROBIOM
WENN DER BAUCH DAS GEHIRN KRANK MACHT
Die Darmflora beeinflusst auf vielfältige Weise Hirnfunktionen – etwa über Botenstoffe und über das vegetative Nervensystem.
Von Valérie Daugé, Mathilde Jaglin, Laurent Naudon und Sylvie Rabot
PLASTIZITÄT
DAS GEHIRN NEU VERDRAHTEN
»Kritische Perioden« ermöglichen Kindern intensives Lernen, zum Beispiel zum Aufbau des Sehens. Solche sensiblen Zeitfenster lassen sich im Prinzip auch bei Erwachsenen wieder öffnen.
Von Takao K. Hensch
GEDÄCHTNIS
EIN NETZ VON ERINNERUNGEN
Zeitlich nahe liegende Erlebnisse verknüpfen sich miteinander – allerdings nur im jüngeren Alter. Jetzt beginnen Forscher die beteiligten molekularen Mechanismen zu verstehen.
Von Alcino J. Silva
VERHALTEN
RAUMORIENTIERUNG
DAS GPS IM GEHIRN
Zum Navigieren verwenden Säugetiere innere Landkarten, die sie mittels mehrerer Sets von speziellen Orientierungsneuronen erstellen.
Von May-Britt Moser und Edvard I. Moser
SCHLAF
WARUM TRÄUMEN WIR?
Träumen hilft, Lebensanforderungen besser zu bewältigen, sogar Examen.
Von Isabelle Arnulf
HIRNEVOLUTION
WIE MAN EINEN FAUSTKEIL MACHT
An Studenten, die lernen, Steingeräte herzustellen, vollzieht der Autor nach, wie sich das Gehirn in unserer Evolution an die Faustkeilfabrikation anpasste.
Von Dietrich Stout
MRT
SO FUNKTIONIERT EIN HIRNSCANNER
Die Magnetresonanztomografie hat Medizin und Hirnforschung revolutioniert. Wie kommen die Bilder zu Stande, und was zeigen sie?
Text: Anna von Hopffgarten / Grafik: Martin Müller
BEWUSSTSEIN
WIE FREI IST DER MENSCH?
Und es gibt ihn doch, den freien Willen – auch wenn er Einschränkungen unterliegt.
Von Eddy Nahmias
ORGANOIDEMINIGEHIRNE AUS DEM LABOR
Mit aus menschlichen Zellen gezüchteten »Organoiden« möchten Forscher Kontruktions- und Funktionsprinzipien unseres komplexesten Organs beleuchten sowie Erkrankungen wie Autismus oder Alzheimer enträtseln.
»What I cannotcreate, I do not understand«
(Was ich nicht selbsterzeugen kann, verstehe ichnicht) Richard Feynman 1988
Jürgen A. Knoblich ist stellvertretender Direktor des Instituts für Molekulare Biotechnologie der Akademie der Wissenschaften in Wien. Zu seinen Forschungsschwerpunkten zählen neuronale Stammzellen und die Entwicklung des Nervensystems der Taufliege.
►► spektrum.de/artikel/1513357
AUF EINEN BLICKMENSCHLICHE HIRNORGANOIDE
1 Viele grundlegende Erkenntnisse der Hirnforschung stammen von Nagetieren. Doch denen fehlen die höheren Funktionen unseres Denkorgans.
2 Manche neurologischen Erkrankungen des Menschen lassen sich an Tieren nicht untersuchen, etwa Schizophrenie oder die Alzheimerdemenz.
3 Im Labor gezüchtete winzige Organoide eignen sich dagegen für solche Studien, weil sie ähnliche Strukturen und Zelltypen wie unser Gehirn ausbilden. Auch der Wirkung des Zikavirus kam man damit auf die Spur.
Alles, was uns als Menschen auszeichnet, entsteht letztlich in einer 1,4 Kilogramm schweren, weichen, gelblichen Gewebemasse – die wir unser Gehirn nennen. Hier formen sich unsere Gedanken, hier fühlen wir Liebe und Hass, hier entspringen die höchsten Ideale und niedersten Motive der Menschheit. Das in seiner Form ein wenig an eine Walnuss erinnernde Gebilde ist das komplexeste Organ, das die Natur je geschaffen hat. Es enthält etwa 86 Milliarden Nervenzellen oder Neurone. Diese müssen, damit das Gehirn ordentlich funktioniert, zur richtigen Zeit entstehen, dann zum passenden Ort wandern und sich schließlich dort korrekt arrangieren und vernetzen. Das alles im Zusammenhang und Detail zu begreifen – das heißt Entwicklung, Aufbau und Arbeitsweise unseres Gehirns zu verstehen –, gilt als größte Herausforderung für die moderne Biologie.
Bisher stammt das meiste Wissen hierzu von Tierstudien, oft an Mäusen und Ratten. Tatsächlich ähneln sich die Gehirne von Nagern und Menschen in vieler Hinsicht. Sie sind im Prinzip gleich aufgebaut, verfügen über etliche identische Nervenzelltypen und erfüllen in entsprechenden Regionen vergleichbare Aufgaben. Doch es gibt einen wesentlichen Unterschied: Bei einer Maus ist die Hirnoberfläche glatt, beim Menschen tief gefurcht.
Das ist keineswegs trivial. Nach Ansicht vieler Neurowissenschaftler ergibt die stark konturierte Oberfläche letztlich ein fundamental anderes Organ. Denn bei gleichem Volumen haben in der Hirnrinde nun bedeutend mehr Nervenzellen Platz. Wohl nicht von ungefähr sind die Gehirne der intelligentesten Tiere gefaltet, wie die von Affen, Katzen, Hunden und Walen. In dem Zusammenhang entdeckten Evolutionsbiologen, dass die meisten Neurone des menschlichen Gehirns aus einer bestimmten Sorte so genannter Vorläuferzellen entstehen, die es bei der Maus gar nicht oder nur in geringer Zahl gibt.
Unterschiede wie diese könnten die folgende Beobachtung erklären: Viele genetische Mutationen, die beim Menschen schwere neurologische Erkrankungen hervorrufen, beeinträchtigen Mäuse wenig, wenn man ihnen die entsprechenden Erbanlagen eingepflanzt hat. Das Phänomen wäre begreiflich, sofern solche Mutationen die Entwicklung oder den Erhalt von hirnarchitektonischen Strukturen oder Zelltypen behinderten, die zwar beim Menschen existieren, bei den Nagern aber nicht. Hierin mag ein Grund liegen, wieso Forschungen an Mäusen oder Ratten noch keine bahnbrechenden Therapien unter anderem für Schizophrenie, Epilepsie und Autismus erbracht haben.
Die Neurowissenschaftler suchen deswegen dringend nach besser geeigneten Modellen für derartige Studien. Meiner Arbeitsgruppe gelang unlängst ein neuer, zukunftsträchtiger Ansatz: Ausgehend von menschlichen Stammzellen ist es uns gelungen, dreidimensionale Gewebekulturen herzustellen, die dem Gehirn eines menschlichen Embryos verblüffend ähnlich sind. Wir können sozusagen frühe Entwicklungsstadien des menschlichen Gehirns im Miniaturformat im Labor züchten. Wir nennen diese Kulturen zerebrale Organoide. Daran lassen sich viele Prozesse untersuchen, zu deren Erforschung sich Nagetiere nicht eignen. Zum Beispiel kann man diese Gebilde dem Zikavirus aussetzen, das in letzter Zeit von sich reden macht, weil es bei ungeborenen Kindern offenbar Mikrozephalie verursacht. Oder man verpasst den Organoiden bestimmte genetische Merkmale, so dass sie Eigenschaften entwickeln, die denen von Gehirnen mit einem neurologischen Defekt ähneln.
Wichtiges Ziel: Wissenslücken füllen mit Hirnorganoiden aus menschlichen Stammzellen
In meinem Team begannen die Studien zu menschlichen zerebralen Organoiden 2012. Damals gehörte die amerikanische Forscherin Madeline A. Lancaster als Postdoc dazu, die heute an der University of Cambridge (England) arbeitet. Sie entwickelte ein Verfahren, bei dem in Zellkultur viele wesentliche Vorgänge der Hirnbildung beim Embryo bis zum etwa zehn Wochen alten Gehirn eines frühen Fötus ablaufen (siehe »Die Hirnfabrik«).
Den Anfang machen bei unseren Studien menschliche pluripotente Stammzellen, wie man sie inzwischen aus differenzierten Zellen etwa der Haut durch genetische Rückprogrammierung gewinnen kann (siehe Spektrum Juni 2011, S. 22). Den gleichen Zelltyp weisen Embryonen in einer frühen Entwicklungsphase auf. Pluripotenz bedeutet, dass eine Zelle unter geeigneten Bedingungen noch die verschiedensten Gewebe auszubilden vermag – zum Beispiel Blut, Knochen-, Muskel- oder Nervengewebe. Beim Embryo oder Fötus bleiben neue Stammzellen nur für wenige Tage in einem Zustand, in dem sie fast jeden Zelltyp hervorzubringen vermögen. Doch unter speziellen Kulturbedingungen lässt sich die Pluripotenz bewahren. Auf solche Zellen greifen Forscher bei der Zucht von Organoiden zurück.
Bei unserem Verfahren werden die Stammzellen zuerst in einem flüssigen Medium kultiviert, dem sämtliche Nährstoffe zugesetzt sind, die sie benötigen, um ein so genanntes Neuroektoderm auszubilden – denn aus dem Ektoderm, dem äußeren »Keimblatt« eines Embryos, entsteht nicht nur unter anderem die Haut, sondern auch das Nervengewebe. In dem Nährmedium beginnen sich die Stammzellen bald zu teilen, und innerhalb weniger Tage bilden sich kleine Kügelchen aus vielen Zellen, die wir als Embryoide oder Embryoidkörper bezeichnen. Die betten wir in eine gallertartige Substanz namens Matrigel ein. Es handelt sich dabei um ein für solche Zwecke gern verwendetes Medium, das man von Zellen aus einem Knorpeltumor der Maus produzieren lässt. Dieses Gel erfüllt viele Funktionen der Umgebung, genauer gesagt der extrazellulären Matrix, in der die Zellen eines menschlichen Fötus heranwachsen. Zum einen enthält das Matrigel ein reiches Angebot an Substanzen, welche die Zellen zur Vermehrung anregen und am Leben erhalten. Zum anderen bietet es ihnen ein Gerüst zum Wachsen. Das ist gerade so fest, dass sie sich daran halten können, aber dennoch nachgiebig und formbar genug, um sich den sich vermehrenden Zellen anzuschmiegen.
Im passenden Milieu entstehen Replikate des fötalen Vorderhirns des Menschen
Das Ergebnis dieser Arbeiten war wirklich spektakulär. Im Matrigel wachsen die Embryoidkörper von allein zu weißlichen, unregelmäßig ausgebuchteten dreidimensionalen Gewebebällchen heran, die einem embryonalen humanen Gehirn in vielerlei Hinsicht verblüffend ähneln. Wenn sie die passenden chemischen Signale für die fötale Hirnentwicklung erhalten, entwickeln sich unsere Kulturen von selbst zu präzisen Replikaten des menschlichen Vorderhirns, des Bereichs unseres Gehirns, der für höhere kognitive Funktionen zuständig ist.
Zum Beispiel ordnen sich die Zellen in den für die Hirnrinde so charakteristischen Schichten an. Ebenso finden wir eher locker strukturierte Gebilde, die dem so genannten choroidalen Plexus entsprechen – einem Geflecht, das in unserem Gehirn die Zerebrospinalflüssigkeit erzeugt. Nicht zuletzt entdecken wir typische innere Ausbeulungen des Nervengewebes, die als »ganglionic eminences« oder »Ganglienhügel« bezeichnet werden. Aus ihnen entstehen besondere Nervenzellen, die so genannten Interneurone, die während der Entwicklung über weite Entfernungen wandern und an ihrem Bestimmungsort die Aktivität anderer Nervenzellen dämpfen. Ebenso finden wir die Regionen, die später den Hippocampus ausbilden, den Ort, in dem unser Langzeitgedächtnis beheimatet ist.
Selbst bei genauer Betrachtung arrangieren sich die Zellen in den Organoiden im Grunde genauso wie beim acht bis zehn Wochen alten menschlichen Fötus. Einzelne der Minihirne entwickeln sogar kleine, mit pigmentierten Zellen bestückte Ausbeulungen, die an ein frühes Stadium der Augenbildung erinnern – unsere Netzhaut ist ja genau genommen Hirngewebe. Ebenso teilen und differenzieren sich die Zellen in den Organoiden in die gleichen Typen wie beim Embryo. Bemerkenswerterweise bilden die jungen Neurone auch Axone, die langen Ausläufer, über die Hirnnervenzellen anderen Neuronen Signale schicken und ein Kommunikationsnetz aufbauen. Letzteres scheint in den Minihirnen gleichfalls stattzufinden. Bevor sich neue Nervenzellen in das Netzwerk integrieren, müssen sie allerdings erst an ihren Bestimmungsort – häufig in ein anderes Areal – wandern. Selbst dieses Verhalten wirkt beim Fötus und bei den Organoiden erstaunlich gleich. Der Vorgang interessiert uns besonders, da an dieser Stelle bei psychiatrischen Erkrankungen des Öfteren etwas schiefgelaufen zu sein scheint.
An sich ist die Idee, im Labor Gewebe zu züchten, nicht neu. Wie so viele wissenschaftliche Entdeckungen basieren die gegenwärtigen Fortschritte in der Organoidzüchtung auf jahrelangen vorbereitenden Studien. Manche Erkenntnisse, auf denen die heutige Forschung aufbaut, wurden sogar bereits vor mehr als einem Jahrhundert gewonnen. Der amerikanische Zoologe Henry V. Wilson (1863–1939) etwa beobachtete schon 1907, dass sich bestimmte einfache Tiere wie Schwämme wieder zu intakten Organismen reorganisierten, nachdem er sie in einzelne Zellen zerlegt hatte. Das warf früh die Frage auf, ob womöglich auch für das Gehirn Programme existieren, anhand derer sich seine Teile zusammenfügen. Weitere wichtige Beiträge hierzu lieferte der deutsch-amerikanische Embryologe Johannes Holtfreter (1901–1992), der 1939 entdeckte, dass die verschiedenen Zelltypen eines Froschembryos wieder zueinander finden – sich »reaggregieren« – und ihre frühere Form annehmen können.
In den 1980er Jahren gab es dann einen regelrechten Boom an »Reaggregationsstudien« zu komplexen Organen oder Organteilen. Sofern man in Laborkulturen die richtigen Zelltypen zusammengab, fanden sie sich beispielsweise zu einer Netzhaut oder selbst zu einer Hirnrinde zusammen. Hierauf baute Yoshiki Sasai (1962–2014) vom Riken-Zentrum für Entwicklungsbiologie in Kobe (Japan) ab dem Jahr 2006 auf. Er setzte erstmals pluripotente Stammzellen ein, um Nervengewebe zu gewinnen. Damit gelang es ihm, im Labor menschliche Netzhaut zu erzeugen (siehe Spektrum Juli 2011, S. 16). Dieses Verfahren haben wir mit einer bahnbrechenden Methodik des niederländischen Mediziners, Immunologen und Molekulargenetikers Hans Clevers von der Universität Utrecht kombiniert. Von ihm kommt die Idee, zum Züchten von Organoiden aus Stammzellen Matrigel zu verwenden. Hiermit schaffte er es, Gewebe von Darm, Magen, Leber und Bauchspeicheldrüse zu gewinnen.
Bei unseren Studien machen wir uns noch weitere umwälzende Methoden der biomedizinischen Forschung zu Nutze. Wie schon angedeutet, verwenden wir so genannte reprogrammierte (rückprogrammierte) Stammzellen und untersuchen mittels Gentechnik an den Hirnorganoiden die Bedeutung von Mutationen.
Ohne Embryonen: Mit wenigen gezielten Eingriffen von der reifen Zelle zur pluripotenten Stammzelle
Das Zurückprogrammieren von differenzierten Körperzellen in einen frühen Zustand – quasi das Zurückstellen der genetischen Entwicklungsuhr – entwarf Shinya Yamanaka von der Universität Kyoto, wofür er 2012 den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin erhielt (siehe Spektrum Dezember 2012, S. 20). Wie er herausfand, lassen sich mit Hilfe von wenigen genetischen Manipulationen, nämlich nur ein paar molekularen Faktoren, praktisch alle Typen von reifen Zellen in pluripotente Stammzellen zurückverwandeln. Egal, ob sie von der Haut oder aus Blut gewonnen wurden: Solche Stammzellen kann man wiederum dazu bringen, verschiedene Typen von Hirnzellen zu generieren, und aus denen können zerebrale Organoide heranwachsen. Embryonen benötigt man für solche Studien also nicht länger.
Die Möglichkeit der genetischen Rückprogrammierung öffnet biomedizinischen Untersuchungen über Erkran kungsmechanismen neue Wege. Zum Beispiel lassen sich aus Zellen von Patienten, die an einem genetischen Defekt leiden, Organoide züchten, die man mit welchen aus Zellen von gesunden Menschen vergleicht. Denn solch ein Fehler beeinträchtigt oft bereits frühe Stadien der Organentwicklung. Wir selbst haben auf diese Weise schon Phänomene der Mikrozephalie untersucht, die durch genetische und diverse andere Ursachen bedingt sein kann. Betroffene Kinder kommen mit einem viel zu kleinen Gehirn auf die Welt. Die Organoide, die wir mit den Zellen eines Patienten züchteten, waren ebenfalls wesentlich kleiner als normal. Da wir mit den genannten Methoden aus den Zellen eines Menschen praktisch beliebig viele Organoide erzeugen können, sollen nun detaillierte Analysen der molekularen Mechanismen erfolgen, die das Hirnwachstum beim Fötus behindern. Ähnliche Studien sind für Schizophrenie, Epilepsie und andere Krankheiten denkbar, bei denen man gern wüsste, auf welchen Fehlbildungen des Gehirns sie beruhen.
Auch Organoide aus reprogrammierten Zellen von gesunden Menschen nutzen der Medizin. Im Fall des Zikavirus haben Forscher mehrerer Labors in Brasilien und später in den USA daran nachweisen können, dass dieser Erreger tatsächlich in der Schwangerschaft das Hirnwachstum behindert und die Mikrozephalie vieler Neugeborener in Südamerika verursacht haben dürfte. Wie sich zeigte, sterben in Organoiden, die mit dem Virus infiziert sind, zahlreiche Nervenzellen ab. Die Gebilde sind dadurch am Ende deutlich kleiner als die nichtinfizierten Vergleichsexemplare, ganz ähnlich wie bei unseren eigenen Arbeiten mit Zellen eines Mikrozephaliepatienten.
Forschungen an Organoiden werden sicherlich noch eine Menge weiterer Fragen rund um das Zikavirus klären helfen. Beispielsweise verstehen die Mediziner noch nicht, wieso es sich nur in einigen Weltregionen so katastrophal auswirkt. Um das herauszufinden, könnte man verschiedene Organoide mit jeweils einem anderen Virusstamm traktieren. Ein Rätsel ist ebenfalls, aus welchem Grund längst nicht jedes Kind, das dem Virus im Mutterleib ausgesetzt war, mit einem zu kleinen Gehirn geboren wird. Ein weiterer wichtiger Aspekt wäre die Andockstelle, also der Rezeptor, über den das Virus sich Zutritt in die Hirnzellen verschafft. Nicht zuletzt könnte man Wirkstoffe gegen diesen Erreger zuerst an Organoiden erproben, bevor dann klinische Studien an Patienten stattfinden.
Auch mit Hilfe modernster Gentechnologie – so genannten Genomengineerings (Manipulation des Genoms) – lassen sich an Organoiden gezielt Krankheitsursachen abklären. Gesunden Zellen kann man eine Mutation einpflanzen, von der man annimmt, dass sie hinter einer bestimmten Krankheit steht, und dann Entwicklung und Verhalten der Minihirne untersuchen. Mehr noch: An Organoiden ließe sich erproben, ob die Reparatur des verdächtigen Gens oder der verdächtigen Mutation wirklich die gewünschten Auswirkungen hat. Falls ja, wüsste man nun, an welcher Stelle im biochemischen Apparat der Zelle neue Therapien ansetzen müssten.
Neurowissenschaftler stehen quasi in den Startlöchern, um weitere mögliche Anwendungen der Organoidtechnologie zu erkunden. Einen der vordersten Ränge nimmt dabei die Medikamentenentwicklung ein. Die Minihirne könnten viele der heute noch verlangten Studien an Tieren überflüssig machen und so nicht zuletzt die Kosten erheblich senken. Zum einen lässt sich an ihnen austesten, ob ein Wirkstoff den gewünschten Effekt hat. Zum anderen können zerebrale Organoide offenbaren, ob ein Medikament der Hirnentwicklung des Kindes schadet. Das berüchtigte Contergan (Thalidomid) wäre schwangeren Frauen um 1960 bestimmt nicht verschrieben worden, hätte man den Wirkstoff damals zuvor an Hirnorganoiden getestet. Wie wir heute wissen, beeinträchtigt es nicht nur die Ausbildung der Gliedmaßen – was nachträgliche Tierversuche bestätigten –, sondern unter anderem auch das Nervensystem und Gehirn in einer frühen Entwicklungsphase.
Überdies erweisen sich die gezüchteten Minihirne als sehr wertvolle Modellsysteme für Evolutionsbiologen. An ihnen lässt sich herausfinden, welche Gene uns im Vergleich mit anderen Primaten zu unserem riesigen Gehirn verhelfen. Genomvergleiche brachten bereits Aufschluss über genetische Hintergründe einiger kognitiver Unterschiede, so etwa über essenzielle Gene für die menschliche Sprache. Aber wie diese Gene dazu beitragen, war bislang vielfach nicht recht klar. Jetzt können die Forscher Erbgutsequenzen von verschiedenen Affenarten in menschliche Hirnorganoide einsetzen und die Auswirkungen verfolgen. Umgekehrt lassen sich auch menschliche Gene oder ganze Genomabschnitte in Affenorganoide überführen, um deren Bedeutung zu studieren.
Manche Leute gruselt es, wenn sie sich vorstellen, dass Menschengehirne in einem Glaskolben wachsen. Bei vielen weckt das Assoziationen an den Sciencefiction-Film »Matrix«, in dem intelligente Maschinen ganze Menschen massenhaft in Kulturgefäßen züchten. Doch für irgendwelche Befürchtungen dieser Art besteht keinerlei Anlass. Die Hirnorganoide werden mit Sicherheit niemals auch nur annähernd so etwas wie ein Bewusstsein hervorbringen. Denn dafür muss ein Geschöpf Sinneseindrücke aus der Außenwelt aufnehmen und verarbeiten. Erst dann vermag es ein inneres Modell von der Realität zu entwickeln. Den Organoiden fehlt jeder sensorische Input, sie können weder sehen noch hören. Selbst wenn wir sie mit einer Kamera und einem Mikrofon verbinden könnten, müsste man die eintreffende visuelle und auditorische Information erst noch in eine Signalform übersetzen, die von dem Konglomerat aus Hirnzellen in der Laborschale erfasst und vor allem verstanden würde. Bis auf Weiteres ist dies schon allein technisch gesehen wohl eine unüberwindbare Hürde.
Die zerebralen Organoide ähneln allenfalls kleinen, bei Hirnoperationen entfernten Gewebestückchen
Zerebrale Organoide stellen folglich keine funktionsfähigen Gehirne dar. Sie sind vielmehr Gewebeklumpen, die lediglich molekulare und zelluläre Funktionen des natürlichen Organs spektakulär genau nachbilden. Sie ähneln darin allenfalls kleinen Gewebestückchen, die bei Hirnoperationen entfernt werden.