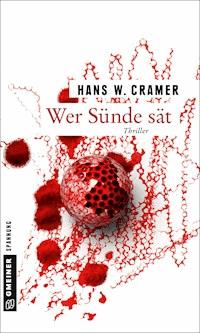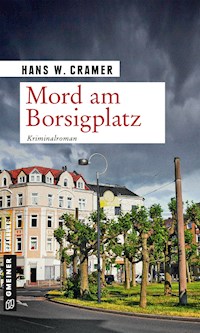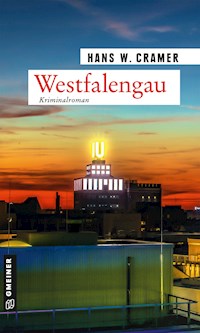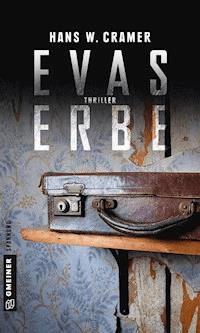Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sabine, Raster und Philo
- Sprache: Deutsch
Täuschend echt aussehende Spinnen tauchen plötzlich an öffentlichen Plätzen auf. Was zuerst wie ein Scherz aussieht, wird bald bitterer Ernst. Denn auf einmal sind auch echte Spinnen darunter, und es kommt zu tödlichen Bissverletzungen. Als auch Sabines Nichte gebissen wird, nehmen sich die drei Freunde Sabine, Philo und Raster der Sache an. Die Ermittlungen führen sie über illegale Tierverkäufe bis hin zu Menschenhandel. Können sie die Wahrheit rechtzeitig ans Licht bringen? Denn auch ihr Leben gerät zunehmend in Gefahr …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 346
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hans W. Cramer
Spinnenbiss
Thriller
Impressum
Bisherige Veröffentlichungen im Gmeiner-Verlag:
Wer Sünde sät (2016)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2017 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2017
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © krissikunterbunt / fotolia.com
ISBN 978 3 8392 5454 7
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Prolog
Das Mädchen starrte mit weit aufgerissenen Augen Hilfe suchend in das Gesicht des Vaters. Die Wangen fleckig gerötet, die Haare in Strähnen auf der schweißnassen Stirn. Der Mund war leicht geöffnet, die Atmung ging stoßweise.
»So tun Sie doch was!« Verzweifelt krallte der Vater seine Finger in den Oberarm des Arztes. »Sie fragen mich hier total unsinnige Sachen. Helfen Sie endlich meiner Tochter! Sie sehen doch, wie schlecht es ihr geht.«
»Bitte beruhigen Sie sich! Es ist wirklich wichtig. Wir können Ihrer Tochter nur helfen, wenn wir wissen, was überhaupt passiert ist. Verstehen Sie bitte! Eine Allergie behandeln wir ganz anders als eine Vergiftung. Also noch einmal«, ruhig drückte der Arzt den aufgelösten Mann auf einen Stuhl neben der Trage, auf dem das zehnjährige Mädchen wimmernd lag. »Wo waren Sie mit Saskia, bevor die Symptome anfingen? Fangen Sie bitte heute Morgen an.«
Der Vater beruhigte sich ein wenig und nahm vorsichtig die heiße Hand seiner Tochter. »Heute Morgen haben wir ganz normal, wie jeden Samstag, zusammen gefrühstückt. Dann sind wir in die Stadt und haben ein paar Einkäufe erledigt. Danach …«
»Halt. Das muss ich genauer wissen. Wo waren Sie da? Hat Saskia mit irgendetwas Außergewöhnlichem Kontakt gehabt?«
»Nein. Wir waren in einem Kaufhaus am Westenhellweg. Da haben wir zwei T-Shirts für sie gekauft. Dann waren wir noch in der Apotheke, weil ich Nasentropfen für mich brauchte. Und dann sind wir auch schon zum Tierpark gefahren. Herr Doktor, was ist mir ihr?«
Der Arzt hatte im selben Augenblick bemerkt, dass sich der Zustand des Mädchens rapide verschlechterte. Die Atmung wurde flacher, die Augenlider flatterten und das Wimmern hatte aufgehört.
»Saskia! Kannst du mich hören? Saskia! Mach die Augen auf!« Keine Reaktion.
»Holen Sie sofort Frau Doktor Gründer aus der Anästhesie! Wir müssen intubieren!« Die Ansage galt Schwester Rita, die abwartend neben der Liege stand.
Der Arzt nahm eine bereits aufgezogene Spritze von dem kleinen Behandlungstisch und injizierte eine klare Flüssigkeit in den venösen Zugang, den er direkt nach der Aufnahme gelegt hatte. »Hören Sie! Noch einmal. Das ist ganz wichtig. Hatte Saskia im Zoo zu irgendeinem Tier Kontakt?«
»Nein!« Verzweifelt ging der Vater jedes einzelne Gehege in Gedanken noch einmal durch. »Nein, da war wirklich nichts. Sie meinte nur irgendwann zwischendurch, sie wäre von einer Wespe in die Wade gestochen worden.«
»Und das sagen Sie erst jetzt? Hat Saskia irgendwelche Allergien?« Er untersuchte die braun gebrannten Unterschenkel des Mädchens, die dünn wie Storchenbeine aus den Shorts herauslugten.
»Nein. Sie hatte schon öfter Wespen- und Bienenstiche. Da ist nie was passiert. Glauben Sie mir doch! Ich hatte mir dabei wirklich nichts gedacht.«
»Ist ja schon gut. Ich sehe hier rechts auch nur einen kleinen Kratzer, das kann es eigentlich nicht sein. Das Kortison scheint zu wirken, sie wird wieder ruhiger«, sagte er mehr zu sich selbst als zu dem aufgelösten Vater.
Beide Männer beobachteten erleichtert, dass sich Saskias Gesicht tatsächlich entspannte. Es zeichnete sich sogar ein kleines Lächeln ab, und die roten Flecken schienen blasser zu werden.
Vorsichtig tätschelte der Arzt Saskias Wangen. »Saskia! Kannst du mich jetzt hören?«
Aber nach wie vor gab es keine Reaktion. Keine Anzeichen, dass sie überhaupt etwas wahrnahm.
»Das verstehe ich nicht. Eigentlich müsste sie wieder ansprechbar sein«, meinte er kopfschüttelnd. In diesem Moment kam Schwester Rita mit der angeforderten Chefärztin der Anästhesie durch die Tür. Der Diensthabende briefte die Kollegin präzise und professionell über Symptome und die bereits durchgeführten Maßnahmen.
Frau Doktor Gründer überprüfte gewissenhaft die Vitalfunktionen und meinte daraufhin: »Ich sehe das genauso. Wir sollten sicherheitshalber intubieren. Die Atmung ist mir zu schlecht. Die Sauerstoffsättigung ist deutlich unter der Norm, und auch das EKG gefällt mir nicht wirklich. Herr – äh?« Fragend blickte sie in das Gesicht des Mannes, dessen Blick panisch zwischen der Ärztin und dem Arzt hin und her huschte.
»Ich bin der Vater.«
»Bitte seien Sie gut und warten erst einmal draußen. Wir kümmern uns um Ihre Tochter.«
Widerstrebend stand er auf, strich dem reglosen Mädchen liebevoll und zärtlich über die verschwitzten Wangen und trottete mit hängenden Schultern hinaus.
Er sollte seine Tochter nie wieder lebend sehen. Nur zehn Minuten später hörte Saskias Herz auf zu schlagen. Keine der angestrengten Reanimationsversuche schlugen an.
Saskia starb im Sommer 2009 mit gerade einmal zehn Jahren.
Die durchgeführte Obduktion inklusive der üblichen toxikologischen Untersuchungen brachte keinerlei Hinweis auf die Todesursache. Letztendlich schrieb man »Reizleitungsversagen des Herzens« auf den Totenschein, wohl wissend, dass das nicht alles sein konnte.
Der Vater blieb allein zurück und konnte keinen klaren Gedanken fassen.
Aber irgendwer muss doch die Verantwortung übernehmen, dachte er Wochen später, als er langsam aus seiner Lethargie erwachte.
Erster Teil
Spinnen
»Oh greul! Oh greul! Oh ganz abscheul!
Wir hängen hier am roten Seul.
Oh greul! Oh greul!
Die Unke unkt,
Die Spinne spinnt,
Und schiefe Scheitel kämmt der Wind.«
Christian Morgenstern aus den »Galgenliedern«
1. Kapitel
Max Krüger war müde. Seine Frau hatte zwar mehrfach angeboten, auch ein Stück der langen Fahrt von Siena nach Münster in Westfalen zu übernehmen. Aber Max hatte darauf bestanden, die ganze Strecke alleine zu fahren. Sie waren morgens um zwei Uhr von ihrem Ferienhaus in der Toskana aufgebrochen. Die Kinder schliefen im Auto sofort wieder ein, und auch Bettina Krüger hatte es nur eine Stunde geschafft, Max ein wenig zu unterhalten. Dann war auch sie immer stiller geworden, bis ein leises Schnarchen vom Beifahrersitz zu vernehmen war.
Mittlerweile fuhren sie immerhin schon auf der A45 und näherten sich Lüdenscheid. Noch gut zwei Stunden, dann hätten sie es geschafft. Die Kinder wurden immer nörgliger, und Max konnte sie verstehen. Für den achtjährigen Felix und die elfjährige Sonja war eine solch lange Zeit im Auto tatsächlich eine Tortur.
»Papa, ich muss mal. Dringend!«, tönte es jetzt gerade von hinten.
»Es kommt gleich eine Raststätte. Halt noch ein Momentchen durch!« Max hatte zwar überhaupt keine Lust, schon wieder eine Pause einzulegen, aber das waren nun einmal die Naturgesetze.
Wenige Kilometer später erschien das Hinweisschild auf die Raststätte Sauerland Ost, und Max setzte den Blinker.
»Ich geh vorsichtshalber mit. Ja, du auch, Felix.« Bettina zog mit ihren Kindern los und verschwand in dem flachen Anbau hinter der Tankstelle.
Max nutzte die Zeit, öffnete das Seitenfenster, um frische Luft ins Wageninnere zu lassen, schloss für einen Moment die Augen und döste ein.
Ein gellender Schrei riss Max brutal aus seinen Träumen. Als Erstes sah er, wie Bettina aus der Toilettentür stürzte, Sonja und Felix im Schlepptau. Dann stellte er verwundert fest, dass sie eindringlich auf andere Menschen einredete, die offensichtlich ebenfalls die Toilette benutzen wollten. Max konnte nichts verstehen, erkannte aber, dass seine Frau dringend davon abriet.
Er stieg aus und ging auf die erregte Gruppe zu. »Was ist denn hier los?«, fragte er.
»Max. Hör zu! Du musst sofort die Polizei oder die Feuerwehr verständigen.«
»Warum denn? Ist jemandem schlecht geworden?« Dann würde man ja wohl eher einen Krankenwagen rufen, dachte Max im selben Moment.
»Nein! Da drin sitzt eine Spinne … Das kannst du dir nicht vorstellen!«
Max starrte ungläubig in Bettinas Gesicht. »Du machst hier ernsthaft einen solchen Aufstand wegen einer Spinne?« Er wusste nicht, ob er sauer werden oder einfach nur lachen sollte. »Bettina! Das ist jetzt nicht dein Ernst.«
»Dann komm mit und guck dir das selber an«, meinte sie und zog Max zu der Tür, wo sich bereits eine kleine Menschentraube versammelt hatte. In einigen Gesichtern konnte Max echtes Erschrecken erkennen, und langsam fragte er sich, was ihn erwarten würde.
Es war die mit Abstand größte, behaarte und unheimlichste Spinne, die er je gesehen hatte. Sie saß dick und fett auf einem der Waschtische der Damentoilette und starrte die Ankömmlinge aus schwarzen Knopfaugen an. Max meinte, ein leises Vibrieren der Beißzangen erkennen zu können, war sich aber nicht ganz sicher. Der Körper war gedrungen und wie auch die Beine streifenförmig gelb-schwarz. Am Hinterteil erkannte er einen kugeligen Fortsatz. Die acht Beine waren lang und ebenfalls behaart. Insgesamt mochte die Spinne etwa zehn Zentimeter groß sein.
»Okay«, sagte er zu seiner Frau, während sich die beiden langsam wieder zurückzogen. »Die Wette hättest du gewonnen. Das ist ja unglaublich.« Mehr fiel ihm in diesem Augenblick auch nicht ein.
Als sie wieder draußen waren, hörten sie ein Martinshorn näher kommen. Irgendjemand hatte bereits die Polizei gerufen.
Die Beamten reagierten zunächst genau wie Max: ungläubig, teils genervt, teils von der Panik der Umstehenden amüsiert gingen sie in das Gebäude, um sehr schnell – ernst und eine Spur blasser – wieder herauszukommen.
Sie besprachen sich kurz, dann holte einer der beiden eine Rolle Absperrband aus dem Polizeifahrzeug, während der andere telefonierte und dabei mit der freien Hand immer wieder einem imaginären Zuhörer deutlich machte, wie groß dieses Ding sei.
»Das Gebäude darf vorerst nicht betreten werden«, rief der erste und begann, die Tür abzusperren. »Bitte benutzen Sie die Toilette drüben in der Gaststätte!«
»Kommt. Wir fahren weiter«, meinte Max und wandte sich dem Auto zu.
»Och nö!«, tönte es aus zwei kleinen Mündern. »Das ist so spannend hier. Wir haben doch noch ein bisschen Zeit, ja, Mama?«
Bettina schaute seufzend zu ihrem Mann hinüber und zuckte mit den Schultern.
»Von mir aus«, sagte Max, »mich interessiert ehrlich gesagt auch, was das für ein Biest ist, und wo es herkommt.«
Wie die meisten Leute, die einen Blick auf die Spinne hatten werfen können, blieb also auch Familie Krüger stehen und schaute gespannt dem weiteren Treiben zu.
Es dauerte nicht lange, da trafen zwei Einsatzfahrzeuge der Lüdenscheider Berufsfeuerwehr ein. Neben den Feuerwehrleuten stieg auch eine Frau in Zivil aus, die einen Käfig und eine Tasche mit sich führte.
»Das scheint eine Art Spinnenfängerin zu sein«, meinte Bettina und beobachtete, wie zwei Feuerwehrmänner, einer der Polizisten und die Frau im Toilettengebäude verschwanden.
Lange Zeit passierte gar nichts. Die Menschen wurden unruhig, und auch der draußen gebliebene Beamte begann, nervös hin und her zu laufen.
Endlich öffnete sich die Tür, und die kleine Prozession kam wieder heraus. Als Letztes die Frau mit Tasche und Käfig in der einen und der riesigen Spinne in der anderen Hand.
Ein aufgeregtes Gemurmel ging durch die Gruppe der Wartenden.
»Wir haben hier ein Prachtexemplar einer Mexikanischen Riesenspinne. Wirklich sehr schön und besonders groß.« Lachend hielt die Frau das Tier in die Luft. »… und aus Plastik, meine Damen und Herren. Die ganze Aufregung war umsonst. Da hat sich jemand einen recht derben Scherz erlaubt. Was machen wir jetzt mit dem Tierchen?«, fragte sie etwas leiser den Polizisten, der offensichtlich das Sagen hatte.
Dieser überlegte kurz und fragte dann in die Runde: »Ist zufällig noch diejenige da, die die Spinne als Erste entdeckt hat?«
Schüchtern ging Sonjas rechter Arm nach oben.
»Willst du das Teil als Andenken haben?«, fragte der Polizist, und Sonja nickte mit hochrotem Kopf.
2. Kapitel
Während Sabine die ersten Teller und Untertassen auf den Tisch stellte, zählte sie in Gedanken kurz durch, wer denn überhaupt kommen würde. Da waren Raster und Philo, ihre beiden Mitbewohner, dann ihre Schwester mit Kind, ihr jüngster Bruder und sie selbst natürlich. Machte sechs. Das passte noch gut an den großen Tisch in der chaotischen Küche der kleinen WG, wo sich sowieso das tägliche Leben abspielte. Das gemeinsame Wohnzimmer wurde so gut wie nie genutzt, außer wenn, wie heute Abend, zu einer Party eingeladen wurde. Sabine hatte Geburtstag und wurde 40 Jahre alt. Es war ein Freitagnachmittag im Oktober, und die Feierlichkeiten sollten mit einem Kaffeetrinken in kleinem Kreis beginnen.
Wie schön wäre es gewesen, wenn ihre beiden anderen Brüder auch hätten kommen können. Aber sie wohnten beide in Bayern, hatten Familie und waren beruflich sehr eingespannt. Da hatte ein Anruf am Morgen reichen müssen. Sabine unterbrach ihre Tätigkeit und schaute durch das Küchenfenster auf den Südwestfriedhof, der das Dortmunder Kreuzviertel in dieser Richtung begrenzte. Noch lieber als ihre Brüder hätte sie natürlich ihre eigene Familie um sich gehabt. Einen Mann, vielleicht zwei oder drei Kinder, die sie heute so richtig verwöhnen würden. Halt im klassischen Sinne: Blumen, vielleicht ein kleines Schmuckstück … Aber Dr. Sabine Funda war Single. Und ganz tief innen drin wusste sie auch genau, woran das lag.
Entschlossen schüttelte sie den Kopf, dass ihre halblangen dunkelblonden Haare um ihr hübsches Gesicht herumfegten, und konzentrierte sich wieder auf das Tischdecken.
In diesem Augenblick hörte sie einen Schlüssel in der Wohnungstür. Diese sprang auf, und das anschließende Stöhnen bewies Sabine sofort, dass es sich nur um Raster handeln konnte, der den Hausflur betrat.
»Hallo, Hans!« Sabine war einer der wenigen Menschen, die Hans Schulz bei seinem richtigen Namen nennen durften. Die meisten nannten ihn aufgrund seiner hellblonden Rastalocken, die er sich vor etwa 20 Jahren in der Karibik hatte machen lassen, »Raster«(das eigentlich richtige Rasta war ihm einfach zu weiblich). Die Zeit damals war geprägt von Surfen, Steeldrums, Grasrauchen und Rum in allen denkbaren Kombinationen. Stolz war er nicht auf diese Epoche seines Lebens, zumal sie ihn auf schmerzhafte Weise auch an die Umstände erinnerte, die ihn in jungen Jahren zu diesem Ausreißen gebracht hatten. Aber sie gehörte nun einmal zu ihm wie eben diese Frisur.
»Hallo, mein Engel«, feixte er und nahm Sabine in den Arm. »Nochmals alles Gute! Hast du heute gar keinen Einsatz? So ein richtig feiner Geburtstagseinsatz mit viel Blut und Knochenbrüchen wäre doch genau das Richtige, oder?«
»Raster, lass das. Du weißt, dass ich das nicht lustig finde. Komm, mach dich lieber mal nützlich.«
Sabine war Notärztin und fuhr unregelmäßig teils für die Städtischen Kliniken, teils für die »Malteser« auf den Rettungsfahrzeugen. Sie wollte sich nicht durch eine Festanstellung in einem Krankenhaus oder durch eine Praxis binden. Auch das war Teil ihres komplizierten Lebenskomplexes.
»Ich hab dir was mitgebracht. Hier!«, und damit überreichte Raster Sabine ein kleines Kästchen mit einer bunten Schleife.
»Kann ich das nachher auspacken? Ich muss jetzt erst fertig werden. Nicht böse sein, okay?«
»Du weißt, ich kann dir nicht böse sein«, schmachtete Raster, der, seit sie vor 18 Jahren zusammen mit Philo in diese WG gezogen waren, Sabine umschwärmte und ihr zu jeder möglichen und unmöglichen Gelegenheit seine Liebe gestehen musste.
»Du kannst Sahne schlagen, den Kuchen aufschneiden, und mir fällt bestimmt noch mehr ein«, lachte Sabine und platzierte das Kästchen zunächst auf einer IKEA-Anrichte neben der Spüle.
Es klingelte, und Raster sprang zur Haustür, um den angesagten Pflichten entkommen zu können. Herein kamen Sabines Bruder Ralf, ihre Schwester Hanna mit Tochter Klarissa, und als Raster gerade die Tür wieder schließen wollte, kam auch Philo die Treppe herauf.
Philo, der dritte Bewohner der WG hieß eigentlich Friedrich Sachse, wurde aber von allen – auch von Sabine – nur Philo genannt. Er war Philosophiedozent an den Universitäten Dortmund und Bochum, erzkonservativ und vollgestopft mit Allgemeinwissen. Doch wer meinte, Philo wäre eine unsympathische Type, der wurde schon nach fünf gemeinsamen Minuten eines Besseren belehrt. Seine konservative Art war hauptsächlich auf Äußerlichkeiten wie seine biedere Kleidung beschränkt, und sein fulminantes Wissen nutzte er nie als Vehikel, sich selbst in den Vordergrund zu stellen. Im Gegenteil: Philo war eher bescheiden, wenn nicht sogar schüchtern und durchweg liebenswert. Heute trug er einen karierten Pullover, darunter ein Button-down-Hemd, eine hellbeige Tuchhose und ein Paar Collegeslipper, die nicht so ganz zu seinem Alter – er war auch immerhin 39 – passen wollten.
Mit wie immer streng gescheiteltem Haar lief er auf Sabine zu und umarmte sie. »Heute Morgen musste ich schon so früh los. Ich konnte dir noch gar nicht gratulieren. Alles Gute zum Geburtstag!«
Jetzt erst kamen Sabines Geschwister und ihre Nichte zum Gratulieren und man setzte sich anschließend an den Tisch, wo ein munteres Geplauder anfing. Man kannte sich und die Küche, und alle außer Raster packten mit an, sodass schon bald mit dem Kaffeetrinken und Kuchenessen begonnen werden konnte.
Mittlerweile hatten sich auf der Anrichte drei weitere Geburtspäckchen eingefunden und, nachdem der erste Hunger gestillt war, wurde Sabine aufgefordert, doch endlich die Geschenke auszupacken.
Die elfjährige Klarissa hatte Sabine in den Sommerferien ein Bild gemalt. Zu sehen war der Teide auf Teneriffa, wo die kleine Familie ihren Urlaub verbracht hatte. Ralf hatte sich an ein Fläschchen Parfüm gewagt, von dem er wusste, das es Sabine mochte, und ihre Schwester hatte einen Gutschein für ein gemeinsames Wochenende in Berlin gebastelt, worüber sich Sabine besonders freute.
Nun blieben nur noch die beiden sehr ähnlich aussehenden Kästchen von Raster und Philo übrig.
Sabine entfernte die erste Schleife und hob neugierig den Deckel. Erschrocken streckte sie das Päckchen weit von sich. »Bah, was ist das denn?«
Neugierig geworden, schauten nun auch die anderen in das kleine Kästchen hinein.
Philo reagierte als Erster. »Was? Du auch? Hast du etwa dieselbe Idee gehabt?« Entgeistert schauten sich Raster und er an.
Sabine hatte mittlerweile die etwa sechs Zentimeter große Plastikspinne mit naturgetreuer Behaarung und acht relativ kurzen Beinen aus dem Karton geholt. Klarissa war mit einem lauten Schrei auf die Toilette geflüchtet. »Und dir ist auch nichts anderes eingefallen?«, fragte sie Philo, während sie sich anschickte, das zweite ähnliche Kästchen zu öffnen.
»Doch! Das ist eine ganz andere Spinne als die da«, meinte Philo. »Auch viel schöner, wie ich finde.«
Sabine hatte die zweite inzwischen ausgepackt und setzte sie mit leicht angewiderter Miene neben die erste auf den Küchentisch. Philos Spinne war tatsächlich ein ganz anderes Exemplar. Insgesamt etwas kleiner mit dünneren Beinen, von denen die vorderen beiden hochgestellt waren, wodurch die Spinne den Eindruck vermittelte, im Sprung zu sein.
»Was ist das für eine?«, fragte Raster neugierig.
»Eine Brasilianische Wanderspinne«, antwortete Philo stolz. »Wird bereits mit 60 Euro gehandelt. Oh, das ist ja ein Geschenk. Vergiss das schnell wieder, Sabine!« Entschuldigend hob er mit rotem Kopf beide Hände.
»Also kann mich hier mal irgendwer aufklären? Ich verstehe nur Bahnhof.« Hanna schaute erwartungsvoll von einem zum anderen.
»Hast du das denn gar nicht mitgekriegt? Das geht schon seit drei Monaten so. Seit dieses Mädchen aus Münster die erste Spinne auf der A45 gefunden hat, tauchen jetzt überall in Deutschland in öffentlichen Toiletten, in Warenhäusern und in Bahnhöfen diese Spinnen auf. Mittlerweile werden die gesammelt, getauscht und bei eBay mit Gewinn wieder veräußert.«
Sabine schaute verdutzt zu Raster herüber. Sie konnte sich nicht daran erinnern, wann er zuletzt eine solch lange Rede gehalten hatte. Und sogar mit einem abgeschlossenen Satz am Ende. Es war nämlich eine von Rasters unangenehmeren Eigenarten, dass er sehr häufig mitten im Satz abbrach, weil er meinte, der Rest würde sich schon aus dem bisher Gesagten ergeben. Danach war er einfach zu faul, um weiterzusprechen.
»Und, sammelst du die etwa auch?«, fragte Hanna ihre Schwester.
»Nein. Bis jetzt nicht. Aber meine lieben Mitbewohner wünschen sich das wohl.«
»Naja. Ich dachte, einer von uns müsste doch mal damit anfangen. Und da du am meisten Zeit von uns hast …«, sagte Philo und Raster ergänzte: »außerdem kann man mit ein bisschen Geschick richtig Gewinn damit machen. Was glaubst du, was diese beiden Tierchen hier in zwei Monaten wert sind!«
Sabine zuckte ergeben mit den Schultern. »Lass sie uns trotzdem jetzt erst einmal wegräumen, damit die arme Klarissa vom Klo kommen kann.«
3. Kapitel
Der Mann, der sich selbst »Dompteur« nannte, tigerte unruhig vor dem Wohnzimmerfenster seiner Wohnung in Dortmund-Hörde hin und her. Er konnte sich noch immer nicht daran gewöhnen, keinen Garten mehr zu haben, in dem er, wann er wollte, spazieren gehen, die Blumen und Büsche pflegen und den Rasen schneiden konnte. Aber es ging nicht anders. Das Haus in Berghofen hatte er verkauft und war in diese Dreizimmerwohnung gezogen. Er hatte den Erlös gebraucht. Zumindest jetzt noch. Was später war, ließ ihn kalt. Zusammen mit dem Geld aus der Lebensversicherung seiner Frau hatte er nun ein kleines Vermögen auf seinem Girokonto, mit dem er ohne finanzielle Sorgen seine Pläne verwirklichen konnte. Und die waren kostspieliger, als er anfangs gedacht hatte.
Es ging darum, die zweite Phase einzuläuten. Und das gestaltete sich schwieriger als vermutet.
Der Dompteur setzte sich im Wohnzimmer an seinen PC, öffnete den Internetbrowser und suchte eine spezielle Schweizer Seite. Aufmerksam las er die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch und nickte schließlich zustimmend. Nicht, dass er diesen Text zum ersten Mal gelesen hätte, aber er wollte auf Nummer sicher gehen.
In Gedanken ging er die nächsten Schritte zum vielleicht hundertsten Mal durch. Ein Problem waren die Transportbehälter, darum musste er sich noch kümmern. Er wollte sich nicht auf das verlassen, was ihm die Schweizer anbieten würden. Zum anderen musste er seinen Flug nach Südamerika planen, um die Spritzen zu besorgen.
Gedankenverloren ging er nach nebenan in das ursprüngliche Schlafzimmer, in dem er aber nie schlief, sondern das zu einem hochmodernen Terrarium umgebaut worden war.
Glaskästen in verschiedenen Größen standen auf Schränken mit Schubladen, in denen Werkzeuge, Kisten mit den ersten toten und lebenden Insekten, Würmer sowie Erde und Ersatzlampen verstaut waren. Über den Glaskästen hingen unterschiedlich starke Rotlichtlampen. Auf dem Fußboden hatte er einfache, aber gut zu pflegende Steinplatten verlegt. Alles war bereit für den Einzug seiner »Krieger«, wie er die zu erwartenden Spinnen nannte.
4. Kapitel
Polizeihauptmeister Thomas Bechel hatte gerade in sein Wurstbrötchen gebissen, auf das er sich schon den halben Tag gefreut hatte, als sein Telefon klingelte. Sicherheitshalber guckte er sich um, ob nicht ein Kollege das Gespräch annehmen konnte, aber er war der einzige Beamte in dem Großraumbüro der Heidelberger Stadtpolizei.
»Bechel!«, nuschelte er, da er noch die Hälfte des Bissens im Mund hatte.
»Hier spricht Polizeimeister Katja Klauber. Wir bräuchten die Hilfe der Zentrale. Wir haben wieder eine Spinne, und zwar auf dem Schloss. Und außerdem eine Verletzte.«
»Und was sollen wir da? Sammeln Sie die Spinne ein, schenken Sie sie Ihren Kindern oder verkaufen Sie sie, ist mir völlig egal. Aber lassen Sie mich bitte mit diesem Blödsinn in Ruhe. Wir haben hier Wichtigeres zu tun.« Bechel hatte sich gerade richtig in Rage geredet und wollte eigentlich zur Bekräftigung seiner Ansage den Hörer auf die Gabel knallen, als er innehielt. »Was haben Sie gesagt? Bitte wiederholen!«
»Ich sagte, wir haben eine Verletzte. Diese Spinne hier ist eindeutig echt. Der Frau geht es nicht gut. Wir mussten sie in die Uniklinik bringen lassen. Jetzt haben wir aber noch das Problem mit der Beseitigung. Helfen Sie uns?«
»Äh, natürlich. Sperren Sie alles großräumig ab. Wir kommen.« Damit legte Bechel auf und musste sich erst einmal sammeln. Das Brötchen hatte er vergessen. Wen musste er in einem solchen Fall benachrichtigen? Er hatte zugegebenermaßen keine Ahnung. Schließlich rief er die Feuerwehr an, erklärte den Sachverhalt und bat diese, einen Kammerjäger mitzubringen. Dann informierte er noch kurz seinen Vorgesetzten, der aber kaum zuhörte, und machte sich mit einem Kollegen auf den Weg zum Schloss.
Als Thomas Bechel und Polizeihauptmeister Erwin Schmidt ankamen, war die Feuerwehr bereits eingetroffen. PM Klauber hatte den Bereich mit rot-weißem Tatortband weiträumig abgeriegelt. Offensichtlich saß die Spinne in einer der öffentlichen Toiletten.
Bechel und Klauber erklärten den Feuerwehrleuten sowie dem Kammerjäger, worum es ging. Die Frage, um welche Spinnenart es sich denn handeln würde, konnte jedoch keiner beantworten. Die gebissene Frau war die Einzige, die sie gesehen hatte, und die war längst im Krankenhaus.
Die Männer gingen mit einem etwas mulmigen Gefühl die Treppenstufen herab und betraten das Halbdunkel des Kellergewölbes, in dem sich die Toiletten befanden. Taschenlampen wurden eingeschaltet, und die Lichtkegel huschten von einer Ecke zur anderen. Schließlich wurden sie fündig. Die Spinne saß neben einem Abfalleimer in der Damentoilette und versuchte zu fliehen, als das grelle Licht der Taschenlampen sie streifte. Der Kammerjäger, bewaffnet unter anderem mit einem Plastikgefäß stürzte sich beherzt auf das Tier und stülpte das becherähnliche Ding über den vielleicht zwei Zentimeter großen Spinnenleib. Mit Beinen hatte sie eine Spannweite von etwa sechs Zentimeter und war damit ein mittelgroßes Exemplar. Ansonsten zeigte das Tier keine Besonderheiten. Es war kaum behaart, und die Proportionen von Leib zu Beinen entsprachen in etwa denen unserer Hausspinnen.
»Das hätten wir auch hingekriegt«, meinte Bechel zu seinem Kollegen Schmidt. »Dann wollen wir mal wieder. Wegen so einem Tierchen so ein Aufstand.«
»Naja. Aber die Frau ist von dem Biss eindeutig erkrankt«, meinte Katja Klauber, die das Gemurmel mitbekommen hatte. »So harmlos kann das folglich nicht sein. Wir sollten das Tier auf jeden Fall untersuchen und klassifizieren lassen.«
»Machen Sie das, Kollegin«, sagte Bechel und stieß Schmidt grinsend in die Seite. »Und vergessen Sie nicht, uns einen Bericht zukommen zu lassen!«
»Hohle Ignoranten!«, murmelte PM Klauber, als die beiden außer Hörweite waren, und stellte sich zu den Feuerwehrleuten und dem Kammerjäger, die noch angeregt diskutierten, um was für eine Spezies es sich denn nun handeln würde. Am meisten Ahnung hatte interessanterweise nicht der Kammerjäger, sondern Feuerwehrmann Thorsten Jäger, der ein leidenschaftlicher Spinnenkenner und -sammler war. Er war sich absolut sicher, dass es sich um eine Fischernetzspinne handelte, die zwar eigentlich nur im Mittelmeerraum und in England vorkomme, aber vom Aussehen her gäbe es gar keine andere Möglichkeit.
Katja Klauber rief sofort in der Heidelberger Uniklinik an und ließ sich mit dem Arzt verbinden, der die gebissene Frau behandelte. Sie gab ihm die vermutete Spinnenart durch, worauf der sich erleichtert zeigte und meinte, in diesem Fall wäre die Behandlung nicht kompliziert. Die Frau könnte voraussichtlich schon am nächsten Tag wieder nach Hause.
Drei Tage später lag der vollständige Bericht inklusive bestätigter Artenbestimmung, Symptombeschreibung und Therapie bei einer Bissverletzung auf Bechels Schreibtisch. Unterschrieben von PM Katja Klauber.
Bechel schaute sich wieder in seinem Büro um, konnte keinen Kollegen entdecken und zeriss kurzerhand den Bericht in viele kleine Schnitzel. Sollte er sich wegen so einer Geschichte unnötig Arbeit aufhalsen, seinen Chef informieren oder sogar selbst noch Nachforschungen betreiben? Nein, ganz sicher nicht.
Die Geschichte wäre komplett untergegangen, wäre da nicht zufällig der Freund der gebissenen Frau, ein gewisser Stefan Rieger, seines Zeichens freier Journalist für verschiedene Zeitungen und Magazine in Heidelberg und Mannheim, gewesen. Dieser wollte den Fall zu gerne ausschlachten und für seine Reputation nutzen. Das tat er dann auch, was ihn zwar die Freundin kostete, aber 300 Euro Extraeinkünfte einbrachte.
Immerhin brachte er noch vor dem Ende seiner Beziehung in Erfahrung, dass es nur zu dem Unfall gekommen war, weil seine Exfreundin meinte, ein besonders schönes Exemplar der so hoch gehandelten Plastikspinnen gefunden zu haben. Als sie sich anschickte, die Spinne aufzuheben – diese saß gerade in einem Waschbecken der Damentoilette und hatte keine Fluchtmöglichkeit – war das vermeintliche Plastikteil plötzlich lebendig geworden, auf ihre ausgestreckte Hand gelaufen und hatte zugebissen. Der Schreck war in diesem Moment größer als der Schmerz, der sich allerdings dann heftig und schnell auf den ganzen Arm ausbreitete. Außerdem war ihr schlecht geworden, sodass ihre Freundin, der sie das Heidelberger Schloss zeigen wollte, sofort den Notarzt angerufen hatte.
5. Kapitel
Die Luft im »B-Trieb« ist wesentlich besser als früher, dachte Sabine, die an einem kleinen Ecktisch saß, ihren Kaffee trank und sich über das landesweite Rauchverbot freute. Es war Mittag und sie wollte sich mit Philo und Raster zu einem kleinen Mittagessen treffen. Die hausgemachten Frikadellen hier waren einfach der Hit.
Vor Jahren hatten sie sich öfter im »Komma«, einer Kneipe am Nordmarkt getroffen. Vor allem samstags gab es damals ein festes Ritual: Zunächst ein kleines bescheidenes Frühstück zu Hause, dann ging man auf den Nordmarkt, um frische Lebensmittel fürs Wochenende einzukaufen und danach ein deftiges Mittagessen im »Komma«zu genießen. Diese Besuche waren allerdings seltener geworden, seit bulgarische und rumänische Wirtschaftsflüchtlinge, Prostituierte und die vielen, die die mitgebrachte Armut schamlos für sich ausnutzten, den Dortmunder Norden bevölkert hatten. Die alteingesessenen und gut integrierten Türken, Italiener, Kurden, Spanier und Portugiesen waren aus einigen Straßenzügen schon komplett verdrängt worden, und entsprechend fehlten auch so manche lieb gewonnene Stände auf dem Wochenmarkt. Die ganze Atmosphäre, die noch wenige Jahre zuvor an das alte Kreuzberg in Berlin erinnert hatte, hatte sich massiv geändert. Seitdem trafen sie sich hier im »B-trieb«, einer Kneipe ganz in der Nähe ihrer Wohnung an der Kreuzstraße.
Sabine schaute auf die Uhr. Die beiden schienen sich zu verspäten. Macht nichts, sie hatte Zeit. Den Hauptteil und die Stadtteilseiten der mitgebrachten »Ruhr-Nachrichten« hatte sie bereits gelesen. Dann würde sie eben noch ein bisschen weiter schmökern.
Auf Seite vier fand sie einen Artikel, der sie stutzig machte. In Heidelberg war eine Frau von einer Spinne gebissen worden, die sie für eine dieser Plastiktiere gehalten hatte. Was Sabine verwunderte, war die Tatsache, dass das Tier zu einer in Deutschland nicht vorkommenden Art gehörte. Wie war das möglich? Wovon man schon einmal hörte oder las, war, dass fremde Spinnen mit Bananenkisten aus dem außereuropäischen Ausland eingeschleppt wurden und dann in Lebensmittelläden Aufsehen erregten. Aber auf einer Toilette, gerade so wie diese Spielspinnen? Weit ab von einem Lebensmittelverkauf? Das war doch äußerst eigenartig. Die Polizei hatte sich hierzu noch nicht geäußert. Wahrscheinlich weil der Biss nicht lebensgefährlich und die Frau bereits wieder aus dem Kranknehaus entlassen worden war. Sabine nahm sich trotzdem vor, ihren beiden Freunden davon zu erzählen, denn auch die waren ganz der Sammellust erlegen. Als deutlich wurde, dass sich ihre Freude über die beiden geschenkten Tierchen in Grenzen hielt, hatten Philo und Raster kurzerhand gemeint, sie würden das übernehmen und hatten Sabine stattdessen zum Essen eingeladen. Seitdem verging kein Tag, an dem nicht bei eBay geboten wurde, Internet-Sammelbörsen konsultiert und Bekannte angerufen wurden, die »großartige« Angebote über »ganz seltene« Exemplare offerierten. Sabine wollte nur vermeiden, dass ihnen etwas Ähnliches wie der Frau in Heidelberg passierte, sollten sie mit ihrem Enthusiasmus einer echten Spinne begegnen.
Die Tür öffnete sich, und herein kam Philo. Gezielt steuerte er Sabines Tisch an, machte dem Wirt ein Zeichen mit der Bitte um ein Glas Wasser und ließ sich auf einem Stuhl neben Sabine nieder.
»Kommt Raster nicht?«, fragte Sabine erstaunt.
»Nee. Der hat mich vorhin angerufen. Er hat noch im Bochumer Rathaus zu tun. Die haben schon wieder Probleme mit ihrem Server.«
Raster war frei arbeitender Informatiker, programmierte für Spieleentwickler und betreute nebenbei die Netzwerke der Rathäuser und Stadtwerke in Bochum und Dortmund.
Sabine beobachtete Philo verstohlen von der Seite. Irgendetwas war heute anders. Aber sie konnte es noch nicht recht einordnen. »Und? Wo kommst du jetzt her?«, fragte sie. Tatsächlich: Philos Gesichtsfarbe wurde eine Spur dunkler, und die Augen huschten unruhig von links nach rechts.
»Äh, von der Uni. Ich hatte eine Vorlesung über« – Pause – »Nietzsche. Jaja, der alte Nietzsche.«
Hier stimmte doch was nicht. Sabine nahm Philos Gesicht in ihre Hände und drehte es zu sich herüber. »Kannst du mir bitte erzählen, was los ist? Du verheimlichst mir doch etwas.«
Philo entzog sich Sabines Griff. »Es ist nichts. Jedenfalls nichts Wichtiges, glaub mir. Ich kann dir das jetzt nicht erklären, okay?«
»Klar, wenn du meinst.«
Philo nickte erleichtert. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, irgendjemandem von seinem heimlichen Verhältnis mit einer seiner Studentinnen zu erzählen. Andererseits war die Tatsache, gerade Sabine etwas zu verheimlichen, in seinen Augen ein Sakrileg. Aber es ging einfach nicht. Noch nicht. Er musste sich selbst erst einmal klar werden, was das für ihn bedeutete. Es war seine erste Beziehung seit … Nein, sei ehrlich! Es war seine erste Beziehung überhaupt. Und das mit 39 Jahren. Er schüttelte den Kopf. Wenn er nur mit irgendwem über all das reden könnte. Aber es ging nicht. Nicht einmal mit Sabine. Dazu schämte er sich zu sehr.
»Alles in Ordnung?«, fragte sie gerade, die sein Kopfschütteln registriert hatte, das nach dem vorhergehenden Nicken irritierend wirkte.
»Jaja!«
»Sag mal, hast du schon von dem Spinnenbiss in Heidelberg gehört?«, fragte Sabine, um das Thema endgültig zu wechseln.
Wieder nickte Philo. »Ja. Habe ich heute Morgen in der Zeitung gelesen. Ganz komische Sache. Diese Fischernetzspinnen wurden bisher noch nie durch die bekannten Wege wie Lebensmittelkisten oder Ähnliches nach Deutschland eingeschleppt.«
»Woher weißt du das? Stand das alles in deiner Zeitung?«
»Nö. Das weiß ich halt. Ich kenn mich ein wenig mit Spinnen aus. Jedenfalls ist das tatsächlich so ungewöhnlich, dass ich mich frage, warum die Polizei noch nicht reagiert hat.«
»Die Polizei?«, fragte Sabine. »Was hat denn die damit zu tun? Das war doch ein Unfall.«
»Ja schon. Aber man muss sich fragen, ob nicht Mutwillen dahinter steckt. Verstehst du?«
Sabine schüttelte den Kopf.
»Na ja. Pass auf! Jemand wird gebissen, wie zufällig. Aber ausgerechnet jetzt, wo alle Welt auf Spinnensuche ist. Und dann auch noch von einem so seltenen Exemplar. Das riecht für mich nicht gerade nach Zufall.«
»Ich verstehe«, meinte Sabine. »Vielleicht gibt es da eine Art Trittbrettfahrer, der die allgemeine Spinnensammelwut genutzt hat und mal sehen will, ob man mit dieser Masche jemanden ernsthaft verletzen kann.«
»Zum Beispiel«, bestätigte Philo. »Oder das Ganze ist von langer Hand geplant«, sinnierte er leise.
»Was meinst du?«, fragte Sabine.
»Ach nichts. Ich hab nur laut gedacht.«
Genauso oder zumindest sehr ähnlich dachte im selben Moment Kriminalhauptkommissar Friedbert Kusel vom BKA in Wiesbaden über den Fall. Er saß an seinem Schreibtisch, las den entsprechenden Artikel in einer Wiesbadener Zeitung und strich sich nachdenklich über sein glatt rasiertes Kinn. Kusel war bekannt für eine gewisse Behäbigkeit im Amt, aber genauso für eine Beharrlichkeit, die seinesgleichen suchte. Zusammen mit einem Kollegen war er von seinem Vorgesetzten zwei Wochen zuvor beauftragt worden, diese eigenartige Spinnensache im Auge zu behalten. Es war natürlich keine Sonderkommission gebildet worden, warum auch? Jedoch bei Dingen, die nicht klar durchschaubar waren, aber das gesamte Staatsgebiet betrafen, wollte man kein Risiko eingehen.
Und jetzt dieser Unfall in Heidelberg. Wenn es denn ein Unfall war? Kusel war sich nicht sicher. Er würde die Sache doch noch genauer im Blick halten müssen. Irgendwie kam ihm das Ganze merkwürdig vor.
6. Kapitel
Der Dompteur lehnte sich entspannt zurück und klappte das Tischchen nach oben. Das Essen hatte ihm entgegen seiner Erwartungen geschmeckt. Jetzt wollte er den Rest des zwölfstündigen Fluges von Rio de Janeiro nach Frankfurt schlafend verbringen. Müde genug war er. Eigentlich war es vollkommener Blödsinn gewesen, wegen fünf Ampullen und einigen Transportkästen nach Brasilien hin und gleich wieder zurück zu fliegen, zumal es das Serum vielleicht auch in Deutschland gegeben hätte. Er brauchte es nur für den Fall, dass er von einem seiner gefährlichsten Krieger bei der Pflege gebissen werden sollte. Aber auf eine diesbezügliche Recherche zu Hause hatte er sich nicht einlassen wollen. Zu groß war die Gefahr, dass jemand hellhörig werden könnte. Also was soll’s. Die paar tausend Euro waren gut investiert. Er musste nur konzentriert bleiben. Bis jetzt war alles nur ein Spiel. Sobald er aus der Schweiz zurück war, wurde es ernst. Und dann ging hoffentlich endlich sein Plan auf.
Es war schon erstaunlich, welche Energie er in den letzten Monaten aufgebracht hatte. Wenn er da an die erste Zeit des Alleinseins zurückdachte …
Er hatte seinen Beruf als Busfahrer geliebt. Finanziell wäre diese Beschäftigung eigentlich nicht nötig gewesen. Als seine Frau noch da war, hatten sie durch ihre Einkünfte mehr als genug zum Leben gehabt. Aber jetzt war er froh, dass er seine tägliche Routine behalten hatte. Alles ging seinen gewohnten Gang, und das half über die erste Zeit der Trauer hinweg. Dann jedoch kam der Zusammenbruch, und er schaffte es einfach nicht mehr, morgens rechtzeitig aufzustehen. Sein Einsatzleiter hatte anfangs noch verständnisvoll reagiert, als er aber zum vierten Mal nicht pünktlich erschien, gab es die erste Abmahnung. Auch der Alkohol wurde wichtiger. Hatte er vorher gelegentlich mit einem Freund ein Bier getrunken, wurde jetzt der Schnaps zum täglichen Begleiter, immer früher beginnend und in steigenden Mengen.
Freunde hatte er bald keine mehr.
Als es ihm auch körperlich richtig schlecht ging, zwang er sich, zu seinem Hausarzt zu gehen, der ihm strenge Vorhaltungen machte, ihn in eine Entzugsklinik schicken wollte und ihm schließlich eine Überweisung zu einem Psychologen gab.
Dort fühlte er sich wohl und begann, ein wenig von seinem früheren Leben zu erzählen. Allerdings längst nicht alles, und der Therapieerfolg ließ auf sich warten. Der Psychologe verschaffte ihm schließlich zusammen mit dem Hausarzt eine Frühberentung, die er gerne annahm.
Vier Monate waren nun vergangen, seitdem er vollkommen allein war. Er hatte es sich mit seiner restlichen Familie, bestehend aus einer Schwester und einem alten Onkel, verdorben, deren Hilfe er schroff zurückgewiesen hatte. Immer weiter verkroch er sich in tiefe Depressionen und eine eigene Welt, in der Familie oder Freunde keine Rolle spielten. Sein Haus glich schon bald mehr einem Müllhaufen als einer Wohnstatt, und die Kleidung, die er am Leib trug, hatte den Gestank der verdreckten Küche und des Mülls angenommen.
Während seiner Trinkzüge durch diverse Kneipen in Dortmund-Hörde und Umgebung hatte er mehr zufällig als beabsichtigt Antworten auf seine Fragen bekommen.
An einem späten Nachmittag im Herbst war er, bereits leicht angetrunken, in einer Kneipe neben dem Hörder Bahnhof gelandet. Die Tische in dem relativ kleinen Gastraum waren alle besetzt, sodass sich Vollmer zwischen zwei Männer an die Theke quetschte und ein Bier bestellte.
Der rechts von ihm sitzende Mann hob protestierend seinen Kopf. »Hey! Was soll’n das? Wir unterhalten uns hier. Da kannste dich doch nicht einfach so dazwischen drängeln!«
Vollmer, dem das entgangen war, nuschelte eine Entschuldigung und wollte sich mit seinem Bierglas davonmachen.
»Nee du. Bleib mal hier«, meinte der links von ihm Sitzende. »Ist ein interessantes Thema. Hör mal zu, was der Typ da zu erzählen hat.« Und damit wies er mit seinem tropfenden Schnapsglas auf den rechten Mann.
Eigentlich hatte Vollmer keine Lust auf Smalltalk, andererseits war er bereits zu müde, um sich großartig zu wehren. Also blieb er auf seinem Hocker sitzen und hörte mit halbem Ohr zu, was der Kerl neben ihm zu erzählen hatte.
Doch schon nach wenigen Minuten war er hellwach. Das konnte doch wohl nicht wahr sein! Der Typ rechts neben ihm – ein gewisser Klaus Huber und ehemaliger Tierpfleger des Dortmunder Zoos – erzählte gerade vom mysteriösen Verschwinden einiger Tiere vor allem aus dem Amazonashaus. Außerdem behauptete er, von illegalem Tierhandel zu wissen, der wahrscheinlich durch den damaligen Leiter der Terrarien organisiert wurde. »Natürlich verschwinden dabei auch mal ein paar Tierchen«, meinte er. »Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was da alles passieren kann. Ich meine, da sind ja auch richtig gefährliche Spinnen dabei. Stellt euch mal vor, so eine läuft einfach frei durch den Zoo. Nicht auszudenken, wenn da zum Beispiel ein Kind gebissen wird …«
»… Papa. Ich glaub’, mich hat grad eine Wespe in die Wade gestochen. Guck doch mal …«
Vollmer sah seine Tochter noch so deutlich vor Augen, als wäre es gestern gewesen, als sie mit rotem Kopf vor dem Giraffengehege auf ihre rechte Wade zeigte. Er hatte tatsächlich einen kleinen Einstich gefunden, die Sache aber schnell wieder vergessen, bis es Saskia nach wenigen Minuten immer schlechter ging …
Nach ein paar konkreten Fragen war alles klar. Die Antworten, die er schon längst nicht mehr erwartet hatte, lagen plötzlich vor ihm. Doch die Erleichterung blieb aus.
In dieser Verfassung begannen die Träume. Es waren immer dieselben. In diesen Träumen wurde seine Einsamkeit durch kleine Wesen, die spinnenähnlich auf acht Beinen in seine Wohnung drängten, immer weiter reduziert. Er begann, mit diesen Wesen zu sprechen und ihnen zuzuhören. Es wurden mehr und mehr, und bald fingen sie an, seinen Kopf mit Rachegedanken zu füllen. Der Dompteur war seinen Helfern so dankbar, weil sie ihn aus seinen Depressionen geholt hatten.
Die Träume waren anfangs nur sporadisch und natürlich nachts aufgetaucht. Aber nach etwa zwei Wochen sah er die ersten Spinnen auch tagsüber durch seine Wohnung krabbeln. Traum und Wirklichkeit vermischten sich, bis sie eins wurden. Die Tiere fingen an, immer eindringlicher auf ihn einzureden, und er hörte aufmerksam zu. Langsam entwickelte sich ein erster Plan.
Eine seltsame Kraft erfüllte ihn neu. Das Ziel vor Augen, den Wunsch seiner Helferlein zu erfüllen, koste es, was es wolle, machte ihn stark und selbstbewusst und halfen ihm, das Elend seines bisherigen Lebens zu vergessen. Er bemerkte nicht, dass er nur erneut Opfer seiner Vergangenheit geworden war.
Das Chaos verschwand und wurde ersetzt durch Planen und Zielstrebigkeit. Der Psychologe, dem er von seinen Träumen und den neuen Freunden nichts erzählte, klopfte sich selbst in dieser Zeit nach jeder Sitzung auf die Schulter und gratulierte sich zu seiner außerordentlich gelungenen Therapie. Dem Patienten schien es von Tag zu Tag besser zu gehen …
Der Dompteur schlug die Augen auf. Auf dem kleinen Monitor vor ihm konnte er ihre momentane Position des Fliegers erkennen. Kurz vor den Kanarischen Inseln. Also nur noch etwa vier Stunden bis Frankfurt.
Warum war er aufgewacht? Im Flugzeug war alles ruhig. Fast alle Mitreisenden schliefen. Er sah zwei Männer, die sich leise unterhielten, eine Frau, die ihr kleines Kind zudeckte. Aber alles war still. Was hatte ihn also aufgeschreckt? Angestrengt bemühte sich der Dompteur, seinen letzten Traum aufleben zu lassen. Aber da war keine Erinnerung. Nichts. Egal. Wird schon nicht so wichtig gewesen sein. Er schloss erneut die Augen und versuchte, wieder einzuschlafen. Im Moment des Wegdämmerns fiel es ihm ein. Er war aufgewacht, weil er plötzlich das sichere Gefühl hatte, einen Fehler gemacht zu haben. Er meinte, auch zu spüren, dass er beim Aufwachen noch gewusst hatte, was. Aber es war weg. Außer dieser quälenden Gewissheit, etwas übersehen zu haben.
Ab jetzt war an Schlaf nicht mehr zu denken.
7. Kapitel
Philo saß nachdenklich am Küchentisch, kaute auf seiner Unterlippe und schaute zu, wie Sabine Paprika für das Chili con Carne schnitt.
»Hallo! Erde an Philo! Ich fragte gerade, ob du die Zwiebeln schneiden könntest?«
»Äh, ja natürlich. Gib schon her!«
»Ich will dich nicht drängen, aber noch mal zum Mitschreiben. Wenn du was auf dem Herzen hast, kannst du jederzeit mit mir sprechen. Alles klar?«