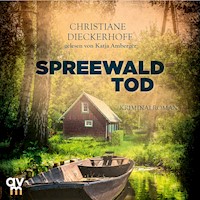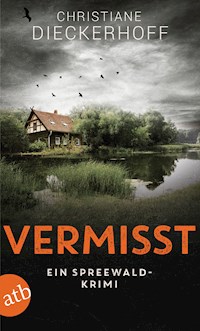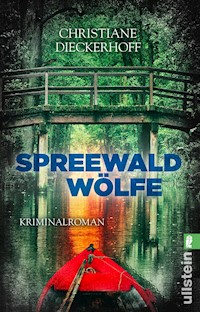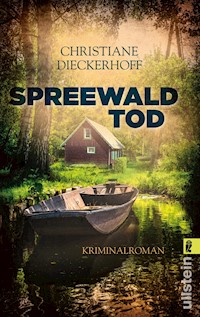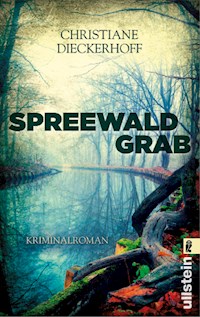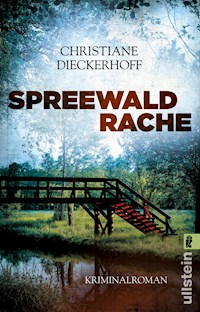
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein eBooks
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
Tödliche Fehde im Spreewald Ein junger Mann wird blutüberströmt auf einer kleinen Spreewald-Insel gefunden. Er überlebt nur knapp. Kurz darauf finden Anwohner einen toten Obdachlosen in einer Datsche. Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner steht vor einem Rätsel. Die beiden Männer kannten sich nicht, trotzdem hängen die beiden Fälle offenbar zusammen. Ihre Nachforschungen bringen Erstaunliches ans Licht: Eine alte Fehde zwischen den Fährleuten von Lübbenau führte schon zwanzig Jahre zuvor zu einem tödlichen Unfall. Oder was es Mord? Klaudia Wagner ermittelt unter Hochdruck, denn der Streit zwischen den Kahnführer-Familien ist neu entfacht und fordert weitere Opfer ... Liebe, Verrat, Mord: Auch im Spreewald tun sich menschliche Abgründe auf
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
Kriminalobermeisterin Klaudia Wagner kann sich im Moment nicht über zu viel Stress im Job beschweren: Es geht ruhig zu bei der Kripo Lübben im Spreewald. So ruhig, dass Klaudias Chef seiner Abteilung eine Teambildungsmaßnahme verordnet hat: einen Lehrgang im Wursten. Klaudia ist wenig begeistert und wünscht sich schon fast, dass ein Mordfall sie von der gewöhnungsbedürftigen Aufgabe erlöst. Doch als dann tatsächlich aus dem Novembernebel ein Polizeiboot mit Kollegen von der Spurensicherung auftaucht, hat Klaudia ein schlechtes Gewissen: Auf einer der kleinen Inseln im Spreewald wurde ein junger Mann brutal niedergeschlagen. Auch eine Leiche lässt nicht lange auf sich warten. Bei ihren Ermittlungen stößt Klaudia auf eine alte Feindschaft zwischen den Kahnführerfamilien von Lübbenau, die auch heute noch Opfer fordert. Klaudia muss tief in die Vergangenheit eintauchen, um den Fall zu lösen …
Die Autorin
Christiane Dieckerhoff, Jahrgang 1960, machte eine Berufsausbildung zur Kinderkrankenschwester, ist Mutter zweier erwachsener Kinder und lebt in Datteln. Sie schreibt vor allem aktuelle und historische Krimis.
Von Christiane Dieckerhoff sind in unserem Hause bereits erschienen:
Spreewaldgrab · Spreewaldtod
CHRISTIANE DIECKERHOFF
SPREEWALD
RACHE
KRIMINALROMAN
Ullstein
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1762-5
Originalausgabe im Ullstein Taschenbuch
1. Auflage April 2018
© 2018 by Christiane Dieckerhoff
© dieser Ausgabe: Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2018
Umschlaggestaltung: zero-media.net, München
Titelabbildung: © alamy
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog – 1993
Der Junge war so wütend, dass er sich selbst den Rückweg abschnitt. Er stieß die Tür zum Bootshaus auf und legte den Riegel vor. Dann erst drehte er sich um, presste den Rücken gegen das sonnenwarme Holz und starrte ins Zwielicht. Abgedeckte Kähne schaukelten auf dem Wasser, und Staub tanzte in der Luft.
»Ich weiß, dass ihr hier seid«, rief er.
Keine Antwort, nur das Knacken des Holzes, das Plätschern der Spree. Trotzdem meinte er, ihren unterdrückten Atem zu hören.
Wahrscheinlich lagen sie in einem der Kähne und hielten die Luft an. Er wusste, dass sie hier waren, und er wusste auch, was sie taten. Sie hatte es ihm gesagt, gelacht hatte sie. Aber es war ein wütendes Lachen gewesen. Wahrscheinlich war sie selbst scharf auf ihn. Schweiß perlte von seinem Haaransatz, es war ein heißer Tag. Ein Tag, an dem man schwimmen ging, kein Tag, um die eigene Schwester zu verfolgen. Mit einer ungeduldigen Handbewegung wischte er Schweißtropfen und Gedanken fort.
»Zieh dich an und komm endlich raus.« Er hatte keine Lust auf ihre Spielchen. Ungeduldig steckte er sich eine Zigarette zwischen die Lippen. »Oder findest du dein Höschen nicht?«
Immer noch keine Reaktion.
»Ich geh hier nicht ohne dich raus, das kannst du dir abschminken. Ausgerechnet einer von denen.« Er nahm die Zigarette aus dem Mund und spuckte seine Verachtung in die Spree. Immer hatten die Klingebiels ihr Fähnchen nach dem Wind gedreht. Erst Nazis, dann überzeugte Kommunisten und schließlich Demokraten. Und immer war es zu ihrem Vorteil gewesen. Alles hatten sie an sich gerissen, dieses Bootshaus, das Wohnhaus am Fließ. Alles. Es war nicht recht, dass die jetzt hier wohnten, in dem Haus, das ihnen gehörte. Aber der alte Klingebiel war nach 1945 schneller Funktionär geworden, als eine Kippe Feuer fing, und hatte Opa bei den Russen angeschwärzt, um es zu kriegen. Nazi sei er gewesen. Dabei war jeder in der Partei gewesen. Opa war im Lager verreckt, während der hier fett geworden war. Nur die Werkstatt im Wald war ihnen geblieben, und von da aus hatten sie neu angefangen. Und jetzt das. Die Genossenschaft hatte er gegen sie mobilisiert, nur weil sie den kleinen Hafen wiedereröffnet hatten. Den Krieg hatte er ihnen erklärt, kaputt machen wollte er sie.
»Komm endlich.« Immer noch keine Reaktion, kein Geräusch, nur das Plätschern der Spree und ein leises Zischen, das er sich nicht erklären konnte.
Wut und Enttäuschung brandeten in ihm auf. Er wandte sich ab. Sie hatte gelogen. Natürlich hatte sie das. Schließlich gehörte sie zu dem Pack. Frustriert steckte er sich die Zigarette wieder zwischen die Lippen, griff nach seinem Feuerzeug, sein Daumen ratschte über das Zündrädchen, und genau in diesem Moment begriff er, woher das Zischen kam, aber es war zu spät: Eine Wolke aus Feuer hüllte ihn ein, fraß sich in seine Haut, versengte seine Haare. Er ließ das Feuerzeug fallen, Wasser, dachte er. Ich muss ins Wasser. Ein Kreischen dröhnte in seinen Ohren. Laut, schrill, voller Schmerzen. Sein eigenes Kreischen. Er warf sich nach vorn, fiel, doch es war nicht die kühle Oberfläche der Spree, die ihn erwartete, sondern Holzbretter. Seine Finger krümmten sich in der Hitze, doch das merkte er schon nicht mehr.
1. Kapitel
Klaudia konnte sich eine Menge unter teambildenden Maßnahmen vorstellen: wandern, bowlen oder von ihr aus auch grillen. Doch das hier gehörte eindeutig nicht dazu. Sie knirschte mit den Zähnen, bis ihr rechtes Ohr klingelte. Wenn sie klug gewesen wäre, hätte sie sich krankgemeldet. Aber sie war nicht klug, nur pflichtbewusst und ein bisschen dämlich. Also war sie vor Tau und Tag am kleinen Hafen am Spreeschlösschen gewesen, um sich mit ihren verfrorenen Kollegen von Schiebschick durch den dichten Novembernebel staken zu lassen. Die Tour endete schließlich auf einer von Erlen gesäumten Lichtung am Rande des Hochwaldes, wo sie ihre Gastgeber Mario und Jana Schenker bereits erwarteten. Auf dem Anleger kläffte ein Hund, der aussah wie eine Mischung aus Dackel und Fuchs und auf den Namen Balduin hörte.
Beim Anblick des halben Schweins, das an einer ausgefahrenen Leiter vor einem Holzschuppen hing, wäre sie am liebsten wieder zu Schiebschick in den Kahn gestiegen, doch der hatte bereits abgelegt. Und den Kahn ihrer Gastgeber konnte sie schließlich schlecht nehmen. Oder vielleicht doch? In Gedanken stieg Klaudia in den schmalen Spreekahn, dessen Borte blau leuchtete. Weit würde sie damit nicht kommen. Sie konnte nicht staken. Also blieb ihr nichts anderes übrig, als sich ein Lächeln in die Mundwinkel zu tackern.
Schenker hatte ihnen in einem Satz das Du angeboten und das Füttern des Hundes verboten und die Truppe dann in ihre Arbeitsplätze eingewiesen. Also stand Klaudia nun an diesem blank gescheuerten Holztisch und trug ein Haarnetz, das im Nacken juckte. Außerdem schützte eine knielange Plastikschürze Fleecejacke und Jeans, und ihre Finger steckten in zu großen Einmalhandschuhen.
Obwohl es ein sonniger Tag werden sollte, lag noch immer dichter Nebel über dem Fließ. Die Novemberkälte kroch durch die Sohlen ihrer Sneaker und wanderte Klaudias Waden hinauf, während sie eine Schüssel unter den Fleischwolf hielt, aus dem eine blassgraue Masse quoll.
»Tolle Idee«, flüsterte sie Petra zu, die die Kurbel drehte. »Hättest du das nicht verhindern können?«
Unauffällig schob Klaudia etwas von der Masse über den Schüsselrand. Mit sicherem Hundeblick hatte Balduin sie sofort als Schwachstelle erkannt und sich zu ihren Füßen niedergelassen.
»Ich hatte ja keine Ahnung.« Mit spitzen Fingern warf Petra weiteren Speck in den Fleischwolf.
Dampf waberte über die Lichtung und verlor sich im schütteren, gelben Laub der Erlen. In der Nähe des Schuppens hing ein eiserner Kessel über einer Feuergrube, in dem Schulterfleisch und Speck kochten.
Das wird die Wurst, hatte der Metzger gesagt. Die beiden Schenkers unterstützten die Kriminalbeamten des Lübbener Polizeireviers, die mit Kochen und dem Vorbereiten der Därme beschäftigt waren oder wie Klaudia und Petra aus fein gewürfeltem Schweinespeck Bindemasse für Blutwürste herstellten.
Der ideale Lebenszweck, schoss es Klaudia durch den Kopf. Die Liedzeile hatte sich in ihr festgesetzt wie der tranige Geruch von gekochtem Fleisch in ihrer Jacke. Mit einem konspirativen Schnaufen meldete sich der Hund zu ihren Füßen, und Klaudia beförderte einen weiteren Klecks passierten Specks über den Schüsselrand.
»Ob PH das im Führungsseminar an der FHPOL gelernt hat?« Wie alle Kollegen kannte Klaudia nur die englisch ausgesprochene Abkürzung. Pi Aitsch. Der Vorname ihres Chefs war das Geheimnis des Lübbener Polizeireviers. Klaudia hob die Hand, um eine Haarsträhne unter das Haarnetz zu schieben. Gerade noch rechtzeitig fiel ihr ein, dass sie gerade den Hund gefüttert hatte, und so pustete sie die Haarsträhne zur Seite.
»Meinst du wirklich?« Die blassgraue Masse stockte.
Klaudia seufzte verstohlen. Petra war zwar eine Seele von Mensch und sie hatte auch einen ziemlich derben Sinn für Humor. Allerdings war Ironie an sie verschwendet. Natürlich glaubte Klaudia nicht, dass irgendein Dozent der Fachhochschule der Polizei ihrem Chef geraten hatte, mit seinem Team Wursten zu gehen. Aber seit er im Sommer ein Personalführungsseminar für leitende Beamte besucht hatte, gehörten zu seinem Vokabular Begriffe wie teambildende Maßnahmen und Mitarbeiterführung. Und dass sie nun hier auf der Lichtung standen, war eine direkte Folge davon.
»Eine Leiche wäre mir lieber gewesen.« Klaudia schaute zu den männlichen Kollegen. Während PH voller Enthusiasmus in dem großen Topf rührte und dabei mit dem Metzger plauderte, gönnte Frank sich eine Zigarettenpause auf dem Anleger der Hütte. Seit dem 1. Oktober waren seine Zeiten als Geheimwaffe aus Königs Wusterhausen gezählt, und er gehörte offiziell zum Team der Kripo Lübben. Nachdem er und Klaudia im Frühjahr einen denkbar schlechten Start miteinander gehabt hatten, verstanden sie sich nach ihrem letzten Fall recht gut.
»Ist dir eine halbe Sau nicht tot genug?«, fragte Petra.
So viel zum Thema verschwendete Ironie, dachte Klaudia. »Was soll man da ermitteln?«, entgegnete sie. »Selbstmord und natürlicher Tod scheiden ja wohl aus.«
»Willst du den Metzger verhaften?« Petra kicherte bei der Vorstellung.
»Und weshalb wollt ihr meinen Bruder verhaften?« Jana stellte ein Tablett mit gut gefüllten Schnapsgläsern auf die freie Fläche neben dem Fleischwolf. »Bedient euch.«
»Schön habt ihr’s hier«, sagte Petra.
»Ja.« Jana schaute sich ebenfalls um. »Mario hat eine Menge Zeit und Geld reingesteckt, um alles wieder herzurichten.«
»Was war das hier? Eine Jagdhütte?« Klaudia musterte das lang gestreckte Holzgebäude, vor dem sie standen.
»Nein«, antwortete Jana. »Meine Familie hat hier bis zur Wende Kähne gebaut.« Sie griff in die Kitteltasche und holte ihr Handy raus. Ihr Daumen wanderte über das Display. Klaudia glaubte schon, dass sie ihr Bilder zeigen wollte, aber Jana steckte es mit einem ungeduldigen Seufzen zurück.
»Kein Netz?«
»Leider.« Für einen Moment wirkte Jana besorgt, aber dann straffte sie die Schultern.
»Ich kann dir meins geben.« Klaudias Smartphone brachte es immerhin auf zwei Balken. Wenn auch nur intermittierend.
»Nicht nötig.« Jana lächelte wieder. »Wollt ihr mal schauen?« Sie blickte von Klaudia zu Petra. »Wir vermieten auch. Alles komplett eingerichtet.«
»Später vielleicht.« Klaudia hatte wenig Lust, eine Ferienwohnung zu besichtigen. »Steckt bestimmt viel Herzblut drin«, fügte sie hinzu, um ihrer Ablehnung die Schärfe zu nehmen.
»Ja.« Jana Schenker sah zu ihrem Bruder, der mit einem langen Stecken im Wurstkessel rührte. »Er liebt diesen Ort. Ich glaube, er hätte auch gerne Kähne gebaut.« Sie lächelte versonnen. »Aber man kann halt nicht immer machen, was man gerne möchte.«
»Wem sagst du das.« Klaudia dachte an ihr warmes Bett.
»Nimm dir einen«, forderte Jana sie auf. »Hilft gegen die Kälte.«
Warum nicht, dachte Klaudia. Sauf ich mir den Tag halt schön. Sie zog die Handschuhe von den Fingern und nahm sich ein Schnapsglas. Misstrauisch schnupperte sie daran.
»Keine Angst.« Jana Schenker nahm ebenfalls ein Glas vom Tablett. »Wir vergiften euch jetzt nicht mit Gurkenschnaps.«
»Birne, oder?« Klaudia atmete den Duft nach sommerwarmer Birne ein. So kann man sich täuschen, dachte sie, weil sie Jana für Marios Frau gehalten hatte. Doch jetzt, wo sie wusste, dass sie Geschwister waren, fiel ihr auch die familiäre Ähnlichkeit auf. Beide Schenkers waren eher kräftig gebaut und hatten dünne, mehr dunkle als blonde Haare und rote Wangen, wie Menschen, die viel an der frischen Luft waren. »Das mit dem Verhaften war übrigens ein Scherz.« Sie prostete Jana zu.
»Wegen dem toten Schwein«, ergänzte Petra.
»Ich verstehe.« Jana reichte Petra, die nun ebenfalls die Handschuhe ausgezogen hatte, ein Schnapsglas. »Aber ihr müsst euch darüber keine Sorgen machen. Die Sau hatte ein wirklich gutes Leben und bis zum Schluss keinen Stress.« Jana erzählte noch eine ganze Menge mehr übers Schlachten, und dass die Schweine bis zur letzten Sekunde in ihrer vertrauten Umgebung seien und keine Ahnung hätten, was sie erwartete. Nicht so wie in den Großschlachtereien, fügte sie hinzu, wo die Schweine schon auf dem Transport Todesängste ausstehen würden.
»Das mag alles sein«, sagte Klaudia, als Jana kurz innehielt, um Luft zu holen. Aber, hatte sie hinzufügen wollen, das war nicht unser Thema. In einer ihrer Hirnwindungen lauerte auch noch ein Scherz, der Jana das Absurde der Situation erklärt hätte. In der Theorie war also alles ganz einfach, aber tatsächlich kam nichts davon über ihre Lippen, sondern sie fragte: »Ist dieser Verrat nicht viel schlimmer?«
In dem Moment, in dem der Gedanke ausgesprochen war, wusste sie, dass sie sich gerade keine Freunde machte. Petra schüttelte den Kopf, als sich ihre Blicke begegneten.
»Wie meinst du das?« Jana nahm das Tablett wieder auf und musterte Klaudia mit der geschulten Geduld einer Verkäuferin im Umgang mit zickigen Kundinnen.
Was sie dachte, stand ihr jedoch in Leuchtbuchstaben auf die Stirn geschrieben: Wieder so eine, die glauben will, dass Fleisch auf Bäumen wächst.
»Ich weiß nicht.« Klaudia kam sich ziemlich dämlich vor, doch jetzt war es für einen Rückzieher zu spät. »Aber ich frage mich schon, wie das sein muss«, sagte sie. »Ich meine, für beide Seiten.«
Klaudia sah den steinigen Weg und die hohen Mauern der Sackgasse, in die sie preschte, konnte aber nicht mehr bremsen. »Wie sich das anfühlt, ein Wesen, das dir blind vertraut, zu töten.« Fast flüsternd fuhr sie fort: »Oder wenn du im letzten Augenblick deines Lebens merkst, dass du dem falschen Menschen vertraut hast.« Sie starrte auf ihr Glas und merkte erst am Zittern ihrer Finger, dass sie über sich selbst sprach.
Petras Arm legte sich um ihre Schultern.
Entschuldigend schaute Klaudia zu Jana Schenker, doch die starrte aufs Fließ.
Klaudia drehte sich um und starrte ebenfalls auf das Boot, das aus dem Nebel glitt.
2. Kapitel
Er war also wieder da. Sie hatte gewusst, dass er kommen würde, als sie seinen Namen in der Todesanzeige gelesen hatte. Sie hatte sich eingeredet, dass es ihr gleichgültig sei. Es war so lange her. Ihr Leben war weitergegangen. Und sie hatte geglaubt, es sei ein gutes Leben.
Doch mit jedem Tag, den die Beerdigung näher rückte, war die Unruhe in ihr gewachsen. Und dann hatte sie ihn gesehen. Einfach so aus dem Nichts war er aufgetaucht, und sein Anblick traf sie wie ein Faustschlag in den Magen. Alles war auf einmal wieder da. Unwillkürlich presste sie die Hand gegen den Mund und konnte doch den Blick nicht abwenden. Er hatte sich nur wenig verändert. Natürlich waren die Jahre auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen. Doch sie hatten ihm nicht geschadet, im Gegenteil, sie hatten ihm so etwas wie Patina verliehen: Sein Gesicht und seine Augen sahen aus, als hätte er die letzten zwanzig Jahre in die Sonne geblickt. Seine Haare waren heller und kürzer als früher. Sehr viel kürzer. Und kräftiger war er auch geworden. Nicht im Sinne von dick, wie die anderen Männer seines Alters, sondern eher im Sinne von kraftvoll. Nur der Blick war gleich geblieben, auch wenn die Augen jetzt von einem Netz aus Falten umgeben waren. Sein frostblauer Blick, den nichts erschüttern konnte, strich teilnahmslos über sie hinweg. Er erkannte sie nicht, und dafür war sie dankbar. Er sollte sie nicht so sehen, trotzdem war sie versucht, die Hand nach ihm auszustrecken. Sie war selbst überrascht von ihrer Gier: Sie wollte ihn sehen, spüren, schmecken. Es sollte sein wie früher und die letzten zwanzig Jahre fortspülen. Egal wie viel er gesehen und erlebt hatte. Sie würde es auslöschen. Sie hatte so lange darauf gewartet. Jeden verfluchten Tag. Das begriff sie jetzt. Auch wenn das Leben weitergegangen war, hatte sie gewartet.
›Weitergegangen war‹: was für eine abgedroschene Phrase. Sie hatte kein Leben gehabt, das weitergehen konnte, sie hatte existiert, mehr nicht. Sie sah seine sehnigen Hände und fragte sich, wie viele Frauen diese Hände seit damals gestreichelt hatten? Wie viele Brustwarzen sich unter seinen Fingerspitzen aufgerichtet hatten? Wie vielen Mündern diese Hände ein begehrliches Stöhnen entlockt hatten? Seine Hände waren wie die Drogen, mit denen sie damals experimentiert hatte.
Sie wandte sich ab. Sie hatte so lange gewartet, jetzt kam es auch nicht mehr auf einen Tag an. Wärme stieg in ihr auf. Wie konnte es sein, dass ihr Herz noch immer atemlos schlug, wenn sie nur an ihn dachte? Er war nicht der erste und auch nicht der letzte Mann gewesen, mit dem sie geschlafen hatte, obwohl sie wünschte, es wäre so. Doch in diesem Moment erinnerte sich ihr Körper mit einer Macht an ihn, die sie taumeln ließ.
Frank hatte sie gelehrt, dass miteinander schlafen mehr war als schwitzen und keuchen, und dann war er fortgegangen, bevor sie es ihm sagen konnte. Einfach so verschwunden. Die Leute hatten geredet, doch das war ihr egal gewesen. Sie hatte sich in ihrem Schmerz vergraben und seinen Sohn geboren, den er nicht kannte. Noch nicht kannte.
Sie stolperte über ihren Schmerz, und auf einmal wusste sie, wo sie auf ihn warten würde.
3. Kapitel
Der Bug des Polizeibootes stieß dumpf gegen den Anleger, dann drehte es bei. Balduin kläffte sich die Kehle aus dem Hals. Irgendwie wusste sein Hundehirn, dass diese Fremden keine Gäste waren.
»Beißt der?« Thang warf Demel das Tau zu.
»Ich schließ ihn ein.« Der Metzger griff nach dem Halsband und zerrte den Hund in den Schuppen. Sofort gesellte sich zu dem Kläffen das Geräusch von kratzenden Pfoten.
»Ihr kommt zu früh!«, rief PH, der immer noch im Kessel rührte. »Die Würste simmern noch.«
»Danke, aber ich habe schon gefrühstückt.« Thang hechtete mit einem eleganten Sprung über die Reling. Allerdings verzog er bei der Landung schmerzhaft das Gesicht. Ganz in Ordnung war sein Bein wohl doch noch nicht. Um seine Augen lagen Schatten, als würde er zu wenig schlafen. Was erstaunlich war, weil sich im Moment selbst die Rechten sehr ruhig verhielten und die Arbeit der Kripo Lübben im Wesentlichen aus Nichtstun bestand.
»Was ist los?« Klaudia trat zu Thang auf den Anleger. Unwillkürlich flüsterte sie. Schon als der Bug des Polizeibootes aus dem Nebel auftauchte, hatten sich ihre Nackenhaare aufgestellt. Und sie war sich sicher, dass auch PHs witziger Spruch eher eine Warnung an die Kollegen war, so nach dem Motto: Vorsicht, Bürger in Hörweite.
Und als jetzt auch noch Wibke an der Reling auftauchte, wusste Klaudia, dass die Saure-Gurken-Zeit vorbei war. Ich hätte mir etwas anders wünschen sollen, dachte sie, verdrängte den Gedanken jedoch sofort wieder. Nicht gedankenlos ausgesprochene Wünsche töteten, sondern Menschen. Die Spusikollegin trug eine kanariengelbe Regenjacke und hatte sich die Kapuze tief ins Gesicht gezogen.
»Wenn die Kripo schon mal einen Ausflug macht«, witzelte sie und sprang ebenfalls auf den Anleger. Doch ihre Stimme klang angestrengt. Wahrscheinlich gehörte ihre Bemerkung in die Kategorie Adrenalinscherze, die man – kaum ausgesprochen – am liebsten verschlucken würde. Balduins Kläffen verstummte, entweder hatte er aufgegeben oder einen Ausgang gefunden, und für einen Moment war nur das Prasseln des Feuers zu hören.
»Sind Sie Frau Schenker?« Thang trat zu Jana. Der schmale halbvietnamesische Kollege wirkte zierlich, wie er so vor der eher kräftig gebauten Frau stand, trotzdem wich sie einen Schritt zurück.
»Ist was mit Daniel?«, flüsterte sie. »Ich hab die ganze Zeit versucht, ihn zu erreichen.« Sie brach abrupt ab. Klaudia und Petra waren gleichzeitig bei ihr und stützten sie.
Sag was, versuchte Klaudia mit ihren Gedanken Thang zu erreichen. Und als hätte er sie gehört, räusperte er sich.
»Er wurde niedergeschlagen.«
»Niedergeschlagen?«, wiederholte Jana. »Aber warum denn?«
»Das wissen wir nicht.« Thang hob die Schultern und ließ sie entschuldigend fallen.
»Hat Daniel nichts gesagt?«, fragte Jana. »Wo ist er überhaupt? Geht’s ihm gut?« Mit jeder Frage wurde ihre Stimme schriller. Der Hund jaulte jetzt wieder, als spürte er ihre Panik.
»Er ist im Krankenhaus in Cottbus.«
»In Cottbus? Aber warum denn?«
»Weil …« So schonend wie möglich klärte Thang die besorgte Mutter über den Zustand ihres Sohnes auf.
»Aber er wird gesund, ja?«
»Er ist bewusstlos«, wiederholte Thang.
»Ich muss zu ihm.« Jana drehte sich im Kreis, lief dann zum Anleger.
»Wenn du willst, fahre ich dich gleich hin«, sagte Klaudia und registrierte Thangs dankbaren Blick. »Aber zuerst muss der Kollege dir noch ein paar Fragen stellen.«
»Ja, natürlich.« Jana nickte: ein eifriges Kind, das nichts falsch machen wollte.
»Wir haben einen Hinweis vom Staatsschutz bekommen, dass auf der Klingeweide eine Techno-Party stattfinden würde, die ein paar Rechte aufmischen wollten.«
»Das war er also …«, flüsterte Jana. Den Rest des Satzes übertönte Marios laute Stimme.
»Auf der Klingeweide?«, fragte er.
Thang nickte.
»Aber Daniel ist kein Rechter«, warf Jana ein. »Er ist ein ruhiger Junge, kein Schläger. Er macht eine Banklehre.«
»Das mag sein«, wich Thang einer direkten Antwort aus.
Was soll er auch sagen, dachte Klaudia. Die meisten Eltern wussten erstaunlich wenig über ihre Kinder, und wenn sie an ihre eigene Jugend dachte, war das wahrscheinlich auch gut so.
»Auf jeden Fall wurde Ihr Sohn niedergeschlagen.«
»Von einem Rechten?«
»Das wissen wir nicht. Es war nicht direkt auf der Klingeweide, sondern er wurde vor einer Datsche gefunden. Ein Anwohner hat Erste Hilfe geleistet. Ein Herr …« Thang kramte sein Notizbuch aus der Parkatasche.
»Hast du dir keine Gedanken gemacht, als er nicht nach Hause gekommen ist?«, fragte Petra.
Klaudia verspürte den albernen Wunsch, Petra gegen das Schienbein zu treten. Sie war Sekretärin und keine Sachbearbeiterin. Es war wenig hilfreich, der Mutter auch noch ein schlechtes Gewissen zu machen.
»Ich war ja selbst nicht zu Hause«, antwortete Jana. »Ich hab hier übernachtet.« Sie zeigte zum Schuppen. »Ich hab die Musik gehört.« Sie schwankte.
»Und da hast du nicht die Polizei angerufen?«, fuhr ihr Bruder sie an.
»Mario! Das reicht!« Klaudia drückte die zitternde Jana auf die Holzbank und blieb dicht bei ihr, die Hände auf ihren Schultern, um ihr Halt zu geben.
»Hier ist doch meistens kein Netz«, murmelte Jana und schaute zu Thang, der immer noch in seinem Notizbuch blätterte.
»Klingebiel«, sagte er schließlich.
»Was, verdammt noch mal, wollte Daniel bei diesem Verbrecher?« Marios Stimme überschlug sich fast.
»Was?«, fragten Thang und Klaudia gleichzeitig, und auch die Kollegen horchten auf.
»Nicht«, jammerte Jana. »Hör auf.« Sie schlug die Hände vors Gesicht. »Das sind doch alles alte Kamellen.«
»Mord ist keine Kamelle«, fauchte Mario.
4. Kapitel − 1993
»Wir sollten das nicht tun. Nicht hier.«
»Warum nicht? Ich wollte es schon immer mal im Kahn machen.«
»Aber wenn uns jemand hört?«
»Wer soll uns um die Zeit hören? Nun komm schon.«
»Deine Mutter zum Beispiel.«
»Die hat was anderes zu tun.«
»Und wenn nicht?«
»Dann wird sie wahrscheinlich trotzdem nicht in den Kahnschuppen kommen.«
»Wenn sie uns erwischt, ist die Hölle los.«
»Scheiß drauf.«
»Das sagst du so. Die denken doch, ich spiel’ immer noch mit Puppen.«
»Dabei spielst du mit bösen Jungs. Tust du es gerne? – Hey, sag: Tust du es gerne? Nicht nicken. Sagen.«
»Schon. Aber nur mit dir. Du bist so anders.«
»Ich bin nicht anders: Ich bin gut.«
»Arrogant bist du.«
»Weil ich gut bin. Und nun komm.«
»Das klingt gemein. Du hast gesagt, du liebst mich.«
»Das tu ich doch. Aber du lässt mich ja nicht. Du sitzt da und redest, anstatt zu mir in den Kahn zu kommen.«
»Warum treffen wir uns nicht in der Datsche?«
»Das hab ich dir schon tausendmal gesagt. Es geht nicht.«
»Aber mit ihr ging es, oder?«
»Hör endlich auf damit. Es ist vorbei.«
»Ach ja?«
5. Kapitel
Nachdem Thangs Auftauchen dem Team-Event einen unerwarteten Abschluss bereitet hatte, fuhr Klaudia Jana zum Krankenhaus. Selbst wenn sie es nicht versprochen hätte, wäre diese Aufgabe an ihr hängen geblieben. Weil sie eine Frau war, hielten die Kollegen sie für einfühlsamer im Umgang mit Opfern. Klaudia teilte zwar diese Einschätzung nicht unbedingt, aber ihr war es recht. Sie fuhr lieber nach Cottbus, als sich um die Würste zu kümmern – das machte PH mit Mario − oder die Fallakte anzulegen, was Demels Aufgabe war, oder durch den nassen Spreewald zu stapfen, was Thang und Wibke die nächsten Stunden beschäftigte. Am frühen Nachmittag würden sie sich dann alle wieder im Revier treffen.
Flüchtig schaute Klaudia zu ihrer Mitfahrerin hinüber. Jana drückte sich in die äußerste Ecke des Beifahrersitzes. Sie wirkte, als sei sie bereit, beim ersten falschen Wort aus dem Wagen zu springen. Also hielt Klaudia sich zurück, obwohl ihr Marios Bemerkung nicht aus dem Kopf ging: Mord ist keine Kamelle. Sie fragte sich, welche Geschichte dahintersteckte und welche Rolle dieser Klingebiel darin spielte.
Vielleicht sollte ich Schiebschick mal auf ein Bier einladen, dachte sie. Der alte Fährmann war ein Spreewaldlexikon auf zwei Beinen, und wenn es um alte Geschichten ging, war er unschlagbar.
Nach einigen Irrwegen fanden Klaudia und Jana schließlich die Intensivstation des Klinikums. Klaudia drückte die Klingel, und eine Schwester bat sie, zu warten.
»Was hat das zu bedeuten?«, fragte Jana alarmiert. »Warum lassen sie mich nicht zu ihm?«
»Wahrscheinlich kommt gleich jemand, um uns abzuholen«, beruhigte Klaudia sie. Ein leises Pling kündigte eine SMS von Wibke an: Sind so weit fertig. Wir sehen uns um vier. Was macht das Opfer?
Klaudia wollte gerade antworten, als die Automatiktür aufsprang und ein Arzt in grüner OP-Kleidung zu ihnen auf den Flur kam. Er war dunkelhaarig und nuschelte einen arabisch klingenden Namen, den Klaudia nicht verstand. Sie steckte das Smartphone weg und trat zu Jana Schenker, die aufgeregt nach ihrer Hand griff. Ihre Finger waren so kalt, dass es Klaudia schauderte.
»Wie geht’s ihm?«
»Sind Sie die Mutter?« Der Arzt sprach mit leicht schwäbischem Akzent.
Jana Schenker nickte nur. Offensichtlich war die Kapazität ihrer Stimmbänder durch diese eine Frage aufgebraucht.
»Ihr Sohn hat eine schwere Gehirnerschütterung und eine Kalottenfissur.«
Jana schluckte krampfhaft, und Klaudia verstärkte den Druck ihrer Hand, um ihr Halt zu geben. Komm zum Punkt, dachte sie, und als hätte sie den Gedanken laut ausgesprochen, fuhr der Arzt mit einem Lächeln in den Mundwinkeln fort. »Also nichts, was nicht ausheilt.«
Mit einem leisen Stöhnen entspannte sich Jana.
»Trotzdem werden wir ihn die nächsten vierundzwanzig Stunden hierbehalten, und auch nachher braucht er noch mindestens eine Woche Ruhe.«
»Ja, natürlich«, keuchte Jana. »Kann ich …?«
»Er ist sehr müde und braucht unbedingt Ruhe.«
»Ich möchte trotzdem mit ihm sprechen«, mischte sich Klaudia ein.
»Und Sie sind …?« Der Arzt schaute zu Klaudia.
»Kripo Lübben.« Klaudia kramte in ihrem Rucksack nach der Dienst-ID, während sie sich vorstellte.
»Ich glaub’s Ihnen auch so.« Der Arzt hob abwehrend die Hände und trat einen Schritt zur Seite. »Aber machen Sie es bitte kurz.«
»Danke.« Klaudia griff nach Janas Ellbogen und schob sie in den Vorraum. Sie war oft genug in Krankenhäusern und auch auf Intensivstationen gewesen, um zu wissen, dass sie nicht einfach so auf die Station durfte. Sie trat also ans Waschbecken und wusch sich die Hände.
»Wie ich sehe, kennen Sie sich aus.« Ein Summton aus seiner Kitteltasche unterbrach den Arzt. »Das letzte Zimmer rechts.« Mit dem Handy am Ohr verschwand er in einem der angrenzenden Zimmer.
Daniel Schenker lag mit geschlossenen Augen und blutverkrusteten Haaren im Bett. Die Schürfwunden in seinem Gesicht waren mit Jodtinktur eingepinselt und so ziemlich das einzig Farbige in seinem Gesicht. In den Händen hielt er einen Spuckbeutel, in dem eine klare, grünlich schimmernde Flüssigkeit im Rhythmus seines Atems schwappte.
»Mein Gott, Daniel.« Jana war mit zwei Schritten am Bett und beugte sich über ihren Sohn. »Was ist nur passiert?« Klaudia schob einen Stuhl ans Bett und drückte Jana Schenker darauf.
Stöhnend öffnete Daniel die Augen. Seine Pupillen zitterten über den Augapfel. Für einen Moment sah es so aus, als würde ihn die Übelkeit wieder übermannen, aber dann schluckte er, und die steile Falte zwischen seinen Augenbrauen verschwand. »Ich weiß nicht«, flüsterte er mit rauer Stimme.
»Hast du gesehen, wer dich niedergeschlagen hat?«, fragte Klaudia.
»Das ist Frau Wagner von der Kripo in Lübben«, sagte Jana Schenker, bevor ihr Sohn antworten konnte. Klaudia hatte das Gefühl, dass sie ihn warnen wollte. Irgendetwas verbarg diese Frau vor ihr.
»Ich weiß nicht.« Daniel würgte wieder und hielt sich den Beutel vors Gesicht.
»Würde es dir etwas ausmachen, einen Moment draußen zu warten?« Klaudia lächelte Jana Schenker an, um ihrer Bitte die Schärfe zu nehmen. »Ich möchte allein mit Daniel sprechen.«
»Aber du siehst doch …«
»Es dauert nicht lange.«
»Er braucht Ruhe, sagt der Arzt.«
»Mama, bitte«, stieß Daniel zwischen zusammengepressten Zähnen hervor.
»Wenn was ist, ich bin vor der Tür.«
»Du hast Glück gehabt«, sagte Klaudia, als sie allein waren. »Ich darf dich doch duzen, oder?«
»Ja klar.« Er tastete nach der Wunde. »Kann man so sehen, muss man aber nicht.«
»Sieht übler aus, als es ist.«
»Aber wahrscheinlich nicht, als es sich anfühlt.« Er schloss die Augen.
Klaudia bewunderte ihn dafür, dass er sich Mühe gab, cool zu wirken. Schade nur, dass sich diese Coolness gegen ihre Ermittlungen richtete. »Du warst also auf dieser Techno-Party.«
»Nein«, widersprach Daniel. »Ich …«
Klaudia hörte geradezu, wie seine Gedanken ratterten. Er war auf der Suche, das spürte sie. Aber wonach? Nach einer Antwort oder einer Lüge?
»Du musst niemanden decken«, sagte sie. »Wir wissen auch so, dass es eine Party gegeben hat.«
»Eine Party?«, fragte er schließlich. »Ich erinnere mich nicht.«
»Was ist das Letzte, an das du dich erinnerst?«
»Ich war zu Hause.«
»Okay«, sagte Klaudia gedehnt. »Und was dann?«
»Ich weiß es nicht.«
»Deine Mutter sagt, du seist bei deiner Freundin gewesen.«
»Wir sind nicht mehr zusammen.«
»Du bist also allein zur Party?«
»Nein.«
»Dann mit Kumpels?«
»Ja. Ich weiß nicht.« Die Antwort kam so schnell, dass Klaudia wusste: Der Junge lügt.
»Bist du auf der Party niedergeschlagen worden?«
»Muss wohl.« Daniels Stimme klang, als taste er sich an einer Abbruchkante entlang.
»Okay«, sagte Klaudia, die immer noch Marios Bemerkung im Ohr hatte. »Warum warst du dann an den Datschen?«
»War ich das?«
»Zumindest wurdest du dort gefunden. Von dem Besitzer. Kennst du ihn?«
»Nein.«
Wieder kam die Antwort zu schnell.
Er schloss die Augen. »Mir ist schlecht.«
»Wir sprechen später noch einmal miteinander«, sagte Klaudia. »Wenn es dir wieder besser geht.« Obwohl sie bei dieser Ankündigung freundlich auf den im Bett liegenden Jungen herabschaute, wusste sie, dass es in seinen Ohren wie eine Drohung klang.
6. Kapitel
Daniel schloss die Augen. Diese Polizistin machte ihm Angst, irgendwie hatte er das Gefühl, dass sie in ihm lesen konnte wie in einem Buch. Der Gedanke gefiel ihm nicht. Wieder öffnete sich die Tür, schabte über das Linoleum. Seine Mutter roch nach Rauch und Schnaps.
»Daniel?« Sie flüsterte, so als hätte sie Angst, ihn zu wecken.
Willst du dich entschuldigen? Daniels Magen hob sich, und er verschloss seine Sinne gegen ihre Anwesenheit. Er wollte nicht mit ihr sprechen. Früher schon, da hatte er mit ihr reden wollen. Gestern noch, aber da hatte sie ja Besseres zu tun. Heute wollte er nicht mehr reden. Heute wusste er Bescheid. Er hatte die Polizistin angelogen. Keine Amnesie. Leider. Er wusste noch alles, bis zu dem Augenblick, als ihm ein heftiger Schmerz die Lichter ausgeknipst hatte. Wie ein Film flimmerte die Erinnerung über seine geschlossenen Lider. In der Rolle des Narren: er selbst, Daniel Schenker!
Er hatte vor der Aussegnungshalle gewartet. Außer ihm lehnte nur noch ein Penner an dem Gestell für die Gießkannen und starrte auf seine schlammweißen Turnschuhe. Flüchtig hatte sich Daniel gefragt, wer der Typ sei. Er kannte ihn nicht, hatte ihn noch nie im Ort gesehen, und trotzdem hatte er etwas Vertrautes an sich, das ihn verwirrte. Als hätte er den Gedanken laut ausgesprochen, schaute der Penner auf, und für einen peinlichen Augenblick kreuzten sich ihre Blicke. Daniel zog sich die Kapuze über den Kopf, versenkte die klammen Finger in den Hosentaschen und starrte auf seine roten Chucks. Hoffentlich ist er da. Der Gedanke traf ihn so eisig wie der Novemberwind. Bis zu diesem Moment hatte er die Angst unterdrückt, sein Plan könnte an der einfachen Tatsache scheitern, dass sein Vater nicht zur Beerdigung gekommen war. Doch jetzt, während er von einem Fuß auf den anderen trat, erschien es ihm immer wahrscheinlicher, dass er sich hier vergeblich die Eier abfror. Gerade als er sich abwenden wollte, öffneten sich die Türen der Feierhalle, und der Sarg wurde von Fährmännern in roten Westen herausgetragen. Der Penner trat einen Schritt zurück, als wollte er nicht gesehen werden, und auch Daniel wäre in diesem Moment liebend gerne unsichtbar gewesen. Dem Sarg folgten die Witwe und der älteste Sohn mit seiner Familie und einige andere Menschen in Trauerkleidung, die sehr gut zu den prall gefüllten Zeilen unter der Todesanzeige passten, und schließlich – nach einer Lücke, die ihm das Herz in die Kehle jagte, traten die Schlössers aus der Halle. Wie die anderen Trauernden hielten sie den Blick auf ihre gefalteten Hände gesenkt. Natürlich! Daniel hätte sich ohrfeigen können. Die Schlösser war ja eine geborene Klingebiel. Also so etwas wie seine Tante. Außerdem war sie die Mutter von Onkel Marios Gesellen. Daniel erinnerte sich noch gut an die Diskussionen, die Dominiks Einstellung vorausgegangen waren. Aber dann hatte die Vernunft gesiegt. Niemand wollte mehr Metzger lernen, also hatte sein Onkel Dominik eingestellt. Unwillkürlich zog Daniel sich die Kapuze tiefer in die Stirn. Wenn Frau Schlösser herumerzählte, dass sie ihn auf der Beerdigung gesehen hatte, wüssten es bald auch sein Onkel und seine Mutter. Scheiße.
Daniel konnte und wollte den Gedanken nicht zu Ende denken. Erst als die Schlössers an ihm vorbeigegangen waren, schaute er auf und begegnete dem Blick von Dominiks Mutter. Sie schaute über die Schulter zurück, und ein wissendes Lächeln stahl sich in ihre Mundwinkel, dann wandte sie sich ab. Daniel hatte die Hoffnung fast aufgegeben, als sein Vater doch noch auf den Vorplatz trat. Er sah aus wie auf den Bildern, die von ihm im Netz kursierten, und Daniel erkannte ihn sofort. Seit er durch einen Bericht in der Lausitzer Rundschau erfahren hatte, dass sein Vater Fotograf war, folgte er ihm auf Instagram. Auf den Fotos, die er dort postete, paddelte er über Seen oder lehnte an staubigen Offroadern.
Daniel hatte sich dem Trauerzug angeschlossen und später hatte er dann im Spreewaldidyll, wo die Trauerfeier stattfand, an der Theke gesessen, bis sein Vater sich von den anderen Trauergästen verabschiedet hatte, dann war er ihm gefolgt. Obwohl es schon spät war, waren viele Menschen unterwegs. Die meisten in seinem Alter. Sie alle gingen über die Brücke, als hätten sie ein gemeinsames Ziel. Auch sein Vater ging über die Brücke. Doch als Daniel die Brücke erreichte, stellte sich ihm der Penner vom Friedhof in den Weg und sagte, sein Vater wolle ihn nicht sehen, er habe Damenbesuch. Daniel hatte keine Ahnung, woher der Alte das wusste. Trotzdem war er nach Hause gedackelt, aber da war niemand, und er war noch einmal losgegangen, und diesmal war er bis zur Datsche gekommen. Vorbei an den tanzenden Menschen, niemand hatte auf ihn geachtet. Und dann hatte er am Haus gestanden und durchs Fenster geblickt. Das Letzte, an das er sich erinnerte, waren die rot lackierten Fingernägel der Frau.
»Ich weiß, dass du nicht schläfst«, sagte seine Mutter.
Und ich weiß, was du gestern getan hast, dachte Daniel und schlug die Augen auf.
7. Kapitel
Nach der Befragung verließ Klaudia das Krankenhaus und machte sich auf den Rückweg. Wegen einer Wanderbaustelle verließ sie die A15 schon in Lübbenau und fuhr auf der parallel zur Autobahn verlaufenden Bundesstraße nach Lübben, trotzdem schaffte sie es nur so gerade eben innerhalb der akademischen Viertelstunde zur Besprechung. Sie hastete die Treppen hinauf und schlitterte um siebzehn nach vier in den Besprechungsraum. PH saß mit der Schäfchentasse in der Hand auf seinem üblichen Platz vor dem Flipchart, und auch die anderen Kollegen hatten sich bereits mit Kaffee versorgt. Ein hastiger Blick in die Runde entspannte Klaudia. Sie war nicht die Letzte. Noch fehlte Wibke. Erleichtert ließ sie sich auf den freien Stuhl zwischen Demel und Thang fallen.
Demel schob ihr einen gefüllten Kaffeebecher hin. »Wie geht’s dem Jungen?«
»Beschissen, aber wach.« Dankend nahm Klaudia den Becher.
»Und was sagt er?«, fragte PH.
»Erinnert sich an nichts.«
»Gut möglich.« Thang klopfte sich mit einem Kugelschreiber gegen die Zähne, wie immer, wenn er nachdachte.
PH beugte sich vor und schob eine noch sehr dünne Fallakte über den Tisch. An ihrem heißen Kaffee nippend, schlug Klaudia sie auf. Noch enthielt sie nicht mehr als eine TKÜ-Anordnung, über die Thang den Jungen identifiziert hatte, seinen Bericht und eine lange Namensliste. Wahrscheinlich alle Besucher der Techno-Party. Klaudia überflog die Liste. Unwillkürlich suchte sie nach dem Namen des Typen, der im Sommer die Radmuttern an ihrem Peugeot gelockert hatte. Als sie ihn nicht fand, suchte sie nach Annalene. Die Tochter ihres Kollegen und Vermieters war in dem Alter, wo man zu solchen Partys ging. Aber auch ihr Name stand nicht auf der Liste. Erleichtert konzentrierte Klaudia sich auf Thangs Bericht.
»Da steht nichts von irgendwelchen Rechten.« Sie schaute von der Akte auf.
»War wohl eine Fehlinformation«, antwortete Thang.
»Unser Staatsschutz«, ätzte Klaudia. »Wie immer gut informiert. Seit man sie im Sommer aus Staatsschutzgründen bei Ermittlungen ausgebremst hatte, war sie nicht besonders gut auf die Kollegen aus Cottbus zu sprechen.
»Aber immerhin waren wir da und haben den Jungen gefunden.«
»Ich dachte, den hätte dieser Klingebiel gefunden.«
»Wir waren zeitgleich da. Er ist raus, weil er uns gehört hat, und ist quasi über den Jungen gestolpert.«
»Darüber sollten wir noch einmal mit ihm sprechen. Ich ruf ihn gleich nach der Besprechung an.« Klaudia scannte den Bericht. »Da steht keine Telefonnummer.«
»Er ist nicht von hier und hat wohl kein Handy.«
»Er hat kein Handy?«, fragte Klaudia.
»Wohl eher der Festnetztyp, was?«, warf Demel ein.
Klaudia versuchte, sich einen Festnetztypen vorzustellen, und ein grauer Typ mit zurückweichendem Haaransatz und Bierbauch tauchte vor ihrem inneren Auge auf.
Thang grinste schief. »Eher Abenteurer und Zivilisationsverweigerer«, sagte er.
»Na, dann versuch ich halt so mein Glück.« Klaudia las weiter. »Valera?«, fragte sie in die Runde. »Wo liegt denn das?«
»Venezuela«, antwortete Thang.
»Oh«, sagte Klaudia. »Und was macht er dann hier?«
»Du solltest dich mehr für deine neue Heimat interessieren und Zeitung lesen«, antwortete Demel. »Dann wüsstest du, dass er wegen der Beerdigung hier ist.«
»Dann wüsste ich wahrscheinlich auch, von welcher Beerdigung die Rede ist.« Klaudia verdrehte die Augen.
»Fritz Klingebiel hat seine letzte Fahrt angetreten«, deklamierte Demel pathetisch. »Die Zeitungen waren voll davon. Jeder Verein, der etwas auf sich hält, vermisst ihn: die Genossenschaft, der Anglerverein, der Kleingartenverein, die freiwillige Feuerwehr und wo der Verstorbene noch überall ein hochgeehrtes Mitglied gewesen ist.«
»Okay.« Klaudia hob die Hände, um Demels Redefluss zu stoppen. »Er ist also wegen der Beerdigung hier.«
»Er ist der Sohn des Verstorbenen.«
»Danke, das hab ich mir jetzt auch gedacht.« Klaudia beugte sich wieder über die Fallakte. »Diese Klingeweide gehört dann wohl der Familie? Und da war die Techno-Party?«
»Korrekt«, antwortete Thang.
»War er eingeladen?«
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.