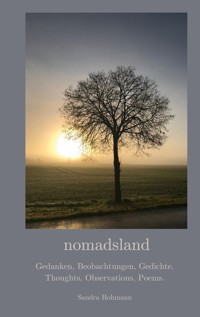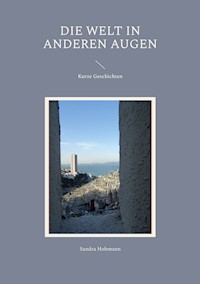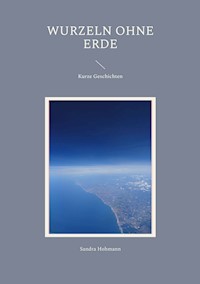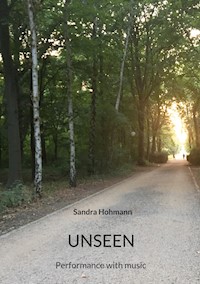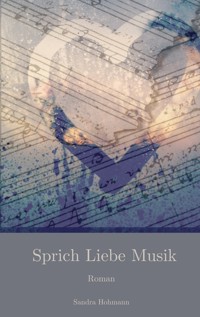
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Lucrezia liebt Musik so sehr, dass sie "Musik spricht". Sie spricht aber auch gerne über Musik, so wie über die Liebe und viele Facetten des Lebens - mal gefühlvoll, mal scharfsinnig, mal provokant. Mit ihren Gedanken und Gefühlen fordert sie alle in ihrem Umfeld heraus, steht sich mitunter aber auch selbst im Weg. Wir begleiten sie durch Freude, Verliebtheit, Verzweiflung, Trauer - und auch der Humor kommt nicht zu kurz. Geschrieben wurde dieser Roman 1998/99.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 351
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1: TALENT UND TAUFE
Kapitel 2: AM ANFANG WAR DIE MUSIK
Kapitel 3: LEERLAUF
Kapitel 4: INTERMEZZO
Kapitel 5: DIE TOTE MUTTER
Kapitel 6: KURZE ZWISCHENBEMERKUNG
Kapitel 7: BEILÄUFIGES
Kapitel 8: BEILÄUFIGERES
Kapitel 9: URATUR LUCREZIA, ADURATUR ET DESIDERIO
Kapitel 10: SEUFZER UND THEORIE
Kapitel 11: FREIHEIT UND TRAUM
Kapitel 12: KUNST UND WISSEN
Kapitel 13: OH FORTUNA
Kapitel 14: NOCH MEHR THEORIE
Kapitel 15: VERZWEIFELTE BEMÜHUNGEN
Kapitel 16: BEILÄUFIGSTES
Kapitel 17: VOM TOD UND ANDEREN BEGEBENHEITEN
Kapitel 18: NACHWIRKUNGEN
Kapitel 19: DAS UNBERÜHRTE MORGENROT VERGEHT
Kapitel 20: HEILSVERSPRECHEN
Kapitel 21: SCHICKSALHAFTE BEGEGNUNGEN
Kapitel 22: VIELVERSPRECHENDES
Kapitel 23: ANDEUTUNGEN
Kapitel 24: DIE TAGE WERDEN LÄNGER
Kapitel 25: EINE CHARMANTE UNTERHALTUNG
Kapitel 26: VON DEN KLEINEN DINGEN
Kapitel 27: NOCH EINE KURZE ZWISCHENBEMERKUNG
Kapitel 28: SCHWEIGEN
Kapitel 29: NETTIGKEITEN
Kapitel 30: DIE LEICHTIGKEIT
Kapitel 31: EINE KURZE ZEIT
Kapitel 32: DIE SCHWIERIGKEIT
Kapitel 33: ILLUSIONEN
Kapitel 34: HÖHEN UND TIEFEN
Kapitel 35: AM ENDE BIN ICH NUR ICH SELBST
Kapitel 36: REQUIEM
Kapitel 37: AUSKLANG
Kapitel 38: VERBITTERUNGEN
Kapitel 39: ERHABENER TOD
1
TALENT UND TAUFE
„Ach, sieh doch nur, all die Farben ... Hörst du sie nicht?“
Dolores wusste keine Antwort darauf, sie wusste nicht einmal, ob Lucrezia sie das wirklich gefragt hatte. Es waren die letzten Worte, die ihre Freundin zu ihr sagte. Nicht dass Dolores das in jenem Moment auch nur geahnt hätte. Doch vielleicht ist es besser, bei Lucrezias Geburt zu beginnen.
„Eieiei...“, machte der Vater mit einem Ausdruck höchsten Unwohlseins, als er seine Tochter zum ersten Mal auf den Arm genommen hatte.
Die Mutter war indes damit beschäftigt, die umstehenden Verwandten und Bekannten von der schier unvergleichlichen Schönheit und auch Intelligenz dieses Kindes zu überzeugen. Lucrezias Mutter hielt es für eine göttliche Fügung, dass ihr mit immerhin achtunddreißig Jahren noch der Wunsch erfüllt worden war, ein Kind zur Welt zu bringen, hatte sie doch zuvor eigentlich schon alle Hoffnung zu Grabe getragen. Das Kind war eine Gabe Gottes, zweifelsohne. Dass sie es dann wiederum ausgerechnet auf den Namen Lucrezia taufen lassen wollte, weil sie in einem der letzten Gottesdienste am Rande irgendwo diesen Namen aufgeschnappt und für überaus schön befunden hatte, hielt Lucrezias Vater für eine eher naive Fügung merkwürdiger Umstände, doch hatte er dem Vorschlag nichts entgegengesetzt.
Alles, was in Lucrezias ersten Lebensjahren aus dem Rahmen fiel, war ihr Name. Zweifellos war er ungewöhnlich, zweifellos war er derart beschaffen, dass ihn sich ein jeder, auch ein Mensch mit eher löchrigem Gedächtnis, merken konnte. Und da dieser Name später dann mit Musik verknüpft werden sollte, erfüllte er immerhin den segensreichen Dienst, dass sich plötzlich Menschen für Musik interessierten, die bis dahin taub durch ihr Leben gegangen waren.
Die Herren Plönz und Rattler sind in die Annalen der dörflichen Kirchengeschichte eingegangen, da sie die ehrenwerte Aufgabe hatten, diesen Namen bei der Taufe zu verkünden. Im Grunde ging die gesamte Taufe nicht nur in die dörfliche Kirchengeschichte, sondern auch die Familiengeschichte und nicht zuletzt das Kompendium humoristischer Ereignisse ein. Vermutlich haben Plönz und Rattler – ihres Zeichens bis dahin ebenso unbescholtene wie unauffällige Kirchenmänner, die nur dadurch auffielen, dass sie alles gemeinsam machten – in ihrem Leben nicht so viel geflucht wie in diesen wenigen Stunden. Lag es daran, dass der Name sie verdächtig an Luzifer erinnerte oder daran, dass sie dabei an Lucrezia Borgia dachten, die sie nach wie vor für eine Hexe hielten – und an dieser Stelle fügten sich diese beiden Gedanken magisch, ja geradezu genial zu einem Ganzen zusammen –, jedenfalls hatten sie größte Schwierigkeiten, die acht Buchstaben über die Lippen zu bringen.
Auf Plönzens Stirn zeichneten sich bereits Schweißtropfen ab, noch ehe er zu dem entscheidenden „Ich taufe dich auf den Namen ...“ anheben wollte oder musste, Rattler stand wie angewurzelt daneben, seine Blicke hefteten sich förmlich auf dem kleinen Kind fest, das in den Armen seines Vaters lag, die Augen friedlich geschlossen. Hätte das Kind die Augen geöffnet, wäre Rattler gewiss ein diabolisches Blitzen aufgefallen. Schließlich war er es auch gewesen, der gleich nach dem Bekanntwerden des Namens bemerkt haben wollte, wie das Kind mit seinen fünf Tagen, die es alt war, teuflisch gegrinst und dem Herrn Rattler einen schrecklichen Blick zugeworfen hat. Plönz war immer noch im Begriff, Luft zu holen, Rattler dachte, dass Plönz mit einem Male gigantische Lungen zu haben schien, dabei war ihm nur entgangen, dass Plönz bereits zum dritten Mal ansetzte. Rattler starrte auf das Kind, Plönz holte zum vierten Mal Luft, die Mutter beugte sich erwartungsvoll nach vorne, der Vater schaute etwas misstrauisch von einem zum anderen.
Die ganze Szene war so abstrus, dass um ein Haar die energische Großmutter der Lucrezia, ihres Zeichens eine stolze Lucinde, aufgesprungen wäre und den Herrn Plönz wahrlich am Talar gezogen hätte. Da war Lucinde nämlich ganz praktisch und schrak auch vor selbsternannten Heiligen nicht zurück.
Doch just in diesem Moment entfleuchte dem Plönz ein zartes „Ich ...“, beinahe nur aus Versehen, denn er blickte sich verschämt um, als hätte nicht er diesen Laut von sich gegeben, sondern der Heilige Geist. Aber nun gab es kein Zurück. Alles, was Plönz jetzt noch möglich war, war das Hinauszögern des Augenblicks, in dem er dieses Wort aussprechen sollte. Und er hatte sich auch vorgenommen, es dann ganz, ganz schnell über die Lippen zu bringen, wenn es erst einmal so weit war. Vielleicht, so dachte Plönz nämlich, vielleicht würde der liebe Herrgott es dann ja nicht hören, wenn er es wirklich ganz, ganz schnell –und vielleicht auch nicht so deutlich wie notwendig – ausstoßen, schon mehr ausspucken als aussprechen würde. Es spricht für die Kurzsichtigkeit oder das schlechte Gedächtnis der beiden, wahrscheinlich also insgesamt gegen sie, dass Plönz und Rattler die gute Lucinde, die in der ersten Reihe saß, aus ihren Gedanken und ihrer Wahrnehmung gestrichen hatten. Lucinde schaute Plönz immer argwöhnischer an, je näher er dem entscheidenden Wort kam. Plönz versuchte seinerseits angestrengt, andächtig zu wirken und war damit so beschäftigt, dass er fast nicht nur die Großmutter Lucinde, sondern sogar das zu taufende Kind vergessen hätte. Lucindes Blick wurde immer bohrender. Rattler war es, der auf einmal bemerkte, wie die Alte förmlich durch ihn durch auf Plönz starrte, aber da war es bereits zu spät.
Just in diesem Augenblick haspelte Plönz den Namen. Oder das, was er davon übriggelassen hatte. Es war wohl nicht seine Absicht, sich als Schöpfer weiblicher Vornamen zu betätigen, aber das, was er von sich gegeben hatte, klang etwa wie „Luca“, was freilich mit dem ursprünglichen Namen nicht mehr allzu viel zu tun hatte.
Plönz war heilfroh, es, wie er meinte, hinter sich gebracht zu haben. Innerlich hatte er soeben zu einem besonders frommen Vaterunser angesetzt, als Lucinde, die für einen Schreckensmoment wie erstarrt vor der Holzbank gestanden hatte, wie eine Furie nach vorne stob. Sie fauchte Plönz an, auf welchen Namen er das Kind bitte getauft habe. Plönz bemühte sich ungeschickt, den Namen nicht aussprechen zu müssen, und erklärte, natürlich auf den, den die Eltern gewünscht hatten.
Ach, zeterte die aufgebrachte Großmutter, welcher das denn gewesen sei? Sie habe ihn nämlich sehr schlecht verstanden und schwerhörig sei sie keinesfalls.
Plönz wollte um nichts auf der Welt diesen Namen laut aussprechen und Lucinde wollte ihn um nichts in der Welt ungeschoren davonkommen lassen.
Warum er den verdammten Namen nicht aussprechen wollte, kreischte sie. Und sie fragte, ob der Name etwa verhext sei. Damit tat sie einen gewaltigen Schritt nach vorn und stand Plönz beinahe auf den Füßen.
Dieser, den Oberkörper skurril nach hinter gebeugt, stand dort wie ein verunglücktes Fragezeichen und fand einfach keine Antworten mehr. Aus den Schweißtropfen auf Plönzens Stirn waren inzwischen wahre Sturzbäche geworden und er keuchte Lucinde seine Verzweiflung ins Gesicht.
Plönz stand dort, die Arme um die Bibel geknotet, den Oberkörper nach hinten gebeugt, die Augen weit aufgerissen, den Mund leicht geöffnet, schwer atmend und schweißgebadet. Vor ihm, die Hände in die Hüften gestemmt, mit zornrotem Kopf und feurigen Augen, die Lippen zusammengekniffen, den Oberkörper nach vorne gebeugt und mit herausforderndem Blick stand Lucinde. Rattler sah daneben aus wie der Dorftrottel, schaute von Plönz zu Lucinde, von Lucinde zu Plönz und war sich nicht sicher, ob er eingreifen oder sich besser zurückziehen solle. Plönz wurde immer bleicher.
In die Stille der Kirche hauchte er zögernd ein „Lllll...“, woraufhin Lucinde ihn noch herausfordernder anblickte.
Rattler war inzwischen zu der Überzeugung gekommen, dass es wohl das Beste sei, den unseligen Namen einfach auszusprechen, um sich von diesem Leid zu erlösen. Danach könnten sich er und Plönz ja auch gegenseitig die Absolution erteilen. So kam es, dass Rattler Plönz nicht mehr nur anblickte, sondern auch aufmunternd seine Laute wiederholte. „Llll...“, machte Plönz. Und „Llll...“, zischte Rattler. Plönz bemerkte ihn zunächst gar nicht und machte „Llluu...“ Rattler machte ebenfalls „Llllluuu...“, nur noch etwas langgezogener. Daraufhin stierte Plönz ihn an, als sei Rattler geistesgestört. Dieser erwachte nach Plönzens scharfem Blick aus seiner Trance und schaute verlegen zu Boden. Er blickte die nachfolgende Zeit überhaupt nur noch auf den Boden und Laute gab er auch nicht mehr von sich. Lucinde jedoch ließ sich von Plönzens Seitenblick nicht irritieren und starrte ihn erbarmungslos an. Plönz schickte einen Blick gen Himmel, schloss die Augen und unter Aufbringung seiner ganzen Kraft stieß er hervor: „Lucrezia!“, um dann sofort in eine wohlverdiente Ohnmacht zu fallen.
Lucinde war zufrieden. Wenn Lucrezia jemals etwas in ihrem späteren Leben bereut hat, dann war es der Umstand, dass sie selbst sich an diese Taufe nicht erinnern konnte.
2
AM ANFANG WAR DIE MUSIK
Manche behaupten, die klassische Musikerlaufbahn begänne damit, dass ein Mensch frühzeitig in der Badewanne singt, wohl noch bevor er ein Wort sprechen kann. Andere wiederum sind der Auffassung, dass ein musikalisches Kind fasziniert ist von Instrumenten und auch ohne Kenntnis von Noten schöne Melodien spielen kann.
Lucrezia hat niemals in der Badewanne gesungen und im Alter von elf Monaten hatte sie zornentbrannt ihre Rassel mit Fußtritten in die ewigen Jagdgründe geschickt. Doch einige Jahre später wusste sie mit Sicherheit, dass die Musik ihre erste und auch letzte große Liebe sein würde.
Es war an einem schummrigen und leicht verschneiten Dezemberabend, als Lucinde ihrer Enkelin bezeugte, sie könne Musik sprechen. „Ja“, sagte sie, „Lucrezia spricht Musik. Es ist unglaublich, einzigartig.“ Das war ziemlich genau zwei Wochen vor Lucindes Tod und ziemlich genau zwei Wochen vor Heiligabend. Lucrezias Großmutter war bis dahin der einzige Mensch, der das Talent ihrer Enkelin zumindest annähernd fühlen konnte. Über das Ausmaß dieses Talents war sich auch Lucinde nicht recht im Klaren, aber sie hatte es immerhin erkannt und Lucrezia dazu ermutigt, ihr Talent auszuschöpfen.
So schöpfte Lucrezia also aus dem Vollen, auch wenn die Musik, die sie ihrer Großmutter präsentierte, nicht immer so ganz nach deren Geschmack war. Aber diese Tatsache wurde dadurch aufgewogen, dass Lucrezia jede Art von Musik, solange sie eine Seele hatte, sprechen konnte und ihre Großmutter an dem Wunderbaren dieser verschiedenen Seelen teilhaben ließ. An jenem Dezemberabend also war Lucrezia bei ihrer Großmutter gewesen und dieser Besuch, so dachte die alte Dame bis zu ihrem Tod, war mit keinem zuvor zu vergleichen. Es schien ihr, als sei Lucrezia geradezu über Nacht von einer göttlichen Eingebung getroffen worden. In Wirklichkeit hatte sie nur immer und immer wieder Musik gehört, so oft es nur ging. So kam es, dass Lucrezia diese Musik in sich aufnahm, sie durch ihren ganzen Körper fließen ließ, mal langsamer und mal schneller, manchmal hielt sie den Fluss kurze Zeit an, um ganz genau jede Winzigkeit spüren zu können. Und dann besaß sie die große Gabe, diese Musik, die sie aufgenommen hatte, auch wieder nach außen zu lassen, und zwar so, dass jeder, aber auch wirklich jeder Mensch plötzlich verstand, was Musik bewirken konnte, was es in ihr bewirkt hatte und wie wunderbar das alles war. Lucrezia unterschied die Musik nicht nach verschiedenen Stilrichtungen, wie die meisten Menschen es zu tun pflegen – dies, so bedauerte Lucrezia immer wieder, gereiche übrigens der Musik zu großem Leid. Lucrezia hatte festgestellt, dass es Musik mit Seele gibt und auch solche ohne Seele. Musik ohne Seele, das waren dann nur noch mehr oder weniger zufällig aneinandergereihte Töne, lieblos, ohne Leidenschaft aneinandergekettet und dazu verdammt, gemeinsam etwas zu sein, was sie weder wollten noch konnten. Doch darüber sprach Lucrezia nicht mit ihrer Großmutter. Sie sprach über Musik mit Seele.
„Es geht geradezu etwas Magisches von ihr aus“, hatte sie ihrer Großmutter einmal gesagt. „Es ist so, dass sie dich nicht gleichgültig lässt, sie berührt dich. Wenn sie eine Seele hat, berührt sie dich. Und je größer die Seele ist, umso tiefer berührt sie dich. Sie vermag etwas in dir aufzuwecken, von dem du noch nicht einmal gewusst hast, dass es in dir wohnt. Sie vermag mehr als irgendetwas oder irgendjemand sonst auf der ganzen Welt. Es sollte sich auch niemand dagegen wehren, wenn die Seele der Musik von einem Menschen Besitz ergreift, denn es ist etwas sehr Schönes.“ Das hatte Lucrezia ihrer Großmutter erzählt. Und Lucrezia fragte ihre Großmutter natürlich auch, ob sie schon einmal in ihrem Leben von der Seele einer Musik ergriffen worden sei.
Lucinde zögerte und schluckte einmal, zweimal und dachte an ihre erste Hochzeit. Damals war sie, so glaubte sie zu wissen, von eben dieser Seele der Musik ergriffen worden. Ja, dachte sie, war es nicht erst gestern gewesen, dass sie geheiratet hatte? Sie hatte ein traumhaft schönes Brautkleid, eine Nachbarin hatte es genäht aus Stoffen, aus Gardinenresten, die sie über viele Monate hinweg gesammelt hatte. Ihr erster Mann war Soldat und trug eine Uniform mit glitzernden Abzeichen. Die Sonne strahlte vom Himmel und alle lachten, es war ein so herrlicher Tag. Es gab eine Kapelle, die einen Walzer spielte, als sie aus der Kirche kamen, und ihr Mann nahm sie und sie tanzten die Treppe hinunter zu den Klängen der Musik, sie tanzten und tanzten und tanzten, alles drehte sich in ihnen und um sie herum. Sie hätte am liebsten weitergetanzt bis in den strahlend blauen Himmel. Sie, ihr Mann und diese Musik. Wenige Wochen später nur tanzte er allein weiter im Himmel, so sagte Lucinde einmal. Und eigentlich war das Kleid aus Gardinenresten auch gar nicht schön gewesen. Der Tag war trüb gewesen, es hatte sogar ein wenig geregnet. Aber die Musik, die war tatsächlich dort gewesen. Das hatte Lucinde nie vergessen, nur hatte sie es immer für sich behalten.
Sie hatte zwar – selten nur und zögerlich – versucht, anderen davon zu erzählen, aber schnell bemerkt, dass sie niemand recht verstand, sich vielleicht auch niemand die Mühe machen wollte, sie zu verstehen.
Bis Lucrezia mit ihr sprach. So erzählte sie ihrer Großmutter, dass es Musik gibt, die uns förmlich aus unserem Körper befreit, die es schafft, dass wir uns plötzlich unglaublich leicht fühlen. „Aber nicht nur wir selbst fühlen uns leicht, auch alle Dinge, die wir tun, sind auf einmal ganz einfach, geradezu spielerisch bewerkstelligen wir Aufgaben, an denen wir zuvor verzweifelt sind. Und das Wunderbare daran ist, dass wir diese Leichtigkeit auf andere Menschen übertragen können, wenn wir erst einmal von ihr beseelt sind. Wir sind in der glücklichen Lage, sie weitergeben zu können, was etwas Wunderbares ist, denn es macht nicht nur Freude, Leichtigkeit geschenkt zu bekommen, sondern viel mehr noch, sie selbst verschenken zu können. Diese Art von Musik verbreitet Freude, man kann sich freuen über etwas, was sonst unbemerkt geblieben wäre.“ Das würde übrigens, befand Lucrezia, der Musik insgesamt innewohnen. „Sie schärft unsere Sinne aufs Höchste. Manchmal kann das wundervoll sein, zum Beispiel bei dieser Musik, die Freude bereitet. Aber es gibt auch Musik, die ist so unendlich schwer, sie lässt den Hörer nicht ans Tageslicht, hält ihn gefangen in einem dunklen Verließ, irgendwo im Abgrund der Seele hockt er dann da, in der hintersten Ecke, dort, wohin kein anderer Mensch kommen kann. Und es gibt Kleinigkeiten, die schrecklich sein können. Es gibt Momente, in denen dieser Abgrund offensteht, bereit ist, jemanden eintreten zu lassen. Die meisten Menschen fürchten sich vor diesem Abgrund und springen deshalb über diese winzige Öffnung oder sie tun einfach so, als würden sie sie nicht sehen. Doch die Musik, die unsere Sinne auf das grausamste zu schärfen vermag, diese Musik macht es, dass wir diese winzigen Öffnungen als großes Tor wahrnehmen und dass wir uns von diesem Abgrund sehr stark angezogen fühlen. Nun ...“ fügte sie noch an und blickte ihrer Großmutter sehr ernsthaft ins Gesicht, „es ist aber auch nicht schlimm, in diesen Abgrund hinunterzusteigen. Die meisten Menschen fürchten sich nur davor, weil sie sich überhaupt vor allem fürchten, was ihnen wehtun könnte. Aber jedes Mal, wenn ich mich in diesen Abgrund begebe, hat auch das etwas Wunderbares. Man kann das Schöne nur sehen, wenn man auch bereit ist, das Hässliche zu sehen, es zu fühlen, vielleicht sogar zu sein.“
3
LEERLAUF
Lucrezia war keine begnadete Sängerin. Das hatte auch sie selbst erkannt. Schließlich habe ich deshalb nie in der Badewanne gesungen, dachte sie verärgert, als sie in die Gesangsstunde kam. Sie hatte ihrer Großmutter versprochen, ihr Talent zu nutzen, die Großmutter hatte ihr wiederum etwas Geld hinterlassen. Damit machte Lucrezia sich nun auf die Suche nach einer passenden Ausbildung, denn sie war sich zu jedem Zeitpunkt sicher, dass sie dabei Hilfe benötigte.
Der Vater war völlig außer sich durch das Wohnzimmer gesprungen, als er von den Plänen seiner Tochter erfahren hatte. Sängerin! Nein, so etwas gäbe es doch nicht. Sängerin! So was hatte noch nie jemand in der Familie gemacht! Worin Lucrezia im Übrigen ein entscheidendes Problem sah. „Außerdem“, tobte der Vater, „ist das doch gar nichts Gescheites.“ Das gäbe es doch nun wirklich nicht, davon könnte man doch nicht leben und was das überhaupt solle. Nach einer halben Stunde hatte auch er selbst gemerkt, dass sich seine vermeintlichen Argumente in diesen zwei Aussagen erschöpften. Darüber war er noch verärgerter und stampfte wütend aus dem Haus.
Seine Frau sagte nichts zu alldem. Lucrezia konnte sich ihren Eltern nicht recht erklären, aber schließlich hatten nicht sie, sondern ihre Großmutter ihr tagelang zugehört und sie auch verstanden, zumindest teilweise. Und deshalb wog das Versprechen, das sie der Großmutter gegeben hatte, stärker als alle Flüche des Vaters.
Lucinde war der Auffassung gewesen, es sei geradezu sträflich, wenn Lucrezia nicht ihr Leben der Musik widmen würde. Natürlich, sie hatte das auf gewisse Weise auch bislang schon getan, aber Lucinde meinte, dass sie ihren Beruf dementsprechend wählen sollte. Sie solle Musikunterricht geben, befand die Großmutter. Das wäre eine Bereicherung für den Musikunterricht, wie sie noch nie dagewesen sei. Oder, fügte sie angesichts Lucrezias entsetztem Blick rasch hinzu, sie solle doch zumindest selbst recht viel musizieren. Schließlich, als die Großmutter merkte, dass Lucrezia sich doch sträubte, ging sie so weit, dass Lucrezia ihr versprechen musste, irgendeinen Beruf zu ergreifen, der mit Musik zu tun hatte. Lucrezia tat ihrer Großmutter den Gefallen, versprach es also, war aber noch keinesfalls überzeugt. Sie hatte nämlich Bedenken, dass die meisten Menschen sie nicht recht verstünden, dass sie ihr Leben lang nicht in der Lage wäre, das zu vermitteln, was sie vermitteln wollte, und am Ende kläglich gescheitert wäre. Nun hatte Lucrezia sich also bei der Gesangslehrerin angemeldet, aber schon nach der ersten Stunde, eigentlich bereits nach der Probe bei der Anmeldung, war sie todunglücklich. Sie hatte die dumpfe Ahnung, dass sie dies nicht besonders lange durchhalten würde.
Als Lucrezia ihre Gesangslehrerin zum ersten Mal sah, dachte sie, dass es doch wirklich Menschen gibt, die aussehen wie ihre eigene Karikatur. Die Nase war viel zu groß, fand Lucrezia, und zu allem Überfluss auch spitz wie eine Nadel. Eigentlich, dachte Lucrezia, war fast alles an dieser Frau spitz wie eine Nadel. Außer den Brüsten, die waren beinahe noch flacher als die Schiefertafel, vor der die Dame immer stand, fügte Lucrezia in Gedanken an und konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Auf der großen Nase trug sie eine jener Hornbrillen, die aus jedem noch so schönen Menschen einen abgrundtief hässlichen machen konnten, aber, Lucrezia schüttelte den Kopf, in diesem Fall war auch das keine Entschuldigung. Die rechte Hand der Gesangslehrerin umklammerte nicht nur an jenem Tag einen ungewöhnlich spitzen Taktstock. Manche Gesangsschüler behaupteten sogar, sie würde den Taktstock bösartigerweise vor jeder Stunde anspitzen. Es kann sich dabei aber auch um ein Gerücht gehandelt haben. Lucrezias Gesangslehrerin war die Art von Frau, vor der kleine Kinder wegliefen. Aber sie war in der ländlichen Gegend die einzige Person weit und breit, die Gesang unterrichtete. Zum Leidwesen all jener, die singen wollten und Musik liebten. Lucrezia gelangte schnell zu der Überzeugung, dass Musik diese alte Schachtel herzlich wenig kümmerte und sie sich mehr für eine strenge Einhaltung irgendwelcher Schemata oder exakter Töne und Akkorde und Pausen und wer weiß was sich irgendein unmusikalischer Mensch einst noch ausgedacht hatte, einsetzen würde. Und in dieser Gesangsstunde, die Lucrezias letzte sein sollte, was sie bei der Ankunft am Haus der Gesangslehrerin noch nicht so genau wusste, war es dann endlich so weit. Lucrezia der Auffassung, nun endlich einmal die Musik vor der Zerstörungswut dieser Person bewahren zu müssen und ihr einmal darzulegen, was sie von ihr hielt.
Kaum hatte Lucrezia sich an ihr vorbei in das Haus gezwängt, fauchte die Alte sie mit Blick auf die Uhr auch schon an, ob sie überhaupt eine Vorstellung davon hätte, wie enorm wichtig Pünktlichkeit für die Musik wäre. Lucrezia schluckte kurz und polterte dann los. Sie müsse doch bestimmt in direkter Linie mit Attila verwandt sein und ebenso viel wie der würde sie von Musik verstehen. „Es würde mich durchaus nicht wundern, wenn extra für sie noch eine Station unterhalb der Hölle aufgemacht werden würde.“ Lucrezia drehte sich auf dem Absatz um – und ging. Damit war Lucrezias Rede deutlich kürzer ausgefallen, als sie selbst gedacht hatte, aber sie war vor allem erleichtert darüber, diesem Haus den Rücken gekehrt zu haben.
Zuhause angekommen, waren die Eltern, das heißt in erster Linie der Vater, heilfroh darüber, dass die Unnatürlichkeit – so nannte er den Gesang inzwischen –, die seine Tochter angefangen hatte, ein Ende genommen hatte. Lucrezia schloss sich übelgelaunt in ihrem Zimmer ein. Aber durch das Versprechen, das sie ihrer Großmutter gegeben hatte, raffte sie sich schon wenige Tage später erneut auf, um sich in einen weiteren Unterricht zu begeben. Diesmal wollte sie Klavier lernen, was aber freilich etwas ungünstig ist, solange man kein Klavier zuhause hat, um zu üben. Das sah auch Lucrezia bereits nach kurzer Zeit so und gab es wieder auf. So hangelte sich Lucrezia durch verschiedene Instrumente, aber je mehr sie ausprobierte, desto unzufriedener wurde sie. Desto klarer wurde sie sich darüber, dass alles, was sie bis jetzt getan hatte, nicht zu ihr passte. Es entsprach ihr einfach nicht. Abgesehen davon wurde ihr sehr klar, dass das kleine Erbe ihrer Großmutter bald aufgebraucht sein und der Rest noch nicht einmal mehr für eine Triangel ausreichen würde. So verging ein Tag nach dem anderen und Lucrezia plagten ganz banale Geldsorgen, denn ihre Eltern – in Gestalt ihres Vaters – drängte sie nicht nur Tag für Tag, endlich einen ordentlichen Beruf zu ergreifen, wenn sie schon nicht heiraten wolle, und zudem Kostgeld abzugeben, solange sie noch nicht ausgezogen sei. Lucrezia aber dachte, sie könne doch nicht ausziehen, wenn sie nicht einmal wisse, wohin die Reise ginge, geschweige denn, wovon sie die Reise bezahlen sollte. Beinahe wäre es sogar um sie geschehen gewesen, nein, sie wäre nicht gestorben, noch nicht, aber beinahe hätte sie die Musik zu weit aus ihrem Blick verloren.
Es gibt manchmal merkwürdige Zufälle im Leben, wie Lucrezia später auch noch des Öfteren feststellte. Lucrezia hatte noch am Vorabend fluchend bemerkt, dass doch jetzt endlich einmal etwas passieren müsste. Ein Ereignis muss her, welches mein Leben erschüttert, hatte sie gedacht. Es fiel ihr aber noch nicht ein, ihr Leben selbst zu erschüttern. Doch ihr Leben erwies ihr diesen Gefallen und schon am nächsten Tag bereute Lucrezia all ihre Wünsche und wollte nur noch ein entsetzlich langweiliges Leben führen.
4
INTERMEZZO
Lucrezia wusste nicht, ob sie eigentlich vor Schmerz oder aus Rührung weinte. Sie dachte in diesem Moment natürlich auch nicht darüber nach. Lucrezia hockte zusammengekauert auf dem großen Sessel und schluchzte in sich hinein.
Auf dem zweiten Sessel saß ihr Vater und hatte die Ratlosigkeit auf seiner Stirn geschrieben. Er konnte mit dem, was er da soeben gehört hatte, nicht viel anfangen und eigentlich auch nicht mit seiner heulenden Tochter neben ihm.
Lucinde, die alte Dame, an die Lucrezia sich gerne erinnerte, war bereits zehn Jahre tot. Und Lucrezia schluchzte nicht wegen ihres Todes, das heißt, vielleicht tat sie es doch irgendwie, aber eigentlich war es der Tod von Lucrezias Mutter, der nun im Vordergrund stand.
Der Notar saß auf der anderen Seite des ausladenden Schreibtisches und fast schien es so, als hätte er diesen gigantischen Schreibtisch nur deshalb gekauft, damit er den trauernden Angehörigen nicht zu nah säße, wenn er ihnen das Testament der gestorbenen Menschen verliest. Natürlich konnte der Notar diesen großen Schreibtisch auch deshalb gekauft haben, weil der eine oder andere Neffe, Schwager, Schwiegersohn oder Halbbruder schon einmal dazu neigt, im Eifer des Gefechts den Verkünder der schlechten Nachricht, dass er nichts geerbt habe, persönlich anzugreifen. Verständlich, denn der Mensch, der diese schlechte Nachricht verursacht hatte, ist persönlich nicht mehr anzugreifen. In diesen Momenten tut es einem dann vielleicht nur deshalb leid, dass jemand gestorben ist, weil man ihn eben nicht selbst hatte umbringen können.
Aber Lucrezia hatte mit Geld so wenig zu schaffen wie ihr Vater mit der Musik. Und natürlich heulte Lucrezia nicht wegen irgendwelchen Geldes, was ihre Mutter ja auch gar nicht hatte. Ihre Mutter Charlotte also hatte in ihrem Testament etwas ganz Besonderes verfügt. Ihr letzter Wunsch war es nämlich, dass Lucrezia die Musik zu ihrer Beerdigung machen solle. Wie genau, das hatte sie ihrer Tochter überlassen.
Sie hatte im Testament in ihrer etwas unbeholfenen und dadurch zugleich umso rührenderen Sprache Folgendes verfasst: „Ob du nun singen möchtest oder einfach etwas von einer Platte oder einem Tonband abspielst und dazu einen Tanz aufführst, das liegt bei dir. Du kannst auch über die Musik reden, wenn dir das lieber ist. Aber ich wünsche mir zumindest für den letzten Augenblick meines Lebens, von dir diese wundervolle Gabe hören zu dürfen.“
Niemand wusste recht zu sagen, ob Charlotte die Beerdigung tatsächlich für den letzten Moment ihres Lebens gehalten hatte, und es war tragisch, dass dies niemand wusste. Lucrezia hatte sich das zunächst so ruhig es nur ging angehört, aber dann war sie, völlig außer sich, in Tränen ausgebrochen.
Wie gut kann man einen anderen Menschen kennen? Und Lucrezia weinte und weinte. Aber Charlotte hatte ihrer Tochter eine Möglichkeit offengelassen, ihr schlechtes Gewissen ein kleines bisschen zu befreien, auch wenn das von ihr selbst keinesfalls so gedacht gewesen war. Natürlich wollte Lucrezia diese Aufgabe mit größter Mühe und Sorgfalt, mit all ihrem Sein angehen. Aber auch daran dachte sie in diesem Moment noch nicht. Sie saß nur dort auf dem großen Polstersessel und weinte herzzerreißend.
5
DIE TOTE MUTTER
Die Sonne strahlte mit ihrer ganzen Kraft vom blauen Julihimmel, und die Vögel, die die schwarze Schar umflogen, zirpten fröhlich in leichten Tönen. Lucrezia hatte eine Kassette mitgebracht. Aber sie hatte, wen wundert es in dieser Situation, das Abspielgerät vergessen. Als sie das bemerkt hatte, begann sie zunächst fürchterlich zu lachen, sie lachte so laut, dass die Menschen es noch am anderen Ende des Friedhofs hören konnten. Dann schüttelte sie sich und ihr hysterisches Lachen ging in ein hysterisches Weinen über, ehe sie abermals kurz auflachte.
Ihr Vater hatte bereits ernsthafte Sorge, seine Tochter würde nun endgültig verrückt geworden sein.
Lucrezia fing sich nach wenigen Minuten wieder, zog ein Taschentuch nach dem anderen aus ihrer Jacke, schnäuzte sich die Nase, wischte die Tränen von den Wangen. Mit einmal Male hielt sie inne, als sie soeben ein neues Taschentuch gezückt hatte, starrte dieses an und begann erneuert zu lachen.
„Wenn sich ein Mensch nun schon auf einer Beerdigung die Tränen wegwischen soll“, flüsterte sie, eher an sich selbst gerichtet denn an die anderen, die um sie herumstanden und sie weitgehend verständnislos anstarrten. Lucrezia hielt in diesem Moment die ganze Szenerie, die sich aufgebaut hatte, für völlig absurd.
Unvermittelt schrie sie die Umstehenden an: „Dort steht ihr und starrt mich an, was!? Ihr starrt mich an wie eine Aussätzige, wie eine, die die Pest hat, eine furchtbar ansteckende Krankheit – und soll ich euch etwas sagen? Ich wünsche mir so sehr, dass es mir gelingt, euch alle anzustecken, wie ich mir noch niemals etwas gewünscht habe. Ich wünsche mir, ich könnte euch mit in diese Krankheit reißen, euch, seht euch doch an, dort, wie ihr dort steht, alle in diesem merkwürdigen Schwarz und ihr meint, das würde ausreichen, um traurig zu sein. Das meint ihr doch, oder etwa nicht? Ihr meint doch, wenn ihr euch einmal alle paar Jahre in einen schwarzen Anzug oder in ein schwarzes Kleid steckt, dann wüsstet ihr, was Trauer ist. Aber das ist eine ganze verdammte Lüge, sonst nichts. Euer ganzes Leben ist so doch nur eine einzige Lüge! Glaubt ihr, wenn ihr ein paar Stunden hier herumsteht, dann wird alles wieder gut, ja? So ist es aber nicht! Es reicht verdammt noch mal nicht aus, hier wie angewurzelt zu stehen und mich, die ich um meine Mutter weine, anzuschauen, weil ich Tränen vergieße, Herrgott auf einer Beerdigung, auf einer gottverdammten Beerdigung Tränen vergieße!“ Lucrezia schaute sich schluchzend um, dann überschlug sich ihre Stimme förmlich. „Und ich sage euch noch etwas – es ist nicht schlimm, so verrückt zu sein, wie ich es jetzt bin – das denkt ihr, ich sei verrückt, oder etwa nicht? Aber ich bin nicht verrückt, ich bin traurig, so elendig traurig wie noch nie zuvor in meinem Leben. und ich wünsche mir, ihr könntet nur ein kleines Bisschen dieser Trauer spüren, nur ein kleines Bisschen, damit ihr wüsstet, was ihr bis jetzt nicht gehabt habt, damit ihr begreifen würdet, was meiner Mutter gefehlt hat, ihr ganzes Leben lang gefehlt hat. Und nur diese eine Mal, das hat sie sich gewünscht, nur dieses eine Mal könnten wir ihr das geben, was ihr gefehlt hat – begreift ihr das? Nur einmal, nur ein einziges Mal!“ Und mit einem brüllenden „Charlotte ...!“ stürzte sie auf den Boden, kniete neben dem Sarg, der Rotz lief ihr die Nase herunter, das Gesicht war hochrot und ihre Stimmbänder schmerzten, so sehr hatte sie geschrien.
Langsam, langsam, ganz langsam erhob sich Lucrezia wieder, die Tränen versiegten, sie richtete ihren Körper in Zeitlupentempo auf, bis sie, beinahe verträumt sah sie aus, neben dem schwarzen Sarg aus Eschenholz stand und in die Ferne blickte. Ihre Augen wanderten den Himmel entlang, schien es, manche Menschen drehten sich gar um und fragten sich, was sie dort wohl sähe. Ein paar Menschen wollten unbedingt auch das sehen, was Lucrezia dort sah. Doch Lucrezia sah nicht, Lucrezia hörte und sie fühlte. Sie hatte ein Versprechen einzulösen. Und so begann sie flüsternd: „Lasst euch einfach treiben, lasst euch mitnehmen und seht, wohin es euch führen wird. Es ist ein leichtes Vibrieren am Anfang... Ihr müsst schon sehr gut achtgeben, um es überhaupt zu bemerken. Ganz, ganz zart ... Aber versucht, ganz genau um euch herum und in euch hineinzufühlen. Ein ganz kleines Zittern, und es ist kaum vorstellbar, dass daraus etwas Gewaltiges entstehen sollte. Wer auch immer dieses kleine, zarte Vibrieren zum ersten Mal vernimmt, der möchte es beinahe beschützen, denn es ist so zerbrechlich, meint man. Es kann fast nicht weiterleben ohne Hilfe. Es macht Spaß, es zu sehen, zu hören, zu fühlen. Und doch haltet eure Hände fern von ihm, denn es wird alleine wachsen, es wird sich verwandeln, unendlich viele Stadien durchlaufen“, und Lucrezia begann, ihren Körper sanft zu wiegen, einer Welle gleich, die friedlich am Strand landet. „Ganz klein, so klein ...“, murmelte sie und versprühte mit ihren Worten und Bewegungen Magie. „Am besten ist es, die Augen zu schließen. Das Sehen verhindert es manchmal, die kleinen Dinge zu hören. Wenn die Augen geschlossen sind, kann man sich am besten auf das kleine Zittern konzentrieren, das durch unsere Gehörgänge in uns eindringt.“
Ihre Bewegungen wurden etwas schneller, sie tanzte wie eine Schlange, die von Musik beschwört wurde. Und sie war beschwört von diesen Tönen, doch zugleich konnte sie auch andere Menschen damit beschwören. Ein Mann und eine Frau hatten die Augen geschlossen und ob sie es wollten oder nicht, unwillkürlich hörten sie plötzlich jenes zarte Tönchen, von dem Lucrezia sprach, jenes kleine Kitzeln in den Ohren und sie gaben dem Impuls nach, sich ganz sanft dazu zu bewegen.
„Es ist die Musik des Schmerzes, von der ich euch nun erzählen möchte. Am Anfang, oder tief im Inneren, der Kern einer jeden Musik ist wunderbar. Dieser wunderschöne kleine Ton, dieses sanfte Zittern und Kitzeln, das ist der Kern einer jeden Musik. Doch um diesen Kern herum, aus diesem Kern hervor ... Wandlungen, unzählige Wandlungen ...“
Sie wogte immer noch ihren Körper, aber wieder sehr langsam, sie bewegte sich nach der Musik.
„Zunächst kann niemand so recht erkennen, was sich aus dieser Winzigkeit einmal entwickeln wird. Hört ihr es noch genau? Spürt ihr es? Es wird sich langsam wandeln, langsam, aber unaufhaltsam, es gesellt sich ein unangenehmer Laut zu unserem sanften Surren. Dieser Laut trübt die Freude schon beträchtlich, er stört, ja, er stört regelrecht und wir wollen ihr nicht in uns haben, er ist unangenehm, er kitzelt nicht sanft, nein er schmerzt in den Ohren und er wir immer lauter! Lauter! Lauter!“, brüllte Lucrezia und wandte sich in größtem Ekel und Schmerz. „Ein gewaltiger Chor, andere Dimensionen tun sich auf, seht ihr ihn, seht ihr diesen mächtigen Chor, alle diese gewaltigen Stimmen, Tausende mögen es sein, die alle anderen Geräusche von sich geben, nein, es ist kein Gesang, es ist beileibe kein Gesang! Es ist ... es ist furchtbar! Und er kommt immer näher und näher, Gewirr tausender Stimmen in unseren Ohren, die geballte Macht der Musik bekommen wir zu spüren, es ist grausam, wie unaufhaltsam sie ist. Es kann ein Kreischen sein, ein Pfeifen oder Dröhnen, ein Schlagen oder Hämmern, ein Jaulen oder Krächzen, es kann alles sein, es ist nur mit Sicherheit eines nicht, es ist nicht schön, nie und nimmer ist es schön – weg! Fort mit ihm! Aber es geht nicht, nein, ganz im Gegenteil, dieser Schmerz, der in unseren Ohren angefangen hat, er breitet sich immer weiter aus, er kriecht mitten in unseren Kopf und dort macht er sich erst so richtig breit. Er frisst sich fest und bohrt so lange, bis er uns in unserem Mark erschüttert hat. Er drückt in unsrem Gehirn, er breitet sich aus wie ein Geschwür. Es ist kaum auszuhalten, dieser Schmerz ist kaum auszuhalten, es ist so unendlich. Er soll raus! Raus! Raus! Aber er geht nicht, er lässt sich nicht vertreiben. wir schmeißen uns zu Boden, rennen gegen Wände, schlagen mit der Faust in unser eigenes Gesicht, wir jammern und schreien, aber dieser Schmerz sitzt fest, er sitz dort oben und quält uns. Er bleibt nicht dort, er will noch weiter, legt ein atemberaubendes Tempo vor, er drückt von innen auf die Augen. Die Augen werden von ihrer Last befreit, doch nur, weil der Schmerz sich einen Weg sucht, wie er uns ganz ausfüllen kann. So kriecht er nieder, und von entsetzlichem Ekel gepackt winden wir unseren Körper, wir winden unsere Arme um die Brust, dort glauben wir, könnten wir ihn packen, dort sitzt er, doch er breitet sich immer schneller und schneller aus, unser ganzer Körper ist plötzlich ein einziges Kreischen, ein Dröhnen wilder Trommeln, brüllen wilder Hörner. Es ist so laut in uns, so laut wir finden tage- und nächtelang nicht eine Sekunde Ruhe zum Schlaf. Der Lärm und der Schmerz, sie halten uns wach und wir glauben erneut, wahnsinnig zu werden. Tagelang ohne Schlaf, tagelang dieser Lärm, dieser Schmerz. Ein letzter verzweifelter Versuch, das alles loszuwerden, es aus uns herauszuschneiden, wir würden zu jeder Methode greifen, brächte sie nur eine Linderung. Wir halten uns die Ohren zu, in dem naiven Glauben, den Lärm in uns dann nicht mehr zu hören, wir schneiden uns mit Messern in das Fleisch, denken, dieser Schmerz würde uns den inneren Schmerz vergessen machen, wir stampfen und schreien, wir jaulen und heulen, heulen bis zur Erschöpfung und laufen! Laufen! Laufen! Meinen, durch Laufen könnten wir dem Schmerz entkommen und laufen und schreien dabei immer lauter und laufen und laufen und schreien und laufen und laufen – aaahhh! Es ist um uns geschehen, er hat vermocht, uns in Brand zu stecken, eine kleine Flamme war es zunächst nur, die der brausende Schmerz entfachen konnte, eine kleine empfindliche Stelle in uns nährte die Glut und schon lodert die kleine Flamme in uns empor. Die Hitze durchdringt uns von oben nach unten und umgekehrt, kreuz und quer schießt sie durch unsere Eingeweide, findet immer neue Nahrung, das Feuer breitet sich aus, Himmel, wir verbrennen bei lebendigem Leibe, bei lebendigem Leib, so tut denn niemand etwas, hilft denn keiner, wir brennen von innen, da Feuer frisst sich durch uns durch und die Wunden brennen so sehr, sie schmerzen unendlich, wir bluten und schreien und es raubt uns den Verstand. Ich brenne, mit jeder meiner Poren, mit jeder Zelle, jedem Bruchteil meines Selbst in Flammen aufgehe. Über den Schmerz scheinen wir das Bewusstsein zu verlieren. Eure Lungen rasseln erbärmlich bei dem Versuch, noch einige Liter Luft einzusaugen, euer Gehirn arbeitet so schnell und so wirr, dass es kurz vor der Explosion zu stehen schien, die Nerven überschlagen sich förmlich, die Zellen wuseln wild durcheinander und scheinen sich ineinander zu verschmelzen, dann wieder gewalttätig zu trennen, um mit großer Geschwindigkeit von dem einen Ende meines Schädels zum anderen zu schießen. Farben, Formen, Gerüche und Geräusche zucken um euch herum und durch euch durch, dort in euch hinein hier und dort wieder hinaus, viel zu schnell, um sie wahrzunehmen. wir sind weit davon entfernt, einen klaren Gedanken fassen zu können, jeder ist weit von sich entfernt und noch weiter von dieser Welt. Wolken, Sterne, Kanten und Ecken, Quadrate fliegen an euch vorbei, riesige Gehirne und winzige Brocken aus fernen Galaxien. Formieren sich, schweben um eure Schädel, lösen sich in Nichts auf, kehren zurück als Staub und Asche, als Sand und Luft. Gelbe Luft mischt sich direkt über uns mit blauer, um als rot gestreifte Schlage davonzufliegen. Die tausend Jahre meines Lebens umkreisen uns und nehmen schließlich Platz an unserer Seite, auf tausend Stühlen, die wir nur für sie geholt hatten. Ich sehe die Schatten der Zeit und die Umrisse von Gott. Die Schwänze des Teufels und den Kosmos in meiner Tasche. Die Götter der Antike sind nebenan und der Tag beginnt in jeder Sekunde aufs Neue. Die Moleküle sind so riesig, sie schwirren durch das Zimmer und lassen sich in einem kleinen Löffelchen aufkochen. Immer lauter und lauter, je näher wir herangetragen werden an die Grenze des fernen Lebens, immer lauter und lauter wird diese erbärmliche Musik. Lasse dich los, lasse dich doch nur einmal los und spüre, wie wunderbar es ist, zwischen den Wolken zu schweben. Die Planeten zu sehen und die Sterne vom Himmel holen zu können. Gott ist nah an dir und der Teufel. Nimm einen von beiden mit und trage ihn immer bei dir. Lasse dich los. Schwebe durch Raum und Zeit, durch Himmel und Hölle, durch Alles und Nichts, durch diese Welt und durch die Träume, im Exzess, im Wahn, dem Wahnsinn verfallen, schwebe durch deinen eigenen Körper und durch tausend andere, fliege durch die Moleküle, so klein und unbedeutend, greife nach den fernsten Sternen, so riesig und mächtig, so allumfassend und so überwältigend. Sind es Violinen wohl, die kreischend zu uns drängen, sind es Celli, oder gar Flöten, ja, Flöten werden es wohl sein, sie krächzen, sie bemühen sich verzweifelt um einen Ton, bemühen sich verzweifelt um Liebe, sie hauchen und zischen, sie prallen mit ihrem grausamen Spiel auf das Trommelfell, doch sie erlangen keine Liebe, nein, sie sind so schrecklich, so unbeholfen und doch voller Absicht, sie quälen die Ohren mit ihrem ungekonnten Pfeifen, sie quälen unser selbst, unser innerstes, sie quälen uns durch und durch, sie quälen uns ganz. Alles ist plötzlich verzerrt, wir sehen nur noch wilde Fratzen, die sich auf und ab bewegen, alle Farben sind verwischt, nichts ist mehr klar, die Menschen verwandeln sich, Kreise werden zu Quadraten, die Luft, die uns umgibt, ist plötzlich mit Schlangen gefüllt, alles ist so hässlich, so unerträglich hässlich, jeder Anblick tut aufs Neue so weh, brennt in den Augen, wir glauben, verrückt zu sein. Ein Trommeln mächtigster Pauken, sie schlagen uns schallen, sie tönen durch uns hindurch, sie erschüttern uns, die Noten bleiben hängen, bleiben in uns, reißen einen Teil aus uns heraus, während sie gewaltsam ihren Weg hinaus suchen, hinaus, hinaus, schallen sie und tönen, sie lärmen gar, sie sind gewaltig, so gewaltig wie sie in uns dringen, wie sie an uns kratzen, die Haut einschneiden, um in uns gelangen zu können, wie sie jede Faser zerkleinern, alles, was ihnen im Weg ist, zerstören sie. Wir zerren an uns selbst, an unseren Körpern, würden sie am liebsten auseinanderreißen, weil wir hoffen, dass der Schmerz dann nachlassen würde, so laufen wir gegen Wände, greifen in Glasscherben, fügen uns selbst Schmerz zu, um diesen inneren Schmerz zu bekämpfen, um ihn übertönen zu können. Aber was wir auch immer versuchen, es gelingt uns nicht, es gelingt einfach nicht. Es reißt in uns, zieht und zerrt, brennt und trocknet uns aus, ist unerträglich kalt und reißt uns wie in wildes Tier. Wir werden zerrissen, förmlich zerrissen von scharfen Zähnen, die sich in unser Fleisch graben, tief hinein, so tief und so schmerzhaft graben sie sich unter die Haut, sprengen die Adern und das Blut läuft aus unserem Körper. Es läuft an uns