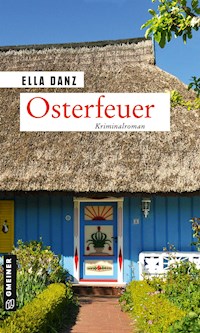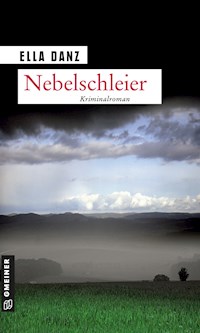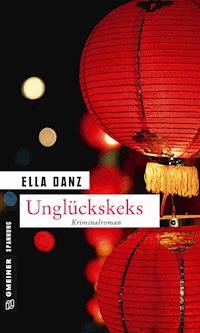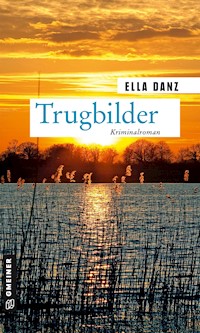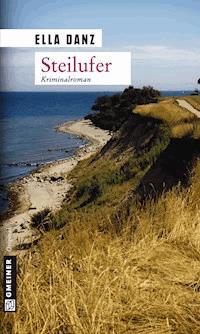
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Hauptkommissar Georg Angermüller
- Sprache: Deutsch
An einem verregneten Sommertag wird in der Lübecker Bucht ein Toter gefunden. Sein Gesicht ist vollkommen zerstört - die Identifizierung ist zunächst unmöglich. Nicht weit vom Fundort entfernt wird der Pâtissier eines Feinschmeckerrestaurants, ein junger Algerier, vermisst. Der Fall scheint klar, denn auch das Motiv ist schnell gefunden: Rassismus. Tatverdächtig ist eine Clique Neonazis. Anna Floric, die Chefin des Restaurants, bekommt es mit der Angst zu tun. Viele ihrer Mitarbeiter stammen aus Nordafrika. Ihre größte Sorge jedoch gilt Lionel, ihrem zwölfjährigen Sohn. Als die Ermittlungen sich immer zäher gestalten und auch noch dunkle Wolken über seinem Privatleben aufziehen, droht Kommissar Georg Angermüller seine Seelenruhe und die allseits bekannte Vorliebe für gutes Essen zu verlieren …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 467
Veröffentlichungsjahr: 2009
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Ella Danz
Steilufer
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2007 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75/20 95-0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
Für Moni & Läusi mit Dank für die großartige Gastfreundschaft!
Der Fund
Nachdem Dorothea Paschke im Alter von 40 Jahren die Hoffnung aufgegeben hatte, einmal eine eigene Familie zu gründen und ihr klar geworden war, dass sie die ihr verbleibenden Werktage bis zum Rentenalter im Vorzimmer von Dr. Hübner verbringen würde, den sie liebte und verehrte, für den sie aber immer nur die patente Dodo blieb, die man beauftragen konnte, seine Frau anzurufen, wenn es mal wieder später wurde – nachdem ihr dies klar geworden war, gab sie kurz entschlossen ihrem Leben einen neuen Sinn. Sie wollte einen Traum verwirklichen, der sie, wenn sie es recht bedachte, schon von Kindesbeinen an begleitet hatte. Mit preußischer Disziplin und eiserner Sparsamkeit, die ihre nichts ahnenden Mitmenschen gerne als krankhaften Geiz interpretierten, hatte sie begonnen, unbeirrt an der Verwirklichung ihres neu gesteckten Zieles zu arbeiten.
Dorothea Paschke war das einzige Kind ihrer Eltern – der Vater Postbeamter, die Mutter Hausfrau – und aufgewachsen im unspektakulären Lichterfelde, wo der alte Berliner Westen besonders provinziell war. Das hatte sie nie gestört. Das Leben war hier ruhig und übersichtlich und auch als sie sich eine eigene Wohnung nahm, zog sie nur ein paar Straßen weiter. Die tägliche Portion großstädtischen Flairs bezog sie auf dem Hin- und Rückweg zur Arbeit, denn das Büro der Dr.-Hübner-Konzertagentur befand sich mitten in der City, im Europa-Center, mit Blick auf Gedächtniskirche und Kurfürstendamm. Doch auch darauf hätte sie gerne verzichten können. Die Geschäfte ringsum wurden immer teurer, sodass sie lieber Stullen ins Büro mitbrachte, statt sich ein belegtes Brötchen zu holen, mittlerweile Baguette genannt und dafür zum doppelten Preis. Auch die unangenehmen Kehrseiten von Wohlstand und Fortschritt nahmen unübersehbar zu: der Verkehr, der Lärm, der Müll, der einfach so auf den Straßen lag, die vielen Penner, die auf den Stufen vor der Kirche lungerten – mit den Jahren schätzte sie die ordentliche Beschaulichkeit ihres Wohnbezirks immer mehr.
Seit die Familie Paschke es sich leisten konnte, verbrachte sie im Sommer drei Wochen an der Ostsee, in einer kleinen Pension nahe Timmendorfer Strand. Bei ihren Spaziergängen über die Promenade und durch den Ort mit seinen schicken Hotels und teuren Boutiquen genossen sie dann das Gefühl, in einem mondänen Badeort der großen Welt abgestiegen zu sein. Und als ihre Lebensplanung endlich klar vor ihr lag, beschloss Dorothea Paschke, dass sie ihren Ruhestand hier verbringen wollte. Sie erwarb ein Appartement in einer modernen Anlage mit allen Schikanen wie Pool, Garage und Portier, direkt an der Promenade, mit einer sonnigen Terrasse und herrlichem Blick aufs Meer. Sie aß im Büro ihre Stullen, ging kaum aus und besaß kein Auto, wohnte im Urlaub weiterhin in der kleinen Pension und vermietete ihre Traumwohnung an Feriengäste.
Vor drei Jahren, sie war gerade 58 geworden, rief ihr verehrter Chef sie zu sich und bot ihr eine größere Summe, wenn sie vorzeitig aus dem Betrieb ausschiede. Sie rechnete kurz nach, schob die Kränkung, dass man sie einfach so zum alten Eisen warf, kurz entschlossen beiseite, forderte mehr Geld, ging in den Vorruhestand und wenig später konnte sie ihren Traum endlich leben. Sie bezog ihr Luxusappartement am Meer und jeden Morgen, wenn sie nach dem Aufstehen erst einmal auf ihre Terrasse hinaustrat, um den weiten Blick zu genießen, dankte sie ihrem Schicksal.
Schnell hatte sich Dorothea Paschke in ihrem neuen Leben eingerichtet. Als sie berufstätig war, verlief ihr Alltag in einem festen Rhythmus: Montag bis Freitag arbeiten, Montag, Mittwoch und Freitag einkaufen, am Wochenende Hausputz, Gesichtsmaske, Maniküre, Elternbesuch, Spaziergang oder ein Kulturereignis, das wenig bis gar nichts kostete. Und auch jetzt hatte jeder Tag seine Aufgaben: kochen, putzen, bügeln, Sonderangebote studieren, einkaufen, Gymnastik, spazierengehen, Schönheitspflege – das und vieles mehr wollte erledigt werden. Die Belohnung für ihre strenge Zeiteinteilung war eine Wohnung, die blinkte und blitzte und in der sie jederzeit Besuch empfangen konnte und ihre gepflegte Erscheinung, der man weder die Vorzimmerdame, noch ihr Alter ansah. Allerdings bekam sie nie Besuch. Ihre Eltern waren inzwischen gestorben, weitere Verwandte hatte sie nicht und bisher hatte sie weder Nachbarn noch Herren, die sie beim Kurkonzert kennengelernt hatte, für wert befunden, ihre heiligen Hallen zu betreten. Nie wäre sie auf die Idee gekommen, die drei, vier ehemaligen Kollegen und Kolleginnen, denen sie an Weihnachten Karten sandte, in ihre neue Heimat einzuladen. Deshalb hatte sie auch lange gezögert, als Frau Geyer aus der Buchhaltung – inzwischen ebenfalls im Ruhestand – bei ihr anrief, um zu fragen, ob es nicht nett wäre, wenn sie für ein verlängertes Wochenende zu ihr nach Timmendorf käme.
Schließlich hatte der Stolz auf ihr neues, elegantes Leben gesiegt und sie sagte zu. Bestimmt würde die Geyer mächtig beeindruckt sein. Allerdings verwahrte sie sich dagegen, dass sie auch bei ihr nächtigte – so eng waren sie nun doch nicht miteinander – und empfahl ihr ein kleines Hotel in der Nachbarschaft. Dorothea empfing ihre alte Kollegin nach deren Ankunft am Freitagnachmittag zum Tee. Leider war es zu windig, um auf der Terrasse zu sitzen und so hatte sie den Tisch vor der großen Panoramascheibe gedeckt, die sie wöchentlich putzte und wie erwartet erging sich Frau Geyer in verzückten Ausführungen über die Lage, die Größe und die Noblesse von Dorotheas Domizil.
Als es mit den Komplimenten vorbei war, folgte bei Dorothea die Ernüchterung und sie musste feststellen, dass Frau Geyer noch genauso übergewichtig und laut wie eh und je war. Mit großem Appetit verschlang sie die teuren Tortenstückchen, die Dorothea ausnahmsweise und nur für den Besuch besorgt hatte und versuchte, ihrer Gastgeberin klar zu machen, dass sie selbst viel lieber im Süden ihren Lebensabend verbringen wollte.
»Mein Rudi und ich, wir wollen uns ein Appartement auf Mallorca kaufen.«
Sie sprach das Wort ›Appartemang‹ und Rudi war ihr schrecklicher Mann, ein öliger Pharmareferent. Dass sie überhaupt einen Mann hatte, bei dieser Figur und dem ungezügelten Appetit, war Dorothea sowieso ein Rätsel, auch ihre Art, sich zu kleiden, hatte mit ihrem eigenen Stil einer schlichten, sportlichen Eleganz nichts gemein. Sie beschloss, den Großteil des Wochenendes mit der Kollegin an der frischen Luft zu verbringen. Schließlich wollte sie ja die Gegend kennenlernen und vielleicht würde sie dann nicht so viel reden. Jetzt folgte erst einmal eine weitere Peinlichkeit und bevor Dorothea Paschke protestieren konnte, hatte Frau Geyer die als Geschenk überreichte Likörflasche geöffnet, zwei Gläser aus dem Regal gegriffen und das ›Du‹ angeboten.
»Ich bin die Ute.«
»Dorothea«, sagte Dorothea Paschke überrumpelt.
»Ich werde dich Dodo nennen, so wie unser Doktorchen immer!«, und schon hatte Dorothea zwei feuchte Küsschen auf den Wangen.
Missmutig schlenderte Dorothea den Strand entlang. Pünktlich zu Frau Geyers Ankunft hatte sich das Wetter noch weiter verschlechtert, die Sonne ließ sich selten blicken und ein kräftiger, kalter Wind trieb dunkle Wolkenwände vor sich her, aus denen es hin und wieder regnete. Die Farbe des Meeres schwankte zwischen dunkelgrün und schmutzigbraun. Die Folge waren sich häufende Hinweise auf das mallorquinische Klima, das Ute und Rudi ja so glänzend bekam. Aber außer dass sie ihren neuen Badeanzug nicht würde tragen können, bedauerte Ute Geyer nicht ihr Kommen und auch die langen Spaziergänge schienen ihr nicht das Geringste auszumachen. Dorothea hatte sie am Sonnabendmorgen den mehrere Kilometer langen Weg am Steilufer nach Travemünde geführt, der mal oben auf der Höhe, mal unten am Wasser lief und vorgeschlagen, retour den Bus zu nehmen. Doch nach einem kräftigen Imbiss im Café an der Promenade in Travemünde– Ute hatte ein Bauernfrühstück und ein Stück Lübecker Marzipantorte, Dorothea ein Krabbensüppchen– fühlte Ute sich so gestärkt, dass sie auch den Rückweg zu Fuß machen wollte.
Dorothea zog die Kapuze ihres cremefarbenen Anoraks enger an den Kopf. Die dezenten braunen Streifen an den Ärmeln korrespondierten perfekt mit der Farbe ihrer sportlichen Wildlederschuhe und dem helleren Braun der schmal geschnittenen Hose. Ute lief durch den Sprühregen voraus, ihre orangefarbene Regenjacke leuchtete durch das Grau. Sie bückte sich hier nach einem Stein, sammelte dort eine Muschel ein und redete unentwegt. Durch Wind und Brandung verstand Dorothea kaum ein Wort und das war ihr nur recht.
»Dodo!«
Wie peinlich, mit diesem komischen Namen gerufen zu werden! Doch angesichts des Wetters war kaum jemand am Strand und schon gar nicht in Hörweite, der sich darüber hätte mokieren können. Ute balancierte auf einer aus großen Findlingen ins Meer gebauten Buhne, die an diesem Strandabschnitt, an dem in jedem Winterhalbjahr die Stürme fraßen, die Anlandung fördern sollte. Wenn sie bloß nicht noch ins Wasser fällt, dachte Dorothea, als ihre alte Kollegin jetzt auch noch heftig mit den Armen zu wedeln begann und immer wieder auf die andere Seite des Steinwalls deutete.
»Dodo! Schau dir das an!«
Im Nachhinein bereute Dorothea bitter, Utes Ruf gefolgt zu sein. Niemals wäre sie auf die Buhne geklettert, hätte sie vorher gewusst, was sie auf der anderen Seite zu sehen bekommen sollte. Utes Winken und Rufen hatten wohl eine gewisse Aufgeregtheit, doch nicht genug, um dahinter eine so grauenvolle Entdeckung zu vermuten. An der Seite der Buhne, an die die Brandung rollte, trieb ein kleines Schlauchboot in den Wellen. Die eine Luftkammer schien nicht mehr den vollen Inhalt zu haben und es schlug mit seinem Kunststoffboden gegen die mächtigen Basaltblöcke, was einen dumpfen Klang erzeugte. Ute stand breitbeinig auf den Steinen und zeigte mit dem Finger in das Boot.
»Siehst du, was da liegt?«, fragte sie durch Wind und Brandungsrauschen. Dorothea balancierte konzentriert über die Findlinge, um ihre neuen Schuhe zu schonen und nicht abzurutschen und dann hatte sie das Boot voll im Blick. Ungläubig starrte sie hinein. Sah die Gestalt darin liegen. Dann stieg Übelkeit in ihr hoch. Sie wendete sich abrupt ab und kroch auf allen Vieren über die Steine zurück an den Strand und es war ihr egal, dass sie dabei die edlen Schuhe verschrammte.
»Dodo! Nun warte doch mal! Wir können den doch hier nicht so liegen lassen!«
Dorothea versuchte, den Anblick sofort zu verdrängen, doch dieses im wahrsten Sinne des Wortes zu Brei geschlagene Gesicht, das nur noch eine schwarzbraunrote Masse zu sein schien, haftete in ihrem Kopf. Sie hielt sich die Ohren zu. Sie wollte dieses entsetzliche Ding nicht nur nicht mehr sehen, sie wollte auch nichts darüber hören.
1
Ungläubig starrte sie auf den Papierstreifen, den der Rechner ausgeworfen hatte. Wenn diese Zahlen wirklich stimmten, war ihre Situation nicht nur kritisch, sondern fast schon ausweglos. Wie konnte sie sich nur so täuschen? Der Juni war doch ein verhältnismäßig guter Monat gewesen! Das Wetter hatte mitgespielt, die Pfingstfeiertage waren sehr gut gelaufen und sie hatten eine große Hochzeitsgesellschaft, einen Empfang für den Fremdenverkehrsverein und zwei Geburtstage ausgerichtet. Außerdem hatte ein Team des Regionalfernsehens ein Portrait über ihr Restaurant gedreht und eine große Frauenzeitschrift einen Artikel veröffentlicht, der eine einzige Lobeshymne auf sie und ihre Kochkunst darstellte. Sie hatte ein so gutes Gefühl gehabt. Und nun das.
Resigniert legte Anna Floric den Streifen zuoberst auf den Stapel Briefe auf ihrem Schreibtisch. Fast alle bargen Rechnungen: von Lieferanten, von der Druckerei, von der Wäscherei, von der Autowerkstatt. Ihre Fantasie zum Ersinnen weiterer Sparmaßnahmen war erschöpft. Es würde ihr nichts weiter übrig bleiben, als wieder einmal einen sehr unangenehmen Gang zu ihrer Bank anzutreten und mit diesem Banausen im feinen Zwirn über eine Erweiterung ihres Kreditrahmens zu verhandeln. Schon bei dem Gedanken daran bekam Anna ein flaues Gefühl im Magen. Zahlen waren einfach nicht ihre Welt und vor diesem spießigen Filialleiter als Bittstellerin zu Kreuze zu kriechen, lag ihrem geradlinigen Wesen schon gar nicht. Mechanisch öffnete sie einen Brief nach dem anderen und stapelte alle Rechnungen in den Korb mit der ordentlichen Aufschrift ›Überweisen‹, der rechts auf dem großen, alten Eichenschreibtisch stand. Am liebsten hätte sie mit all diesen finanziellen Dingen gar nichts zu tun gehabt. Kochen, das war es, was sie konnte und wollte. Doch feine Speisen in einem ansprechenden Ambiente zu servieren, war eben noch lange keine Garantie für finanziellen Erfolg. Und sie hätte wissen müssen, auf welches Wagnis sie sich einließ, als sie ein eigenes Restaurant eröffnete, schließlich stammte sie aus einer Dynastie von Hoteliers und Gastwirten.
Ihr fiel ein, dass Yann sie erst kürzlich wieder gemahnt hatte, alle Forderungen penibel auf ihre Richtigkeit zu überprüfen, bevor sie überwiesen wurden, weil er sie in dieser Hinsicht für ein bisschen zu nachlässig hielt und er hatte wahrscheinlich recht. Mit einem Seufzer ergab sie sich dieser Einsicht und griff nach dem Packen Rechnungen, um ihre Pflicht zu tun. Vom Hof erklang ein lautes Motorengeräusch.
Anna hob den Kopf und sah durch das Fenster, wie der schmächtige Hadi sich gerade noch mit einem Sprung vor dem heranpreschenden Lieferwagen mit der Aufschrift ›Gourmet-Profi‹ in Sicherheit bringen konnte, der jetzt kurz vor ihm mit einem heftigen Ruck zum Stehen kam. Die Fahrertür sprang auf und heraus federte ein braun gebrannter Mann mit einem kurzen Bürstenschnitt, der an den Haarspitzen blond gefärbt war. Grinsend rief er etwas in Hadis Richtung, was Anna durch die geschlossenen Fenster nicht verstehen konnte. Hadi antwortete nur mit einer drohend erhobenen Faust und verschwand dann schnell in Richtung Remise. Gerade wollte Anna hinausstürzen und diesen rücksichtslosen Typen anschreien, in Zukunft auf ihrem Grundstück wie ein zivilisierter Mensch zu fahren, schließlich spielten hier auch öfter Kinder, da sah sie Mat-thias, den Kochlehrling, den alle nur ›Matte‹ nannten auf den Hof treten und ganz gegen seine Gewohnheit machte er ein freundliches Gesicht.
Er und dieser Rennfahrer klatschten sich wie alte Kumpels mit der rechten Hand ab, der Fahrer, der vielleicht um die 30 sein mochte, bot Matthias eine Zigarette an und dann standen sie nebeneinander und rauchten und schienen viel zu bereden zu haben. Der Ältere trug eine Art Armeehose in Tarnfarben zum weißen T-Shirt, das auch den Schriftzug ›Gourmet-Profi‹ trug und eng um seinen breiten Oberkörper und die muskulösen Arme spannte und ab und zu haute er Matte kräftig auf die Schulter. Das schien der wie ein Kompliment zu genießen.
»Anna! Die Frischware kommt gerade an. Ich nehme die Lieferung entgegen. Gibts irgendwas, das wir brauchen können, falls er ein zusätzliches Angebot hat?«
Yanns Stimme ließ Anna den Blick vom Hof nehmen und sie rief in den Treppenflur:
»Merci, Yann! Ich habe neulich mal nach Meeresschnecken gefragt. Wenn er heute welche hätte, wäre das schön, wir könnten mal wieder die kleinen Schneckenküchlein anbieten. Zwei Kisten würden ausreichen.«
»D’accord, cheffesse!«
Mit einem Lächeln beugte sich Anna wieder über die Rechnungen auf dem Schreibtisch. ›Chefin‹ nannte er sie. Yann war ihr Geschäftspartner, ihr Berater und darüber hinaus, wenn sie es recht bedachte, Teil ihres Lebens. Ohne ihn hätte sie die Idee, hierher in den Norden Deutschlands zu ziehen, die ›Villa Floric‹ zu eröffnen und ein neues Leben zu beginnen, wahrscheinlich nie in die Tat umgesetzt. Und dabei hatte sie viele Gründe gehabt, das Küstenstädtchen in der Bretagne, in dem sie geboren und aufgewachsen war, nach 27 Jahren zu verlassen. Als sie Yann von ihren Absichten erzählte, hatte er ihr sofort angeboten, mitzukommen– er, der jetzt auch schon auf die 40 ging, damals kaum Deutsch sprach und in seiner Heimat am Atlantik fest verwurzelt schien. Natürlich hatte sie das im ersten Moment sehr erstaunt, doch da er außer einer Cousine, die in Nantes wohnte und die er kaum kannte, keinerlei Verwandte hatte und schon so lange mit ihrer Familie lebte, hatte sie sein Angebot dankbar angenommen und diese Entscheidung keine Sekunde bereut.
Seit mehr als drei Jahren lebten und arbeiteten sie schon an diesem Platz hoch über der Lübecker Bucht – und was für ein herrlicher Platz war das! Sie erinnerte sich noch an ihre erste Annäherung über den Fußweg, der über das Steilufer durch einen kleinen Laubwald führte, der sich plötzlich auftat und den Blick auf die in einem sanften Altrosa leuchtende Jugendstilvilla freigab, davor, begrenzt von Heckenrosen, eine Art natürliche Terrasse, unterhalb derer man die Ostsee in der Ferne glitzern sah und die Schemen der mecklenburgischen Küste erahnte. Immer wieder hatte ihre Tante Edith Anna von der schon lange leer stehenden historischen Gaststätte berichtet und versucht, sie zu einer persönlichen Inaugenscheinnahme nach Lübeck zu locken. Als sie dann endlich davor stand, war sie ohne Widerstand dem Charme des zweistöckigen Gebäudes aus den 20er Jahren und seiner traumhaften Umgebung erlegen und es hatte keiner weiteren Überredungskunst ihrer Tante bedurft.
Anna hatte sich ihren Anteil am Erbe auszahlen lassen und voller Elan hatten sie und Yann sich in die Renovierung gestürzt, behutsam die alte Bausubstanz unter den Renovierungsschäden früherer Besitzer freilegen lassen, den Garten neu angelegt und die Gasträume mit der gleichen Liebe und Aufmerksamkeit gestaltet, mit der sie eine eigene Wohnung eingerichtet hätten. Nach fünf Monaten voll harter Arbeit, nicht enden wollenden Diskussionen mit Architekten und Handwerkern, vielen schlaflosen Nächten und einem sich teuflisch schnell verkleinernden Kontostand, hatten Anna und Yann voller Stolz die Türen zu ihrem Restaurant ›Villa Floric‹ geöffnet und die ersten Gäste begrüßt. Im ersten Jahr konnten sie sich über mangelnden Zuspruch wahrlich nicht beklagen. Viele Feinschmecker in Lübeck und Umgebung schienen nur auf ein neues Ziel für ihre kulinarischen Wallfahrten gewartet zu haben und pilgerten scharenweise in die roséfarbene Villa hoch über dem Meer. Doch eine ebenso große Anzahl von Gästen wollte wohl nur ihre Neugierde befriedigen und mitreden können, war aber von den Kreationen der Küche im ›Floric‹ überfordert und ebenso wenig bereit, dafür den angemessenen Preis zu bezahlen.
Ja, ja – die Menschen hier waren nicht so leicht zu überzeugen. Jede Münze, die sie ausgaben, drehten sie dreimal um und zwar gerade die Pfeffersäcke, die es sich eigentlich leisten konnten. Sie hatten mindestens so harte Dickschädel wie die Bretonen und ein tief sitzendes Misstrauen gegen alles Neue und Unbekannte, ob es sich dabei um Personen, Moden oder Speisen handelte. »Wat de Buer nich kennt, fret he nich!«, hatte ihre Mutter sie schon gelehrt und die musste es wissen, schließlich stammte sie von hier oben. Im Gegensatz zu den Norddeutschen waren aber die Bretonen – auch wenn sie es nicht wahrhaben wollten – den Franzosen sehr ähnlich und hatten das typische Savoir-vivre im Laufe der Jahrhunderte genauso wie ihre Landsleute in den anderen Provinzen verinnerlicht. Nicht zuletzt deswegen war Annas Mutter nach einem Au-pair-Aufenthalt von der Bretagne nicht wieder losgekommen. Und natürlich wegen ihres Vaters.
Hals über Kopf musste sie sich damals in ihn verliebt haben. Und er sich in sie. Er war ein großer, gut aussehender Mann mit seinen dunklen, dichten Haaren und den braunen Augen, ein Witwer, dem man die 25 Jahre, die er älter war als sie, nicht ansah. Er konnte unwahrscheinlich charmant sein und nannte drei schon fast erwachsene Jungs sein Eigen. Es war nicht leicht für die junge Deutsche, nach ihrer Heirat mit den großen Stiefsöhnen klarzukommen und das Vertrauen ihrer Umgebung zu gewinnen. Doch Annas Mutter war eine furchtlose Frau, ehrlich und klar, die einfach ihren Gefühlen folgte und dadurch letztlich jeden für sich einnahm. Anna war 17, als ihre Mutter, die doch überhaupt noch nicht alt war, voller Energie steckte und immer so vital wirkte, an einem zu spät erkannten Krebsleiden starb. Dass Anna der geliebten Mutter an Spontaneität und Geradlinigkeit in nichts nachstand, auch nicht an unbeugsamem Willen, hatte sie ihrer Umgebung schon seit Kindertagen klar gemacht. Und nach dem Tod der Mutter, mit dem ihr Vater noch weniger fertig wurde als sie, als Anna spürte, dass sie ihr Leben nun selbst in die Hand nehmen musste und in ihrer Gefühlswelt ein großes Loch klaffte, verliebte auch sie sich Hals über Kopf. Kompromisslos.
»Maman! J’ai faim!«, hallte es durch den Flur. Die Tonlage signalisierte dringenden Handlungsbedarf. Eilige Schritte, Hundegebell und gleich darauf schob sich ein dunkler Lockenkopf durch die geöffnete Tür, während der weißgraue Bobtail auf Anna zustürzte, um dann um Anerkennung hechelnd vor ihr sitzen zu bleiben.
»Braver Hund, Napoléon!«, kraulte sie das Tier hinter den Ohren. »Und du, mon petit nounours! Bist du am Verhungern? Da müssen wir ja ganz schnell etwas dagegen tun.«
Ehe seine Mutter ihn mit weiteren Peinlichkeiten wie ›kleines Bärchen‹ bloßstellen konnte, rief der Junge hastig:
»Und Jakob hat auch Hunger!«
Schon erschien der Kopf des Freundes im Türrahmen, die Wangen vom Toben gerötet, das weißblonde Haar zerzaust, und schaute erwartungsvoll zu Anna.
»Was wünschen Sie denn zu speisen, Messieurs?«
»Galettes!«, kam die Antwort zweistimmig und wie aus der Pistole geschossen.
»Das lässt sich wohl machen.«
Dankbar für die Unterbrechung der ihr ohnehin lästigen Beschäftigung legte Anna die Rechnungen zurück in den Korb und erhob sich vom Schreibtisch.
»Verschieben wir es auf morgen!«, sagte sie fröhlich zu den Jungen und hakte einen rechts, einen links unter. Mit einer Mischung aus Bedauern und Belustigung registrierte Anna, dass die Jungen sich kaum merklich gegen diese Berührung sträubten. Die unbeschwerten Kindertage waren endgültig vorbei und allzu große körperliche Nähe oder gar Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit eigentlich nicht mehr erwünscht. Wie die beiden schon wieder gewachsen waren! Es fehlte nicht mehr viel und sie würden sie überragen. Sie musste allerdings zugeben, dass es angesichts ihrer Größe von eins zweiundsechzig nichts Außergewöhnliches war, überragt zu werden. Klein, wie sie war, wenn auch ein bisschen rundlich, die blonden, lockigen Haare zu einem lustigen Pferdeschwanz gebunden, in Jeans und Sweatshirt, hätte man Anna auch für die große Schwester der beiden halten können. Jakob war immerhin schon 13 Jahre alt, aber Lionel gerade erst 12 geworden und fast schon ebenso groß. Nicht nur, was das anbetraf, wurde Lionel seinem Vater immer ähnlicher.
»Machst du uns wieder Schinken und Käse auf die Pfannkuchen?«
Jakob sah sie gespannt von der Seite an und stolperte, wie so oft, über seine offenen Schnürsenkel. Ebenso wie diese immer offen waren, schien der Junge auch immer hungrig zu sein und wusste sehr genau, was ihm schmeckte. Seine Mutter Frauke war eine offene, freundliche Person und, neben ihrer Tante Edith, Annas beste Freundin, mit der sie reden, lachen und bei der sie sich ausheulen konnte. All dies freilich viel zu selten, da sie beide wenig Zeit hatten. Doch vom Kochen hatte Frauke keine Ahnung. Sie gab auch offen zu, dass sie daran nichts weiter interessierte, als dass es möglichst wenig Aufwand kostete. Ihr Beruf als Ärztin im Krankenhaus ließ ihr ohnehin nicht viel Zeit für Häuslichkeiten.
»Klar, Jakob, kein Problem.«
Wenns weiter nichts war! Anna erfüllte dem Jungen gerne seinen Wunsch. Sie war froh, dass er und Lionel sich so gut verstanden. Für Lionel war es anfangs nicht leicht gewesen, sich in dem fremden Land und in der anderen Sprache zurechtzufinden. Seine Deutschkenntnisse waren nicht sehr gut und ihm fehlten die Freunde, die er in seiner bretonischen Heimat zurücklassen musste. Jakob war ein kräftiger Kerl, etwas ungelenk und ein wenig langsam im Begreifen, aber sehr gutmütig und mit einer unerschöpflichen Fantasie begabt, was das Erfinden ihrer Spielwelten anbetraf. Lionel und er waren ein wunderbares Gespann. Sie langweilten sich nie, die einfachsten Dinge dienten als Spielzeuge und sie waren stundenlang nicht zu hören und zu sehen, wenn sie wieder einmal an einem großen Projekt arbeiteten. Zurzeit hatten sie Ferien und da immer noch nicht das ersehnte Strandwetter herrschte, bauten sie im Wäldchen hinter der Villa an einer ›Weltraumburg‹ – was auch immer das sein mochte, es nahm sie ganz in Anspruch und nur ein Anfall von Hunger trieb sie dann ins Haus.
Die beiden Jungen saßen an dem langen, glatten Holztisch, der fast eine ganze Seite der Restaurantküche einnahm, und stürzten sich mit Heißhunger auf die Buchweizenpfannkuchen, die Anna in einer schweren, alten Eisenpfanne im Akkord für sie buk. Fast immer war eine Schüssel Teig für diese bretonische Spezialität vorrätig, denn er sollte vor dem Zubereiten mindestens einige Stunden geruht haben und winzige Galettes pflegte man in der ›Villa Floric‹ mit Räucherlachs und Dillsahne auch als Amuse-Gueule für die Gäste zu servieren. Sobald von dem heißen Schweineschmalz leichter Rauch aufstieg, goss Anna einen Schöpflöffel der dünnflüssigen Mischung aus Mehl und Milch in die Pfanne und sofort begann es knisternd zu brutzeln und köstlich zu duften. Lionel und sein Freund liebten eine deftige Variation und so legte Anna eine Scheibe Schinken auf den mit Butter bestrichenen Pfannkuchen, bestreute ihn mit geriebenem Käse, klappte ihn zusammen und ließ ihn noch eine Minute backen. Schon hielt Jakob ihr wieder seinen geleerten Teller entgegen und mit Freude sah sie zu, wie er sich ein dickes Stück des herzhaften Pfannkuchens, mit zartrosa Schinken und golden geschmolzenem Käse gefüllt, auf seine Gabel lud – und nicht einmal mehr nach Ketchup verlangte, wie am Beginn ihrer Bekanntschaft.
Die geräumige Profiküche, die förmlich nach Sauberkeit duftete, beherrscht von dem mächtigen Herd in der Mitte, in der die blanken Gerätschaften von der Decke hingen und aus Regalen blinkten, war dank ihrer drei großen Fenster ein heller, freundlicher Raum. Die gefliesten Wände und die Decke strahlten in reinstem Weiß, das nur durch eine Keramikreihe mit Blumenornamenten in Augenhöhe unterbrochen wurde, die den Blauton des ebenmäßigen Fliesenbodens aufnahm. In einer durch ein Regal voller Kochutensilien abgetrennten Nische stand ein mächtiger roher Holztisch mit zwei langen Bänken, an dem die Küchenmannschaft gemeinsam zu rasten, zu essen und zu reden pflegte. Auf dem Tisch leuchtete ein Strauß weißer Margeriten und blauer Glockenblumen. Für Anna waren die harmonische Gestaltung und die kleinen, persönlichen Akzente in ihrer Küche unverzichtbar. Kochen war für sie mehr als bloße Nahrungszubereitung. Es erforderte Fantasie, Kreativität, Improvisationstalent und das klappte am besten, wenn sie sich wohl fühlte, im Einklang mit sich und ihrer Umgebung stand. Schließlich verbrachte sie hier einen großen Teil ihrer Lebenszeit. Am Abend, wenn das Restaurant voll war, zählten natürlich nur die geschickte Aufteilung des Raumes und die praktische Anordnung der verschiedenen Arbeitsplätze– dann hatte niemand einen Blick für die Umgebung, alles und alle mussten dann nur reibungslos funktionieren.
»Wohin damit?«
Matthias, der Lehrling, stand mit dem üblichen unbewegten Gesicht in der Tür, zwei große Holzkisten vor sich hertragend.
»Was ist denn in den Kisten, Matte?«, fragte Anna ihn freundlich.
»Weiß nicht. Irgendwelche Meeresschweinereien. Schnecken. Keine Ahnung.«
»Ah, bien.«
Anna warf einen Blick in die Kisten und untersuchte neugierig ihren Inhalt.
»Das sind Wellhornschnecken und das sind Napfschnecken. Wunderbar! Bring sie hier in die Küche. Du kannst sie nachher gleich säubern und vorbereiten und erleben, wie ich meine delikaten Schneckenküchlein zubereite!«
Ohne Annas Begeisterung zu teilen, stellte der Junge die Kisten neben dem geräumigen Edelstahlbecken ab und verschwand wieder im Flur. Einen Moment später waren von dort ein Rumpeln und sogleich laute Stimmen zu hören. Ein Schwall arabischer Laute, aus deren Aufgeregtheit und Lautstärke Anna schloss, dass es sich um Schimpfworte handelte und dazwischen Matthias, der auch nicht gerade höflich darauf antwortete. Anna sah aus der Küchentür.
Matthias war in dem engen Flur mit dem schmalen, kleinen Hadi zusammengestoßen, der gerade drei Eimer Crème fraîche in die Kühlkammer tragen wollte. Nun lagen die Gefäße am Boden und aus dem einen Eimer, der beim Sturz beschädigt worden war, floss der fette, weiße Inhalt auf die Fliesen. Hadis dunkle Hose hatte auch mehrere Spritzer abbekommen. Mit großen Gesten zeigte der kleine Algerier immer wieder darauf und machte offensichtlich Matthias dafür verantwortlich.
»Lass doch endlich das Gejaule, ich versteh sowieso kein Wort! Selbst schuld, wenn du nicht aufpassen kannst, Terrorist!«
»Na, na, Matte! Wie redest du denn mit deinem Kollegen? Das ist doch alles gar nicht so schlimm. Ihr beide beseitigt jetzt die Spuren eures kleinen Zusammenstoßes und das wars«, versuchte Anna die Gemüter zu beruhigen, doch Matthias schnaubte aufgebracht:
»Der soll erst mal mit seinem Gesabbel aufhören!«
»Dein Kollege heißt Hadi, Matte! Und du gehst jetzt einen Eimer Wasser, Putzmittel und Lappen holen, los!«, unterbrach ihn Anna bestimmt und schob ihn energisch beiseite. Da Hadis Deutschkenntnisse über das im Arbeitsalltag Notwendige nicht hinausreichten, schon gar nicht in diesem Zustand von Erregung, wandte sie sich auf Französisch an den anderen Streithahn.
»Warum regst du dich so auf, Hadi? Es ist doch nichts weiter passiert! Ihr macht das jetzt sauber und die Sache ist erledigt.«
In dem typisch gefärbten Französisch der Nordafrikaner beschwerte sich Hadi aufgeregt, dass er oft und immer wieder Probleme in der Zusammenarbeit mit Matthias habe, der sich nichts von ihm sagen lassen wolle, wenn er Fehler mache und alles auf ihn schiebe, wenn etwas schief gehe. In seinen dunklen Augen waren Wut und Trauer, als er ruhiger hinzufügte:
»Wir sind nur Kollegen. Er muss nicht mein Freund sein. Aber er beleidigt mich. Er sagt, ich soll doch zurück in meine Heimat, wenn es mir hier nicht passt. Er nennt mich Terrorist. Er weiß gar nichts. Meine Familie ist von Terroristen getötet worden. Was in unserem Dorf noch nicht zerstört war, hat die Armee erst geplündert, dann zerstört.« Hadi brach ab und sah Anna an. Er wiederholte leise:
»Er weiß gar nichts.«
Und in diesem Satz lagen so viel Schmerz und Verzweiflung, dass Anna erst gar nicht wusste, was sie darauf sagen sollte.
»Du hast recht – er weiß nichts«, versuchte sie schließlich zu trösten, »er meint das bestimmt nicht so. Matte hat vor allem Probleme mit sich selbst. Er ist eben noch nicht so richtig erwachsen.«
Anna sah Hadis skeptischen Blick. Mit einem hilflos wirkenden Schulterzucken wandte er sich ab und kümmerte sich um die unversehrt gebliebenen Eimer mit der Crème fraîche. Er war höchstens vier Jahre älter als Matthias, doch die Erfahrungen in seiner Heimat, aus der er in Matthias’ Alter hatte fliehen müssen, hatten ihn unfreiwillig sehr früh erwachsen werden lassen. Auch wenn der deutsche Junge nicht in paradiesischen Verhältnissen groß geworden war, vaterlos, sehr bescheidene Wohnverhältnisse, viel allein, weil die Mutter jede Putzstelle annehmen musste, um ihre beiden Söhne zu ernähren – er wusste wirklich nicht, wie gut er es hatte, im Vergleich zu Hadis Biografie und der der Anderen. Eigentlich hatte sie angenommen, Menschen, die tagtäglich miteinander arbeiteten, würden sich auch über die Arbeit hinaus füreinander interessieren – Matthias offensichtlich nicht. Vielleicht lag es auch nur an Hadis geringen Deutschkenntnissen, dass es mit dem Kontakt haperte. Sie würde mit Matthias einmal ein ernsthaftes Gespräch führen müssen, doch jetzt war dazu weder Zeit noch Gelegenheit.
»Ist Matte ein Rassist?«, fragte Lionel, der mit Jakob die Vorgänge im Flur interessiert verfolgt hatte, seine Mutter. Die Backen voller Pfannkuchen, schauten die beiden Anna gespannt an. Vor den großen Ferien hatten sie in der Schule das Thema Ausländerfeindlichkeit behandelt, nachdem ein schwarzer Junge, der eine höhere Klasse ihrer Schule besuchte, auf dem Schulweg von ein paar halbwüchsigen Neonazis böse misshandelt worden war. Einer von vielen kleinen Vorfällen, die Anna Angst machten.
»Matte ist ein dummer Junge, der mit sich selbst unzufrieden ist – kein Rassist«, antwortete sie bestimmt, doch in ihrem Kopf war sie sich nicht so sicher. Obwohl er schon ein paar Monate als Lehrling bei ihnen war, kannte sie Mat-thias im Grunde gar nicht, hatte über das Berufliche hinaus mit ihm kaum ein paar Worte gewechselt. Er war ein verschlossener Junge und hatte wahrscheinlich Schwierigkeiten mit der nicht ganz überwundenen Pubertät. Er war ein bisschen dicklich und hatte noch ein richtiges Kindergesicht. Die Haare trug er sehr kurz, was ihn eher entstellte, als ihm schmeichelte. Trotz seiner 19 Jahre war er gerade mal im ersten Lehrjahr. Nach der Schule, die er mit mäßigen Leistungen verlassen hatte, gab es keinen Beruf, der ihn wirklich interessiert hätte, geschweige denn Lehrstellen und er fiel seiner Mutter, die in der ›Villa Floric‹ putzte, mehr und mehr zur Last und als diese Anna um Hilfe bat, konnte sie, wie so oft, nicht nein sagen und nun war er hier. Er stellte sich gar nicht so schlecht an in der Küche, hatte flinke Finger und war schnell und ordentlich, doch verrichtete er alle Aufgaben mit mürrischem Gesicht und sprach nur das Nötigste. Waren seine ruppige Ausdrucksweise und seine kurzen Haare schon Ausdruck einer politischen Haltung? Anna seufzte. Ein persönliches Gespräch mit ihm stand wohl wirklich dringend auf der Tagesordnung.
Als die beiden Jungen ihr Mahl beendet hatten, trieb ihr Pflichtbewusstsein Anna doch wieder an ihren Schreibtisch zurück. Wenn sie sich nicht gerade der ungeliebten Buchführung widmen musste, fühlte sie sich in ihrem Büro sehr wohl. Im ersten Stock der Villa gelegen, war es der kleinere Teil eines großen Raumes, dessen Hauptteil sie zum Zimmer für Lionel ausgebaut hatten. Jede freie Wand des kleinen Büros wurde mit Regalen genutzt, die bis zur Decke mit Akten, Büchern und Fundstücken jeder Art voll gestopft waren. Fotos, alte Speisekarten, ein kleines Stillleben in Öl fanden sich darin, ebenso wie Muschelschalen, eine ungeöffnete Champagnerflasche, eine kleine Quicheform, drei Probegläschen Konfitüre und eine Reihe mehr oder minder geschmackvoller Werbegeschenke irgendwelcher Feinkostlieferanten. Hauptsache, Anna hatte die Dinge erst einmal von ihrem Schreibtisch. Das riesige Eichenungetüm bot trotz seiner ungeheuren Ausmaße kaum ausreichend Platz für Computer, Telefon und all die Papierstapel, Bücher und Zettel, die sich hier türmten. An der Rückwand des Raumes drängte sich noch ein mit flaschengrünem Samt bezogenes Jugendstilkanapee, auf dem Besucher Platz nehmen durften und vor dem ein winziges Bistrotischchen stand.
Lionels abgetrenntes Reich verfügte über vier Fenster, die einen freien Rundblick über die Lübecker Bucht erlaubten. Aber außer dass er Schiffe beobachten konnte, interessierte einen Jungen in Lionels Alter das Panorama eher wenig. Annas Büro hatte nur zwei Fenster, von denen eines zum Hof zeigte und das andere sie zumindest auf ein Zipfelchen Ostsee blicken ließ. Beide Aussichten hatte sie von ihrem Schreibtischstuhl aus im Blick und die dunklen, regenschwangeren Wolkenberge, die sich gerade von West nach Ost über den Himmel schoben, waren nicht dazu angetan, ihre durch die Beschäftigung mit den schlechten Umsätzen gedrückte Stimmung zu heben. Höchstens 16 Grad im Juli, dazu Regen und Wind: Das waren keine guten Aussichten für die Hochsaison, die hier gerade zwei Monate – Juli und August – dauerte.
»Ihre Zahlen, Frau Floric! Ihre Zahlen!«, würde der Mann in der Bank, der angeblich ihr persönlicher Berater war, wieder beschwörend raunen und sein Gesicht in besorgte Falten legen. Anna streckte beide Arme nach oben und gähnte herzhaft.
»Fatiguée, chefesse? Darf ich reinkommen?«
Yann deutete am Türrahmen ein Klopfen an, eine für seine natürliche Zurückhaltung typische Geste, denn die Bürotür stand immer offen.
»Müdigkeit wirst du dir heute nicht leisten können, Anna. Du weißt, wir haben heute Abend volles Haus: zwei Geburtstagsgesellschaften. Und es sind jetzt auch schon jede Menge Einzelreservierungen eingegangen – dabei ist erst früher Nachmittag!«
Anna hatte ihren Bürostuhl zu ihm herumgedreht und sah sein zufriedenes Gesicht.
»Mais c’est merveilleux, Yann!Eine bessere Nachricht konntest du mir gerade jetzt gar nicht bringen!«
»Gibt es Probleme? Ich finde, es läuft richtig gut zurzeit.«
»Das dachte ich auch. Setz dich doch, Yann!«, sagte Anna und deutete auf das grüne Kanapee.
»Ich hatte nicht vor, dich mit diesem neuen Finanzloch zu belästigen«, begann sie, doch Yann unterbrach sie sofort:
»Anna, du weißt, ich kann mir jederzeit das Geld aus meiner Lebensversicherung auszahlen lassen.«
Jetzt ließ Anna ihren Partner nicht ausreden.
»Und du weißt, dass ich das nicht will! Wahrscheinlich hast du noch nie richtig darüber nachgedacht, aber du wirst das Geld im Alter bestimmt gut brauchen können. So üppig wird deine Rente nicht sein und dann wird man mal krank, hat den einen oder anderen Wunsch und dann ist man froh, noch so ein kleines finanzielles Polster in der Hinterhand zu haben.«
Yann schüttelte seinen Kopf und lächelte.
»Du redest, als ob du meine Mutter wärst! Wir haben gerade vor kurzem dieses Restaurant eröffnet, unser Leben fängt doch langsam erst an!«
Yann war ein Mensch von schlichter Bodenständigkeit und normalerweise kein Freund vieler Worte, doch seit sie an der ›Villa Floric‹ und ihrer gemeinsamen Zukunft arbeiteten, war seine ruhige, fast schüchterne Zurückhaltung einer maßvollen Begeisterung gewichen. Wie er da so auf dem Kanapee saß – ein großer Mann in Jeans und Troyer, kurzes, dunkles Haar über dem sonnengebräunten Gesicht mit den wachen, blauen Augen, die forschend seine Umgebung erfassten –, strahlte er einen unerschütterlichen Optimismus aus, von dem Anna sich nur zu gerne anstecken ließ.
»Aber zurück zum Thema«, sagte Yann. »Ich will dir nur erklären, dass ich lieber jetzt das Geld nutzbringend investiere, als es liegen zu lassen, bis ich womöglich selbst gar nicht mehr bestimmen kann, was ich damit anfangen will. Und was den einen oder anderen Wunsch betrifft – das Meer, der Wein, eine charmante Partnerin – was will ich mehr?«
Er lächelte und heftete seinen klaren Blick fest auf Anna, deren Wangen sich sanft röteten, was ihr ziemlich peinlich war. Was war nur mit ihr los? Sie kannte Yann, seit sie 12 war, seitdem gehörte er einfach zu ihrem Leben und plötzlich gab es da so irritierende Momente. Dabei hatte sie geschworen, sich nicht noch einmal mit der sogenannten großen Liebe zu belasten, denn man konnte nie sicher sein, ob dieses Glück nicht abrupt beendet werden würde. Und dann war man einsamer als je zuvor. Das wusste sie sehr genau. Als Yann zu ihrem eigentlichen Gesprächsgegenstand zurückkehrte, war sie richtig erleichtert.
»Ich bin überzeugt, wir stehen auch diesen finanziellen Engpass durch, wir zwei alten Bretonen – glaubst du nicht? Wir haben schon so viel geschafft, da haut uns doch dieses kleine Finanzloch nicht um! Wir stehen am Beginn der Hauptsaison und ich bin sicher, das wird eine gute Saison! Ich rieche das: Es wird eine Supersaison!«
Froh und dankbar für Yanns aufmunternde Worte, beschloss Anna sogleich, zum Anfang kommender Woche einen Termin in der Bank zu vereinbaren – die Hoffnung auf eine gute Saison würde bestimmt zur Stärkung ihrer Selbstsicherheit in den Verhandlungen beitragen.
»Und sollte es wider Erwarten ganz schlecht laufen, haben wir für alle Fälle ja immer noch meine Lebensversicherung in der Hinterhand«, fügte Yann mit einem verschmitzten Grinsen hinzu und ließ Anna keine Gelegenheit zur Widerrede.
Zumindest für diesen Abend behielt Yann mit seiner Ankündigung einer Supersaison recht. Bereits um 19 Uhr war die ›Villa Floric‹ bis auf den letzten Platz besetzt und Yann, der am Abend für Rezeption und Bar zuständig war, musste viele enttäuschte Besucher abweisen. Zu Beginn ihrer Zeit in Schleswig-Holstein hatte dieses frühe Eintreffen der Gäste Anna und ihren Partner, die an französische Gepflogenheiten gewöhnt waren, noch etwas irritiert. Doch sie hatten sich schnell darauf eingestellt. Wie so oft hatte sich jetzt zum Abend die Sonne durch die dunklen Wolkenwände gekämpft und tauchte die Landschaft vor den großen Fenstern des ehemaligen Wintergartens in ein unwirkliches, golden getöntes Licht. Hier im Norden ließ die Dämmerung sich im Sommer besonders viel Zeit. Wenn es schon nicht möglich war, im Freien auf der Terrasse zu servieren, so konnte man hier wenigstens hinter Glas den grandiosen Ausblick genießen und zwischen Orangen- und Lorbeerbäumchen speisen, die in Terrakottakübel gepflanzt den Raum zierten.
Immer noch erfüllte der Anblick der liebevoll hergerichteten Räumlichkeiten Anna mit Freude und Stolz. Sie würde nie all die Mühe, den Ärger und die Sorgen vergessen, die der Umbau bereitet hatte, doch sie würde das alles jederzeit noch einmal auf sich nehmen. Der Besucher betrat die ›Villa Floric‹ durch einen hallenartigen Raum, in dem die Rezeption und die Bar mit einer kleinen Lounge untergebracht waren. Hier herrschten Schwarz und Weiß und viel Spiegelglas vor und erinnerten zusammen mit organisch anmutenden Formen diskret an die Jugendstilvergangenheit des Hauses. Im Hintergrund führte eine Treppe in das obere Stockwerk, wo sich die Privaträume und auch Annas Büro befanden. Linker Hand lag das lichte, geräumige Restaurant mit dem ehemaligen Wintergarten und rechts, hinter der Lounge, gelangte man in die sogenannte Bibliothek. Um einige wenige Tische waren antike Sitzmöbel verschiedener Epochen gruppiert und wo sie an einer freien Wand standen, gab es auch Kanapees. Gefüllte Bücherregale und ein üppig verzierter Kamin rundeten den Eindruck gediegener Gemütlichkeit ab.
Leise Gespräche, sanftes Gläserklirren und der dezente Ton, wenn wohlerzogene Hände mit Besteck den feinen Speisen auf den Tellern zu Leibe rückten, erfüllten den Raum. Mit unnachahmlicher Grazie bewegte sich Djaffar zwischen den weiß gedeckten Tischen, lauschte freundlich und geduldig den Wünschen der Gäste und dirigierte unauffällig seine drei Kolleginnen und Kollegen dorthin, wo Bedarf war. In seinem dunklen Anzug und dem blendend weißen Hemd, das seinen olivfarbenen Teint noch dunkler erscheinen ließ, war der algerische Chefkellner eine wirklich beeindruckende Erscheinung, der mit seinem natürlichen Charme jeden auch noch so anspruchsvollen Gast zufriedenzustellen wusste.
Immer wieder geriet Anna ins Staunen, wenn sie daran dachte, was für einen Djaffar sie drei Jahre zuvor kennengelernt hatte: einen schüchternen, verunsicherten, ziemlich abgemagerten Mann, dessen beherrschendes Lebensthema die Angst war. Die Angst vor den schrecklichen Bildern seiner Vergangenheit, die Angst vor dem fremden, kalten Land und schließlich die Angst vor der Abschiebung in seine Heimat, die er zwar einerseits schmerzlich vermisste, aber andererseits fürchtete wegen der Metzeleien, die dort an der Tagesordnung waren, sei es durch islamische Fanatiker, die Armee oder Terroristen jedweder Gesinnung. Wer sich nicht zu den einen oder anderen bekennen wollte, war in Gefahr. Die Bedrohung war unberechenbar, man musste um Leib und Leben fürchten. Deshalb war er nach Deutschland gekommen, wo er, wie alle Flüchtlinge, in den ersten Monaten nur kaserniert und kontrolliert leben durfte. Dank des für alle Asylbewerber geltenden Arbeitsverbots zu Beginn seines Aufenthalts war er zur Untätigkeit gezwungen, wurde verfolgt von den Schreckensbildern in seinem Kopf und spürte dann noch die Ablehnung, ja den Hass, der ihm von vielen Menschen in seinem Gastgeberland entgegenschlug. Sie hielten ihn für einen Schmarotzer, der sich auf ihre Kosten einen lauen Lenz machte oder verachteten ihn einfach nur, weil er Ausländer war. Dabei war Djaffar den Deutschen dankbar, dass sie ihn aufgenommen hatten und wollte für sie arbeiten, egal was, auch für wenig Geld. Doch die deutschen Gesetze dulden keine Ausnahmen.
Aber dann hatte Djaffar Glück. Der Verein Asylhilfe e.V. nahm sich seiner an, unterstützte ihn beratend bei seinem Bemühen um Anerkennung als politischer Flüchtling, ließ ihn an einer Therapie gegen seine Depressionen teilnehmen und vermittelte ihm die Teilnahme an einem Deutschkurs. Durch ihren guten Draht zum Arbeitsamt erreichten die Leute vom Verein fast immer großzügige Ausnahmeregelungen vom geltenden Arbeitsverbot. So besorgten sie ihm hin und wieder den einen oder anderen Job und Djaffar, der eigentlich Lehrer war, nahm jede Arbeit begeistert an. Schließlich landete er auf der Baustelle des ›Floric‹ und lernte Anna kennen. Und seither gehörte er zum Team. Er hatte großes Glück gehabt, denn nach so kurzer Zeit ein Anrecht auf Asyl zu erhalten, war den wenigsten vergönnt.
Verstohlen beobachtete Anna, wie Djaffar einen Tisch mit sechs älteren Damen, die ihn und die Lokalität skeptisch musterten, bei der Auswahl von Speisen und Getränken beriet und wie er mit seiner Mischung aus vornehmer Zurückhaltung und natürlicher Freundlichkeit auch hier das Eis zum Schmelzen brachte.
»Das ist genau wie bei meinen Schulkindern früher. Du musst ihnen zeigen, dass sie dir wichtig sind, dass du nur für sie da bist – dann lieben sie dich«, war Djaffars Erklärung für seinen Erfolg bei den Gästen, als sie ihn einmal deswegen fragte.
Anna wandte sich wieder ihrer Küchenmannschaft zu und machte sich daran, die Beurre Blanc für den pochierten Seebarsch vorzubereiten. Matthias hatte die Schalotten bereits sehr fein gehackt und auch wenn es noch lange dauern würde, bis er die Kunst der gehobenen Küche beherrschen würde, ließ Anna es sich nicht nehmen, ihren Lehrling in die Geheimnisse der Zubereitung dieser klassischen Fischsauce einzuweihen.
»Das Geheimnis dieser Sauce, weißt du, worin das liegt?«
Aus Matthias’ reglosem Gesichtsausdruck ließ sich weder Interesse noch das Gegenteil ablesen, doch Anna ließ sich davon nicht beirren.
»Die richtige Temperatur, mon ami, das ist das A und O! Ist sie zu hoch, wird die Mischung flüssig, fettig, ölig – ist sie zu gering, verbinden sich die einzelnen Komponenten nicht. Die Temperatur muss stimmen – das ist die Kunst!«
Sie erhitzte die Schalotten mit Essig und Weißwein und kochte sie so lange, bis nur eine ganz geringe Menge an Flüssigkeit zurückblieb. Nun gab sie etwas Fischsud dazu und zog dann nussgroße Stückchen eiskalter Butter darunter, heftig mit einem Schneebesen schlagend, bis eine dicke, elfenbeinfarbene Creme entstanden war.
»Voilà, fertig! Her mit den Saucieren!«
Schnell reichte Matthias ihr das angewärmte Geschirr, sie füllte die Portionen ein, während Jack und Kirsten die Tranchen vom Seebarsch, die sie in einer Court-Bouillon pochiert hatten, auf den bereitgestellten Tellern mit Blättchen glatter Petersilie und hauchdünnen Zitronenscheiben arrangierten. Das Zusammenspiel klappte reibungslos – sie waren eben ein gutes Team.
Eine bunt zusammengewürfelte, junge Truppe hatte Anna um sich geschart. Aus Polen, Schottland, Algerien und Frankreich stammten die Mitglieder der Küchenmannschaft in der ›Villa Floric‹, nicht zu vergessen Johannes, der österreichische Vorspeisenspezialist und natürlich Matthias, Kirsten und Kai aus Schleswig-Holstein. Niemand war älter als 30 und alle waren höchst engagiert. Jeder ging seiner Arbeit mit Freude nach, weshalb sie auch gut besuchte Abende wie diesen relativ harmonisch und stressfrei überstanden. Selbst Matthias fügte sich in dieses perfekt funktionierende Räderwerk ein und Anna hegte die Hoffnung, dass diese Erfahrung sich auch positiv auf seine Persönlichkeitsentwicklung auswirken würde. Auch wenn der Junge es nie zugegeben hätte, es war nicht zu übersehen, dass er Jack mit einem gewissen Respekt begegnete.
Jack, Annas Souschef und mit 30 genauso alt wie sie, war manche Umwege gegangen, bevor er diesen Beruf ergriffen hatte. Er kam aus Schottland und in seiner Jugend war die Punkszene sein Zuhause. Später schlug er sich mit Jobs durch, vom Hafenarbeiter bis zum Ringer auf Rummelplätzen, und schließlich fuhr er zur See, wo er in der Schiffsküche landete, und damit die ersten Schritte in Richtung seines jetzigen Berufs machte. Er erkämpfte sich einen Ausbildungsplatz in einem Spitzenrestaurant an der Cote d’Azur, arbeitete in den Küchen diverser nobler Hotels. Einzig zwei Tätowierungen, die seine Oberarme zierten und von den Maori in Neuseeland stammten, zeugten noch von seiner Vergangenheit. Seit ein paar Monaten hatte er eine kleine Tochter und klagte mit ironischem Bedauern, dass er jetzt wohl gänzlich auf dem Weg zum Spießer sei.
»Hey, wo bleibt eigentlich unser Zuckerbäcker?«, rief Jack. Dieselbe Frage hatte sich Anna auch schon gestellt und nervös zur Uhr geschaut. Fouhad, der seit einiger Zeit als Pâtissier fungierte und die köstlichsten Nachspeisen schuf, war stets zuverlässig und kam sonst nie zu spät zur Arbeit. Allerdings hatte er wohl seit Kurzem eine Freundin in Travemünde, wie ihr die anderen aus der Remise erzählt hatten und fuhr, so oft er konnte, mit dem Roller zu ihr hin, was eine Verspätung erklären könnte. Doch das war nicht der Moment, über Fouhads Verbleib zu rätseln. Jemand anders musste seine Aufgaben übernehmen.
»Margoszata, kümmerst du dich bitte um die Desserts, bis Fouhad hier auftaucht?«
»Mach ich! Sogar gerne«, rief die junge Polin fröhlich, die dem Team seit Anbeginn als Köchin angehörte und die mit ihrem Talent, ihrer Energie und ihrem Ehrgeiz sicherlich eines Tages ihr eigenes Restaurant haben würde.
Als Anna gegen 11 endlich dazu kam, ihren Gästen persönlich einen guten Abend zu wünschen und Komplimente und Anregungen entgegenzunehmen, war das Restaurant immer noch gut besetzt. Die Begegnung mit den Gästen war ihr keine lästige Pflicht, sondern wichtiger Bestandteil ihrer Arbeit. Zum einen sah sie sich nicht nur als Köchin, sondern auch als Gastgeberin und zum anderen konnte sie erst in diesem Dialog feststellen, ob ihre Arbeit gewürdigt wurde und was vielleicht doch noch verbessert oder verändert werden konnte. Neuen Impulsen gegenüber war Anna immer aufgeschlossen.
Dr. Burmester war der letzte Gast, an dessen Tisch sie an diesem Abend verweilte. Er war ein wohl situierter Rechtsanwalt und angesichts seines Alters von fast 70 Jahren, was man ihm überhaupt nicht ansah, nur noch in Ausnahmefällen in seinem Beruf tätig. Er war stets elegant gekleidet, mit einer flotten, sportlichen Note und in seinem Gesicht stand meist ein nachsichtiges Lächeln. Er war nicht so häufig in der ›Villa Floric‹, wenn er kam, war es meist an einem Freitagabend und in Begleitung einiger Herren seines Alters. Aber er legte Wert darauf, jedes Mal von den Chefs wahrgenommen und wie ein vertrauter Stammgast behandelt zu werden. Dann neigte er dazu, Anna Ratschläge geben zu wollen – nicht, was ihre Kochkunst betraf, bewahre. Er war mit den Speisen immer hochzufrieden und insgeheim fragte sich Anna, ob er deren exquisiten Standard überhaupt beurteilen konnte, denn sie hatte den Eindruck, dass sein Geschmack sich auf einem eher schlichten Niveau bewegte.
Seine Hinweise bezogen sich vielmehr auf allgemeine Lebensbereiche, in denen er sich ihr überlegen fühlte.
Als sie so neben ihm stand, nett anzusehen mit den widerspenstigen, blonden Locken, in der blütenweißen Kochjacke mit dem eingestickten Schriftzug ›Anna Floric – Cuisinière‹, nahm er wieder einmal ihre Hand und tätschelte sie – vorgeblich väterlich. Zum einen schien er es als ein Vorrecht seines Alters zu betrachten, junge Frauen anfassen zu dürfen, wenn ihm danach war, zum anderen stellte er sich gern als Freund der Familie dar, da er noch ihre früh verstorbenen Großeltern mütterlicherseits gekannt hatte.
»Aber nur flüchtig!«, wie ihre Tante Edith betonte, als Anna sie danach gefragt hatte.
»Und sie mochten ihn gar nicht besonders, wenn ich mich recht entsinne.«
Dr. Burmester hielt Annas Hand immer noch in seiner Rechten und sprach dabei mit seinen Tischgenossen, als ob sie gar nicht anwesend oder aber ein unverständiges, kleines Kind wäre.
»Wir können sie ja einfach danach fragen – bestimmt wird Mademoiselle Anna ihre Gründe haben.«
Die anderen alten Herren lächelten satt und nickten zustimmend und starrten Anna dabei fast die Kleider vom Leib, während Burmester sich leutselig an sie wandte:
»Meine Freunde und ich haben über das Arbeitslosenproblem gesprochen, das keine unserer Regierungen in den letzten Jahren in den Griff bekommen hat. Und nun würde uns einmal interessieren, warum Sie so viel ausländisches Personal beschäftigen, Anna. Sie erlauben die Frage: Gibt es hier an der Küste nicht eine Menge deutsche Arbeitslose?«
Hinter der zur Schau gestellten jovialen Behäbigkeit verspürte Anna durchaus etwas Lauerndes in den Blicken der Herrenrunde. Natürlich hätte sie vieles auf diese Frage referieren können über Kosten und Lohnforderungen, über Arbeitsunwillige, die das Arbeitsamt geschickt hatte, über die Chemie, die stimmen musste zwischen den Mitarbeitern, über die Pflicht, Menschen in Not zu helfen und vieles mehr. Sie schaffte es endlich, Dr. Burmester ihre Hand zu entwinden und sagte nur freundlich:
»Es ist schwierig, die richtigen Leute zu finden, aber ich denke, ich habe mittlerweile ein ganz gutes Team zusammen. Sie sind doch zufrieden, Messieurs?«
Heftiges, zustimmendes Nicken sämtlicher Herren. Anna war nicht in die Falle gegangen. Sie winkte Djaffar heran und fragte in die Runde:
»Darf ich Sie noch zu einem Digestif einladen?«
Natürlich rief auch diese Frage einvernehmliches Nicken hervor und als Djaffar das Tablett mit den Gläsern voll braungoldenem Goutte servierte, einem bretonischen Cidrebrand, hob Anna ihr Glas mit einem Santé, nahm einen kleinen Schluck und verabschiedete sich dann schnell.
Kurz darauf stand sie am Rand der Terrasse, schaute auf die unter einem sternenlosen Himmel schwarz daliegende Ostsee und atmete tief die frische, kühle Nachtluft. Nur ganz vereinzelt bewegten sich ein paar Lichter auf dem Meer, dort eine Fähre, vielleicht auf dem Weg nach Skandinavien, hier ein paar kleine Fischerboote und in der Ferne zu ihrer Linken blinkte ruhig und gleichmäßig der Leuchtturm von Pelzerhaken. Anna seufzte. Immerhin, es war ein erfolgreicher Abend gewesen, aber sie würden noch viele derartige Abende brauchen, um ihre finanzielle Krise zu überwinden. Manchmal verließ sie die Zuversicht und das Gefühl der Verlassenheit wurde so stark, dass sich ihr Magen schmerzhaft zusammenzog. Gestern in Lübeck, in der belebten Fußgängerzone vor dem Rathaus, hatte sie einen Moment lang geglaubt, in der Menge eine wohlbekannte Gestalt entdeckt zu haben, die aber gleich darauf wieder verschwunden war. Sie sah wohl schon Gespenster.
»Ach, Said! Ich fühl mich so allein. Warum bist du nicht da?«, flüsterte sie in die Dunkelheit. Sie hörte ein Geräusch und drehte sich schnell um.
»Nicht erschrecken, ich bins.«
Yann trat neben sie und Anna hoffte im Stillen, er mochte ihr leises Flehen nicht gehört haben. Er rieb sich freudig die Hände.
»Formidable, n’est-ce pas?Siehst du, ich habe immer recht, cheffesse! Ab jetzt gehts aufwärts! Ein fantastischer Umsatz heute!«
»Ach, Yann! Was würde ich bloß ohne deinen unerschütterlichen Optimismus machen?«
»Schön, zu wissen, dass ich hier doch irgendwie gebraucht werde!«, sagte Yann gut gelaunt, aber mit unüberhörbarer Selbstironie und legte seinen Arm um ihre Schultern.
»Jetzt tu nicht so, als ob du nicht wüsstest, wie wichtig du hier bist!«, protestierte Anna und knuffte ihn sanft in die Seite. Und wie schon öfter in den letzten Wochen spürte sie bei diesem freundschaftlichen Geplänkel eine gewisse Befangenheit. Seine Nähe machte sie auf eine ganz eigene Art nervös und sie fühlte sich so unsicher wie ein Teenager beim ersten Rendezvous. Täuschte sie sich oder hatte sich auch sein Verhalten ihr gegenüber geändert? Am besten, sie dachte gar nicht darüber nach. Ihre Wunden waren noch lange nicht verheilt und sie wollte sich neben all den anderen Sorgen nicht auch noch mit ihrem Gefühlschaos auseinandersetzen müssen. Ihr Leben war in Ordnung, wie es war. Es gab keine Notwendigkeit, etwas zu verändern. Um diese Gedanken zu verscheuchen, schnitt Anna ein Thema an, das sie schon den ganzen Abend beschäftigt hatte:
»Yann, ich fange langsam an mir Sorgen zu machen. Wegen Fouhad«, sagte sie in ernstem Tonfall. »Er ist bis jetzt nicht aufgetaucht und dabei ist er doch so ein zuverlässiger Kerl.«
Yann zog seinen Arm zurück und sah sie an.
»Aber Anna, das kann mal passieren.C’est l’amour, tout simplement!Unseren lieben Fouhad hats erwischt. Trotzdem werde ich morgen ein ernstes Wörtchen mit ihm reden müssen.«
»Ich weiß nicht. Es passt so gar nicht zu ihm: Du weißt, wie wichtig ihm sein Posten in der Küche ist. Mich beunruhigt das irgendwie.«
»Also, wenn Fouhad morgen wirklich nicht wieder auftaucht, sollten wir etwas unternehmen. Aber ich bin mir sicher, er ist morgen wieder da!«
»Vielleicht hast du ja recht.« Anna reckte beide Arme und gähnte. »Puh! Heute war wirklich ein anstrengender Tag. Ich bin ganz schön geschafft und geh schlafen.«
»Ja, ruh dich aus, Anna. Du wirst deine Kräfte brauchen, denn das war heute nur der Anfang der goldenen Ära in der ›Villa Floric‹! Ich spüre das: Der Sommer kommt und er wird großartig, du wirst sehen!«
»Ich werde von jetzt an auch ganz fest daran glauben! Vielleicht hilft das ja. Gute Nacht, Yann!«
2
›La donna è mobile, qual piuma al vento.‹Die Arie näherte sich ihrem Höhepunkt, noch einmal schwoll die Musik an. Der Mann, der voller Inbrunst mit dem Gemüsemesser auf die knackigen, roten Paprikaschoten hackte, stand dem die Unzuverlässigkeit des weiblichen Wesens beklagenden Tenor aus den Lautsprechern in nichts nach. Aus voller Kehle schmetterte er: ›E di pensier!‹ Das Messer verharrte dramatisch in der Luft und kehrte erst mit dem Schlussakkord wieder zu dem roten Gemüse auf dem Holzbrett zurück.
Auf dem Herd begann das Olivenöl in der großen Eisenpfanne zu brodeln und mit einem eleganten Schwung ließ Georg Angermüller die Paprikastreifen hineingleiten. Seine Stimmung hätte besser nicht sein können: Es war Sonnabendnachmittag, die Zwillinge, Julia und Judith, verbrachten das Wochenende mit ihrem Hockeyclub bei einem Turnier in Kiel, Astrid war zum Segeln und er durfte in aller Ruhe in der Küche werkeln. Sie hatten für den Abend ein paar Freunde eingeladen und aus dem geplanten kleinen Essen hatte sich während seiner Überlegungen dazu in Nullkommanix ein üppiger Reigen mediterraner Köstlichkeiten entwickelt.
Ein kurzes Prüfen mit der Gabel – das Gemüse hatte jetzt genau die richtige Konsistenz. Georg Angermüller beförderte die Paprika mit dem Schaumlöffel auf bereitgelegtes Küchenkrepp, wo auch die schon gegarten Auberginen- und Bleichselleriescheiben lagerten und gab nun die Zwiebelringe in das heiße Öl, auf dass sie sich golden färbten. Es folgten die geschälten, entkernten, zerkleinerten Tomaten, die Kapern sowie das gehackte Basilikum und sogleich erfüllte ein süßlich würziger Duft den Raum. Jetzt noch die eingeweichten Sultaninen dazu, die in Scheiben geschnittenen grünen Oliven, salzen und pfeffern, mit Balsamico und Zucker abschmecken und eine kleine Weile köcheln lassen.
Lange schon hatte Angermüller nicht mehr seiner Kochleidenschaft so ausgiebig frönen können. Ein überquellender Schreibtisch und unvorhergesehene Dienste, auch am Wochenende, hatten seine Freizeit immer knapper werden lassen und außer zu solchen Verpflichtungen wie Besuchen bei seinen Schwiegereltern oder Veranstaltungen in der Waldorfschule der Mädchen hatte es nicht gereicht. Und dabei musste er sich sowohl von seiner Schwiegermutter wie von der Lehrerin seiner Töchter anhören, wie kostbar und selten doch seine Besuche seien.