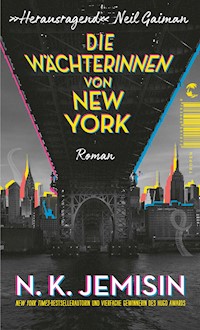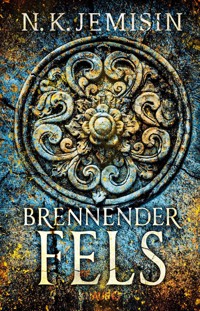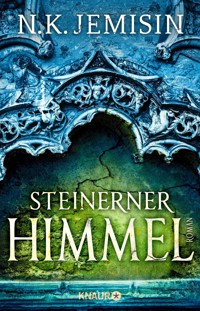
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die große Stille
- Sprache: Deutsch
Preisgekrönt, hochgelobt und atemraubend spannend: der Abschluss der »Broken Earth«-Trilogie, einer Fantasy-Saga über eine sterbende Welt und den Kampf einer Mutter um ihre Tochter Das Licht des Mondes verschwand vom Kontinent »Die Stille«, nachdem ein flammender Spalt das Land geteilt und den Himmel mit Asche verdunkelt hatte. Nun sagen alle Vorzeichen, dass der Mond bald wieder sichtbar sein wird – doch ob dies die Rettung der Menschheit bedeutet oder ihren Untergang, sagen die Zeichen nicht. Das Schicksal der »Stille« wird von den Entscheidungen zweier Frauen abhängen: Essun, die die Macht ihres Mentors Alabaster Tenring geerbt hat und die Obelisken beherrscht, mit deren Hilfe sie nun endlich ihre Tochter Nassun finden will; und Nassun, die all das Böse in der Welt gesehen und akzeptiert hat, was ihre Mutter Essun nicht zugeben will: Manchmal kann das Böse nicht gereinigt, sondern nur zerstört werden. Die amerikanische Bestsellerautorin N. K. Jemisin ist für alle drei Teile ihrer High-Fantasy-Trilogie »Broken Earth« mit dem »Hugo Award« ausgezeichnet worden – ein absolutes Novum in der Geschichte des renommierten Fantasy-Preises. Auch in Deutschland wurde die Trilogie begeistert aufgenommen: »N. K. Jemisin [...] hat mit ihrer ›Broken Earth‹-Trilogie die High Fantasy quasi neu erfunden.« Die Welt »Mitreißend und klug verbindet Jemisin Fantasy mit Science-Fiction und Themen wie Rassismus und Umweltzerstörung.« emotion Die preisgekrönte High-Fantasy-Saga ist in folgender Reihenfolge erschienen: - »Zerrissene Erde« - »Brennender Fels« - »Steinerner Himmel«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 612
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
N. K. Jemisin
Steinerner Himmel
Roman
Aus dem Englischen von Susanne Gerold
Knaur e-books
Über dieses Buch
Manchmal kann das Böse nicht gereinigt, sondern nur zerstört werden.
Das Licht des Mondes verschwand vom Kontinent »Die Stille«, nachdem ein flammender Spalt das Land geteilt und den Himmel mit Asche verdunkelt hatte. Nun sagen alle Vorzeichen, dass der Mond bald wieder sichtbar sein wird – doch ob dies die Rettung der Menschheit bedeutet oder ihren Untergang, sagen die Zeichen nicht.
Zwei Frauen haben das Schicksal in der Hand: Essun, die auf der Suche nach ihrer Tochter Nassun ist – und Nassun, die die Ausmaße des Bösen nun begreift.
Inhaltsübersicht
Für jene, die überlebt haben: Atmet. Das ist es. Noch einmal. Gut. Ihr seid gut. Selbst wenn ihr es nicht seid, seid ihr am Leben. Das ist ein Sieg.
Prolog
ich, als ich ich war
Die Zeit wird knapp, meine Liebe. Enden wir mit dem Anfang der Welt, ja? Gut.
Es ist seltsam. Meine Erinnerungen sind wie in Bernstein eingeschlossene Insekten. Diese erstarrten, seit Langem verlorenen Lebewesen sind selten heil. Normalerweise gibt es da nur ein Bein, irgendeine Flügelschuppe, ein Stück vom Brustkorb – und das Ganze lässt sich nur aus Bruchstücken erschließen, und durch schartige, schmutzige Risse erkennen. Wenn ich meinen Blick verenge und in die Erinnerungen schaue, sehe ich Gesichter und Ereignisse, die für mich Bedeutung haben sollten, und das haben sie auch, nur … sie haben es nicht. Die Person, die all diese Dinge hautnah miterlebt hat, bin ich, und doch wieder nicht ich.
In diesen Erinnerungen war ich jemand anderes, so wie die Stille eine andere Welt war. Damals, und jetzt. Du, und du.
Damals. Dieses Land bestand einst aus drei Ländern – die sich im Grunde an der gleichen Stelle wie das befinden, was eines Tages als Stille bezeichnet werden wird. Wiederholte Fünftzeiten werden letztlich zu mehr Eis an den Polen führen, woraufhin das Meer sinken wird und eure »Arktischen« und »Antarktischen« größer und kälter werden. Damals allerdings –
– jetzt, während ich mich an damals erinnere, fühlt es sich an wie jetzt, das meine ich, wenn ich sage, dass es seltsam ist –
Jetzt, in dieser Zeit vor der Stille, gibt es im hohen Norden und tiefen Süden annehmbaren Ackerboden. Was du als Westküste vor dir siehst, besteht hauptsächlich aus Sumpf- und Regenwald; beides wird im nächsten Jahrtausend verschwinden. Einige Regionen der Nordmittbreiten existieren noch nicht, sie werden erst durch jahrtausendelange, von eruptiven Impulsen angeregte vulkanische Ergüsse erschaffen. Das Gebiet, das einmal zu Palela werden wird – deiner Heimatstadt? –, existiert noch nicht. Alles in allem keine allzu großen Veränderungen, andererseits ist dieses Jetzt nicht lange her, tektonisch betrachtet. Vergiss nicht, wenn wir sagen, dass »die Welt untergegangen ist«, ist das normalerweise eine Lüge. Dem Planeten geht es gut.
Wie bezeichnen wir diese verlorene Welt, dieses Jetzt, wenn nicht als Stille?
Lass mich dir zunächst von einer Stadt erzählen.
Es ist eine Stadt, die nach euren Maßstäben falsch erbaut wurde. Keine moderne Gem hätte sich auf diese Art und Weise ausbreiten dürfen, denn sie benötigt zu viele Mauern. Die äußersten Bereiche dieser Stadt haben sich entlang von Flüssen und anderen Lebensadern verzweigt, um zusätzliche Städte hervorzubringen, so ähnlich wie Schimmel, der sich entlang der üppigen Adern des Nährbodens verzweigt und hinzieht. Zu eng beieinander, könnte man meinen. Zu viel sich überlappendes Territorium; sie sind zu sehr verbunden, diese sich ausbreitenden Städte und ihre sich schlängelnde Brut, jeder Teil unfähig zu überleben, sollte er vom Rest abgeschnitten werden.
Manchmal haben diese Kind-Städte aussagekräftige regionale Spitznamen, besonders dann, wenn sie groß oder alt genug sind, um ihrerseits eigene Kind-Städte hervorzubringen. Aber das ist trivial. Deine Wahrnehmung ihrer Verbundenheit ist korrekt: Sie haben die gleiche Infrastruktur, die gleiche Kultur, die gleichen Begierden und Ängste. Jede Stadt ist wie die andere. Alle Städte sind gewissermaßen eine Stadt. Diese Welt, in diesem Jetzt, heißt genau wie diese Stadt: Syl Anagist.
Kannst du wirklich verstehen, wozu eine Nation fähig ist, Kind der Stille? Das gesamte Alt-Sansia, nachdem es sich aus den Bruchstücken der hundert »Zivilisationen« zusammengesetzt hat, die in der Zeit zwischen Jetzt und Damals leben und sterben, wird im Vergleich dazu nichts sein. Lediglich eine Ansammlung paranoider Stadtstaaten und Gemeinschaften, die übereingekommen sind, um des Überlebens willen miteinander zu teilen. Oh, die Fünftzeiten werden die Welt auf wirklich erbärmliche Träume reduzieren.
Hier, jetzt, sind Träume grenzenlos. Die Bewohner von Syl Anagist haben die Kräfte der Materie und ihrer Zusammensetzung gemeistert; sie haben das Leben so gestaltet, dass es zu ihren Launen passt; sie haben die Geheimnisse des Himmels so gründlich erforscht, dass ihnen dabei langweilig geworden ist und sie ihre Aufmerksamkeit auf den Boden unter ihren Füßen gerichtet haben. Und Syl Anagist lebt, oh, und wie es lebt, in geschäftigen Straßen und unaufhörlichem Handel und Gebäuden, die dein Geist nur mühsam als solche bezeichnen könnte. Die Gebäude haben Wände aus strukturierter Zellulose, was unter den Blättern, dem Moos, den Gräsern und den Trauben aus Früchten oder Knollengewächsen kaum zu sehen ist. Auf einigen Dächern wehen Fahnen, die genau genommen gewaltige, entfaltete Pilzblüten sind. In den Straßen wimmelt es von Dingen, die du nicht als Fahrzeuge erkennen würdest, abgesehen davon, dass sie sich fortbewegen und etwas befördern. Einige kriechen auf Beinen, wie riesige Gliederfüßler. Andere sind wenig mehr als offene Plattformen, die auf einem Kissen aus Resonanzpotenzial dahingleiten – oh, aber das würdest du nicht verstehen. Lass mich nur sagen, dass diese Fahrzeuge ein paar Zoll über dem Boden schweben. Sie werden nicht von Tieren gezogen. Nicht von Dampf oder Chemikalien angetrieben. Sollte etwas, vielleicht ein Haustier oder ein Kind, unter ihnen hindurchgehen, wird es vorübergehend aufhören zu existieren und auf der anderen Seite weitergehen, ohne Störung der Geschwindigkeit oder der Wahrnehmung. Niemand betrachtet dies als Tod.
Es gibt hier etwas, das du wiedererkennen würdest. Es ragt aus dem Herzen der Stadt empor und ist meilenweit das Höchste und Strahlendste überhaupt; sämtliche Schienen und Wege sind auf die ein oder andere Weise damit verbunden. Es ist dein alter Freund, der Amethyst-Obelisk. Er schwebt nicht, noch nicht. Er sitzt – nicht ganz untätig – auf seinem Sockel. Hin und wieder pulsiert er auf eine Weise, die dir von Allia vertraut sein wird. Dieses Pulsieren ist gesünder, als es das damals war; der Amethyst ist nicht der beschädigte, sterbende Granat. Dennoch, wenn die Ähnlichkeit dich erschauern lässt, ist das keine ungesunde Reaktion.
Wo immer in den drei Ländern sich ein ausreichend großer Knoten von Syl Anagist befindet, steht ein Obelisk in dessen Zentrum. Sie sprenkeln die Welt, zweihundertundsechsundfünfzig Spinnen in zweihundertundsechsundfünfzig Spinnennetzen, die jede Stadt nähren und ihrerseits von ihr genährt werden.
Netze des Lebens, wenn du so willst. In Syl Anagist, verstehst du, ist das Leben heilig.
Stell dir nun einen sechseckigen Gebäudekomplex vor, der die Basis des Amethysts umgibt. Was immer du vor dir siehst, wird der Realität nicht annähernd gerecht, aber es wird genügen, wenn du dir einfach etwas Hübsches vorstellst. Betrachte das dann genauer; das entlang des südwestlichen Randes des Obelisken; das auf einem abschüssigen kleinen Hügel. Vor den Kristallfenstern des Gebäudes gibt es keine Gitterstäbe, aber stell dir eine etwas dunklere Vergitterung aus Gewebe über dem durchsichtigen Material vor. Nesselzellen, eine beliebte Methode, Fenster gegen unerwünschten Kontakt zu sichern – auch wenn dieser Schutz nur auf der Außenseite der Fenster existiert, um Eindringlinge fernzuhalten. Sie verursachen einen brennenden Schmerz, aber sie töten nicht. (In Syl Anagist ist das Leben heilig.) Vor den Türen im Innern des Gebäudes stehen keine Wachen. Wachen sind sowieso nutzlos. Das Fulcrum ist nicht die erste Institution, die eine ewige Wahrheit der Menschheit gelernt hat: Wachen sind unnötig, wenn man die Leute davon überzeugen kann, an der eigenen Internierung mitzuwirken.
Hier ist eine Zelle in dem hübschen Gefängnis.
Sie sieht nicht wie eine Zelle aus, ich weiß. Da ist ein wunderschönes Möbelstück, das man als Sofa bezeichnen könnte, auch wenn es keine Rückenlehne hat und aus verschiedenen Teilen besteht, die gruppenweise angeordnet sind. Die übrigen Möbelstücke sind gewöhnliche Gegenstände, die du wiedererkennen würdest; jede Gesellschaft braucht Tische und Sitzmöbel. Das Fenster ermöglicht den Blick auf einen Garten, der sich auf dem Dach eines der anderen Gebäude befindet. Zu dieser Tageszeit fängt der Garten das durch den großen Kristall schräg einfallende Licht ein, und die Blumen, die im Garten wachsen, sind auf diesen Effekt hin gezüchtet und gepflanzt worden. Purpurfarbenes Licht färbt die Wege und Beete, und die Blumen scheinen leicht zu glühen. Einige dieser winzigen weißen Blumenlichter zwinkern hin und wieder, was den Anschein erweckt, als würde das ganze Blumenbeet glitzern wie der Nachthimmel.
Da ist ein Junge, der durch das Fenster zu den zwinkernden Blumen schaut.
Genau genommen ist er ein junger Mann. Äußerlich gesehen ist er erwachsen, auf eine alterslose Weise. Seine Gestalt ist weniger stämmig als eher kompakt, das Gesicht breit und spitzbübisch. Er hat einen schmalen Mund, und alles an ihm ist weiß: die farblose Haut, die farblosen Haare, die eisweißen Augen, seine elegant drapierte Kleidung. Auch das Zimmer, in dem er sich befindet, ist weiß: die Möbel, die Teppiche, der Boden unter den Teppichen. Die Wände sind aus gebleichter Zellulose, und nichts wächst an ihnen. Nur die Fenster zeigen Farben. In diesem sterilen Raum im reflektierten purpurnen Licht von draußen ist nur der Junge offensichtlich am Leben.
Ja, der Junge bin ich. Ich erinnere mich nicht mehr richtig an seinen Namen, aber ich erinnere mich noch daran, dass er zu viele rostverdammte Buchstaben hatte. Nennen wir ihn daher Houwha – der gleiche Klang, nur aufgefüllt mit allen möglichen stummen Buchstaben und verborgenen Bedeutungen. Das ist nah genug dran und angemessen symbolisch für –
Oh. Ich bin wütender, als ich sein sollte. Faszinierend. Wechseln wir also den Kurs und widmen uns etwas weniger Beladenem. Kehren wir zu dem Jetzt zurück, das sein wird, und einem ganz anderen Hier.
Das Jetzt ist das Jetzt der Stille, durch die der Nachhall des Grabenbruchs immer noch zu spüren ist. Das Hier ist nicht genau die Stille, sondern eine Höhle gleich oberhalb der Hauptlavakammer eines riesigen, uralten Schildvulkans: das Herz des Vulkans, falls dir das besser gefällt und du einen Sinn für Metaphorik hast; falls nicht, ist dies eine tiefe, dunkle, nicht ganz stabile Lavablase im Felsgestein, die in den vielen Tausend Jahren, seit Vater Erde sie ausgerülpst hat, noch immer nicht wesentlich abgekühlt ist. In dieser Höhle stehe ich, zum Teil mit einem Steinklotz verschmolzen, damit ich besser auf die winzigen Störungen oder großen Verformungen achten kann, die einen Zusammenbruch ankündigen. Ich muss das nicht tun. Es gibt nur wenige Prozesse, die sich weniger aufhalten lassen als der, den ich hier in Gang gesetzt habe. Dennoch begreife ich, was es bedeutet, allein zu sein, wenn man verwirrt ist und Angst hat und sich nicht sicher ist, was als Nächstes passieren wird.
Du bist nicht allein. Du wirst niemals allein sein, es sei denn, du entscheidest dich dafür. Ich weiß, was wichtig ist, hier am Ende der Welt.
Oh, meine Liebe. Eine Apokalypse ist etwas Relatives, nicht wahr? Wenn die Erde zerbricht, ist das eine Katastrophe für das Leben, das von ihr abhängig ist – aber nichts Besonderes für Vater Erde. Wenn ein Mann stirbt, sollte das für ein Mädchen vernichtend sein, das ihn einst als Vater bezeichnet hat, aber das wird nichtig, wenn sie so oft als Monster bezeichnet worden ist, dass sie schließlich diese Zuschreibung anerkennt. Wenn ein Sklave rebelliert, hat das für die Menschen, die später darüber lesen, keine große Bedeutung. Nur dünne Worte auf noch dünnerem Papier, das vom Abrieb der Geschichte verschlissen wurde. (»Dann wart ihr also Sklaven, na und?«, flüstern sie. Als wäre das nichts.) Aber für die Leute, die einen Sklavenaufstand mitmachen, sowohl jene, die ihre Vormacht für selbstverständlich halten, bis sie im Dunkeln über sie kommt, als auch jene, die lieber die Welt brennen lassen wollen, bevor sie auch nur einen Moment länger an »ihrem Platz« ausharren –
Das ist keine Metapher, Essun. Keine Übertreibung. Ich habe die Welt brennen gesehen. Erzähl mir nichts von unschuldigen Zuschauern, unverdientem Leiden, herzloser Rache. Wenn sich eine Gem auf einer Verwerfungslinie bildet, machst du dann die Mauern dafür verantwortlich, wenn diese die Leute zwangsläufig zermalmen? Nein; du machst diejenigen verantwortlich, die dumm genug waren zu glauben, sie könnten den Gesetzen der Natur trotzen. Nun, einige Welten sind auf einer Verwerfungslinie aus Schmerz errichtet worden, aufrecht gehalten durch Albträume. Klage nicht darüber, wenn diese Welten fallen. Sei wütend darüber, dass sie erschaffen wurden, um unterzugehen.
Jetzt werde ich dir erzählen, wie diese Welt, Syl Anagist, geendet hat. Ich werde dir erzählen, wie ich sie beendet habe, oder zumindest genug von ihr, dass sie wieder von vorn beginnen und sich von Grund auf neu erschaffen musste.
Ich werde dir erzählen, wie ich das Tor geöffnet und den Mond weggeschleudert habe, und wie ich dabei lächelte.
Und ich werde dir alles darüber erzählen, wie ich später, als sich die Ruhe des Todes herabsenkte, geflüstert habe:
Genau jetzt.
Genau jetzt.
Und wie die Erde zurückgeflüstert hat:
Brennt.
1
du, aufwachend und träumend
Also. Gehen wir das also alles noch einmal durch.
Du bist Essun, die einzige überlebende Orogene in der ganzen Welt, die das Obelisk-Tor geöffnet hat. Niemand hat von dir ein so beeindruckendes Schicksal erwartet. Du hast einmal zum Fulcrum gehört, aber du warst niemals ein aufgehender Stern wie Alabaster. Du bist als Ungezähmte in der Wildnis gefunden worden, und ungewöhnlich warst du nur, weil du mehr angeborene Fähgkeiten besessen hast als andere zufällig geborene Roggas. Aber obwohl du gut angefangen hast, hast du dich früh eingependelt – wenn auch ohne ersichtlichen Grund. Dir hat einfach der Drang gefehlt, irgendwas zu erneuern, ebenso wie der Wunsch, dich hervorzutun; zumindest haben die Erfahrenen dies hinter geschlossenen Türen beklagt. Du hast dich bereitwillig dem System des Fulcrums angepasst. Das hat dich begrenzt.
Was allerdings gut war, denn sonst hätten sie die Leine nie so locker gelassen, wie sie es getan haben, als sie dich mit Alabaster auf diese Mission geschickt haben. Er hat ihnen eine rostverdammte Angst eingejagt. Du aber … sie haben dich für eine der Ungefährlichen gehalten, die angemessen gebrochen worden war und gelernt hatte zu gehorchen; unwahrscheinlich, dass du aus Versehen eine ganze Stadt auslöschen würdest. Dieser Schuss ist nach hinten losgegangen; wie viele Städte hast du inzwischen ausgelöscht? Eine halb absichtlich. Die anderen drei waren Unfälle, aber spielt das eine Rolle? Für die Toten nicht.
Manchmal träumst du davon, alles ungeschehen zu machen. Nicht in Allia wild um dich schlagend nach dem Granat-Obelisken auszugreifen, sondern den schwarzen Kindern beim glücklichen Spielen in der Brandung eines schwarzsandigen Strandes zuzusehen, während du mit dem schwarzen Messer eines Wächters in dir verblutest. Nicht von Antimon nach Meov gebracht zu werden, sondern zum Fulcrum zurückzukehren, wo du Korund geboren hättest. Man hätte ihn dir nach der Geburt zwar weggenommen, und du hättest niemals Innon gehabt, aber beide wären vermutlich noch am Leben. (Nun. Was immer »am Leben sein« wert ist, wenn sie Koru in eine Knoten-Station gesteckt hätten.) Aber dann hättest du auch nie in Tirimo gelebt, Uche nie geboren, der unter den Fäusten seines Vaters gestorben ist. Du hättest Nassun nicht großgezogen, die dir von ihrem Vater gestohlen wurde, hättest niemals deine einstigen Nachbarn vernichtet, als sie versucht haben, dich zu töten. So viele Leben wären gerettet worden, wenn du nur in deinem Käfig geblieben wärst. Oder bei Bedarf gestorben.
Und hier also, seit Langem frei von den angeordneten, konservativen Beschränkungen des Fulcrums, bist du mächtig geworden. Du hast die Gemeinschaft von Castrima auf Kosten von Castrima gerettet; ein kleiner Preis, verglichen mit dem Blut, das die feindliche Armee euch im Falle eines Sieges gekostet hätte. Du hast den Sieg herbeigeführt, indem du die verbundene Macht eines arkanen Mechanismus freigesetzt hast, der älter ist als (eure) niedergeschriebene Geschichte – und weil du bist, wer du bist, hast du, während du gelernt hast, deine Macht zu beherrschen, Alabaster Zehnring umgebracht. Du hast das nicht gewollt. Du vermutest sogar, dass er es wollte. Wie auch immer, er ist tot, und durch diese Abfolge von Ereignissen bist du die mächtigste Orogene auf dem Planeten geworden.
Was allerdings auch bedeutet, dass dein Anspruch als mächtigste Orogene gerade ein Ablaufdatum erhalten hat, denn mit dir passiert das Gleiche, was mit Alabaster passiert ist: Du verwandelst dich in Stein. Im Augenblick betrifft es nur deinen rechten Arm. Es könnte schlimmer sein. Und es wird auch schlimmer, wenn du das nächste Mal das Tor öffnest, oder wenn du das nächste Mal genügend von dieser fremdartigen silbrigen Nicht-Orogenie ausübst, die Alabaster als Magie bezeichnet hat. Du hast allerdings keine Wahl. Du musst eine Aufgabe erfüllen, dank Alabaster und der nebulösen Gruppe aus Steinessern, die heimlich versuchen, einen uralten Krieg zwischen dem Leben und Vater Erde zu beenden. Diese Aufgabe, die du erfüllen musst, hältst du für die leichtere von beiden. Den Mond fangen. Den Grabenbruch von Yumenes schließen. Die vorausgesagte Wucht der gegenwärtigen Fünftzeit von Abertausend oder Millionen Jahren zu etwas reduzieren, das handhabbar ist – bei dem die menschliche Rasse eine Chance hat zu überleben. Die Fünftzeiten ein für alle Mal beenden.
Die Aufgabe allerdings, die du erfüllen willst? Nassun finden, deine Tochter. Sie von dem Mann zurückholen, der deinen Sohn ermordet und sie inmitten der Apokalypse durch die halbe Welt geschleift hat.
Was das betrifft, habe ich gute und schlechte Neuigkeiten. Aber zu Jija kommen wir gleich.
Du liegst nicht wirklich im Koma. Du bist eine Schlüsselkomponente in einem komplexen System, das gerade einen gewaltigen, schlecht kontrollierten Hochfahr-Prozess und eine Notabschaltung mit ungenügender Abkühlzeit durchgemacht hat und sich jetzt als arkanochemischer Phasenzustandswiderstand und mutagenes Feedback präsentiert. Du brauchst Zeit, um dich zu … rebooten.
Das bedeutet, du bist nicht bewusstlos. Es ist eher so, dass du Phasen hast, in denen du halb wach bist, und andere, in denen du halb schläfst, sofern das einen Sinn ergibt. Du nimmst manches irgendwie wahr. Ruckartige Bewegungen, gelegentliches Schubsen. Jemand schiebt dir etwas zu essen und zu trinken in den Mund. Glücklicherweise besitzt du die Geistesgegenwart zu kauen und zu schlucken, denn das Ende der Welt und die aschebestreute Straße sind ein schlechter Zeitpunkt und ein ungünstiger Ort, um eine Magensonde zu finden. Hände ziehen an deiner Kleidung, und etwas wird um deine Hüfte gebunden – eine Windel. Auch dafür sind Zeitpunkt und Ort schlecht gewählt, aber immerhin ist jemand bereit, sich um dich zu kümmern, und es stört dich nicht. Du merkst es kaum. Du verspürst keinen Hunger und keinen Durst, bevor sie dir etwas geben; deine Entleerungen bringen keine besondere Verbesserung. Das Leben geht weiter. Das muss es aber nicht begeistert tun.
Irgendwann unterscheiden sich die Phasen des Wachseins und des Schlafens deutlicher voneinander. Und eines Tages öffnest du die Augen und starrst in den bewölkten Himmel über dir. Er schwankt. Kahle Äste und Zweige verdecken ihn gelegentlich. Der schwache Schatten eines Obelisken fällt durch die Wolken: der Spinell, vermutest du. Er ist zu seiner üblichen Form und Unermesslichkeit zurückgekehrt und folgt dir wie ein einsames Hündchen, seit Alabaster tot ist.
Nach einer Weile wird es langweilig, zum Himmel hochzusehen, und du drehst den Kopf und versuchst zu verstehen, was gerade passiert. Um dich herum bewegen sich Gestalten, traumgleich und in Grauweiß gehüllt … Nein. Nein, sie tragen gewöhnliche Kleidung; sie ist nur mit heller Asche bedeckt. Und sie tragen eine Menge Kleidung, denn es ist kalt – nicht kalt genug, dass Wasser gefrieren würde, aber nicht weit davon entfernt. Die Fünftzeit dauert jetzt fast zwei Jahre; zwei Jahre ohne Sonne. Am Äquator stößt der Grabenbruch eine Menge Hitze aus, aber das reicht nicht einmal annähernd, um das Nichtvorhandensein des riesigen Feuerballs am Himmel auszugleichen. Dennoch wäre die Kälte ohne den Grabenbruch noch schlimmer – deutlich unter dem Gefrierpunkt statt knapp darüber. Kleine Gefälligkeiten.
Wie auch immer, eine dieser in Asche gehüllten Gestalten scheint zu bemerken, dass du wach bist, spürt vielleicht die Verlagerung deines Gewichts. Ein Kopf mit Gesichtsmaske und Schutzbrille dreht sich zu dir um und sieht dich an, blickt dann wieder nach vorn. Zwischen den beiden Menschen vor dir werden gemurmelte Worte gewechselt, die du nicht verstehst. Dabei sprechen sie keine andere Sprache. Du bist nur noch nicht richtig da, und die Worte werden zum Teil von der herunterrieselnden Asche verschluckt.
Hinter dir spricht jemand. Du zuckst zusammen und siehst dich um, findest dort ein weiteres Gesicht mit Maske und Schutzbrille. Wer sind diese Leute? (Es kommt dir nicht in den Sinn, Angst zu haben. Derartige viszerale Dinge sind – genau wie Hungergefühle – von dir abgetrennt.) Dann macht etwas in dir Klick, und du begreifst. Du liegst auf einer Trage, bestehend aus zwei Stöcken mit etwas Leder dazwischen, die von vier Leuten getragen wird. Eine Trägerin ruft etwas, und die anderen weiter vorn antworten. Viele Rufe. Viele Leute.
Noch ein Ruf von irgendwo weiter vorn, und die Leute, die dich tragen, bleiben stehen. Sie sehen einander an und stellen die Trage mit der ungezwungenen Gleichzeitigkeit von Leuten ab, die viele Male die gleichen, gemeinsamen Bewegungen ausgeführt haben. Du spürst, wie sich die Trage auf eine weiche, pudrige Ascheschicht senkt, unter der eine dickere Ascheschicht ist, unter der wiederum eine Straße sein könnte. Dann gehen die Träger weg, öffnen Bündel und Laufsäcke und folgen einem Ritual, das dir von deinem monatelangen Leben auf der Straße vertraut ist. Sie machen Pause.
Du kennst das Ritual. Du solltest aufstehen. Etwas essen. Deine Stiefel auf Löcher oder Steine hin untersuchen, die Füße auf unentdeckte Verletzungen. Dafür sorgen, dass deine Maske – warte, trägst du eine? Wenn alle anderen eine haben … Du hast deine in deinem Laufsack aufbewahrt, oder nicht? Wo ist dein Laufsack?
Jemand taucht aus der Düsternis und dem Aschenregen auf. Groß, mit breiten Schultern, und obwohl die Persönlichkeit hinter der Kleidung und der Maske verschwindet, wird sie durch die vertraute krause Textur der aschgrauen Mähne wiederhergestellt. Sie hockt sich auf Kopfhöhe neben dich. »Hm. Nicht tot, tatsächlich. Schätze, die Wette habe ich gegen Tonkee verloren.«
»Hjarka«, krächzt du. Deine Stimme klingt noch schlimmer als ihre.
Du errätst an der Verformung ihrer Maske, dass sie grinst. Irgendwie seltsam, ihr Lächeln wahrzunehmen, ohne die übliche unterschwellige Bedrohung durch ihre spitz zugefeilten Zähne. »Dein Hirn ist wohl noch in Ordnung. Ich gewinne also zumindest die Wette mit Ykka.« Sie sieht sich um und brüllt: »Lerna!«
Du versuchst, eine Hand zu heben, um nach ihrem Hosenbein zu greifen. Es fühlt sich an, als wolltest du einen Berg bewegen. Doch du solltest eigentlich in der Lage sein, Berge zu versetzen, also konzentrierst du dich und bringst die Hand halb hoch – und dann vergisst du, warum du Hjarkas Aufmerksamkeit überhaupt auf dich lenken wolltest. Glücklicherweise sieht sie sich jetzt um und bemerkt deine erhobene Hand, die vor Anstrengung zittert. Nachdem Hjarka einen Moment nachgedacht hat, seufzt sie und nimmt die Hand, dann sieht sie weg, als wäre sie verlegen.
»Was …«, bringst du hervor.
»Rostverdammt, wenn ich das wüsste. So schnell hätten wir nicht schon wieder eine Pause gebraucht.«
Das war nicht das, was du gemeint hast, aber es ist zu anstrengend für dich zu versuchen, den Rest auch noch zu sagen. Also liegst du einfach nur da, lässt dir von einer Frau die Hand halten, die eindeutig lieber etwas anderes tun würde und sich dennoch dazu herabgelassen hat, dir Mitgefühl entgegenzubringen, weil sie denkt, dass du es brauchst. Das tust du nicht, aber du bist froh, dass sie es versucht.
Zwei weitere Gestalten lösen sich aus dem wirbelnden Aschenregen, beide erkennst du an ihrer Statur. Die eine ist männlich und schlank, die andere weiblich und rundlich. Die schmale nimmt Hjarkas Stelle an deiner Seite ein und beugt sich zu dir herunter, um dir die Schutzbrille abzunehmen, von der du gar nicht gewusst hast, dass du sie trägst. »Ich brauche einen Stein«, sagt der Mann. Es ist Lerna; seine Worte ergeben keinen Sinn.
»Was?«, fragst du.
Er antwortet dir nicht. Tonkee, die andere Person, stößt Hjarka den Ellbogen in die Seite, und Hjarka seufzt und kramt in ihrer Tasche, bis sie einen kleinen Gegenstand findet. Sie reicht ihn Lerna.
Er legt dir eine Hand an die Wange, während er den Gegenstand hochhält. Das Ding beginnt, in einem vertrauten weißen Licht zu leuchten. Du begreifst, dass es ein Stück Kristall von Untercastrima ist – er leuchtet auf, wie sie es tun, wenn sie Kontakt mit Orogenen haben, und Lerna berührt dich jetzt. Genial. Er beugt sich nach vorn und untersucht mithilfe des Lichts deine Augen. »Die Pupillen ziehen sich normal zusammen«, murmelt er leise vor sich hin. Die Hand an deiner Wange zuckt. »Kein Fieber.«
»Ich fühle mich schwer«, sagst du.
»Du bist am Leben«, sagt er, als wäre dies eine vernünftige Aussage. Niemand spricht auf eine Weise, die du heute verstehen kannst. »Motorik träge. Wahrnehmung …?«
Tonkee beugt sich zu dir hin. »Was hast du geträumt?«
Die Frage ergibt genauso viel Sinn wie Lernas Ich brauche einen Stein, aber du versuchst zu antworten, weil du zu sehr neben dir stehst, um zu begreifen, dass du nicht antworten solltest. »Da war eine Stadt«, murmelst du. Ein paar Ascheflocken fallen auf deine Wimpern, und du zuckst zusammen. Lerna setzt dir die Schutzbrille wieder auf. »Sie war lebendig. Über ihr war ein Obelisk.« Über ihr? »Vielleicht auch darin. Glaube ich.«
Tonkee nickt. »Obelisken schweben selten direkt über menschlichen Wohnstätten. In der Siebten hatte ich eine Freundin, die einige Theorien dazu hatte. Willst du sie hören?«
Schließlich begreifst du, dass du gerade etwas Dummes tust: Du ermutigst Tonkee. Du strengst dich ordentlich an und wirfst ihr einen zornigen Blick zu: »Nein.«
Tonkee sieht Lerna an. »Ihre Wahrnehmungsfähigkeiten scheinen in Ordnung zu sein. Ein bisschen träge vielleicht, aber das war bei ihr schon immer so.«
»Ja, danke, dass du das bestätigst.« Lerna beendet das, was immer er getan hat, und lässt sich auf die Fersen nieder. »Möchtest du versuchen zu gehen, Essun?«
»Ist das nicht etwas früh?«, fragt Tonkee. Sie runzelt die Stirn, was trotz der Schutzbrille zu sehen ist. »Wo sie doch im Koma war und so?«
»Du weißt so gut wie ich, dass Ykka ihr nicht mehr viel Zeit zur Genesung zugestehen wird. Es könnte ihr sogar guttun.«
Tonkee seufzt. Aber dann hilft sie Lerna dabei, als er einen Arm unter deinen Rücken schiebt und dich in eine aufrechte Position bringt. Schon das kostet dich unendliche Mühe. Du fühlst dich benommen, kaum dass du dich aufgesetzt hast, aber es geht vorbei. Etwas stimmt allerdings nicht. Vielleicht ein Beweis dafür, wie viel du durchgemacht hast, diese dauerhaft gekrümmte Haltung. Deine rechte Schulter sackt nach unten, der Arm wird hinuntergezerrt, als
bestünde er aus
Oh. Oh.
Die anderen hören auf, sich an dir zu schaffen zu machen, als du begreifst, was passiert ist. Sie sehen, wie du in dem Versuch, deinen rechten Arm zu betrachten, die Schulter hochziehst, so gut es geht. Der Arm ist schwer. Deine Schulter schmerzt, da der größte Teil des Gelenks immer noch aus Fleisch besteht, und das Gewicht des Arms zieht an diesem Fleisch. Einige Sehnen haben sich verändert, aber sie sind immer noch an lebendigen Knochen befestigt. Kiesige Stücke von etwas reiben in etwas, das eine geschmeidige Gelenkkugel sein sollte. Es schmerzt nicht so sehr, wie du vermutet hättest, nachdem du mit angesehen hast, was Alabaster durchgemacht hat. Das ist immerhin etwas.
Der Rest deines Armes – jemand hat ihn von den Ärmeln deines Hemds und deiner Jacke befreit – hat sich fast bis zur Unkenntlichkeit verändert. Es ist dein Arm, da bist du dir ziemlich sicher. Nicht nur, dass er immer noch mit deinem Körper verbunden ist, er hat auch die Form, die du kennst – nun ja, er ist nicht mehr so graziös und konisch zulaufend wie früher, als du noch jung warst. Eine Weile warst du korpulent, was man noch an dem üppig aussehenden Unterarm und dem leichten Durchhängen deines Oberarms sehen kann. Der Bizeps ist nach den zwei Jahren Überlebenskampf ausgeprägter. Die Hand bildet eine Faust, der Ellbogen ist leicht angewinkelt. Du hattest immer die Neigung, die Hände zu Fäusten zu ballen, wenn es besonders schwierig wurde, mit der Orogenie zu arbeiten.
Das Muttermal mitten auf deinem Unterarm, ein winziger schwarzer Fleck, ist allerdings verschwunden. Du kannst den Arm nicht so drehen, dass du dir den Ellbogen anschauen könntest, deshalb betastest du ihn. Der narbige Wulst von einem Sturz ist nicht mehr zu spüren, obwohl er sich von der umgebenden Haut leicht abheben müsste. Dieser feine Grat ist in einer rauen, dichten Konsistenz – wie unpolierter Sandstein – untergegangen. In einer möglicherweise selbstzerstörerischen Anwandlung reibst du darüber, aber unter deinen Fingerspitzen lösen sich keine Partikel; das Material ist fester, als es aussieht. Die Farbe ist gleichmäßig und lückenlos gräulich braun und erinnert ganz und gar nicht an deine Haut.
»So war es schon, als Hoa dich zurückgebracht hat«, sagt Lerna, der geschwiegen hat, während du deinen Arm untersucht hast. Seine Stimme klingt neutral. »Er sagt, er braucht deine Einwilligung, um, äh …«
Du hörst auf zu versuchen, die Steinhaut abzuschaben. Vielleicht liegt es am Schock, vielleicht hat die Angst dir auch den Schock geraubt, oder aber du kannst wirklich nichts mehr spüren.
»Also dann«, sagst du zu Lerna. Die Anstrengung, die es dich kostet, aufrecht zu sitzen und deinen Arm zu betrachten, hat deinen Verstand ein bisschen zurückgeholt. »Was sollte ich deiner, äh, beruflichen Einschätzung nach jetzt hiermit tun?«
»Ich denke, du solltest entweder Hoa erlauben, ihn zu essen, oder zulassen, dass jemand von uns ihn mit einem Vorschlaghammer bearbeitet.«
Du zuckst zusammen. »Findest du das nicht etwas drastisch?«
»Ich bezweifle, dass etwas anderes mehr als eine Kerbe verursachen wird. Du vergisst, dass ich oft die Gelegenheit hatte, Alabaster zu untersuchen, als das mit ihm passiert ist.«
Schlagartig fällt dir ein, dass Alabaster daran erinnert werden musste, zu essen, weil er keinen Hunger mehr verspürt hat. Das ist jetzt nicht wichtig, aber der Gedanke steigt einfach auf. »Das hat er zugelassen?«
»Ich ließ ihm keine Wahl. Ich musste wissen, ob er ansteckend war, schließlich schien es sich bei ihm auszubreiten. Einmal habe ich ihm eine Probe entnommen, und er hat einen Witz darüber gemacht, dass Antimon – die Steinesserin – sie zurückverlangen würde.«
Es war sicher kein Witz gewesen. Alabaster hat immer gelächelt, wenn er die schroffsten Wahrheiten ausgesprochen hat. »Hast du sie ihm zurückgegeben?«
»Darauf kannst du Gift nehmen.« Lerna fährt sich mit einer Hand über die Haare, schiebt einen kleinen Haufen Asche beiseite. »Hör zu, wir müssen den Arm nachts umwickeln, damit deine Körpertemperatur nicht aufgrund seiner Kälte sinkt. An deiner Schulter – da, wo der Arm an deiner Haut zerrt – sind Dehnungsmale zu sehen. Ich vermute, dass die Knochen deformiert und die Sehnen übermäßig beansprucht werden; das Schultergelenk ist nicht dafür gemacht, so viel Gewicht zu tragen.« Er zögert. »Wir können ihn jetzt abnehmen und Hoa später geben, wenn du willst. Ich sehe keinen Grund, warum du es … auf seine Weise tun musst.«
Du glaubst, dass Hoa irgendwo unter deinen Füßen ist und zuhört. Aber Lerna ist seltsam zimperlich. Warum? Du wagst eine Vermutung. »Es stört mich nicht, wenn Hoa ihn isst«, sagst du. Das sagst du nicht nur für Hoa. Du meinst es wirklich so. »Wenn es ihm guttut und ich das Ding auf diese Weise loswerde, warum nicht?«
Etwas flackert in Lernas Miene auf. Die Maske der Emotionslosigkeit verrutscht, und plötzlich erkennst du, dass ihn die Vorstellung abstößt, wie Hoa dir den Arm abkaut. Nun, so betrachtet, ist das ganze Konzept abstoßend. Aber das ist eine zu zweckmäßige Betrachtungsweise. Zu primitiv. Aufgrund all der Stunden, die du damit verbracht hast, zwischen die Zellen und Partikel von Alabasters transformierenden Körper einzutauchen, weißt du auf eine sehr vertraute Weise, was in deinem Arm vor sich geht. Wenn du ihn ansiehst, kannst du die silbrigen Fäden der Magie fast sehen, die die unendlich winzigen Partikel und Energien deiner Substanz ausrichten, indem sie das eine Teilchen so bewegen, dass es sich am gleichen Pfad orientiert wie das andere Teilchen, sich all das vorsichtig zu einem Gitter verfestigt, das alles miteinander verbindet. Was für ein Prozess genau es auch ist, er ist zu präzise, zu mächtig, um Zufall sein zu können – oder das Groteske, das Lerna offenbar darin sieht, weil Hoa es sich einverleiben will. Du weißt jedoch nicht, wie du ihm das alles erklären kannst, und selbst wenn du es wüsstest, hättest du nicht die Kraft, es zu versuchen.
»Hilf mir auf«, sagst du.
Tonkee nimmt behutsam deinen Steinarm und hebt ihn an, damit er sich nicht verlagert oder absackt und an deiner Schulter zerrt. Sie wirft Lerna einen zornigen Blick zu, bis er schließlich zu dir tritt und wieder einen Arm unter deine Achsel schiebt. Mithilfe der beiden gelingt es dir, dich aufzustellen, aber es ist sehr schwer. Als du es geschafft hast, keuchst du, und deine Knie fühlen sich ziemlich wackelig an. Das Blut in deinem Körper scheint sich seiner Aufgabe wenig verpflichtet zu fühlen, und du schwankst einen Moment benommen und schwindelig.
»In Ordnung, lassen wir sie sich wieder hinsetzen«, sagt Lerna.
Sofort sitzt du wieder, dieses Mal außer Atem. Der Arm schiebt deine Schulter unangenehm nach oben, bis Tonkee seine Position korrigiert. Das Ding ist wirklich schwer.
(Dein Arm. Nicht »das Ding«. Es ist dein rechter Arm. Du hast deinen rechten Arm verloren. Du bist dir dessen bewusst, und schon bald wirst du ihn betrauern, aber im Augenblick ist es leichter, in ihm ein Ding zu sehen, das von dir getrennt ist. Eine besonders nutzlose Prothese. Ein bösartiger Tumor, der entfernt werden muss. Genauso ist es. Es ist aber auch dein rostverdammter Arm.)
Du sitzt da, keuchst und versuchst, die Welt zu zwingen, sich nicht mehr zu drehen, als du hörst, wie sich jemand anderes nähert. Die hier spricht laut, ruft allen zu, dass sie die Sachen wieder einpacken sollen, weil die Pause vorbei ist und sie vor der Dunkelheit noch weitere fünf Meilen gehen müssen. Ykka. Du hebst den Kopf, während sie nahe genug herankommt, und in diesem Moment begreifst du, dass sie wirklich eine Freundin ist. Du erkennst es daran, dass es sich gut anfühlt, ihre Stimme zu hören und sie voller Entschlossenheit aus der wirbelnden Asche auftauchen zu sehen. Beim letzten Treffen war sie von feindseligen Steinessern bedroht worden, die Untercastrima angegriffen hatten und sie töten wollten. Das war einer der Gründe, die Steinesser zu bekämpfen, indem du sie in die Kristalle von Untercastrima eingeschlossen hast. Du wolltest, dass Ykka lebt, und all die anderen Orogenen von Castrima, und damit auch all die Bewohner von Castrima, die von den Orogenen abhängig waren.
Du lächelst also. Das Lächeln ist schwach. Du bist schwach. Deshalb tut es tatsächlich weh, als Ykka sich zu dir umdreht und die Lippen zu einer harten Linie zusammenpresst, die unmissverständlich Empörung ausdrückt.
Sie hat den Stoff weggezogen, der die untere Hälfte ihres Gesichts bedeckt hat. Die Augen hinter der behelfsmäßigen Schutzbrille – sie hat Stofffetzen darum gebunden, um die Asche fernzuhalten – sind grau-schwarz geschminkt, wovon sie nicht einmal das Ende der Welt abhalten kann. »Scheiße«, sagt sie zu Hjarka. »Du wirst mir das jetzt immer unter die Nase reiben, oder?«
Hjarka zuckt mit den Schultern. »Nur solange du nicht bezahlst.«
Du starrst Ykka an, und das zaghafte kleine Lächeln auf deinem Gesicht erstarrt.
»Sie wird sich wahrscheinlich vollständig erholen«, sagt Lerna. Seine Stimme klingt auf eine Weise sachlich, die seine Vorsicht verrät. Eine Über-eine-Lavaröhre-gehen-Vorsicht. »Es wird allerdings ein paar Tage dauern, bis sie zu Fuß mithalten kann.«
Ykka seufzt, stemmt eine Hand in die Hüfte und lässt sich offensichtlich etliche Dinge durch den Kopf gehen, die sie sagen könnte. Schließlich entscheidet auch sie sich für etwas Sachliches. »Schön. Ich werde die Rotation der Leute, die sie tragen, noch etwas ausweiten. Aber sorgt dafür, dass sie so bald wie möglich gehen kann. In dieser Gem trägt jeder sein eigenes Gewicht oder wird zurückgelassen.« Sie dreht sich um und stapft davon.
»Nun ja«, sagt Tonkee leise, als Ykka außer Hörweite ist. »Sie ist ein bisschen angepisst, weil du die Geode zerstört hast.«
Du zuckst zusammen. »Weil ich –« Oh, verdammt. Das Einschließen der Steinesser in den Kristallen. Du hattest alle retten wollen, aber Castrima war eine Maschine – eine sehr alte, sehr komplizierte Maschine, deren Mechanismus du nicht verstanden hast. Und jetzt seid ihr hier oben und stapft durch den Aschenregen … »Oh, rostverdammte Erde, ich habe die Geode zerstört!«
»Was denn, war dir das nicht klar?« Hjarka lacht ein wenig. Ihr Lachen hat eine bittere Schärfe. »Hast du wirklich gedacht, diese ganze rostverdammte Gem ist aus Spaß hier oben und wandert durch Asche und Kälte nach Norden?« Sie geht weg, schüttelt den Kopf. Ykka ist nicht die Einzige, die deshalb angepisst ist.
»Das habe ich nicht …« Das habe ich nicht gewollt, willst du sagen, aber dann unterbrichst du dich. Denn du willst so etwas nie, und am Ende spielt es niemals eine Rolle.
Lerna mustert dein Gesicht und seufzt leise. »Rennanis hat die Gem zerstört, Essun. Nicht du.« Er hilft dir, dich wieder hinzulegen, aber er weicht deinem Blick aus. »Wir haben die Geode in dem Moment verloren, als wir Obercastrima mit Kochkäfern überschwemmt haben, um uns zu retten. Ist ja nicht so, als wären sie jemals von alleine weggegangen oder hätten uns in dem Gebiet noch irgendwas zu essen übrig gelassen. Wenn wir in der Geode geblieben wären, wären wir zum Tode verurteilt gewesen, auf die eine oder andere Weise.«
Das stimmt; seine Ausführungen sind vollkommen vernünftig. Ykkas Reaktion beweist allerdings, dass es manchmal nicht um Vernunft geht. Du kannst anderen Menschen nicht so unerwartet und dramatisch ihr Zuhause und ihr Gefühl von Sicherheit nehmen und erwarten, dass sie sich erst mit der ausgedehnten Verkettung von Schuld beschäftigen, bevor sie wegen ihres Verlusts wütend werden.
»Sie werden darüber hinwegkommen.« Du blinzelst und bemerkst, dass Lerna dich ansieht. Sein Blick ist klar, sein Gesicht ist offen. »Wenn ich es konnte, können sie es auch. Es wird nur eine Weile dauern.«
Du hast gar nicht mitbekommen, dass er über Tirimo hinweggekommen ist.
Er ignoriert deinen eindringlichen Blick und gestikuliert zu den vier Leuten, die in der Nähe warten. Du liegst bereits wieder, daher sorgt er dafür, dass dein Steinarm neben dir ruht und die Decken ihn bedecken. Die Träger führen ihre Aufgabe wieder aus, und du musst deine Orogenie unterdrücken, die – jetzt, da du wach bist – darauf besteht, bei jedem Ruck so zu reagieren, als wäre es ein Beben. Als die Träger sich wieder in Bewegung setzen, taucht Tonkees Kopf in deinem Blickfeld auf. »Hey, es wird alles gut werden. Mich hassen auch viele Leute.«
Das ist ganz und gar nicht beruhigend. Es frustriert dich, dass es dir etwas ausmacht, und dass andere das sehen. Dabei hattest du immer ein Herz aus Stahl.
Aber du weißt plötzlich, warum das nicht mehr so ist.
»Nassun«, sagst du zu Tonkee.
»Was?«
»Nassun. Ich weiß, wo sie ist.« Du versuchst, deine rechte Hand zu heben, um ihre zu nehmen, und da ist ein Gefühl, das durch deine Schulter surrt wie Schmerz und Schweben. Du hörst ein klingendes Geräusch. Es tut nicht weh, aber insgeheim verfluchst du dich, weil du es vergessen hast. »Ich muss gehen und sie finden.«
Tonkee wirft einen Blick auf die Träger und dann in die Richtung, in die Ykka gegangen ist. »Sprich leiser.«
»Was?« Ykka weiß ganz genau, dass du gehen wirst, um deine Tochter zu finden. Es war fast das Erste, was du ihr gesagt hast.
»Wenn du unbedingt willst, dass man dich am rostverdammten Straßenrand liegen lässt, sprich gern weiter.«
Das bringt dich zum Schweigen, zusammen mit deinen andauernden Bemühungen, deine Orogenie zu bändigen. Oh. So angepisst ist Ykka also.
Die Asche fällt weiter; schließlich verdeckt sie deine Schutzbrille, weil du nicht die Energie aufbringst, sie wegzuwischen. In der grauen Dämmerung, die dadurch entsteht, überwältigt dich das Bedürfnis deines Körpers nach Genesung, und du schläfst wieder ein. Als du das nächste Mal aufwachst, liegt das daran, dass die Trage wieder abgestellt worden ist und ein Stein oder Ast oder etwas anderes in deinen unteren Rücken drückt. Du streichst dir die Asche vom Gesicht und richtest dich mühsam auf einem Ellbogen auf, und dieses Mal ist es etwas leichter; viel mehr bringst du allerdings nicht zustande.
Die Nacht ist angebrochen. Ein paar Dutzend Leute lassen sich auf einer Art Felsvorsprung in einem rauen, seltsam anmutenden Wald nieder. Als du das Gestein mentastest, fühlt es sich aufgrund deiner orogenischen Erkundungen von Castrimas Umgebung vertraut an. Es hilft dir, zu erkennen, wo du bist: auf einem Stück frischer tektonischer Hebung, die sich etwa einhundertsechzig Meilen nördlich der Castrima-Geode befindet. Das verrät dir, dass die Reise von Castrima erst vor wenigen Tagen begonnen hat, da eine Gruppe dieser Größe nur eine bestimmte Geschwindigkeit an den Tag legen kann. Und du weißt auch, dass sie nur ein Ziel haben, wenn sie nach Norden unterwegs sind. Rennanis. Von irgendwoher müssen sie wissen, dass es leer und bewohnbar ist. Vielleicht hoffen sie das aber auch nur, und es gibt sonst nichts, worauf sie ihre Hoffnung richten können. Nun, diesbezüglich kannst du sie beruhigen … sofern sie dir zuhören werden.
Die Leute um dich herum errichten Feuerstellen. Kochgruben. Latrinen. An einigen wenigen Stellen hier und da im Lager sorgen kleine Haufen von zerbrochenen Castrima-Kristallbrocken für zusätzliche Beleuchtung; gut zu wissen, dass genügend Orogenen übrig geblieben sind, um sie funktionieren zu lassen. Ein Teil der Geschäftigkeit ist nicht sehr effektiv, wenn es um ungewohnte Aufgaben geht, aber zum größten Teil ist alles gut organisiert. Die Tatsache, dass viele der Bewohner von Castrima wissen, wie man auf der Straße lebt, erweist sich jetzt als Segen. Deine Träger haben dich allerdings irgendwo abgestellt und dann allein gelassen, und falls irgendwer vorhat, ein Feuer für dich zu entfachen oder dir etwas zu essen zu bringen, merkst du noch nichts davon. Du siehst Lerna bei ein paar Leuten hocken, die ebenfalls auf dem Boden liegen, aber er ist beschäftigt. Ah, ja; es muss etliche Verwundete gegeben haben, nachdem die Soldaten von Rennanis in die Geode gelangt sind.
Nun, du brauchst kein Feuer, und du bist auch nicht hungrig, daher stört dich das Desinteresse der anderen im Moment nicht besonders, außer vielleicht emotional. Dich beunruhigt allerdings, dass dein Laufsack weg ist. Du hast dieses Ding durch die halbe Stille geschleppt, deine alten Rang-Ringe hineingestopft, ihn sogar davor bewahrt, pulverisiert zu werden, als ein Steinesser sich in deiner Unterkunft transformiert hat. Es war nicht viel darin, was noch von Bedeutung für dich gewesen wäre, aber die Tasche selbst hat einen gewissen sentimentalen Wert.
Nun. Jeder hat irgendetwas verloren.
Plötzlich belastet ein Berg deine Wahrnehmung. Trotz allem lächelst du unwillkürlich. »Ich habe mich schon gefragt, wann du auftauchen würdest.«
Hoa steht über dir. Es ist immer noch ein Schock, ihn so zu sehen: eher ein Erwachsener mittlerer Größe als ein kleines Kind, schwarz geäderter Marmor statt weißem Fleisch. Es ist trotzdem leicht, ihn als die gleiche Person wahrzunehmen – die gleiche Gesichtsform, die gleichen gequält dreinblickenden eisweißen Augen, die gleiche unbeschreibliche Fremdheit, der gleiche Hauch schlummernder Spitzbübigkeit. Es ist der Hoa, den du im vergangenen Jahr gekannt hast. Was hat sich geändert, dass ein Steinesser dir nicht mehr fremdartig erscheint? Bei ihm nur oberflächliche Dinge. Bei dir alles.
»Wie fühlst du dich?«, fragt er.
»Besser.« Der Arm zerrt an dir, als du dich verlagerst, um zu ihm hochzusehen, eine beständige Ermahnung an den ungeschriebenen Vertrag zwischen euch. »Warst du derjenige, der ihnen das mit Rennanis gesagt hat?«
»Ja. Und ich führe sie dorthin.«
»Du?«
»Soweit Ykka zuhört. Ich denke, sie bevorzugt Steinesser als stumme Bedrohungen statt als aktive Verbündete.«
Das entlockt dir ein müdes Lachen. Aber. »Bist du ein Verbündeter, Hoa?«
»Nicht ihrer. Aber auch das versteht Ykka.«
Ja. Das ist vermutlich der Grund, warum du noch am Leben bist. Solange Ykka dafür sorgt, dass es dir gut geht, wird Hoa helfen. Du bist wieder auf der Straße, und schon geht es erneut um einen rostverdammten Handel. Die Gem, die Castrima war, lebt, aber es ist jetzt keine richtige Gemeinschaft mehr, nur eine Gruppe von gleichgesinnten Reisenden, die sich zusammengeschlossen haben, um zu überleben. Vielleicht kann die Gruppe später wieder eine richtige Gem werden, wenn sie ein neues Zuhause hat, das es zu verteidigen gilt, aber im Augenblick verstehst du, warum Ykka wütend ist. Etwas Wunderschönes und Gesundes ist verloren gegangen.
Nun. Du siehst an dir hinunter. Du bist nicht mehr gesund, aber das, was von dir übrig ist, kann gestärkt werden; du wirst schon bald in der Lage sein, Nassun zu suchen. Aber alles der Reihe nach. »Gehen wir es an?«
Hoa sagt einen Moment nichts. »Bist du dir sicher?«
»So, wie er jetzt ist, nützt mir der Arm nichts.«
Da ist ein schwaches Geräusch. Stein, der über Stein reibt, langsam und unaufhaltsam. Eine sehr schwere Hand legt sich auf deine halb transformierte Schulter. Trotz des Gewichts hast du das Gefühl, dass die Berührung nach Maßstäben der Steinesser zart ist. Hoa geht behutsam mit dir um.
»Nicht hier«, sagt er und zieht dich hinunter in die Erde.
Es dauert nur einen Moment. Er hält diese Reisen durch die Erde immer kurz, wahrscheinlich, weil es, wenn man länger bleibt, schwieriger wird zu atmen … und bei geistiger Gesundheit zu bleiben. Dieses Mal ist es kaum mehr als eine verschwommene Empfindung von Bewegung, ein Flackern von Dunkelheit, ein Hauch von Lehm, der üppiger riecht als die saure Asche. Dann liegst du wieder auf einem felsigen Untergrund – möglicherweise auf dem gleichen, auf dem der Rest von Castrima sich ausgebreitet hat, nur ein Stück vom Lager entfernt. Hier gibt es keine Feuerstellen; das einzige Licht stammt von dem Grabenbruch, der von den dicken Wolken über dir rötlich reflektiert wird. Deine Augen gewöhnen sich rasch daran, auch wenn es nicht viel zu sehen gibt, nur Felsen und die Schatten nahe stehender Bäume. Und eine menschliche Silhouette, die jetzt neben dir hockt.
Hoa hält deinen Steinarm in den Händen, sanft, beinahe ehrfürchtig. Wider Willen spürst du die Feierlichkeit dieses Augenblicks. Und warum sollte er auch nicht feierlich sein? Dies ist das Opfer, das die Obelisken verlangen. Dies ist das Pfund Fleisch, das du für die Blutschuld deiner Tochter zahlen musst.
»Das hier ist nicht das, was du denkst«, sagt Hoa, und einen Moment machst du dir Sorgen, dass er deine Gedanken lesen kann. Wahrscheinlich liegt es aber daran, dass er buchstäblich älter ist als steinalt und dass er in deinem Gesicht lesen kann. »Du siehst, was in uns verloren ist, aber wir haben auch etwas gewonnen. Dies ist nicht so hässlich, wie es aussieht.«
Es scheint, als würde er jetzt deinen Arm essen. Es ist in Ordnung für dich, aber du möchtest es verstehen. »Was ist es dann? Wieso …?« Du schüttelst den Kopf, bist dir unsicher darüber, welche Frage du stellen sollst. Vielleicht spielt das Warum gar keine Rolle. Vielleicht kannst du es nicht verstehen. Vielleicht ist das hier nicht für dich gedacht.
»Es geht nicht um Stärkung durch Nahrung. Wir brauchen nur Leben, um zu leben.«
Die zweite Hälfte ist unsinnig, daher springst du auf die erste Hälfte an. »Wenn es keine Stärkung durch Nahrung ist, was …?«
Hoa bewegt sich langsam. Steinesser tun das nicht oft. Bewegung ist das, was ihre unheimliche Natur betont, der Menschheit so ähnlich und doch ganz anders. Es wäre einfacher, wenn sie fremdartiger wären. Wenn sie sich bewegen, kannst du sehen, was sie einst gewesen sind, und das Wissen ist eine Bedrohung für und eine Warnung an all das, was menschlich in dir ist.
Und dennoch. Du siehst, was in uns verloren ist, aber wir haben auch etwas gewonnen.
Er hebt deinen Arm mit seinen beiden Händen, die eine unter deinem Ellbogen, die Finger der anderen leicht gespreizt unter deiner rissigen Faust. Langsam, langsam. So tut es deiner Schulter nicht weh. Auf halbem Weg zu seinem Gesicht bewegt er die Hand unter deinem Ellbogen, verrückt sie so, dass sie die Unterseite deines Oberarms umfasst. Sein Stein gleitet an deinem entlang, mit einem schwachen schleifenden Geräusch. Es ist überraschend sinnlich, auch wenn du nicht das Geringste spüren kannst.
Dann ruht deine Faust an seinen Lippen. Die Lippen rühren sich nicht, als er von irgendwo in seiner Brust fragt: »Hast du Angst?«
Du denkst einen langen Moment darüber nach. Solltest du nicht welche haben? Aber … »Nein.«
»Gut«, erwidert er. »Ich tue dies für dich, Essun. Alles für dich. Glaubst du das?«
Du weißt es zunächst nicht. Ein Impuls bringt dich dazu, die gesunde Hand zu heben, sanfte Finger auf seiner harten, kühlen, polierten Wange. Du kannst ihn kaum sehen, so schwarz ist er vor dem Dunkel, aber dein Daumen findet seine Brauen und erspürt seine Nase, die in dieser erwachsenen Gestalt länger ist. Er hat dir einmal gesagt, dass er sich selbst als Mensch betrachtet, trotz seines seltsamen Körpers. Erst jetzt begreifst du, dass du dich entschieden hast, ihn auch als Mensch zu sehen. Das macht das hier zu etwas anderem als einem räuberischen Akt. Du bist dir nicht sicher, was es stattdessen ist, aber … es fühlt sich wie ein Geschenk an.
»Ja«, sagst du. »Ich glaube dir.«
Er öffnet den Mund. Weit, weiter, weiter, als jeder menschliche Mund sich öffnen kann. Einmal hast du dir Sorgen gemacht, weil sein Mund zu klein war; jetzt ist er breit genug, dass eine Faust hineinpasst. Und er hat so kleine, gleichmäßige Zähne, diamantklar, im roten Abendlicht hübsch glitzernd. Jenseits dieser Zähne ist nur Dunkelheit.
Du schließt die Augen.
Sie hatte schlechte Laune. Das Alter, erklärte mir eines ihrer Kinder. Sie sagte, es wäre nur der Stress von dem Bemühen, die Leute zu warnen, die doch nicht hören wollten, dass schlechte Zeiten bevorstünden. Es war keine schlechte Laune, es war das Privileg, das das Alter ihr erkauft hatte, mit dem Lügen aus Höflichkeit aufzuhören.
»In dieser Geschichte gibt es keinen Schurken«, sagte sie. Wir saßen in ihrer Gartenkuppel, die nur deshalb eine Kuppel war, weil sie darauf bestanden hatte. Die Syl-Skeptiker behaupten immer noch, dass es keinen Beweis dafür gibt, dass die Dinge sich so entwickeln, wie sie es gesagt hat, aber sie hat sich in ihren Vorhersagen nie geirrt, und sie ist mehr Syl als die anderen, also. Sie hat Gewiss getrunken, als würde dies den Wahrheitsgehalt erhöhen.
»Es gibt nicht das eine Böse, auf das man deuten könnte, einen einzelnen Moment, an dem sich alles geändert hat«, sprach sie weiter. »Die Dinge waren schlecht und dann schrecklich und dann besser und dann wieder schlecht, und dann sind sie erneut passiert, und wieder, weil niemand es aufgehalten hat. Die Dinge können … angepasst werden. Verlängert das Bessere, sagt das Schlechtere voraus und verkürzt es. Verhindert manchmal das Schreckliche, indem ihr wählt, was lediglich schlecht ist. Ich habe es aufgegeben zu versuchen, euch Leute aufzuhalten. Habe nur meinen Kindern beigebracht, sich zu erinnern und zu lernen und zu überleben … bis jemand irgendwann den Kreislauf durchbricht.«
Ich war verwirrt. »Sprichst du von einem Runterbrennen?« Das war es, worüber ich schließlich mit ihr sprechen wollte. Einhundert Jahre, hatte sie vor fünfzig Jahren vorhergesagt. Was sonst war noch wichtig?
Sie lächelte nur.
– Transkribiertes Interview, übersetzt vom Obelisken-Erbauer C, gefunden in Tapita Plateau Ruine #723 von Shinash Innovatorin Dibars. Datum unbekannt, Transkribent oder Transkribentin unbekannt.Spekulation: der oder die erste Kundige? Persönlich: Baster, du solltest diesen Ort sehen. Überall historische Schätze, das meiste zu zerfallen, um es entziffern zu können, aber dennoch … Ich wünschte, du wärst hier.
2
Nassun, aus der Fassung geraten
Nassun steht über dem Körper ihres Vaters, sofern man einen Haufen aus zerbrochenen Juwelen als Körper bezeichnen kann. Sie ist benommen und schwankt etwas, weil die Wunde in ihrer Schulter – wo ihr Vater auf sie eingestochen hat – heftig blutet. Der Stich ist die Folge seiner Forderung, eine unmögliche Entscheidung zu treffen: Entweder ist sie seine Tochter oder eine Orogene. Sie hat sich geweigert, existenziellen Selbstmord zu begehen. Er hat sich geweigert, eine Orogene weiterleben zu lassen. In diesem letzten Augenblick war in beiden keine Bösartigkeit, nur die grimmige Gewalt des Unausweichlichen.
Auf der einen Seite dieses Schauplatzes steht Schaffa, Nassuns Wächter. In einer Mischung aus Erstaunen und kalter Befriedigung starrt er auf das, was von Jija Resistenter Jekity übrig geblieben ist. Auf der anderen Seite steht Stahl, Nassuns Steinesser. Es ist angebracht, ihn jetzt so zu nennen, ihn als ihren Steinesser zu bezeichnen, denn in der Stunde der Not ist er zu ihr gekommen – nicht um ihr zu helfen, das niemals, sondern um ihr etwas zu geben. Was er ihr anbietet, und was sie, wie sie schließlich begriffen hat, benötigt, ist ein Ziel. Nicht einmal Schaffa hat ihr so etwas gegeben, aber das liegt daran, dass Schaffa sie bedingungslos liebt. Sie braucht diese Liebe, oh, wie sehr sie sie braucht, aber in diesem Moment, als ihr Herz ziemlich gründlich gebrochen ist, als ihre Gedanken am wenigsten fokussiert sind, da greift sie nach etwas … Festerem.
Sie wird die Festigkeit haben, die sie will. Sie wird um sie kämpfen und töten, weil sie das bereits wieder und wieder hatte tun müssen und es zur Gewohnheit geworden ist, und wenn sie erfolgreich ist, wird sie dafür sterben. Schließlich ist sie die Tochter ihrer Mutter – und nur Leute, die glauben, sie hätten eine Zukunft, haben Angst vor dem Tod.
In Nassuns gesunder Hand summt eine drei Fuß lange, konische Kristallscherbe, tiefblau und fein facettiert, wenn auch mit leichten Deformationen an der Basis, wo sich eine Art Heft geformt hat. Hin und wieder wechselt dieses seltsame Langmesser flimmernd in einen durchscheinenden, nicht greifbaren, irrealen Zustand. Aber es ist sehr real; nur ihre Aufmerksamkeit hindert das Ding in Nassuns Händen daran, sie ebenfalls in bunte Steine zu verwandeln, wie es das bei ihrem Vater gemacht hat. Sie hat Angst davor, was passieren wird, wenn sie durch den Blutverlust ohnmächtig wird, und würde den Saphir wirklich gern zurück in den Himmel schicken, damit er dort seine ursprüngliche Gestalt und gewaltige Größe wieder annimmt – aber das kann sie nicht. Noch nicht.
Dort, beim Schlafhaus, befinden sich die beiden Gründe dafür: Umber und Nida, die anderen beiden Wächter von Fundemond. Sie beobachten sie, und als Nassuns Blick auf sie fällt, flackert in den sich verschränkenden Silberranken, die zwischen den beiden wabern, etwas auf. Sie wechseln weder Worte noch Blicke, es gibt nur diese stumme Verbundenheit, die Nassun nicht bemerken würde, wäre sie nicht die, die sie ist. Unter beiden bewegen sich zarte silbrige Linien, schlängeln sich vom Boden hoch in ihre Füße, verbinden sich durch das Nerven-und-Adern-Flimmern ihrer Körper mit winzigen Eisensplittern in ihren Hirnen. Diese pfahlwurzelähnlichen Linien sind schon immer da gewesen, aber vielleicht liegt es an der angespannten Situation, dass Nassun jetzt bemerkt, wie dick diese Lichtlinien bei diesen beiden Wächtern sind – sehr viel dicker als diejenige, die den Boden mit Schaffa verbindet. Und endlich begreift sie, was das bedeutet: Umber und Nida sind Marionetten eines größeren Willens. Nassun hat versucht, etwas Besseres in ihnen zu sehen, dass sie ein eigener Menschenschlag sind, aber hier, jetzt, mit dem Saphir in den Händen und dem toten Vater vor ihren Füßen … manche Erkenntnisse können nicht auf einen passenderen Moment warten.
Also verankert Nassun einen Torus tief in der Erde, denn sie weiß, dass Umber und Nida dies spüren werden. Es ist eine Finte; sie braucht die Kraft der Erde nicht, und sie vermutet, dass die beiden das wissen. Trotzdem reagieren sie, Umber breitet die Arme aus, und Nida, die bisher am Geländer der Veranda gelehnt hat, richtet sich auf.
Auch Schaffa reagiert, blickt zu ihr hin, ohne den Kopf zu bewegen. Es ist unvermeidlich, dass Umber und Nida es bemerken werden, aber es geht nicht anders; in Nassuns Hirn befindet sich kein Teil der Üblen Erde, das die Kommunikation erleichtern könnte. Wo die Materie versagt, muss die Fürsorge genügen. Er sagt: »Nida«, und mehr ist nicht nötig.
Umber und Nida sind schnell – so schnell –, weil das silberne Gitter in ihnen ihre Knochen verstärkt und die Muskelstränge gestrafft hat, sodass sie etwas tun können, was ein gewöhnlicher menschlicher Körper nicht tun kann. Ein negierendes Pulsieren bewegt sich mit sturmflutartiger Unerbittlichkeit vor ihnen, schlägt augenblicklich auf die Hauptlappen von Nassuns Mentastzellen ein und betäubt sie. Nassun ihrerseits greift bereits an. Nicht körperlich; in einem solchen Kampf kann sie die beiden nicht besiegen, und abgesehen davon kann sie kaum stehen. Alles, was sie hat, sind ihr Wille und das Silber.
Also greift Nassun – mit reglosem Körper und brachialem Geist – nach den Silberfäden in der Luft um sich herum, webt sie zu einem behelfsmäßigen, aber wirksamen Netz. (Sie hat so etwas noch nie getan, aber es hat ihr auch noch niemand gesagt, dass man es nicht tun kann.) Einen Teil davon wickelt sie um Nida, ignoriert Umber, wie Schaffa es ihr gesagt hat. Und begreift im nächsten Augenblick, warum er gesagt hat, dass sie sich nur auf einen feindlichen Wächter konzentrieren soll. Das Silber, das sie um Nida gewoben hat, sollte die Frau rasch festhalten, wie ein Insekt, das in ein Spinnennetz gerät. Stattdessen kommt Nida stolpernd zum Halten, dann lacht sie, während Fäden von etwas anderem sich aus ihrem Innern herausschlängeln und durch die Luft peitschen, das Netz um sie herum zerfetzen. Sie stürzt wieder auf Nassun zu, die aber – einen Moment zurückschreckend angesichts der Geschwindigkeit und der Wirksamkeit des Gegenschlags der Wächterin – Gestein aus der Erde hochreißt, das Nidas Füße durchbohrt. Doch das behindert Nida nur wenig. Sie stürmt weiter, bricht die Felssplitter vom Boden ab und greift an, obwohl die Splitter immer noch ihre Stiefel perforieren. Die eine Hand hält sie wie eine Klaue, die andere formt sie zu einer flachen Klinge aus versteiften Fingern. Diejenige, die Nassun als Erstes erreicht, wird darüber bestimmen, wie Nassun mit bloßen Händen zerrissen wird.
In diesem Moment gerät Nassun in Panik. Nur ein bisschen, denn sonst würde sie die Kontrolle über den Saphir verlieren – aber eben doch ein wenig. Sie spürt einen rohen, hungrigen, chaotischen Widerhall in den Silberfäden, die durch Nida surren. Noch nie hat Nassun etwas Ähnliches wahrgenommen, und es ist furchterregend. Sie weiß nicht, was dieser seltsame Widerhall in ihr anrichten wird, wenn Nida sie auf irgendeine Weise berühren sollte. (Ihre Mutter weiß es allerdings.) Sie weicht einen Schritt zurück, zwingt das Saphir-Langmesser, sich schützend zwischen sie und Nida zu bewegen. Ihre gesunde Hand umfasst immer noch den Griff des Saphirs, und so sieht es aus, als würde sie – zittrig und viel zu langsam – eine Waffe schwingen. Nida lacht wieder, hell und erfreut, denn sie können beide sehen, dass nicht einmal der Saphir sie wird aufhalten können. Nida spreizt die Finger der Klauenhand, schwingt sie vorwärts in Richtung von Nassuns Wange, während sie sich wie eine Schlange um ihre wilden Stöße herumwindet –
Nassun lässt den Saphir sinken und schreit; ihre benommenen Mentastzellen spannen sich verzweifelt und hilflos an –
Aber die Wächter haben Nassuns anderen Wächter vergessen.
Stahl scheint sich nicht zu bewegen. In einem Moment steht er noch da, wo er die letzten paar Minuten gestanden hat, mit dem Rücken zu dem kunterbunten Haufen, der einmal Jija gewesen war, mit gelassener Miene, in lässiger Haltung, während er den nördlichen Horizont betrachtet. Im nächsten Moment ist er näher, direkt neben Nassun, hat sich so schnell hierher befördert, dass Nassun das scharfe Klatschen der verdrängten Luft hören kann. Und Nidas Vorwärtsbewegung kommt abrupt zum Halt, als Stahl sie mit einer Hand fest an der Kehle packt.
Sie schreit. Nassun hat Nida stundenlang mit ihrer vibrierenden Stimme herumschwafeln gehört, und vielleicht hat sie sich Nida deshalb als Singvogel vorgestellt, trällernd und zwitschernd und harmlos. Dieser Schrei ist der eines Raubvogels, Wildheit verwandelt sich in Raserei, als sie daran gehindert wird, sich auf ihre Beute zu stürzen. Sie versucht, sich loszureißen, riskiert dabei, dass sich Stücke ihrer Haut und ihrer Sehnen lösen, aber Stahls Griff ist so fest wie Stein. Sie ist gefangen.