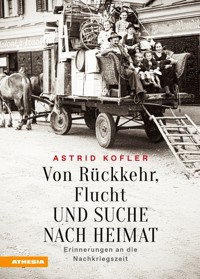Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Raetia
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wie leben wir mit dem Tod? Was ist ein guter Tod? Was wird bleiben von uns? Angesichts des Verlustes einer geliebten Person, im Bewusstsein der eigenen Endlichkeit erhält das Leben einen tieferen Sinn. Die positiven Einstellungen der Interviewten zum Tod überraschen. In einfühlsamen Gesprächen mit der Journalistin Astrid Kofler erzählen unheilbar Kranke, Angehörige, Ärztinnen und Ärzte, Begleiterinnen der Hospizbewegung und Notfallseelsorge, Theologen, Therapeutinnen, Menschen unterschiedlichen Glaubens und Alters von ihren Hoffnungen und Ängsten, von Erfahrungen im Umgang mit Sterbenden und der Trauer danach.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 391
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sterben Des Lebens heller Schatten
ASTRID KOFLER
Sterben Des Lebens heller Schatten
Gespräche
Edition Raetia
jetzt werden wir von dem hören, was niemand hören will.
jetzt hören wir von tod, death, mort, meth.
Naja Marie Aidt, aus: „Carls Buch“
Des Lebens heller Schatten, ein Plädoyer
Ich durfte noch mit dem Gefühl groß werden, dass alles so weitergehen würde wie stets. Durch die Augen meiner Kinder lernte ich neu zu sehen und realistischer: Sie müssen mit der Gewissheit ins Leben wachsen, dass auch ein Planet nicht alles erträgt. Dass er nicht unendlich ist, zumindest nicht nach unserem Verständnis von Dasein. Wir sehen der Endlichkeit ins Antlitz.
Das Sterben der Biene, auf die ich barfuß im Klee getreten bin, der Gelsen, die wir auf unseren Armen zerschlugen, von Menschen schließlich, die mir nahestanden, der Meere, des Strandes, mancher Träume und Hoffnungen machte mich nachdenklich und mitunter verzweifelt. Ich wurde wütend auf den Tod und hab nach Wegen gesucht, ihn mir leichter zu machen. Dabei war er mir nie fremd gewesen.
Schon als Kind stellte ich mir vor, wie es sei unter dunkler Erde zu liegen, als Jugendliche verbrachte ich Stunden am alten Grieser Friedhof, las immer und immer wieder Texte und Namen auf den Grabsteinen, wurde vom damaligen Pfarrer vor einer Jungscharmesse gerügt, weil wir das Altartuch so stark schüttelten – um abgefallene Blütenblätter zu entfernen –, dass es wie ein Leichentuch auf die Erde flog.
Als Erwachsene führte mich jede Reise unweigerlich auch auf Friedhöfe: die alten jüdischen in Wien, Budapest und Prag, den wie von Gitterbetten bestückten in Soweto, die mit Mosaiken geschmückten Saadian Gräber in Marrakesch, die Nekropolen der Etrusker, die Kriegsgräberstätten in der Normandie, Père Lachaise in Paris, die Katakomben von St. Peter in Salzburg, auch die nur kleinen Friedhöfe in Griechenland, Irland, Cornwall oder, in Südtirol, St. Peter am Sonnenberg und den Waldfriedhof in Bruneck. Stundenlang saß ich in Kathmandu und Varanasi und sah dem Abschiednehmen der Männer zu, dem letzten Waschen mit heiligem Wasser, dem Schmücken des Leichnams mit Blumenketten, dem Verbrennen des Körpers.
Der Tod hatte es mir schon immer angetan. Ich liebte Georg Trakls Gedichte, Rainer Maria Rilkes „Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge“, Thomas Manns „Der Zauberberg“, Goethes „Werther“, die Werke von Ingeborg Bachmann, Franz Kafka und Paul Celan. Und natürlich Albert Camus’ „Die Pest“ und Erich Maria Remarques „Im Westen nichts Neues“. Ich wurde auch ermahnt deshalb, vielleicht aus der Befürchtung, dass meine Affinität zum Tod eine Sehnsucht, eine Verherrlichung sein könnte.
Was Tod als Verlust bedeutet, spürte ich erstmals, als mein Vater starb. Dass er an seiner degenerativen Erkrankung des Nervensystems sterben würde, wussten wir. Man sagte uns, es könnte noch Jahre dauern. Mit Herzversagen hat er sich am Samstag unerwartet verabschiedet, nachdem Atemapparate und künstliche Ernährung am Freitag erstmals ausprobiert worden waren. Dass an Krankheiten oder an Altersschwäche Sterbende unbewusst bewusst den Zeitpunkt ihres Todes mitbestimmen, dass gerade an solchen Diagnosen leidende Patienten sich heute um ein würdiges Sterben, einen ärztlich assistierten Suizid bemühen, weiß ich erst jetzt. Das logische Ende meines Vaters wäre ein qualvolles Ersticken gewesen.
Als er starb, verspürte ich Zorn, was ich mir nachträglich vorwarf. Auch das, lernte ich später, gehört zur Trauer dazu. Auch dass das Feiern nach dem Begräbnis spätabends, in der Küche, mit Spaghettata und Wein, nicht verwerflich war. Und mit der Zeit erfuhr ich, dass es ganz normal sei, dass ich noch mit ihm rede, ihm von Wichtigem und Zweifeln erzähle, ihn um Zeichen und Rat bitte. Wirklich tot ist erst, wer vergessen wird, sagt eine der Interviewten.
Als er starb, wusste ich, ich möchte Kinder haben. Ich wollte immer schon Mutter werden, irgendwann. Es war an der Zeit. Als mir – zehneinhalb Monate später – bei einem Notkaiserschnitt mit Vollnarkose mein erster Sohn entbunden wurde, das kleine blutige Bündel in den Brutkasten musste, sein Papi mir nur ein Video zeigen, ich ihn nicht halten durfte, war ich wortlos glücklich, dass er es geschafft hatte, und unheimlich allein. Monatelang hatte ich ihn in mir gespürt, mit der Geburt war er nicht mehr Teil von mir, jetzt war ich wieder nur mein Körper, ohne Kind. Ein neuer Mensch war geboren. Ein kleines Wuzerl, hungrig. Ein Großer, jetzt. Seine Ankunft war ein Geschenk, für das ich lange keine Worte hatte, sie war auch ein Abschied, ein Loslassen.
Mit der Geburt meiner Kinder lernte ich den Tod anders zu fürchten, ich begann mich zu sorgen.
Der Tod von Kindern führt an eine Grenze jenseits alles Fassbaren. Eine Mutter erzählt in diesem Buch, wie ihr Sohn nun wieder in sie zurückgekehrt sei, sie trägt ihn, die Erinnerung an ihn, sein Wesen wieder in ihrem Körper. Er ist stets bei ihr. Doch anders, natürlich, wäre es ihr lieber.
Der natürliche Umgang mit dem Tod ist verloren gegangen. Im 20. Jahrhundert wurde er zum Tabu, vielleicht waren zu viele auf den Schlachtfeldern gestorben, vielleicht haben sich die Menschen, hat sich die Medizin überschätzt. Die Friedhöfe wurden aus dem Zentrum an den Stadtrand verlegt, die Menschen sterben – wenn ihr Leben gar nicht mehr zu verlängern geht – fast nur mehr im Krankenhaus. Über den Tod zu reden, wurde zur Provokation.
Zwei Monate vor seinem Tod saß mein Vater abgemagert mit Hosenträgern auf dem bequemsten Lehnstuhl, den wir hatten. Wie schön du bist, sagte ich, mit den Hosenträgern. Mach doch ein Foto von mir, sagte er, ein Totenbilderl für die Zeitung. Er wollte reden, über sein Sterben. Meine Mutter sagte, du wirst wieder gesund, ging in die Küche und weinte. Ich war nicht stark genug, habe ihre Bitte darüber zu schweigen respektiert. Natürlich hielt sich der Tod nicht an die statistische Lebenserwartung, es war zu früh, mein Vater war damals drei Jahre älter als ich jetzt. Heute würde ich ihn fragen, ob er Angst hat. Ich würde versuchen einen Raum zu eröffnen, dass er nicht so alleine ist mit dem, was ihn beschäftigt, ich würde leise vortasten und ihm die Möglichkeit geben zu reden, worüber er reden möchte. Ich weiß, er wollte uns nicht belasten. Und wir wollten ihn schützen – und auch uns. Wir wollten es nicht wahrhaben und nichts an- und aussprechen, um ihm die Hoffnung zu lassen und vielleicht vor allem uns selbst. Damals, vor 25 Jahren, ging meine Mutter in die Küche und rief mich zu sich. Er stirbt nicht, sagte sie, er wird wieder gesund.
Als ich mich innerlich zu wehren begann, zwei Monate später, konnte ich nur mehr seine Hand halten, bei ihm sitzen, er konnte nicht mehr sprechen. Meine Eltern hatten wundervolle Freunde, die auch einfach nur bei ihm saßen. So gesehen war er nie allein. Als er am Aschermittwoch abgeholt wurde – drei Tage vor seinem Tod –, nicht um zu sterben, sondern um diese Maschinen auszuprobieren, für später, stand einer seiner Freunde bei uns im Garten, schnitt die kleinen Obstbäume, sah ihm nach und weinte. So weit weg war der Tod von unserem Zulassen, dass ich nicht verstand, warum er weinte. Wir haben möglichst viel gelacht in der letzten Zeit, Anekdoten aus der Kindheit erzählt, ich habe ihm absurde Literatur vorgelesen. Vermeintlichen Nonsens von Daniil Charms.
Damals, vor 24 Jahren, ging ich zu einem Psychologen und fragte ihn, wie ich damit fertig werden könne, nicht aufbegehrt, ihm im Sterben nicht Ernst und Würde gestattet zu haben, die ihm gebührten. Er sagte, du bist die Tochter. Sie ist seine Frau. Sie war vor dir. Für eine kurze Zeit war ich mit dieser Aussage zufrieden.
Selbst in Zeiten von Covid-19 wurde vom Tod möglichst wenig gesprochen. Dabei wissen wir, dass es so nicht ewig weitergeht, wir wissen, dass wir endlich sind, dass sich morgen, heute, vielleicht gleich schon alles ändern könnte. Wir könnten sterben oder, vielleicht noch viel schlimmer, es könnte an der Tür klingeln, zwei Polizeibeamte könnten vor der Tür stehen und zwei Freiwillige der Notfallseelsorge. Über dem Tod liegt – bei uns – ein gesellschaftliches Schweigen. Zugleich ist er allabendlich Thema im Fernsehprogramm, Krimis verkaufen sich besser als jede andere Literatur. Leichen dienen der Unterhaltung. Ist ein Fall aufgeklärt, kann der nächste beginnen. Im Leben wird er lieber verdrängt. Der Tod – das sind Daten, das ist Statistik, das sind nicht wir.
Wir sind es doch. So habe ich bei einigen Mitarbeiterinnen der Hospizbewegung vorzufühlen begonnen, was sie von einem Buch über das Sterben halten würden, und ich habe den Verleger Thomas Kager gefragt. Das Thema interessierte ihn. Und doch hat er kurz gezweifelt. Wollen wir darüber lesen? Ich bin überzeugt, dass wir wollen. Wirst du denn genug Interviewpartnerinnen und -partner finden? Ich war auch davon überzeugt, stöberte in meinem Kopfarchiv nach Menschen, denen ich im Laufe meines Lebens begegnen durfte oder denen ich längst schon begegnen wollte, von denen ich überzeugt war, dass sie sich öffnen würden, bereit wären, davon zu sprechen. Alle, die ich dann fragte, manche per E-Mail, die meisten übers Telefon, haben sich bereit erklärt. Am liebsten hätte ich noch viele weitere mehr gefragt, ich konnte fast nicht mehr aufhören, obwohl ich wusste, die bereits bearbeiteten Gespräche sprengten bereits alle vertraglich ausgemachten Seitengrenzen. Der Verleger hatte am Anfang noch zu bremsen versucht, dann ließ er mich schreiben und gab mir Halt, die Gespräche ließen sich nicht einfach kurz und bündig beenden, wir können uns dem Thema nicht entziehen, es zu verdrängen kostet so viel Energie, und am Ende sitzen wir da und schütteln den Kopf: Was hab ich bloß mit meinem Leben gemacht, warum hab ich Nichtigkeiten so viel Aufmerksamkeit geschenkt, warum habe ich missachtet, was und wer wirklich zählt? Es war intensiv, manche haben geweint, ab und zu habe ich mitgeweint, immer war es heilsam.
„Solange wir den Tod als Niederlage sehen, etwas, das es eigentlich nicht geben darf, werden wir uns schwertun“, sagt eine der Interviewpartnerinnen in diesem Buch. „Der Tod gehört zum Leben dazu“, sagen alle. „Der Tod ist eine Lebensaufgabe, nicht erst zuletzt“, so bringt es einer auf den Punkt. So sehe auch ich es. Es ist nicht der Tod, der dem Leben Sinn gibt.
Den müssen wir unserem Leben schon selbst geben. Der Tod – nicht ausgeklammert – lässt es bewusster werden.
Als Gründungsmitglied des Krah-Forumtheaters brachte ich vor dreizehn Jahren die Endlichkeit auf die Bühne. Ich spielte eine sterbende Frau, ihr Mann besucht sie am Krankenbett, sie sprechen über dies und jenes, das Lebensthema Tod umgehen sie. Es war kaum auszuhalten für die Zusehenden, sie unterbrachen – wie es Ziel des Forumtheaters ist – immer wieder das Spiel, warfen Sätze in den Raum, die die anderen Mitspielenden aufnahmen, um das Gespräch des Paares in neue Bahnen zu lenken. Einmal waren meine Kinder in der Vorstellung, ich hatte sie, den Bedenken anderer zum Trotz, mitgenommen, wie auch damals, als sie klein waren und ihre Großmutter tot im Krankenhaus lag, die Augen in dunklen Höhlen, mit Kinnstütze aus Kunststoff. Während ich nun auf der Bühne auf dem Krankenbett saß und mit dem Schauspielgatten übers Wetter plauderte, kamen – auch das gehört zu dieser Form des interaktiven Theaters, dass Zuschauende nicht nur Worte einwerfen, sondern auch selbst spontan mitspielen – die zwei älteren meiner drei Kinder auf die Bühne, setzten sich zu mir aufs Sterbebett und begannen davon zu reden, dass der Hund des Nachbarn gestorben sei, dass sie nun traurig wären, der Nachbar gesagt hätte, das gehöre zum Leben, dass stirbt, wer geboren wird. Sie haben es geschafft, auf das Thema zu lenken, das wir – auf der Bühne natürlich mit Absicht – auf alle Fälle vermeiden wollten: Mein Schauspielgatte wollte mich schonen und ich ihn. Jetzt aber konnten wir nicht mehr schweigen, wir mussten benennen, worüber nicht zu sprechen sehr schade wäre.
Die Ausgangsposition für dieses Buch und die Interviews war eine entschiedene, wobei ich versucht habe diesen meinen Zugang zurückzuhalten, nicht zu suggerieren: Das Wissen um unsere Endlichkeit ist ein Geschenk. Wie anstrengend muss es sein, wenn es unendlich wäre. Das Leben gut zu leben hat immer einen Sinn. Ob ich nur dieses Leben habe und dann nichts mehr ist. Ob dieses Leben eine Etappe ist, Perle in einem Zyklus, und irgendwo anders irgendwie weitergeht. Das Leben ist ein Angebot, es hängt von mir ab, welchen Wert ich ihm gebe. Es ist meine Wahl. Natürlich, wenn ich frei bin und wählen kann. Es gibt auch Menschen, die nicht leben wollen. Wir werden, wie ein Interviewpartner sagt, nicht gefragt, ob wir leben wollen.
Jedes Leben, jedes Sterben, jede Familie, jeder Trauerprozess ist individuell, jeder Mensch braucht eine andere Begleitung, auf seine Weise Respekt. Jede und jeder verdient sich ein Sterben in Würde, so, wie sie, wie er es selbst sich wünscht. Jede und jeder soll anerkannt werden in der Art des Trauerns, ob sie jahrelang auf den Friedhof geht, um dort in Gedanken zu verharren, ob er auf Gipfel läuft und im Tun den Schmerz zu strukturieren versucht, in der Bewegung sich befreit. Zur Trauer gehört auch die Furcht des Vergessens, die Angst, dass die Stimme eines geliebten Menschen, sein Blick, sein Sein mit der Zeit vergehen, dass das Fehlen irgendwann gleichgültig wird. Dass das Annehmen der Tatsache Heilung sein könnte, dass das allmähliche Verschwinden des Gefühls der Nähe zugleich unerträglich ist.
Das mit meinem Vater nie geführte Gespräch bewog mich, endlich, 20 Jahre nach seinem Tod, die Ausbildung zur ehrenamtlichen Mitarbeiterin in der Caritas-Hospizbewegung anzugehen, lange schon war es mein Wunsch gewesen, nachdem ich zuvor mehrere Jahre in Altersheimen vor allem mit Demenzkranken Nachmittage verbringen durfte. Als Clown durfte ich lachen, musste ich mit ihnen lachen. Als es einmal ernst geworden war – weil es sich so ergab, es so werden wollte –, hat mich das Pflegepersonal des Altersheims zur Aussprache zitiert: Ich sei hier, um die Leute aufzuheitern, nicht um vom Tod zu reden, der sei hier kein Thema. Da wusste ich, dass ich dort nicht mehr Clown sein wollte. Dass ich überhaupt nicht mehr Clownfrau sein wollte.
Der Anspruch der Hospizbewegung „Leben in Würde – bis zuletzt“ ist ein hoher, wir lernten mit vier Ohren zuhören und beobachten. Wir lernten einfach nur da zu sein. Wir lernten, niemals zu werten. Wir übten, jemandes Hand zu halten: unsere darunter, nie über der anderen. Unsere darunter, auf dass die Patientin, der Patient, die alte, sterbende Person, ihre zurückziehen könne. Festhalten, zwingen dürfen wir nicht.
Nicht immer sprechen wir – in der Begleitung alter Menschen – vom Tod, vielleicht sprechen wir auch kein einziges Mal davon, doch etwas spielt sich immer ab, wenn miteinander geredet wird, wenn wir beieinander sitzen: Beziehung.
Dass wir heute vom medizinischen Aspekt her, vom Gesichtspunkt der Schmerzen und des Leides, vor dem Tod nicht mehr Angst haben müssen, sagen alle Ärzte in diesem Buch. Dass wir uns vor dem Tod nicht fürchten brauchen, berichten fast alle, die dem Tod bereits nah waren. Menschen, die eine Nahtoderfahrung erlebt haben, erzählen, dass ihre Einstellung zum Leben nun eine viel ruhigere sei. Dass sie zugleich gelernt hätten, achtsam zu sein, dem Leben mehr Aufmerksamkeit zu schenken, da sie wissen, wie wenig es bedarf: ein falscher Schritt im steilen Gelände. Ein wenig Müdigkeit hinter dem Steuer. Ein fallender Baumstamm. Eine Krise.
Im September 2013 hatte ich das Glück einer Nahtoderfahrung. Es war nicht eine mit dem Tunnel und dem Licht am Ende, ich war auch nicht bewusstlos und ich trat auch nicht aus meinem Körper, um über mir zu schweben, mich selbst mit objektiven Augen zu sehen. Ich war nur dem Tode sehr nahe, hatte aber in diesen Sekunden nicht einmal dafür die Zeit, dies bewusst zu bedenken.
Kurz unter dem Grat am Seelenkogel rutschte ich aus, ich schlitterte, überschlug mich, purzelte über Schotter hinunter. Die Bergretter – an dieser Stelle gebührt ihnen nochmals mein Dank, der mir damals als Leserbrief nicht abgedruckt wurde, da es zu viele derartige Leserbriefe gäbe – sagten, es waren 70 Meter. Das Leben lief vor mir ab wie ein Kinofilm. In Zeitlupe. Und ich dachte, es ist gut so, ich bin müde, ich darf gehen. Es war so erleichternd, so wundervoll entspannt, so geschmeidig, obwohl Steine und Felsen Wunden rissen. Bis da ein Engel stand, mit weitem weißem Gewand, ausgebreiteten Armen und geöffneten hellen Flügeln, viel größer als ich. Er hielt mich zurück. Er ließ mich nicht gehen. Die Nebel zogen erst eine viertel Stunde später auf. Es war noch Zeit für die Flugrettung, mich zu bergen. Und ein junger Mann, ganz in der Nähe, der mich zuvor überholt hatte, ohne Rucksack, nur mit einem Rotkreuzbeutelchen festgezurrt an der Hose, der uns gewarnt hatte, wir sollten nicht weiter hochgehen, der umgedreht war auf dem Grat, da es rutschig war und ein wenig Neuschnee lag, kroch auf dem Bauch zu mir, zog mich am Gürtel etwas hoch, wickelte mich in eine Decke, zog ein weißes Tuch aus dem Beutel und winkte den Flugrettern, mir schien es wie eine Friedensfahne. Meine Augen waren voller Blut, ich konnte nichts sehen und sah alles. Ich zitterte und fror und er gab mir Wärme. Der Kameramann, eine meiner treuesten Freundschaften in den vergangenen bald dreißig Jahren, der es von der Hütte aus beobachtet hatte, meinte später, das war, damit die Flugrettung wusste, wie es um den Wind stand.
Im Krankenhaus hatte ich Zeit zum Denken. Dass ich bereit gewesen wäre zu gehen, dass ich es als erleichternd empfand, bekümmerte mich sehr, war ich doch Mutter von drei kleinen Kindern. Dass ich eine Aufgabe habe, das denke ich mir seitdem täglich. Dass das Ende vorbestimmt ist und das Gehen nicht erlaubt, wenn der Zeitpunkt noch nicht da ist, dessen bin ich mir sicher. Dass ich das Gespräch suche und niemals mehr mich in Streit von jemandem trennen möchte, dass ich jeden Moment bereit bin zu gehen und alles gesagt haben möchte, dass ich nicht am Sterbebett liegen und denken möchte, ich hätte noch dies und jenes zu tun gehabt, dass ich niemals ein „jetzt ist es zu spät“ haben möchte, all das beherzige ich Tag für Tag. Dass ich von anderen Menschen, die eine ähnliche Erfahrung gemacht hatten, hörte, dass auch sie es so wunderschön empfunden hatten und kaum mehr zurückwollten, entband mich von Selbstvorwurf und schlechtem Gewissen.
Und ich bin noch neugieriger geworden auf das Leben. Ich möchte noch mehr hören, reden, austauschen, tun, angehen, erfahren, ich möchte noch mehr nachdenken, Freunden gegenüber auch Unangenehmes erwähnen. Ich möchte aufmerksam sein, Fragen stellen: Was ist wirklich wichtig? Für dich? Für mich?
Und ich bin jeden Tag dankbar für dieses Leben. Ich bin dankbar, dieses Buch schreiben zu dürfen, da ich heute keine Angst habe vor dem Tod. Angesichts der Jahrtausende Menschheit ist er nichts. Vielleicht werde ich morgen Angst haben, wenn es so weit ist. Vielleicht ist ein kleines Angst-Haben auch gar nicht so schlecht. Ein Interviewpartner erklärt, dass gerade diese kleine Angst uns unser Leben bewusster und tiefer leben lässt. Angst hat etwas Gutes, ist sinnvoll, wenn sie nicht lähmt. Wenn sie Anlass gibt, sich mit einem Thema zu beschäftigen.
Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, so wäre es, nicht einfach nur einzuschlafen eines Nachts und nicht mehr zu erwachen. So einen schnellen Tod möchte ich nicht. Es wäre schön, Abschied zu nehmen und zu trösten, da zu sein, wenn die Kinder vielleicht noch Fragen haben. Den Tod als einen Übergang in etwas Neues zu feiern. Vielleicht ist er es auch nicht. Vielleicht ist er tatsächlich nur das Ende.
Ich habe im Laufe der letzten dreißig Jahre – seitdem ich Journalistin bin – mit vielen alten Menschen gesprochen. Ein alter Witwer hat mir erzählt, wie seine Frau über dramatische Ereignisse in ihrem Leben jahrzehntelang geschwiegen hätte. Sterbend endlich brach sie ihr Schweigen und hielt zwei Nächte lang seine Hand. Zuvor, so sagte er, hatte sie es nie getan. Er war so unendlich dankbar dafür. Und mit ihm waren es auch seine Kinder. Wie schön, dachte ich damals, dass sie Frieden machen konnten, bevor sie ging. Dass auch er dadurch endlich Frieden fand. Wie traurig, dachte ich auch, dass sie sich so viel Zeit gelassen hatte, wie schade, dass sie zuvor nie sprechen konnte über das, was ihr, bevor sie ihn kennengelernt hatte, widerfahren war. Ihrer beider Leben hätte um so vieles leichter sein können.
Wie unwichtig ein unaufgeräumtes Zimmer, der Streit um eine Nichtigkeit ist, angesichts des Todes, erzählt eine Notfallseelsorgerin in diesem Buch. Das Letzte, was eine Mutter mit ihrem Sohn besprochen hatte, bevor er das Haus verließ, war dieses Chaos in seinem Raum gewesen. Wie relativ wurde dies, als er kurz darauf tödlich verunglückte.
Ich habe noch nicht viele Tote gesehen in diesem Leben. Meinen Vater, die zu Hause aufgebahrte wunderschöne Tochter von Freunden meiner Eltern, einen jungen, an Magenkrebs erkrankten Obdachlosen, der es geschafft hatte, 2011 aus Niger über das Mittelmeer nach Italien zu fliehen, um hier in Freiheit leben zu können, und mir dann sterbend die Lektüre von Salman Rushdis „Des Mauren letzter Seufzer“ empfahl, einen der ersten Biobauern und Meditationslehrer aus dem Vinschgau, mit dem ich einst das Maha-Kumbh-Mela-Fest am heiligen Ganges besuchte, und meine Schwiegermutter. Sie hatte sterbend öfters gefragt, ob sie denn immer noch hier sei oder endlich dort. Ihr schon vor Längerem verstorbener Mann Edi würde warten, sie möchte zu ihm. Sie hat, als sie im Spätsommer an der Schwelle stand, den Arzt gebeten, sie nochmals zu operieren, sie wollte noch leben, zwei Wochen, bis alle Kinder da waren, und tatsächlich, nachdem der Letzte gekommen war, just in dem Moment setzte der Pulsschlag aus. Auch meine Großmutter hatte auf ihren Jüngsten, meinen Vater, gewartet und losgelassen, als sie sein Auto hörte, unten im Hofraum.
Manche harren des Moments, in dem sie alleine sind, andere, bis sich endlich alle um das Bett versammelt haben. Manche fühlen sich gerufen und abgeholt. Einige wünschen sich endlich zu sterben. Manche sterben plötzlich. Einige viel zu früh. Als hätten sie nur eine Botschaft überbringen wollen. Und vielleicht auch nicht mal das. Der Tod stellt viele Fragen. Antworten gibt es nicht immer.
Das Leben ist eine Grenzsituation und voller Wunder. Unser Sterben ist es auch.
IRENE VOLGGER
„Die Trauer braucht Zeit.“
Geboren 1958 in Tscherms, studierte Kunstgeschichte und Komparatistik, Psychologie und Pädagogik. Ehemalige Waldorfmama, systemische Supervisorin, Coachin und Lebensberaterin, begleitet freiberuflich Menschen im beruflichen Veränderungskontext sowie auf schwierigen Lebens- und Trauerwegen. Sie ist seit 20 Jahren in der Trauerbegleitung tätig, leitet eine Selbsthilfegruppe für trauernde Eltern, ist Koordinatorin der Caritas-Hospizbewegung in Meran.
Trauern ist ein schwerer Weg, doch ein Weg, der das Leben mit neuer Tiefe beschenkt, er kann uns Menschen weiterbringen. Es gibt oft ein Vorher und ein Nachher. Ein Vater erzählte mir nach dem Tod seines Sohnes, dass er nun neue Freunde habe, andere Schwerpunkte im Leben und immer gehe es in Richtung Lebenstiefe und Lebenssinn.
Ich selbst frage die Trauernden nie, ob sie nachträglich im Ereignis einen Sinn sehen. Das steht mir als Außenstehende nicht zu. Ich kann es höchstens unterstützen, in diese Richtung zu gehen. Viele Trauernde fragen sich aber irgendwann selbst, was hat das für einen Sinn, dass es so geschah, was will mir das sagen. Das ist auch etwas, das sich Sterbende oft am Lebensende fragen. Was hatte es für einen Sinn?
Das Trauern umschreibe ich oft gerne mit einem Bild. Es ist eine Landschaft, die man durchwandert. Es braucht Zeit. Am Anfang gleicht es dem anstrengenden Aufstieg auf einen hohen Berg, dann ist es wieder ein abrupter Abstieg. Es geht hinauf und hinunter, manchmal führt der Weg durch eine enge Schlucht. Dann weitet sich wieder der Blick auf die Landschaft. Es wird leichter mit der Zeit, aber bleibt ein Leben lang ein Prozess. Es gibt Tage oder Momente, Weihnachten oder Allerheiligen, der Geburtstag oder Todestag, dann ist das Trauern wieder intensiv.
Jeder trauert anders. Das Abschiednehmen ist eine Herausforderung, die 80 Prozent der Hinterbliebenen alleine schaffen, mit Freunden, mit der Familie, mit eigenen Kräften, mit dem Glauben, mit der Natur. Manche aber brauchen Begleitung, und es ist richtig, wenn sie Hilfe suchen. Mitmenschen können Trauernde unterstützen, indem sie sie ernst nehmen, in ihrer Trauer gut wahrnehmen, sie nicht in Abhängigkeit bringen, sie nicht nur bemitleiden. Wenn eine Person in ihrer Trauer verharrt, ist es angebracht, sie dahingehend zu unterstützen, dass sie sich professionelle Hilfe sucht. Aber es darf nicht wertend vermittelt werden in dem Sinne: Du musst jetzt in professionelle Hände.
Früher hieß es stets: loslassen.
Loslassen ist für mich schon fast ein Unwort. Loslassen muss ich einen Sterbenden. Ich kann ihm sagen, ich lass dich gehen auf deinem Weg. Aber zu Trauernden darf man nicht sagen, sie sollten loslassen. Trauernde berichten immer wieder, das sei so, wie wenn jemand sagen würde, du musst jetzt vergessen. Das geht nicht. Vielleicht könnte ich raten, lass es sein, nimm es an, wie es ist, versuch den Weg unter diesem neuen Aspekt zu gehen.
Was ich loslassen kann, ist, wie die Person im Leben war. Was bleibt, ist das Herzensbild. Ich behalte dieses bei mir, in Erinnerung an diese Person, die mir lieb war, oder vielleicht auch nicht immer lieb war, aber zumindest eine wichtige Bezugsperson. Trauerbegleitung bedeutet für mich, einen Menschen darin zu unterstützen, Erinnerungen zu schaffen. Das tut auch innerhalb von Familien gut, miteinander über den Verstorbenen zu reden. Oder eben auch alleine, ein Tagebuch zu schreiben, Momente zu notieren.
Man sprach auch lange von vier Trauerphasen, dem ersten Schock und dem Nicht-wahrhaben-Wollen, der Wut und Verzweiflung, der Suche nach Antworten, der Annahme und der Neuorientierung.
Heute spricht man auch in der Wissenschaft nicht mehr von Phasen. Weil die Trauernden in Schwierigkeiten gerieten, wenn man ihnen vermittelte, du bist jetzt nicht in der „richtigen“ Phase, du solltest jetzt so trauern oder anders. Es kann passieren, dass diese Phasen gleichzeitig ablaufen. Auch wurden die Trauernden damit ein wenig in die Passivität gedrängt, als müssten sie den Ablauf dieser Phasen einfach überstehen. Von den Phasen ging man weg zu den Aufgaben nach William Worden. Dieser amerikanische Trauerforscher hat ein Modell mit fünf Traueraufgaben entwickelt, um Menschen nach dem Verlust einer geliebten Person zu helfen, ihre neue Situation zu akzeptieren. Trauer als Prozess, aber nicht als Zustand. Aber da hat man ein wenig den Eindruck, als ob man etwas schwer erarbeiten müsste, erst dann ist es vorbei.
Wir sprechen heute weder von Phasen noch von Aufgaben, sondern einfach vom Trauerweg. Oder dem „Trauer-Erleben“. Wir wissen, dass alles zugleich sein kann. Wir wissen, dass es am Anfang schwer ist, diese Situation anzuerkennen. Wir wissen, dass am Anfang ein Schock da ist und diese Schocksituation auch später momenthaft wieder da sein kann, wir wissen, dass es Momente gibt, wo ich es nicht annehmen kann und dann doch wieder annehme. Ich erwache am Morgen und denke mir, es ist nichts geschehen, und nach einer Stunde weiß ich, es ist doch geschehen. Es gibt eine Gleichzeitigkeit von Situationen, die den Menschen überfallen, und dann doch wieder ein lineares Weitergehen. Die Trauer braucht Zeit. Wir sprechen nicht mehr von einem Trauerjahr. Wir sprechen heute von mehr oder weniger vier Jahren akuter Trauerzeit, das zu wissen, ist tröstend.
Die Trauer ist so viele Jahre lang akut?
Das ist die Dauer, in der die Trauer sehr nahe ist. Das zweite Trauerjahr – so haben wir beobachtet – ist eine der schwierigsten Zeiten. Da beginnt erst die wirkliche Anerkennung dessen, was passiert ist. Dann kommt so langsam der Weg, wo man es annehmen kann, wo man zu überlegen beginnt, es gibt auch ein Leben und Überleben ohne den geliebten Menschen.
Es gibt ganz unterschiedliche Reaktionen und Emotionen. Einige werden wütend und machen sich deshalb dann Vorwürfe. Andere werden still …
Wenn wir von der emotionalen Betroffenheit ausgehen, so haben wir die ganze Palette an Gefühlen: Sehnsucht, Freude, Wut, Aggression, Rückzug. Wir können Menschen suchen oder meiden, körperlich stumm werden oder aktiv. Ich habe einmal ein Mädchen begleitet, das tanzen musste, um seiner Trauer Ausdruck zu verleihen.
Wir müssen uns verdeutlichen, dass wir in einem sozialen Netz sind und doch alleine, auch das ist ein Zwiespalt. Ich bin in der Trauer umgeben von lieben Menschen und doch betrifft die Trauer nur mich. Es gibt kein falsches Emotionserleben in der Trauer, weil die Trauer so ausgerichtet ist, wie ich als Mensch auf dem Weg bin. Und das ist individuell.
Natürlich ist es gekoppelt mit einem schlechten Gewissen oder mit Schuldgefühlen, wenn die Gesellschaft diesen individuellen Trauerweg nicht anerkennt. Das Umfeld ist manchmal nicht sehr verständnisvoll, wenn es sagt, der tut nix, der trauert nicht, der geht ins Fitnesscenter. Die Trauer ist ein emotionales Gewebe, kann aber einen körperlichen Ausdruck finden.
Männliche und weibliche Trauer: Gibt es da Unterschiede?
Meine Erfahrung zeigt mir, dass sich männliche und weibliche Trauer oft unterschiedlich äußern. Männliche Trauer geht häufig ins Tun. Der Vater eines verstorbenen Sohnes sagte mir, zuerst muss ich meinen Körper müde machen und dann kann ich erst nachdenken, zuerst habe ich auf meine Frau geachtet und dann kam ich. Das ist wichtig zu wissen, für beide, du trauerst so und ich so. Die Frauen ziehen sich eher zurück oder suchen Gespräche, sie haben Rituale, zünden eine Kerze an. Für Männer kann das zu viel an Emotion, zu eng werden. Wenn beide wissen, dass sie unterschiedlich trauern, dann können sie einen Weg suchen, den sie gemeinsam gehen, einmal geht er mit ihr und einmal sie mit ihm. Ein junges Paar, Eltern eines totgeborenen Kindes, erzählte mir, einen Sonntag gehen wir kuscheln, den nächsten auf den Berg.
Wir sehen keine Toten mehr, ist das Trauern deshalb schwierig geworden?
Wir haben das Projekt „Hospiz macht Schule“, wo wir mit Kindern über das Sterben reden. Kinder sind überfordert, doch wenn das System rundherum gut zurechtkommt, wenn die Eltern es mitnehmen zur verstorbenen Großmutter, mit zum Begräbnis, dann kann ein Kind verstehen. Viele behalten heute die Urne zu Hause. Ich sehe das etwas skeptisch. Ich glaube, wenn ich tagtäglich die Urne sehe, muss ich immer wieder die Frage stellen, warum ist das passiert. Da kann ich mich nicht auf den Weg machen, es so sein zu lassen.
Wir Menschen haben die Fähigkeit der Trauer mitbekommen, sie ist nicht das Problem, sie ist die Lösung. Dieses Gefühl hilft mir, diesen schweren Weg zu meistern.
VERENA WACHTER SPIRIDON DOVAS
„Auf den Tod des eigenen Kindes kann man sich nicht vorbereiten.“
Verena Wachter
Geboren 1969 in Graz, in Bozen aufgewachsen, hat in Wien und Florenz Kunstgeschichte und Innenarchitektur studiert. 20 Jahre lang arbeitete sie im Amt für Film und Medien, jetzt beim Katholischen Familienverband.
Spiridon Dovas
geboren 1960 in Messolonghi in Griechenland. Er hat in Florenz Pädagogik studiert, ist Erzieher bei der Sozialgenossenschaft Südtiroler Kinderdorf.
Sie leben am Ritten, haben zwei erwachsene Söhne. Tochter Dania, das jüngste ihrer Kinder, kam mit einem angeborenen Herzfehler zur Welt, sie ist am 21. Dezember 2020, mit knapp 18 Jahren verstorben.
spiridon dovas: Der Tod ist etwas Natürliches. Schwierig wird es, wenn die regulären Zeiten missachtet werden, wenn ein junger Mensch stirbt. Oder bei einer gesundheitlichen Situation, wie sie unsere Dania hatte. Man hofft dann doch immer, dass es noch ein Stückchen weitergeht und noch ein Stückchen. Als wir nach Padua fuhren, zu ihrer Herztransplantation, hatten wir nicht Angst. Wir waren voll Vertrauen, dass die Operation gut gehen würde, dass sie endlich das Leben führen könnte, das sie sich so sehr wünschte. Und wenn auch nur mit ihren Freundinnen tanzen zu gehen. Die Realität hat uns dann eingeholt.
Wir kannten ähnliche Situationen, in denen alles gut gegangen ist. Wir haben bis zuletzt gehofft. Auf ein Wunder. Dass sie aufwacht, dass sie uns ein Zeichen gibt.
Wir glauben doch, dass wir das Richtige getan haben, die Transplantation zu versuchen. Sonst wären ihre Schmerzen noch schlimmer geworden. In der Zeit vor ihrem Tod waren wir oft im Krankenhaus, ihr Zustand war prekär geworden. Wir waren auf dieser Liste und haben auf ein neues Herz gewartet.
verena wachter: Es ist ganz schnell gegangen. Es war der 4. Dezember, spät am Abend, ich bekam einen Anruf von einer unbekannten Nummer und habe abgenommen, im Glauben, es sei Jannis, der zweite unserer Söhne. Er war nicht zu Hause und hat immer wieder mit unbekannten Nummern angerufen, wenn sein Handy einen leeren Akku hatte, das gab es öfters. Ich habe den Anruf entgegengenommen und gefragt: „Ja, was ist denn?“, so beiläufig. Und dann hat eine Stimme auf Italienisch gesagt: „Signora Dovas? Ich bin Chirurg, wir hätten ein Herz für eure Tochter Dania.“ Es war ein Freitag, Dania war schon im Bett. Was tust du in diesem Moment? Spiridon ist zu ihr ins Zimmer. Sie war aufgeregt und begeistert. Große Aufruhr. Innerhalb einer Stunde haben wir sie hergerichtet, noch die Haare gewaschen, die Tasche gepackt, die Ambulanz gerufen.
In jener Nacht hat es so unglaublich geschneit, so viel, dass ich unsicher war, ob sie mit der Ambulanz überhaupt fahren können. Um zwölf Uhr nachts haben wir sie dann ab unserer Eingangstür übergeben und Dania ist alleine nach Padua. Wir haben uns gefragt, was wir jetzt tun sollten. Gleich starten? Einige Stunden schlafen? Um acht, so hat es geheißen, stünde das Herz bereit. Sicherheit hat man ja erst, wenn die Ärzte das Spenderherz in der Hand halten und sehen, ob es denn wirklich geeignet ist oder nicht.
Um acht waren wir unten. Es war die Zeit von Corona, wir waren im Wartezimmer, Dania in einem geschlossenen Raum. Wir haben uns per Whatsapp-Anruf gesehen und geredet. Ich habe versucht, mir die blödesten Witze aus den Fingern zu saugen, um sie aufzumuntern. Wir waren angespannt und nervös. Plötzlich ist das Okay gekommen, dass Dania nun operiert werden kann. Sie wurde auf dem Krankenbett aus dem Zimmer gebracht, von der Ferne durften wir sie sehen. Wegen Corona wusste ich gar nicht mehr, ob ich sie denn umarmen durfte oder nicht.
Das war der letzte Moment, in dem ich sie gesehen habe. Mein letztes Bild von ihr als Lebende ist, wie ihr auf der einen Seite eine Träne über die Wange rinnt.
Die Operation hat 16 Stunden gedauert, wir haben kein Auge zugetan. Wir haben draußen gewartet, haben im Hotel gewartet, sind wieder im Gang gesessen. Nach 16 Stunden ist der Arzt aus dem Operationssaal gekommen. Das werde ich nie verstehen, wie er 16 Stunden lang operieren konnte. Er hat uns gleich gesagt, dass die Operation sehr schwierig gewesen sei und viele Transfusionen nötig gewesen seien, sie habe sehr viel Blut verloren. Ihr Herz war mit dem umliegenden Gewebe verklebt, mit der Lunge und der Lungenarterie, wegen der drei Operationen, die sie schon vorher gehabt hatte. Diese Verklebungen zu lösen war schwierig gewesen, viel Zeit war dabei verloren gegangen. Doch die Operation war fertig. Das neue Herz war transplantiert, es musste nur noch schlagen.
Am nächsten Tag hatte es noch nicht zu schlagen begonnen. Auch nicht am übernächsten. Sie hing an der Herz-Lungen-Maschine, wir saßen im Wartezimmer und hofften. So ging das über Tage. Eine Turnusärztin schaute ab und zu vorbei, nicht der Arzt, der Dania operiert hatte. Sie hatte nie wirklich Informationen für uns. Das war schlimm. Sie sagte nur: „Ich muss euch sagen, dass es um eure Tochter sehr, sehr schlecht steht.“ Einmal wurde mir dabei dunkel vor den Augen und ich wurde bewusstlos.
Wir haben immer in dieser Hoffnung gelebt, dass sie es schafft. Wir wollten gar nicht wahrhaben, dass sie es nicht schaffen könnte. Für uns war klar, dass sie es auch dieses Mal schaffen würde. Weil sie bereits drei Operationen am offenen Herzen überstanden hatte. Zwölf Herzkatheter. Sie war ja ständig im Krankenhaus. Sie hat alles so meisterhaft überstanden. Für mich war meine Tochter trotz der Schwere der Situation unbesiegbar. Dania stirbt nicht. Sie ist eine Kämpferin, sie schafft das. Sie ist in der Blüte ihres Lebens, jetzt geht es erst los. Diese Einstellung habe ich ihr vermittelt. Dania war auch immer positiv. Sie ist mit dieser Gabe geboren, stets lächelnd durch das Leben zu gehen.
Es ist nicht dazu gekommen. Man würde sich denken, dass man Zeit hat, sich darauf vorzubereiten, weil das Kind ja schon krank auf die Welt gekommen ist. Für mich ist das Unsinn.
Auf den Tod des eigenen Kindes kann man sich nicht vorbereiten. Das geht nicht und ich wollte das auch nicht.
Habt ihr die Zeit, die ihr hattet, aufgrund ihrer Erkrankung intensiver, bewusster gelebt?
sd: Sie hat manchmal gefragt, warum das gerade ihr passiert ist. Diese Frage stellen sich alle. Wer mit einer solchen Krankheit geboren wird, fühlt sich benachteiligt. Vor allem wenn sie sich mit Freundinnen verglichen hat, die nicht ständig zu Arztterminen mussten, die sich keine Gedanken machten.
Wir haben von ihrer Krankheit erfahren, als Verena im fünften Monat schwanger war. Die Ärzte haben uns gesagt, dass es nicht leicht werden wird, sie haben auch von Abtreibung gesprochen. Wir haben uns entschieden, sie zu behalten, wir haben zu ihr Ja gesagt. Wir wollten als Familie die Hoffnung nicht aufgeben. Natürlich war es eine Aufgabe mehr. Wer Kinder bekommt, hat Aufgaben. Das müssen keine Krankheiten sein, jeder hat etwas. Das Leben ist ja voll von Herausforderungen. Wir hatten also diese Aufgabe mehr. Wir haben in der Stadt gelebt, mit dem Krankenhaus in der Nähe. Also haben wir es so beschlossen, ganz bewusst, Dania sollte und wollte geboren werden.
Ich glaube, ich bin überzeugt, ich hoffe, dass wir ihr niemals das Gefühl vermittelt haben, sie wäre eine Last. Wir haben dafür gesorgt, dass sie sich wohlfühlt, wir hatten nicht ständig Angst um sie. Sie konnte normal groß werden. Ja, sie musste Medikamente nehmen und öfters ins Krankenhaus. Aber auch im Krankenhaus konnte sie sehen, dass sie nicht die einzige Patientin war. Dort waren auch andere Kinder, eines älter, eines jünger. Du gewöhnst dich daran. Die Medizin ist eine große Hilfe, sie gibt dir Mittel, um weiterzumachen. Natürlich träumte sie vom Leben. Sie wollte reisen, sie wollte Ernährungswissenschaften studieren, sie wollte mit Nahrung arbeiten und Foodbloggerin werden, weil sie Essen wirklich genießen konnte. Sie war eine Feinschmeckerin. Sie konnte das Leben wirklich genießen. Sie freute sich über die kleinen Dinge des Lebens.
Sie hat manchmal gefragt,
warum das gerade ihr passiert ist.
Diese Frage stellen sich alle.
Man könnte annehmen, dass sie das Leben genießen wollte, weil sie nicht wusste, wie viel Zeit ihr blieb. Aber nein. Es war nicht so. Es war ihre Natur. Sie war so positiv. Als wir in der Nacht ihre Tasche packten, hat sie ihren Computer mitgenommen, damit sie sich vom Krankenhaus aus in den Unterricht einloggen konnte. Für sie war es eine Hürde, die sie überwinden musste, um weiterzugehen.
vw: Auch sie hat an ein besseres Leben geglaubt.
sd: Man weiß es ja nie. Auch der Arzt hat nach dieser komplizierten Operation gesagt, dass er sie nicht operiert hätte, wenn er gewusst hätte, wie verklebt ihr Herz war.
vw: Der Arzt hat auch gesagt, dass sie sonst noch zwei Jahre zu leben gehabt hätte. Nicht mehr. Sie hatte eine zweite Krankheit entwickelt. Das Eiweißverlustsyndrom. Die Eiweiße werden durch den Darm ausgeschieden, der Körper kann sie nicht behalten. Das war der eigentliche Grund, warum sie auf der Liste ganz oben war, weil es für diese Begleiterkrankung keine Heilmethode gibt.
sd: Diese Begleiterkrankung kommt von der Herzkrankheit, davon, dass das Blut nicht richtig zirkuliert. Wenn uns einer gesagt hätte, dass sie an einem neuen Medikament experimentieren, dass sie dabei wären, eine Heilungschance zu finden, mit der man dieses Eiweißverlustsyndrom heilen könnte, vielleicht hätten wir gesagt, gut, warten wir noch zwei Jahre mit der Herztransplantation. Aber diese Wahl hatten wir nicht. Wenn es die gegeben hätte, hätten wir vielleicht etwas länger überlegt. Wir hätten auch Nein sagen können. Aber sie wollte es machen. Sie war überzeugt, es konnte nur besser werden.
Habt ihr euch deshalb einen Vorwurf gemacht?
vw: Nein. Wir haben getan, was uns in jenem Moment als das einzig Richtige erschien. Wir haben getan, was uns die Ärzte rieten. Wir sind ja keine Ärzte. Sie hat so sehnsüchtig auf das neue Herz gewartet. Wir haben alle gehofft.
Wann habt ihr die Hoffnung verloren?
vw: Meine Hoffnung war so groß, und meine Überzeugung, dass sie es schafft, so vollkommen, weil ich an ein Wunder glaubte. Wenn es darauf ankommt, dann trifft der Spruch schon zu: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Zudem ist die Operation in die Weihnachtszeit gefallen, da habe ich Geburtstag, am 23. Dezember, und auch Dania. Am 27. Dezember wäre sie 18 geworden. Es war eben diese Zeit, in der wir aufgrund unserer christlichen Kultur noch offener für Wunder sind. Ich hatte ja schon Geschenke für sie gekauft, sie hatte ihrerseits Geschenke für ihre Freundinnen gekauft. Ich habe viele Dinge als Zeichen gesehen, sehen wollen. Am Abend, an dem wir den Anruf bekommen haben, ist das neue Album von ihrem Lieblingssänger Shawn Mendes erschienen. Wir haben jedes Lied miteinander angehört. Dann war dieser starke Schneefall. Ich habe das alles als gutes Zeichen interpretiert. Ich konnte nicht wahrhaben, dass es so weit kommt, dass sie stirbt.
Sie ist zwei Wochen auf der Intensivstation gelegen. Wir haben gehofft, gehofft, gehofft. Wir waren immer da. Auch ihre beiden Brüder Alexander und Jannis sind gekommen, wir haben gemeinsam gewartet. Einen Tag nur war Spiridon aus beruflichen Gründen in Bozen. Als er schon auf dem Rückweg nach Padua war, rief mich der Arzt an. Ich war so überzeugt, dass er eine gute Nachricht für mich hätte, dass ich sofort zu ihm bin. Sonst hätte ich gesagt, warten wir noch, bis mein Mann kommt, er müsste bald da sein, dann kommen wir zusammen. Ich gehe also zu ihm, setze mich in sein Büro und er sagt: „Es tut mir so leid, wir können für Ihre Tochter nichts mehr tun. Sie hat ein Multiorganversagen erlitten. Es gibt keine Hoffnung mehr. Ihr müsst jetzt nur entscheiden, ob wir die Medikamente absetzen oder noch ein paar Tage warten, bis sie von alleine aufhört zu atmen.“ In diesem Moment dachte ich mir, er redet von jemand anderem, das betrifft mich nicht. Nur so konnte ich es aushalten.
sd: Du bist dort, um etwas zu hören, das du nie hören wolltest. Du bist in einer anderen Welt, du glaubst, dass sie von jemand anderem reden, nicht von deiner Tochter.
vw: Der Schmerz ist so groß. Das kannst du nicht verarbeiten.
sd: Der Arzt war kalt. Er hat uns nur die Fakten erklärt. So ist das im Krankenhausbetrieb, es hat halt ihn getroffen, dass er es uns mitteilen musste. Vielleicht war es auch Selbstschutz. Vielleicht, wenn er mitfühlen würde, würde er es selbst nicht mehr aushalten. Er macht das halt professionell, fünf klare Worte, die sagen, was sie sagen müssen. Er redet nicht um den heißen Brei herum. Ich war auch nicht bereit, das zu hören. In diesem Moment war ich außer mir. Vielleicht hätte ich seine Tonlage in einem anderen Moment besser ausgehalten.
Zudem war das mit Corona. Wir durften nur allein in ihr Zimmer gehen. Ein, zwei Mal haben wir es geschafft, es zu zweit zu betreten, weil wir die Frau am Schalter flehend darum baten. Aber meistens durfte nur eine Person hinein und der Rest hat draußen gewartet. Die Großeltern und die Verwandten aus Griechenland haben am Handy auf unsere Nachrichten gewartet, weil sie ja nicht kommen konnten.
vw: Es war so traurig, auch anstrengend, wenn man nie etwas Positives schreiben konnte.
Wie habt ihr euch dann entschieden?
vw: Wir wollten den Leidensweg nicht unnötig verlängern und haben uns dazu entschieden, die Medikamente abzusetzen. Am Tag bevor sie gestorben ist, sind wir alle vier zu ihr. Wir haben gebeten, sie in einen separaten Raum zu verlegen, damit wir unter uns sein konnten.
sd: Wir waren dann am Freitagnachmittag und am Samstag den ganzen Tag bei ihr. Zu diesem Zeitpunkt war sie schon unterwegs. Sie atmete noch, weil sie an die Maschinen angeschlossen war, aber sie war schon ganz gelb im Gesicht. Die Ärzte sagten, sie sei bereits hirntot, sie sei bereits ein anderer Mensch. Wir aber haben noch bis Freitag gehofft. Sie hat noch die Wimpern bewegt, wenn man sie berührte. Wir sagten zu ihr, wenn du uns hörst, gib uns ein Zeichen. Die Ärzte haben gesagt, dass das nur physische Reaktionen seien. Aber wir haben uns an allem festgehalten.
vw: Sie ist die ganzen zwei Wochen mit halboffenen Augen im Bett gelegen, hat immer ins Leere gestarrt. Einmal schien mir, sie hört mich, sie sieht mich. Jetzt kommt sie wieder zurück ins Leben. Ich habe ein Spiel mit ihr gespielt. Ich habe zu ihr gesagt, blinzle, wenn du ja sagen willst. Und mir ist vorgekommen, dass sie bei den Fragen immer richtig geblinzelt hat.
sd: Es war nicht genug, um sie wieder aufzuwecken.
vw: Das neue Herz hat nie geschlagen.
sd: Die Ärzte haben gesagt, das Wichtige sei, dass sie erwacht. Wenn sie das tut, wäre sie die Erste auf der Liste für ein neues Herz. Aber sie war zu schwach.
vw: Sie konnten keine Magnetresonanz machen, aber es ist wahrscheinlich, dass ihr Gehirn eine Weile ohne Sauerstoff war. Vielleicht ist sie deshalb nicht aufgewacht. Vielleicht ist es deshalb – im Nachhinein – gut, dass sie gehen durfte. Wenn wir sie als Pflegefall zurückbekommen hätten, wäre das nicht in ihrem Sinne gewesen. Das ist ein winzig kleiner Trost.
Sie war ein Geschenk, habt ihr mir einmal gesagt.
sd: Wenn dir das Leben schwere Hürden beschert, wächst du als Mensch. Du gibst nur den wichtigen Dingen Wert. Du regst dich nicht über Kleinigkeiten auf, du weißt, was zählt. Aber du musst es leben, um zu verstehen, wie es sich anfühlt.
Aber ja, sie hat 18 Jahre gelebt. Sie war ein Geschenk für uns. Sie hatte Pech am Ende, aber vielleicht war das ihr Schicksal, wenn wir daran glauben wollen. Es ist eben so gekommen. Diese Dinge passieren. Leute sterben aus so vielen Gründen. Das Wichtige für mich ist, dass wir alle mit Hoffnung in diese letzte Operation gegangen sind. Und sie war ein gutes Beispiel für ihre Freundinnen. Sie hatte Freundinnen mit Depressionen. Und Dania war immer da, um sie wieder nach oben zu ziehen. Sie konnte immer lächeln. Mit dem Lächeln hat sie ihre eigenen Schwierigkeiten überwunden, aber sie war auch für ihre Freundinnen da. Sie war das Herz der Gruppe, mit ihrem schwachen Herzen war sie der Motor.
Wo ist ihre Seele jetzt?
VW: Für mich war Dania nie weg. Sie war immer da. Sie ist jetzt noch da. Ich habe mich nur lange schwergetan, das in eine richtige Ordnung zu bringen. Der herkömmliche christliche Glaube war nicht sehr hilfreich in diesem Moment. Nicht zu wissen, wo sie jetzt ist, hat mich am meisten mitgenommen. Ich wusste, sie ist noch, aber ich wusste nicht wo. Das hat mich fertiggemacht. Ich habe mich dann auf die Suche begeben, ich habe viel gelesen von Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, die gegangen und wieder gekommen sind. In dem Moment, als ich erfuhr, dass sie alle die gleiche Erfahrung machten, dass sie alle dasselbe berichteten von diesem Licht nach dem Tunnel, egal vor welchem Kulturoder Konfessionshintergrund, habe ich Ruhe gefunden. Sie haben alle beschrieben, dass sie eine Welt wahrgenommen hätten, die so unfassbar schön sei, dass man sie nicht in Worte fassen könne, dass sie nicht mehr zurückkehren wollten. Ich bin überzeugt, dass Dania hier ist, in einer anderen Form. Nicht in einer physischen, in einer metaphysischen oder seelischen. Ich habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass sie hier ist, dass sie das beeinflusst, was mir geschieht.