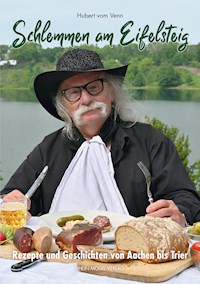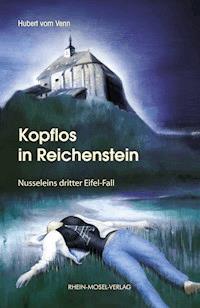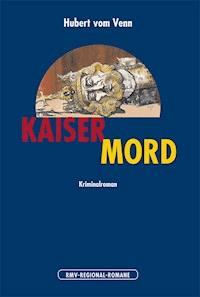Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rhein-Mosel-Vlg
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Doch erstens kommt es anders… Das Schicksal verschlug uns nämlich nicht in die Provence sondern vielmehr in die Eifel. Genauer gesagt, auf eine Eifeler Insel, die nicht etwa von tosendem Wasser umspült wird, sondern von Belgien. Leyhof heißt dieser zu Monschau gehörende Stadtteil und ist eine deutsche En- oder Exklave – das kommt ganz auf die Sichtweite an. Habe ich wirklich die paar Häuschen gerade 'Stadtteil' genannt? Kurzum: Allen Unkenrufen und Belästigungen durch Besucher aus der Stadt zum Trotz, haben wir uns in dieser Eifel auf Dauer eingerichtet – wenn man so will, also diesseits von Afrika. Und das nun schon im zweiten Jahr.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 261
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© 2005 eBook-Ausgabe 2011RHEIN-MOSEL-VERLAGZell/Mosel Brandenburg 17, D-56856 Zell/Mosel Tel. 06542/5151, Fax 06542/61158 Alle Rechte vorbehalten ISBN: 978-3-89801-788-6 Umschlagbild: Blick auf Nideggen, unbekannter Maler (Flohmarkt-Fund) Korrektur: Thomas Stephan
Hubert vom Venn
Sterne der Eifel
Fortsetzung von »Mein Jahr in der Eifel«
RHEIN-MOSEL-VERLAG
Für die Eifel-Mafia – ehrlich und friedlich – und für Kurt Schreiber, ohne den das ganze Theater nicht möglich wäre …
Sie erinnern sich vielleicht noch …
Meine Frau und ich wollten uns – angelockt von der Bestsellerliste und einem Engländer, der sich in der Provence genüsslich breit gemacht hatte – ein Haus in Süd-Frankreich kaufen. Die Angebote dieser Region hatten wir dank Kleinurlaub und Großbildband kennen gelernt: gemütliche Boules-Turniere am Rande der Wochenmärkte, Olivenhaine bei Malaucéne, Lavendelfelder auf dem Valensole-Plateau sowie in der Camargue pretty Flamingos, schwarze Stiere und weiße Pferde beim Fest der Gipsys.
In bester Erinnerung war auch der Ausblick über die Kanäle und auf die Salinen bei einer Wanderung über die Stadtmauer von Aigues-Mortes geblieben. Im Umfeld meiner Lieblingsburg »Les Baux« hatte ich so manches kleine, feine Lokal ausfindig gemacht und die deutsche Übersetzung »Seele der Provence« von Frédéric Mistral hatte Fernweh nach sich gezogen. In meinen kühnsten Träumen aß ich jede Woche in Arles im »Grand Hotel Nord-Pinus« des Modeschöpfers Christian Lacroix neben dem Van-Gogh-Café diese schweineteure Fischsuppe, auch gerne Bouillabaisse genannt. Ich stellte mir dann vor, einen Stuhl zu ergattern, auf dem schon Hemingway, Picasso oder Jean Cocteau gelümmelt hatten.
Doch erstens kommt es anders …
Das Schicksal verschlug uns nämlich nicht in die Provence sondern vielmehr in die Eifel. Genauer gesagt, auf eine Eifler Insel, die nicht etwa von tosendem Wasser umspült wird, sondern von Belgien. Leyhof heißt dieser zu Monschau gehörende Stadtteil und ist eine deutsche En- oder Exklave – das kommt ganz auf die Sichtweise an.
Habe ich wirklich die paar Häuschen gerade »Stadtteil« ge-nannt?
Kurzum: Allen Unkenrufen und Belästigungen durch Besucher aus der Stadt zum Trotz, haben wir uns in dieser Eifel auf Dauer eingerichtet – wenn man so will, also diesseits von Afrika. Und das nun schon im zweiten Jahr.
Januar
Wir hatten die Festtage ohne größere Verletzungen hinter uns gebracht: Gut, ich hatte neben der Gans auch ein wenig die Tischdecke tranchiert, die uns meine Schwiegermutter zu Weihnachten aufgedrängt hatte. Man stelle sich das doch einfach einmal vor: Eine Tischdecke, auf der Flusspferde mit Weihnachtsmann-Mützen in Bermudashorts olympischen und nichtolympischen Disziplinen nachgehen. So tauchte neben meinem Rotweinglas ein Nilpferd auf, das physiognomisch deutliche Züge eines deutschen Nationaltorwarts nach dem zweiten gehaltenen Elfmeter trug. Lediglich unsere beiden Enkelkinder Sandra und Caroline freuten sich, da sie ob ihrer Bildung, die sie in diesem Falle zugegebenermaßen aus Überraschungseiern bezogen hatten, die Tiere gleich einordnen konnten:
»Toll, alles voll Hippos.«
Meine Tochter Katharina war verzückt und ihr Ehemann, ein Banker namens Sascha, musste sofort den Hammer seiner mittleren Bildungsreife rausholen:
»Ja, Hippo kommt aus dem Lateinischen: Hippopotamus am-phibus.«
Ich hasse Leute, die immer mit ihrer Bildung prahlen müssen. Daher konnte ich Minuten später einen Internet-Ausdruck präsentieren, auf dem die korrekte Übersetzung des Wortes ins Bulgarische (Hipopotamam), ins Griechische (ippopstamoV) ins Norwegische (Flodhest), ins Finnische (Vertahepo), ins Arabische (faras un-nahr) ins Gälische (Dobhareach) und in Afrikaans (Seekoei) ausgedruckt stand. Immerhin kann sich unsereins von einem Schwiegersohn, der zu allem Überfluss auch noch Sascha heißen muss, nicht alles gefallen lassen. Meine Frau musste natürlich wieder ablenken und redete nur von dem zerschnittenen Tischtuch zwischen meiner Schwiegermutter und mir. Man kann aber auch hinter allem ein Sinnbild sehen …
Wie gesagt, bis auf diesen kleinen Zwischenfall hatten wir die Festtage unfallfrei hinter uns gebracht.
*
Doch dann passierte es.
Unsere neuen Nachbarn – Dr. Edgar Nässel-Köhler und seine Frau Saskia, Frisch-Zugezogene aus Aachen – hatten uns zu einer »Weinprobe«, getarnt als »Kennenlern-Party«, wie vollmundig auf viel zu teurem Papier stand, eingeladen:
»Er«, das wusste ich von Johanna aus dem kleinen Lebensmittelgeschäft im belgischen Küchelscheid, »ist Psychologe, und sie hat sie auch nicht alle.«
»Wehe, du verlangst ein Bier!«, schärfte meine Frau mir noch ein. Nur piekfeines Volk aus dem Dunstfeld des Aachener Klinikums war da. Der Gastgeber sprang um eine Massenansammlung von Weinflaschen rum und plapperte wie der Einpeitscher eines Fachseminars für Wein-Hooligans. Dabei rief er immer wieder aus:
»Degustation, Degustation, Degustation!!!«
Ich war froh, dass mich keiner kannte.
Dr. Edgar Nässel-Köhler, so vermutete ich, hatte sich sein Studium als Messer- oder Spritztütenverkäufer vor »Woolworth« finanziert, denn er rief aus:
»Ikonen des Genusses: Domaine Croix Belle Cabernet Sauvignon, Cockatoo Ridge Cabernet-Merlot, Gremaschi Cabernet Sauvignon Reserve und noch viel mehr! Verkostung und Bewertung. Dabei werden wir, meine Freunde, Auge, Nase und Gaumen des Weines entseelen.«
Das Entseelen brachte mich auf eine Idee, die ich aber verwarf. Immerhin haben Eifler Kriminalbeamten auch einmal einen Feierabend verdient.
Mir drückt Dr. Edgar Nässel-Köhler gleich ein Glas in die Hand:
»Chablis. Premier cru. Auch wenn es in der Hochzeit von Kanaa anders steht. Wir wollen heute einfach beginnen.«
»Also mit Essig!«, raunte ich meiner Frau nach dem ersten Schluck zu. Doch die stieß mich in die Rippen:
»Wenn du nicht gleich dein dummes Maul hältst …«
Dabei war Dr. Edgar Nässel-Köhler der mit dem dummen Maul.
»Jetzt, meine Lieben, kommt ein erster Höhepunkt. Ein Rothschild, allererste Lage. Wir haben ja dort ein Haus in der Nähe. Höhöhö. Ich habe gleich zwei Flaschen mitgebracht. Château Mouton Rothschild. Doppelmagnum-Flaschen, vollendet den exklusiven Gesamteindruck mit einem Künstleretikett.«
»Zwei Flaschen nur. Das ist aber was wenig für die ganze Sippschaft hier«, flüsterte ich meiner Frau zu, »na gut, dann werden wir wenigstens nicht besoffen.«
»Den darf man aber auch nicht trinken«, fuhr der Gastgeber fort, »das Etikett hat nämlich Jean-Francois Trottoir gemalt, einer der jungen Wilden Frankreichs. Das ist ein Sammlerstück.«
»Wie mein ungestempelter Bitburger Fehldruck mit gezacktem Rand«, murmelte ich. Als Ersatz holte der Mensch dann einen Wein ohne Etikett raus:
»Ohne Etikett, damit Ihr was zum Raten habt, meine Freunde. Ein ausgezeichneter Tropfen.«
»So kann man billige Prülle auch an den Mann bringen«, murmelte ich nur. Doch meine Frau hörte schon gar nicht mehr hin. Und dann ging ein Theater los, ich glaubte es nicht. Dr. Edgar Nässel-Köhler zog die Wangen zusammen, gurgelte, steckte seine Nase in das Glas, schwenkte es in der hohlen Hand und hielt es abschließend gegen das Licht. Dann rief er begeistert aus:
»Oh, der hat Charakter. Der schmeckt nach Karamell, Eichenfass, Lösboden und Zimt und tröndelt beim sanften Abgang. Ich finde, dieser Wein erzählt mir eine ganze Geschichte.«
Ein Wein? Erzählt eine Geschichte?
Ich habe darauf statt der Nase mein Ohr tief ins Glas gedrückt. Und Sie glauben es nicht – aber ich schwöre es, beim Barte des Propheten. Der Wein rief mir ganz deutlich zu:
»Los, Junge, lass uns hier abhauen und irgendwo ein vernünftiges Bier schlucken …«
Da meine Frau die neuen Nachbarn aber »entzückend und so gebildet« fand, musste ich mir noch einige Stunden die Beine in den Leib stehen – ich schwöre, ich bin an diesem Abend zwei Zentimeter geschrumpft. Als wir nach Hause kamen, bin ich sofort in einen Tiefschlaf gefallen, in dem mir im Traume eine Stimme immer noch »Degustation, Degustation, Degustation!!!« zurufen musste.
*
Und so hätte ich am nächsten Morgen fast einen historischen Augenblick verpasst, den es in der Eifel leider viel zu häufig gibt. Ich spreche vom Beginn überflüssiger Baumaßnahmen im Januar, wenn mildes Wetter solche Arbeiten zulässt. Und ich hatte Pech: Dieser Januar war verteufelt mild, die Anti-Schlechtwettergeld-Riege konnte ausrücken.
»Guten Tag, ich bin von der Baufirma!« – in den nächsten Wo-chen sollte dies der häufigst gesprochene Satz in meiner kleinen Welt werden.
Mit »Guten Tag, ich bin von der Baufirma!« ging das Drama los. Ein Mensch, der sich als »Bauleiter Koll« vorstellte, erklärte mir, dass nun endlich auch bei uns die Häuser an den Kanal angeschlossen würden:
»Da freuen Sie sich doch bestimmt. Weil Sie ja eine Insel in Belgien sind, dauerte das natürlich ewig mit den Genehmigungen. Aber jetzt ist alles in trockenen Tüchern.«
Aber dann verfiel der Bauleiter in Trauerstimmung:
»Allerdings: Damit sind natürlich kleine Unannehmlichkeiten verbunden!«, wusste er zu berichten und mir schwante Schlimmes.
Zu den Unannehmlichkeiten: Zuerst wurde die Straße aufgerissen und ein Graben vor unserem Haus gezogen, wie um die Burg Tintagel in der Artus-Saga. Und der Artus-Graben ist immerhin das Meer zwischen England und Irland. Das zog allerdings wieder ein »Guten Tag, ich bin von der Baufirma!« nach sich, da »Rein aus Versehen, Meister!« dabei mein Telefonkabel durchtrennt worden war. Nur einen halben Tag konnte ich keinen Notarzt anrufen oder durch Anrufe von meiner Schwiegermutter aufgeschreckt werden.
Nach vier Wochen lag der Kanal, wieder rückte ein Mensch namens »Bauleiter Schnitzler« mit einem »Guten Tag, ich bin von der Baufirma!« an und erklärte mir, dass er nun die Straße neu teeren müsse und ich mein Auto besser zwei Dörfer weiter in Belgien parken solle:
»Sonst kommen Sie hier nicht weg!«
Auch die Zeit der Volkswanderungen zu meinem Wagen ging vorbei.
»Guten Tag, ich bin von der Baufirma!«, schallte es einige Wo-chen später wieder an mein Ohr. Ein »Bauleiter Fitzek« machte mir die freudige Mitteilung, dass nun die Straße für eine Erdgasleitung aufgerissen werden müsse. Kein Mensch in unserer Gegend wollte diesen Anschluss. Politiker nennen das wohl »Aufschwung der Bauwirtschaft«.
Wieder wurde die Straße aufgerissen, wieder wurde der Kö-nig-Artus-Graben gezogen, wieder wurde mein Telefonkabel vom Bagger zerrissen, wieder wurde die Straße neu geteert, wieder musste ich zu meinem Wagen wandern. Als diese Aktion zu Ende war, entfuhr mir gerade ein »Gott sei Dank, die sind weg!«, als es an der Haustür schellte:
»Guten Tag, ich bin von der Baufirma!«, sagte ein »Bauleiter Bünten« und überbrachte mir die freudige Mitteilung, dass nun eine Glasfaserleitung für ferngesteuerte Mikrowellen- und Fernsehbedienung verlegt werden müsse. Zwar wollte ich das überhaupt nicht – aber die Leitung wurde trotzdem vor meinem Haus verlegt. Fazit: Straße aufgerissen, Artus-Graben gezogen, Telefonkabel zerrissen und zum Auto gewandert. Als die Arbeiten fertig waren, klingelte es an der Tür:
»Guten Tag, ich bin von der Baufirma!«, sagte ein »Bauleiter Abshoff«, der mir ans Herz legte, meinen Wagen auf der anderen Straßenseite zu parken – ich ahnte es:
Wegen eines neuerlichen Artus-Grabens.
Dieses Parken zog ein weiteres »Guten Tag, ich bin von der Baufirma! Sie erinnern sich: Bauleiters Abshoff« nach sich, da ein rückwärts rangierender LKW – »Nicht extra, Meister!« – an meinem Wagen einen Schaden verursacht hatte, der aussah, als hätte der indische Elefant aus der Werbung mit meinem Mittelklassewagen Elfmeter-Schießen geübt. Da ging ich langsam unter die Decke – beruhigte mich aber im Laufe des Abends langsam wieder. Am nächsten Morgen klingelte es wieder:
»Guten Tag, ich bin …!«
Ich ließ den Menschen nicht ausreden:
»Ich weiß, ich weiß: Von der Baufirma und Sie wollen bestimmt wieder irgendein Loch graben.«
»Ein Loch graben, schon«, sagte der Mensch, »aber von einer Baufirma bin ich nicht. Ich bin von der Kripo in Stolberg. Hauptkommissar Trappert. Hier soll jemand im Zorn einen Bauleiter erschlagen und heimlich vergraben haben …«
*
Na gut, das Ende der Geschichte hatte ich mir ausgedacht – ausgedacht für meine regelmäßigen Pfeifenabende mit Heinz Maahsen, Lehrer am Monschauer Gymnasium. Heinz und seine Frau Martha waren echte Leyhofener seit Urzeiten. »Die Maahsens«, wie wir sie nannten, wurden nach unserem Umzug in die Eifel unsere besten Freunde. Heinz bescherte mir in diesen Januar-Tagen mein nächstes Erlebnis mit einem typischen Eifler. Da Heinz keinen Wagen hatte, die Autowerkstatt sprach von »Zwei Tage TÜV-Fertigmachen mit Mobilitätsgarantie«, hatte ich versprochen, meinen Freund von der Schule abzuholen. Der alte Preuße in mir sorgte wieder einmal dafür, dass ich viel zu früh in der Schule ankam. Dort stieß ich dann auf den Hausmeister, der sich als Herbert Stollenwerk vorstellt und zunächst einmal wissen wollte:
»Sind Sie Eltern? Zum Lehrkörper gehören Sie doch nicht? Was machen Sie hier?«
Da ich weder Eltern noch Körper war, konnte ich den guten Mann beruhigen. Herbert Stollenwerk, uniformiert mit einem grauen Kittel, trug als Dienstmütze ein kleines, braun geriffeltes Hütchen aus Hartmanchesterstoff – die Eifler sagen dazu »Män-schäster«. Er erklärte mir sofort, dass er überhaupt keine Zeit habe, um sich mit mir zu unterhalten, schob dann aber nach:
»Sie müssen wissen: Ohne mich läuft hier ja nix, und das seit Jahren. Dabei war ich ursprünglich ja gar kein Hausmeister. Im Rahmen der Umschulungsmaßnahme »Vom Nahtnutschweißtechniker zum Hausmeister« habe ich mich aber schon vor Jahren umschulen lassen, als das hier in der Eifel mit der Schwerindustrie nicht mehr so lief. Damals arbeitete ich noch bei den Junker-Werken in Lammersdorf. Aber glauben Sie ja nicht, dass ich so ein normaler Hausmeister bin. Immerhin bin ich nicht nur für das Gymnasium hier, sondern auch da drüben für die Hauptschule zuständig. Die von der Stadtverwaltung wissen eben, was sie an mir haben.«
Ich ahnte, dass ich mich auf einen längeren Exkurs über das Leben des gemeinen Eifler Hausmeisters einstellen musste und richtig – Herbert Stollenwerk nahm tief Luft:
»Was ich hier täglich erlebe – Sie glauben es nicht. Der wichtigste Satz, den ein Hausmeister lernen muss, weil man ihn auch täglich, was sage ich, stündlich braucht, ist: Da können wir aber nicht stehen bleiben! Sie glauben ja nicht, wie dusselig sich Lehrer beim Parken anstellen können, besonders die jungen, die Referendarinnen. Aus Aachen, besonders die! Tja, jedem ist eben kein Parkhaus in die Wiege gelegt worden.«
Ich versuchte über den Sinn dieses Satzes nachzudenken. Herbert Stollenwerk zwinkerte mir zu und fuhr fort, genauer – blieb leider da:
»Unter uns: Wenn ich ›Da können wir aber nicht stehen bleiben!‹ rufe und dabei das ›wir‹ betone, ist das nur höflich. Ich kann da natürlich stehen, sogar parken. Aber dafür bin ich ja die wichtigste Person hier. Vielleicht von diesem Schulleiter einmal abgesehen. Aber auf jeden Fall auf der gleichen Stufe. Und besser verdienen tue ich auch. Weil ich ja in der Schule noch den Kiosk mit Hefe-Schnecken, Limo, Mars und Cola bestücke und da natürlich auch eine Kleinigkeit draufschlagen muss – immerhin kostet die Fahrt nach dem Aldi auch etwas und zum Bäcker muss ich sogar täglich, weil diese verdammten Schnecken auch noch frisch sein müssen. Da sind die Schüler heutzutage sehr verwöhnt – wir hätten früher ja sogar ein Käsebrötchen vom Vortag gegessen. Aber nein, die Damen und Herren Schüler – alles wollen sie frisch haben. Und, das brauchen Sie gar nicht zu glauben, ich habe nicht etwa wie die Damen und Herren Lehrer am frühen Nachmittag schon Feierabend. Dann kommen nämlich die türkischen Putzfrauen, die ja kaum richtig Deutsch sprechen können. Da muss ich auch noch mein Sprachtalent einsetzen. Neulich sagte ich zu einer: ›Du, aber korrekti in Ecki, sauber putzi, putzi!‹ Da sagt die doch glatt zu mir: ›Können Sie sich etwas differenzierter ausdrücken!‹ Der habe ich aber was erzählt, immerhin bin ich es, der jedes Jahr nach Antalilusien, da unten in der Türkei, fährt. Ich weiß, wie man da sprechen tut.«
Diesen Satz wollte ich mir unbedingt für den nächsten Pfeifenabend mit Heinz merken. Aber Herbert Stollenwerk hatte immer noch keine Zeit für mich:
»Und abends muss ich auch arbeiten, mich richtig krumm legen. Da tagt ja dauernd unser Stadtrat hier, weil im Rathaus der Sitzungssaal umgebaut wird. Dann warte ich immer, bis der Bürgermeister die Sitzung eröffnet hat, platze dann mitten in die Eröffnungsrede rein und rufe mit glockenklarer Stimme: ›Der Fahrer des Fahrzeuges mit dem amtlichen Kennzeichen‹ – aus Datenschutzgründen sage ich das jetzt natürlich nicht – ›muss sofort, aber so was von sofort, sein Fahrzeug wegfahren.‹ Da müssten Sie mal sehen, wie der halbe Stadtrat aus dem Sitzungssaal flitzt.«
Verstohlen schaute ich auf die große Schuluhr und hoffte inständig, dass Heinz mich bald erretten würde. Aber Heinz kam nicht und Herbert Stollenwerk blieb:
»Ich sage ja nichts, wenn ein Wagen auf dem linken Arm einer Rentnerin parkt, die im Stadtrat zuhören wollte. Immerhin überlasse ich es jeder Partei selbst, wie sie einen Beitrag zum Abbau des Rentnerbergs leistet, aber wenn ein Wagen auf dem Parkplatz vom Schulleiter steht. Das geht doch zu weit. Selbst wenn es der Schulleiter selbst ist. Aber glauben Sie ja nicht, der wäre abends mal in seinem Büro. Pustekuchen. Da war sein Vorgänger, ein netter Mensch übrigens, von einem ganz anderen Kaliber. Der war oft noch hier, wenn ich die Lichter ausmachte.«
Ich sehnte das Ende dieses Gesprächs herbei, doch ich hatte meine Rechnung ohne den Hauswirt gemacht:
»Natürlich mache ich vor den Politikern auch immer etwas Druck – das ist nämlich die einzige Sprache, die die verstehen. Ich habe ja gerne immer einen lustigen Scherz auf den Lippen und rufe dann mitten in die Sitzung rein: »Der Fahrer, dessen Wagen auf dem Arm der Rentnerin steht, wird gebeten, das Fahrzeug sofort vorschriftsmäßig zu entfernen. Im anderen Fall muss die Rentnerin notgeschlachtet werden. Die dadurch entstehenden Kosten muss der Autofahrer tragen. Selbst wenn er im Stadtrat ist.«
Herbert Stollenwerk seufzte wie jemand, der alle Last der Welt auf seinen grauen Schultern tragen muss:
»Und mit so was muss sich unsereins nun tagaus-tagein auseinander setzen. Ein bisschen Rücksicht, ein bisschen Rücksicht nur, kann doch jeder nehmen. Man kann doch Rentner auch außerhalb meines Geländes entsorgen.«
Hausmeister Stollenwerk nahm tief Luft – ich befürchtete die Fortsetzung des Monologs:
»Als hätte ich nicht genug zu tun. Wie gesagt: Ich bin ja Hausmeister an beiden Schulen hier. Da muss ich mich auch dauernd mit den falsch geparkten Wagen von den Dealern rumschlagen. Gestern habe ich es einem aber gegeben: ›Mein lieber Freund‹, habe ich gesagt, ›dein Auto muss sofort vom Schulbus-Parkplatz verschwinden.‹ So klein, so klein, war der. Mit Hut.«
Herbert Stollenwerk redete sich in Rage:
»Genau wie neulich dieser Bankräuber. Steht der doch vor der Sparklasse in Monschau im Halteverbot mit laufendem Motor. Das ist zwar nicht mein Gebiet, aber als Bürger möchte man ja auch Einfluss nehmen. Da habe ich mir den Fahrer des Fluchtfahrzeugs vorgeknöpft: ›Du kannst meinetwegen soviel Banken überfallen, wie du willst, aber hier können wir nicht stehen bleiben.‹ Der Kollege kam dann aber mit der Beute rausgestürmt und die sind sofort losgerast. Da brauchte ich mir noch nicht einmal das Nummernschild aufzuschreiben – weil, er hat ja auf meine Kritik sofort reagiert und ist aus dem Halteverbot gefahren. Wo steht übrigens Ihr Wagen?«
Ich erklärte Hausmeister Stollenwerk meinen Standort und stieß auf Milde:
»Das ist eigentlich ein Lehrerparkplatz. Da Sie aber den Maahsen abholen, drücke ich noch einmal beide Augen zu. Ich muss jetzt aber gehen, mir wächst die Arbeit sonst über den Kopf.«
Sprachs und ging mit erhobenem Haupte von dannen. In der Ferne hörte ich ihn noch rufen:
»He Sie, Fräuleinchen. Als Referendarin müssen Sie außerhalb des Lehrerparkplatzes auf der Straße parken.«
Wenig später kam Heinz:
»Ich habe dich aus meiner Klasse gesehen. Na, war es nett mit dem Grauen in Grau?«
»Ein typischer Eifler Übertreiber«, konterte ich.
»Na, na«, drohte Heinz mit dem Finger, »ich erinnere dich nur an deine Geschichte mit dem Bauarbeiter und dem Kriminalbeamten. Du bist selbst auf dem besten Wege, ein echter Eifler zu werden. Warte noch dreißig Jahre, dann erkennen wir dich an.«
Ich erinnerte mich an einen Polizisten, der 1950 als 20-jähriger aus dem Ruhrgebiet in die Eifel versetzt und sesshaft wurde und bis heute im Volksmund »Fremder« heißt.
*
Heinz schlug vor, dass wir uns statt eines traditionellen Pfeifen-abends, bei dem wir immer über Gott und die Eifelwelt reden, einen Kaffeemittag im »Hirsch-Café« in Monschau gönnen sollten:
»Wie alte Weiber?«, warf ich ein.
»Wie alte Weiber!«, konterte Heinz. »Sind wir das nicht auch ein bisschen?«
Wir fuhren also vom Gymnasium in die Monschauer Altstadt, parkten verbotswidrig am Marktplatz und orderten erst einmal jeder ein Stück Schmandkuchen. Während Heinz einen großen Pott Kaffee bestellte, musste ich mit nicht vorhandenen Italienisch-Kenntnissen prahlen:
»Latte Macchiato.«
Heinz gab unser Diskussionsthema vor:
»Ich komme noch einmal auf unseren Hausmeister zurück«, begann er die Runde unserer meist tief schürfenden Gespräche, »ist dir auch schon mal aufgefallen, dass es Sätze gibt, die nur von einer ganz speziellen Berufsgruppe gesprochen werden? Machen wir mal einen Test. Ich sage dir einen Satz und du musst mir den dazu passenden Beruf nennen. Also: Nicht vom Beckenrand springen!«
Nachdem ich noch ausführlich lamentiert hatte, dass so ein Spiel für zwei mittel gebildete Männer im fortgeschrittenen Alter doch recht albern sei, stieg ich dann doch auf das Spiel ein und tat Heinz den Gefallen:
»Bademeister!!!«
Heinz geriet in Verzückung:
»Richtig! Kein anderer Mensch sagt das. Ja, es würde sogar zu Verwirrungen führen. Stell dir doch nur mal vor, eine Bardame aus dem Club ›Amour auhur‹ würde das rufen. Man würde den Satz doch völlig falsch verstehen.«
»Dreiminus für eine dumme Randbemerkung«, bemerkte ich, gestand mir aber ein, dass ich darauf nicht gekommen wäre. Doch Heinz hörte gar nicht hin:
»Oder ein anderes Beispiel – wie du es eben erlebt hast: ›Da können wir aber nicht stehen bleiben!‹ Richtig. Hausmeister. Kaum fährt man – zum Beispiel am Rathaus oder einem Sportmittelzentrum – auf einen Parkplatz, erscheint ein Mensch im grauen Kittel, Schlägerkappe oder Pepitahütchen und schreit: ›Da können wir aber nicht stehen bleiben!‹ Wir? Dabei steht der Mensch selbst schon ewig da. Wo wir schon einmal beim Auto sind: Schlimm ist auch folgender Satz: ›Da können wir aber nicht durchfahren!‹ Diesen Satz hört man oft am Rande von Volksfesten, wo so genannte Verkehrskadetten einem die Zufahrt auf einen völlig leeren Parkplatz verweigern und einen dann noch auf einen zehn Kilometer entfernten Platz schicken, auf dem man für teures Geld einen Pendelbus nehmen muss, der einen dann auf den leeren Parkplatz bringt.«
Heinz fuhr fort, war nicht zu bremsen:
»Oder ›Darf es für zwei Euro mehr sein?‹ Diese Menschen – meist Fleischereifachverkäuferinnen oder Blumenkohlmarktstand-Abwiegerinnen – fragen nie ›Darf es für einen Euro weniger sein?‹ – immer mehr.«
Heinz nahm tief Luft:
»Ein anderes Beispiel: ›Dafür bin ich nicht zuständig, ich verbinde Sie mal weiter!‹ Ein beliebter Satz in Gemeinde- und Stadtverwaltungen. Allerdings wird man mit diesem Satz mindestens zehnmal konfrontiert. Solange, bis man auf den Lehrling trifft, dem seine Vorgesetzten auf dem Telefon den Weiterverbindungsknopf zugeschweißt haben.«
Ich stieg auf das Thema ein:
»Oder in der Gastronomie: ›Das ist nicht mein Tisch. Kollege kommt gleich.‹ Jeder Kellner hat diesen Satz mindestens schon 120.000-mal in seinem Leben gesprochen. Genau wie: ›Die Rechnung ist schon unterwegs!‹ Das heißt doch immer, dass man mindestens noch eine Stunde warten muss.«
Die Runde war wieder bei Heinz:
»Die Pflichterfüller – ganz schlimm: ›Was wollen Sie, ich tue doch nur meine Pflicht hier!‹ Mit diesem Satz werden die unsinnigsten Handlungen begründet. Dabei reicht die Palette von Falschparker-Anzeigen bis zum Erschießungskommando.«
»Jetzt wirst du aber politisch!«, warf ich ein.
»Höchstens Deutsch!«, erwiderte Heinz.
Ich wollte das Thema wechseln:
»Man muss sich eben auch über Dinge Gedanken machen, über die die Wenigsten reden wollen – und wenn, dann nur hinter vorgehaltener Hand.«
Heinz sah mich fragend an und ich fuhr fort:
»Mir geht es um ein Thema, das in den intimsten Bereich eines Menschen vordringt und über das man selbst im engsten Familienkreis, ja sogar meistens zwischen Mann und Frau, nie redet.«
Heinz sah mich gespannt an, nahm einen großen Schluck Kaffee und meinte dann mitleidig:
»Du hast Potenzprobleme?«
»Quatsch. Ich spreche über – und nenne das Ding beim Namen, weil ich ein Betroffener bin – Wollflusen im Nabel. Jeden Abend zittere ich förmlich, wenn ich mir mein Hemd ausziehe. Ich bin dann meistens ganz euphorisch, weil ich glaube: Heute ist nichts passiert. Dann erfolgt der Griff mit dem gekrümmten Schabefinger und – eine Wollfluse im Nabel. Schrecklich. Dann ist für mich der Tag gelaufen – quasi alles umsonst gewesen. Woher, frage ich mich, kommen zum Beispiel schwarze Nabelflusen, wenn man nur ein graues Unterhemd und ein hellblaues Oberhemd sowie eine blaue Arbeiterhose anhatte?«
»Von der Unterhose?«, warf Heinz ein.
»Ich bitte dich, die ist doch nicht schwarz. Na ja, wenigstens nicht tiefschwarz. Doch was kann man machen? Ich habe mir schon das Flusensieb aus der Waschmaschine mit Heftpflaster über den Nabel geklebt. Aber das sah unter dem Hemd aus, als hätte ich einen Außenbordmotor – quasi einen Nabelschrittmacher. Und abends dann? Flusensieb leer, und im Nabel – Flusen. Ich fing an, an der Welt zu verzweifeln.«
»Deine Probleme möchte ich haben«, lachte Heinz.
»Das sind Probleme. Ein Hobby-Psychologe hat mir mal erzählt, dass es Leute gibt, die sich ein gesundes Bein aboperieren lassen, weil sie dauernd Phantom-Schmerzen verspüren. Daher sollte ich mir doch einfach von einem Arzt den Nabel zubetonieren oder liften lassen.«
»Eine gute Idee«, fand Heinz.
»Das ist natürlich Blödsinn. Ich lasse mir doch nicht den Nabel liften. Bei meinem Bauch ist der Nabel dann auf der Stirn und, wetten, abends immer noch voll Flusen. Die Lösung, dachte ich, im letzten Sommer gefunden zu haben. Da bin ich den ganzen Tag ohne Hemd rumgelaufen.«
»Sicher ein furchtbarer Anblick!«
»Doch das war auch falsch. Abends hatte ich einen Sonnenbrand und – ich bin fast verzweifelt – schwarze Flusen … zwischen den Zehen!«
Heinz sah mich an, als hätte ich vor seinen Augen eine Kröte verschluckt, schlug mir auf die Schulter und meinte:
»Wir sollten austrinken und nach Hause fahren. Du machst dann ein Mittagsschläfchen und danach sieht die Welt wieder ganz anders aus. Können wir bitte zahlen?«
Sekunden später stand die Verkäuferin mit der Rechnung neben uns. Betreten schauten wir uns an und Heinz meinte:
»Na ja, es gibt eben auch Ausnahmen von der Regel.«
*
Ich habe mich dann doch gegen ein Mittagsschläfchen entschieden und eine Zapprunde vor dem Fernseher eingelegt. Meine Frau war nicht zu Hause – sie hasst Zappen.
Ich war fassungslos. Mit was sich die Leute heute so rumschlagen! Normalerweise gucke ich mittags nie Fernsehen, diese Talkshows vor allen Dingen nicht, also nur so rein zufällig, beim Rumzappen, wie gesagt, wenn Sie wissen, was ich nicht meine. Und da war an diesem Tag eine Sendung über ein Problem, das offensichtlich den Menschen auf den Nägeln brennt. Ein Problem, da flossen nur so die Sturzbach-Tränen. Es ging – ich glaubte es nicht – um ein offensichtlich heißes Problem unserer Tage:
Frauen benutzen den Rasierapparat ihrer Männer, um sich die Haare auf den Beinen zu entfernen. Kein Weltwirtschaftsgipfel, keine Naturkatastrophen also – nein, Haare auf den Beinen regen die Welt auf. Wenigstens die Welt der Redakteure einiger Privatsender. Die Sendung startete ganz harmlos – mit dem Thema Frisuren. Ein Mensch – ich glaube aus den neuen Bundesländern – sagte:
»Nüüüü, meine Frau hot keine Frisur, meine Frau hot nur Hoore.«
Da ging es aber los! Als eine Sozialpädagogin das hörte, wälzte sie sich vor laufenden Kameras auf dem Boden und schrie:
»Es muss langsam Schluss sein mit der Benachteiligung von uns Frauen in Sachen Haare. Ich will auch Haare auf der Brust und auf dem Rücken haben.«
In Sekunden war die Hölle los. Ein weiterer Mann, ich tippte auf Schwaben, beschuldigte seine Frau, dass sie sich mit seinem Rasierapparat die Haare auf den Beinen geschnitten hätte, wodurch die Messer stumpf geworden seien – weil die Fläche so groß sei, vor allen Dingen die Oberschenkel.
»Immerhin«, rief der Mann, »gibt es doch einen Ladyshave.«
Das rief wiederum die Sozialpädagogin auf den Plan. Sie riss sich Haare aus und bezeichnete den Ladyshave als frauenfeindlich, da der Ladyshave eindeutig die Frauen ausgrenzen würde:
»Es gibt ja auch keine Kaffeemaschinen nur für Frauen.«
Nun war das Toben an den Männern: Frauenbeinhaare seien zu dünn und einer hatte seine Frau sogar erwischt, wie sie sich unter den Armen rasiert hätte:
»Der Rasierapparat hat danach wochenlang nach Deo ge-schmeckt«, schimpfte der Mann, Hesse vermutlich, aber nicht Hermann.
Ich bedauerte, dass Heinz nicht da war, und rief ihn sofort an.
»Rein zufällig«, sagte er, würde er diese Sendung auch sehen. Wie immer schlug er eine Brücke zur Eifel:
»In der Eifel ignoriert man solche schwerwiegenden, gesellschaftlichen Probleme: Eifler Frauen machen nämlich diesen Quatsch um die Haare nicht mit. Warum hat schließlich jeder Eifler Mann einen Schnurrbart?«
Ich wusste es nicht und Heinz klärte mich auf:
»Damit er seiner Mutter ähnlicher sieht.«
Für diesen schlechten Witz gab ich meinem Freund vier scheinheilig betroffene, frauenfeindliche Minuspunkte, beendete das Gespräch und lachte mich schlapp.
*
Aber nicht nur einen Ladyshave hält der Eifler für völlig überflüssig. Es gibt auch noch andere Dinge, die brauchen diese Mittelgebirgsler überhaupt nicht: Taxis zum Beispiel.
Sie merken, ich entwickele mich langsam zum richtigen Eifler. Welcher Mensch käme sonst auf die Idee, gedanklich eine Brücke vom Ladyshave zum Taxi zu schlagen? Immerhin: Die paar Meter, die der Eifler betrunken fährt, kann er auch im eigenen Auto zurücklegen.
Doch nun gibt es auch bei uns seit einigen Wochen ein Taxi-Unternehmen – wahrscheinlich eine Ich-AG. Der Einmann-Unternehmer ist Franz Jansen, der, so erzählte mir Johanna aus dem Lebensmittelgeschäft, früher eine Schießbude hatte und von Kirmes zu Kirmes gezogen war:
»Ich bitte Sie, das ist doch kein Leben!«, empfand Johanna und schob dann noch hinterher:
»Als der Jeck alte Maschinenpistolen von drüben, von den Vopos, als Marktlücke einführte, haben sie ihm die Konzession entzogen.«
Ich schaute Johanna an. War das wieder eine dieser Eifler Übertreibungsgeschichten. Doch meine Lieblings-Warenhausbesitzerin schaute ganz treuherzig.
Da ich allem Neuen (sieht man einmal vom Ladyshave ab) aufgeschlossen gegenüber stehe, habe ich direkt eine Taxifahrt gebucht. Ich erzähle die Geschichte meiner ersten Eifler Taxifahrt einmal so, wie ich sie später Heinz erzählt habe. Also Eiflerisch, mit leichten Übertreibungen, aber nur ganz, ganz wenigen. Wirklich!
Also: Schon bei der Ankunft des Wagens war alles ganz anders als man es so aus dem Fernsehen kennt. Weder wurde mein Ge-päck durchleuchtet, noch wurde ich vor der Fahrt von Sicherheitsbeamten abgetastet. Nun ja, ich hatte kein Gepäck dabei, aber ein bisschen abklopfen hätte Franz Jansen mich doch schon gekonnt. Und dann war ich im Taxi drin. Keine Schwimmwesten und kein Getränk »für umsonst« wurden gereicht, geschweige denn belegte Brote. Lediglich anschnallen musste ich mich – aber das teilte mir auch keine freundliche Stewardess mit, sondern der Jansen knurrte nur:
»Schnall’ dich gefälligst an.«
Als die Fahrt nach Mützenich zu Ende war, musste ich direkt zahlen und Franz Jansens sagte nur »Tschüss dann« – statt »Taxi Jansen wünscht Ihnen einen angenehmen Aufenthalt in Mützenich und würde sich freuen, Sie demnächst wieder als Gast bei Taxi-Jansen begrüßen zu können.«
Also der Service – da gab es einige Minuspunkte, zumal ich auch bar und nicht mit Kreditkarten bezahlen musste. Daher habe ich aus stillem Protest auch nicht geklatscht, als der Jansen erfolgreich vor dem »Nassenhof« geland…, also gehalten hat. Und ich habe mich auch nicht, wie sonst immer im Süden, auf der Rolltreppe zum Taxi fotografieren lassen. Ja, das Taxi hatte noch nicht einmal eine Rolltreppe. Und dann das Gerede von Taxi-Jansen. Ja, verdammt, im Flugzeug erzählt mir der Pilot doch auch nicht über Lautsprecher von seinen Krankheiten. So interessierte mich auch nicht das offene Bein der alten Frau Jansen, das diese mit Heilkräutern, wahrscheinlich Brennnesseln, behandeln würde. Allerdings hat das Taxifahren in der Eifel auch Vorteile. Man kann aktiv in das Flugverhalten eingreifen. Fünf Mal habe ich »Kuck nach vorne auf den Verkehr, du Dämel« gerufen. Nun ja, zugegeben, den »Dämel« habe ich nur gedacht. Aber sagen Sie so einen Halbsatz mal zu einem Lufthansa-Piloten. Der streikt doch sofort 24 Stunden …
*
Im »Nassenhof« aß ich – das muss man schon aus traditionellen Gründen in Mützenich – eine Schmugglerplatte und trank ein blondes Leffe. Anschließend wanderte ich – die, zugegeben, wenigen Meter – nach Kaiser Karls Bettstatt. Aha, auf diesem Stein soll also der Kaiser einmal geschlafen haben. Ich nahm mir fest vor, dieses Thema nicht weiter zu vertiefen. Danach schlenderte ich noch etwas durchs Venn und rief dann vom Parkplatz Nahtsief an der Straße nach Eupen – nein, nicht Taxi-Jansen – sondern vielmehr meine Frau an.
*
Der Januar, da brauchte ich nur den Schweizer Wetterexperten meines Vertrauens zu befragen, war wirklich lausekalt. Um Kalterherberg, verkündete Kachelmann, wurden wieder mal Rekordminustemperaturen gemessen – und wir waren mittendrin im Rekord. Zu allem Überfluss fror uns auch noch in der Garage der Wasseranschluss ein. Gut, ich hätte bis zum Frühjahr warten können, aber Heinz hatte mich am Telefon gewarnt: