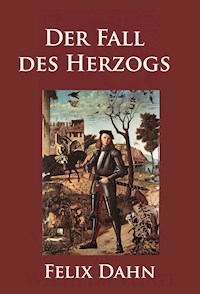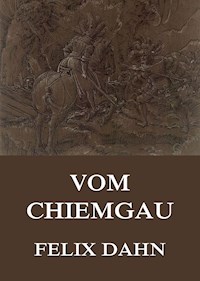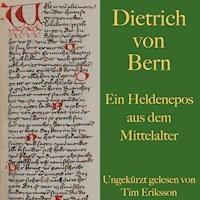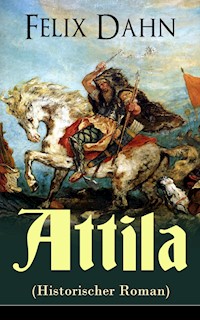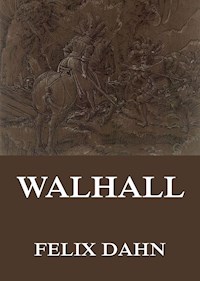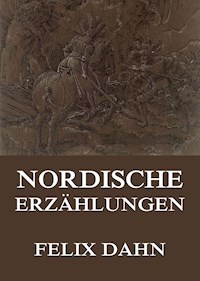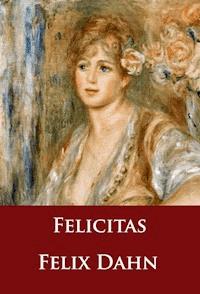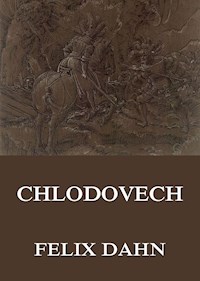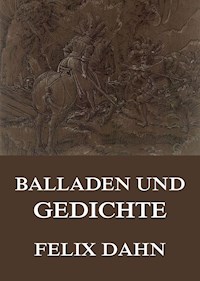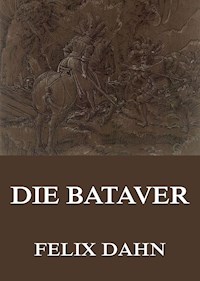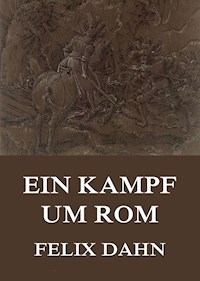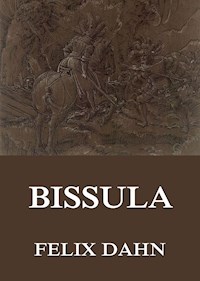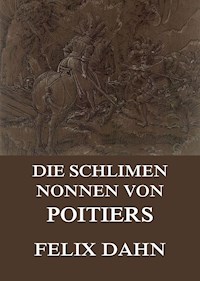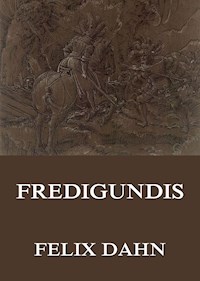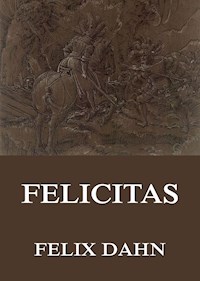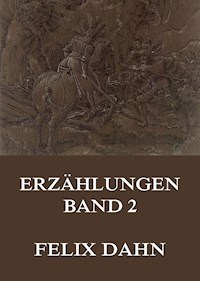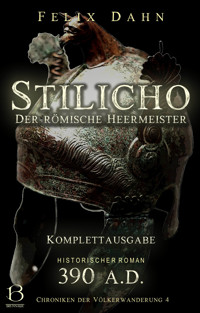
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: apebook Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
“STILICHO” Der Halbvandale Stilicho steigt zum Regenten des römischen Westreiches auf. Doch ist ihm die Hälfte des Reiches nicht genug, und er greift auch nach dem Osten. Der oströmische Kaiser Arcadius und sein oberster Feldherr Rufinus sind aber nicht gewillt, die Oberhoheit Westroms und Stilichos anzuerkennen. Die militärische Bedrohung durch Alarich I. und seine Westgoten sowie andere in das Reich einfallende barbarische Horden hindern Stilicho aber daran, sein Augenmerk ausschließlich auf Ostrom zu lenken. Doch kaum scheint diese Gefahr gebannt, erhebt sich im Norden – wie aus dem Nichts – eine neue Bedrohung: die Legionen Britanniens rufen einen Gegenkaiser aus. Als dieser mit seinen Truppen über den Ärmelkanal setzt und in Gallien landet, steht Stilicho vor der größten Herausforderung seines Lebens. “CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG” Es ist eine Zeit des Umbruchs und der Veränderung. Und es ist eine Zeit, die Jahrhunderte andauern wird. Kriegerverbände auf der Suche nach Beute und Versorgung ziehen marodierend durch die Landschaften Europas. Andere, schwächere Gruppen werden verdrängt oder vernichtet. Das ehemals unbesiegbar scheinende Römische Reich geht unheilvolle Bündnisse mit barbarischen Stämmen ein, um seine Grenzen und Außenbezirke zu schützen. Doch jeglicher Frieden und jegliche Sicherheit sind bloßer Schein und von kurzer Dauer, denn von überall her droht die Gefahr. Wer “Herr der Ringe” oder “Game of Thrones” mag, sich aber mehr Realismus wünscht, der findet in den “Chroniken der Völkerwanderung” von Felix Dahn womöglich eine Offenbarung. In altertümlicher und poetischer Sprache lässt Dahn die Spätantike und das Frühmittelalter wiederauferstehen. Helden, Könige und Könniginnen begegnen uns hier mit zaubervollen Namen und phantastischen Taten. Und doch sind viele Teile der erzählten Geschichten und viele der Figuren echt. Jeder der 13 Bände der “Chroniken der Völkerwanderung” ist eine in sich geschlossene Geschichte und lässt sich unabhängig von den übrigen Teilen der Reihe lesen. Zugleich bilden die einzelnen Teile eine chronologische Abfolge und sind aufgrund der historischen Zusammenhänge miteinander verknüpft. “Stilicho” ist der vierte Band der Reihe “Chroniken der Völkerwanderung” und besteht seinerseits aus drei Teilen. Der Umfang des kompletten vierten Bandes entspricht ca. 250 Buchseiten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
FELIX DAHN
STILICHO
DER RÖMISCHE HEERMEISTER
T R I L O G I E
KOMPLETTAUSGABE
HISTORISCHER ROMAN
390 A.D.
CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG 4
Dieses Buch ist Teil der BRUNNAKR Edition: Fantasy, Historische Romane, Legenden & Mythen.
BRUNNAKR ist ein Imprint des apebook Verlags.
Nähere Informationen am Ende des Buches oder auf:
www.apebook.de
1. Auflage 2020
V 1.0
ISBN 978-3-96130-327-4
Buchgestaltung/Coverdesign: SKRIPTART
www.skriptart.de
Alle Rechte vorbehalten.
© BRUNNAKR/apebook 2020
Bleibe auf dem Laufenden über Angebote und Neuheiten aus dem Verlag mit dem lesenden Affen und
abonniere den kostenlosen apebook Newsletter!
Erhalte zwei eBook-Klassiker gratis als Willkommensgeschenk!
Du kannst auch unsere eBook Flatrate abonnieren.
Dann erhältst Du alle neuen eBooks aus unserem Verlag (Klassiker und Gegenwartsliteratur)
für einen sehr kleinen monatlichen Beitrag (Zahlung per Paypal oder Bankeinzug).
Hier erhältst Du mehr Informationen dazu.
CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG
DIE BATAVER: Der Aufstand der Verbündeten (69 A.D.)
JULIAN: Der Abtrünnige (337 A.D.)
BISSULA: Die geliebte Sklavin (378 A.D.)
STILICHO: Der römische Heermeister (390 A.D.)
ATTILA: Der Hunnenkönig (453 A.D.)
FELICITAS: Der Zug der Germanen (476 A.D.)
CHLODOVECH: Der König der Franken (481 A.D.)
GELIMER: Letzter König der Vandalen (534 A.D.)
FREDEGUNDIS: Die kaltblütige Königin (570 A.D.)
LEOVIGILD: Der Vater und die Söhne (579 A.D.)
DAS KLOSTER: Die schlimmen Nonnen von Poitiers (589 A.D.)
DIE BAJUWAREN: Die Siedler vom Chiemgau (596 A.D.)
EBROIN: Herrscher der Franken (638 A.D.)
Inhaltsverzeichnis
STILICHO
Impressum
Karte
ERSTES BUCH
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
ZWEITES BUCH
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
DRITTES BUCH
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
Eine kleine Bitte
CHRONIKEN DER VÖLKERWANDERUNG
BRUNNAKR Edition
Buchtipps für dich
A p e B o o k C l a s s i c s
N e w s l e t t e r
F l a t r a t e
F o l l o w
A p e C l u b
L i n k s
Zu guter Letzt
KARTE
von
»GERMANIEN«
ERSTES BUCH
I
In dem Palatium des großen Kaisers Theodosius zu Mailand diente ein umfangreicher, auf allen vier Seiten von Säulengängen umgebener Hof den kriegerischen Spielen der vornehmen Knaben und Jünglinge wie der Römer so der vielen befreundeten oder auch unterworfenen Völker, die als Zöglinge, als »Gäste«, in Wahrheit oft als Geiseln, unter Aufsicht und Gewalt des Imperators in Italien lebten.
In diesem Hofe tummelten sich gegen Ende des vierten Jahrhunderts unter Römern, Griechen, Asiaten auch zahlreiche junge Germanen von mancherlei Stämmen. Der Älteste von diesen, auch seiner Volksgenossen hohe Gestalten um Haupteslänge überragend, aber das blonde Haar nach Römersitte kurz geschnitten und den sprossenden Flaumbart beschoren, in römische Tunika gekleidet, mit römischen Sandalen beschuht, hatte sich aus dem Getümmel der wettspielenden Genossen zurückgezogen und auf eine der hohen Stufen des Säulengangs gesetzt, von wo er sinnend das Auge über die eifrig, ja hitzig mit Ringen, Speerwurf, Pfeilschuß Wettkämpfenden gleiten ließ.
Lange saß er so, ruhig, verhalten, mit ernsterem Ausdruck als seinen Jahren zukam. Da störte ihn aus seinem Nachdenken auf ein etwa fünf Jahre jüngerer Freund, der, ebenfalls unverkennbar ein Germane, nichts Römisches an sich trug, sondern in allen Stücken die Tracht seines Volkes.
»Eh Stilicho, höre!« rief er mit heller, wohllautender Stimme in der Sprache der Westgoten, einen gotischen Wurfspeer schwingend, »hast du gesehen wie ich eben den Schild der römischen Legionäre – aus norischem Erz! – dicht am Stachel mit dem Wurfger durchbohrte? Hei, gotischer Speer bricht römischen Schild! Nicht du könntest stärker werfen!« – »Vielleicht nicht,« lächelte der andre. »Aber schärfer zielen. Hast du vergessen...?»« – »Beim Schwerte Gottes, ich vergeß es nicht! Wie du neulich meinen Speer, der den Zielring der Scheibe getroffen, mit deiner Lanze zerspellt!« – »Scharf zielen, mein Alarich, ist noch besser als stark werfen.«
»Wohl, wohl! – – Aber laß doch dies Latein. Sprich dein Vandalisch wie ich mein Gotisch: wir verstehen uns damit prächtig. Sind wir doch alle Goten, deine Vandalen wie wir.« – »Ja, aber ich habe seit des Vaters Tod fast ganz vergessen sie zu sprechen, die Sprache der...« – »Barbaren, willst du sagen,« rief Alarich zornig. »Hei, darüber ließe sich viel reden.« – »Gewiß, mein Wildfang! Aber ich fürchte, wir sind – beide! – noch zu jung, was Gescheites darüber zu reden.« – »Magst Recht haben!« rief Alarich, ließ die Lanze fallen und sprang mit einem Satz die mehreren Marmorstufen hinan, sich neben ihm niederlassend und vertraulich an seine Schulter lehnend: »Uf! Macht Speerwerfen heiß in diesem schönen, aber schwülen Land! Oh, Vetter Ataulf, sorg' uns für einen kühlen Trunk!«
»Gern,« antwortete ein ihm ungefähr gleichaltriger, aber ganz hervorragend, ganz auffallend schöner Jüngling in wallendem Goldgelock. »Komm mit, Heraclian, hilf aussuchen: du verstehst dich auf die Falerner des Imperators.« – »Aber nicht für Goten und Vandalen,« erwiderte ein junger Römer mit feindseligem Blick. »Ihr Bären!« – »So spüre denn des Bären Pranken!« rief Ataulf, sprang von vorn auf ihn zu, hob ihn im Ringkampf flugs in die Höhe und hätte ihn auf den Rücken in den hochaufgeschütteten Sand geworfen, wäre nicht ein andrer junger Römer plötzlich hinterrücks herangesprungen und hätte ihn niedergerissen, so daß beide Ringer auf den Boden rollten.
Sofort war Ataulf wieder auf den Füßen und faßte den Überfallenden an der Gurgel: »Carinus! Elender Neiding!« – Aber dieser Römer war stark und zäh: er riß sich los, sprang zurück, raffte eine Lanze aus dem Stand der Speere an der Wand und fällte sie gegen Ataulfs Brust. – Da sauste mit einem Sprung Stilicho herab und warf sich zwischen den Römer und den Goten: »Halt! Haltet an! Wollt ihr des Imperators Haus und Wirtlichkeit mit Blut beflecken? Er riß Carinus den Speer aus der Hand.
Auch Alarich trat jetzt herzu: »Was hast du, Vetter, mit den beiden Walen?« – »Ah,« meinte der die Faust drohend erhebend, »der eine gönnt uns keinen Tropfen Wein, der andere überhaupt gar nichts.« – »Am liebsten nicht einmal das Leben. Ihr Barbaren seid das Unglück des Römerreichs,« sprach Heraclian, eines Senators Sohn, und schritt hinaus. – »Und Carinus?« fragte Stilicho. Bevor Ataulf antworten konnte, rief jener: »Wenn dieser gelbzottige Skythe noch einmal wagt, der Kaisertochter Placidia auf seiner mißtönigen Harfe vorzuklimpern – so tief sind wir gesunken im Haus des Imperators! – reiß' ich ihm die blauen Glotzaugen aus.« Damit folgte er seinem Freund Heraclian. »Sind liebe Leute!« lachte Alarich, ihnen nachblickend. – »Bei aller imperatorischen Pracht, – ich find' es unbehaglich in diesem Palatium. Ah, hoffentlich ruft der Vater mich und den Vetter, seinen Mündel, bald ab aus dieser – wie soll ich sagen? – Erziehung oder Vergeiselung? hinaus in die rauhen Wälder und zu den Auerstieren am Danubius! Sind mir lieber als diese giftgeschwollnen Walen. Ungern, Freund Stilicho, laß ich dich hier zurück.«
»Warum? Ich gehöre hierher. Wohin sollte ich gehen?« – »Du kannst fragen? Zu deinem Volk! Dahin gehörst du.« – »Ja,« meinte Ataulf, »zu den tapfern Vandalen in Pannonien. Man sagt ja, du stammest aus ihrem Königsgeschlecht, den Asdingen.« – »Gewiß! Aber der Vater befahl mir sterbend, – für den großen Imperator starb er, nach einem Sieg über die Franken – todwund brachten sie ihn mir über die Alpen hierher – er befahl mir, bei Theodosius und dessen Haus solang ich lebe auszuharren in treuem Waffendienst für Rom. Er stammelte dann noch was von Dankespflicht, von Sühnen einer Schuld, – ich konnt' es nicht mehr verstehn. Aber er ließ mich schwören. Ich schwor: und nun halt ich meinen Eid.«
II
Und viele Jahre verstrichen. – Aus dem Jüngling Stilicho war ein reifer, ein herrlicher Mann geworden, ein Held, der in vielen Schlachten die germanischen Reitergeschwader Roms zum Siege geführt hatte: gegen Anmaßer, die sich wider Theodosius erhoben, aber auch gar oft gegen Germanen von allerlei Stämmen. Jedoch auch ein Staatsmann war er, der, von aller Bildung der damaligen Römerwelt durchdrungen, in dem Rat des großen Imperators eine stets befragte, meist befolgte Stimme führte.
Jetzt kam dieser edle Herrscher zu sterben: und er wußte das und bestellte sein Haus und sein Reich. Er entließ die vornehmen Beamten des Palastes, die er zu sich beschieden, und gebot, Stilicho zu rufen. Mit feindseligen Neidesblicken sahen die scheidenden Römer den »Barbaren« – allein – über die Schwelle des kaiserlichen Schlafgemachs schreiten.
Der Imperator winkte ihm, sich auf den Rand des niederen Pfühls zu setzen, richtete sich auf aus den Kissen und begann: »Ich schließe die Augen leichter, Magister militum, hat mein letzter Blick auf dir geruht. Denn – mag es meinen Stolz – den eines Römers vom ältesten Adel der Quiriten! – schmerzen – das Reich Cäsars, das Reich Trajans ist so weit gekommen, daß nach meinem Tod ein Germane seine stärkste, ach fast seine einzige Stütze sein wird. Stütze, Schild gegen Feinde auf allen Seiten – vor allem gegen deine Germanen. Großes, Größtes vertrau' ich dir an. Wohl hab' ich dich schon bisher hoch geehrt, dir mehr vertraut als allen Römern meines Hofes: meine Lieblingsnichte, die fromme Serena, hab' ich dir vermählt, dich so zu einem Glied meines Hauses erhoben: aber jetzt erst – nach meinem Tode – sollst du mein höchstes Vertrauen ...« Er stockte: Schwäche hemmte ihm die Zunge. Nach einer Weile fuhr er fort: »Nimm die Urkunde dort aus jener Kapsel. Du weißt, meine Erben sind zwei Knaben: Arcadius, der ältere, soll in Byzanz das Ostreich . . ach, ,beherrschen?' Ihn und das Ostreich wird Rufinus leiten.« – »Mein Todfeind,« dachte Stilicho, »schon seit der Schulzeit.« Aber er verneigte sich und schwieg. – »Honorius aber, das Kind, und das Westreich sollst du mir schützen, zum Guten führen, beherrschen: du, der Vandale, das ewige Rom!« – »Du ehrst mich hoch, Imperator.« – »Aber versprich mir: nie, niemals Krieg zwischen den Brüdern!« – »Behüte! Welch Unheil wär's für beide!« – »In allen Stücken, die das Ostreich angehen, gehorchst du Arcadius.« – »Und Rufinus,« dachte Stilicho. – »Er ist dein Herr wie Honorius. Und nun kommt das Letzte, Schwerste für dich zu vernehmen. Ich hab' es dir erspart bis zur letzten Stunde meines Lebens. Erfahre jetzt, daß ich besondern Grund habe, dir zu – mißtrauen.«
»Theodosius,« rief Stilicho tief verletzt und sprang auf. – »Still. Höre! Ich habe nicht mehr viel Zeit. – Wenn nun doch einmal der Germane, der Vandale in dir – das liegt ja im Blut! – sich so mächtig regte, daß du – bei aufgezwungener Entscheidung! – mehr als Germane denn als Römer fühltest, dachtest, handeltest?« – »Oh Imperator! Allüberall, im Palast, im Heer, in Italien, in den Provinzen, tritt mir dies Mißtrauen, dieser Haß gegen den ,Barbaren' entgegen: bald heimlich, bald offen drohend. Das hemmt meine Schritte, das verbittert, vergiftet mein Leben. Die Germanen schelten mich abtrünnig, die Römer schelten mich den rohen, treulosen Barbaren. Wohl: es ist mein Schicksal, es wird der Kampf meines Lebens – mit andern. Aber, daß auch mein Kaiser, daß du...! Du hast kein Recht zu solcher Kränkung.« – »Doch ... vielleicht. Wär's denn ein Wunder, wär's ein schändliches Geschehnis, wenn im Widerstreit deines römischen Staates und deines germanischen Blutes dieses einmal – vorübergehend! – siegte?« »Das ist unmöglich!« – »Das ist möglich: denn es ist geschehn.« – »Wie? Wer? Welcher Verräter ...?« – »Schweig! Schilt ihn nicht: denn es war dein Vater.«
Stilicho fuhr auf-. »Mein ... mein Vater? Nein!«
»Ja. Er focht lange tapfer und treu für mich. Aber kurz vor seinem Tode drangen in das Reich – dort in Pannonien – seine Volksgenossen, die Vandalen: sie verhandelten mit ihm, der den Limes verteidigte – in seiner Sprache: lange hatte er sie nicht gehört: mächtig drang sie an sein Ohr, allzumächtig in sein Herz: er wollte zu ihnen übergehn – gegen Rom.« – »Undenkbar!« – »Dort ... in jenem Schrein liegt sein aufgefangener Brief an König Wisumer. Ich rief ihn ab, bevor er den Plan ausführen konnte. Hier, in diesem Gemach, an jenem Fenster dort, zeigte ich ihm den Brief und – begnadigte ihn.« – »O Theodosius!« – »Er fiel mir zu Füßen und rief: ,Ach Imperator, du weißt nicht, wie stark, wie zwingend das Blut, das Volksblut im Manne wirkt. Sollte ich die Meinen zusammenhauen? Du weißt nicht ...!' Aber ich wußte. Auch ich habe ja ein Volk, bin ein Römer. Und ich verzieh ihm, ließ ihm Rang und Würden, vertraute – unbeschränkt! – seinem Sohn. Aber du begreifst: was den Vater hingerissen, könnte auch den Sohn ...« – »Niemals! Ich schwör's.« – »Gut. So schwöre auf diesen Splitter vom Kreuze Christi, – in jener Arca liegt er – daß du dich solang du atmest nur als Römer fühlen wirst, als Schirmer dieses Reiches, nie abfallen wirst in Tat oder Gedanken zu deinen Germanen.«
Stilicho, tief erschüttert, trat dicht an das Bett: »Laß den Splitter von altem Holz, laß auch den Schwur. Ich verspreche dir hier mit dem Schlag meiner Rechten auf Treu' und Ehre – Splitter und Eid würden mich nicht fester binden – ich gelobe, ich werde tun, wie du begehrst. Ich gelobe es auf mein Schwert.« Und er legte die Hand auf den ehernen Griff.
»Seltsam,« sprach der Kranke. »Er verspricht Rom, ein Römer zu sein – auf germanische Art. Aber du wirst's halten, ich weiß. – Und nun, mein Freund, meine einzige Hoffnung für des Reiches Zukunft, nun das Letzte: nimm dies Kodizill zu meinem Testament – dort – in dem Geheimfach der Marmorwand – links – öffne es nach meinem Tod: – aber allein. Und halt' es geheim solang wie irgend möglich. Hoffentlich – ich flehe darum zu Gott! – hoffentlich wirst du nie nötig finden, es zu brauchen. Wird es aber nötig – ah entsetzlich! –, dann brauch' es schonungslos. Erst das Reich, dann erst meine Söhne. – Geh jetzt, laß mich. Ich will allein sterben: mit den Menschen bin ich fertig: nun muß ich mit meinem Gott reden.«
III
Und abermals waren viele Jahre verflossen. Stilicho hatte, seinem Worte getreu, nur für das Römerreich gelebt in Krieg und Frieden, zunächst für das ihm besonders anvertraute Westreich. Siegreich hatte er in Italien, in Gallien, in Rätien, in Noricum, am Po, am Rhein, an der Donau. Einfälle der Germanen von gar manchen Stämmen abgewehrt. Sein und der Kaisernichte Serena Sohn, Eucherius, war zum stattlichen Jüngling herangewachsen. Den Imperator Honorius hatte er, ihn noch fester an sich zu fesseln als durch die Dankbarkeit – sie ist oft gar schwach bei kleinen Menschen auf Kaiserthronen – mit seiner Tochter Maria, dann, nach deren frühem, kinderlosem Tod, mit der zweiten, Thermantia, vermählt. Allein dies war der erste Plan, der dem erfolgreichen Staatsmann fehlschlug: der Hof wußte, – oder flüsterte doch – daß die beiden Bräute von dem fast noch knabenhaften Bräutigam unberührt geblieben waren, und die Eunuchen des Palastes flüsterten noch leiser, der Grund sei, daß dem Imperator seine üppig schöne und geistig allen Frauen – und sehr vielen Männern! – des Hofes, ja des Reiches überlegene Halbschwester, Galla Placidia, viel besser gefalle als seine beiden Frauen und alle Frauen, die er kannte.
Mit Gram sah der Vater wie die erste so die zweite Tochter, seinen Liebling, in allem Pomp der Kaiserschaft, vom Gatten vernachlässigt, dahin welken. Er entschloß sich kühn und offen, wie er war, Abhilfe zu suchen da, wo ihm die Wurzel des Übels zu liegen schien: bei Placidia selbst.
Vorsichtig, schonend begann er in dem Sprechsaal des Palastes zu Mailand ein Zwiegespräch mit der Warnung vor dem – »freilich ja verleumderischen!« – Gerede der zahlreichen Priester am Hofe, die an der Zärtlichkeit der Geschwister Anstoß nahmen, ja sogar mit leisen Andeutungen schon in ihren Predigten ... Aber übel kam er an! Das von Gesundheit und Kraft strotzende, von Schönheit strahlende Geschöpf schüttelte das prachtvolle blauschwarze Gelock, das von der goldnen Stirnbinde kaum gebändigt werden konnte und lachte dem Mächtigen übermütig, aber so anmutig ins Gesicht, daß er ihr nicht zürnen konnte: »Ei, lieber Held und Barbarenbesieger, wer sagt dir, daß sie verleumden?« – »Placidia!« – »Nun, nun, nur nicht gleich das Ärgste denken von der armen Kaisertochter, tugendsamer Germane! Was kann ich dafür, daß ich schöner bin als alle Mädchen und Frauen, die ich je gesehn? Und daß ich das so gut weiß? Nun, es ist kein Wunder: haben es mir doch alle Männer gesagt, die ich je gesehn: – ausgenommen du, gestreng ernster Magister militum! Und das soll mich nicht freuen? Dann wär' ich kein Weib! Ich bin aber eins, ach, so sehr.« Sie lachte vor sich hin: »Denke nur, gestern hätten sich Ataulf, der Gesandte der Westgoten – ein bildschönes Stück von einem Barbaren, ja ein germanischer Apoll!« – sie errötete leicht – »und der Präfekt Carinus – schon als flaumbärtige Buben haben sie sich um mich gerauft! – schier mit den Schwertern um mich beworben, wild mir nahend: aber ich lief davon und setzte mich an des Imperators Seite. Großer Staatslenker und Schlachtensieger, ich hoffe, ich bring' es noch zu höherer Macht im Reich mit meiner Schönheit als du mit all' deiner Weisheit und Heldenschaft. Und hab' ich Mäuslein – treulich hielt ich stets zu dir! – nicht schon manches Netz zernagt, das seine Feinde über des Löwen Haupt geworfen? Ich bin deine beste Verbündete: also freue dich, hält der Kaiser was auf Placidia. Aber vergib: ich enteile. Er hat mich zu sich befohlen: und ›dem Herrscher gehorchen ist höchstes Gesetz‹ – oder doch höchste Schlauheit.« Und wieder lachte sie und schwebte anmutvoll hinaus.
Er sah ihr sinnend, kopfschüttelnd nach: »Ich werde nicht klug aus dem herrlichen Mädchen! Was ist stärker in ihr? Die Lust zu herrschen wie eine Kaiserin – eben als des Theodosius Tochter – oder des Weibes Drang, gepriesen zu werden? Sollte nicht bald in ihr auch ein andrer Drang erwachen: der, geliebt zu werden? Heißer noch, der Drang zu lieben? Mir ist, sie wirft sich in die Herrschsucht, jenem holden Sehnen zu entrinnen: sie will nicht Weib, – Herrscherin will sie sein. Wie lang noch wird ihr das genügen? Und was dann, wann das andre kommt? Dann, fürcht' ich, werden Westreich und Ostreich zusammen nicht ausreichen, dieses Weib abzuhalten von seinem ›Glück‹ – oder von seinem Verderben!«
IV
Nachdenklich wollte er das dumpfe Gemach verlassen, draußen auf dem weiten Reitplatz vor dem Palast durch eine Schau über die neu angeworbenen germanischen Leibwachen – die »Custodes« – des Kaisers sich zu erfrischen, da traten über die Schwelle seine Gattin und sein Sohn, offenbar in Unfrieden untereinander: seufzend bemerkte das der Gemahl und Vater.
Serenas edle Züge hatten unter den Jahre hindurch fortgesetzten frommen Übungen einen allzustrengen, ja finsteren Ausdruck angenommen: sie begann: »Herr Sohn, verklage mich beim Vater wenigstens in meiner Gegenwart,«
Der Jüngling mit den traurigen Augen schüttelte die dunkeln Locken: »Mutter, ich wagte nur, zu bitten.« – »Aber als das nichts half, da wardst du ...« – »Betrübt. Nicht meinethalben wahrlich.« – »Was ist?« fragte Stilicho ermüdet.
»Es ist, daß dein Sohn ein halber Heide ist. Ja, ja! Er verkehrt, er lebt nur mit Künstlern, Kunstforschern, Gelehrten und Poeten: man weiß aber, all' diese Menschen denken mehr an Apollo denn an Christus. Und zumal sein Busenfreund, der junge Claudian, der Versedrechsler! Man sagt, der sei ein ganzer Heide.« – »Jedenfalls ein ganzer Dichter,« sprach Stilicho ernst, »der größte seit Vergilius.« – »Unser Sohn verdirbt es mit der heiligen Kirche!« – »Die möchte am liebsten mich verderben,« lächelte der Vater bitter. – »Am letzten Sonntag soll sogar schon in der Basilika Sankt Johannis gegen ihn und gegen Claudian gepredigt worden sein.« – »Gegen was und gegen wen predigen sie nicht, diese deine Heiligen auf Erden!« – »Nicht gegen dich, da sei Gott vor,« rief sie erschrocken. »Wir dürfen nicht die Gunst der Heiligen verwirken, nicht der im Himmel, nicht der auf Erden.« – »Unter diesen sind gar sonderbare,« grollte Stilicho. »Aber euer Streit ...?«
»Kein Streit, Vater, Ich bat nur die Mutter ...« – »Zurückzuweichen vor dem Zorn seiner heidnischen Freunde und Götzendiener! Ich erfuhr, daß in dem längst – seit Constantius – geschlossenen Tempel der Rhea das Marmorbild der Götzin eine kostbare Halskette trage. Was braucht die Dämonin solchen Schmuck? Ich ließ mir die Cella öffnen, nahm den Schmuck ...« – »Ei nicht doch!« zürnte der Gatte. – »Warte doch mit deiner Schelte! Nicht für mich wahrlich! Es sind herrliche Perlenschnüre. Ich schenkte sie dem Bild der heiligen Jungfrau in ihrer ärmlichen Kapelle jenseit des Tibers. Das erfuhren die Heidenfreunde – und sie toben.« – »Sie toben nicht, Mutter, sie klagen.« – »Wie erfuhren sie's?« forschte Stilicho. – »Ja, wie? Durch Rechtsbruch! Denn immer noch stehlen sich die Götzendiener, kirchlichen und weltlichen Gesetzen trotzend, durch Bestechung der Pförtner in ihre gesperrten Tempel, dort zu opfern. So fanden sie's aus. Keinesfalls darfst du der Heiligen einen Schmuck wieder nehmen, den sie einmal hat. Schwer würde sie zürnen!«
Stilicho lächelte: »Ist also wie andere Frauen!« Nun aber furchte er die Brauen: »Ich werde dem Tempel – er ist nur geschlossen, nicht eingezogen – den Wert ersetzen, obwohl ich des Geldes zur Zeit zu ganz anderem dringend bedarf. Übrigens, Eucherius, glaubst du an die Wunder der Göttin Rhea?« – »So wenig, mein Vater, wie an die der Jungfrau Maria.« – »Unseliger!« rief die Mutter und schlug ein Kreuz.