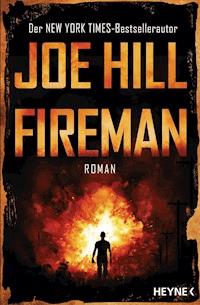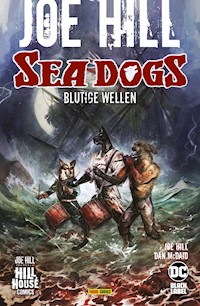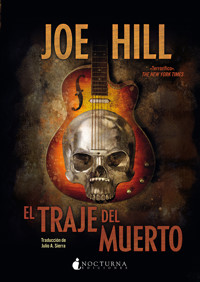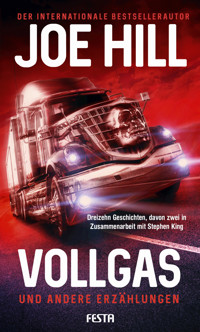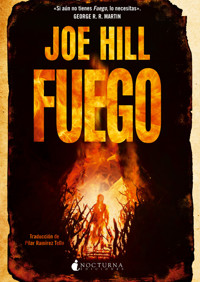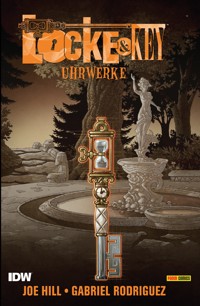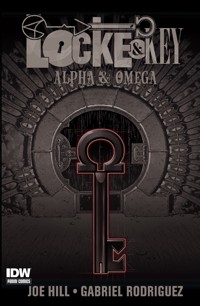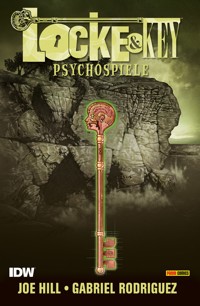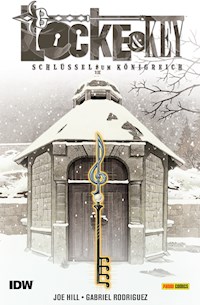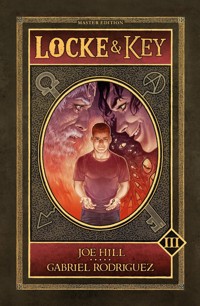5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Vier literarische Juwelen, die unseren ständigen Krieg zwischen Gut und Böse ins Extreme treiben. SCHNAPPSCHUSS ist die verstörende Geschichte eines Jungen, der von einem brutalen Schläger bedroht wird. Dieser besitzt eine Sofortbildkamera, die Erinnerungen löscht, Schnappschuss für Schnappschuss … HOCH OBEN: Ein junger Mann fliegt für seinen ersten Fallschirmsprung hoch in den Himmel … und landet auf einer festen Wolke, die von einem eigenen Verstand belebt zu sein scheint und Gedanken lesen kann. REGEN: An einem scheinbar gewöhnlichen Tag in Colorado öffnen sich die Wolken und es regnet Kristallsplitter, die jede Person zerfetzen, die ohne Deckung ist. Dieses Phänomen droht sich wie eine Apokalypse auf der ganzen Welt auszubreiten. In GELADEN stoppt der Sicherheitsbeamte eines Einkaufszentrums mutig eine Amokläuferin und wird zum Helden der modernen Waffenrechtsbewegung. Doch als eine Reporterin die wahren Hintergründe der Geschichte aufdeckt, dreht der Beamte durch … Kirkus Reviews: »Falls du noch kein Fan von Joe Hill bist, wird dich dieses Buch dazu machen.« Lauren Beukes: »Joe Hill war schon immer gut, aber mit diesem Buch hat er etwas Brillantes geschaffen, anspruchsvoll und originell. Er ist ein Meister des Erzählens, der mit Feuer in den Adern schreibt.« SciFiNow: »Sehr gut gezeichnete Figuren, einige heftige Schockmomente und ein großartiger Sinn für Humor.« Mail on Sunday: »Er greift die Ängste von uns allen auf, dass die Welt untergeht.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 769
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Susanne Picard
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe
Strange Weather: Four Short Novels
erschien 2017 im Verlag William Morrow.
Copyright © 2017 by Joe Hill
Copyright © dieser Ausgabe 2020 by Festa Verlag, Leipzig
Veröffentlicht mit Erlaubnis des Verlages William Morrow,
ein Imprint of HarperCollins Publishers, LLC.
Titelbild: Alan Dingman
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-877-3
www.Festa-Verlag.de
Inhalt
Impressum
SCHNAPPSCHUSS
GELADEN
HOCH OBEN
REGEN
Joe Hill
Entdecke die Festa-Community
SCHNAPPSCHUSS
Kapitel 1
Shelly Beukes stand am Fuß der Auffahrt und starrte mit konzentriertem Blick zu unserem Bungalow aus rosafarbenem Sandstein herüber, als sähe sie das Haus heute zum ersten Mal. Sie trug einen Trenchcoat, der Humphrey Bogart alle Ehre gemacht hätte, und hatte eine große Umhängetasche aus mit Ananas und tropischen Blumen bedrucktem Stoff um die Schulter geschlungen. Man hätte glauben können, sie sei auf dem Weg zum Einkaufen, wenn sich ein Supermarkt oder so etwas in Laufweite befunden hätte, was nicht der Fall war. Ich musste zweimal hinsehen, bevor ich bemerkte, was mich an ihrem eigentlich ganz normalen Anblick so irritierte: Sie hatte vergessen, Schuhe anzuziehen. Ihre nackten Füße waren schmutzig, sie starrten förmlich vor Dreck.
Ich war gerade in der Garage und experimentierte herum. Jedenfalls nannte mein Vater das so, wenn ich beschloss, an einem völlig intakten Staubsauger oder der einwandfrei funktionierenden Fernbedienung des Fernsehers herumzubasteln. Ich machte dabei mehr kaputt, als ich reparierte, auch wenn ich es einmal geschafft hatte, einen Joystick meines alten Atari-Computers in eine Art Radio umzubauen, sodass ich mit dem »Feuern«-Knopf von Sender zu Sender schalten konnte. Das war natürlich ein ausgesprochen alberner und nicht sehr sinnvoller Trick. Nichtsdestotrotz hatte er die Juroren der Wissenschaftsmesse im achten Schuljahr beeindruckt und mir glatt das Blaue Band für Kreativität eingebracht.
An dem Morgen, an dem Shelly am Fuß unserer Auffahrt auftauchte, arbeitete ich gerade an einer Partykanone. Sie sah aus wie ein Todesstrahlengewehr aus der guten alten Science-Fiction-Zeit der 60er-Jahre, mit einer großen, zerbeulten Messingtrompete als Lauf und dem Abzug und dem Griff einer Luger (ich hatte tatsächlich eine Trompete und ein Spielzeuggewehr für den Bau verwendet). Wenn man den Abzug betätigte, erklang eine laute Tröte, kleine Glühbirnen leuchteten auf und das Ding spuckte einen Schwall Konfetti und Papierschlangen aus. Mir schwebte vor, dass – wenn ich das Ding nur richtig zum Laufen bekam – mein Vater und ich es an Spielzeugunternehmen, vielleicht sogar ein etwaiges Patent an Spencer Gifts persönlich, verkaufen könnten. Wie das bei den meisten Hobbyingenieuren so ist, versuchte ich mich also zum größten Teil an Basteleien, die kaum über das Niveau von Schülerstreichen hinausgingen. Aber bei Google arbeitet bis heute ja auch niemand, der nicht davon geträumt hätte, eine Röntgenbrille zu erfinden, um Mädchen damit unter den Rock zu gucken.
Ich richtete den Lauf meiner Partykanone auf die Straße, als ich Shelly das erste Mal sah. Sie stand genau in meinem Blickfeld. Ich ließ meine Superspaßknarre sinken, blinzelte und nahm sie genauer in Augenschein. Fakt war, ich konnte sie sehen, sie mich aber nicht. Von ihrem Standpunkt aus war die offen stehende Garage wohl auch kaum mehr als eine finstere Höhle, deren Inneres dunkel war wie die undurchdringliche Schwärze eines offen stehenden Bergbauschachts.
Ich wollte sie schon ansprechen, aber dann fiel mein Blick auf ihre Füße und die Worte blieben mir im Hals stecken. Ich rührte mich also nicht, gab keinen Ton von mir und beobachtete sie eine Weile. Ihre Lippen bewegten sich, als spräche sie mit sich selbst.
Sie warf einen Blick über die Schulter in die Richtung, aus der sie gekommen war, als hätte sie Angst, dass sich jemand an sie heranschleichen könnte, doch da war niemand. Die Welt war unter den tief hängenden Wolken schwül und still. Ich erinnere mich daran, dass alle Nachbarn ihren Müll herausgestellt hatten. Doch die Müllabfuhr war spät dran und so stank es in der Straße nach Fäulnis und Abfall.
Fast von Anfang an stand ich unter dem Eindruck, es sei wichtig, nichts zu tun, was Shelly erschrecken könnte. Eigentlich gab es keinen Grund dafür, so vorsichtig zu sein, aber viele unserer besten Gedankengänge finden im Unbewussten statt und haben nichts mit Vernunft zu tun. Das Unterbewusstsein nimmt viele Informationen auf, die nichts weiter sind als subtile Hinweise, die wir gar nicht als solche wahrnehmen.
Als ich also die geschwungene Auffahrt hinabging, hatte ich die Daumen in die Taschen meiner Jeans geklemmt und sah Shelly nicht einmal direkt an. Ich blinzelte in die Ferne, als verfolgte ich mit meinem Blick ein Flugzeug, das weit über uns dahinzog. Ich ging auf sie zu, wie man auf einen humpelnden, streunenden Hund zugeht, einen, der einem entweder in hoffnungsvoller Zuneigung die Hand lecken wird, wenn man herankommt, oder der vielleicht mit gebleckten Fangzähnen auf einen zuspringt und knurrend die Zähne fletscht. Ich sagte nichts, bis ich auf fast eine Armlänge an sie herangekommen war.
»Oh. Hallo, Mrs. Beukes«, sagte ich dann und tat so, als sähe ich sie nun zum ersten Mal. »Ist alles in Ordnung mit Ihnen?«
Ihr Kopf wirbelte zu mir herum, ihr rundliches Gesicht verzog sich sofort zu einer freundlich-sanften Miene. »Also, jetzt bin ich aber ganz verwirrt! Ich bin den ganzen Weg hierhergelaufen, aber ich weiß gar nicht mehr, warum eigentlich! Heute ist doch gar nicht der Tag zum Putzen!«
Das hatte ich nicht erwartet.
Es hatte tatsächlich einmal eine Zeit gegeben, in der Shelly dienstags und freitags jeweils ein paar Stunden zu uns gekommen war und das Haus sauber gemacht hatte. Schon damals war sie alt gewesen, hatte aber dennoch die geschmeidige Kraft einer Sportlerin von olympischem Rang besessen. Freitags brachte sie in der Regel einen Teller weicher, mit Datteln gefüllter Kekse mit, die unter einer Klarsichtfolie lagen. Mann, das waren vielleicht Kekse! So was kriegt man heutzutage gar nicht mehr, und mit einer Tasse Tee waren sie so gut, so gut wäre nicht einmal die Crème brulée im Vier Jahreszeiten gewesen.
Aber im August 1988 stand ich nur ein paar Wochen davor, auf die High School zu gehen, und Shelly hatte mein halbes Leben bis dahin für uns aufgeräumt und sauber gemacht. 1982 hatte sie aufgehört, weil man ihr einen dreifachen Bypass gelegt und der Doktor ihr geraten hatte, sie solle sich erst einmal erholen. So war es seither geblieben. Ich hatte eigentlich nie so recht darüber nachgedacht, aber wenn ich das getan hätte, hätte ich mich wohl gewundert, warum sie den Job überhaupt erst angenommen hatte. Es war nicht so, als hätte sie das Geld nötig gehabt.
»Mrs. Beukes? Hat mein Vater Sie vielleicht angerufen und hergebeten, damit Sie Marie helfen?«
Marie war die Frau, die dann an Shellys Stelle gekommen war, eine stämmige, nicht besonders intelligente junge Frau Anfang 20, die laut lachte und einen herzförmigen Hintern besaß, der mir nachts regelmäßig in meinen feuchten Träumen erschien. Eigentlich konnte ich mir nicht vorstellen, warum mein Vater dachte, dass Marie wohl Hilfe bräuchte. Wir erwarteten meines Wissens keine Gäste. Ich kann mich nicht einmal erinnern, dass wir jemals welche gehabt hätten.
Shellys Lächeln bröckelte kurz. Sie warf wieder einen dieser ängstlichen Blicke über die Schulter auf die Straße. Als sie sich wieder mir zuwandte, war der freundlich-sanfte Gesichtsausdruck so gut wie verschwunden. Aus ihren Augen sprach Furcht.
»Keine Ahnung, Bucko. Sag du’s mir doch! Hätte ich die Wanne putzen sollen? Ich weiß, ich bin letzte Woche nicht dazu gekommen, und jetzt hätte sie es wohl nötig.« Shelly griff in ihre Stofftasche, kramte darin herum und begann, Unverständliches in sich hineinzumurmeln. Als sie wieder aufsah, hatte sie die Lippen fest aufeinandergepresst und sah frustriert aus. »Ach, scheiß drauf. Ich bin aus dem Haus gegangen und hab dabei das verdammte Putzmittel vergessen.«
Ich zuckte zusammen. Ich hätte nicht verwirrter sein können, wenn sie den Trenchcoat ausgezogen hätte und darunter nackt gewesen wäre. Shelly Beukes entsprach vielleicht nicht jedermanns Vorstellung einer adretten alten Dame; ich erinnerte mich sogar daran, wie sie einmal in einem alten John-Belushi-T-Shirt geputzt hatte, aber dass sie fluchte, hatte ich nie gehört. Dieses »Scheiß drauf« war um einiges deftiger als das, was ich von ihr gewohnt war.
Shelly bemerkte meine Überraschung gar nicht. Stattdessen sprach sie einfach weiter. »Sag deinem Vater, dass ich mich morgen um die Badewanne kümmern werde. Ich brauche nicht länger als zehn Minuten dafür, dann strahlt sie wieder so sauber und rein, als hätte nie jemand mit seinem Arsch dringesessen.«
Ein Träger ihrer Stofftasche rutschte ihr von der Schulter, sodass ich hineinsehen konnte. Ein angeschlagener, schmutziger Gartenzwerg lugte heraus, ein paar leere Limodosen und ein alter, abgetragener Turnschuh.
»Ich geh wohl besser heim«, sagte sie plötzlich. Sie klang wie ein Automat. »Mein Afrikaaner wird sich schon wundern, wo ich bleibe.«
Der »Afrikaaner« war ihr Ehemann, Lawrence Beukes, der aus Kapstadt auswanderte, noch bevor ich geboren worden war. Noch mit 70 war Larry Beukes einer der kraftvollsten Männer, die ich kannte. Er war ein ehemaliger Bodybuilder mit den ausgeprägten Muskeln und dem von Adern durchzogenen Stiernacken eines Gewichthebers vom Zirkus. Dieses muskulöse Aussehen war Bestandteil seines Berufs. Er hatte sein Geld mit einer Kette von Fitnessstudios gemacht, die er in den 70er-Jahren eröffnet hatte, gerade als der mit unglaublichen, mit Öl übergossenen Muskeln bepackte Arnold Schwarzenegger sich ins öffentliche Bewusstsein vorgearbeitet hatte. Larry und Arnie waren sogar einmal in ein und demselben Kalender abgebildet worden. Larry hatte den Monat Februar verkörpert, deshalb seine Muskeln im Schnee zur Schau gestellt und dabei nichts weiter getragen als einen winzigen schwarzen Tanga, der gerade mal seinen Schniedel bedeckte. Arnie dagegen war für den Juni aufgetreten und stand mit ölglänzendem Körper in der Sonne am Strand, in jedem seiner riesigen Arme ein Mädchen im Bikini.
Shelly warf noch einmal einen raschen Blick über die Schulter und schlurfte dann davon. Sie ging in eine Richtung, die sie noch weiter von ihrem Zuhause fortbringen würde. In dem Augenblick, als sie den Blick von mir nahm, verschwand jeglicher Ausdruck aus ihrem Gesicht. Ihre Lippen begannen sich zu bewegen, als wisperte sie eine Frage nach der anderen in sich hinein.
»Shelly! Hey, ich wollte Mr. Beukes fragen, ob … Ich wollte wissen …« Ich suchte rasch nach etwas, das ich Larry Beukes fragen oder was ich mit ihm besprechen könnte. »Braucht er vielleicht jemanden, der ihm den Rasen mäht? Er selbst hat doch sicher Besseres zu tun, oder? Macht es Ihnen was aus, wenn ich Sie nach Hause begleite?« Ich griff nach ihrem Ellbogen und erwischte sie, bevor sie nicht mehr in meiner Reichweite war.
Sie zuckte bei meinem Anblick zusammen, als hätte ich mich wie ein Weltmeisterspion angeschlichen, dann lächelte sie mich auf diese mutige, herausfordernde Weise an. »Ich habe dem Afrikaaner gesagt, dass wir jemanden brauchen, der uns den … den …« Ihr Blick stumpfte ab. Sie konnte sich nicht mehr an das erinnern, was eigentlich geschnitten werden musste. Schließlich schüttelte sie leicht den Kopf und fuhr fort: »… dass wir das erledigen müssen. Schon seit Ewigkeiten rede ich davon! Du kannst gern mit mir nach Hause gehen. Und weißt du was?« Sie tätschelte meine Hand. »Ich glaube, ich habe sogar noch ein paar dieser Kekse, die du so magst!«
Sie zwinkerte mir zu und für einen Augenblick war ich mir sicher, dass sie mich kannte und, was noch wichtiger war, dass sie sich selbst kannte. Shelly Beukes kam für einen Augenblick zu Verstand. Doch dann verlor sie ihn wieder. Ich konnte sehen, wie ihre Wahrnehmung sich wieder trübte, wie ein Licht, das man am Dimmer immer weiter herunterdrehte, bis die Glühbirne nur noch schwach glomm.
Also ging ich mit ihr nach Hause. Ich fühlte mich schlecht, weil sie barfuß über den heißen Asphalt gehen musste. Es war furchtbar schwül, Mücken schwirrten in Schwärmen um uns herum. Nach einer Weile fiel mir auf, dass sie rot geworden war und Schweißtropfen in den Härchen auf ihrer Oberlippe hingen. Ich dachte daran, sie dazu zu bringen, den Mantel auszuziehen. Auch wenn ich zugeben muss, dass mir dabei erneut der Gedanke kam, sie sei darunter vielleicht wirklich nackt. Wenn man ihre Verwirrtheit in Betracht zog, war das vielleicht gar nicht auszuschließen. Allerdings kämpfte ich mein Unbehagen nieder und fragte, ob ich ihr vielleicht den Mantel tragen dürfte. Sie schüttelte kurz den Kopf.
»Ich will doch nicht erkannt werden.«
Das war einfach so wundervoll durchgeknallt, dass ich gar nicht anders konnte, als für einen Moment die Situation, in der wir uns befanden, zu vergessen und so zu antworten, als wäre Shelly ganz sie selbst, eine vernünftige Person, die Jeopardy! liebte und Herdplatten mit einer beinahe brutalen Entschlossenheit wienerte.
»Von wem erkannt werden?«, wollte ich also wissen.
Sie beugte sich zu mir herab und flüsterte mir mit einer Stimme, die beinahe ein Wispern war, zu: »Vom Polaroid-Mann. Dieses verdammte, schleimige Frettchen in seinem Cabrio! Er knipst ständig Fotos, wenn mein Afrikaaner nicht da ist. Ich habe keine Ahnung, wie viele er schon geschossen hat, aber von mir kann er keine mehr haben.«
Sie packte mein Handgelenk. Ihr Körper war immer noch kräftig und hatte diese imponierende Oberweite, aber ihre Hand war knochig und glich den Klauen einer Märchenhexe. »Lass bloß nicht zu, dass er dich fotografiert. Er darf gar nicht erst damit anfangen, dir etwas wegzunehmen.«
»Ich werde aufpassen. Hey, echt jetzt, Mrs. Beukes, Sie sehen aus, als würden Sie in diesem Mantel förmlich wegschmelzen. Lassen Sie mich das Ding nehmen, und wir achten zusammen auf diesen Kerl. Sie können ihn ja rasch wieder anziehen, wenn wir ihn entdecken.«
Sie zog den Kopf zurück und sah mich mit zusammengezogenen Brauen an, als betrachtete sie das Kleingedruckte am Ende eines dubiosen Vertrags. Schließlich schnaubte sie und glitt aus dem großen Mantel, den sie mir dann in die Hand drückte. Sie war mitnichten nackt darunter, doch sie trug schwarze Sportshorts und ein T-Shirt, das auf links gedreht war und das sie falsch herum angezogen hatte, sodass das Fähnchen unter ihrem Kinn prangte. Ihre Beine waren knotig und erschreckend weiß, an den Waden hatte sie zahlreiche Krampfadern. Ich faltete den Mantel ordentlich zusammen, schweißfeucht und zerknittert, wie er war, und legte ihn mir über den Unterarm. Wir gingen weiter.
Die Straßen in Golden Orchards, unserem kleinen Vorort im Norden Cupertinos, waren kurvig und verschlungen wie ein Haufen Seil und verliefen an keiner Stelle geradeaus. Auf den ersten Blick schienen die Häuser alle in unterschiedlichem Stil gebaut, eines auf spanische Art verputzt hier, ein viktorianisches Ziegelhaus dort. Aber wenn man sich nur lange genug umsah, erkannte man, dass alle mehr oder weniger den gleichen Grundriss hatten, die gleiche Anzahl an Badezimmern und die gleiche Lage der Fenster. Allerdings hatte jedes eine andere Fassade, als hätte sich jedes mit einem anderen Kostüm verkleidet.
Das Haus der Beukes war ein pseudoviktorianisches Haus, das irgendjemand mit Elementen eines Strandthemas versehen hatte; Muscheln waren in den Waschbeton eingearbeitet, der den Weg zum Eingang hinauf pflasterte, ein ausgeblichener Seestern hing an der Tür. Vielleicht nannte Mr. Beukes die Studios seiner Fitnesskette ja Neptune Fitness. Oder Atlantic Athletics. Vielleicht bezog er sich mit den Elementen aber auch einfach darauf, dass er in seinen Studios hauptsächlich Fitnessgeräte der Firma Nautilus aufgestellt hatte. Erinnern kann ich mich in dieser Richtung an nichts mehr. Auch wenn mir manches, was an diesem Tag, dem 15. August 1988, geschah, noch sehr präsent ist, weiß ich aber auch nicht, ob ich mir damals überhaupt Gedanken darüber machte.
Ich brachte Shelly bis zur Tür und klopfte. Dann klingelte ich. Ich hätte sie auch einfach hineingehen lassen können, immerhin war es ja ihr Haus, aber ich dachte, dass das der Situation nicht angemessen war. Ich war der Ansicht, ich müsse Larry Beukes sagen, dass sie ziellos auf der Straße herumgewandert war, und hoffte, mir fiele eine nicht allzu peinliche Art ein, ihm zu sagen, wie verwirrt sie war.
Shelly gab keine Anzeichen von sich, die darauf schließen ließen, dass sie ihr eigenes Haus erkannte. Sie stand am Fuß der Stufen zum Eingang, blickte sich interessiert um und wartete geduldig. Noch vor wenigen Sekunden hatte sie durchtrieben, ja sogar ein wenig Furcht einflößend gewirkt. Jetzt machte sie den Eindruck einer gelangweilten Oma, die mit ihrem Enkel, einem Pfadfinder, von Tür zu Tür ging, während er Zeitungsabos verkaufte.
Hummeln gruben sich brummend in nickende, weiße Blütenkelche. Zum ersten Mal kam mir der Gedanke, dass Larry Beukes wohl tatsächlich jemanden brauchte, der ihm den Rasen mähte. Der Garten war ungepflegt und von Unkraut überwuchert, überall spross Löwenzahn aus dem Boden. Das Haus selbst hätte eine Hochdruckreinigung nötig gehabt; Stockflecken waren unter der Regenrinne zu sehen. Es war schon eine Weile her, dass ich hier vorbeigekommen war, und wahrscheinlich noch länger, dass ich mir das Haus genauer angesehen hatte.
Larry Beukes hatte sein Anwesen immer mit der Genauigkeit und der Energie eines preußischen Feldmarschalls in Schuss gehalten. Normalerweise mähte er zweimal die Woche, in ein viel zu knappes, ärmelloses Shirt gekleidet, mit angespannten Schultermuskeln und das Grübchenkinn entschlossen vorgestreckt mit seinem mechanischen Handrasenmäher den Rasen. Der Rasen der Nachbarn war grün und ordentlich. Seiner war penibelst gepflegt.
Natürlich war ich erst 13, als all das passierte, und jetzt weiß ich vieles, was ich damals nicht wusste: Lawrence Beukes glitt das schon damals alles aus der Hand. Seine Fähigkeiten, etwas zu managen, ja sogar mit dem wenig fordernden Vorstadtleben Schritt zu halten, wurden von etwas anderem nach und nach völlig verschlungen. Er war damit überfordert, sich um eine Frau zu kümmern, die nicht mehr in der Lage war, sich um sich selbst zu kümmern. Ich schätze, dass es nur sein ihm eigener Optimismus und seine Gewohnheit waren, sein Sinn für persönliche Fitness, wenn man so will, die ihn so weitermachen ließen wie bisher und die ihm vorgaukelten, er könne mit alledem fertigwerden.
Ich dachte schon, dass ich Shelly wieder zu mir nach Hause bringen und mit ihr dort warten müsste, als Mr. Beukes’ zehn Jahre alte burgunderfarbene Limousine rasant in die Auffahrt einbog. Er fuhr wie ein Gauner, der vor Starsky und Hutch floh, und streifte mit einem Reifen den Bordstein, als er um die Ecke bog. Hastig stieg er aus, stolperte und fiel beinahe, während er auf uns zulief.
»Ach du liebe Zeit, da bist du ja«, rief er mit seinem holländisch wirkenden Akzent, der einen automatisch an Apartheid, Folter und Diktatoren auf vergoldeten Thronen in Marmorpalästen denken ließ, in denen Eidechsen über die Wände huschten. »Ich habe schon überall nach dir gesucht. Fast hätte ich einen Herzinfarkt bekommen!«
Beinahe konnte er einem mit diesem Akzent leidtun, immerhin hatte er sich sein Geld mit Gewichtheben verdient, nicht damit, Blutdiamanten zu schmuggeln. Er hatte zwar diverse Charakterfehler, immerhin hatte er Reagan gewählt, glaubte, dass Carl Weathers als Apollo Creed in den Rocky-Filmen ein grandioser Schauspieler sei, und begann immer zu heulen, wenn er ABBA hörte. Aber er bewunderte und liebte seine Frau, und dagegen verblassten seine persönlichen Fehler, egal welche das waren.
»Wo warst du denn? Ich bin doch nur kurz zu Mr. Bannerman nebenan und wollte mir Waschpulver ausleihen. Doch als ich zurückkomme, bist du weg – als wärst du das Medium in einem David-Copperfield-Trick!«
Er packte seine Frau an den Oberarmen und für einen Augenblick sah es aus, als wollte er sie schütteln, doch dann umarmte er sie stattdessen. Über ihre Schulter hinweg sah er mich mit tränenumflorten Augen an.
»Schon gut, Mr. Beukes«, meinte ich. »Ihr geht’s gut. Sie hatte sich … einfach verlaufen.«
»Ich habe mich nicht verlaufen«, meldete sich Shelly zu Wort und grinste ihren Mann verschmitzt an. »Ich habe mich vor dem Polaroid-Mann versteckt.«
Er schüttelte den Kopf. »Still jetzt. Du hältst jetzt den Mund, meine Liebe. Jetzt komm aus der Sonne und … Ach du lieber Himmel. Deine Füße! Bevor ich dich reinlasse, wirst du die ja wohl sauber machen. Du wirst den Dreck sonst überall im Haus verteilen!«
All das klingt jetzt im Nachhinein irgendwie rücksichtslos und brutal, aber seine Augen waren nass dabei und in seiner Stimme schwang eine grimmige, verletzte Zuneigung mit. Es war, als spräche er mit einer geliebten alten Katze, die sich draußen geprügelt hat, nach Hause kommt und der ein Ohr fehlt.
Er bugsierte sie an mir vorbei die Ziegelstufen hinauf, hinein ins Haus. Ich wollte gerade nach Hause gehen, weil ich glaubte, man hätte mich schon vergessen, als er sich noch einmal umdrehte und mit einem zitternden Finger in meine Richtung zeigte.
»Ich habe noch etwas für dich«, erklärte er. »Mach dich bloß nicht dünne, Michael Figlione.«
Dann knallte er die Tür hinter sich zu.
Kapitel 2
Irgendwie war seine Wortwahl beinahe lustig. Dass ich mich dünne machte, stand nämlich nicht zu befürchten. Ich habe den Elefanten im Zimmer ja noch gar nicht angesprochen. Die Tatsache, die darin bestand, dass ich mit 13 genau das war: ein Elefant im Zimmer. Ich war nämlich geradezu fett. Ich hatte keine »starken Knochen«, ich war nicht »stämmig«, und ganz sicher war ich nicht einfach bloß »ein bisschen pummelig«. Wenn ich durch die Küche stampfte, klirrte das Glas in den Schränken. Wenn ich zwischen meinen Schulkameraden der achten Klasse stand, wirkte ich wie ein Büffel in einem Rudel Präriehunde.
In der heutigen Zeit der sozialen Medien und der Tatsache, dass man dem Mobbing gegenüber so sensibel geworden ist, ist es schwierig geworden, jemandem »Fettsack!« hinterherzubrüllen. Der Betroffene wird sofort mit Fug und Recht melden, er habe unter Missbrauch zu leiden; Stichwort: Body Shaming. Aber 1988 war »Twitter« nur der Laut, mit dem man das Zwitschern von Vögeln beschrieb. Ich war fett und ich war einsam. Damals war das eben so: Wenn man Ersteres war, dann folgte das Zweite so sicher wie ein Naturgesetz. Ich hatte eine Menge Zeit, alte Damen nach Hause zu bringen. Ich vernachlässigte meine Freunde damit nicht, denn ich hatte gar keine. Niemand hier in der Gegend war in meinem Alter. Mein Vater fuhr mich manchmal in die Stadt, damit ich an den monatlichen Treffen eines Clubs mit dem seltsamen Namen SF-Roboes (dem San-Francisco-Club der Roboterbenutzer und -enthusiasten) teilnehmen konnte, aber die meisten, die auch zu diesen Treffen kamen, waren viel älter als ich; älter und außerdem entsprachen sie dem allgemeinen Klischee. Ich muss sie nicht mal beschreiben, wahrscheinlich sieht man sie schon bei der Erwähnung vor dem geistigen Auge: den schlechten Teint, die dicken Brillengläser, die offenen Hosen. Ich lernte bei diesen Treffen nichts über Festplatten oder Computer, sondern war sogar selbst der Ansicht, ich blicke auf meine Zukunft, denn die Treffen bestanden aus Diskussionen über Star Trek und ein Leben im Zölibat.
Natürlich kam bei mir hinzu, dass mein Nachname Figlione lautet, was man während meiner Schulzeit gern zu Fetti-lione oder Fag-lione machte und schon recht bald zu Fag abkürzte, was auch so viel wie »schwul« bedeutet. Sogar mein geliebter Englischlehrer nannte mich einmal aus Versehen so, was lautes Gelächter in der Klasse auslöste. Wenigstens hatte er den Anstand, rot zu werden, eine traurige Miene zu machen und sich zu entschuldigen.
Aber dennoch hätte mein Leben noch viel schlimmer sein können. Ich war sauber und ordentlich und weil ich niemals Französisch belegte, entkam ich dem Schlimmsten, das allen Nerds passieren kann: auf die Liste derer zu geraten, die obendrein auch noch Streber waren und die Lieblinge der Lehrer. Denen waren Prügel auf dem Schulhof meist sicher. Mir dagegen passierte selten Schlimmeres als hier und da eine kleine Demütigung, und wenn man mich ärgerte, dann lächelte ich immer nachsichtig, als nähme mich ein alter Kumpel freundschaftlich auf den Arm. Shelly Beukes konnte sich nicht an das erinnern, was gestern geschehen war. Und ich wollte das gar nicht erst.
Plötzlich flog die Tür wieder auf. Larry Beukes war zurück. Ich drehte mich zu ihm um, gerade als er sich mit der schwieligen Hand die feuchte Wange rieb. Ich war verlegen und wollte mich schon abwenden und den Blick auf die Straße richten, hatte ich doch keine Erfahrung mit heulenden Erwachsenen. Mein Vater war nicht gerade ein emotionaler Mensch und ich bezweifle, dass meine Mutter nahe am Wasser gebaut war, auch wenn ich das gar nicht mit Sicherheit sagen kann. Ich habe sie immer nur zwei oder drei Monate im Jahr gesehen. Larry Beukes stammte aus Südafrika, wohingegen meine Mutter nach Afrika gereist war, um dort anthropologische Studien zu betreiben, und selbst irgendwie niemals wirklich zurückgekehrt war. Auch wenn sie hier bei uns zu Hause lebte, blieb ein Teil von ihr 10.000 Kilometer entfernt auf einem anderen Kontinent zurück und war nicht erreichbar. Damals war ich aber nicht böse darüber. Kinder brauchen für ihren Zorn ein Objekt, das sich in ihrer Nähe befindet. Auch wenn sich das später ändert.
»Ich bin in der Nachbarschaft herumgefahren, um sie zu suchen. Diese verflixte alte Schachtel. Das ist jetzt das dritte Mal! Ich dachte, diesmal ist es passiert, diesmal ist sie hinunter zur Hauptstraße gelaufen und man hat sie überfahren! Diese dumme alte … Ich danke dir, Michael Figlione, dass du sie mir zurückgebracht hast. Gott segne dich! Gott segne deine Freundlichkeit.« Er griff in eine seiner Hosentaschen und kehrte sie auf links, sodass Geld in allen Formen herausquoll und auf den Gehweg und den Rasen purzelte; Geldscheine, silbrige Münzen, alles durcheinander. Ich erkannte, irgendwie alarmiert, dass er mich zu bezahlen gedachte.
»Ach du liebe Zeit, Mr. Beukes, das ist in Ordnung. Das müssen Sie nicht. Ich hab gern geholfen. Ich will gar nicht … Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn …«
Er hob eine Braue und starrte mich böse an. »Das ist mehr als nur eine Belohnung. Das ist eine Vorauszahlung.« Er bückte sich, schnappte sich eine 10-Dollar-Note und streckte sie mir hin. »Na los, nimm schon.« Als ich das nicht tat, steckte er den Geldschein selbst in die Brusttasche meines Hawaiihemds. »Michael … wenn ich irgendwohin muss … kann ich dir dann Bescheid geben, dass du so lange nach ihr siehst? Ich bin eigentlich den ganzen Tag zu Hause, um nach meiner verrückten Alten zu sehen. Aber manchmal muss ich nun mal einkaufen oder in meinen Studios nach dem Rechten sehen. Da gibt es immer etwas zu tun. All diese Muskeltypen, die für mich arbeiten, können 400 Pfund heben, aber keiner von denen kann weiter als bis zehn zählen. Dann haben sie nämlich keine Finger mehr, an denen sie abzählen können.« Er klopfte noch einmal auf die Brusttasche mit dem Geldschein darin und nahm mir den Mantel seiner Frau ab. Er hing immer noch über meinem Unterarm wie das vergessene Handtuch eines Oberkellners. »Also sind wir uns einig?«
»Sicher, Mr. Beukes. Sie hat ja auch auf mich aufgepasst, als ich klein war. Ich denke, ich … ich kann …«
»Ja, pass auf sie auf, wie sie auf dich aufgepasst hat. Sie ist nun einmal in ihrer zweiten Kindheit, Gott helfe ihr. Und mir auch. Sie braucht jemanden, der darauf achtet, dass sie nicht davonläuft. Und nach … ihm sucht.«
»Dem Polaroid-Mann.«
»Sie hat dir von ihm erzählt?«
Ich nickte.
Er schüttelte den Kopf und glättete mit einer Hand seine mit Gel zurückgekämmten und immer dünner werdenden Haare. »Ich fürchte, sie wird eines Tages jemanden vorbeigehen sehen und glauben, er sei es; und ihm dann ein Küchenmesser in den Wanst stoßen. O Gott, was soll ich dann bloß machen?«
Das war nun nicht gerade das, was man einem Jungen hätte sagen sollen, den man gerade gebeten hatte, auf die eigene alte und dement werdende Ehefrau aufzupassen. Jetzt war es mir fast unmöglich, nicht zu überlegen, was geschehen würde, wenn sie mich für den Polaroid-Mann hielte und mit dem Küchenmesser auf mich losging. Aber daran dachte er in diesem Augenblick gar nicht und sprach aus, was ihm gerade durch den Kopf ging. Und eigentlich war es mir auch egal. Ich hatte keine Angst vor Shelly Beukes. Ich glaubte, dass sie mich bereits vergessen hatte und sich selbst schon viel länger, dass diese Tatsache aber nicht dazu führte, dass sich ihr Charakter an sich änderte. Und der war freundlich, effizient und völlig außerstande, etwas wirklich Böses zu tun.
Larry Beukes sah mich mit erschöpften, blutunterlaufenen Augen an. »Michael, eines Tages wirst du ein reicher Mann sein. Wahrscheinlich machst du einmal ein Vermögen und gestaltest die Zukunft neu. Willst du dann etwas für mich tun? Für deinen alten Freund Larry Beukes, der seine letzten Jahre damit verbracht hat, sich verzweifelt um seine närrische alte Frau zu kümmern, deren Hirn sich zu Haferschleim verflüssigt? Um die Frau, die ihn glücklicher machte, als er es je verdient hat?«
Er fing wieder an zu weinen. Ich hätte mich am liebsten im nächsten Mauseloch verkrochen. Stattdessen nickte ich.
»Sicher, Mr. Beukes. Ganz bestimmt.«
»Dann erfinde einen Weg, nie alt zu werden«, sagte er. »Das ist ein widerlicher Streich, den uns das Universum spielt. Alt zu werden ist keine Art, nicht mehr jung zu sein.«
Kapitel 3
Ich trottete verwirrt von dannen und war mir dabei kaum bewusst, dass ich mich bewegte, und ebenso wenig war mir klar, wohin ich unterwegs war. Mir war heiß, ich konnte kaum denken, man hatte mir gewaltsam zehn Dollar in die Hemdtasche geschoben, Geld, das ich gar nicht haben wollte. Meine schmierigen Run-DMC-Adidas-Turnschuhe brachten mich schließlich automatisch an den Ort, an dem ich das Geld am schnellsten wieder loswerden konnte.
Es gab eine große Tankstelle gegenüber der Einfahrt in unseren Vorort, auf der anderen Seite der Schnellstraße. Ein halbes Dutzend Zapfsäulen und einen auf überaus angenehme Temperaturen klimatisierten kleinen Supermarkt, wo man Beef Jerky, Zwiebelringe und, wenn man alt genug war, Softporno-Magazine kaufen konnte. In diesem Sommer fuhr ich auf eine ganz spezielle Slush-Mischung ab: Einen Maxi-Becher von ungefähr einem Liter füllte ich mit zerstoßenem Eis, tränkte es in Vanilla-Coke und gab einen Spritzer Arctic Blu darauf. Arctic Blu hatte die azurblaue Farbe von Scheibenentfroster und schmeckte ein wenig nach Melone und ein wenig nach Kirsche. Ich war verrückt nach dem Zeug, aber wenn es mir heute über den Weg liefe, würde ich es wahrscheinlich nicht mehr probieren. Ich denke, meinen 40 Jahre alten Geschmackssinn würde es zu sehr an pubertäres Leiden erinnern.
Aber an diesem Tag stand mir der Sinn nach diesem Arctic-Blu-Vanilla-Coke-Slush-Spezial und ich wusste das nicht mal, bis ich vor der Tankstelle mit der zwölf Meter hohen Säule stehen blieb, auf der der steigende rote Pegasus der Exxon Mobil stand. Der Parkplatz war erst kürzlich frisch geteert worden, dick wie Kuchenglasur und tiefschwarz. Hitze flirrte darüber und sorgte dafür, dass die ganze Tankstelle schwach zu erzittern schien wie eine Fata Morgana, eine halluzinierte Oase, wie ein Verdurstender sie erblicken mag. Mir fiel der weiße Cadillac an Zapfsäule 10 gar nicht auf und den Kerl, der neben mir stand, bemerkte ich ebenfalls erst, als er mich ansprach.
»Hey«, sagte er, und als ich nicht reagierte, weil ich völlig in einen sonnigen Tagtraum versunken war, wiederholte er den Gruß. »Hey, Gummiball.«
Diesmal hörte ich ihn. Mein Radar war auf alle Signale eingestellt, bei denen es sich auch nur im Entferntesten um Mobbing handeln konnte, und bei »Gummiball« schrillten die Glocken trotz der gutmütigen Stimmlage des Mannes.
Er selbst hätte den Ball, was das Aussehen anbelangte, auch ruhig etwas flacher halten können. Zwar war er gut angezogen, allerdings wirkten seine Klamotten irgendwie unpassend.
In einem Aufzug wie dem seinen hätte er gut am Eingang eines Nachtclubs in der Innenstadt San Franciscos stehen können. Hier, gegenüber einer Tankstelle in einem Vorort, wirkte er fehl am Platz. Er trug ein seidiges schwarzes und kurzärmeliges Hemd mit roten Glasknöpfen, lange, schwarze Hosen mit messerscharfer Bügelfalte und schwarze Cowboystiefel, die mit rotem und weißem Faden vernäht waren.
Er war unglaublich hässlich, sein Kinn verschwand fast in seinem langen Hals, seine Wangen waren verunstaltet von alten Akne-Narben. Seine tiefbraunen Unterarme waren mit schwarzen Tätowierungen bedeckt, die aussahen wie eine seltsam geschwungene Schrift, die sich schlangengleich bis hinunter zu seinen Handgelenken zog. Er trug einen schmalen Schlips, wie er in den 80er-Jahren Mode war und den er mit einer Krawattennadel aus Plexiglas mit einem vergilbten Skorpion darin festhielt.
»Ja, Sir?«, wandte ich mich an ihn.
»Willst du da rein? Und dir ein paar M&M’s oder so was kaufen?« Geräuschvoll rammte er die Zapfpistole in die Tanköffnung seines riesigen, weißen Wagens.
»Jawohl, Sir«, erwiderte ich und dachte ›M&M’s am Arsch, Vollidiot‹.
Er griff in seine Hosentasche, kramte ein paar vergilbte, verknitterte Scheine heraus und pulte einen 20-Dollar-Schein daraus hervor. »Ich sag dir was. Bring das rein und sag Bescheid, sie sollen Zapfsäule 10 anschalten. Dann … Hey, Träumer, ich red mit dir. Hör mir zu!«
Meine Aufmerksamkeit war abgelenkt worden. Denn mein Blick war auf den Gegenstand gefallen, der auf dem Rücksitz seines Caddys lag: eine Sofortbildkamera von Polaroid.
Wahrscheinlich wissen Sie noch, wie eine Polaroid aussieht, selbst wenn Sie zu jung sind, je eine gesehen, geschweige denn selbst benutzt zu haben. Die originalen Polaroid-Sofortbildkameras sind sehr prägnant und versinnbildlichten zu ihrer Zeit einen so enormen technischen Fortschritt, dass sie zur Ikone ihrer Zeit wurden. Polaroidkameras gehörten zu den 80ern wie Reagan und Pac-Man.
Heutzutage hat jeder seine Kamera in der Tasche. Die Vorstellung, jederzeit einen Schnappschuss machen und ihn dann gleich betrachten zu können, ist für niemanden mehr sensationell. Aber im Sommer 1988 war eine Polaroid eine der wenigen Kameras, mit denen man ein Foto schießen und es mehr oder weniger direkt entwickeln und ansehen konnte. Die Kamera spuckte nach dem Knipsen fast sofort ein großes, weißes Papierquadrat aus, in dessen Mitte sich ein grauer Film befand. Nach ein paar Minuten, oder noch schneller, wenn man damit in der Luft herumwedelte, sodass der Entwickler rascher mit dem chemisch behandelten Papier reagierte, tauchte aus dem grauen Film ein Bild auf und verfestigte sich zu einer Fotografie. Damals war das der neueste technische Stand.
Als ich die Kamera sah, wusste ich, dass er es war. Der Polaroid-Mann, vor dem Mrs. Beukes sich versteckte. Dieses schleimige Frettchen, in seinem weißen Cadillac-Cabrio mit dem roten Verdeck und den roten Sitzen. Schon allein diese Farbzusammenstellung signalisierte, dass es sich um ein Arschloch handeln musste.
Ich wusste natürlich, dass das, was Mrs. Beukes von ihm glaubte, keinesfalls der Wahrheit entsprach, dass es sich sozusagen um die Fehlzündung eines Gehirns handelte, das ohnehin schon falsch funktionierte und langsam, aber sicher den Geist aufgab. Aber ich konnte diesen einen Satz, den sie gesagt hatte, nicht verdrängen: Lass bloß nicht zu, dass er dich fotografiert. In diesem Augenblick, in dem ich realisierte, dass der Polaroid-Mann keine senile Fantasie, sondern ein echter Mensch war, der direkt vor mir stand, rann mir ein eisiger Schauer über den Rücken.
»Äh … Schießen Sie los, Mister. Ich hör zu.«
»Hier«, sagte er. »Nimm diesen Zwanziger und sag denen, sie sollen die Zapfsäule hier aktivieren. Mein Caddy ist durstig. Und ich sag dir was, Junge. Wenn es Wechselgeld gibt, kannst du’s behalten. Kauf dir einen Diät-Ratgeber davon.«
Ich wurde nicht mal rot. Das war ein gemeiner Tiefschlag, aber ich war so abgelenkt, dass er kaum in mein Bewusstsein drang.
Auf den zweiten Blick nämlich sah ich, dass es sich durchaus nicht um eine Polaroidkamera handelte. Jedenfalls nicht so richtig. Ich kannte diese Dinger ziemlich gut, hatte ich doch mal eine komplett auseinandergenommen und wusste daher, dass diese hier etwas anders sein musste. Zunächst einmal war sie schwarz mit einer roten Vorderseite, weswegen sie ziemlich gut zum Auto und den Klamotten des Kerls passte. Aber sie war auch sonst … anders. Schlanker. Sie lag auf dem Rücksitz, in Reichweite von Mr. Schleimig, und so, dass ich das Fabrikat nicht erkennen konnte. Ich fragte mich, ob es wohl eine Konica war. Was mir allerdings besonders ins Auge fiel, war die Schublade. Oder besser die Tatsache, dass sie gar nicht da war. Eine Polaroid hatte vorn eine Art Schublade, die man öffnen und in die man einen Stapel Filme, also Papierrohlinge für die Fotos, einlegen konnte. Wie man allerdings diese Kamera hier lud, war für mich nicht zu erkennen. Das Gerät schien gewissermaßen glatt und wie aus einem Stück gemacht.
Der Typ sah, wie ich auf die Kamera schielte, und tat etwas Merkwürdiges: Er legte schützend die Hand darauf, wie eine alte Dame, die ihre Handtasche etwas fester an sich drückt, wenn sie an ein paar Schlägertypen vorbeihuscht. Er wedelte noch einmal mit dem klebrigen Zwanziger vor meiner Nase. Ich ging hinten um den Wagen herum und griff nach dem Schein. Mein Blick fiel dabei auf die Schrift auf seinem Unterarm. Ich erkannte sie nicht, aber es sah ein wenig aus wie Hebräisch.
»Cooles Tattoo«, meinte ich. »Welche Sprache ist das?«
»Phönizisch.«
»Was heißt es denn?«
»Es heißt, geh mir nicht auf die Nerven, Mann. … Mehr oder weniger.«
Ich steckte das Geld in meine Hemdtasche und machte mich langsam auf den Weg in den Laden. Rückwärts. Ich hatte zu große Angst vor ihm, um ihm den Rücken zuzuwenden.
So konnte ich natürlich nicht sehen, wohin ich lief, prallte prompt an den hinteren Spoiler des Caddys und wäre beinahe gefallen. Ich musste mich am Kofferraum des Wagens abstützen und hinsehen, und dabei fiel mein Blick auf die Fotoalben.
Ungefähr ein Dutzend davon war auf dem Rücksitz gestapelt. Eines war sogar aufgeschlagen, die Polaroids darin ordentlich in die Plastikschuber geschoben. Auf den Fotos selbst war nichts Besonderes zu erkennen. Ein überbelichteter Schnappschuss eines alten Mannes, der Kerzen auf einer Geburtstagstorte ausblies. Ein vom Regen durchnässter Corgi, der mit traurigen, hungrigen Augen in die Kamera starrte. Ein muskelbepackter Kerl in einem lächerlichen orangefarbenen Tanktop, der auf der Motorhaube eines TransAm posierte, der direkt aus Knight Rider zu stammen schien.
Dieses letzte Bild hielt meinen Blick fest. Irgendwie kam mir der junge Mann im Tanktop bekannt vor. Ich fragte mich, ob ich ihn schon einmal im Fernsehen gesehen hatte. Vielleicht war er Wrestler und schon einmal mit Hulk Hogan in den Ring gestiegen.
»Sie haben ja eine Menge Fotos«, meinte ich.
»Das ist mein Job. Ich bin ein Scout.«
»Scout?«
»Für Filme. Wenn ich etwas Interessantes sehe, einen Ort oder ein Gesicht, dann mache ich ein Foto davon.«
Er lächelte aus dem Mundwinkel und entblößte einen Zahn, der seltsam aus der Reihe der anderen hervorstand. »Warum fragst du? Willst du selbst mal in einem Film mitspielen, Kleiner? Soll ich auch von dir mal ein Bild machen? Hey, man kann ja nie wissen. Vielleicht mag ja jemand in einer der Besetzungsagenturen dein Gesicht. Dann bist du im Handumdrehen im Filmgeschäft, Kleiner.«
Bei diesen Worten fummelte er auf eine Art an der Kamera herum, die mir nicht gefiel. Irgendwie gierig, richtig geil darauf, ein Bild zu machen.
Selbst in dieser theoretisch unschuldigeren Zeit, den späten 80ern, war ich nicht gerade scharf darauf, einen Kerl ein Foto von mir machen zu lassen, der aussah wie ein Typ, der seine Klamotten bei »Pädophilia & Co.« gekauft hatte. Shelly hatte mich gewarnt: Lass bloß nicht zu, dass er dich fotografiert. Diese Warnung kroch jetzt wie eine giftige Spinne mit haarigen Beinen mein Rückgrat hinab.
»Nein, das wär mir nicht recht«, sagte ich. »Wäre wohl zu schwierig, mich auf ein Foto zu kriegen.« Ich wies auf meine Plauze, über der sich mein Hemd spannte.
Für einen Augenblick drohten seine Augen aus seinen Höhlen zu treten, dann lachte er. Ein raues, wieherndes Geräusch, das teilweise von seinem Unglauben sprach, teilweise aber von echter Belustigung. Er deutete mit dem Zeigefinger auf mich, den Daumen wie bei einer Pistole abgespreizt. »Du bist in Ordnung, Junge. Ich mag dich. Verlauf dich auf dem Weg zur Kasse bloß nicht.«
Unsicher ging ich von ihm fort, nicht nur deshalb, weil ich damit einem unheimlichen Typen entkommen wollte, der einen hässlichen Mund und ein noch hässlicheres Gesicht hatte. Ich war einfach ein vernünftiger Junge. Ich las Isaac Asimov, verehrte Carl Sagan und fühlte eine Seelenverwandtschaft mit Andy Griffiths Matlock. Ich wusste, dass Shelly Beukes’ Vorstellung vom Polaroid-Mann (den ich schon längst in den »Phönizier« umbenannt hatte) die verrückte Idee eines zerfallenden Verstands war. Eigentlich hätte ich ihre Warnungen in den Wind schlagen müssen. Aber das tat ich nicht. In den letzten Augenblicken hatten diese Warnungen sogar eine geradezu abergläubische Wucht entwickelt und mich so beunruhigt, wie mich sonst nur beunruhigt hätte, wenn ich an einem Freitag dem Dreizehnten im Flug 1313 Platz 13 bekommen hätte; ungeachtet der Tatsache, dass die 13 eigentlich eine ziemlich coole Zahl ist, nicht nur Primzahl oder eine Zahl in der Fibonaccifolge, sondern auch eine Mirpzahl. Das heißt, sie ist auch eine Primzahl, wenn man die Ziffernfolge, aus der sie besteht, zu 31 umdreht.
Ich ging also in den Minimarkt hinein, zog das Geld aus der Hemdtasche und ließ es auf den Tresen gleiten.
»Das ist für die 10, den netten Kerl da in dem Cadillac«, erklärte ich Mrs. Matsuzaka, die mit ihrem Sohn Yoshi hinter der Theke stand.
Niemand nannte ihn Yoshi außer Mrs. Matsuzaka. Er selbst nannte sich Mat, mit einem »t«. Mat hatte eine Glatze, lange, drahtige Arme und benahm sich immer so cool wie ein Surfer. Er war fünf Jahre älter als ich und würde Ende des Sommers nach Berkeley gehen. Sein großes Ziel war, ein Auto zu erfinden, das nicht mit Benzin betrieben wurde, und so seine Eltern brotlos werden zu lassen.
»Hey, Fag«, meinte er und nickte mir zu. Das heiterte mich etwas auf. Jaja, schon recht, er nannte mich Fag, aber das nahm ich nicht persönlich, für die meisten Kids meiner Generation war das eben mein Name. Heutzutage klingt das natürlich schrecklich eklig und das war es ja auch, aber im Jahr 1988, der Ära von AIDS und Eddie Murphy, war »Fag« eben ein echt witziger Spitzname. Im Vergleich zu den meisten anderen, die ich kannte, war Mat geradezu ein Muster an Sensibilität. Er las jeden Monat die Ausgabe der Popular Mechanics, einer Zeitschrift, die sich mit populärwissenschaftlichen Themen beschäftigte, von der ersten bis zur letzten Seite. Manchmal, wenn ich die Tankstelle besuchte, schenkte er mir eins seiner älteren Exemplare, weil er etwas darin gelesen hatte, von dem er glaubte, dass es mir gefiele: über den Prototyp eines Jetpacks oder ein Einpersonen-U-Boot. Aber ich will ihn nicht falsch darstellen, wir waren nicht befreundet. Er war 18 und cool. Ich war 13 und alles andere als das. Eine Freundschaft zwischen uns war so unwahrscheinlich wie ein Date von mir mit der Schauspielerin Elizabeth Shue. Aber ich war der Meinung, er hatte eine Art Mitleid mit mir und verspürte irgendwie den inneren Drang, auf mich aufzupassen, weil wir beide eingefleischte Erfinder und Mechaniker waren. Damals war ich einfach dankbar für jede Art der Zuneigung, die ich von Gleichaltrigen erfuhr.
Ich griff nach einem der größten Behälter für mein Arctic-Blu-Vanilla-Coke-Slush-Spezial, das ich im Augenblick nötiger hatte denn je. Mein Magen knurrte ganz aufgeregt und ich wollte etwas haben, das ihn beruhigte.
Ich hatte kaum den letzten Tropfen des neonblauen Arctic-Sirups auf die Mischung gekippt, als der Phönizier auch schon mit dem Unterarm die Tür aufstieß, als hätte er persönlich etwas gegen sie. Die offene Tür blockierte den Blick auf den Slush-Dispenser, daher sah er mich nicht, obwohl er seinen grimmigen Blick durch den Raum wandern ließ. Er ging mit großen Schritten auf Mrs. Matsuzaka zu.
»Was muss man hier eigentlich anstellen, damit man an dieser Tankstelle verdammt noch mal tanken kann? Warum haben Sie die Zapfsäule abgestellt?«
Mrs. Matsuzaka war höchstens 1,50 groß und einigermaßen zierlich gebaut. Im Laufe der Jahre hatte sie sich angewöhnt, einen leeren, undurchdringlichen Gesichtsausdruck zur Schau zu stellen. Viele Einwanderer in der ersten Generation, die ausreichend Englisch verstanden, konnten eine solche Miene aufsetzen, wenn sie es für angezeigt hielten, Unverständnis vorzutäuschen. Mrs. Matsuzaka hob die Schultern zu einem schwachen Zucken und überließ es Mat, die Situation zu erklären.
»Hey, Bro, wenn Sie zehn Dollar zahlen, dann tanken Sie auch nur für zehn Dollar«, ließ Mat sich von seinem Stuhl hinter der Theke vernehmen, wo er vor dem Regal mit den Zigaretten saß.
»Kann einer von euch auf Englisch zählen?«, stieß der Phönizier hervor. »Ich hab den Jungen mit einem Zwanziger reingeschickt.«
Mir war, als hätte ich meinen Arctic-Blu-Vanilla-Coke-Slush-Spezial in einem Schluck ausgetrunken. Mein Blut erstarrte zu Eis, ich schlug zu Tode erschrocken mit einer Hand auf meine Hemdtasche. Mir war sofort klar, was ich da angestellt hatte. Ich hatte einfach in meine Tasche gegriffen, Geld in die Finger bekommen und ohne nachzusehen auf den Tresen gelegt. Aber ich hatte dabei die 10-Dollar-Note erwischt, die Larry Beukes mir gegeben hatte, nicht den Zwanziger, den ich vom Phönizier draußen vor der Zapfsäule erhalten hatte.
Ich konnte nur noch daran denken, mich sofort in Luft aufzulösen, so schnell und so vollständig wie nur möglich. Ich stand kurz vor dem Losheulen, dabei hatte der Phönizier nicht einmal mich angeschrien. Ich hastete durch den Kiosk an den Tresen und streifte dabei mit der Hüfte einen Aufsteller mit Chipstüten, sodass sich die Lay’s-Packungen auf dem Boden verteilten. Ich zerrte die 20-Dollar-Note aus der Tasche.
»O Mann, o Mann! Es tut mir ja so leid, Sir, das hab ich echt versemmelt! Tut mir echt leid, tut mir echt superleid. Ich hab gar nicht drauf geachtet, welchen Geldschein ich da auf die Theke lege, Mister, und hab dabei meinen Zehner mit Ihrem Zwanziger verwechselt. Ich schwöre, ich schwöre, ich hab es nicht …«
»Als ich sagte, du kannst das Wechselgeld behalten, um dir ein paar Diätpillen zu kaufen, meinte ich damit nicht, dass du mich verarschen kannst.«
Er hob eine Hand, als wollte er mir einen Klaps auf den Hinterkopf verpassen.
Er war mit seiner Kamera hereingekommen, die er in der anderen Hand hielt, und obwohl ich zutiefst verwirrt war, schoss mir der Gedanke durch den Kopf, wie seltsam es war, dass er sie überhaupt mit hereingebracht hatte.
»Nein, wirklich! Das wollte ich nicht, ich schwör’s Ihnen!«, stammelte ich. Meine Augen brannten, gleich würde ich losheulen. Hastig stellte ich den riesigen, fast einen Liter fassenden Becher mit Blu-Coke-Slush auf den Tresen, traf dabei aber nur die Kante, sodass der Becher in dem Augenblick, in dem ich ihn losließ, kippte und eine ohnehin schon schlimme Situation noch viel, viel schlimmer machte. Der Becher fiel, ging zu Boden und verteilte seinen Inhalt in einer leuchtend blauen Eisexplosion. Neonblaue Eisstückchen spritzten die perfekt gebügelten Hosen des Phöniziers hinauf bis in seinen Schritt und ließen saphirfarbene Tropfen auf seine Kamera fallen.
»Scheiße!«, schrie er in den höchsten Tönen auf und tänzelte auf den Zehenspitzen seiner Cowboystiefel ein paar Schritte zurück. »Bist du eigentlich vollkommen gehirnamputiert, du Spasti?«
»He!«, rief Mats Mama und stieß den Zeigefinger in Richtung Phönizier. »He, he, he, kein Streit in Laden. Sonst Polizei kommen!«
Der Phönizier starrte an sich hinab auf seine mit Blu bespritzten Klamotten und dann wieder auf mich. Sein Gesicht verfinsterte sich. Er legte die Polaroid-die-gar-keine-war auf den Tresen und ging einen Schritt auf mich zu. Ich hatte keine Ahnung, was er vorhatte, aber er wirkte ziemlich aufgeregt und sein linker Fuß rutschte in dem sich auf dem Boden immer weiter ausbreitenden Arctic-Blu-Vanilla-Coke-Eissee aus. Die Stiefel hatten hohe, kubanische Absätze und sahen echt gut aus, aber in ihnen zu laufen musste in etwa so schwierig sein, wie in 15 Zentimeter hohen Stilettos herumzustaksen. Beinahe wäre er tatsächlich auf eins seiner Knie niedergegangen.
»Ich mach alles wieder sauber!«, kreischte ich. »O Mann, das tut mir alles so leid, ich mach alles wieder sauber und, du lieber Gott, glauben Sie mir bitte, dass ich niemals jemanden betrogen habe. Ich bin so ehrlich, dass ich mich sogar beim Furzen im Schulbus immer von den anderen wegdreh …«
»Hey, Bruder, jetzt chill mal«, sagte Mat und erhob sich. Er war sehnig und groß, und mit seinen dunklen Augen und der Glatze sah er durchaus bedrohlich aus. »Machen Sie sich mal locker. Fag ist okay. Ich garantiere Ihnen, der wollte Sie nicht verarschen.«
»Du hältst dich da verdammt noch mal raus«, stieß der Phönizier hervor. »Oder besser, halt dir die Situation mal vor Augen, bevor du dich auf seine Seite schlägst. Der Kleine hier betuppt mich um zehn Mäuse, kippt seinen Drink auf mich und dann brech ich mir noch sämtliche Beine in diesem klebrigen Scheiß.«
»Ziehen Sie die Stiefel halt nicht an, wenn Sie nicht drin laufen können, Kumpel«, gab Mat zurück, ohne ihn anzusehen. »Sie könnten sich sonst echt verletzen.«
Mat griff nach einer Rolle Papierhandtücher, die unter dem Tresen verstaut waren, und gab mir einen so subtilen Wink, so schnell, dass ich es beinahe nicht gesehen hätte. Ich zitterte fast vor Dankbarkeit, so erleichtert war ich, dass ich Mat nun auf meiner Seite wusste.
Ich riss eine Handvoll Papierhandtücher ab und ging sofort in dem Eismatsch auf die Knie, um dem Phönizier die Hosen abzuputzen. Man hätte glatt glauben können, ich hätte ihm zur Entschuldigung einen blasen wollen.
»O Mann, ich war schon immer ein Tollpatsch, ich kann ja nicht mal rollerskaten …«
Er tänzelte wieder rückwärts und wäre beinahe noch einmal gefallen, beugte sich dann vor und riss mir die von Slush durchtränkten Papiertücher aus der Hand. »Hey! Hey, nicht anfassen! Du bist mir da auf den Knien viel zu routiniert. Lass die Finger von meinem Schwanz, danke im Voraus! Ich mach das schon.«
Sein Blick auf mich besagte, dass ich in seinen Augen die Grenze von einem, der einen kräftigen Arschtritt benötigte, zu einem, den er in seiner Nähe nicht haben wollte, überschritten hatte. Er putzte an seinen Hosen und an seinem Shirt herum und schimpfte dabei in sich hinein.
Immer noch hielt ich die Rolle mit den Papiertüchern in der Hand und platschte durch die Eispfütze auf seine Kamera zu, um sie zu säubern.
Zu diesem Zeitpunkt war ich schon so nervös und durch den Wind, dass ich mich viel zu hektisch bewegte. Als ich die Kamera aufhob, drückte ich aus Versehen auf den roten Auslöser und machte ein Foto. Als die Kamera losging und dabei einen grellweißen Blitz aufleuchten und gleichzeitig ein hohes mechanisches Sirren erklingen ließ, war das Objektiv direkt auf Mat gerichtet.
Das Foto wurde nicht aus der Kamera geschoben, es wurde buchstäblich herausgeschleudert, flog über die Theke und landete auf der anderen Seite. Mats Kopf zuckte zurück. Er blinzelte hektisch, möglicherweise hatte der Blitz ihn geblendet.
Ich selbst war ein wenig geblendet, merkwürdige kupferfarbene Würmer krochen auf meiner Netzhaut herum. Ich schüttelte den Kopf und starrte wie betäubt auf die Kamera in meiner rechten Hand. Die Marke hieß »Solarid«, eine Firma, von der ich noch nie etwas gehört hatte und die, soweit ich weiß, auch nie existiert hat, weder in den USA noch sonst wo.
»Leg sie wieder hin«, sagte der Phönizier. Seine Stimme klang jetzt ganz anders.
Ich dachte, er wäre schon äußerst angsteinflößend gewesen, als er so herumgeschrien hatte, aber das hier war anders und viel schlimmer. Das war der Klang eines Munitionszylinders, der in den Revolver zurückschnappte; das Klicken, das den Abzug entsicherte.
»Ich wollte doch nur …« Meine Zunge war schwerfällig.
»Du wirst dich verletzen. Und das so sicher wie ein Herzinfarkt.«
Er streckte die Hand aus und ich legte die Solarid hinein. Wenn ich die Kamera hätte fallen lassen, da war ich sicher, wenn sie mir aus den zitternden, schweißnassen Händen geglitten wäre, dann hätte er mich umgebracht. Seine Finger um meine Kehle gelegt und zugedrückt. Ich glaubte das damals, und jetzt glaube ich das auch noch. Seine grauen Augen musterten mich mit kalter, unglaublicher Wut, sein pockennarbiges Gesicht war so ausdruckslos wie eine Latexmaske.
»Das Bild. Her mit dem Bild«, forderte er.
Mat schien immer noch benommen vom Blitzlicht. Er sah mich an. Dann sah er zu seiner Mutter. Er schien auf einmal gar nicht mehr zu wissen, worum es hier ging.
Der Phönizier ignorierte ihn und richtete seine Aufmerksamkeit auf Mrs. Matsuzaka. Er streckte die flache Hand aus. »Das ist mein Foto, und ich will es wiederhaben. Meine Kamera, mein Film, mein Foto.«
Ihr Blick suchte den Boden um sich herum ab, dann sah sie auf und zuckte wieder mit den Schultern.
»Es wurde ausgeworfen und ging auf Ihrer Seite der Theke zu Boden«, erklärte der Phönizier und sprach dabei laut und langsam, so wie Leute eben sprechen, wenn sie unglaublich zornig auf einen Ausländer sind. Als könnte man sie besser verstehen, je lauter sie werden. »Das haben wir alle gesehen. Suchen Sie gefälligst danach. Es liegt sicher da unten.«
Mat rieb sich derweil mit den Handballen die Augen, ließ die Hände wieder sinken und gähnte. »Was ist denn hier los?«, wollte er wissen. Als hätte er gerade erst die Decke zurückgeschlagen, wäre aufgestanden, ins Zimmer gekommen und dabei in einen Streit geplatzt.
Seine Mutter sagte etwas auf Japanisch zu ihm, mit schneller und hektischer Stimme. Er starrte sie wieder mit diesem verschleierten Blick an, dann hob er den Kopf und ließ seinen Blick zu dem Phönizier wandern.
»Was ist denn das Problem, Bro?«
»Das Foto. Das Bild, das dieser fette Junge hier von dir gemacht hat. Ich will es haben.«
»Warum denn dieser Aufstand? Wenn ich’s finde, soll ich’s dann für Sie signieren?«
Der Phönizier hatte es jetzt satt herumzuquatschen. Er ging zu der hüfthohen Klapptür, die hinter den Tresen und zur Kasse führte. Mats Mom, die gerade mit einem etwas leeren Blick den Boden absuchte, wirbelte herum und hielt mit einer erstaunlich flinken Bewegung die Türe zu, bevor er hereinkommen konnte. Ihre Miene war nun sehr missbilligend.
»Nein! Kunden bleiben auf anderer Seite von Theke! Nein, nein!«
»Ich will dieses verdammte Foto«, erklärte der Phönizier.
»Yo, Bruder!« Mat schüttelte auch die letzten Reste seiner Verwirrung ab. Er trat zwischen seine Mutter und den Phönizier und plötzlich wirkte er sehr groß. »Sie haben sie doch gehört. Bleiben Sie zurück. Hausordnung. Niemand kommt auf diese Seite des Tresens, der nicht hier arbeitet. Wenn Ihnen das nicht gefällt, kaufen Sie sich ’ne Postkarte und schicken Sie ’ne Beschwerde an die Firmenleitung von Exxon. Die haben sicher grade auf Sie gewartet.«
»Könnten Sie mal ein bisschen schneller machen? Ich hab ein Baby im Wagen«, mischte sich jetzt eine Frau mit einem Armvoll Katzenfutterdosen hinter uns ein.
Ja, was denn, haben Sie wirklich gedacht, wir vier wären die ganze Zeit die Einzigen im Laden gewesen? Während ich meinen Arctic-Blu-Vanilla-Coke-Slush-Spezial auf dem Phönizier verteilt und er geflucht und geschmollt und gedroht hatte, waren neue Kunden hereingekommen, hatten sich an Chips und Drinks bedient, an in Plastik verpackten belegten Brötchen und hatten hinter uns eine Schlange gebildet. Mittlerweile reichte diese Schlange durch den halben Laden.
Mat stellte sich hinter die Kasse. »Der Nächste bitte.«
Die Mutter mit dem Arm voller Katzenfutterdosen trippelte vorsichtig um den in lebhaftem Science-Fiction-Blau funkelnden Slush-See herum und Matt begann, sie abzukassieren.
Der Phönizier konnte es sichtlich kaum glauben. Mats summarische Abfertigung war eine Unverschämtheit, die etwa meiner Frechheit gleichkam, seine Hose mit Arctic Blu zu beschmutzen.
»Wisst ihr was? Fickt euch doch. Fick diesen Laden, fick dieses nutzlose Stück fette Scheiße hier und dich, Schlitzi, noch obendrein. Ich will in dieser Kloake keinen Penny mehr ausgeben als absolut nötig!«
»Das macht 1,89«, sagte Mat zu der Frau mit dem Katzenfutter. »Und das Unterhaltungsprogramm heute Nachmittag gibt’s kostenlos dazu.«
Der Phönizier hatte die Tür erreicht, blieb aber noch einmal stehen, um mir, schon halb aus der Tür, einen bösen Blick zuzuwerfen. »Ich werd dich nicht vergessen, Kleiner. Du solltest dir hinten Augen wachsen lassen, hast du kapiert?«
Der Schrecken hatte mich noch zu sehr im Griff, als dass ich auch nur den Ansatz einer Antwort hätte herauspressen können. Er knallte die Tür hinter sich zu. Einen Augenblick später hatte sein Caddy die Zapfsäulen röhrend hinter sich gelassen und war mit quietschenden Reifen auf die Schnellstraße eingebogen.
Ich benutzte den Rest der Papiertücher, um den Slush vom Boden aufzuwischen. Es war eine Erleichterung, wieder auf die Knie gehen zu dürfen, sodass ich niemandem mehr in die Augen sehen musste und quasi privat ein wenig vor mich hin weinen konnte. Du liebe Zeit, ich war 13. Die Kunden traten um mich herum, bezahlten und gingen dann wieder, wobei sie taten, als könnten sie mein Schnüffeln und meine erstickten Schluchzer nicht hören.
Als ich die Bescherung endlich aufgewischt hatte (der Boden war jetzt klebrig, aber trocken), trug ich die Masse klitschnasser Papiertücher zum Tresen. Mrs. Matsuzaka stand neben ihrem Sohn, ihren Blick in die Ferne gerichtet und die Mundwinkel herabgezogen. Aber als sie mich mit dem Arm voller nasser Papiertücher erblickte, wachte sie auf und griff nach dem großen Mülleimer hinter der Theke. Sie zerrte ihn zu mir herüber und da sah ich es: das Foto. Es lag mit dem Bild nach unten auf dem Boden. Es war unter den Mülleimer geglitten, sodass Mrs. Matsuzaka es nicht hatte entdecken können.
Jetzt sah Mrs. Matsuzaka es auch und drehte sich danach um, während ich meine nassen Papiertücher in den Mülleimer fallen ließ. Sie starrte auf das Foto herab, als konnte sie nicht begreifen, was sie sah. Dann blickte sie auf, zu mir herüber und hielt mir das Bild hin, sodass ich es ebenfalls ansehen konnte.
Es hätte eigentlich ein Porträt von Mat sein sollen. Das Objektiv war genau auf ihn gerichtet gewesen.
Doch stattdessen war es eine Fotografie von mir.
Aber es war nicht ich, wie ich gerade, vor ein paar Minuten, ausgesehen hatte. Es war ein Bild von einer Situation mit mir vor ein paar Wochen. Auf dem Bild saß ich auf einem Plastikstuhl neben der Slush-Maschine, las eine Popular Mechanics-Ausgabe und nuckelte an einem riesigen Becher Arctic-Blu-Vanilla-Coke-Slush-Spezial herum. Auf dem Polaroid (dem Solarid?) trug ich ein weißes Huey-Lewis-T-Shirt und ein paar knielange Jeans. Heute trug ich Kakihosen und ein Hawaiihemd mit Taschen darauf. Der Fotograf hätte sich in einer Position hinter der Theke befinden müssen.
Das ergab überhaupt keinen Sinn. Ich starrte das Bild völlig verwirrt an und versuchte herauszufinden, wo es wohl herkam. Es konnte ja gar nicht das Foto sein, das ich versehentlich geschossen hatte, aber wer es vor ein paar Wochen gemacht haben könnte, wusste ich ebenso wenig. Ich hatte keine Erinnerung daran, dass Mat oder seine Mom mich geknipst hatte, während ich eins von Mats Magazinen gelesen hatte. Ich konnte mir auch nicht vorstellen, warum sie das überhaupt hätten tun wollen, und hatte beide auch noch nie mit einer Polaroidkamera gesehen.
Ich schluckte und fragte, ob ich das Bild haben könnte.
Mrs. Matsuzaka warf noch einen verständnislosen Blick auf das Bild, schürzte die Lippen und legte es auf die Theke. Dann schob sie es mir zu. Und als sie die Hand zurückzog, rieb sie die Fingerspitzen aneinander, als hätte sie eine unangenehme Substanz darauf.
Ich starrte noch ein paar Sekunden mit einem Knoten in der Kehle auf das Bild. Mir war sogar ein wenig übel, in mir war ein Schrecken, der seine Ursache nicht nur in dem Zorn und den Drohungen des Phöniziers hatte. Ich steckte das Bild schließlich in meine Hemdtasche und schob mich dann zur Kasse hinüber. Dann legte ich den Zwanziger auf die Theke und dachte schaudernd: Das ist sein Geld. Was wird er wohl tun, wenn ihm klar wird, dass du es ihm nicht wiedergegeben hast? Du solltest dir hinten Augen wachsen lassen, Fag. Und auf dich aufpassen.
Sehen Sie, damals beleidigte ich mich sogar selbst.
»Tut mir leid wegen des Chaos«, sagte ich. »Das ist für den Liter Slush.«
»Hey, mach dir nichts draus, Kumpel. Ich werd’s dir nicht berechnen. Ist doch nur etwas verschüttetes Zuckerwasser.« Mat schob mir den Geldschein wieder hin.
»Okay. Na ja, ich schulde dir was, weil du mich vor dem Kerl in Schutz genommen hast. Du hast mir das Leben gerettet, Mat, echt jetzt.«
»Ja, klar«, antwortete er. Doch dabei zog er die Brauen zusammen und warf mir einen verwirrten Blick zu, als wäre er nicht ganz sicher, wovon ich eigentlich redete. Er sah mich noch einen langen Augenblick an, dann schüttelte er leicht den Kopf. »Kann ich dich mal was fragen?«
»Klar, was denn, Mat?«
»Du redest, als wären wir Freunde. Kennen wir uns?«
Kapitel 4
Ich verließ die Tankstelle mit zum Zerreißen angespannten Nerven und einem Übelkeit erregenden Summen im Kopf. Als ich ging, war ich absolut sicher, dass Mat nicht die geringste Ahnung hatte, wer ich verdammt noch mal war, und keine Erinnerung daran hatte, mich je zuvor gesehen zu haben. Und das, obwohl ich beinahe jeden Tag zur Tankstelle ging und seine zerlesenen Ausgaben von Popular Mechanics seit über einem Jahr las. Er kannte mich ganz einfach nicht mehr. Eine Vorstellung, die mich zutiefst erschütterte.