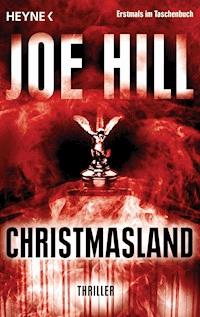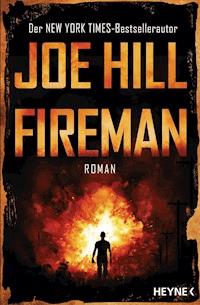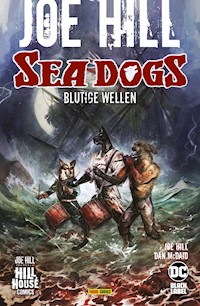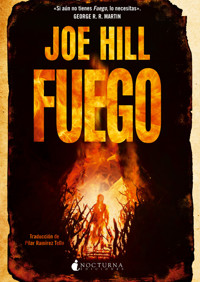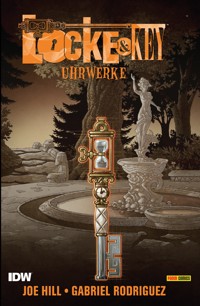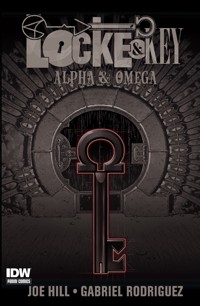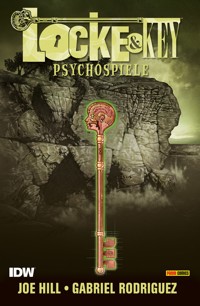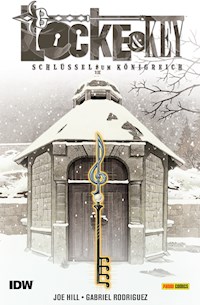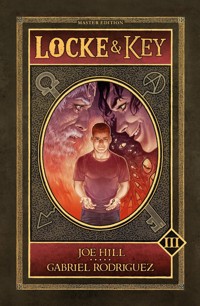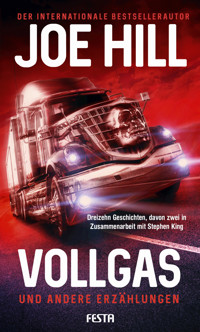
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Festa Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
13 Geschichten voll Schrecken und purer Magie. Darunter ›Vollgas‹ und ›Im hohen Gras‹, zwei Zusammenarbeiten mit Stephen King. Kirkus Reviews: »Kleine Meisterwerke des modernen Horrors, die beweisen, dass das Leben hart, seltsam und immer tödlich ist.« SFF World: »VOLLGAS ist eine grandiose Sammlung und ein weiterer Beweis dafür, dass Hill einer der großartigsten Geschichtenerzähler des frühen 21. Jahrhunderts ist. Sehr empfehlenswert.« Die Werke eines genialen Erzählers. Hypnotisch und beunruhigend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 788
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Aus dem Amerikanischen von Manfred Sanders
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe Full Throttle
erschien 2019 im Verlag William Morrow.
Copyright © 2019 by Joe Hill
Copyright © dieser Ausgabe 2021 by Festa Verlag, Leipzig
Veröffentlicht mit der Erlaubnis des Verlages William Morrow,
ein Imprint von HarperCollins Publishers, LLC.
Titelbild: Arndt Drechsler-Zakrzewski
Alle Rechte vorbehalten
eISBN 978-3-86552-907-7
www.Festa-Verlag.de
Inhalt
Impressum
EINLEITUNG: Wer ist dein Daddy?
VOLLGAS (mit Stephen King)
DAS KARUSSELL
WOLVERTON STATION
AN DEN SILBERNEN WASSERN DES LAKE CHAMPLAIN
FAUN
ÜBERFÄLLIG
MEINE WELT DREHT SICH NUR UM DICH
DAUMENABDRUCK
DER TEUFEL AUF DER TREPPE
TWEETS AUS DEM ZIRKUS DER TOTEN
MUMS
IM HOHEN GRAS (mit Stephen King)
WIR GEBEN SIE FREI
Anmerkungen und Danksagungen
Über den Autor
Für Ryan King, den Tagträumer.
Ich liebe dich.
EINLEITUNG: Wer ist dein Daddy?
Jeden Abend gab es ein neues Monster.
Ich hatte dieses Buch, das ich innig liebte: Bring On the Bad Guys. Es war eine große, klobige Taschenbuch-Anthologie von Comicgeschichten, und wie Sie anhand des Titels vielleicht schon erraten können, ging es darin nicht um Helden. Vielmehr war es eine Sammlung von Geschichten über die Schlimmsten der Schlimmen, niederträchtige Psychopathen wie The Abomination und ähnliche Gestalten.
Mein Dad musste mir jeden Abend aus dem Buch vorlesen. Er hatte keine Wahl. Es war einer dieser Scheherazade-Deals: Wenn er mir nicht vorlas, würde ich nicht im Bett bleiben. Ich würde unter meiner Das Imperium schlägt zurück-Bettwäsche hervorkriechen und in meinem Spiderman-Schlafanzug durchs Haus streunen, einen feuchten Daumen im Mund und meine Schmusedecke über der Schulter. Ich konnte die ganze Nacht umherwandern, wenn mir danach war. Mein Vater musste vorlesen, bis mir fast die Augen zufielen, und selbst dann konnte er nur entkommen, indem er behauptete, er wolle schnell draußen eine rauchen und sei gleich wieder da.
(Meine Mutter behauptet, ich hätte diese Schlafstörungen einem Trauma zu verdanken. Mit fünf bekam ich eine Schneeschippe vors Gesicht und verbrachte eine Nacht im Krankenhaus. In jenem Zeitalter der Lavalampen, Flauschteppiche und des Rauchens in Flugzeugen war es Eltern nicht gestattet, über Nacht bei ihren verletzten Kindern im Krankenhaus zu bleiben. Die Legende besagt, dass ich mitten in der Nacht mutterseelenallein erwachte, meine Eltern nicht finden konnte und zu türmen versuchte. Krankenschwestern erwischten mich, als ich mit nacktem Hintern durch die Korridore wanderte, steckten mich in ein Kinderbett und spannten ein Netz darüber, um mich an der Flucht zu hindern.
Die Geschichte ist so wundervoll grausam und gruselig, dass wir sie, glaube ich, unbedingt für wahr halten müssen. Ich hoffe nur, dass das Kinderbett schwarz und verrostet war und dass eine der Schwestern flüsterte: »Ich tue es für dich, Damien!«)
Ich liebte die Submenschen in Bring On the Bad Guys – wahnsinnige Kreaturen, die unverschämte Forderungen kreischten, Tobsuchtsanfälle hatten, wenn sie ihren Willen nicht bekamen, mit den Fingern aßen und wild darauf waren, ihre Feinde zu beißen. Natürlich liebte ich sie. Ich war sechs. Wir hatten viel gemeinsam.
Mein Dad las mir diese Geschichten vor und sein Finger wanderte von einem Bild zum nächsten, damit mein müder Blick der Handlung folgen konnte. Wenn Sie mich gefragt hätten, wie Captain Americas Stimme klingt, hätte ich es Ihnen sagen können: Er klang genau wie mein Dad. Ebenso Dread Dormammu. Ebenso Sue Richards, die Unsichtbare – sie klang wie mein Dad, wenn er eine Frauenstimme imitiert.
Sie waren alle mein Dad, jeder Einzelne von ihnen.
Die meisten Söhne kann man in zwei Gruppen einteilen.
Da gibt es den Jungen, der seinen Vater ansieht und denkt: Ich hasse diesen Hurensohn und schwöre bei Gott, dass ich niemals so sein werde wie er.
Und dann gibt es den Jungen, der es anstrebt, genauso zu sein wie sein Vater: genauso frei zu sein, so liebenswürdig, sich so in seiner eigenen Haut wohlzufühlen. Und ein solcher Sohn hat keine Angst davor, dass er seinem Dad in Wort und Tat ähneln könnte; er hat Angst davor, seine Erwartungen nicht zu erfüllen.
Mir scheint, dass die erste Sorte Söhne diejenigen sind, die eigentlich im Schatten ihres Vaters stehen. Auf den ersten Blick mag das unlogisch erscheinen. Schließlich haben wir es da mit einem Burschen zu tun, der sich seinen Dad ansieht und dann beschließt, so weit wie möglich und so schnell wie möglich in die andere Richtung zu rennen. Welche Entfernung muss man zwischen sich und seinen alten Herrn bringen, bevor man wirklich frei ist?
Und an jedem Scheideweg in seinem Leben stellt unser Bursche fest, dass sein Vater direkt hinter ihm steht: bei seinem ersten Date, bei seiner Hochzeit, beim Bewerbungsgespräch. Jede Entscheidung muss gegen Dads Vorbild abgewogen werden, damit man auch wirklich das Gegenteil davon macht … Und auf diese Weise geht diese unglückliche Beziehung immer weiter und weiter, selbst wenn Vater und Sohn seit Jahren kein Wort mehr miteinander geredet haben. Man rennt und rennt und kommt doch nirgends an.
Der zweite Junge hört dieses John-Donne-Zitat – »Wir sind nicht einmal der Schatten, den unsere Väter zur Mittagszeit werfen« – und nickt und denkt: Ah, Shit, stimmt genau. Er hat Glück – schreckliches, unverdientes, duseliges Glück. Er ist frei, er selbst zu sein, weil sein Vater es auch war. Dieser Vater wirft in Wirklichkeit gar keinen Schatten. Er wird vielmehr zu einer Quelle des Lichts, zu etwas, das einem dabei hilft, das vor einem liegende Territorium etwas klarer zu erkennen und sich seinen eigenen Weg zu suchen.
Ich versuche, immer daran zu denken, was für ein Glück ich habe.
Heutzutage erscheint es uns selbstverständlich, dass wir uns einen Film, der uns gefällt, immer wieder ansehen können. Man streamt ihn auf Netflix oder kauft ihn bei iTunes oder gönnt sich die DVD-Sonderedition mit Bonusmaterial und allen Extras.
Aber bis ungefähr 1980 sah man einen Film im Kino und dann wahrscheinlich nie wieder, es sei denn, er wurde irgendwann im Fernsehen ausgestrahlt. In den meisten Fällen sah man sich einen Film nur in seiner Erinnerung noch einmal an – ein sehr trügerisches, substanzloses Format, das aber auch nicht ohne seinen eigenen Reiz ist. Eine ganze Reihe von Filmen macht sich am besten in der verschwommenen Rückerinnerung.
Als ich zehn war, kam mein Vater mit einem Laserdisc-Player nach Hause, dem Vorläufer des modernen DVD-Players. Er hatte außerdem drei Filme gekauft: Der weiße Hai, Duell und Unheimliche Begegnung der dritten Art. Die Filme waren auf diesen riesigen schimmernden Scheiben – entfernt erinnerten sie an die tödlichen Frisbees, mit denen Jeff Bridges in Tron um sich wirft. Jede dieser schillernden Platten enthielt 20 Minuten Film auf jeder Seite. Wenn ein 20-Minuten-Segment endete, musste mein Dad aufstehen und das Ding umdrehen.
Den ganzen Sommer über sahen wir uns Der weiße Hai, Duell und Unheimliche Begegnung der dritten Art an, wieder und immer wieder. Manchmal gerieten Scheiben durcheinander: Wir sahen 20 Minuten lang zu, wie Richard Dreyfuss die staubigen Hänge des Devils Tower hochkraxelte, um die Alienlichter im Himmel zu erreichen, dann sahen wir 20 Minuten lang, wie Robert Shaw gegen den Hai kämpfte und mittendurch gebissen wurde. Irgendwann schließlich waren es gar keine voneinander unabhängigen Geschichten mehr, sondern ein einziger verwirrender Flickenteppich von Handlungen, ein Patchwork von wild dreinblickenden Männern, die gnadenlosen Raubtieren zu entkommen versuchen und im sternenübersäten Himmel nach Rettung Ausschau halten.
Wenn ich in jenem Sommer schwimmen ging und unter die Oberfläche des Sees tauchte, war ich mir sicher, dass jeden Moment ein großer weißer Hai aus der Dunkelheit auf mich zugeschossen kommen würde. Mehr als einmal hörte ich mich unter Wasser schreien. Wenn ich in mein Zimmer ging, rechnete ich damit, dass meine Spielsachen zu groteskem übernatürlichem Leben erwachten, angetrieben von der Energie, die vorbeifliegende Ufos ausstrahlen.
Und jedes Mal wenn ich mit meinem Vater im Auto fuhr, spielten wir Duell.
Der Film, gedreht vom jungen Steven Spielberg, handelt von einem farblosen Geschäftsmann in einem Plymouth (Dennis Weaver), der verzweifelt durch die kalifornische Wüste rast, verfolgt von einem namenlosen, unsichtbaren Trucker in einem dröhnenden Peterbilt-Tanklastzug. Der Film war (und ist immer noch) eine im grellen Sonnenlicht spielende Hommage an Hitchcock und eine chromblitzende Kostprobe des unerschöpflichen Potenzials des Regisseurs.
Wenn mein Dad und ich mit dem Auto fuhren, taten wir gern so, als wäre der Truck hinter uns her. Wenn der imaginäre Truck uns von hinten rammte, trat mein Dad aufs Gaspedal, um den Eindruck zu erwecken, wir hätten einen Stoß von hinten erhalten. Dann warf ich mich schreiend auf dem Beifahrersitz hin und her. Natürlich ohne Sicherheitsgurt – das war 1982, vielleicht 1983. Zwischen uns auf dem Sitz lag ein Sixpack Bier … und wenn mein Dad eine Dose geleert hatte, flog sie aus dem Fenster, zusammen mit seiner Zigarette.
Schließlich zerquetschte der Truck uns und mein Dad stieß einen Todesschrei aus und schwenkte den Wagen auf der Straße hin und her, um anzudeuten, dass wir tot waren. Er konnte manchmal eine ganze Minute mit heraushängender Zunge und verrutschter Brille fahren, um zu zeigen, dass der Truck ihn erledigt hatte. Es war immer ein Riesenspaß, mit ihm zusammen auf der Straße zu sterben, Vater und Sohn und der teuflische Sattelschlepper des Todes.
Mein Dad las mir Geschichten über den Grünen Kobold vor, meine Mutter über Narnia. Ihre Stimme war (und ist) so beruhigend wie der erste Schneefall des Jahres. Sie las von Verrat und brutalem Gemetzel mit der gleichen geduldigen Sicherheit, mit der sie von Auferstehung und Erlösung las. Sie ist nicht religiös, aber sie vorlesen zu hören fühlt sich ein bisschen so an, als stünde man in einer majestätischen gotischen Kathedrale, angefüllt mit Licht und dem Gefühl eines großen, freien Raumes.
Ich erinnere mich an Aslan, tot auf dem Stein liegend, während die Mäuse an den Seilen nagen, die seine Leiche fesseln. Ich glaube, das hat mir ein grundlegendes Gefühl für Anstand vermittelt. Um ein anständiges Leben zu leben, bedarf es nicht viel mehr, als eine Maus zu sein, die an einem Seil nagt. Eine Maus ist nicht viel, aber wenn genug von uns nagen, können wir etwas freisetzen, das uns vor dem Schlimmsten retten kann. Vielleicht rettet es uns sogar vor uns selbst.
Ich glaube auch, dass Bücher nach den gleichen Prinzipien funktionieren wie verzauberte Schränke. Man steigt in diesen kleinen Raum hinein und kommt an der anderen Seite in einer riesigen geheimen Welt heraus, an einem Ort, der furchterregender und wundersamer ist als die eigene Welt.
Meine Eltern lasen nicht nur Geschichten vor – sie schrieben sie auch, und wie sich herausstellte, waren sie beide sehr gut darin. Mein Dad war so erfolgreich, dass er auf das Cover des Time Magazine kam. Und zwar gleich zwei Mal! Es wurde behauptet, er sei der Mann, der Amerika das Fürchten lehrte. Alfred Hitchcock war tot, also musste es jemand anders tun. Meinem Dad war es recht; Amerika das Fürchten zu lehren ist ein gut bezahlter Posten.
Regisseure wurden von den Ideen meines Vaters angetörnt, und Produzenten wurden von Geld angetörnt, deshalb wurden etliche der Bücher verfilmt.
Mein Vater freundete sich mit einem angesehenen Independent-Filmemacher namens George A. Romero an. Romero war der zottelige, rebellische Autorenfilmer, der mit seinem Film Die Nacht der lebenden Toten quasi die Zombie-Apokalypse erfunden hat, der aber irgendwie vergaß, die Idee urheberrechtlich schützen zu lassen, und deshalb nie viel Geld damit verdiente. Die Macher von The Walking Dead werden Romero auf ewig dafür dankbar sein, dass er so gut als Regisseur war und so schlecht im Schützen seines geistigen Eigentums.
George Romero und mein Vater standen auf die gleiche Art von Comics: die fiesen, blutigen, die in den 50er-Jahren veröffentlicht wurden, bevor sich eine Bande von Senatoren und Seelenklempnern zusammenrottete, um die Kindheit wieder langweilig zu machen. Tales from the Crypt, The Vault of Horror, The Haunt of Fear.
Romero und mein Dad beschlossen, gemeinsam einen Film zu machen – Creepshow –, der wie einer dieser Horrorcomics sein sollte, nur in Filmform. Mein Dad spielte sogar eine Rolle in dem Film: einen Mann, der mit einem außerirdischen Erreger infiziert wird und sich in eine Pflanze verwandelt. Sie drehten in Pittsburgh, und ich glaube, mein Dad wollte nicht allein sein, deshalb holte er mich dazu und sie steckten mich auch in den Film. Ich spielte einen Jungen, der seinen Vater mit einer Voodoo-Puppe ermordet, nachdem Dad ihm seine Comics weggenommen hat. Mein Film-Dad war Tom Atkins, der im wirklichen Leben viel zu liebenswert und umgänglich ist, um ihn zu ermorden.
Der Film war voll mit großartigen Ekelmomenten: abgetrennte Köpfe, aufplatzende angeschwollene Leiber, aus denen Kakerlaken herausquellen, lebende Leichen, die aus dem Morast kriechen. Romero konnte einen Künstler des Gemetzels als Maskenbildner gewinnen: Tom Savini, den Zauberer des Widerlichen, der auch die Titelgestalten des Filmes Zombie kreierte.
Savini trug eine schwarze lederne Motorradjacke und Motorradstiefel. Er hatte einen satanischen Kinnbart und gewölbte Spock-artige Augenbrauen. In seinem Wohnwagen gab es ein ganzes Regalbrett voller Bücher mit Autopsiefotos. Im Endeffekt hatte er bei Creepshow zwei Jobs zu erledigen: sich um die speziellen Make-up-Effekte kümmern und mich babysitten. Ich verbrachte eine ganze Woche in seinem Wohnwagen, wo ich ihm dabei zusah, wie er Wunden aufmalte und Klauen formte. Er war mein erster Rockstar. Alles, was er sagte, war witzig und gleichzeitig seltsamerweise auch wahr. Er war in Vietnam gewesen, und er erzählte mir, dass er stolz auf das sei, was er dort geleistet hatte: nicht getötet zu werden. Er war der Meinung, dass ein Revisualisieren des Gemetzels im Film eine gute Therapie sei, nur dass er dafür bezahlt werde.
Ich sah ihm zu, wie er meinen Dad in ein Sumpfmonster verwandelte. Er pflanzte Moos in die Augenbrauen meines Vaters, befestigte struppiges Grünzeug an seinen Händen, klebte ihm einen Klumpen künstliches Gras auf die Zunge. Eine halbe Woche lang hatte ich keinen Dad, sondern einen Garten mit Augen. In meiner Erinnerung riecht er nach der feuchten Erde unter einem Haufen Herbstblätter, aber das ist wahrscheinlich nur ein Werk meiner Fantasie.
Tom Atkins musste im Film so tun, als würde er mir eine Ohrfeige verpassen, und Savini malte einen roten Handabdruck auf meine linke Wange. Die Dreharbeiten dauerten an dem Abend sehr lange, und als wir das Set verließen, war ich halb verhungert. Mein Vater fuhr mit mir zu einem nahe gelegenen McDonald’s. Ich war übermüdet und überdreht, ich zappelte herum und rief, dass ich einen Schokoladen-Milchshake wolle, dass er mir einen Milchshake versprochen habe. Irgendwann merkte mein Vater, dass uns ein halbes Dutzend McDonald’s-Mitarbeiter mit entsetzten, anklagenden Blicken ansahen. Ich hatte immer noch diesen Handabdruck im Gesicht, und er war um ein Uhr morgens mit mir bei McDonald’s, um mir einen Milchshake zu kaufen als … was? Als Bestechung, damit ich ihn nicht wegen Kindesmisshandlung anzeigte? Wir verschwanden aus dem Laden, bevor jemand die Kinderschutzbehörde alarmieren konnte, und waren nicht wieder bei McDonald’s, bis wir Pittsburgh verließen.
Als ich schließlich mit meinem Dad nach Hause fuhr, waren mir zwei Dinge klar geworden: dass ich erstens keine wirkliche Zukunft als Schauspieler hatte, ebenso wenig wie mein Dad (sorry, Dad). Und zweitens, dass ich, auch wenn ich nicht das geringste Schauspieltalent besaß, dennoch meine Berufung gefunden hatte, meinen Lebensinhalt. Ich hatte sieben volle Tage dabei zugesehen, wie Tom Savini Menschen künstlerisch abschlachtete und unvergessliche missgestaltete Monster erschuf, und genau das wollte ich auch tun.
Und im Endeffekt kam es dann ja auch so.
Was mich zu dem bringt, was ich in dieser Einleitung eigentlich sagen will: Ein Kind hat nur zwei Eltern, aber wenn man das Glück hat, seinen Lebensunterhalt mit einer künstlerischen Tätigkeit verdienen zu können, hat man letztlich eine ganze Reihe Mütter und Väter. Wenn jemand einen Schriftsteller fragt: »Wer ist dein Daddy?«, dann lautet die ehrlichste Antwort: »Das ist kompliziert.«
In der High School kannte ich Sportskanonen, die jede Ausgabe von Sports Illustrated von vorn bis hinten lasen, und Rockfans, die jede Ausgabe des Rolling Stone studierten wie ein Gläubiger die Heilige Schrift. Ich für meinen Teil las vier Jahre lang Fangoria.Fangoria – Fango für die wahren Fans – war eine Zeitschrift, die sich ganz um Splatterfilme drehte, Filme wie John Carpenters Das Ding aus einer anderen Welt, Wes Cravens Shocker und auch so einige Filme mit dem Namen Stephen King im Untertitel. In jeder Ausgabe von Fangoria gab es eine ausklappbare Mittelseite, genau wie im Playboy, nur nicht mit einer nackten Frau, sondern mit irgendeinem Psychopathen, der gerade mit einer Axt einen Schädel spaltete.
Fango war mein Leitfaden in den weltbewegenden soziopolitischen Debatten der 80er-Jahre wie: War Freddy Krueger zu lustig? Was war der ekelhafteste Film, der je gedreht wurde? Und ganz besonders wichtig: Würde es jemals eine bessere, fiesere, knochensplitterndere Werwolfverwandlung geben als die in American Werewolf? (Über die Antworten auf die ersten beiden Fragen lässt sich diskutieren – die Antwort auf die dritte lautet schlicht und einfach Nein.)
Es war fast unmöglich, mir Angst einzujagen, aber American Werewolf gelang das Nächstbeste: Er erweckte in mir ein Gefühl der grauenerfüllten Dankbarkeit. Mir schien, dass der Film seine haarige Klaue auf eine Idee legte, die unter der Oberfläche aller wirklich großen Horrorgeschichten lauert, nämlich: Ein menschliches Wesen zu sein, bedeutet, ein Tourist in einem kalten, unfreundlichen und uralten Land zu sein. Wie alle Touristen hoffen wir auf Spaß – ein paar Lacher, ein bisschen Abenteuer, ein Nümmerchen im Heu. Aber es ist so leicht, sich zu verirren. Die Tage enden so schnell und die Straßen sind so verwirrend und da draußen in der Dunkelheit gibt es Dinge mit Zähnen. Um zu überleben, müssen wir möglicherweise selber ein paar Zähne zeigen.
Etwa um die Zeit, als ich anfing, Fangoria zu lesen, begann ich auch, täglich zu schreiben. Es erschien mir als die normalste Sache der Welt. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, saß meine Mutter hinter ihrer tomatenfarbenen IBM Selectric und dachte sich Sachen aus. Auch mein Vater war damit beschäftigt, dicht über den Monitor seines Wang-Textverarbeitungsgerätes gebeugt – der futuristischste Apparat, den er seit dem Laserdisc-Player angeschafft hatte. Der Bildschirm hatte das schwärzeste Schwarz in der Geschichte des Schwarz, und die Wörter darauf wurden in grünen Buchstaben angezeigt, der Farbe toxischer Strahlung in Science-Fiction-Filmen. Beim Essen drehten sich die Gespräche um Fantasiewelten, um Charaktere, Schauplätze, unerwartete Wendungen und Szenarien. Ich beobachtete meine Eltern bei der Arbeit, lauschte ihren Tischgesprächen und gelangte zu einer logischen Schlussfolgerung: Wenn man sich jeden Tag ein paar Stunden hinsetzte und sich Sachen ausdachte, würde einem früher oder später jemand einen Haufen Geld für seine Mühen zahlen. Was sich letzten Endes tatsächlich als wahr herausstellte.
Wenn man googelt: »Wie schreibt man ein Buch?«, dann erhält man eine Million Treffer, aber ich verrate Ihnen das schmutzige Geheimnis: Es ist reine Mathematik. Und noch nicht mal schwere Mathematik – Grundschulrechenkünste reichen. Schreiben Sie drei Seiten pro Tag, jeden Tag. Nach 100 Tagen haben Sie 300 Seiten. Tippen Sie »Ende« darunter – fertig.
Ich schrieb mein erstes Buch mit 14. Es hieß Midnight Eats, und es ging um eine Privatschule, in der die Damen aus der Kantine Schüler zerstückelten und dem Rest der Kinder zum Mittagessen vorsetzten. Es heißt ja, man ist, was man isst – ich verschlang Fango und schrieb etwas mit dem literarischen Wert eines billigen Splatterstreifens.
Ich glaube nicht, dass es irgendjemand geschafft hat, das Ding ganz bis zu Ende zu lesen, mit Ausnahme vielleicht meiner Mutter. Wie gesagt: Ein Buch zu schreiben ist reine Mathematik. Ein gutes Buch zu schreiben ist eine ganz andere Geschichte.
Ich wollte mein Handwerk erlernen, und ich hatte nicht nur einen, sondern gleich zwei brillante Autoren, die unter dem gleichen Dach lebten wie ich – ganz zu schweigen von Romanautoren jeglicher Couleur, die jeden Tag bei uns ein und aus gingen. 47 West Boulevard, Bangor, Maine, war vermutlich eine der besten unbekannten Autorenschulen der Welt, aber auf mich war sie größtenteils verschwendet, und das aus zwei guten Gründen: Ich war ein schlechter Zuhörer und ein noch schlechterer Schüler. Alice, bei ihrer Irrfahrt im Wunderland, stellt fest, dass sie sich selbst oft gute Ratschläge erteilt, sie aber nur selten beherzigt. Ich kann das verstehen. Ich hörte als Jugendlicher viele gute Ratschläge, von denen ich mir keinen einzigen zu Herzen nahm.
Manche Menschen sind visuelle Lerner; manche Menschen können viele hilfreiche Dinge aus Vorträgen oder dem Schulunterricht mitnehmen. Ich hingegen habe alles, was ich je über das Schreiben von Geschichten herausgefunden habe, aus Büchern gelernt. Mein Gehirn arbeitet nicht schnell genug für Unterhaltungen, aber Wörter auf einer Buchseite warten auf mich. Bücher haben Geduld mit langsamen Lernern. Der Rest der Welt weniger.
Meine Eltern wussten, dass ich das Schreiben liebte, und sie wollten, dass ich Erfolg damit hatte, und ihnen war klar, dass der Versuch, mir etwas zu erklären, manchmal ein bisschen so war, als ob man mit einem Hund redet. Unser Corgi Marlowe konnte ein paar wichtige Wörter verstehen wie ›geh‹ oder ›friss‹, aber das war auch so ziemlich alles. Ich kann nicht behaupten, dass es bei mir viel besser war. Also kauften meine Eltern mir zwei Bücher.
Meine Mutter schenkte mir Zen in der Kunst des Schreibens von Ray Bradbury, und auch wenn das Buch voll ist mit hervorragenden Vorschlägen, wie man seine Kreativität freisetzt, war das, was mich wirklich beeinflusst hat, die Art und Weise, wie es geschrieben ist. Bradburys Sätze gehen ab wie Salven von Feuerwerkskörpern in einer heißen Julinacht. Die Entdeckung Bradburys war ein bisschen so wie der Moment im Zauberer von Oz, als Dorothy aus der Scheune in die Welt hinter dem Regenbogen tritt – der plötzliche Übergang aus einem schwarz-weißen Zimmer in ein Land, in dem alles in Technicolor ist. Das Medium war die Botschaft.
Heute muss ich zugeben, dass ich Bradburys Sätze manchmal ein bisschen überfrachtet finde (nicht jede Zeile muss ein Clown auf einem Einrad sein, der mit brennenden Fackeln jongliert). Aber mit 14 brauchte ich jemanden, der mir die explosive Macht eines wohlgesetzten und erfinderischen Satzes nahebrachte. Nach Zen in der Kunst des Schreibens las ich eine ganze Weile nichts anderes als Bradbury: Löwenzahnwein, Fahrenheit 451 und – am besten von allen – Das Böse kommt auf leisen Sohlen. Oh, wie ich Darks Jahrmarkt der grotesken, realitätsverzerrenden Attraktionen liebte, vor allem das schreckliche Karussell in der Mitte, ein Karussell, das Kinder zu alten Menschen macht. Und dann waren da Bradburys Kurzgeschichten – jeder kennt diese Geschichten –, Meisterwerke der bizarren Literatur, die man in zehn Minuten lesen kann und dann sein ganzes Leben lang nicht mehr vergisst. Da war ›Ferner Donner‹, die Geschichte von ein paar Jägern, die ein Vermögen bezahlen, um Dinosaurier schießen zu können. Oder ›Das Nebelhorn‹, Bradburys Geschichte über ein prähistorisches Wesen, das sich in einen Leuchtturm verliebt. Seine Schöpfungen waren genial und überwältigend und mühelos, und ich griff immer und immer wieder zu Zen in der Kunst des Schreibens, um herauszufinden, wie er es gemacht hat. Und tatsächlich hat er für angehende Autoren einige handfeste und praktische Hilfsmittel anzubieten. Da gibt es eine Übung, bei der man Listen von Substantiven erstellt, um Ideen für Geschichten zu generieren. Eine Variation davon benutze ich bis heute (ich habe es zu einem eigenen kleinen Spielchen umgearbeitet, das ich ›Blitzpräsentation‹ nenne).
Mein Vater besorgte mir ein Buch von Lawrence Block mit dem Titel Telling Lies for Fun and Profit, eine Sammlung von Blocks Ratgeberkolumnen aus Writer’s Digest. Ich habe es immer noch. Das Buch ist mir in die Badewanne gefallen, deshalb ist es aufgequollen und verformt, und die Tinte, mit der ich ganze Passagen unterstrichen habe, ist verwischt, aber für mich ist es so wertvoll wie eine signierte Erstausgabe von Faulkner. Was ich von Block mitnahm, ist, dass das Schreiben ein Handwerk ist wie jedes andere, wie die Schreinerei. Um die Kunst zu entmystifizieren, konzentrierte er sich auf Details wie: Wie sieht ein großartiger erster Satz aus? Wie viel Detail ist zu viel? Warum funktionieren manche schockierenden Enden, während andere lahm wie ein einbeiniger Hundertjähriger sind?
Und – das fand ich besonders faszinierend – was sind die Vorteile des Schreibens unter Pseudonym?
Mit Pseudonymen kannte Block sich aus. Er benutzte selbst einen ganzen Haufen davon, um ganz bestimmte Identitäten für ganz bestimmte Arten von Werken zu erschaffen. Bernard Malamud bemerkte einmal, dass die erste und schwierigste Schöpfung eines Autors er selbst sei; sobald man sich selbst erfunden habe, würden die Geschichten ganz mühelos aus dieser Persona herausströmen. Mich faszinierte der Gedanke, dass Block, wenn es ihm dienlich war, ein neues Gesicht aufsetzte und Romane von Leuten schrieb, die ihrerseits reine Fiktion waren.
»O ja«, sagte mein Dad. »Sieh dir Such Men Are Dangerous an, den Roman, den Block als Paul Kavanagh geschrieben hat. Das Buch fühlt sich kaum wie ein Roman an, sondern mehr, als würde man in einer dunklen Gasse eins über den Schädel kriegen.« Such Men Are Dangerous ist die Geschichte eines Ex-Soldaten, der im Krieg grässliche Dinge getan hat und nach Hause kommt mit dem Wunsch, auch dort grässliche Dinge zu tun. Auch wenn es Jahrzehnte her ist, seit ich es gelesen habe, glaube ich, dass die Einschätzung meines Dads im Großen und Ganzen korrekt war. Bradburys Sätze waren wie Feuerwerkskörper in einer Sommernacht. Kavanaghs waren wie Schläge mit einem Bleirohr. Larry Block schien mir ein recht netter Kerl zu sein. Paul Kavanagh nicht.
Etwa um die Zeit fing ich an, mich zu fragen, wer ich wohl wäre, wenn ich nicht mehr ich wäre.
Ich schrieb während meiner High-School-Zeit drei weitere Romane. Alle drei hatten ein künstlerisches Merkmal gemeinsam: Sie waren grottenschlecht. Aber schon damals war mir klar, dass das normal ist. Wunderkinder sind fast immer tragische Gestalten, die ein paar Jahre lang hell lodern und mit 20 ausgebrannt sind. Jeder andere muss es auf die langsame Weise angehen, auf die harte Tour, eine öde Schaufel Erde nach der anderen. Diese langsame, harte Arbeit belohnt einen damit, dass sie die mentalen und emotionalen Muskeln aufbaut und im Allgemeinen ein stabileres Fundament errichtet, auf dem man eine Karriere aufbauen kann. Wenn es dann Rückschläge gibt, ist man darauf vorbereitet. Schließlich musste man ja auch schon früher mit ihnen fertigwerden.
Als ich auf dem College war, dachte ich dann natürlich auch irgendwann darüber nach, einige meiner Geschichten zu veröffentlichen. Aber ich hatte Angst, sie unter meinem eigenen Namen einzureichen. Bislang, so wusste ich, hatte ich noch nichts geschrieben, das sich zu lesen lohnte. Wie sollte ich es wissen, wenn ich etwas Gutes, etwas wirklich Gutes verfasste? Meine Sorge war, dass ich ein lausiges Buch an die Verlage schickte und irgendjemand es trotzdem veröffentlichte, weil er die Chance sah, ein paar schnelle Dollar mit meinem Nachnamen zu machen. Ich war unsicher, hatte oft sonderbare (und unrealistische) Ängste und ich wollte unbedingt die Gewissheit haben, dass ich, wenn ich eine Geschichte verkaufte, sie auch aus den richtigen Gründen verkaufte.
Also ließ ich meinen Nachnamen weg und begann, als Joe Hill zu schreiben. Warum Hill? Es ist die verkürzte Form meines zweiten Vornamens Hillström – und im Nachhinein, o Mann, was habe ich mir nur dabei gedacht! Der Umlaut ist in der englischen Sprache etwas absolut Hardrockmäßiges, und ich habe einen in meinem Namen und habe ihn nicht verwendet! Das war die Chance meines Lebens auf Heavy-Metal-Ruhm, und ich habe sie nicht genutzt.
Des Weiteren überlegte ich mir, dass ich es besser vermeiden sollte, Gruselgeschichten zu schreiben, und mir lieber mein eigenes Material suchen sollte. Also schrieb ich einen Stapel Erzählungen im Stil des New Yorker über Scheidung, die Erziehung schwieriger Kinder und die Midlife-Crisis. Diese Geschichten enthielten den einen oder anderen guten Satz, aber sonst nicht viel, was sich zu lesen lohnte. Ich habe nicht viel über Scheidungen zu sagen – ich war nie verheiratet! Das Gleiche gilt für die Erziehung schwieriger Kinder. Die einzige Erfahrung, die ich mit schwierigen Kindern gemacht habe, bestand darin, selbst eins zu sein. Und da ich zu der Zeit Mitte 20 war, war ich spektakulär unqualifiziert, über die Midlife-Crisis zu schreiben.
Aber von alledem abgesehen, war die Hauptschwierigkeit beim Verfassen einer guten New Yorker-Geschichte die, dass ich New Yorker-Geschichten nicht besonders mochte. In meiner Freizeit las ich abgedrehte Horrorcomics von Neil Gaiman und Alan Moore und keine Geschichten voller Mittelschicht-Ennui von Updike oder Cheever.
An irgendeinem Punkt, wahrscheinlich nach ungefähr 200 Ablehnungen, hatte ich eine kleine Erleuchtung. Es stimmte natürlich, dass es, wenn ich unter dem Namen Joseph King schriebe, ziemlich ungeschickt wäre, mit Horrorstorys Fuß fassen zu wollen; es würde aussehen, als würde ich mich mit beiden Händen an Daddys Rockschöße klammern. Aber Joe Hill war nur ein Joe Irgendwer. Niemand wusste etwas über Hills Vater und Mutter. Er konnte jede Sorte Künstler sein, die er nur sein wollte – und was er sein wollte, war Tom Savini, nur in Wortform.
Man bekommt das Leben, das einem zugeteilt wird, und wenn man vorhat zu schreiben, dann ist das die Tinte, mit der man arbeiten muss. Es ist die einzige Tinte, die man bekommt. Und meine war nun einmal sehr rot.
Als ich mir schließlich selber erlaubte, gruselige Geschichten des Übernatürlichen zu verfassen, verschwanden alle meine Probleme praktisch über Nacht, und bevor man noch ›New York Times-Bestseller‹ sagen konnte, war ich auch schon … Hahahahahaha, guter Witz. Vor mir lagen noch immer Unmengen an Mist, die aus meiner Feder strömten. Weitere vier Romane haute ich raus, aus denen nie etwas Brauchbares wurde. Da war Paper Angels, eine drittklassige Cormac-McCarthy-Imitation. Da war der Jugendroman The Evil Kites of Dr. Lourdes (und ja, das ist ein großartiger Titel). Da war The Briars, ein wirrer, erfolgloser Versuch, einen Thriller im Stil von John D. MacDonald über zwei Amok laufende Teenager zu schreiben. Das Beste war noch ein tolkieneskes Ding namens The Fear Tree, an dem ich drei Jahre lang arbeitete und das ein internationaler Bestseller wurde – allerdings nur in meinen feuchten Träumen. Im wirklichen Leben wurde ich von jedem Verleger in New York abgelehnt und von jedem Verleger in London massakriert. Und als letzten Tritt in den Hintern wurde ich auch noch rundheraus von jedem Verleger in Kanada abgewiesen, was uns allen eine Lehre sein sollte: Ganz egal wie tief man fällt, es geht immer noch tiefer.
(Das meine ich nicht wirklich so, Kanada.)
Während ich einen katastrophalen Roman nach dem anderen produzierte, schrieb ich auch Kurzgeschichten, und während dieser Monate (und Jahre, argh!) des Schreibens ereigneten sich nach und nach ein paar gute Sachen. Eine Geschichte über die Freundschaft zwischen einem jugendlichen Straftäter und einem aufblasbaren Jungen landete in einer Anthologie über jüdischen magischen Realismus, und das, obwohl ich ein Goi war (dem Herausgeber war es egal). Eine Erzählung über einen Geist, der in einem Kleinstadtkino spukt, schaffte es in die High Plains Literary Review. Den meisten Leuten hätte das nicht viel bedeutet, aber für mich war eine Veröffentlichung in der High Plains Literary Review (Auflage ungefähr 1000 Exemplare) so, als würde ich einen Schokoriegel auspacken und eine goldene Eintrittskarte finden. Ein paar weitere gute Kurzgeschichten folgten. Ich schrieb eine über einen einsamen Teenagerjungen, der einen auf Kafka macht und sich in eine riesige Heuschrecke verwandelt – nur um dann festzustellen, dass er es bevorzugt, ein Mensch zu sein. Eine andere handelte von einem stillgelegten antiken Telefon, das hin und wieder klingelt, weil ein Toter anruft. Eine weitere erzählte von den Sorgen der Söhne des Abraham Van Helsing. Und so weiter. Ich gewann ein paar kleinere Literaturpreise und landete in einer Best-of-Sammlung. Ein Talentscout bei Marvel Comics las eine meiner Geschichten und gab mir die Gelegenheit, meine eigene elfseitige Spiderman-Geschichte zu schreiben.
Das war nicht viel, aber Sie wissen ja, was man sagt: Allzu viel ist ungesund. Irgendwann im Jahr 2004, nicht lange nachdem mir klar geworden war, dass The Fear Tree eine Sackgasse war, akzeptierte ich die Tatsache, dass ich nicht das Zeug zum Romanautor hatte. Ich hatte mein Bestes gegeben, hatte es versucht und war gescheitert. Das war okay. Mehr als okay. Ich hatte eine Geschichte für Spiderman geschrieben, und selbst wenn ich nie herausfinden würde, wie man einen guten Roman schreibt, so hatte ich zumindest gelernt, eine brauchbare Kurzgeschichte zu komponieren. Ich würde mich nie mit meinem Dad messen können, aber das war mir von Anfang an klar gewesen. Und nur weil ich nicht das Zeug zu einem Roman hatte, hieß das noch lange nicht, dass ich mir nicht einen Job in der Welt der Comics suchen konnte. Einige meiner Lieblingsgeschichten waren Comics.
Ich hatte genug Kurzgeschichten für einen Sammelband, ungefähr ein Dutzend, also beschloss ich, sie rauszuschicken und zu sehen, ob es jemand damit versuchen wollte. Ich war nicht überrascht, dass sie von den größeren Verlagen abgelehnt wurden, die aus nachvollziehbaren kommerziellen Gründen Romane gegenüber Kurzgeschichtensammlungen bevorzugten. Also versuchte ich es bei kleineren Verlagen, und im Dezember 2004 erhielt ich einen Anruf von Peter Crowther, dem distinguierten Gentleman hinter PS Publishing, einem sehr kleinen Imprintverlag im Osten Englands. Peter schrieb selber Gruselgeschichten und war besonders von meiner Geschichte Pop Art angetan, der über den aufblasbaren Jungen. Er bot an, eine kleine Auflage des Buches zu drucken, unter dem Titel 20th Century Ghosts (dt.: Black Box), und tat mir damit einen Gefallen, den ich ihm nie entgelten kann. Aber andererseits hat Pete – genau wie einige andere Leute in der Kleinverlagwelt wie Richard Chizmar und Bill Schafer – schon vielen Autoren einen solchen Gefallen getan, indem er Sachen von ihnen veröffentlichte, nicht weil er damit reich zu werden hoffte, sondern weil sie ihm gefielen. (Ähem, das ist jetzt Ihr Stichwort, die Websites von PS Publishing, Cemetery Dance Publications und Subterranean Press zu besuchen und Ihren Beitrag zur Unterstützung aufstrebender Autoren zu leisten, indem Sie eines ihrer Werke bestellen. Nur zu, es wird Ihrem Bücherregal ganz bestimmt guttun.)
Pete bat mich, einige weitere Kurzgeschichten für das Buch zu schreiben, damit auch etwas ›Exklusives‹, also bisher unveröffentlichtes Material dabei war. Ich sagte okay und schrieb eine über einen Typen, der einen Geist übers Internet bestellt. Irgendwie ging die Geschichte mit mir durch, und 335 Seiten später entdeckte ich, dass ich doch das Zeug zu einem Roman hatte. Ich nannte ihn Heart-Shaped Box (dt.: Blind).
Mann, das Ding liest sich wie ein Stephen-King-Roman. Aber ich habe ihn mir ehrlich erarbeitet.
Ich war schon immer ein Spätzünder, und dieses erste Buch, 20th Century Ghosts, erschien, als ich 33 war. Jetzt bin ich 46 und ich werde 47 sein, bis das vorliegende Buch veröffentlicht wird. Die Tage rasen mit Vollgas an einem vorbei und lassen einen atemlos zurück.
Als ich anfing, hatte ich Angst, die Leute würden wissen, dass ich Stephen Kings Sohn bin, also setzte ich eine Maske auf und tat so, als wäre ich jemand anders. Aber die Geschichten haben immer die Wahrheit erzählt, die wahre Wahrheit. Ich glaube, gute Geschichten tun das immer. Die Geschichten, die ich geschrieben habe, sind alle das unausweichliche Produkt ihrer kreativen DNA: Bradbury und Block, Savini und Spielberg, Romero und Fango, Stan Lee und C. S. Lewis und allen voran Tabitha und Stephen King.
Der unglückliche Schöpfer findet sich im Schatten anderer, größerer Künstler wieder und ärgert sich darüber. Aber wenn man Glück hat – und wie ich bereits sagte, hatte ich mehr als meinen fairen Anteil an Glück und hoffe bei Gott, dass es noch eine Weile anhält –, dann sind diese anderen, größeren Künstler ein Licht, das einem hilft, seinen Weg zu finden.
Und wer weiß? Vielleicht hat man eines Tages sogar das Riesenglück, an der Seite eines seiner Helden arbeiten zu dürfen. Ich hatte die Chance, ein paar Geschichten mit meinem Vater zusammen schreiben zu können, und ergriff sie. Es hat unglaublichen Spaß gemacht. Ich hoffe, sie gefallen Ihnen – sie sind in diesem Buch.
Ich musste einige Jahre lang eine Maske tragen, aber jetzt, da ich sie abgelegt habe, kann ich freier atmen.
Aber das waren jetzt erst einmal genug Worte von mir. Wir haben einen wilden Ritt vor uns. Also dann – auf geht’s!
Bring on the bad guys – her mit den Bösewichtern!
Joe Hill
Exeter, New Hampshire
September 2018
VOLLGAS
MIT STEPHEN KING
Nach dem Massaker fuhren sie nach Westen durch die Painted Desert und machten keine Pause, bis sie 100 Meilen entfernt waren. Schließlich, am frühen Nachmittag, hielten sie an einem Diner mit weißer Stuckfassade und Zapfsäulen auf kleinen Betoninseln. Das satte Donnern ihrer Motoren ließ die Fensterscheiben erzittern. An der Westseite des Gebäudes rollten sie auf einen freien Platz zwischen Lkws und Sattelzügen, klappten ihre Seitenständer herunter und schalteten die Motoren ihrer Bikes aus.
Race Adamson war die ganze Zeit vorausgefahren, teilweise hatte seine Harley eine Viertelmeile Vorsprung gehabt. Diese Unsitte hatte er sich angewöhnt, seit er nach zwei Jahren in der Wüste zu ihnen zurückgekehrt war. Oft fuhr er so weit voraus, dass es den Anschein hatte, als wollte er die anderen zu einem Rennen herausfordern oder als wollte er nichts mit ihnen zu tun haben. Race hatte hier nicht halten wollen, aber Vince hatte ihn gezwungen. Als der Diner in Sicht kam, gab Vince Gas, fuhr an Race vorbei und hob die linke Hand, eine Geste, die der Tribe nur zu gut kannte: Folgt mir vom Highway herunter. Der Tribe war Vince’ Signal gefolgt, so wie immer. Wahrscheinlich eine weitere Sache, die Race an ihm nicht leiden konnte. Davon gab es einige.
Race war einer der Ersten, die auf dem Parkplatz hielten, aber der Letzte, der abstieg. Breitbeinig stand er über seinem Bike, zog langsam die ledernen Motorradhandschuhe aus und funkelte die anderen hinter seiner verspiegelten Sonnenbrille an.
»Du solltest mal ein Wörtchen mit deinem Jungen reden«, meinte Lemmy Chapman zu Vince, mit einer Kopfbewegung in Race’ Richtung.
»Nicht hier«, erwiderte Vince. Das konnte warten, bis sie wieder in Vegas waren. Er wollte die Straße hinter sich bringen. Er wollte sich eine Weile im Dunkeln hinlegen, wollte etwas Zeit vergehen lassen, damit der ekelhafte Knoten in seinem Magen sich auflösen konnte. Und was er vielleicht am meisten wollte, war duschen. Er hatte kein Blut abbekommen, fühlte sich aber trotzdem kontaminiert und würde sich so lange nicht in seiner Haut wohlfühlen, bis er den Gestank dieses Morgens abgewaschen hatte.
Er ging einen Schritt in Richtung Restaurant, aber Lemmy packte seinen Arm, bevor er weitergehen konnte. »Doch. Hier.«
Vince schaute auf die Hand auf seinem Arm – Lemmy ließ nicht los; Lemmy war von den Männern der Einzige, der keine Angst vor ihm hatte –, dann wanderte sein Blick zu dem Jungen, der eigentlich kein Junge mehr war, schon seit Jahren nicht mehr. Race klappte das Topcase über seinem Hinterrad auf und wühlte nach irgendwas.
»Was gibt es da noch zu reden? Clarke ist Geschichte. Genau wie die Kohle. Es gibt nichts mehr zu tun.«
»Du solltest rausfinden, ob Race genauso denkt. Du gehst immer davon aus, dass ihr auf der gleichen Wellenlänge seid, aber in letzter Zeit ist er fast ständig sauer auf dich. Und ich will dir noch was sagen, Boss. Race hat einige von diesen Jungs angeschleppt, und die meisten hat er scharfgemacht mit seinem Gerede, wie reich sie alle durch seinen Deal mit Clarke werden. Bestimmt ist er nicht der Einzige, der eine klare Ansage gebrauchen könnte, wie es jetzt weitergeht.« Er warf einen vielsagenden Blick zu den anderen Männern. Vince merkte erst jetzt, dass sie gar nicht zum Restaurant gingen, sondern bei ihren Motorrädern herumlungerten und ihm und Race immer wieder Blicke zuwarfen. Offenbar warteten sie darauf, dass irgendwas passierte.
Vince wollte nicht reden. Schon der Gedanke daran machte ihn müde. In letzter Zeit waren Unterhaltungen mit Race so, als würde man einen Medizinball hin und her werfen, sehr erschöpfend und auslaugend, und dem fühlte er sich im Moment nicht gewachsen, nicht nach dem, was sie hinter sich gelassen hatten.
Er machte es trotzdem, weil Lemmy fast immer recht hatte, wenn es um den Erhalt des Tribes ging. Lemmy hielt Vince den Rücken frei, seit sie sich im Mekongdelta kennengelernt hatten und die ganze Welt dinky dau war. Damals hatten sie nach Stolperdrähten und Tretminen Ausschau gehalten. In den fast 40 Jahren seither hatte sich nicht viel geändert.
Vince stieg von seinem Motorrad und ging zu Race, der zwischen seiner Harley und einem parkenden Truck stand, einem Tanklastzug. Race hatte gefunden, wonach er in seinem Topcase gesucht hatte, eine flache Flasche, in der etwas gluckerte wie Tee, aber keiner war. Er fing jeden Tag früher mit dem Trinken an, noch etwas, das Vince ganz und gar nicht gefiel. Race nahm einen Schluck, wischte sich den Mund ab und hielt Vince den Flachmann hin. Vince schüttelte den Kopf.
»Sag mir, was los ist«, meinte er.
»Wenn wir die Route 6 nehmen«, sagte Race, »können wir in drei Stunden unten in Show Low sein. Vorausgesetzt dein alberner Reiskocher kann mithalten.«
»Was gibt es in Show Low?«
»Clarkes Schwester.«
»Und warum sollten wir die sehen wollen?«
»Wegen der Kohle. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist: Uns sind gerade 60 Riesen durch die Lappen gegangen.«
»Und du glaubst, dass seine Schwester das Geld hat.«
»Irgendwo müssen wir anfangen.«
»Lass uns drüber reden, wenn wir wieder in Vegas sind. Dann überlegen wir, was wir für Optionen haben.«
»Und warum nicht jetzt? Hast du gesehen, wie Clarke das Telefon aufgelegt hat, als wir reinkamen? Ich konnte ein bisschen von dem, was er gesagt hat, durch die Tür hören. Ich glaube, er hat versucht, seine Schwester anzurufen, aber als er sie nicht erreicht hat, hat er bei einem Bekannten von ihr eine Nachricht hinterlassen. Na, und was glaubst du, warum er den plötzlichen Drang verspürt hat, diese kleine Mistratte anzurufen, als er uns in seiner Auffahrt aufkreuzen sah?«
Um sich zu verabschieden, vermutete Vince, aber er sagte es nicht. »Das hat nichts mit der ganzen Sache zu tun, oder? Was macht sie denn? Macht sie auch Crank?«
»Nein. Sie ist ’ne Nutte.«
»Gott, was für eine Familie.«
»Das sagt der Richtige«, meinte Race.
»Was soll das denn heißen?«, fragte Vince. Es war nicht so sehr die Bemerkung mit ihrer implizierten Beleidigung, die ihn ärgerte, sondern Race’ verspiegelte Sonnenbrille, die ihm ein Spiegelbild von sich selbst zeigte, sonnenverbrannt und mit komplett grauem Bart, das Bild eines runzligen, faltigen alten Mannes.
Race blickte wieder die hitzeflirrende Straße hinunter, und als er sprach, antwortete er nicht auf die Frage. »60 Riesen lösen sich in Rauch auf und du tust so, als wäre nichts.«
»Das tue ich nicht. Aber es ist nun mal passiert. Alles ist in Rauch aufgegangen.«
Race und Dean Clarke hatten sich in Falludscha kennengelernt – vielleicht war es auch Tikrit gewesen. Clarke hatte als Sanitäter gedient und sich auf Schmerzlinderung spezialisiert, seine bevorzugte Behandlungsmethode war erstklassiges Dope gewesen, begleitet von einer großzügigen Dosis Wyclef Jean. Race’ Spezialität war es gewesen, Humvees zu fahren und sich nicht erschießen zu lassen. Auch zurück in der Zivilisation waren die beiden Freunde geblieben, und vor einem halben Jahr war Clarke mit der Idee an Race herangetreten, in Smith Lake ein Meth-Labor aufzubauen. Er schätzte, dass 60 Riesen für einen guten Start ausreichen würden und er in null Komma nichts mehr als diese Summe pro Monat herausholen könnte.
»Echtes Glass«, war Clarkes Hauptargument gewesen. »Nichts von diesem billigen grünen Scheiß, nur echtes Glass.« Dann hatte er die Hand bis über seinen Kopf gehoben, um einen Monsterstapel Banknoten anzudeuten. »Der Himmel ist das Limit, yo?«
Yo. In dem Moment, als das aus Clarkes Mund kam, hätte Vince sofort die ganze Sache abblasen sollen. Auf der Stelle.
Aber er hatte es nicht getan. Er hatte Race sogar mit 20 Riesen von seinem eigenen Geld ausgeholfen, trotz aller Zweifel. Clarke sah wie ein Gammler aus und hatte eine vage Ähnlichkeit mit Kurt Cobain: lange blonde Haare und Schlabberklamotten. Er sagte yo, sprach jeden mit hey, man an, faselte davon, dass Drogen die repressive Macht des Overmind durchbrechen konnten, was immer das bedeuten sollte. Er überraschte und erfreute Race mit intellektuellen Geschenken: Theaterstücke von Sartre, Mixkassetten mit Gedichtlesungen und Dub-Reggae.
Vince nahm es Clarke nicht übel, dass er ein Pseudointellektueller voll mit spirituellem Revolutionsgequatsche war, das er in einer bescheuerten Mischsprache von sich gab, halb Tuntengetue und halb Black English. Was Vince beunruhigte, war, dass Clarke, als sie sich zum ersten Mal begegneten, schon einen übel stinkenden Meth-Mund hatte, mit ausfallenden Zähnen und fleckigem Gaumen. Vince hatte kein Problem damit, Geld mit dem Dreck zu verdienen, aber er hegte ein tief sitzendes Misstrauen gegen jeden, der kaputt genug war, es sich selber reinzuziehen.
Und doch hatte er Geld zugeschossen, hatte Race gewünscht, dass einmal etwas klappte, vor allem nach der Art und Weise, wie er aus der Army geflogen war. Und für eine Weile, während Race und Clarke die Einzelheiten ausarbeiteten, hatte Vince sich sogar halb selbst einreden können, dass die Sache sich vielleicht lohnen würde. Für kurze Zeit strahlte Race eine beinahe übermütige Selbstsicherheit aus, kaufte sogar ein Auto für seine Freundin, einen gebrauchten Mustang, in Erwartung fetter Rendite auf seine Investition.
Nur leider brach im Meth-Labor ein Feuer aus, yo? Und das ganze Ding brannte innerhalb von zehn Minuten komplett aus, gleich am ersten Betriebstag. Die Illegalen, die in dem Gebäude gearbeitet hatten, konnten durchs Fenster fliehen und standen noch draußen herum, angekokelt und rußverschmiert, als die Feuerwehr kam. Jetzt hockten die meisten von ihnen in irgendeinem Countyknast.
Race hatte nicht durch Clarke von dem Feuer erfahren, sondern von Bobby Stone, einem weiteren Freund aus dem Irak, der nach Smith Lake gefahren war, um für zehn Riesen von dem legendären echten Glass zu kaufen, aber umdrehte, als er den Qualm und die blinkenden Lichter sah. Race hatte versucht, Clarke anzurufen, konnte ihn aber nicht erreichen, nicht an dem Nachmittag und auch nicht am Abend. Um elf war der Tribe auf dem Highway gewesen und auf dem Weg nach Osten, um ihn zu suchen.
Sie hatten Dean Clarke in seiner Hütte in den Bergen erwischt, als er gerade dabei war, seine Sachen zu packen. Clarke beteuerte, er habe gerade aufbrechen wollen, um zu Race zu fahren und ihm zu sagen, was passiert war, und um einen neuen Plan auszuarbeiten. Er sagte, er werde alles zurückzahlen. Er sagte, die Kohle sei jetzt zwar weg, aber es gebe Möglichkeiten, es gebe Notfallpläne. Er sagte, es tue ihm so gottverdammt leid. Einiges davon war gelogen und einiges mochte stimmen, vor allem der Teil mit dem Leidtun, aber nichts davon überraschte Vince, nicht einmal als Clarke anfing zu weinen.
Was ihn jedoch überraschte – was sie alle überraschte –, war Clarkes Freundin, die sich im Badezimmer versteckt hatte, bekleidet nur mit einem geblümten Slip und einem Sweatshirt mit der Aufschrift CORMAN SCHULAUSWAHL. 17 Jahre alt, himmelhoch auf Meth und eine kleine 22er in der Hand. Sie hörte mit, wie Roy Klowes Clarke fragte, ob sie hier sei, wie er sagte, wenn Clarkes Schnecke ihnen allen einen blasen würde, dann könne er gleich hier 200 Mücken von seinen Schulden abziehen. Dann ging Roy Klowes ins Badezimmer und holte seinen Schwanz raus, um zu pinkeln, aber das Mädchen dachte, er hätte ihn zu anderen Zwecken rausgeholt, und drückte ab.
Der erste Schuss ging weit daneben und der zweite in die Decke, denn da massakrierte Roy sie bereits mit seiner Machete und alles stürzte in einen blutigen Strudel, fort von der Realität in das Gefilde böser Träume.
»Sicher wird er einiges von dem Geld verloren haben«, sagte Race jetzt. »Kann sein, dass gut die Hälfte von dem, was wir ihm gegeben haben, draufgegangen ist. Aber wenn du glaubst, dass Dean Clarke die ganzen 60 Riesen auf dieses eine Pferd gesetzt hat, dann kann ich dir auch nicht helfen.«
»Vielleicht hat er was davon beiseitegelegt. Ich sag ja nicht, dass du dich irrst. Aber wieso sollte es ausgerechnet bei seiner Schwester gelandet sein? Könnte genauso gut in einem Einweckglas stecken, irgendwo hinter seinem Haus verbuddelt. Ich werde nicht einfach so einer armseligen Nutte die Fresse polieren. Wenn wir erfahren, dass sie plötzlich zu Geld gekommen ist, ist das schon was anderes.«
»Es hat sechs Monate gedauert, diesen Deal einzufädeln. Und ich bin nicht der Einzige, der eine Menge reingesteckt hat.«
»Okay. Reden wir in Vegas darüber, wie wir die Sache wieder hinbiegen.«
»Mit Reden werden wir gar nichts hinbiegen. Wir müssen hinfahren. Jetzt ist seine Schwester noch in Slow Low, aber wenn sie rauskriegt, dass ihr Bruder und sein kleines Schätzchen nur noch blutiger Matsch sind …«
»Du solltest leiser reden«, sagte Vince.
Lemmy stand mit verschränkten Armen ein paar Schritte links von Vince und beobachtete ihn und Race, jederzeit bereit einzuschreiten, falls es notwendig werden sollte. Die anderen standen in Zweier- und Dreiergruppen herum, unrasiert und staubig von der Fahrt. Sie trugen Lederjacken oder Jeanswesten mit dem Patch der Gang auf dem Rücken: ein Totenschädel mit indianischem Kopfschmuck, darunter der Schriftzug THE TRIBE – LIVE ON THE ROAD, DIE ON THE ROAD. Sie waren schon immer der Tribe gewesen, obwohl keiner von ihnen indianischer Abstammung war, mit Ausnahme von Peaches, der behauptete, ein halber Cherokee zu sein, wenn er nicht gerade behauptete, er wäre halber Spanier oder halber Inka. Doc meinte, er könnte auch halber Eskimo oder halber Wikinger sein – in der Summe würde er immer ein kompletter Vollidiot bleiben.
»Die Kohle ist weg«, sagte Vince zu seinem Sohn. »Genau wie die sechs Monate. Sieh es ein!«
Sein Sohn stand da mit verkniffenem Gesicht und sagte nichts. Die Knöchel seiner rechten Hand, die den Flachmann umfasst hielt, traten weiß hervor. Als Vince ihn jetzt ansah, hatte er plötzlich ein Bild von Race mit sechs Jahren vor Augen, das Gesicht genauso staubig wie jetzt, wie er mit seinem grünen Big Wheel die Schottereinfahrt rauf- und runtergerast war und Motorengeräusche imitiert hatte. Vince und Mary hatten herzhaft gelacht, hauptsächlich über den Ausdruck konzentrierter Entschlossenheit im Gesicht ihres Sohnes, des Kindergarten-Roadwarriors. Jetzt weckte der Gedanke daran keinerlei Humor in ihm, nicht zwei Stunden nachdem Race einem Menschen mit einer Schaufel den Schädel gespalten hatte. Race hatte schon immer ein gutes Reaktionsvermögen gehabt, und so war er es gewesen, der Clarke als Erster einholte, als dieser im Chaos nach den Schüssen im Badezimmer zu fliehen versucht hatte. Vielleicht hatte er gar nicht vorgehabt, ihn zu töten. Race hatte ihm nur einen einzigen Schlag verpasst.
Vince öffnete den Mund, aber es gab nichts mehr zu sagen. Er drehte sich um und ging auf den Diner zu. Aber er hatte noch keine drei Schritte gemacht, als er hinter sich eine Flasche zerplatzen hörte. Er drehte sich um und sah, dass Race den Flachmann an die Seite des Tanklasters geworfen hatte, genau an die Stelle, an der Vince noch vor fünf Sekunden gestanden hatte. Vielleicht hatte er sie nach Vince’ Schatten geworfen.
Whiskey und Glassplitter tropften von dem verbeulten Tankauflieger herunter. Vince schaute an der Seite des Trucks hoch und zuckte unwillkürlich zusammen. Ein Wort war auf die Seite schabloniert, und für einen Augenblick glaubte Vince, dass es SLAUGHTERIN lautete. Aber nein, es war LAUGHLIN.
Was Vince über Freud wusste, ließ sich in weniger als 20 Worten zusammenfassen – gepflegter weißer Kinnbart, Zigarre, war überzeugt, dass Kinder gern ihre Eltern ficken wollten –, aber man brauchte nicht viel Psychologie, um zu erkennen, dass hier ein unterbewusstes schlechtes Gewissen am Werk war. Vince hätte gelacht, wäre sein Blick nicht noch auf etwas anderes gefallen.
Der Trucker saß im Führerhaus. Seine Hand hing aus dem Seitenfenster, eine glimmende Zigarette zwischen zwei Fingern. Auf halber Höhe des Unterarms hatte er ein verblasstes Tattoo, DEATH BEFORE DISHONOR, was ihn als Kriegsveteranen auswies, eine Tatsache, die Vince geistesabwesend registrierte und sofort zu den Akten legte, vielleicht um später darüber nachzudenken, vielleicht auch nicht. Er versuchte sich zu erinnern, was der Mann mitgehört haben könnte, versuchte die Gefahr abzuwägen, zu entscheiden, ob die dringende Notwendigkeit bestand, Laughlin aus seinem Truck zu zerren und ein paar Dinge klarzustellen.
Vince dachte noch immer darüber nach, als der Sattelzug laut und stinkend zum Leben erwachte. Laughlin schnippte seinen Zigarettenstummel auf den Parkplatz und löste die Druckluftbremsen. Die Auspuffschornsteine rülpsten schwarzen Dieselqualm aus und knirschend rollte der Lkw auf dem Schotter an. Als der Tanklastzug vom Parkplatz fuhr, ließ Vince langsam den angehaltenen Atem ausströmen und spürte, wie die Anspannung verflog. Er bezweifelte, dass der Kerl überhaupt etwas gehört hatte, und was spielte es schon für eine Rolle? Niemand, der auch nur halbwegs bei Verstand war, würde sich in diesen Schlamassel hineinziehen lassen. Wahrscheinlich hatte Laughlin gemerkt, dass man ihn beim Lauschen ertappt hatte, und sich lieber aus dem Staub gemacht, bevor er Ärger bekam.
Als der Sattelzug auf den zweispurigen Highway bog, hatte Vince sich längst abgewandt und marschierte durch seine Leute hindurch auf den Diner zu. Es dauerte fast eine Stunde, bis er den Truck wiedersah.
Vince ging pinkeln – seine Blase folterte ihn schon seit 30 Meilen –, und auf dem Rückweg kam er an den anderen vorbei, die sich auf zwei Tische verteilt hatten. Sie waren still, machten kaum ein Geräusch bis auf das Kratzen von Gabeln auf Tellern und das Klirren von Gläsern, die abgestellt wurden. Nur Peaches redete, und zwar mit sich selbst. Peaches flüsterte vor sich hin und zuckte gelegentlich zusammen, als wäre er umgeben von einer Wolke unsichtbarer Mücken – ein trauriger und verstörender Tic. Die anderen hatten sich in ihre eigenen kleinen Welten zurückgezogen, sie sahen einander nicht an, sondern starrten nur innerlich auf Weiß-der-Teufel-was. Einige sahen wahrscheinlich das Badezimmer vor sich, nachdem Roy Klowes das Mädchen in Stücke gehackt hatte. Andere erinnerten sich vermutlich an den Anblick von Clarke, mit dem Gesicht nach unten vor der Hintertür, den Hintern in die Luft gereckt, die Hose vollgeschissen, in seinem Schädel das Metallblatt der Schaufel, deren Stiel hoch in die Luft ragte. Und dann gab es wahrscheinlich auch ein paar, die überlegten, ob sie rechtzeitig zu American Gladiators zu Hause sein würden und ob die Lotterielose, die sie gekauft hatten, Gewinnlose waren.
Auf dem Hinweg zu Clarke war es anders gewesen. Besser. Der Tribe hatte gleich nach Sonnenaufgang an einem Diner wie diesem gehalten, und auch wenn die Stimmung nicht direkt fröhlich gewesen war, hatte es doch eine Menge Geflachse und das übliche vorhersehbare Naserümpfen über den Kaffee und die Donuts gegeben. Doc hatte an einem Tisch gesessen und das Kreuzworträtsel gelöst, während andere um ihn herumhockten, über seine Schulter schauten und sich gegenseitig damit aufzogen, was für eine Ehre es doch war, einen Mann von solcher Bildung zu kennen.
Doc war im Knast gewesen, genau wie die meisten von ihnen, und er hatte einen Goldzahn anstelle des Zahnes, der ihm vor ein paar Jahren vom Gummiknüppel eines Cops ausgeschlagen worden war. Aber er trug eine Bifokalbrille und hatte ein hageres, fast schon aristokratisches Gesicht, und er las Zeitung und wusste deshalb Dinge wie die Hauptstadt von Kenia oder die verfeindeten Parteien in den Rosenkriegen.
Roy Klowes warf einen Seitenblick auf Docs Rätsel und meinte: »Was ich brauche, ist ein Kreuzworträtsel mit Fragen zum Motorradreparieren und zum Vögeln. So was wie: Was ich mit deiner Mama mache mit sechs Buchstaben, Doc. Das könnte ich beantworten.«
Doc runzelte die Stirn. »Ich würde ja sagen ›auf den Keks gehen‹, aber das ist zu lang. Also würde meine Antwort wohl ›nerven‹ lauten.«
»Nerven?«, fragte Roy und kratzte sich den Kopf.
»Genau. Du nervst sie. Bedeutet: Du tauchst auf, und sie muss spucken.«
»Yeah, und genau das ist es, was mir bei ihr auf den Sack geht. Denn ich versuch schon die ganze Zeit, sie dazu zu bringen, dass sie schluckt, während ich sie nach Strich und Faden nerve.«
Und die Männer um sie herum fielen vor Lachen fast von den Stühlen. Fast genauso laut lachten sie am Nebentisch, wo Peaches zu erklären versuchte, warum er sich die Samenleiter hatte kappen lassen. »Was mich überzeugt hat, war, als ich kapierte, dass ich nur ’n einziges Mal für ’ne Vasektomie zahlen muss – was man von ’ner Abtreibung ja nicht sagen kann. Da gibt’s theoretisch kein Limit. Keins. Jeder Wichstropfen ist ’n potenzielles Balg, das dir auf der Tasche liegt. Das wird einem gar nicht klar, bis man ’n paarmal für ’ne Ausschabung bezahlt hat und zu überlegen anfängt, ob man nicht was Besseres mit seinem Geld anfangen kann. Und Beziehungen sind auch irgendwie nicht mehr das Gleiche, wenn man erst mal Junior die Toilette runtergespült hat. Ist echt nicht mehr das Gleiche. Glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung.« Peaches brauchte keine Witze zu erzählen. Er war witzig genug, wenn er nur sagte, was ihm durch den Kopf ging.
Jetzt ging Vince an dem desolaten rotäugigen Haufen vorbei und setzte sich neben Lemmy an den Tresen.
»Was meinst du, was wir wegen dieser Scheiße machen sollen, wenn wir in Vegas sind?«, fragte Vince.
»Abhauen«, antwortete Lemmy. »Niemandem sagen, wohin wir gehen. Nie wieder zurückkehren.«
Vince lachte. Lemmy nicht. Er hob die Kaffeetasse bis kurz vor seine Lippen, trank aber nicht, sondern blickte nur ein paar Sekunden auf die Tasse und stellte sie wieder ab.
»Irgendwas nicht in Ordnung damit?«, fragte Vince.
»Ist nicht der Kaffee.«
»Du willst mir doch nicht sagen, dass du es ernst meinst mit dem Abhauen, oder?«
»Wir wären nicht die Einzigen, Kumpel«, erwiderte Lemmy. »Was Roy da im Badezimmer mit dem Mädchen gemacht hat …«
»Sie hätte ihn fast erschossen«, sagte Vince so leise, dass niemand sonst es hören konnte.
»Sie war erst 17.«
Vince gab keine Antwort, aber Lemmy erwartete auch keine.
»Die meisten von den Jungs«, fuhr Lemmy fort, »haben noch nie so was Krasses gesehen, und ich glaube, einige von ihnen – die klügeren – werden sich in alle vier Winde zerstreuen, sobald sie die Gelegenheit haben. Um nach einem neuen Lebensinhalt zu suchen.« Wieder lachte Vince, aber Lemmy warf ihm nur einen Seitenblick zu. »Hör zu, Cap. Mit 18 habe ich meinen Bruder umgebracht, als ich stinkbesoffen Auto gefahren bin. Als ich wieder zu mir kam, konnte ich sein Blut an meinem ganzen Körper riechen. Bei der Army hab ich versucht, mich umzubringen, um es wiedergutzumachen, aber die Burschen in den schwarzen Pyjamas wollten mir einfach nicht dabei helfen. Und das, woran ich mich aus dem Krieg am besten erinnere, ist, wie meine Füße stanken, als sie Dschungelfäule bekamen. Als würde ich in meinen Stiefeln ein Klo mit mir herumschleppen. Ich war im Knast, genau wie du, und das Schlimmste waren nicht die Dinge, die ich getan oder erlebt habe. Das Schlimmste war der Gestank der Leute: Achselhöhlen und Arschlöcher. Das war echt übel. Aber nichts davon war auch nur halb so übel wie die Charlie-Manson-Scheiße, die hinter uns liegt. Was ich einfach nicht loswerde, ist, wie es da gestunken hat. Nachdem es vorbei war. Als würde man in einer Kloschüssel feststecken, in die gerade jemand reinscheißt. Nicht genug Luft, und das bisschen Luft, das da ist, ist nicht gut.«
Er schwieg für einen Moment und drehte sich auf seinem Hocker zu Vince um. »Weißt du, woran ich die ganze Zeit denke, seit wir da weggefahren sind? Lon Refus ist aus Denver weggezogen und hat eine Werkstatt eröffnet. Er hat mir eine Postkarte von den Flatirons geschickt. Ich frage mich, ob er wohl einen alten Kerl wie mich als Schrauber gebrauchen kann. Ich denke, ich könnte mich an den Geruch von Kiefernwäldern gewöhnen.«
Wieder schwieg er, dann wandte er den Blick den anderen Männern an den Tischen zu. »Die Hälfte, die sich nicht aus dem Staub macht, wird versuchen, das zurückzukriegen, was sie verloren hat, auf die eine oder andere Weise – und damit willst du ganz sicher nichts zu tun haben. Denn es wird nur noch mehr von dieser abgedrehten Meth-Scheiße sein. Das hier ist erst der Anfang – die Mautstelle, an der man auf die Schnellstraße fährt. Es steckt zu viel Geld drin, um damit aufzuhören, und jeder, der das Zeug verkauft, nimmt es auch selber, und wer es nimmt, hat nur noch Scheiße im Kopf. Das Mädchen, das versucht hat, Roy zu erschießen, war auf Meth, was der Grund dafür war, warum sie ihn zu töten versucht hat, und Roy selber ist auch auf Meth, was der Grund ist, weshalb er 40 verfickte Male mit seiner Machete auf sie eingeschlagen hat. Mann, wer außer einem verfickten Methhead schleppt eine gottverdammte Machete mit sich herum?«
»Hör mir auf mit Roy! Am liebsten würde ich ihm Little Boy in den Arsch rammen und dabei zusehen, wie ihm das Licht aus den Augen schießt.« Jetzt war es an Lemmy zu lachen. Sich kranke Verwendungsmöglichkeiten für Little Boy auszudenken, war einer der Running Gags zwischen den beiden. Vince fuhr fort: »Komm schon – sag, was du zu sagen hast. Du denkst doch schon die ganze letzte Stunde darüber nach.«
»Woher willst du das wissen?«
»Glaubst du, ich weiß nicht, was es zu bedeuten hat, wenn ich dich stocksteif auf deinem Bock sitzen sehe?«