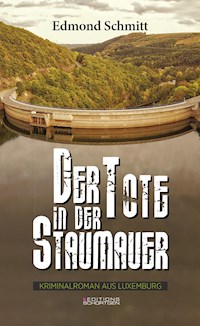Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Schortgen SARL
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Ösling der Nachkriegszeit wächst die junge Maisy im liebevollen Familienkokon auf und ihr Lebensweg als Bäuerin scheint vorgezeichnet. Doch ein brutaler Schicksalsschlag trifft sie mit voller Härte, nichts wird wieder so sein wie vorher? Mit diesem Roman, seinem 7. Werk, liegt erneut ein spannendes und authentisches Werk des Erfolgsautors Edmond Schmitt vor. Mit seinem unverwechselbaren Stil, bestimmt durch seine Gabe für prägnante Charakterisierung auf historisch verbürgtem Hintergrund, zeichnet die wechselvolle Geschichte ein detailliertes Bild des alltäglichen Lebens jener Zeit, die der Autor selbst erlebt hat, und autobiografische Anekdoten fließen immer wieder in den Handlungslauf ein. In ?Tag der Entscheidung? vermischen sich Realität und Fantasie zu einem Roman von großer Intensität.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1
Juli 1949. Im Ösling waren die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges größtenteils beseitigt - der Wiederaufbau fast vollendet. Wohltuende Ruhe lag über der nördlichen hügeligen Landschaft des Landes, wo vor einem halben Jahrzehnt die desaströse Ardennen-Offensive, hierzulande Rundstedt-Offensive genannt, gewütet hatte, als tausende Menschen aus ihren Häusern flüchten mussten, Dörfer zerschossen und zehntausende Soldaten getötet, verletzt oder zu Krüppeln wurden.
Die meisten der zerschossenen Wohnorte sowie verstreut liegenden landwirtschaftlichen Gebäude waren inzwischen wieder aufgebaut - schöner und moderner als zuvor.
In einem der seltenen älteren Gehöfte, die ohne größere Schäden den Krieg überstanden hatten, und auf Sichtweite zur Ardennenmetropole Wiltz, wohnten und arbeiteten der Landwirt Tony Urbany mit seiner Frau Jeanny und mir, ihrer gemeinsamen Tochter Maisy.
Wir waren eine glückliche Familie, in der ich wohl behütet aufwuchs, umsorgt von meinen arbeitsamen Eltern, die mich in das bäuerliche Leben einführten.
Bereits mit acht Jahren holte ich täglich am Spätnachmittag eigenständig die Kühe von der Weide ab, und trieb sie andernmorgens noch vor Schulbeginn, wenn Mutter und Vater sie bereits gemolken hatten, wieder zurück. Ich fütterte die Hühner, sammelte die Eier ein, betätigte mich im Frühjahr beim Kartoffellegen und im Herbst beim Ausheben. Mit zehn Jahren half ich bereits bei der kräfteraubenden Heumaat und der Getreideernte.
Nach Meinung meiner Eltern war ich auf dem besten Weg eine gute Bäuerin zu werden und eines Tages für den Fortbestand unseres landwirtschaftlichen Betriebes zu sorgen. Da meine Mutter nach meiner Geburt an einer schweren Unterleibsentzündung erkrankte und die Gebärmutter entfernt werden musste, war nicht an eine Vergrößerung der Familie Urbany zu denken.
Nun war ich zwölf geworden. Es war die Zeit der großen Schulferien. Schon seit dem frühen Morgen strahlte die Sonne über die Öslinger Kuppen sowie in die engen Täler mit den zwischen Wiesen und Wäldern liegenden Dörfern und Gehöften.
Ein heißer Tag kündigte sich an.
Am Frühstückstisch hatte ich meiner nur ein paar Monate älteren Kusine Karin, die zum ersten Mal einen Teil der Ferien bei mir auf dem elterlichen Bauernhof verbrachte, vorgeschlagen zusammen nach Wiltz zu wandern.
Sommerlich gekleidet, einen breitkrempigen Strohhut auf dem Kopf, für jede eine Flasche Limonade und ein Picknick, das meine Mutter vorbereitet hatte, in unseren Rucksäcken, machten wir uns kurz nach zehn auf den rund anderthalbstündigen Fußmarsch.
Karin war hellauf begeistert von dem imposanten Wiltzer Schloss, dem ehemaligen feudalen Wohnsitz der früheren Grafen von Wiltz. Im großen Innenhof betrachtete sie staunend die verschiedenen Gebäude. Ich machte sie aufmerksam auf die einstigen Scheunen mit Stallungen und den Schlossbrunnen, dem früher das Wasser über Eichenholzrohre zugeführt wurde. Ich zeigte ihr das Haus des Amtmannes, sowie die ehemalige Schlosskapelle und an der Südfassade den halbkreisförmigen Turm, der früher als Pulverlager diente. Ich sagte ihr, dass bis vor kurzem im Schloss während einhundert Jahren ein Pensionat für Mädchen existiert hatte.
Für den Rückweg wählte ich eine Abkürzung, die ich schon öfters gegangen war und daher gut kannte. Außerdem war dieser Weg, der fast ausnahmslos über Feld und Flur führte, verkehrsmäßig ruhiger als die kurvenreiche asphaltierte Landstraße.
Unbeschwert gingen wir vorbei an alten knorrigen Lohhecken, deren Rinde bei der Produktion von Lederwaren in den Wiltzer Fabriken diente; wir schlenderten zwischen längst verblühten Ginstersträuchern und in voller Blüte stehenden Weißdornhecken vorbei, sahen vom Sturm gebrochene riesige Fichten und ausgerissene absterbende Wurzelteller, deren fader Modergeruch uns in die Nase stieg.
Währenddem wurde es immer heißer.
Unsere Limonadenflaschen waren inzwischen leer getrunken. Quälender Durst machte sich bemerkbar. Wir waren froh einen mächtigen Laubwald zu durchqueren, der willkommenen Schatten spendete und für etwas Abkühlung sorgte.
Wir hatten nur noch knappe zehn Minuten Fußmarsch zurückzulegen bis zu meinem elterlichen Hof, als sich vor uns, von der Anhöhe aus, ein weiter Blick in das langgedehnte Tal auftat.
Unweit grasten Kühe und Kälber friedlich neben Schafen und Ziegen. Gegenüber zog eine Mähmaschine mit lautem Motorentuckern in einer bereits zur Hälfte abgemähten Wiese ihre Bahnen.
An dem sich zuziehenden Himmel tauchten von Westen her grauschwarze Wolken auf.
„Sieh dort ganz rechts. Das ist unser Hof“, sagte ich zu Karin und zeigte auf ein entlang der Straße gelegenes langgestrecktes renoviertes Gebäude. „Und der Mann, der dort links geht, das ist mein Papa. Er geht jetzt in den Pferch und holt den Willy heim.“
„Wer ist Willy?“, fragte Karin.
„Willy, das ist unser Bulle, der da hinten allein in der doppelumzäunten Wiese steht. Willy ist eine Kreuzung zwischen einer schwarzen Limousin-Kuh und einem weißen Holstein-Stier. Diese Mischung ergibt hervorragende Zuchtbullen. Mein Vater ist weit und breit dafür bekannt, dass er stets einen kräftigen Stier dieser Gattung hält, der für widerstandsfähigen und gesunden Kälbernachwuchs sorgt. Deshalb kommt auch heute nachmittag der Milleschbauer mit einer seiner Kühen vorbei, um sie von Willy decken zu lassen. Jetzt führt mein Vater den Bullen heim in den Stall, wo die Paarung stattfinden wird.“
„Aber weshalb steht der Willy allein in einer doppelt umzäunten Wiese?“
“Weil Stiere der Holstein-Limousin-Rasse einen schlechten Charakter haben und gefährlich werden können. Es ist schon vorgekommen, dass ein Holsteiner seinen Meister angegriffen hat. Deshalb hält mein Vater seine Bullen auch nie länger als ein Jahr. Dann schafft er sie ab und kauft einen neuen.“
„Wenn das so riskant ist, weshalb hält er dann so ein gefährliches Tier?“
„Weil es Geld einbringt. Für jede von Willy gedeckte Kuh muss der Bauer bezahlen“, antwortete ich. „Lass uns jetzt hinunter gehen. Dann kannst du dir den Holsteiner aus der Nähe ansehen.“
Inzwischen hatte der Himmel sich zugezogen. Es wurde immer schwüler. Ein kräftiger Wind fegte.
Wir befanden uns nur noch etwa fünfzig Schritt vom Pferch, als wir sahen, wie mein Vater dem Bullen eine Handkette am eisernen Nasenring befestigte, um ihn nachhause in den Stall zu führen.
Im diesem Moment fuhr direkt über uns ein greller Blitz aus der dunklen Wolkendecke, begleitet von einem furchteinflößenden Donnerschlag.
Mit einer brüsken Kopfbewegung riss der aufgeschreckte Bulle seinem Meister die Kette aus der Hand, wich einen Schritt zurück, senkte den mächtigen Schädel, schnellte nach vorn und rammte meinem Vater, der nicht mehr rechtzeitig hatte ausweichen können, die kräftigen Hörner in die Brust.
Ein schriller Schmerzensschrei hallte aus dem Pferch.
Entsetzt sahen wir wie sich sein hellgraues Hemd mit Blut färbte. Torkelnd sackte er ins niedrige Gras. Mit wild um sich schlagenden Armen versuchte er das wütende Tier abzudrängen.
Doch anstatt von ihm abzulassen, setzte der massige Bulle den schweren rechten Vorderfuß auf den Unterleib des Verletzten, der herzzerreißende Schreie von sich gab.
„Papa! Papa!“, schrie ich so laut ich konnte, warf gleichzeitig meinen Rucksack ab und kroch unter dem Doppelzaun hindurch, um den wild gewordenen Stier von meinem Vater zu trennen.
„Nein Maisy! Bleib hier! Ich hole Hilfe!“, rief Karin und rannte los.
Die Blitze und das Donnern verzogen sich in Richtung Wiltz. Es begann kräftig zu regnen.
Mit bebender Stimme brüllte ich immer wieder den Bullen an, damit er von meinem am Boden liegenden verwundeten Vater loslasse, aus dessen Brust und Unterleib Blut tröpfelte, das neben ihm in den Erdboden einsickerte. Doch das plumpe Tier bewegte sich keinen Finger breit von der Stelle.
Tränenüberströmt und heftig winkend schrie ich dem Fahrer der Mähmaschine zu, der noch immer unaufhaltsam auf- und abfuhr. Aber er nahm mich nicht wahr und meine verzweifelten Hilferufe wurden vom Geräusch des Motors übertönt.
Da erblickte ich in der Nähe ein abgebrochenes Stück von einem Brett, das ich schnell ergriff. Das kantige Holz kampfbereit in beiden Händen haltend, rannte ich auf den rund vierhundert Kilo schweren Bullen zu. Aber so laut ich auch schrie und so fest ich auch auf ihn einschlug, das Tier starrte mich nur stur an, ließ aber nicht von meinem wimmernden Vater ab, der mich mit weitaufgerissenen und ängstlichen Augen ansah - dem ich aber nicht zu helfen vermochte.
In diesem Moment der absoluten Trostlosigkeit fuhr ein Geländewagen mit Vollgas heran. Vor dem Pferch hielt er brüsk an.
„Steig aus! Schnell!“, rief Patrick Reyter, der Fahrer, dessen Eltern ein Jagdhaus im Dorf besaßen.
Sofort sprang Karin ab. Patrick öffnete das schwere Gattertor, setzte sich wieder hinter das Steuer, drückte das Gaspedal bis unten durch und fuhr mit aufheulendem Motor schnurgerade auf den Bullen zu.
Da hob der Stier den Fuß, senkte den Kopf mit den mächtigen Hörnern und schnaubte mich furchterregend an.
Gerade als er zum Angriff auf mich ansetzte, krachte ein Schuss. Gleich darauf ein zweiter.
Der Bulle brüllte fürchterlich. Blut rann aus seinem Kopf.
Sofort lud Patrick sein Gewehr nach, hielt dem verwundeten Tier den Lauf seiner Waffe an die Stirn und schoss noch zweimal kurz hintereinander.
Mit einem Ruck schubste Patrick mich weg. Dann fasste er meinen Vater an den Schultern und zerrte auch ihn zur Seite.
Torkelnd ging der Bulle in die Knie. Schwerfällig plumpste er zu Boden. Ein nervöses Zucken ging durch den massigen Tierkörper. Dann erstarb alles Leben in ihm.
Schnell raffte ich mich auf, kroch zu meinem blutverschmierten Vater, der nur noch schwach röchelte.
„Papa!“, schluchzte ich, war mir jedoch nicht sicher, ob er mich überhaupt noch wahrnahm.
Blut quoll aus seinen Mundwinkeln. Aus den weit aufgerissenen glanzlosen Augen starrte er mich an. Seine Lippen bewegten sich, als wolle er mir etwas sagen.
Dann beugte er seinen Kopf langsam seitwärts. Die Atmung setzte aus.
Zitternd fühlte Patrick den Puls des Unglücklichen. Noch und noch einmal.
Schließlich zog er seine Kappe, schlug bedächtig ein Kreuz über meinen Vater und wischte sich verstohlen mit dem Hemdsärmel Tränen aus den Augen.
Unschlüssig sah ich Patrick an.
„Was ist? Ist er...?“, stammelte ich verwirrt.
„Ja. Es tut mir sehr leid. Der Herr hab ihn selig!“, erwiderte er und legte mitfühlend seinen Arm um meine Schulter. „Komm Maisy! Wir müssen zu deiner Mutter und ihr sagen, was geschehen ist!“
Nie zuvor hatte ich derart herzergreifende Schreie gehört wie in dem Moment, als Patrick meiner Mutter die niederschmetternde Nachricht vom Unfalltod meines Vaters überbrachte.
Der Arzt, den Patrick telefonisch herbeigerufen hatte, verabreichte zuerst meiner Mutter, dann mir und auch Karin ein Beruhigungsmittel, ehe er den Totenschein meines Vaters ausstellte.
Wie ein Lauffeuer hatte sich die Nachricht von dem grauenvollen Unfalltod des in der Umgegend geschätzten Landwirts Tony Urbany herumgesprochen.
An der drei Tage später stattgefundenen Beerdigung und dem anschließenden Totenamt nahm fast die gesamte Dorfbevölkerung teil. Auch Bekannte aus benachbarten Ortschaften waren gekommen, um uns, den trauernden Hinterbliebenen, ihr Beileid zu bezeugen und dem im blühenden Alter von nur 41 Jahren auf derart tragische Weise aus dem Leben gerissenen Menschen die letzte Ehre zu erweisen.
2.
Durch den unvorhersehbaren frühen Tod meines Vaters war mit einem Schlag alles anders geworden. Unser bis dahin sorgloses Familienleben und auch meine unbeschwerte Kindheit waren abrupt vorbei. Obschon befreundete Bauern uns bei der anstehenden Getreideernte und anderen schweren Arbeiten zur Hand gingen, machten sich von heute auf morgen die fehlende Arbeitskraft und die Erfahrung des Verstorbenen drastisch bemerkbar.
Meiner Mutter wuchs die Arbeit über den Kopf. Schon bald war klar geworden, dass sie das Anwesen ohne fremde Hilfe nicht mehr rentabel bewirtschaften konnte. Ich war noch zu jung, bei allem guten Willen, meinen Vater auch nur ansatzweise zu ersetzen. Wir mussten fremde Hilfe einstellen, obschon das mit Unkosten verbunden war.
Der Knecht, den meine Mutter in Dienst nahm, hieß Rudy, war Mitte Dreißig und kam aus dem Kanton Redingen. Er machte einen recht ordentlichen Eindruck, hatte gute Manieren, war fleißig und willig.
Inzwischen war es September geworden. Die Schulferien gingen ihrem Ende entgegen. Da meine Mutter jetzt einen kräftigen und, wie es schien, zuverläßigen Arbeiter in ihrem landwirtschaftlichen Betrieb hatte, wollte sie mir - da ich unendlich schwer unter dem herben Verlust meines Vaters litt - noch ein paar Tage Abwechslung verschaffen.
In Wasserbillig, bei ihrer Schwester Josette, deren Mann Gilbert und Tochter Karin, meiner Kusine, sollte ich mich ablenken, Ruhe finden und auch Kraft sammeln, bevor der tägliche Schultrott wieder begann.
Als erstes war in Karins Schlafzimmer ein Bett für mich aufgestellt worden. Jetzt konnte ich, bevor ich einschlief, oder auch nachts, wenn ich wach wurde und an meinen verstorbenen Vater dachte, zu meiner Kusine kriechen und mich bei ihr ausweinen.
Um mich aufzumuntern, ließ Karin sich täglich etwas Neues einfallen, was wir beide gemeinsam unternehmen konnten. Einmal hatten wir mit der Fähre über die Mosel an das gegenüberliegende deutsche Oberbillig gesetzt. Ein andermal sahen wir uns im Kino den berühmten Zeichentrickfilm ‘Schneewittchen und die sieben Zwerge‘ von Walt Disney an. Tagsdarauf besuchten wir die Freilicht-Theater-Aufführung der Wasserbilliger Pfadfinder.
Am Vormittag des vorletzten Ferientages entlud sich ein schweres Gewitter über Mosel und Sauer. Es blitzte, donnerte und regnete ununterbrochen. Karin hatte mir sofort angemerkt, dass ich an jenen verhängnisvollen Nachmittag dachte, als bei einem ähnlichen Gewitter der Bulle Willy meinen Vater tödlich verletzt hatte.
Da an Ausgehen nicht zu denken war, stiegen wir beide auf den Speicher des geräumigen Wohnhauses.
Dort waren ausgediente alte Möbel abgestellt und lagerten mannigfaltige Gegenstände, die nicht mehr im häuslichen Gebrauch waren: Steinguterzeugnisse, zerbeulte Kupfertöpfe, metallene Kerzenständer, graublauglasierte Einmachtöpfe aus gebrannter Erde, ein Grammophon, das noch per Hand aufgezogen werden musste. In einem Schrank lagen Puppen. Der untere Teil war aufgefüllt mit Abenteuerbüchern, die Karins Vater als Jugendlicher und von denen auch seine Tochter bereits mehrere gelesen hatte. Entlang der gegenüberliegenden Wand standen eine Kommode aus Eichenholz mit einer gesprenkelten Marmorplatte und darauf eine Waschschüssel, ein Krug und eine Seifenschale mit eingebranntem Blumenmotiv; daneben ein massiver Backtrog, in dem einst der Brotteig geknetet wurde, bevor man ihn in den hauseigenen Backofen schob; ein ausgedientes Spinnrad; ein uralter Kinderwagen mit klobigen Holzrädern; ein Butterfass; ein selbst gezimmerter Rodelschlitten; ein altes Fahrrad mit Vollgummibereifung; ein Sauerkrautfass mit dem dazu gehörigen Hobel und daneben ein Schaukelstuhl, auf dem eine riesige Stoffpuppe saß. Darüber an der Wand hingen mehrere in Holz gerahmte alte Porträts schnurrbärtiger Männer und ernst dreinschauender Frauen in dunklen bis zum Kinn zugeknöpften Kleidern und mit im Nacken festgeflochtenem Haarknoten. Es waren Andenken an verstorbene Vorfahren, die ich nicht gekannt hatte.
Erst am Nachmittag, als die noch warme Septembersonne wieder über die hügelige und waldreiche Landschaft der Sauer schien, wachte ich aus meiner Lethargie auf.
Obschon es in den Stunden vorher stark geregnet hatte, war der Wasserstand des Grenzflusses, an dessem gemütlichen Ufer Karin und ich entlang schlenderten, kaum sichtbar angestiegen.
„Ich habe eine Idee“, sagte Karin plötzlich. „Gehen wir durch die Sauer hinüber auf die deutsche Seite!“
„Ist das nicht gefährlich?“, fragte ich, erstaunt über diesen kühnen Vorschlag.
„Ach wo! Es ist doch Niedrigwasser!“
„In der Schule haben wir gelernt, dass es in der Sauer stellenweise heimtückische Strömungen und Strudel gibt. Und ich kann nicht schwimmen.“
„Ich kann auch nicht schwimmen und ich sehe auch keine Strömungen oder Strudel. Du hast keine Ahnung, wie viele Schmuggler nachts durch die Sauer gehen, die auch nicht alle schwimmen können“, entgegnete Karin schnippisch, währenddem sie ihre Schuhe auszog, die Hosenbeine hochkrempelte und ins Wasser trat. „Schau her, es reicht mir gerade bis an die Knie! Wenn du aber zu feige bist mitzukommen, dann gehe ich eben allein.“
„Ich bin nicht feige!“, ereiferte ich mich, streifte ebenfalls meine Schuhe ab, legte sie unter ein Gesträuch, und stieg gleichfalls ins seichte Gewässer.
Langsam, mit kleinen Schritten, tasteten wir uns vorwärts. Von Stein zu Stein. Karin ein paar Meter vor, ich hintendran.
Wir waren bereits in der Flussmitte, als ich unversehens auf einen großen schräg liegenden glitschigen Stein trat und ausrutschte. Ich verlor das Gleichgewicht und platschte mit dem ganzen Körper ins Wasser. Wie wild schlug ich mit Armen und Beinen um mich. Dann wurde ich flussabwärts getrieben.
Ich schrie um Hilfe so laut ich konnte. Ich schluckte Wasser, bekam Hustenanfälle, schnappte nach Luft und stand Todesängste aus.
Da erschallte von der Uferböschung her die Stimme einer Frau: „Rex! Hol das Mädchen aus dem Wasser! Bring es hierher!“
Sofort rannte der kräftige cremefarbene Golden Retriever in die Fluten der Sauer. Mit schnellen Beinschlägen schwamm er auf mich zu. Gerade als ich ohnmächtig zu werden drohte, packte er mit seiner starken Schnauze mein Hosenbein. Dann zog er mich, unter Aufbietung all seiner Kräfte, bis ans Ufer und ließ mich los. Freudig bellend rannte er seiner herankommenden Meisterin entgegen, um gestreichelt und gelobt zu werden.
Doch die Frau hatte sofort die bedrohliche Situation erfasst, als ich im niedrigen Uferwasser liegend krampfhaft nach Luft rang und zu ersticken drohte.
Resolut kam sie auf mich zu, zog mich ruckartig aufs Trockene und legte mich in die stabile Seitenlage.
„Ich bin Krankenschwester“, sagte sie nur kurz, riss mir den Mund auf und begann mit ihren Fingern den angesammelten Schmutz zu entfernen.
Ich musste kräftig husten und erbrach das geschluckte dreckige Flusswasser. Dann atmete ich ein paarmal kräftig durch.
Danach fasste sie mich an beiden Armen, und drehte mich um.
„Au!“, schrie ich.
„Wo tut es weh?“, fragte sie.
„Hier“, hechelte ich krampfhaft und wies mit der rechten Hand an meine verletzte linke Schulter.
„Dann lass mich sehen!“
Langsam tastete sie mein schmerzendes Schultergelenk ab.
„Nur ausgerenkt!“, stellte sie fest. „Das kriegen wir gleich wieder hin!“.
Entschlossen fasste sie die linke Schulter mit beiden Händen und bewegte sie mit einem kurzen kräftigen Ruck.
Ich schrie laut auf vor Schmerz.
„Fertig!“, lächelte die Pflegerin. Inzwischen war Karin aus der Sauer gestiegen. Höchst erregt und leichenblass kam sie auf mich zugeeilt.
„Maisy! Es tut mir leid!“, schrie sie laut weinend. Ihr war bewusst, dass sie die alleinige Schuld an meinem Unfall trug, der nur dank der hilfsbereiten Krankenpflegerin glimpflich abgelaufen war.
Minuten später fuhr die freundliche Helferin uns beide in ihrem Kleinwagen nach Wasserbillig. Vor dem Haus von Karins Eltern stiegen wir aus und schlichen pudelnass zur Hintertür hinein.
3.
Acht Monate gingen vorüber. Es war Mai geworden. Die bereits warme Sonne strahlte über dem Ösling. Vielerorts waren Landwirte dabei ihre Setzkartoffeln in die frisch gepflügte Erde zu legen. Auch meine Mutter und der Knecht Rudy. Ich, unterdessen dreizehn Jahre alt, war angewiesen worden, nach Schulschluss die Kühe von der Weide abzuholen und mit dem Melken zu beginnen.
Es ging auf sieben Uhr zu, als die beiden, müde und hungrig, vom Feld heimkehrten.
Da es spät geworden war, hatte ich schon sämtliche Kühe gemolken und auch mehrere Kunden, die seit Jahren regelmäßig ihre Milch oder Eier abholten, bedient und mit ihnen abgerechnet.
Nach dem Abendessen, als Rudy sich zurückgezogen hatte, bat meine Mutter mich zu sich.
„Maisy. Schließ bitte die Küchentür“, sagte sie. „Ich habe etwas mit dir zu besprechen!“
„Was gibt es denn, Mama?“
„Es ist nicht einfach für mich. Aber ich erwarte, dass du mir ganz offen die Wahrheit sagst!“
„Mama! Du weißt doch, dass ich das immer tue!“
„Deine Antwort auf meine Frage ist sehr wichtig. Also, Maisy - hast du dir schon mal, ohne dass ich davon weiß, Geld aus der Milchkasse genommen?“
„Ich…? Geld…?“ Ich war fassungslos.
„Bitte antworte mir! Ja oder nein?“
„Nein! Niemals! Wieso fragst du mich das, Mama?“
„Weil ich in letzter Zeit mehrmals festgestellt habe, dass Geld fehlt!“
„Mama! Weshalb beschuldigst du mich gestohlen zu haben?“, begehrte ich auf.
„Das ist keine Anschuldigung. Ich wollte nur ganz sicher sein, dass du nichts damit zu tun hast!“, versuchte sie ihre Frage abzuschwächen. „Da du es nicht warst, bleibt nur einer, der infrage kommt!“, und legte mir beruhigend die Hand auf die Schulter. „Tut mir leid, Maisy!“, flüsterte sie ergriffen und zog mich dabei fest an sich.
Am folgenden Abend sagte sie zu ihrem Knecht: „Rudy. Ich muss nochmals weg, mit Maisy. Kümmern Sie sich heute um den Verkauf der Milch und der Eier. Die Kasse steht auf dem Milchtisch. Eine Handvoll Kleingeld habe ich - ohne es abgezählt zu haben - hineingelegt. Das reicht zum Wechseln.“
„Geht in Ordnung, Chefin.“
Dann wandte sie sich an mich. „Maisy. Nun beeil dich doch! Sonst kommen wir zu spät!“
Aber entgegen dem, was sie zu Rudy gesagt hatte, gingen wir nicht vom Hof, sondern setzten uns in die Rumpelkammer über dem Milchraum. Von hier hatten wir durch die Öffnung einer abmontierten Ofenröhre einen direkten Blick auf die alte Milchtheke und die Kasse.
„Hast du das Kleingeld, das du in die Kasse gelegt hast, wirklich nicht abgezählt?“, flüsterte ich meiner Mutter zu.
„Natürlich habe ich es abgezählt. Aber das darf Rudy nicht wissen!“, entgegnete sie leise.
Es hatte nicht lange gedauert, bis Rudy im Milchraum erschien. Sogleich ging er auf die blecherne Kassette zu. Zögernd richtete er den Blick auf den Inhalt. Dann griff er mit einer Hand hinein, wählte ein paar Münzen aus, und ließ sie in seiner linken Hosentasche verschwinden.
„Hast du das gesehen?“, raunte ich meiner Mutter zu.
Bejahend winkte sie mit dem Kopf und hielt den Zeigefinger an ihre Lippen.
Kurz darauf kamen die ersten Kunden, zahlten und gingen wieder.
Dann erschien die Frau vom Eisenbahner Meier.
„Ich brauche vier Schoppen Milch, einen Liter Schmand und drei Dutzend Eier. Meine Tochter kommt morgen mit den Kindern. Da muss ich backen und vorkochen“, sagte sie mit ihrer lauten Stimme. Doch dann erschrak sie, als sie auf den flachen fast leeren Eierkorb schaute. „Haben Sie sonst keine mehr?“
„Warten Sie! Ich schaue nach, ob ich noch einige im Hühnerstall finde“, sagte Rudy und verschwand. Bald kam er mit einem Körbchen mit frischgelegten Eiern zurück.
„Gottseidank!“, atmete Frau Meier erleichtert auf und hielt Rudy einen Geldschein hin. „Können Sie wechseln? Wenn nicht, dann zahle ich morgen abend, wenn Jeanny wieder hier ist.“
„Kein Problem. Ich kann herausgeben“, erwiderte Rudy und reichte Frau Meier das Wechselgeld. Den Schein legte er neben die Kasse.
Kaum hatte die Frau den Raum verlassen, sahen wir wie Rudy nach dem Geldschein griff, ihn zusammenfaltete und ebenfalls in die linke Hosentasche steckte.
Die letzte Kundin war bedient. Unauffällig verließen wir unseren Spähposten und stiegen aus der Rumpelkammer hinab.
„Wir sind wieder zurück“, sagte meine Mutter zu Rudy. „Wie war‘s?“
„Normal.“
„Viel verkauft?“
„Nicht mehr als sonst.“
„Wie ich sehe, sind auch alle Eier weg. Brauchten Sie keine aus dem Stall zu holen?“
„Nein! Es hat gerade gereicht.“
Dann schüttete sie den klirrenden Kasseninhalt auf die blankgescheuerte Tischplatte.
„Kein Geldschein?“, fragte sie.
„Nein! Nur Münzen.“
„Und wo ist der Geldschein, mit dem Madame Meier bezahlt hat?“
Rudy erschrak heftig. „Welcher Schein? Was soll das?“, begehrte er auf. „Wollen Sie sagen, dass ich Geld gestohlen habe?“
„Ja! Ich und Maisy haben gesehen, wie Sie den Schein von Frau Meier eingesteckt haben!“
„Ich…?“, schrie Rudy aufgeregt.
„Leugnen Sie nicht. Es hat keinen Zweck. Wenn Sie weiter abstreiten, können wir Frau Meier als Zeugin befragen. Wir können aber auch die Gendarmen rufen. Die werden den Geldschein in ihrer linken Hosentasche finden.“
Rudy war erschrocken.
„Also. Geben Sie zu, dass Sie den Schein eingesteckt haben!“, forderte meine Mutter mit erhobener Stimme.
Ohne darauf zu antworten, griff Rudy in seine Hosentasche, zog den Schein hervor und und warf ihn auf den Tisch.
„Jetzt auch noch das Kleingeld, das Sie aus der Kasse gestohlen haben!“
Nochmals griff er in die Tasche, schleuderte die Münzen auf den Tisch und verließ wortlos den Raum.
Am nächsten Morgen packte Rudy seinen Koffer, ließ sich von meiner Mutter den Lohn auszahlen und verließ den Hof - für immer.
Eine Woche war vergangen, ohne dass ein neuer Knecht auf die von meiner Mutter geschaltete Zeitungsanzeige vorstellig wurde.
Da stand plötzlich ein eher schmächtiger Mann mit groben Gesichtszügen und grauem schütterem Haar, schätzungsweise Mitte Fünfzig, an der Tür des Schweinestalls, den sie dabei war auszumisten.
„Ich habe gehört, dass Sie einen Knecht mit Erfahrung suchen“, sagte er mit Akzent.
„Das stimmt“, entgegnete sie, stellte die Mistgabel zur Seite und kam näher. „Ich brauche einen Mann, der selbstständig arbeiten kann - pflügen, mähen, melken, mit Pferden umgehen. Können Sie das denn?“
„Selbstverständlich kann ich das!“
„Wo haben Sie denn bisher gearbeitet?“
„Auf dem elterlichen Hof.“
„Wo ist das?“
„Direkt hinter der belgischen Grenze, nicht einmal zwanzig Kilometer von hier.“
„Weshalb denn jetzt nicht mehr?“
„Weil es nach dem Tod des Vaters innerhalb der Familie zum Streit gekommen ist. Da habe ich meine Sachen gepackt und bin ausgezogen.“
„Das tut mir leid. Es ist immer schade, wenn so etwas in der Familie passiert“, erwiderte sie und schaute sich dabei den Bewerber genauer an. Gerne hätte sie noch weitere Kandidaten gesprochen. Da aber sonst niemand vorstellig geworden war, und sie schnellstens professionelle Hilfe benötigte, traf sie eine sofortige Entscheidung: „Also gut. Ich könnte Sie einstellen. Zuerst einmal probeweise für einen Monat. Danach sehen wir weiter.“
„Moment mal“, entgegnete er lächelnd, wobei zwei Zahnlücken in seinem schmalen Mund sichtbar wurden. „Zuerst möchte ich aber noch die Konditionen wissen, bevor ich ja sage.“
Sie nannte die Summe der Entlöhnung. „Kost und Logis selbstverständlich gratis! Sind Sie damit einverstanden?“
Der Fremde überlegte und kratzte sich verlegen am Hinterkopf. „Wenn Sie noch 100 Franken pro Monat drauflegen, wären wir uns einig“, murmelte er.
Meine Mutter dachte kurz nach. „Wenn ich jetzt ja sagen würde… wann könnten Sie dann anfangen zu arbeiten?“
„Heute! Sofort!“
„Einverstanden! Dann ran an die Arbeit!“, kommandierte sie und reichte ihm die Hand zum Zeichen des gegenseitigen Einverständnisses. „Ich habe noch vergessen zu fragen, wie Sie heißen.“
„Jean-Pierre“, antwortete er.
Jean-Pierre kannte sich tatsächlich bestens aus mit allen anfallenden Arbeiten in einem landwirtschaftlichen Betrieb. Die Zusammenarbeit verlief problemlos. Meine Mutter war zufrieden mit dem neuen Knecht.