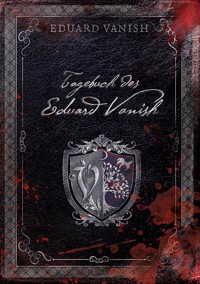
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Tagebuch des Eduard Vanish
- Sprache: Deutsch
Liebe - Leidenschaft - Lust - Verlangen - Leid - Schmerz - Tod Diese Attribute beschreiben mein Leben am besten. Mein Name ist Duke Eduard Vanish. In diesen Aufzeichnungen habe ich mein Leben niedergeschrieben, um einiges über meinesgleichen richtig zu stellen und um etwas zu hinterlassen. Es war kein einfaches Leben - voller Verlangen nach Blut, voller Tod, Fleischeslust und Schmerz, doch auch voller Leidenschaft und unendlicher Liebe. Lest selbst von meinem ewigen Leben und meinen Entscheidungen, doch wagt es nicht, über mich zu urteilen, wenn ihr meine Beweggründe doch nicht verstehen könnt. Die Welt hat viele Monster ... Ich bin keines von diesen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gliederung
01. Dezember 2023
02. Dezember 2023
03. Dezember 2023
04. Dezember 2023
05. Dezember 2023
06. Dezember 2023
07. Dezember 2023
08. Dezember 2023
09. Dezember 2023
10. Dezember 2023
11. Dezember 2023
12. Dezember 2023
13. Dezember 2023
14. Dezember 2023
15. Dezember 2023
16. Dezember 2023
17. Dezember 2023
18. Dezember 2023
19. Dezember 2023
20. Dezember 2023
21. Dezember 2023
22. Dezember 2023
23. Dezember 2023
24. Dezember 2023
01. Dezember 2023
Nun, da ich ins Angesicht meines Todes blicke, möchte ich einige Dinge richtigstellen, die man über die Jahrhunderte falsch überliefert hat.
Märchen und Schauergeschichten - mehr ist von meinesgleichen nicht übrig geblieben.
Aus diesem Grunde schreibe ich mein Leben in dieser Weise nieder und ich erlaube mir, es an eure moderne Sprache anzunähern.
Es ist kein Zufall, dass ich mich in diesem Monat, im Dezember, dazu entschlossen habe, euch die Wahrheit zu offenbaren.
Es geschah, dass ich an einem 24. Dezember geboren wurde - vor beinahe 300 Jahren.
Aber alles der Reihe nach!
Es war der 24. Dezember 1723 im heutigen Frankreich.
Ich wurde als unehelicher Sohn einer Bäuerin, Johanna, und des Lords Nicklaus Vanish geboren.
An jenem Dezembermorgen war es eiskalt und die Familie meiner Mutter, die aus ihrer Schwester, derem Mann und ihrem kleinen Sohn bestand, hatte kaum genug Feuerholz, um über den Winter zu kommen, geschweige denn Nahrung.
Ihre Felder hatten diese Saison brach gelegen. Der aus England stammende Duke, Henry Vanish, Vater von Lord Vanish, war ein grauenhafter Mensch, der seine Untergebenen ausbeutete und mit Füßen trat. Da es keine Ernte gab und er bei anderen Ländereien einkaufen musste, verlangte er, dass ihm alle ihm untergebenen Frauen nacheinander gebracht würden. Der junge Lord fand Gefallen an meiner Mutter und rettete sie vor den Gelüsten seines Vaters. Im Gegenzug verlangte er nur, dass sie ihm jede Woche bei seinem Spaziergang Gesellschaft leiste. Doch dabei blieb es nicht. Es kam wie es kommen musste und sie verliebten sich ineinander. Als sie schwanger wurde, befiel sie jedoch eine furchtbare Angst und sie beschloss, ihm nichts davon zu erzählen. Sie mied die wöchentlichen Spaziergänge und wurde nicht mehr gesehen. Lord Vanish glaubte, es seie ihr zu viel geworden und ließ sie enttäuscht in Frieden.
Nach neun Monaten brachte meine Mutter mich zur Welt und verstarb noch im Kindbett.
Die Schwester meiner Mutter und ihr Mann wussten von dem romantischen Verhältnis. Sie beschlossen, da sie kaum selbst genug zum Leben hatten, mich dem Lord zu überlassen. Bei Nacht und Nebel drang der Mann meiner Tante in das Anwesen des Dukes ein, legte mich zusammen mit einem Brief vor die Tür des jungen Lords und verschwand nach einem letzten Klopfen.
Mein Vater, so erzählte man mir, weinte bitterlich um meine Mutter und machte sich schreckliche Vorwürfe. Er beschloss, mich als seinen Sohn anzuerkennen und jegliche kommende Strafe seines eigenen Vaters auf sich zu nehmen.
Lord Vanish hatte schon den Tod meiner Mutter auf dem Gewissen. Er sah es als seine Pflicht an, sich um mich zu kümmern. So gab er mir den Namen Eduard Vanish.
Der Duke erlag drei Jahre nach meiner Geburt seinem Alter und mein Vater nahm nun seinen Platz ein. Ich möchte betonen, dass er stets ein guter Vater für mich war.
Ich wuchs so unbeschwert auf wie es für einen kleinen Lord nur möglich war, aber natürlich wurde auch viel Zeit und Geld in meine Ausbildung investiert.
Vierzehn Jahre nach meiner Geburt starb mein Vater jedoch nach einer plötzlichen und schweren Krankheit. So wurde es mir damals jedenfalls berichtet.
Nun war ich der Duke. Mit vierzehn Jahren hatte ich allerdings noch kein sehr ausgeprägtes Pflichtbewusstsein und so entfloh ich den Fesseln meines Standes, die man mir anlegen wollte. Auf meiner Reise besuchte ich viele Länder und habe viel gelernt über das Leben - immer unter einem anderen Namen. Charles, George und viele mehr. Mal wanderte ich als Bauer, mal als Maler und nur selten reiste ich als Duke. Ich fand Gefallen an den schönen Künsten und bekam die Möglichkeit, diese zu studieren.
Irgendwann jedoch, es musste um meinen neunzehnten Geburtstag herum gewesen sein, befiel mich das Gefühl, ich sollte nach Hause zurückkehren. Ich war erwachsener und reifer geworden und fühlte mich nun bereit, meine mir zugedachte Aufgabe zu übernehmen.
Die Überraschung, die ich bei meiner Rückkehr allseits auslöste, hatte ich allerdings nicht erwartet. Es schien nicht so als hätten meine Bediensteten und Berater vermutet, mich je wiederzusehen. Gegenüber den Bauern jedoch hatte man mein Verschwinden verschwiegen. Sie hatten weiterhin ihre viel zu hohen Abgaben zahlen müssen. Ich unternahm einen Ritt zu ihnen und ließ ihnen Nahrung, Decken und Kleidung für den bevorstehenden Winter austeilen. Damals wusste ich noch nicht, wieso - weder mein Vater und auch sonst niemand hatte je über die Herkunft meiner Mutter gesprochen - aber irgendetwas schien mich mit diesen Bauern zu verbinden.
»Dass Sie sich nicht schämen!« Ein junger Mann spuckte vor meine Füße.
Er hatte eine seltsame Ähnlichkeit mit mir. Dieselben braunen Haare und dieselben blauen Augen. Meine Wachen gingen sofort auf ihn los. Ich hob meine Hand und sie ließen von ihm ab.
»Habe ich dich in irgendeiner Weise verärgert?«, wollte ich irritiert wissen.
»Sie sind genau wie Ihr Großvater! Wegen Ihnen ist mein Vater letzten Winter gestorben!« rief er.
»Frederic!«, tadelte ihn eine ältere Frau. »Entschuldigen Sie bitte meinen Sohn. Der Tod seines Vaters hat ihn sehr mitgenommen.«
Sie musterte mich mit denselben blauen Augen als würde sie mich kennen.
»Nun, das mit deinem Mann tut mir sehr leid. Ich bedaure euren Verlust zutiefst. Jedoch sehe ich noch nicht, was ich damit zu tun haben sollte.«
»Er ist verhungert, weil die Abgaben zu hoch sind!«, spie der junge Mann und spuckte mir dabei beinahe ins Gesicht.
Augenblicklich fühlte ich mich schrecklich und verantwortlich für diese beiden Menschen.
»Das ist furchtbar. Bitte seid versichert, dass es nie meine Absicht war, irgendeinem von euch ein Leid zuzufügen. Die Wahrheit ist, ich war seit dem Tode meines Vaters auf Reisen und nicht hier. Meine Berater haben eigenmächtig gehandelt und ihre Strafe dafür bereits erhalten.« Ich sah zu den Wachen. »Ihr bringt diese beiden umgehend in mein Anwesen. Ich möchte, dass sie meine Gäste sind.«
»Als ob es das ungeschehen machen würde! Mein Vater ist tot!«
»Frederic, hüte deine Zunge! … Wir sind Ihnen sehr dankbar, Euer Gnaden.« Die alte Frau verneigte sich leicht.
Es genügt wohl, zu schreiben, dass ich nicht wenig Ablehnung von meinen Beratern erhielt. Doch dafür hatte ich mir die Bewunderung der Bediensteten und der Wachen gesichert.
»Mir ist komisch, wenn ich euch betrachte«, gab ich beim Abendessen zu. »So als würde ich euch kennen, obwohl wir uns noch nie zuvor begegnet sind.«
»Vielleicht sind wir uns doch schon zuvor begegnet.« Die Frau wirkte als wollte sie noch mehr erzählen, doch sah dann eingeschüchtert zu den Bediensteten.
Auf einem Fingerzeig von mir verließen alle den Saal.
»Bitte habe keine Scheu. Erzähle, was du zu wissen meinst.«
Und sie erzählte von meiner Mutter, während ihr Sohn sich in missmutiges Schweigen hüllte. So vervollständigte sich also meine eigene Geschichte.
»Bitte verzeiht. Wir hatten selbst kaum genug zum Überleben. Wie hätten wir da noch ein Kind durchfüttern sollen?«
Ich hob meine Hand und erhob mich etwas verstört. »Mein Zustand hat nichts mit euch zu tun. Ich bin mir sicher, dass ihr im besten Gewissen gehandelt habt. Es ist für mich nur nicht leicht zu verdauen. Du bist also die Schwester meiner Mutter.«
»Ja, Euer Gnaden.«
Ich wandte mich zu Frederic. »Dann bist du …«
Knirschend unterbrach er mich: »Wagen Sie es ja nicht, mich Ihren Cousin zu nennen! Wir haben nichts gemein!«
»Vielleicht haben wir doch mehr gemein als du glaubst«, meinte ich schwer. »Auf meinen Reisen wanderte ich oft als Bauer.«
»Sich als Bauer zu geben und einer zu sein, ist bei weitem nicht dasselbe, Duke. Sie werden noch nie Hunger gelitten haben oder im Winter fast an der Kälte verreckt sein!«
Frederic erhob sich und ging.
Ich sah schwer zu Boden. »Er hat recht. Etwas wie dies musste ich noch nie am eigenen Leibe erleben, doch habe ich es oft genug bei anderen gesehen. Er hat jedes Recht, mich zu verabscheuen. Es hätte auch umgekehrt kommen können.
Dann wäre ich nun an seiner und er an meiner Stelle.«
Die alte Frau erhob sich. »Euer Gnaden, die Welt ist nun mal wie sie ist. Sich darüber zu beklagen oder sich etwas anderes zu wünschen - bloße Zeitverschwendung. Die Mächtigen werden immer die Welt regieren. Und Sie, Euer Gnaden, hatten Glück, als ein solcher geboren worden zu sein. Seien Sie dankbar dafür. Und vielleicht gelingt es Ihnen ja, die Welt für uns anderen ein wenig besser zu machen.«
»Ja, das hoffe ich«, erwiderte ich. »Das versuche ich.«
Ich sah ihr in ihren Bauernlumpen nach.
In jener Nacht wollte sich der Schlaf bei mir nicht einstellen.
Zu groß waren meine Gewissensbisse. Ich fühlte mich tatsächlich als hätte ich ihren Mann, einen Teil meiner eigenen Familie, eigenhändig ermordet und danach einfach weitergelebt. Natürlich hatte ich das nicht gewusst. Aber wenn ich es nun doch gewusst hätte, hätte ich es verhindern können.
Schützt die eigene Unwissenheit vor Gottes Urteil?
Am nächsten Tag ließ ich meine einzige noch lebende Familie angemessen bekleiden. Sie sollten fortan bei mir leben. Das Urteil der Anderen war mir gleichgültig. Ich hatte meinen Vater so früh verloren. Meiner restlichen Familie sollte nicht dasselbe geschehen.
Frederic tat sich schwer mit mir, also ließ ich ihn und hoffte, es würde schon irgendwann besser zwischen uns werden.
Was meine Tante anging, so hatte ich eine wirklich liebe Seele in ihr gefunden. Sie schien sich nie über irgendetwas zu beklagen und war dankbar für alles, was ihr gegeben wurde.
Doch was dann geschah, hätte ich nicht vorhersehen können.
Eines Abends, weit nach Sonnenuntergang, ging ich in die Bibliothek, in der Hoffnung, dort alleine meinen noch immer umherwandernden Gedanken nachgeben zu können. Ich wusste nicht, dass sich noch jemand zu dieser Zeit in der Bibliothek aufhielt. So sah ich nicht nach oben und schob die Leiter nur ein Stück zur Seite. Zuletzt klang mir ihr Schrei in den Ohren, bevor ich zu Boden gebracht wurde.
Ich schlug hart auf und musste kurz das Bewusstsein verloren haben. Als ich wieder zu mir kam, standen meine Bediensteten mit schreckensbleichen Gesichtern um mich herum.
»Was ist geschehen?«, fragte ich benommen und setzte mich auf, wobei ich sie sah.
Frederic hielt seine leblose Mutter in seinen Armen und schrie mich mit Tränen in seinen Augen an. »Was haben Sie getan?!«
Mit einem Grausen erhob ich mich und sah auf ihre rote Kehle, die Male von Zähnen aufwies. Entsetzt fuhr ich mir über meinen Mund und starrte dann auf meine blutige Hand.
»Es war ein Unfall! Ich … ich hatte sie nicht gesehen! Oh Gott, es tut mir so leid.« Hastig suchte ich das Weite.
In meinem Studierzimmer wischte ich mir das Blut vom Mund und starrte minutenlang auf das Tuch. Was war nur geschehen? Ich konnte das nicht begreifen. Auf einmal durchbohrte mich eine Klinge von hinten. Als ich mich mit großen Augen umdrehte, sah ich Frederic. Die Klinge tat mir gar nicht weh, obwohl sie mitten in mein Herz gegangen war. Ungläubig griff ich an meinen Rücken und zog die Klinge heraus. Frederic wartete noch, doch als ich nicht umfiel, zog er eine entsetzte Miene und stürzte sich auf mich.
Er fiel ungünstig über mich und so geschah es, dass die Klinge sich in sein Herz bohrte - ohne dass ich hätte irgendetwas dagegen tun können. Er war augenblicklich tot.
»Frederic! Oh nein, bitte!« Ich zog die blutige Klinge aus seiner Brust heraus. »Oh Gott, nein! Frederic!«
Auf einmal erregte mein eigenes Spiegelbild meine Aufmerksamkeit. Aus meinem Nacken, halb verdeckt von meinem Kragen und meinen Haaren, ragten Wirbel. Ich musste mir bei dem Unfall in der Bibliothek das Genick gebrochen haben.
Ich wusste nicht, warum, es geschah eher instinktiv, aber ich hob meine Hand und brachte meine Wirbel mit Knacken wieder in die richtige Position. Mit offenem Mund sah ich mein bleiches Spiegelbild an. Was war nur mit mir geschehen? Auf einmal roch ich etwas. Etwas unwiderstehliches. Ich folgte dem Geruch bis zur blutigen Klinge in meiner anderen Hand.
In mir sträubte sich alles. Ich wollte das nicht! Doch etwas brachte mich dazu, die Klinge abzulecken. Und dann verfiel ich in einen Rausch - einen Blutrausch. Ich grub meine beiden spitz gewordenen Eckzähne mit aller Kraft in seine noch warme Haut und trank sein Blut.
Als ich mich satt getrunken hatte und wieder zu Sinnen kam, rutschte ich mich hastig von seinem Körper weg und drückte mich in eine Ecke.
Er sah aus als hätte ihn ein wildes Tier angefallen. Doch mein Spiegelbild zeigte mir, dass ich dieses wilde Tier gewesen war. Mein Mund und meine Sachen waren blutverschmiert.
Ich fürchtete mich unheimlich vor mir selbst und kauerte mich zitternd und japsend zusammen. Das war nicht ich gewesen.
Das war ein Monster gewesen! Ein Ungeheuer! Ein Dämon!
Irgendwann hatte ich mich wieder etwas gefasst und ich sah zu der geschändeten Leiche meines Cousins.
Was hätten sie wohl getan, hätten sie ihn so bei mir vorgefunden?
Ich erhob mich mit zittrigen Beinen, packte seinen Körper und warf ihn aus dem Fenster direkt in den Fluss hinein, der ins nächste Dorf floss - in sein Dorf. Mein blutgetränktes Hemd ließ ich unter meinen Dielen verschwinden und nagelte diese zu.
Als ich wieder in den Spiegel sah, um mir das Blut aus dem Gesicht zu wischen, sah ich, dass meine Wunde am Nacken nicht mehr vorhanden war. Das Tuch wickelte ich um den schweren Dolch und versenkte ihn im Fluss.
Ich hatte alle Spuren beseitigt, aber mein Spiegelbild machte mir noch immer Angst, denn in meinen Augen war etwas fremdes, das mich aus meinem tiefsten Innern anzustarren schien.
So floh ich aus meinem Studierzimmer..
Es ist wohl unnötig, zu schreiben, dass das bei mir schlimmste Albträume und Ängste auslöste. Ich tat kein Auge mehr zu …
02. Dezember 2023
Nun, wo war ich? …
Ah ja, bei jenem ereignisreichen Abend vor 281 Jahren!
Ich hatte zuvor noch nie jemandem ein Leid zugefügt - niemals.
Was ich nun durchmachte, war wie meine persönliche Hölle.
Ich fühlte mich als schmorte ich lebendig im Fegefeuer und es erschreckte mich, wie gleichgültig ich log. Ich erzählte allen, Frederic wäre davongelaufen und dass ich ihn seither nicht mehr gesehen hätte.
Es war schrecklich. Meine Schuldgefühle verzehrten mich beinahe und die Gier nach mehr zerstörte meine menschliche Seele, die noch auf Erlösung hoffte. Doch alle Hoffnung sollte vergebens sein.
Ich schloss mich selbst in meinem Gemach ein, zog meine roten Vorhänge zu und verhing die Spiegel. Niemand mehr sollte durch mich zu Schaden kommen.
Normal trinken und essen konnte ich noch, doch es war für mich alles vollkommen geschmacklos.
Irgendwann kam ich wieder aus meinem Gemach heraus.
Waren es Tage gewesen? Oder Wochen? Ich erinnere mich nicht mehr.
Jedenfalls berichtete man mir, dass man Frederics Leiche im Fluss gefunden und es so ausgesehen hatte als wäre er von einem wilden Tier angefallen worden. Von dem Einstich in seiner Brust hatte man vermutlich nichts mehr gesehen.
»Bestattet ihn neben seiner Mutter«, befahl ich dumpf und wollte meinen Weg fortsetzen.
»Jawohl . Euer Gnaden, einen Augenblick bitte noch!«
»Was gibt es, Gérard?«
»Heute wird eine Baronin hier ankommen. Sie hat den Baron von Hunrois geehelicht und macht hier einen Halt.«
»In Ordnung. Kümmert euch um sie. Ich lege dies in deine Hand.«
»Ja, Euer Gnaden.«
Ich ging in die Bibliothek, wo ich blieb und mich in einer Ecke selbst bemitleidete mit einem schon ausgelesenen Buch in der Hand. Ich starrte hinaus in die hereinbrechende Dunkelheit. Auf einmal hörte ich Schritte und war ganz leise und bewegungslos.
»Ist jemand hier? Das ist ja beeindruckend!« Eine junge Dame sah sich staunend in der Bibliothek um.
Dem edlen, samtig grünen Kleid nach zu urteilen war sie aus einem guten Hause.
Sie hatte ihre blonden Haare nach hinten geflochten und sah sich mit grünen, glänzenden Augen die Bücher an, ohne mich zu bemerken. Sie hatte noch eine kindliche Naivität an sich, doch irgendetwas an ihr schien mich zu faszinieren.
Ohne einen einzigen Laut erhob ich mich und trat hinter sie.
»Ich hoffe, Sie finden Gefallen an den alten Literaten.«
Sie wirbelte erschrocken herum und neigte hastig den Kopf.
»Euer Gnaden! Verzeihen Sie, ich habe Sie nicht bemerkt!«
»Schon gut.« Ich griff an sie vorbei und zog ein Buch heraus, welches ich ihr überreichte. »Shakespeare. Immer eine Empfehlung. Sie sind die Baronin, nicht wahr?«
»Ja, Euer Gnaden. Baronin. Mein Name ist Veronica.«
Sie sah etwas eingeschüchtert auf das Buch in ihrer Hand.
»Dankeschön.«
»Nun, die Bekanntschaft erfreut mich. Sie sind noch recht jung für eine Baronin.«
»Fünfzehn Jahre, Euer Gnaden.«
»Das ist wirklich noch ein wenig jung. Oh bitte, setzen Sie sich doch!« Ich deutete auf einen Sessel von zweien und wir setzten uns. »Soweit ich weiß, ist Ihr Mann über vierzig.«
»Neunundvierzig.« Sie sah etwas beschämt weg. »Er soll ein guter Mann sein. Wohlhabend und von gutem Stande.«
»Ich verstehe nicht. Kennen Sie ihn noch gar nicht?«
»Wir sind uns erst einmal begegnet. Als er um meine Hand anhielt. Dann musste er jedoch fort. Der Eheschluss wurde in seiner Abwesenheit durchgeführt.«
»Sicher freuen Sie sich, ihn nun wiederzusehen.«
»Ja«, entgegnete sie hohl. »Ja, sicher.«
Ihr war dabei unbehaglich zumute. Das konnte man deutlich erkennen.
Ich schwieg einige Sekunden. »Mein Name ist Eduard. Sie können mich gerne so anreden.«
Auf ihren Lippen bildete sich ein kleines, dankbares Lächeln.
»Dann dürfen Sie mich auch Veronica nennen.«
»Mit Freuden! Wie lange verweilen Sie bei uns?«
„Oh, ich soll morgen bereits weiterreisen.«
»Wieso bleiben Sie nicht einen Tag länger und erholen sich noch?«, schlug ich vor.
»Das würde ich gerne, doch …«
»Der Baron ist damit sicherlich einverstanden. Ich lasse einen Boten aussenden. Es ist ja nur ein paar wenige Stunden von hier entfernt.« Ich erhob mich und veranlasste das, bevor ich mich wieder setzte.
»Sie sind sehr freundlich.«
»Ich freue mich über Gesellschaft beim Lesen. Kennen Sie dieses Buch bereits, Veronica?«
»Dieses hier noch nicht, nein.«
»Es ist lesenswert. Am besten ist, Sie beginnen sogleich damit.« Ich griff mein Buch und tat so als würde ich es studieren.
Sie begann zu lesen und verschlang es beinahe mit einer Leidenschaft, die ich noch nie zuvor erlebt hatte. Ich betrachtete ihre flinken Augen, die jedes Wort erfassten, ihre vollen, roten Lippen, die die gelesenen Wörter stumm formten, und ihre filigranen Finger, die Seite für Seite vorsichtig umblätterten. Noch nie hatte ich jemanden so schnell und hingebungsvoll ein Buch lesen sehen.
Sie hatte es in wenigen Stunden durchgelesen und sah mich mit Tränen in den Augen an. »Das Buch war wunderschön. Doch wieso musste es so dramatisch enden?«
Ich lächelte etwas. »Das müssten Sie schon Shakespeare selbst fragen. Wenn Sie jedoch mich fragen, war Romeo einfach nur ein Narr.«
»Inwiefern, wenn ich fragen darf?« Sie schien ein wenig irritiert.
»Nun, er dachte, Sie hätte sich wegen ihm getötet.
Deswegen hat er sich selbst ermordet. Schließlich hat dies dazu geführt, dass sie sich tatsächlich wegen ihm umbrachte.
Das war unüberlegt von ihm.«
»Sie haben recht, doch meinen Sie nicht, dass man aus Liebe eine Menge unüberlegtes tut?«
»Ich kann dazu keine Einschätzung abgeben. Doch kann ich mir das recht gut vorstellen.«
»Danke für das Buch.« Veronica wollte es mir zurückgeben.
»Behalten Sie es bitte. Es ist ein Geschenk.«
»Ich danke Ihnen.« Sie erhob sich mit einem kleinen Lächeln und ging. »Gute Nacht.«
Mein Blick ging ihr nach. »Gute Nacht.«
Aus einem Tag Aufenthalt wurden schließlich mehrere.
Wir trafen uns immer zum Lesen und anschließenden Diskutieren. Ich genoss ihre Gesellschaft und ihre Sicht auf die Welt.
An dem vierten Abend meinte sie auf einmal: »Das mit Ihrer Familie tut mir sehr leid. Ihre Diener haben es mir erzählt. Das ist furchtbar.«
Auf einmal versperrte sich in mir alles. »Ich rede nicht darüber.«
Missmutig erhob ich mich und ging zu einem der Fenster.
Wieso musste sie das Thema erwähnen?
»Verzeihung. Ich wollte Sie bestimmt nicht verstimmen.«
Sie kam neben mich und sah ebenfalls in die Nacht. »Sie scheinen mir nur sehr einsam zu sein.«
Ich musterte sie aus den Augenwinkeln. »Manchmal ist es besser, alleine zu sein.«
»Nein … das ist niemals gut.« Veronica sah zu Boden.
»Wenn man ansonsten die verletzt, die man liebt, schon.«
Ich schluckte schwer und versuchte, meine Tränen zurückzuhalten.
Ihr Blick wandte sich nun direkt zu mir und Mitleid spiegelte sich in ihm wider. »Was auch immer geschehen ist, ich bin mir sicher, es war nicht Ihre Schuld.«
»Was wissen Sie schon? Sie kennen mich doch überhaupt nicht.« Ich wandte mich zum Gehen. »Ich bin gefährlich.«
»Eduard!« Sie hielt mich an der Hand auf.
Mein Blick wandte sich hinab auf unsere Hände. »Tun Sie das nicht. Ich bin nicht gut für Sie, Veronica.«
»Das glaube ich nicht.« Sie trat vor mich und sah mir in die Augen. »Sie leiden, aber dieses Leid fügen Sie sich selbst zu.
Warum?«
Ich konnte mich kaum von ihrem bezaubernden Anblick losreißen. »Bitte, lassen Sie mich.«
»Eduard …«
»Nein. Sie sollten abreisen. Morgen schon! Ihr Mann wartet auf Sie.« So riss ich mich los und ging.
Auf dem Gang begegnete ich Gérard. »Euer Gnaden, Sie habe ich gesucht.«
Mir war in diesem Moment kein bisschen nach reden zumute. »Weswegen? Was ist jetzt schon wieder?«
Der alte Mann musterte mich bedächtig. »Nichts, Euer Gnaden. Wir haben bloß die persönlichen Gegenstände Ihrer Familie erhalten. Darin fand ich dies hier.« Er überreichte mir eine schwarze Kette mit einem floralen Anhänger, der einer Brosche mit einer Perle in der Mitte ähnelte, wobei feine, rote Äderchen die Brosche durchzogen. »Ich erinnere mich, wie Ihr Vater diese Kette von seiner Mutter erbte und wie Ihr Vater sie Ihrer Mutter geschenkt hat, Euer Gnaden. Ich dachte, Sie würden sie gerne haben. Als Andenken.«
Wortlos betrachtete ich diese Kette und meinte dann: »Sie hätte sie verkaufen können, als es so schlecht um sie alle bestellt war. Wieso hat sie das nicht getan?«
»Ihre Mutter hat Ihren Vater geliebt, Euer Gnaden. Ihm bedeutete diese Kette sehr viel. Einige denken, dass sie verflucht sei, da jede ihre Trägerinnen einen frühen Tod fand, doch Ihr Vater glaubte das nie. Er sah sie eher als heiliges Omen.«
Ich umschloss den Anhänger in meiner Faust. »Danke, Gérard. Wären Sie morgen früh so freundlich und würden die Kutsche für die Baronin vorbereiten?«
»Reist die Baronin schon ab?« Er wirkte verwundert.
»Ja, es wird Zeit.«
»Ich werde mich darum kümmern.«
»Sehr gut. Gute Nacht, Gérard.«
»Gute Nacht, Euer Gnaden.«
Diese Nacht war schlimmer als die vorherigen. Ich schritt ruhelos umher und nahm immer wieder diese Kette in die Hand. Beim genaueren Betrachten fiel mir auf der Rückseite ein kleiner, sehr unscheinbarer Schriftzug auf mit den Worten: Für ein ewiges Leben.
Ich erstarrte einen Augenblick.
Diese Kette gehörte meiner Großmutter. Konnte es möglich sein, dass ich nicht der Erste war? Schnell stieg ich in die Familiengruft hinunter. Dort waren Generationen meiner Familie bestattet. Es war ein Ort mit einer finsteren, unheimlichen Atmosphäre. Mit einem Schaudern zündete ich eine Fackel an und steckte sie in einen der Wandhalter.
Ich musste es wissen!
So bekreuzigte ich mich mit einem unwohlen Gefühl und schob dann mit aller Kraft den schweren Deckel vom Sarg meiner Großmutter. Was ich dort sah, ließ mir gefühlt das Blut in den Adern gefrieren, wenn es bei mir überhaupt noch floss, dessen ich mir in diesem Moment absolut nicht sicher war. Ich sank auf meine Knie.
Ganz davon abgesehen, dass ihre Leiche kein bisschen verrottet war, hatte sie auch ein großes Loch in der Brust, und zwar dort, wo ihr Herz hätte sein sollen. Es wirkte so als hätte sie sich bis zuletzt gewehrt, denn ihre Arme waren angewinkelt, ihr Mund stand mit ausgefahrenen Eckzähnen offen und ihre Augen waren schreckensweit aufgerissen. Ich öffnete auch den Sarg meines Vaters, obwohl ich es gar nicht sehen wollte. Ihm war dasselbe angetan worden. Kein Anblick war je so grausam für mich gewesen. Mein Großvater lag friedlich, verrottend in seinem Sarg gebettet, doch an seinem Hals waren noch Bissspuren zu erkennen.
Langsam wurde das Bild der wirklichen Ereignisse klarer.
Doch war es mein Vater gewesen, der ihn so zugerichtet hatte, sein eigener Sohn?
Ich sah in alle vorhandenen Särge. Es zog sich bis zu meinem Ururururgroßvater väterlicherseits.
Mit Schrecken drückte ich mich an eine Wand, denn mir war als würde ich mein eigenes Ende in ihnen sehen.
Auf einmal bemerkte ich, dass mein Vater auf etwas zu liegen schien. Ich zog ein großes, dickes, in schwarzes Leder gebundenes, blutiges Buch unter seinem Rücken hervor mit einer viel älteren, viel primitiveren Version unseres Familienwappens. Als ich es aufschlug, bemerkte ich jedoch, dass es sich nicht nur um ein Buch, sondern um mehrere Bücher hintereinander handelte - eine Sammlung. Eine Sammlung von Tagebüchern, die sehr weit zurückreichten.
Ich verschloss die Särge und studierte die Aufzeichnungen in meinem Gemach. Es schien so als wäre unsere Linie weit älter als die Schrift selbst. Jedenfalls waren die Informationen von Generation zu Generation weitergegeben worden. Unsere Familie war schon immer so.
Es hieß, es hätten sich die Menschen entwickelt, zeitgleich mit uns. So wie es auch schon immer Raub- und Beutetiere gab. Ein Ausgleich der Natur.
Ich erfuhr alles mögliche von meinen Vorfahren.
Auch wir hatten uns weiterentwickelt. Waren wir doch zu Beginn noch sterblich und wurden dann erst nach Jahrhunderten unsterblich. Damals war es uns noch möglich, mit den Menschen unerkannt zusammenzuleben, doch dann wurde die Blutgier stärker als wir. Sie war unser einziger Feind gewesen, doch dann begannen die Menschen sich zu wehren und Methoden zu entwickeln, uns zu vernichten. Die effektivste war das Herausschneiden des Herzens. Wir hatten tatsächlich zirkulierendes Blut im Körper, wenn es auch nicht mehr unser Eigenes war, sobald wir starben. Deswegen war es für uns lebensnotwendig, das Blut von anderen aufzunehmen.
Wir mussten sterben und dann Blut trinken, um so zu werden. Es war also vererbbar und nicht ansteckend.
Neue Generationen überlebten immer kürzer, weil sie ihre Gier nicht mehr unter Kontrolle hatten. Mein Urgroßvater hatte dreihundert Jahre gelebt, meine Großmutter hundert, mein Vater nur noch zweiunddreißig.
Ich sah alles darauf hindeuten, dass ich der Nächste wäre.
Das durfte nicht geschehen.
Ich wollte noch nicht endgültig sterben - und dann auch noch auf so brutale Weise. Davor graute es mir.
Nein, ich musste mir etwas überlegen, um zu überleben und unentdeckt zu bleiben.
Meine Großmutter und mein Vater hatten einige der Dienerschaft in Verdacht gehabt, die möglicherweise davon gewusst hatten. Ich notierte mir die Namen. Unter anderem war auch Gérards dabei. Das machte durchaus Sinn. Er war am längsten in diesem Haushalt tätig. Das bedeutete, er musste unweigerlich irgendetwas darüber wissen.
Was sollte ich nun tun? Alle auf der Liste zu entlassen war sicherlich keine Lösung.
Das wäre viel zu offensichtlich gewesen.
Ich musste mich einfach ganz normal verhalten, immer auf der Hut sein und vorsichtig handeln. Vor allem aber musste ich das mit dem Blut in den Griff bekommen …
Auf einmal fiel mir eine Abbildung der Kette meiner Großmutter ins Auge. Sie sollte dem liebsten Menschen um den Hals gehängt werden. Die Kette würde denjenigen vor dem Tode und vor der Blutgier unseresgleichen beschützen.
03. Dezember 2023
Am Morgen nach der zuvor beschriebenen Nacht, sah ich, wie Veronica aus dem Haus schritt und meine Dienerschaft ihr Gepäck auf die Kutsche lud.
Ich überwand mich und ging hinunter. Schließlich wäre das von mir zu erwarten gewesen.
»Veronica! Warten Sie!«
Sie stieg in die Kutsche und sah mich an. »Ich freue mich, dass Sie doch noch gekommen sind, Eduard.«
»Ich möchte mich wenigstens von Ihnen verabschieden, obwohl ein Lebewohl noch nie zu meinen Stärken gehörte.
Hören Sie, Veronica, es tut mir leid.«
»Ich weiß.« Sie schenkte mir ein charmantes Lächeln. »Sie könnten uns ja mal besuchen kommen! Ich würde mich sehr darüber freuen.«
»Das werde ich mit Freuden tun.«
»Dann ist dies kein Lebewohl. Auf bald, Eduard.«
»Auf bald, Veronica.« Ich schloss die Kutschtür und sah der Kutsche ein wenig missmutig nach.
Nun war ich wieder ganz alleine - möglicherweise umgeben von meinen schlimmsten Feinden, die ich noch nicht als solche erkennen konnte.
Ich ließ Tage und schließlich Wochen vergehen. Nichts geschah, außer dass mein Durst stärker wurde und mich fast in den Wahnsinn trieb. Blut war das, was ich brauchte, doch es war in vielerlei Hinsicht zu gefährlich. Ein Anflug von Schwäche überkam mich jedoch bereits.
So ging ich in den Wald. Ich behauptete, ich ginge jagen, was im Grunde ja auch der Wahrheit entsprach. Ich konnte einen Puls inzwischen kilometerweit hören und das Blut riechen. Tierblut roch zwar nicht so stark, doch es müsste ausreichen. Ich wusste nicht, ob das funktionieren konnte.
Das hatte noch keiner meiner Vorfahren versucht.
Mit meinen bloßen Zähnen riss ich einen Wolf. Das Blut löste zwar keinen Rausch aus, doch es musste mir genügen.
Ich wollte keine unschuldigen Menschen verletzen.
Tatsächlich verschwand auch das Hungergefühl und die Jagdinstinkte.
Ich sah mit blutverschmiertem Mund Zähne bleckend auf das tote Tier vor mir. Es machte mich stolz. Ich fühlte mich mächtig und unbesiegbar. Ein Gefühl, das ich noch nie zuvor gekannt hatte.
Eines Tages, es war ein Jahr vergangen seit Veronicas Aufbruch, kam ich an der Küche vorbei, wo die Dienstmädchen mit der Köchin redeten.
»Ich weiß. Das habe ich bereits gehört. Die arme Frau.«
»Der Baron soll sie nicht allzu gut behandeln, habe ich gehört. Da sie ihm nicht beiliegen wollte, hat er wohl Hand an sie gelegt.«
»Nein, wie furchtbar!«
Entsetzt trat ich ein. »Reden Sie über die Baronin? Über Veronica?«
Die sechs Frauen drehten sich erschrocken um. »Euer Gnaden! … Ja, über die Baronin. Sie wird wohl einfach nicht schwanger und das missfällt dem Baron.«
»Es missfällt ihm«, wiederholte ich spottend und lief nach einem Kopfschütteln los. »Gérard! Ist mein Pferd noch gesattelt?«
»Ja, Euer Gnaden. Doch wo wollen Sie denn hin?!«
»Ich statte unserem Nachbarn einen längst überfälligen Besuch ab!« So schwang ich mich auf mein Pferd. »Ya!«
Ich verlor keine Zeit und als ich dort ankam, saß der korpulente, unsympathische Baron auf seiner Terrasse und beugte sich über ein Schachbrett. Er konnte kaum aufstehen, als er mich sah.
»Der Duke! Welch Überraschung, Vanish!«
»Ich dachte, ich statte Ihnen einen spontanen Besuch ab.«





























