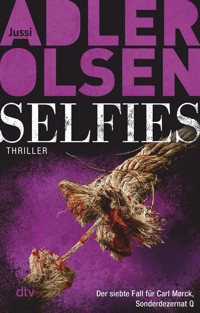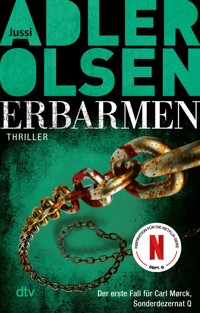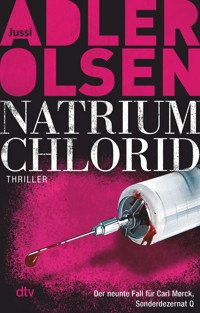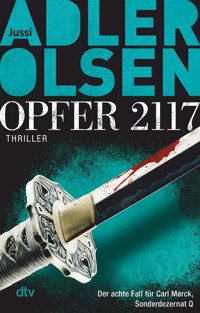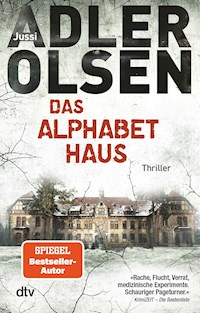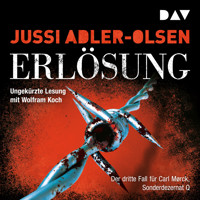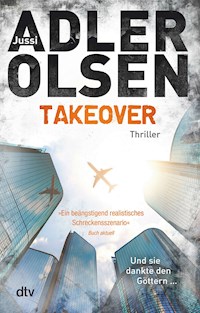
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
In den Fängen einer internationalen Verschwörung Ein brisanter Thriller um persönliche Verstrickungen in einer immer undurchsichtiger werdenden politischen Wirklichkeit. Jussi Adler-Olsens Politthriller hält unserer Zeit den Spiegel vor. Nach den Bestsellern ›Das Alphabethaus‹ und ›Das Washington-Dekret‹ der dritte Stand-Alone von Jussi Adler-Olsen. Ein Mann, der professionell Unternehmen vernichtet. Eine Frau, die sich von ihrer Vergangenheit befreit. Eine Liebe in den Zeiten des Terrors. Geschäftsmann Peter de Boer gehört definitiv nicht zu den Guten: Er lebt im Schatten einer ungeheuren Schuld. Als der irakische Geheimdienst ihn beauftragt – oder vielmehr: nötigt – einen international tätigen Ölkonzern zu zerschlagen, wird sein Albtraum Wirklichkeit. Er droht in einem Strudel aus globalem Terror, Machtpolitik und Wirtschaftskriminalität zu versinken. Wäre da nicht Nicky Landsaat, eine rätselhafte junge Frau mit glänzendem Verstand. Wie schwer wiegt das Gewissen eines Menschen, wenn die Welt in Schuld versinkt? Jussi Adler-Olsen beschwört die Angstszenarien der Gegenwart und schafft eine Wirklichkeit, aus der es kein Entrinnen gibt. »Ein beängstigend realistisches Schreckensszenario.« Buch aktuell »Adler-Olsen mischt gekonnt und szenenschnell Politik, Wirtschaft und Soziologie, Nahostkonflikt, Finanzkrise und Terrorismus mit wilden Verfolgungsjagden, Bränden und Explosionen.« Regina Krieger, Handelsblatt Neben der Carl-Mørck-Reihe sind bei dtv außerdem folgende Titel von Jussi Adler-Olsen erschienen: - ›Das Alphabethaus‹ - ›Das Washington-Dekret‹ - ›Miese kleine Morde‹
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 729
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Jussi Adler-Olsen
TAKEOVER
Und sie dankte den Göttern
Thriller
Aus dem Dänischen von Hannes Thiess
Deutscher Taschenbuch Verlag
Auch wenn die meisten Ereignisse und Personen in diesem Roman fiktiv sind, folgen sie doch in hohem Maße Vorbildern in der Realität. Mehr dazu im Vorwort.
Vorwort
Große Ereignisse sind oft nichts weiter als ein Glied in einer Kette, und nicht immer landet die wichtigste Nachricht auf der ersten Seite der Tageszeitung. Würde man auch Randnotizen hin und wieder ernst nehmen, ließen sich manche Katastrophen womöglich verhindern. Doch wer kann die Relevanz von Ereignissen schon im Vorhinein bewerten?
Der Terrorangriff auf das World Trade Center am 11. September 2001 stellt eine Zäsur in der Weltgeschichte dar: Es gibt nur noch die Zeit vor und nach dem Attentat. Lange war man ausschließlich mit der Aufarbeitung der Katastrophe beschäftigt – doch nach und nach fügte sich eine Reihe anderer, weniger spektakulärer Ereignisse zu einer Kausalkette zusammen. Auch sie werden früher oder später in den Schlagzeilen landen, meist dann, wenn man es am wenigsten erwartet, und vielleicht in Zusammenhängen, die einem erstaunlich vorkommen.
Der Terror hat viele Gesichter. Epidemien, Naturkatastrophen, Börsencrashs: Schicksal? Menschliches Versagen? Alles ist möglich.
Doch solange es Menschen oder Institutionen gibt, die von einer Katastrophe profitieren, muss man genauer hinschauen. Als 1986 beim Pharmakonzern Sandoz durch ein Leck große Mengen Cyanid in den Rhein gelangten, beschlich viele Menschen ein ungutes Gefühl. Wer hätte einen Vorteil davon haben können? Die Konkurrenz – natürlich. Doch würde man aus rein wirtschaftlichem Interesse zu einem solchen Mittel greifen? Während ich am vorliegenden Buch schrieb (die Arbeit war wenige Monate vor dem Angriff auf das World Trade Center abgeschlossen gewesen), kam tatsächlich ans Licht, dass die Stasi damals hinter dem Vorfall bei Basel stand – im Auftrag des KGB. Man wollte die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit von der Katastrophe in Tschernobyl ablenken, die ein halbes Jahr zuvor die Welt erschüttert hatte. Nicht einmal die lebhafteste Schriftstellerfantasie hätte sich etwas so Erbärmliches ausdenken können.
»Manipulationen« in großem und in kleinerem Maßstab finden jeden Tag statt. Internationale Firmen sorgen gezielt für eine Art Gleichgewicht der Macht, bereits »kleinere« Terroranschläge beeinflussen die Aktienkurse in ähnlicher Weise wie der Tod eines Wirtschaftsmagnaten. Für eine Schlagzeile auf den Titelseiten der großen Medien genügt das jedoch nicht.
Denken wir das einmal weiter: Was wäre, wenn Personen oder Gruppen, ausgestattet mit entsprechender Macht, sich zum Ziel setzten, Unternehmen zu zerschlagen – aus den unterschiedlichsten Gründen: wirtschaftlichen, politischen, historischen Gründen. Wer sind diese Mächte? Wie gehen sie vor? Und: Wer weiß von ihnen?
Davon unter anderem handelt dieses Buch. Eingeflochten in eine fiktive Geschichte sind eine ganze Reihe realer Ereignisse einschließlich solcher, deren wahre Hintergründe im Dunkeln liegen, denen in einem Roman aber denkbare Ursachen zugesprochen werden dürfen.
Die Geschichte spielt im Jahr 1996. In jenem Jahr schlug ein gut aufgelegter Bill Clinton, den eine gewisse Monica Lewinsky noch nicht kompromittiert hatte, Bob Dole aus dem Feld. Im selben Jahr herrschte nach den Friedensvereinbarungen um Bosnien halbwegs Frieden auf dem Balkan, und auch in Israel fanden – trotz der Ermordung Yitzhak Rabins ein Jahr zuvor – Friedensgespräche statt. In jenem Jahr nahm Masud Barzani, der Anführer der Kurden, Kontakt auf zu Saddam Hussein und bat ihn, Kurdistan von rivalisierenden Gruppen zu säubern.
Es war ein Jahr voller Randnotizen.
Prolog
Der Fernseher war fast den ganzen Nachmittag über im Hintergrund gelaufen, aber als die Sportsendung begann, schalteten sie ihn aus. Für Sport interessierte sich keiner der vier.
Der Jüngste wischte die Zigarettenasche von der Wachstischdecke und teilte routiniert die Spielkarten aus.
Jamshid Solimann zählte die Asse in seiner Hand, seine beiden Brüder ordneten konzentriert ihre Karten. Die Zigaretten im Mundwinkel, die Augen im Rauch zusammengekniffen, gaben sie sich alle Mühe, cool zu wirken. Unauffällig gab Jamshid seinem Schwiegervater ein Zeichen. Spiel Pik aus, Shivan, sagte sein Blick.
Der Alte nickte kaum merklich, er hatte verstanden – das waren die Fähigkeiten eines alten Soldaten: angreifen und gewinnen. In der Hinsicht waren sich die beiden sehr ähnlich, Jamshid und sein Schwiegervater.
Shivan hatte gerade den Pikbuben auf den Tisch gelegt, als es plötzlich dunkel wurde. Alle vier blickten gleichzeitig zum Fenster. Nur Millisekunden später sahen sie, Jamshid und die drei anderen, wie sich der gewaltige Jumbojet neigte und ungebremst in das Hochhaus gegenüber raste. Wie der Funkenflug die herbstliche Dämmerung in hellen Tag verwandelte. Wie die Explosion und das anschließende Flammenmeer das Haus vor ihren Augen wie in Zeitlupe zum Einsturz brachten. Die Druckwelle sprengte die Glasscheiben. Binnen eines Atemzuges hatten Hunderte von Menschen alles verloren.
Die Männer sahen den schwarzen Rauch und die Trümmer und den Schutt auf der verkohlten Wiese inmitten des Bijlmermeerkomplexes, aber dass die Glassplitter sie selbst verletzt hatten, spürten sie nicht.
»Allmächtiger Allah!« Jamshid deutete auf die Außenhaut des Flugzeugs, die sich in der Hitze der Stichflammen auflöste. Sie alle kannten den türkisblauen Streifen: man kannte ihn einfach, wenn man aus dem Nahen Osten kam.
Und so rannten sie hinunter auf den Platz und ignorierten die Panik und die Schreie der Menschen. Es war der türkisblaue Streifen, der sie veranlasste, unbeirrt die herumliegenden Kisten einzusammeln.
Es war das Jahr 1992. Zwei Monate später waren alle vier tot.
1
Nicky Landsaat hatte ihr Leben lang in ein und demselben Haus in Amsterdam gewohnt. Siebenundzwanzig Jahre in nächster Nähe zu den Kanälen, inmitten von alten Häusern mit abblätternden Fassaden, nur fünf Schritte entfernt vom Rotlichtviertel.
Der einzige Weiße in diesem Haus war ein fantasievoll, aber vulgär tätowierter Kerl, einer, der wusste, wie man Frau und Kindern das Leben zur Hölle machte. Er war ein Arschloch, aber: Er war Nickys Vater.
Nur wenige hundert Meter von Amsterdams Fußgängerzone entfernt, dort, auf der Schattenseite der Stadt, waren Nicky und ihre Geschwister aufgewachsen.
Es gab in dieser Straße weder Türken noch Afrikaner oder Deutsche. Auf der sozialen Stufenleiter unter ihnen rangierten einzig die wenigen Menschen aus Surinam.
Nicky Landsaat war der Inbegriff eines Mischlings. Die markanten Gesichtszüge hatte sie von ihrer molukkischen Mutter, von ihrem Vater die hochgewachsene Gestalt. Auf den Laufstegen von Paris oder New York mochte das von Vorteil sein, in diesen Gassen Amsterdams jedoch brachte es nur Probleme mit sich. Nicky vereinte in sich die unterschiedlichsten Eigenschaften: So war sie einerseits offen, sensibel und wissbegierig – doch es gab auch diese andere Seite, die sie manchmal unberechenbar machte.
Als Teenager wurde sie, die Exotische, von den Jungen umschwärmt, sie, die so ganz anders, so unbekümmert war, lebhaft und fröhlich, Nicky mit ihrem stolzen, federnden Gang.
Doch da Nicky gar kein Interesse an ihnen zeigte, zogen sich die jungen Männer schon bald von ihr zurück.
Sie hatte genug damit zu tun, sich innerhalb ihrer Familie in einer Atmosphäre von Gleichgültigkeit und allgegenwärtigen Spannungen und Konflikten abzugrenzen. Früh schon hatte sie sich eine Gegenwelt geschaffen. Mit Büchern und Zeitschriften träumte sie sich hinaus in ein anderes Leben. Als Einzige in der Familie benutzte sie den Mädchennamen ihrer Großmutter väterlicherseits, Landsaat. Denn de Jong wie der Vater wollte sie auf keinen Fall heißen.
Sie setzte auf Distanz. Und auf eine gute Ausbildung – und so entschloss sie sich zum Studium an der Handelshochschule. »Ich bleibe hier, bis ich fertig bin und eine Arbeit gefunden habe.« Mehr hatte sie der Familie dazu nicht zu sagen.
Es gab einen Riesenkrach, der damit endete, dass Nicky regelmäßig einen Betrag abdrückte, der dem Vater unter anderem eine wöchentliche Flasche Genever zusätzlich sicherte. Sie wusste: Das war eine gute Investition und wahrscheinlich der einzige Weg, diesem Milieu später einmal zu entkommen.
Sie erinnerte sich an andere Zeiten. Doch als ihr Vater seine Arbeit verlor, begann der klassische Abstieg: Erst die Leere, dann der Alkohol – ihr Vater sank tiefer und tiefer, Gewaltexzesse waren nahezu an der Tagesordnung. Und da war keine Mutter, die sich schützend vor ihre Kinder gestellt hätte, nein, die Mutter war selbst zu schwach.
Doch Nicky biss die Zähne zusammen: Sie brauchte eine gute Ausbildung, um sich eine Zukunft aufzubauen, weit entfernt von dieser elterlichen Hölle.
Und dann war es endlich so weit: Nickys Examensnoten waren so gut, dass die aus besseren Verhältnissen stammenden Kommilitonen auf der Handelshochschule vor Neid erblassten. Nicky hatte das Gefühl, endlich aus dem Schatten heraustreten zu können. Nicky, der Mischling, noch ungeküsst.
Jetzt wollte sie nur noch weg.
Nickys Bruder Henk hatte einen anderen Weg gewählt: Er bestritt seinen Lebensunterhalt mit Taschendiebstählen. Sein Revier reichte bis zu den Villen von Weesp, sein Spezialgebiet: Touristen mit offener Handtasche oder der Geldbörse in der Gesäßtasche.
Henk war der Liebling des Vaters. Konnte reden wie die Moderatoren im Fernsehen, und nur wenige Frauen im Viertel hatten ihre Brüste noch nicht in seine Hände geschmiegt.
Illusionen hatte Henk keine, und zarte Worte wie Liebe, Gefühl und Romantik waren ihm fremd. Nicky und Henk lebten in zwei Welten. Nicky schämte sich für das, was er tat, und er hatte nichts als Verachtung übrig für seine Schwester.
Eines Tages, Henk präsentierte gerade stolz den Lohn seiner Tagesarbeit, saß Nicky vor dem Fernseher und sah zum ersten Mal in das Gesicht jenes Mannes, der ihr Leben für immer verändern sollte.
»Der Geschäftsmann Peter de Boer, der seit letzter Woche als Drahtzieher im Zusammenhang mit der Insolvenz des Unternehmens Van Nieuwkoop Holding in Eindhoven gilt, wurde kurz vor Mitternacht vor seinem Privathaus überfallen«, lautete die lakonische Nachricht. Die Sprecherin ordnete routiniert die Papiere vor sich auf dem Tisch. Im Hintergrund wechselte das Bild von einer Porträtaufnahme des Betroffenen zu einem Foto der prunkvollen Haustür, vor der der Überfall stattgefunden hatte. »Der Täter hatte Peter de Boer vor seinem Wohnsitz im Zentrum von Haarlem aufgelauert. Beim Überfall mit einem Machete-artigen Messer auf den Geschäftsmann direkt vor dessen Haustür konnte der Täter von Passanten überwältigt werden.«
An dieser Stelle wurde ein Ausschnitt aus einem älteren Interview mit de Boer eingeblendet. Und das war der Moment, in dem es in Nickys Kopf »klick« machte.
Wie gebannt starrte sie in die Augen eines Mannes, den sie nie zuvor gesehen hatte – dessen Anblick sie jedoch in einem Maße überwältigte, dass sie einen Entschluss fasste.
Nicky wusste genau, wie sie vorgehen wollte. Sie hinterfragte ihren Plan keine Sekunde.
Sie durchsuchte die Stellenanzeigen des ›Telegraaf‹, und tatsächlich: Peter de Boers Firma brauchte neue Mitarbeiter.
Nicky hielt ihre Bewerbung kurz und knapp.
Zu dem Auswahltest waren lauter hippe junge Menschen angetreten, die Ledermappen bei sich trugen und nicht so eine zerschlissene Leinentasche wie Nicky. Die Bewerber mussten im Rahmen eines Assessment-Centers mehr als zweihundert Fragen schriftlich beantworten.
Bis das Ergebnis kam, waren vier Wochen verstrichen.
Nickys Herz schlug schneller, als sie auf der Heizung in der Küche die Ecke eines weißen Briefumschlags entdeckte, die aus dem Stapel Reklameblätter hervorlugte. Flecken und Ränder auf dem Umschlag dokumentierten seinen Weg vom Briefschlitz bis zur Küche und dort von einem Papierstapel auf den nächsten.
»Verdammt! Wie lange hat der hier schon gelegen?«, flüsterte sie und bemühte sich, das Datum des Poststempels zu entziffern. Es lag einige Tage zurück. Alarmiert öffnete sie den Umschlag.
Amsterdam, den 9. August 1996
Sehr geehrte Mevrouw Landsaat,
nach gründlicher Prüfung Ihrer Unterlagen und vor dem Hintergrund Ihrer ausgezeichneten Zeugnisse sowie des fehlerfrei abgelegten Tests freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie für die Teilnahme am nächsten Traineekursus bei Christie N.V. vorgesehen sind.
Die monatliche Vergütung während der Ausbildung beträgt 8.000 Gulden.
Hans Blok
Leitung Finanzen
Christie N.V.
Nicky biss sich auf die Lippe. Das war eine Menge Geld.
Der Wunsch, ihr Glück laut hinauszuschreien, war fast übermächtig, doch sie riss sich zusammen. Beim Weiterlesen stockte ihr der Atem.
Zeitraum: 20. August bis 12. Dezember 1996
Einführung: 19. August, 12.30 Uhr
Kleidung: gedecktes Kostüm, dunkle Schuhe
Anmeldung: bis spätestens 16. August 1996, 10 Uhr
Unwillkürlich warf sie einen Blick auf die Uhr. Es war eins. Die Frist war abgelaufen.
Vor zwei Tagen und drei Stunden.
2
»Entschuldigen Sie, dass ich Sie habe warten lassen, Meneer de Boer.« Schwerfällig ließ sich der Kriminalassistent in den Stuhl hinter seinem Schreibtisch sinken. »Vermutlich ahnen Sie, warum ich Sie auf die Wache bestellt habe?«
»Wahrscheinlich geht es um den Überfall. Aber sind wir die Geschichte inzwischen nicht oft genug durchgegangen?« Peter bemühte sich, mit dem Beamten Blickkontakt aufzunehmen. »Der Mann wurde doch gefasst und hat gestanden. Er wurde gleich während der Tat vor meinem Haus gestellt. Es gab einen Prozess, er wurde verurteilt.«
»Der Täter heißt Bert Vergger. Sie kennen ihn von früher.«
Peter zuckte die Achseln. Ja, gut, und?
»Heute Morgen um 3 Uhr 45 hat Bert Vergger versucht, sich das Leben zu nehmen.« Der Kriminalassistent blickte in seine Unterlagen. »Man fand ihn in seiner Zelle, in seinem Hals steckten Stoffstreifen von seiner Unterwäsche.«
So was geht?, dachte Peter. »Ach. Das tut mir leid«, sagte er.
Der Kriminalassistent blickte auf. »Wirklich?«
»Ja.«
»Meneer de Boer, Sie haben das Unternehmen, in dem Bert Vergger gearbeitet hat, ruiniert. Fast zweihundert Männer wurden arbeitslos, als in der Van Nieuwkoop Holding das Licht ausging. Tut Ihnen das auch leid?«
»Es waren zweihundertneun, und zwar Männer und Frauen.«
»Das wissen Sie sicher besser als ich.«
»Darüber wollten Sie mit mir sprechen?«
»Vergger hat eine Frau und zwei Kinder.«
Das haben mindestens ein Sechstel aller Männer auf der Erde, dachte Peter und sah auf seine Armbanduhr. »Würden Sie mir bitten sagen, worauf Sie hinauswollen? Wenn Sie der Meinung sind, ich müsse etwas bereuen – das habe ich begriffen. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es Bert Vergger war, der versucht hat, mich mit einer Machete umzubringen – nicht umgekehrt.«
»Es ist ihm zum Glück nicht gelungen, aber Ihnen ist es gelungen, die Firma, für die er arbeitete, eine der besten IT-Firmen des Landes, zu zerschlagen.«
»Sie kennen die Firma? Oder jemanden, der dort angestellt war?«
Der Kriminalassistent antwortete nicht. Peter zuckte erneut die Achseln. Die Welt war klein. »Es gibt eine Menge erstklassiger IT-Firmen. Firmen, die darauf verzichten, Software an Embargo-belegte Länder wie den Irak zu verkaufen.«
»Wer wem was verkauft, weiß ich nicht, damit habe ich nichts zu tun. Sie sollen lediglich wissen, dass Ihnen Bert Vergger in Zukunft keine Probleme mehr bereiten wird. Wie lange er schon in seiner Zelle lag, bevor er gefunden wurde, weiß man nicht. Um vollständig zu genesen, war er zu lange bewusstlos. Von diesem Suizidversuch wird er sich nie mehr ganz erholen. Der Fall ist abgeschlossen, de Boer. Sie können sich neuen Aufgaben zuwenden.«
Peter blieb noch einen Moment sitzen, er überlegte, ob er noch einmal sein Bedauern über Bert Verggers Schicksal ausdrücken sollte, vielleicht in Form einer Art Kompensation für die Familie. Ein Trostpflaster. Oder sollte er ihr vielleicht einfach anonym eine größere Geldsumme zukommen lassen?
Unwillkürlich zog er die Mundwinkel nach unten und schüttelte den Kopf. Dann stand er auf und nickte dem Kriminalassistenten zu.
»Einen Augenblick noch, de Boer. Wir hier bei der Polizei mögen Ihre Methoden nicht, das sollten Sie wissen. Nicht wenige Angehörige von Kollegen sind von Ihrem ›Geschäftsmodell‹ betroffen. De Boer, Sie stehen unter genauer Beobachtung, das kann ich Ihnen versichern.« Damit wandte er sich den Papieren auf seinem Schreibtisch zu.
Peter hätte ihm gern eine reingehauen.
Draußen vor dem großen roten Backsteingebäude am Koudenhorn zwei, in dem die Polizeidienststelle untergebracht war, saß Heleen im Auto und wartete auf ihn.
Die Gruppe hatte sich komplett um den Tisch im größten Konferenzraum der Firma versammelt. Peter hatte Christie N.V. vor fünfzehn Jahren gegründet und gemeinsam mit den meisten der Anwesenden aufgebaut. Entsprechend leger war ihr Umgangston.
Als er eintrat, erhob sich seine Sekretärin, Linda Jacobs, und die Gespräche verstummten. Eine geschlagene Stunde warteten sie schon auf ihn. Nur Thomas Klein, der Chef der juristischen Abteilung, wagte es, ihn direkt anzusehen.
Peter nahm grußlos Platz, kein Wort der Entschuldigung. »Wir wollen uns als Erstes den Kakaz-Fall vornehmen und ihn für Rob skizzieren.« Er blickte zum Leiter der Marketingabteilung, der gerade gut erholt und braun gebrannt aus dem Urlaub zurückgekommen war.
»Unser Klient heißt Benjamin Holden, er ist Amerikaner, lebt in den Niederlanden und besitzt eine Schuhfirma mit Namen SoftGo. Er hat uns die Aufgabe übertragen, Kakaz, einen konkurrierenden Schuhfabrikanten, vom Markt zu entfernen. Das ist nicht unproblematisch, denn Kakaz läuft gut und ist mit seinen Aktivitäten breit aufgestellt.« Peter gab der Leiterin der technischen Abteilung ein Zeichen, sie möge fortfahren. Karin Dam erhob sich. Dass viele Stunden intensiver Arbeit hinter ihr lagen, ließ sich leicht an ihren müden Augen ablesen.
»Die Muttergesellschaft von Kakaz ist hier in Amsterdam zu Hause«, begann sie. »Es gibt vierzig Angestellte in Verwaltung, Entwicklung und Vertrieb. Die Schuhproduktion selbst erfolgt durch zwei Subunternehmen, eines in Portugal, ein zweites auf Java, in beiden sind zusammen gut dreihundert Arbeiter beschäftigt.«
Peter unterbrach sie. »Die Produktionskosten von Kakaz sind außerordentlich niedrig, und die indonesische Produktion läuft wie geschmiert. Zu unserem Glück haben wir aber vor wenigen Tagen entdeckt, dass der portugiesische Teil der Produktion staatliche Subventionen erhält, und die laufen im nächsten Jahr aus.« Er bedeutete Karin Dam mit einem Kopfnicken, wieder zu übernehmen.
»Mit der Produktion des letzten Jahres erzielte Kakaz einen Rekordumsatz von 110 Millionen Gulden.« Sie schrieb die Zahl an das Whiteboard hinter ihr. »Was einer Umsatzrendite von rund zehn Millionen Gulden entsprach.«
Peter sah in die Runde. Früher wären seine Mitarbeiter bei einer Zahl dieser Größenordnung schier ausgerastet, aber im Lauf der Jahre hatten sich die Dimensionen verschoben.
Karin Dam fuhr fort. »Unser Honorar für die Marktbereinigung ist um einiges höher als sonst.«
Peter legte die Aktenmappe aus der Hand. »Wir bekommen elf Komma fünf Millionen Gulden. Alles klar?«
Die Versammlung nickte.
»Stellt sich die Frage, ob SoftGo auch wirklich das Geld hat, um uns zu bezahlen?« Er wandte sich an Thomas Kleins blassen, tadellos frisierten Sekretär. »Jetzt bist du an der Reihe, Matthijs. Wie sieht’s denn aus bei SoftGo?«
Der junge Mann räusperte sich. Ein Zucken seines Kinns ließ die Antwort bereits ahnen. »Soweit ich sehe, kann SoftGo nicht zahlen.«
»Keine Sicherheit über fünf Millionen Gulden, wie von uns verlangt?«
»Nein, jedenfalls nicht durch eine Bank. Die fünf Millionen sind allerdings in bar hinterlegt.«
»In bar? Ausgeschlossen, das machen wir nicht. Das ist zu heiß. Und du hast keine Lösung für das Problem?«
»Nein.« Matthijs Bergfeld versuchte angestrengt, seinen Blick nicht zu senken.
»Elf Komma fünf Millionen – das ist eine Menge Geld, Matthijs.«
»Ja. Natürlich.«
»Und da ist nichts zu machen?«
»Nein, ich fürchte, nicht.«
Peter ließ den Blick wandern. Niemand hatte dem etwas hinzuzufügen, auch nicht Thomas Klein, der bloß lächelnd die Schultern zuckte, wie immer unerschütterlich.
»Kommst du mal mit in mein Büro, Thomas?« Ohne eine Antwort abzuwarten, stand Peter auf und öffnete die Tür. »Bitte entschuldigt uns für einen Moment.«
Zwar war Peter fast einen Kopf größer als die meisten, aber um den arroganten Blick dieses selbstgefälligen Kolosses von einem Juristen einzufangen, musste selbst er nach oben schauen. Aus diesem Grund sagte er: »Nimm doch Platz, Thomas.«
Sie sahen sich eine Weile schweigend an.
»Du wirst Matthijs kündigen, Thomas. In deiner Freizeit kannst du deine Hand in seine Hose stecken, so viel du willst, aber hier wirst du auf ihn verzichten müssen.«
»Du bist verrückt! Er ist der beste Mann bei uns!« Entspannt kraulte Klein sein Doppelkinn.
»Elf Komma fünf Millionen Gulden, Thomas! Eine Menge Geld, von dem wir uns da verabschieden müssen. Du hältst dir einen teuren Geliebten.«
»Jetzt lass mal die Kirche im Dorf. SoftGo kann uns nicht bezahlen, ganz einfach. Dafür kannst du doch Matthijs nicht verantwortlich machen.« Er nahm seine Hand vom Kinn. »Hör zu, Peter. Das Projekt ist mit einem riesigen personellen Aufwand kalkuliert. Wir haben andere Projekte, die uns weniger Mühe machen würden. SoftGo soll Kakaz oder meinetwegen sich selbst zerschlagen, aber ohne unser Mitwirken. Matthijs hat recht.« Klein lehnte seinen massigen Körper etwas zu vertraulich nach vorn. Peter de Boer drückte die Sprechanlange.
»Verbinde mich mit SoftGo, Linda. Sag ihnen, Thomas Klein möchte mit ihrem Direktor, Benjamin Holden, sprechen. Bitte sofort, wir warten.«
Klein schüttelte den Kopf. »Das wird doch nichts bringen, Peter. Warst du es nicht, der uns beigebracht hat, aufzuhören, solange das Spiel noch gut läuft?«
»Und was habe ich euch sonst noch beigebracht? Dass ihr improvisieren sollt! Das ist genau der Grund, weshalb ich es nicht leiden kann, dass die juristische Abteilung sich so verdammt in den Vordergrund gespielt hat. Ihr könnt einfach nicht improvisieren. Juristen scheinen dazu nicht in der Lage zu sein.« Peter lehnte sich zurück. »Ihr wisst doch, was ich von euch will, oder?«
Klein setzte an zu protestieren, ließ es dann aber sein.
»Und ihr habt die verdammte Pflicht, euer Bestes zu geben, Thomas. Davon leben wir. Entweder liefert SoftGo seriöse Sicherheiten, oder wir verlangen Aktienoptionen oder abgeschlossene Verträge. Ab sofort gelten wieder meine Spielregeln, Thomas. Und was Matthijs Bergfeld betrifft: Ich will ihn in der Abteilungsleiterrunde nicht mehr sehen, klar?«
Klein rieb sich ein Auge. Er war zufrieden, das war nicht zu übersehen. Der Riese durfte seinen hübschen kleinen Assistenten also behalten.
Als das Telefon klingelte, griff Klein zum Apparat. Mit hochgezogenen Augenbrauen hörte er zu. Schließlich reichte er den Hörer an Peter weiter. »Das hier ist nicht Benjamin Holden, sondern eine amerikanische Anwaltskanzlei. Ich meine, er hätte gesagt, Lawson & Minniver. Sagt dir das etwas?«
Peter schüttelte den Kopf.
»Es geht um Kelly.«
»Kelly?« Peter wurde schlagartig heiß, Unbehagen machte sich in ihm breit. Warum rief jemand wegen Kelly an? Nach so vielen Jahren? Er nahm den Hörer.
Die Stimme klang monoton und selbstbewusst.
Nachdem er aufgelegt hatte, starrte Peter vor sich hin, sein Herz raste. Jetzt weit weg sein, ganz weit weg. Alles hinter sich lassen – die Arbeit, den Kriminalassistenten, das Bild eines Mannes, dem Stofffetzen im Rachen stecken. Und ganz bestimmt auch das hier.
Klein versuchte, Peters Miene zu deuten. »Und?«
Peter zögerte. »Offenbar etwas Neues.«
»Dann lassen wir SoftGo also fallen?«
Peter betrachtete einen Moment seine Hand, die ziellos über den Tisch strich. Die Handfläche war feucht. Er holte tief Luft. »Das eben hat keinerlei Einfluss auf unseren Auftrag von SoftGo oder auf unsere anderen Projekte. Das ist rein privat.«
Klein schob die Unterlippe vor. »Soll ich mich darum kümmern?«
»Vielleicht.« Peter versuchte, die Erinnerungen zu verscheuchen. Erinnerungen an eine Frau, die sich einst seiner Träume bemächtigt hatte. Erinnerungen an Kelly.
»Was ist das mit Kelly, Peter? Was hat das zu bedeuten?«
»Das erzähle ich dir, wenn ich mich entschieden habe, ob du dich der Sache annehmen sollst.«
»Unannehmlichkeiten?«
»Später, Thomas.« Er deutete auf das Telefon auf dem Mahagonitisch, das schon wieder klingelte.
Klein nahm den Anruf entgegen und nickte. Der Eigentümer von SoftGo ließ sie nicht unnötig lange warten.
Kleins Gesicht glänzte speckig, aber er wirkte konzentriert und ruhig. Er machte sein Anliegen kurz und knapp deutlich, hörte den Protesten seines Gesprächspartners geduldig zu, wand erneut seine Worte um dessen Kehle, nickte zu den Beteuerungen am anderen Ende der Leitung, auf die er geschickt einging, und sorgte dafür, dass der Abstand zwischen den Parteien langsam schwand. Wie schon so oft wurde alles unmerklich in die richtige Bahn gelenkt.
Peter richtete seinen Blick auf das mattgrüne Gemälde des Borobudur-Tempels, des größten Heiligtums Javas, das hinter Thomas Klein an der Wand hing. Er schloss die Augen. Zum ersten Mal seit Langem erschienen Kelly und ihr wunderbares, ungezwungenes Lächeln vor ihm. So lebendig, als wären nicht schon Jahre vergangen.
Der Konferenzraum von Christie N.V. ging zum Hinterhof des repräsentativen Gebäudes hinaus, weg von den Kanälen Amsterdams und den Schiffen für die Rundfahrten. Kaum waren Peter de Boer und Thomas Klein zurückgekehrt, schloss Linda Jacobs die Tür und sperrte die lebhafte Geräuschkulisse von draußen aus.
»Hans, die Vorbereitungen zum Fall Kakaz übernimmt ab sofort deine Abteilung!« Peter blickte zu einem mageren Mann ganz hinten im Raum.
Der Chef der Finanzabteilung, Hans Blok, war dem Typ nach Asthmatiker, in Wahrheit jedoch nicht nur körperlich, sondern auch mental ein zäher Bursche. Gerade steckte er sich einen Bonbon in den Mund und kritzelte etwas in sein Notizbuch.
»Vor etwa drei Minuten ist es Thomas gelungen, Benjamin Holden dazu zu bringen, eine Bankgarantie zu besorgen. Sie ist ausgestellt über acht Millionen Gulden, und das bedeutet, dass wir die Geschichte durchziehen können. Die verbleibenden drei Komma fünf Millionen müssen wir dagegen als besonders risikobehaftet betrachten.«
Zwei der Anwesenden lächelten.
»Um die Bankgarantie kümmerst du dich, Hans.«
Der hagere Mann notierte wieder etwas. Peter sah zu Matthijs Bergfeld hinüber. »Danke, Matthijs! Thomas Klein wird dich über deine zukünftigen Aufgaben informieren.« Die beiden nickten einander kaum merklich zu, dann schloss Bergfeld die Tür hinter sich.
Seit Kellys Tod war Peter de Boer vollkommen in seiner Firma aufgegangen. In den beiden letzten Jahren war nur ein einziger Mann neu zur Führungsspitze gestoßen, eben Matthijs Bergfeld. Die übrigen im Raum waren altbekannte Gesichter, die seit Jahren ihr Dasein auf der Sonnenseite genossen und ihm, Peter, Sicherheit gaben. Sie hatten seine Firma zu einem konkurrenzlosen und außerordentlich lukrativen Unternehmen geformt und waren allesamt hoch professionell, ausgesprochen engagiert und eigentlich kaum zu ersetzen.
Doch wer die Menschen hinter den Gesichtern waren, wusste er schon lange nicht mehr. Oder war das immer so gewesen? Peter überlegte kurz. Vielleicht fand er ja mal Gelegenheit, darüber etwas genauer nachzudenken. Jetzt wischte er den Gedanken erst mal beiseite.
Die auf dem Kanal vor dem Gebäude von Christie N.V. ankernden Schiffe voller Möwendreck und -federn waren eindeutig noch nicht auf den Herbst vorbereitet.
Klaas, ein alter Sonderling, lebte schon seit Jahren auf einem Prahm in nächster Nähe. Jetzt hob er zum Gruß den Malerpinsel an seine Mütze, Peter nickte ihm etwas abwesend zu.
Er ließ den Blick umherschweifen bis hinunter zum zweihundert Meter entfernten »Homomonument«, das an die im Zweiten Weltkrieg verfolgten und ermordeten Homosexuellen erinnerte. Er spürte, wie die Fülle der Probleme ihn niederdrückte.
Die letzten Meter bis zum Westermarkt zogen sich endlos hin. Vor der Sauna de Keizer blieb er stehen und sah über das glitzernde Wasser der Keizersgracht.
All die Erinnerungen hatten ihn plötzlich wieder fest im Griff.
Mehr als vier Jahre war es her, dass Mevrouw Jonk, ihre Haushaltshilfe, ihn im Büro angerufen hatte. Sie hatte unter Schock gestanden, und nur mühsam war es ihm gelungen, ihrem Schwall unzusammenhängender Sätze die Kerninformation zu entnehmen.
Sie hatte seine Frau leblos auf der Couch im Wohnzimmer gefunden. Noch während sie nach dem Puls fühlte, hatte sie versucht, die herumliegenden leeren Pillendöschen zu zählen. Kelly de Boers Körper war zu dem Zeitpunkt schon kalt gewesen.
Die Geschichte hatte keine juristischen Folgen gehabt. In der Presse war nur eine kleine Meldung über den Selbstmord der Frau eines reichen Geschäftsmannes erschienen. Die Menschen aus ihrer Umgebung hatten höflich kondoliert und Peter anschließend in Ruhe gelassen.
Thomas Klein war Peters erster Angestellter gewesen. Er genoss einiges an Privilegien, sie waren rasch vertraut miteinander.
Ganz offensichtlich hatte ihn der Anruf des amerikanischen Anwaltes jetzt überrascht und sofort seine professionelle – und natürliche – Neugier geweckt. Dennoch hatte er das Telefonat später am Tag mit keinem Wort erwähnt.
Jetzt in der Mittagspause nahm Peter in Dimitri’s Café auf einer Bank Platz. Er starrte aus dem Fenster und dachte an das Gespräch mit dem Prokuristen der Anwaltskanzlei Lawson & Minniver. Dass amerikanische Anwälte gnadenlos sein konnten, war ihm nicht neu.
Der Anrufer war ohne Umschweife zur Sache gekommen. Angehörige von Peters verstorbener Frau Kelly de Boer, ehemals Kelly Wright, hätten sich mit dem Vorwurf an die Anwälte gewandt, er, Peter de Boer, habe seine Frau mit seiner Tyrannei in den Selbstmord getrieben. Dies sollte nun durch die Anwälte rechtlich verfolgt werden.
Als Nächstes hatte ihm der Anwalt der Familie mitgeteilt, Kellys Mutter habe auf Drängen der Familie hin einen Briefwechsel mit ihrer Tochter ins Feld geführt, der diese Behauptung auf das Stärkste stütze. Eine erschütternde Lektüre, wie der Anwalt bemerkt hatte. Es sei der erklärte Wille der Angehörigen, bevor der Fall verjähre, den Ruf der Verstorbenen und der gesamten Familie wiederherzustellen.
Erst kurz vor Ende des Gesprächs war das Wort »Entschädigung« gefallen. Zwar hätte Peter den Betrag ohne Weiteres begleichen können, auch wenn es sich bei der Forderung um eine geradezu unanständig hohe Summe handelte.
Aber weshalb sollte er bezahlen? Welche Beweise konnte man ins Feld führen für eine solche Beschuldigung? Dennoch: Er würde wohl doch besser Thomas Klein einschalten, auch wenn das zusätzliche Unannehmlichkeiten mit sich brachte. Aber die Geschichte war Thomas ja mehr oder weniger bekannt …
Im Sommer 1985 hatte Peter zwar viel zu tun gehabt, aber er war jung, Freiberufler, und er arbeitete äußerst effektiv.
Seine Aufgabe in den USA war innerhalb von acht Wochen die dritte im Ausland gewesen. Als er mit den Recherchen im kalifornischen Palo-Alto-Adel begann, hatten die örtlichen Spießer schon wochenlang ihrer Sommerbeschäftigung gefrönt, nach passenden Kandidaten für ihre Töchter im heiratsfähigen Alter Ausschau zu halten. Alle wollten dasselbe: junge Männer mit energischem Kinn und gut gefülltem Konto.
Die hübsche Kelly Wright hatte sich unbeeindruckt vom väterlichen Engagement längst selbst auf die Piste begeben. Sie flirtete hemmungslos und hatte in kürzester Zeit viele Herzen gebrochen und ebenso viele Hoffnungen zerstört. Tiefe Gefühle lagen ihr nicht, sie umgab sich mit einer Aura aus Stolz und Arroganz.
Als der hochgewachsene Niederländer auf der Bildfläche erschien, hatte sie sich gerade einer neuen Gruppe junger Männer zugewandt, die ihr allesamt zu Füßen lagen.
Peter de Boer war anders als diese jungen Typen, die an ihrer Angel zappelten. Er war deutlich älter als sie selbst, dazu extrem attraktiv. Und er würdigte sie keines Blickes. Sie war sofort verloren, ihr Jagdfieber war geweckt. Doch Peter zeigte sich unnahbar bis kühl – was Kelly nur noch mehr anstachelte. Er war schließlich hier, um das Unternehmen ihrer Eltern zu retten, und etwas anderes schien ihn auch nicht zu interessieren.
Kelly war zutiefst irritiert, das war sie einfach nicht gewohnt. Doch eines Tages – sie war in Bestform – gelang es ihr, ihn in ein Gespräch über Gott und die Welt zu verwickeln. Sie kam aus einem guten Stall, ihre Eltern hatten es, was ihre Bildung betraf, an nichts fehlen lassen. Und sie hatte ihre Hausaufgaben in Sachen Peter de Boer gemacht. Zielstrebig verwickelte sie ihn in Überlegungen zum Kunstmarkt, brillierte über Mozarts Terzette und die großen Intermezzi der Opernliteratur und schwärmte hinreißend von Yehudi Menuhins Bogenführung und seinen zarten Flageoletttönen. Es musste ihr einfach gelingen, diesen Mann zu knacken.
Sie hatte sich peu à peu an ihn herangetastet – über eine der großen Leidenschaften de Boers: die klassische Musik, den feinen, zarten Klang der Violinen. Am Ende war es gar nicht so schwer gewesen …
Und als er schließlich nach Europa zurückkehrte, fuhr sie mit.
Tatsächlich faszinierte sie ihn mit ihrer Begeisterung für alles, was ihn interessierte. Und an dem Tag, an dem bei einem Fußballspiel im Heyselstadion achtunddreißig Menschen zu Tode getrampelt wurden, empfing Kelly nur fünf Kilometer entfernt ihren Ehering. Elfeinhalb Jahre war das alles her. Jenes Lächeln, mit dem sie ihn damals unter ihrem Brautschleier angeschaut hatte, war ihm gerade eben in einem Ölfilm auf dem Wasser des Kanals erschienen.
Der Alltag mit Kelly hatte Peter bald gezeigt, dass es für seine Frau keinen Unterschied gab zwischen echter Rührung und falschem Pathos, dass ihre gesellschaftliche Stellung und ihr sozialer Hintergrund ihr mehr als alles andere bedeuteten und dass sie Richard Clayderman und Daniel Barenboim in einem Atemzug nannte, ohne rot zu werden.
Von Menuhins Flageoletttönen hatten sie nie wieder gesprochen.
Was folgte, waren sieben unglückliche gemeinsame, einsame Jahre.
Dimitri’s Café war nicht besonders komfortabel, es gab nur wenige Plätze, und man war den Blicken von der Straße ausgesetzt. Trotzdem mochte Peter den Ort. Hier hatte er einige seiner besten Einfälle gehabt, hierher zog er sich zurück, um Zeitung zu lesen und sich über Trends in Politik und Wirtschaft auf dem Laufenden zu halten.
Thomas Klein hingegen fühlte sich sehr viel wohler im Restaurant De Vergulde Gaper, fünfzig Meter entfernt an der Ecke zur Prinsengracht. Sein Unbehagen, als er sich nun ächzend auf einem Stuhl niederließ, war nicht zu übersehen.
»Also hör mal, Peter, was ist denn das für ein Treffpunkt? Was spricht gegen dein Büro?«
»Das hier«, gab Peter zur Antwort, nachdem sie ihre Bestellung aufgegeben hatten, und reichte Klein einige Faxe.
Thomas Klein sah sie flüchtig durch und schüttelte den Kopf. »In der Mittagspause! Wo bleiben meine Rechte als Arbeitnehmer?«
»Ich kann dein Gehalt gern um fünfzehntausend Gulden im Monat kürzen. Wenn du willst, kannst du ab sofort im zweiten Stock sitzen und dich jeden Tag bis Viertel vor fünf mit deinen Rechten amüsieren.«
Klein verzog keine Miene. »Geht es um Kelly?«
»Lies doch!«
Peter betrachtete die Menschen draußen auf der Straße. Hunderttausende waren im Laufe der Jahre die Prinsengracht hinunter zu dem Haus gegangen, in dem Anne Frank gelebt hatte. Gerade zog wieder eine Gruppe Touristen vorbei – wie die Entenküken spazierten sie alle brav hinter der Fremdenführerin her.
»Und?« Thomas Klein legte die Papiere auf dem Nachbarstuhl ab und betrachtete dann abschätzig den Teller, den die Kellnerin vor ihm auf den Tisch stellte, als wäre das Essen eine Zumutung.
»Was, meinst du, können sie mir anhaben?«
»Hör zu, Peter.« Thomas schob sich eine Gabel Pasta mit Pesto und Lachs in den Mund. »Ich habe keine Ahnung, was diese amerikanischen Straßenräuber von Anwälten alles können oder nicht. Aber solange du nicht in Kalifornien herumspazierst, können sie dir erst einmal gar nichts anhaben. Es sei denn, es ist ein von Zeugen bestätigtes Geständnis deinerseits aufgetaucht, dass du Kelly vorsätzlich so lange tyrannisiert hast, bis sie keinen anderen Ausweg mehr sah, als sich umzubringen. Und ein solches Schriftstück existiert vermutlich nicht, oder?«
»Nein, natürlich nicht.«
»Na, dann müssen wir lediglich ihre Behauptung zurückweisen. Die Familie ist eindeutig aufs Geld aus, und das kann man ihnen nicht mal verdenken.«
»Wie hoch könnte so eine Forderung ausfallen?«
»In solchen Fällen ist sie meistens gigantisch hoch.«
»Zehn Millionen?«
Das war der Betrag, den der Anwalt von Lawson & Minniver genannt hatte.
Klein ergriff erneut den gefaxten Brief und las ihn Peter laut vor:
Dear Mom,
die Bäume haben ihr Laub verloren, und Haarlem ist in Winterschlaf versunken.
Die käsigen Holländer sind jetzt alle in ihren Garagen und ölen ihre geliebten Fahrräder, träumen vom nächsten Frühling und welchen Busch sie dann in den Vorgarten pflanzen werden.
Ab jetzt wird bis März nirgendwo irgendetwas passieren. Glaube mir, es ist einfach schrecklich.
Peter ist seit über zwei Wochen nicht mehr zu Hause gewesen. Aber so, wie sich mein Leben gestaltet, ist das auch der einzige Lichtblick.
Jeder Augenblick mit ihm ist eine Qual. Seine Sturheit und seine Kompromisslosigkeit treiben mich in den Wahnsinn.
Ein Wort aus seinem Mund, und ich welke wieder ein bisschen mehr dahin.
Das ganze Haus ist krank. Ich muss zusehen, dass ich bald zu Kräften komme, damit ich hier verschwinden kann …
Klein nahm noch einen Happen. »Also mal ehrlich, Peter, die haben doch nichts in der Hand. Von wann ist dieser Brief, was steht da? 25. November 1991? Das war genau drei Monate vor ihrem Tod, oder?«
Den Weißwein ließ er mit verächtlichem Blick stehen, spülte stattdessen mit Aqua della Madonna nach. »Der Brief ist doch völlig nichtssagend. Das ist das Gejammere einer frustrierten Frau, die früher oder später vermutlich die Scheidung einreichen wird.«
»Aber das hier ist ja auch nur ein Auszug aus einem umfangreichen Briefwechsel, Thomas. Was wissen wir denn, was sie sonst noch geschrieben hat?«
»Was soll sie schon geschrieben haben? Was schreibt man seiner Mutter?«
Klein sah ihn fragend an, aber Peter schüttelte nur den Kopf.
»Peter! Du verlierst den Blick fürs Ganze! Wie du selbst immer zu sagen pflegst: Wer weiß denn, ob unter der Spitze des Eisbergs nicht doch bloß ein altes Floß schwimmt?« Klein legte seinen Löffel auf den Teller, der trotz allem so sauber aussah, als käme er geradewegs aus dem Geschirrspüler. Er wischte sich über den Mund, dann fuhr er fort: »Denn unter der Spitze ist doch wohl kein Eisberg, oder?«
»Nein, ich glaube nicht, nein«, stotterte Peter, auch wenn er das Gefühl hatte, dass der Eisberg in Wahrheit ziemlich groß war. »Ich weiß nicht, was da sein könnte«, fuhr er dann mit fester Stimme fort. »Wir hatten es nicht gut miteinander, und das weißt du auch, das wissen alle. Aber Kellys Tod hat mich dennoch absolut bestürzt, damit hatte ich nie gerechnet. Thomas, wir müssen uns auf jeden Fall wappnen!«
»Lass uns erst mal abwarten, was sie sonst noch zu bieten haben. Auf der Grundlage dieses einen Briefs würde hierzulande sicher kein Gericht die Angelegenheit aufgreifen.«
Peter versuchte, sich seine ehemalige Familie vor Augen zu führen. Gerede über Geld, nichts als Gerede über Geld. »Wir könnten ihnen vielleicht einen Teil von Kellys väterlichem Erbe anbieten«, sagte er vage. »Um die Sache so schnell wie möglich vom Tisch zu haben.«
Thomas Klein wandte seinen Blick nicht vom Dessert ab, das seinen Ansprüchen offenkundig noch weniger entsprach als die Hauptspeise.
»Aber könnte das nicht als eine Art Schuldeingeständnis interpretiert werden?«, fuhr Peter fort. »Könnte man nicht eher eine Kompensation für das versäumte Erbe des Vaters anbieten? Das müsste doch möglich sein, ohne dass ich mich dadurch verdächtig mache. Sagen wir zum Beispiel zwei Millionen.«
Klein hob langsam den Blick. »Du bist doch verrückt, Peter. Was ist denn mit dir los! Zwei Millionen Gulden! Die gib mal lieber mir, dann können Matthijs und ich im Winter eine Weltreise machen. Das würde den armen Kerl bestimmt aufmuntern. Weißt du eigentlich, wie schlecht es ihm geht?«
»Denk drüber nach. Bastel irgendetwas zusammen. Ich kann mich im Moment nicht um noch ein Problem kümmern.«
Thomas Klein schob den Teller zurück. »Was heißt denn ›noch ein Problem‹? Meinst du SoftGo?«
»SoftGo?« Peter blickte dem Mann, mit dem er seit Jahren vertrauensvoll zusammenarbeitete, tief in die Augen. »Nein, Thomas. Gott bewahre, nein.«
Keiner der Mitarbeiter vermochte lauter zu lachen als Magda Bakker. Und wenn sie sauer war, hörte man ihre dröhnende Stimme bis in den letzten Winkel der Büros. Seit sie vor Jahren zur PR-Chefin ernannt worden war, kannte sie keine Zurückhaltung mehr. In Medienkreisen war sie berühmt-berüchtigt. Ihre Art ließ jeden noch so selbstsicheren Wirtschaftsjournalisten erblassen, und selbst den hartgesottensten Chefredakteur konnte Magda Bakker allein mit der Waffe ihrer Stimmbänder dazu bringen, den Aufmacher auf Seite eins zu ändern.
Als ihre durchdringende Stimme in diesem Moment bereits zum dritten Mal durch die Wände schallte, drückte Peter kopfschüttelnd den Knopf der Gegensprechanlage.
»Linda, sieh mal nach, was da los ist. Bei dem Lärm kann ich mich nicht konzentrieren.«
»Magda Bakker empfängt gerade die neuen Trainees.«
»Und warum muss sie dabei so brüllen?«
»Eine der Neuen hat ihre Zusage zu spät eingereicht. Deshalb hat ein anderer ihren Platz im Kurs bekommen.«
»Ja und?«
»Das Mädchen ist trotzdem zur Einführung erschienen, und Magda Bakker versucht, diese dreiste Person gerade zum Gehen zu bewegen.«
»Soll das heißen, zum Traineekursus sind diesmal vier erschienen?«
»Ja.« Ein seltenes Mal klang sie fast verlegen.
»Und was hat Magda Bakker damit zu tun?«
»Sie ist zufällig vorbeigekommen.«
»Sag ihr, sie soll sofort aufhören.«
»Das wird nicht leicht.«
»Dann schick meinetwegen diejenige, die sich zu spät gemeldet hat, zu mir herein.«
3
»Nein, Peter de Boer«, zischte Nicky in Richtung Kanal. »Da mache ich unter keinen Umständen mit. So etwas zu entscheiden, dazu gehören zwei.« Zwei Passanten blickten sie etwas irritiert an. Vor ihr auf dem Bürgersteig lag ein Häufchen Pistazienschalen, sie hatte seit dem Treffen mit Peter de Boer fast die ganze Tüte geleert. Ja, sie war wütend, aber nie hätte sie ihre Wut herausgebrüllt wie ihr Vater. Dennoch: Die Wut musste raus, und sie hatte kaum gemerkt, wie sie leise und empört vor sich hin schimpfte.
Mit den Vorderzähnen knackte sie eine weitere Nuss. Dabei sah sie hinüber zum Gebäude. »Nun kommt schon raus! Ich kann nicht den ganzen Tag hier warten.« Inzwischen wurde es dunkel.
Als Erste kam schließlich diese große, kräftige Frau in Sicht, die Nicky an der Rezeption abgefangen hatte, um sie gleich wieder hinauszuschmeißen. Sie schwang ihre gewaltigen Maße durch die Eingangstür.
Als die nächste Gruppe von Leuten in der Tür auftauchte, stieß Nicky sich von dem Laternenpfahl ab, an dem sie gelehnt hatte. Es waren die drei, die zum Traineekurs angenommen worden waren. »Also los«, murmelte sie und ging langsam zu ihnen hinüber. »Einer von euch hat mir meinen Job weggeschnappt«, ging es ihr immer wieder durch den Kopf. Sie knackte die nächste Nuss und beobachtete dabei sorgfältig die Körpersprache der drei Männer. Dann entschied sie sich, dem größten von ihnen zu folgen.
Demjenigen, der so aussah, als verbrächte er am meisten Zeit vor dem Spiegel.
Der breitschultrige Typ schritt durch die Stadt wie durch eine Art Westernkulisse. Auf dem Muntplein blieb er vor einem Schaufenster stehen, strich sich das glänzende schwarze Haar zurecht und betrachtete eingehend einen figurbetonten Anzug, in dem er garantiert unwahrscheinlich gut aussehen würde. Nicky schlenderte heran und stellte sich vor das benachbarte Schaufenster. Während sie langsam näher rückte, streifte ihr Blick über die ausgestellten Waren.
»Na, das ist ja ein Ding!«, rief sie unvermittelt in seine Richtung, so dass der Typ sich fast die Stirn am Schaufenster stieß.
Verdutzt sah er sie an. Und erst als sie ihn fragte: »Wie war es heute?«, hellte sich seine Miene auf. Sein Lächeln zeigte, dass er sie wiedererkannte.
»Ach so, du bist diejenige, die sich zu spät rückgemeldet hat. Wie ärgerlich.« Er gab sich Mühe, Anteilnahme zu signalisieren.
»Ja. Total ärgerlich.« Sie lächelte ihn an, und unwillkürlich richtete er sich auf, so dass in seinem Hemdausschnitt ein paar Brusthaare sichtbar wurden.
Nicky zuckte die Achseln. »Na, was soll’s, am Ende bin ich ja trotzdem angenommen worden.«
Jetzt horchte er auf und streckte ihr die Hand entgegen.
Sie schlug ein, als er sich als Ruud Dijksma aus Rotterdam vorstellte.
Das Café war voll besetzt, und das Personal schien überfordert oder einfach lustlos.
Mit aufgesetztem Lächeln versuchte Ruud Dijksma, etwas zu bestellen, vergeblich.
Nicky fixierte die blutroten Lippen einer der Kellnerinnen, die sich, Kaugummi kauend, unablässig öffneten und schlossen. Dann wandte sie sich der Speisekarte zu, einem uninspirierten Allerlei aus holländischer Schnellküche und mit Schlagsahne überladenen Konditoreierzeugnissen.
»Nur Kängurufleisch enthält kein Cholesterin, wusstest du das?«
Der Typ ihr gegenüber sah sie irritiert an und entgegnete höflich: »Bist du auch Juristin?«
Nicky schüttelte leicht den Kopf. »Nein, ich habe einen Abschluss in Marketing.«
»Echt!« Als er ein weiteres Mal versuchte, etwas zu bestellen, wirkte das Lächeln des jungen Mannes bereits leicht debil.
»Das ist schon eine tolle Sache, was, Ruud. Mit dem Job, meine ich«, sagte Nicky ungerührt.
»Christie! Ist das nicht unglaublich? Wir beide bei Christie!«
»Doch, ja.« Sie lächelte schwach und wurde sogleich wieder ernst. »Da kann man es weit bringen, wenn man es bringt.«
»Wenn man es bringt?« Ruud Dijksma zog fragend die Augenbrauen hoch. »Natürlich muss man es bringen, sonst hätten wir ja das Aufnahmeverfahren gar nicht bestanden.«
»Das Aufnahmeverfahren? Vergiss es.«
»Klar. Jetzt geht es wahrscheinlich darum, jeden Tag bei der Arbeit sein Können unter Beweis zu stellen, oder was meinst du?«
»Ach, Quatsch!« Nicky spitzte den Mund, so dass ihre Wangenknochen deutlicher vortraten. »Nein, ich denke da an was ganz anderes …« Wieder las sie in der Speisekarte.
Jetzt war der Typ neugierig geworden. »Wie? Was meinst du denn? Peter de Boers Geschäftspraktiken?«
»Seine Geschäftspraktiken? Nein, nein. Die sind, gelinde gesagt, ziemlich alternativ.«
Wieder wanderten die Augenbrauen des Typs neugierig nach oben. Nicky hatte ganz offenkundig das richtige Opfer gewählt.
»Ich meine eher die Sache an der Privatfront …«, fuhr sie fort und sah ihn bedeutungsvoll an. »Weißt du das gar nicht? Dann rechne am besten schon mal damit, dass de Boer so lange hinter dir her sein wird, bis du dich irgendwann freiwillig zu ihm legst. Na ja, das wirst du schon noch früh genug mitbekommen.«
Ruud Dijksmas Blick sprach Bände. Sein Vertrauen in die Welt balancierte plötzlich auf diesem einen Satz.
»Du willst doch nicht etwa sagen, dass …« Er war sichtlich erschüttert.
Nicky lächelte ihn an. Seine Fassungslosigkeit konnte er nur sehr unzulänglich überspielen.
»Große Männer mit braunen Augen.« Nicky sprach jedes Wort mit Bedacht und nutzte seinen Zustand perfekt aus. »Braune Augen und Haare auf der Brust. So etwas registriert Peter de Boer sofort. Damit bringst du es, damit kommst du weiter.«
Seine Miene war übertrieben fragend. »Das ist nicht dein Ernst?«
»Aber ja.«
Die Falten auf seiner Stirn machten ihn nicht unbedingt attraktiver.
»Ach, komm schon, Ruud, nun hör aber auf. Du kommst doch aus Rotterdam. Du kennst doch die einschlägige Szene?«
»Keine Ahnung«, meinte er ausweichend.
Nicky schüttelte den Kopf. »Na ja, egal. Jeder muss seine eigenen Erfahrungen machen.«
»Und wenn ich das nun … nicht … bin?« Unschlüssig ließ Ruud Dijksma sich zurücksinken. Seine Miene verbarg nur sehr unzureichend seine Verwirrung.
Nicky lehnte sich über den Tisch. Gnadenlos fuhr sie fort. »Du musst schon wissen, was dir wichtig ist«, flüsterte sie. »Mein Gott, nimm’s doch einfach mit! Denk dran, wie viele Frauen sich all die Jahre im geheiligten Namen der Karriere haben nach oben schlafen müssen! Und du bist ja schon so gut wie auf dem Weg ganz nach oben in der Firma. Bist du dir darüber im Klaren, wie viel die dort verdienen?«
»Nein. Also: doch. Ich meine …« Es war ihm offenbar langsam auch egal.
Unvermittelt richtete Nicky sich auf, fixierte die Kellnerin, die am Tresen stand, und holte tief Luft. »Das Faultier ist das langsamste Tier der Welt, Fräulein, wussten Sie das? In ganz seltenen Fällen kommt es in einer Stunde hundertfünfzig Meter weit.« Den letzten Satz sagte sie so laut, dass die Botschaft auch alle anderen Gäste im Lokal erreichte.
Dann wandte sich Nicky wieder Ruud Dijksma zu. »Das Faultier ist tatsächlich so faul veranlagt, dass es mit seinen Ausscheidungen auf Regenwetter wartet, weil dann alles von selbst verschwindet. Ist das nicht unfassbar?« Sie nickte, erst in seine Richtung, dann in die der Kellnerin.
Tatsächlich bewegte die Bedienung sich jetzt langsam in ihre Richtung.
»Was soll’s denn sein?«, fragte sie barsch, als sie schließlich an ihrem Tisch stand. Den Bestellblock ließ sie jedoch in der Schürze. Ungeduldig starrte sie den athletischen jungen Mann an.
»Nichts«, antwortete dieser. »Ich glaube, nichts.«
Auf dem Zeedijk konnte man Koks und Gras kaufen – und eins auf die Schnauze bekommen, sogar am helllichten Tag, so lange die schmale Straße noch nicht von Touristenhorden überrannt wurde. Der Zeedijk bildete die Abkürzung zwischen dem Amsterdamer Hauptbahnhof und dem Viertel, in dem Nicky aufgewachsen war, diesem Labyrinth und Hexenkessel, wo sich schnelles Geld verdienen ließ und Prostituierte und allerlei Gesindel sich herumtrieben, deren einziges Ziel darin bestand, gutgläubigen Touristen das Geld aus der Tasche zu ziehen.
Frank, ein massiger Typ aus Surinam mit tiefdunkler Haut, stand dort, wo er immer stand, nämlich mitten auf der Straße, und egal, wer vorbeikam, Frank bewegte sich keinen Zentimeter von der Stelle. Nicky holte tief Luft und gab sich größte Mühe, ihr Herzklopfen zu ignorieren. Hätte sie ihm aus dem Weg gehen wollen, hätte sie schließlich eine andere Straße gewählt.
»Hey, du!« Er brüllte wie immer. »Sag deiner bekloppten Schwester, wenn sie nicht in zehn Minuten hier aufschlägt, dann kann sie sich die plastische OP sparen, von der sie die ganze Zeit faselt.« Er drückte seine Nase mit dem Zeigefinger auf die Oberlippe. »Du weißt schon, die Nase.« Er nahm die Hand runter, ohne zu lächeln.
In zehn Jahren würde er garantiert schon fünf Jahre tot sein. Nicky verließ sich da ganz auf die Statistik.
Darauf bedacht, ihre Nervosität nicht zu zeigen, baute sie sich vor ihm auf. »Weißt du, Frank, was ein Affenmännchen und ein Rattenbock im Gegensatz zu dir haben?« Frank kam bedrohlich näher, doch sie rührte sich nicht vom Fleck. »Einen Knochen im Schwanz. Und weißt du, mit wem du diesen eklatanten Mangel teilst? Nein? Mit den Hyänen, unter anderem. Du hast überhaupt viel mit ihnen gemein.«
Die Umstehenden schienen die Luft anzuhalten. Franks Lakaien hatten bisher an einer Hauswand gelehnt, stießen sich nun aber ab und bezogen Stellung. Nicky starrte Frank weiter an. Alle sollten wissen, dass sie, Nicky Landsaat, keine Angst hatte, auch wenn das nicht ganz stimmte. Sie alle sollten wissen, dass es besser für sie wäre, wenn sie sich von ihr und ihrer Familie fernhielten. Dass sie niemals, unter keinen Umständen, ihre Geschwister im Stich lassen würde.
»Gib’s auf, Frank. Mille ist nicht mal siebzehn, sie wird nicht kommen. Also fahr zur Hölle.« Jetzt hatte sie es gesagt.
Er packte sie am Arm, und sie wusste, was das zu bedeuten hatte. »In zehn Minuten, Nickymuschi. Klar?« Damit hatte er das letzte Wort gehabt, und das Messer konnte in der Tasche bleiben.
Mit wild pochendem Herzen riss Nicky sich los. Didi, einer der anderen Surinamer, trat jetzt auf sie zu, er wohnte in ihrem Haus. Er warf Frank einen fragenden Blick zu, und erst als dieser den Kopf schüttelte, schlurfte Didi zurück an seinen Platz an der Hauswand.
Nicky schnaubte. »In zehn Minuten? Was hast du denn für Vorstellungen!?«
Seine dunklen Augen ließen nicht von ihr ab. Vermutlich hatte er keine Ahnung, wovon sie da redete, aber die herrschende Klasse auf dem Zeedijk kannte keine Furcht vor der eigenen Beschränktheit. »In zehn Minuten, habe ich gesagt. Ansonsten soll es Mille lieber nicht wagen, sich noch einmal auf der Straße blicken zu lassen. Das verspreche ich dir.«
Bis ins Treppenhaus drang der Gestank aus der Wohnung. Seit Freitagnachmittag, dem Nullpunkt und Startschuss eines weit über das Wochenende hinaus reichenden Besäufnisses, frönte Nickys Vater nun wieder dem Alkohol.
»Du hast den Job nicht gekriegt!« Höhnisch grinsend setzte er die Flasche an. Sein Unterhemd war voller Flecken.
»Doch.«
Ihre Schwester Beatrix machte sich nicht mal die Mühe, von ihrer Illustrierten aufzuschauen. Nur Mille winkte ihr halbherzig zu.
Der winzige Raum hinter der Küche gehörte ausschließlich Nickys Mutter. Ganz früher hatte er einmal als Vorratskammer gedient, aber seit es in allen Haushalten Kühlschränke gab, waren Nähtisch, Spitzen, Stoffe sowie allerhand weiterer Kram dorthin versammelt worden. Das war ihr Reich, und schon beinahe ihre ganze Welt.
Langsam hob die Mutter den Kopf von ihrer Flickarbeit und sah Nicky durch die mit den Jahren milchig gewordenen Brillengläser an. »Du hast ihn nicht bekommen, Nicky.« Ihre Stimme klang leidenschaftslos.
»Ist das so offensichtlich?«
Die Mutter schaute wieder nach unten, heftete einen kleinen Riss im Stoff zusammen.
»Aber ich habe noch eine Chance.«
Die Mutter lächelte nicht. »Ja, sicher, Nicky.«
Wortlos saßen sie beisammen, bis die Hose in den Händen der Mutter so gut wie neu war. »Halte dich in den nächsten Tagen von deinem Vater fern.« Sie biss den Faden ab.
Nicky legte ihr die Hand auf die Schulter – eine Schulter, die so zart war und so vieles aushalten musste, auf der im Lauf der Jahre so viel Kummer gelastet hatte, eine Schulter, die solche Gesten der Zärtlichkeit gar nicht mehr wahrzunehmen schien.
»Hab ich vielleicht nicht mein Examen bestanden?« Nicky zog ihre Hand zurück.
Ihre Mutter nickte.
»Habe ich nicht Bestnoten bekommen?«
Wieder nickte die Mutter.
»Dann bekomme ich auch diesen Job, okay?«
»Okay, Nicky. Wenn du meinst. Hauptsache, du vergisst nicht, wo du herkommst.« Jetzt sah ihre Mutter ihr endlich ins Gesicht. Nichts erinnerte daran, dass diese Augen einmal Vulkanen in einer Schneelandschaft geglichen hatten. Das Weiße in ihren Augen war matt und gelblich geworden. »Marketing!« Das Wort klang aus ihrem Mund wie etwas Unwirkliches, beinahe Schmutziges. »So einem Marketingfräulein mit breitem Gesicht und einer Haut wie Safran begegnet man in dieser Gegend nicht jeden Tag, das wirst du doch einsehen!«
»Ich habe Bestnoten, Mutter! Das ist es, was zählt.«
»Ja, das hast du schon gesagt.« Die Mutter griff nach einem der abgegriffenen Wunschpüppchen an der Wand, einem kleinen Etwas mit dreieckigem Zyklopenkopf und winzigem Jadeauge.
»Du musst Mille Hausarrest geben«, bat Nicky.
»Was muss ich?« Ihre Mutter war bereits weit weg. Die Holzpuppe in ihrer Hand lächelte, und sie lächelte zurück. In dem kleinen Raum entfaltete der Urwald seine Macht. Immer öfter versank ihre Mutter in Tagträumen.
»Frank ist wieder unterwegs.«
Unversehens änderte sich der Gesichtsausdruck der Mutter. »Mille kann auf sich selbst aufpassen.«
»So wie Bea, meinst du?«
Ihre Mutter blickte nicht auf.
Beatrix, Nummer drei der vier Geschwister, war einmal über einen Monat nicht nach Hause gekommen. Dann stand sie plötzlich mit Schnittwunden an den Beinen und übersät von starken Blutergüssen an Hals und Schlüsselbein vor der Tür. Doch diese Verletzungen waren nichts gewesen, gemessen an den Folgen des väterlichen Wutanfalls. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn interessierte ihn einen Scheißdreck.
Bea war trotzdem wieder bei ihnen eingezogen. Seither verbrachte sie ihre Tage auf dem Sofa, um Kraft zu sammeln für ihren nächtlichen Job. Und im Moment hoffte sie darauf, dass ihr Bauch aufhören würde zu wachsen.
Wer der Vater des Kindes sein könnte, interessierte sie nicht. Unter den Mädchen auf dem Straßenstrich vom Kloveniersburgwal war sie eine der achtlosesten.
»Mutter, du musst mit Mille reden!« Nicky sprach eindringlich, aber mit gedämpfter Stimme, auf sie ein. Wenn nur ihr Vater nichts mitbekam. »Mutter, du bist die Einzige, die Mille da rausholen kann. Wirklich. Du musst!«
Zwar hatte keines der vier Kinder jemals Überfluss gekannt, aber sie hatten doch alle immer ein eigenes Zimmer gehabt. Einundzwanzig Quadratmeter waren aufgeteilt worden durch Trennwände aus weicher Spanplatte, die Türen aus laminierter Pappe. Hier in ihrem eigenen Reich setzte sich Nicky an den Tisch mit dem kleinen Bildschirm. Sie tastete unter der Tischplatte nach einem Griff und zog eine fast leere Schublade auf.
Ihr eigenes Wunschpüppchen, in Batikstoff gehüllt, lag in ihrer Hand, und Nickys Wünsche waren Wünsche für Mille. Sie zeichnete das Muster des Stoffs mit der Fingerspitze nach, dann drückte sie die Puppe fest und schnaubte: »Peter de Boer! Ich komme wieder!« Sie schloss die Augen. Die Worte kitzelten angenehm, sie musste lächeln. »Bei Serams Geistern! Morgen stellst du mich ein, ob du willst oder nicht!« Sie lockerte den Griff um die Puppe und glättete deren Kleidchen mit dem undefinierbaren Muster.
Nicky hatte immer gut auf die Puppe aufgepasst.
Sie kam von weit her …
Um seinem jämmerlichen Dasein zu entkommen, war der Vater von Nickys Mutter 1945 mit seiner gesamten Familie in einer sternenklaren Nacht von der Insel Seram in der Provinz Maluku losgesegelt. Sie wollten ihr Glück auf Java, in Cirebon oder Jakarta, suchen.
Er und drei weitere Erwachsene mit insgesamt sechs Kindern brauchten fast zweieinhalb Jahre, um sich durch das Inselreich zu den glückverheißenden Städten durchzuschlagen. Am Ende hatte ihnen dieser Aufbruch nichts als Not und Elend gebracht. Bald war nur noch das älteste Kind am Leben.
Die Irrfahrt endete in Jakarta, wo Nickys Mutter, noch ehe sie dreizehn war, lernte, ihren Lebensunterhalt aus eigener Kraft zu bestreiten. Und die Kraft war ihr Körper. Dort begegnete sie einige Jahre später Nickys Vater.
Er nahm sie zu sich, das naive junge Mädchen von den Molukken. Sie hatte Glück gehabt. Viele andere Frauen bedienten weiterhin Freier, erkrankten an Syphilis und starben jung. Gemessen an den Umständen hatte sie noch Glück gehabt, hatte Nickys Mutter oft gesagt.
Heute, fünfunddreißig Jahre später, war Nickys Mutter im Grunde noch immer das arglose Mädchen aus der Wildnis Serams, das lieber über Gewürznelken und Sagopalmen sprach als über Hoffnung, Selbstwertgefühl und Zukunftsträume. Sie lebte weit entfernt von der Realität, die ihre eigenen Kinder in den Abgrund zog.
Vier Kinder hatten sie bekommen. Einen Taschendieb, eine Prostituierte und die sechzehnjährige Mille, die über kurz oder lang Frank und seinen Kumpanen auf den Zeedijk folgen und in den betuchten Stadtteilen hinter dem Damrak mit Kokain dealen würde.
Die Älteste war Nicky, dieses sonderbare große Mädchen, das bisher nichts weiter erreicht hatte, als Zeit zu vergeuden, und das nun obendrein den ersten richtigen Job verpasst hatte.
Diese Herkunft, gegen die sie aufbegehrte und die sie um jeden Preis hinter sich lassen wollte, war es, die Nicky in dieser Nacht beschäftigte.
Sie musste diesen Job einfach haben.
4
»Sag ja nicht, du hättest keine Lust.« Heleen betrachtete sich im Rückspiegel und wischte sich den leicht verschmierten Lippenstift aus den Mundwinkeln. Peter starrte über das Steuer auf den langsam abnehmenden Feierabendverkehr an diesem ersten Werktag der Woche. Er reagierte nicht.
»Peter, amerikanische Geschäftsleute sind meine wichtigsten Kunden«, fuhr sie fort. »Und du weißt ganz genau, dass in meiner Branche die meisten zu den Demokraten gehören. Deshalb müssen wir hin.«
Sie hatten das Villenviertel erreicht. Der Palast, auf den sie zuhielten, war ein steingewordenes Zeugnis der Kolonialzeit der Holländer in Indonesien. Heute war er beleuchtet wie ein Weihnachtsbaum, prachtvoll und etwas vulgär. So sahen die Häuser häufig aus, wenn amerikanische Geschäftsleute jener Gesellschaftsschicht sie übernommen hatten, zu der auch ihre Gastgeber gehörten.
Peter hätte Heleen am liebsten abgesetzt und wäre mit dem Wagen umgekehrt. Heleen bemerkte das sofort. Sie streichelte seinen Oberschenkel. »Lass uns gemeinsam diesen verdammten Geburtstag feiern, Peter, es wird sich lohnen, auch für dich.«
Am Fuß der geschwungenen Treppe kamen ihnen die Gastgeber strahlend entgegen: Amerikaner mittleren Alters, die sich gut gehalten und zur Feier des Tages knallbunte Buttons mit dem breit lächelnden Konterfei ihres Präsidenten auf die Brust gesteckt hatten. Sie empfingen Heleen und Peter auf das Herzlichste – und wandten sich den nächsten Ankömmlingen zu, ohne dass sich ihre Miene auch nur im Geringsten veränderte.
Nach dem Begrüßungscocktail waren alle festlich gekleideten Gäste ebenfalls mit einem Bill-Clinton-Button versehen. Im Foyer und den angrenzenden Sälen hingen amerikanische Flaggen und Banner zu Ehren des 50. Geburtstags des Präsidenten. Die Stimmung war ungetrübt, die Musik laut wie die einer Marching Band im Highschool-Stadion, und das Essen war entsprechend.
Als der Champagner schon eine ganze Weile floss, ließ Peter Heleen mit der Bemerkung allein, sie könne ihre Kontakte ohne ihn sicher besser pflegen. In Wahrheit wollte er sich in einen der Nebenräume flüchten.
Gut dreißig andere Männer hatten dieselbe Idee gehabt. Drinks in der Hand, Kragen und Krawatten bequem gelockert, standen sie an der Bar und diskutierten mit gedämpfter Stimme und großer Geste. Nachdem Peter seinen Sol y Sombra gereicht bekommen hatte, suchte er sich einen Platz in Hörweite.
Wortführer war ein weißhaariger Mann, der dem Jubilar zum Verwechseln ähnlich sah und permanent breit lächelte. »Klar gewinnt Clinton«, erklärte er. »Die Republikaner sind Experten für Irrtümer, und Dole ist der größte von allen!« Dafür erntete der Weißhaarige zustimmenden Beifall.
Ein Mann, dessen Haut im Gesicht auf einer Seite stark vernarbt war, lehnte sich an die Bar. »Das habe ich heute Abend nun schon mindestens zwanzigmal gehört. Aber was ist eigentlich an diesem Clinton so besonders?«
Peter lächelte. Der Mann gehörte mit Sicherheit nicht zu den Demokraten, vermutlich war er nicht einmal Amerikaner.
Der Weißhaarige antwortete jovial: »Er hat volleres Haar als die anderen! Er hat Grübchen und gute Zähne. Die Weiber träumen von ihm und die Männer von seiner vernachlässigten Ehefrau, stimmt’s?« Einige der Männer nickten.
Peter nippte an seinem Drink und sah sich um. Was sich ihm hier bot, sah er nicht zum ersten Mal. Das hier war die amerikanische Wahrheit in nuce. College-Fantasien von großen Titten und breiten Schultern, von Sex, Geld und vier Kindern. Darum ging es immer, gleichgültig zu welchem Anlass, ob Geburtstagsparty, Arbeitsessen oder Präsidentenwahl.
Dole hat Angst zu verlieren, und deshalb wird er verlieren, dachte Peter.
Ein ansteigendes Brausen aus dem großen Saal erinnerte ihn an den Anlass der Party. Hochrufe waren zu hören, und die Menschen begannen zu klatschen. Peter schaute auf die Uhr. Heleen traf bei Gelegenheiten wie dieser zahlreiche Bekannte, und wie so oft würde sie unendlich müde sein, sobald sie in dem eleganten Viertel Haarlems ankamen, in dem ihr Reihenhaus lag.
Er erwog, die Gesellschaft zu verlassen. Sein Unbehagen nahm zu. Vielleicht lag es an dieser Sache mit Lawson & Minniver und der Erinnerung an Kelly, die ihm in den Knochen steckte.
In diesem Moment trat der Mann mit dem unansehnlich vernarbten Gesicht auf Peter zu und sah ihn nachdenklich an. »Kenne ich Sie nicht von irgendwoher?«, fragte er dann.
Peter musterte ihn. Sollte er das Gesicht schon einmal gesehen haben? Er konnte sich nicht entsinnen.
Da hellte sich die Miene des anderen plötzlich auf. »Natürlich!«, rief er. »Ich weiß, wer Sie sind.« Er nickte. »Einige meiner Geschäftsfreunde haben bereits Bekanntschaft mit Ihnen gemacht. Ja, das ist es.« Er schob nachdenklich die Unterlippe vor und nickte erneut. »In einem Fall eine traurige Geschichte, ohne dass ich jemandem die Schuld zuweisen möchte.« Jetzt lächelte er übertrieben breit. »Der ›Abwickler‹, nicht wahr? Werden Sie nicht so genannt?«
Zwei der Männer an der Bar senkten in Zeitlupe ihre Gläser. Peter spürte, wie sie die Ohren spitzten. Er stellte sein Glas ab und trat einen kleinen Schritt zurück. »Um welchen Fall ging es, wenn ich fragen darf?«
»Never mind.«