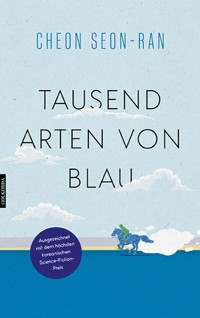
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Golkonda Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Das einstige Spitzenrennpferd Today, das, gnadenlos zu Höchstleistungen getrieben, wegen seiner kaputten Gelenke eingeschläfert werden soll; Koli, der zerborstene Roboter-Jockey, der durch eine Chip-Verwechslung menschliche Gefühle besitzt, die er eigentlich nicht haben dürfte, Eunhye, die an den Rollstuhl gefesselt ist, da ihre Mutter das Geld für die Transplantation künstlicher Beine nicht aufbringen kann, Yeonjae, die vor einer ungewissen Zukunft steht, und Bogyeong, die unendlich um ihren verlorenen Gefährten trauert ... Dieser zauberhafte Roman gibt seinen Figuren, die in einer sich immer rasanter drehenden kapitalistischen Welt abgehängt zu werden drohen, eine Stimme. So ist Tausend Arten von Blau eine Geschichte über Hoffnung, Trost und die wahre Bedeutung von Glück.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 423
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
CHEON SEON-RAN
TAUSEND ARTEN VON BLAU
Aus dem Koreanischen von Jan Henrik Dirks
INHALT
KOLI
YEONJAE
BOGYEONG
EUNHYE
YEONJAE
BOKHUI
BOGYEONG
EUNHYE
YEONJAE
KOLI
EUNHYE
BOKHUI
EUNHYE
BOGYEONG
YEONJAE
KOLI
Die Kammer für den Jockey war so groß, dass eine erwachsene Person sich hineinhocken konnte. Hinlegen oder mit ausgestreckten Beinen hinsetzen konnte man sich nicht. Doch für den Jockey war das nicht relevant. Er maß einen Meter fünfzig und wog vierzig Kilogramm, und nun saß er hier in dieser viereckigen, fensterlosen Betonzelle und wartete. Der Raum fühlte sich noch enger an, als er tatsächlich war. Dass er von hier aus nicht den Himmel sehen konnte, gefiel C-27 nicht. Der Ausdruck »gefallen« passte, wie er selber wusste, im Grunde nicht zu ihm, war in diesem Zusammenhang wohl aber am angemessensten. So hockte er in seiner kleinen Zelle, in die kein Lichtstrahl drang, und wartete. Lange. Sehr lange. Immer weiter wartete er – auf das Mädchen.
Dies ist das Ende der Geschichte. Und es ist auch mein Ende. Ich stürze. In gewöhnlicher Geschwindigkeit würde der Sturz nicht länger dauern als drei Sekunden. Doch ich stürze um ein Vielfaches langsamer, mich allmählich vom Himmel entfernend. Beim Aufprall wird mein Körper keinen Schmerz spüren. Aber er wird in unzählige Teile auseinanderbrechen. Dass ich keinen Schmerz empfinden kann, hat jemand einmal als Grund für meine Existenz und als meinen größten Vorteil bezeichnet. Doch damit hatte er unrecht. Wenn ich Schmerz empfinden könnte, wäre ich nicht gefallen und sähe nun nicht meinem Ende entgegen. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass der Schmerz das herausragendste Abwehrprogramm lebender Organismen darstellt, über das außer ihnen auch niemand verfügt. Der Schmerz hält Menschen am Leben, der Schmerz lässt Menschen weiter wachsen. Es sind zum einen physikalische, zum anderen nicht-physikalische Gründe, die mich zu dieser Erkenntnis gebracht haben. Ob es wohl möglich ist, während meines Sturzes die Geschichte in ganzer Länge zu erzählen? Nach gewöhnlichem Ermessen nicht. Aber für mich fühlt sich die Zeit bis zu meinem Ende sehr lang an, und so könnte es vielleicht gelingen.
Bis vor drei Sekunden saß ich noch auf Todays Rücken. Today ist eine Stute, deren schwarzes Fell so herrlich glänzt wie eine schimmernde Wasseroberfläche. Von Today werde ich später noch ausführlicher berichten, doch fürs Erste ist nur von Bedeutung, dass sie ein Rennpferd ist, ein Rennpferd, perfekt auf mich abgestimmt, mit mir im Einklang atmend. Und ich bin der Jockey, der mit ihr im Einklang atmet. Vor sechs Monaten, im März, begegneten wir einander zum ersten Mal. Die Gelegenheit dazu ergab sich durch einen fatalen Irrtum. Auch davon werde ich später noch erzählen. Jetzt ist nur wichtig, dass wir heute, im September, zum letzten Mal im Einklang miteinander geatmet haben. Historisch, so möchte ich den heutigen Tag nennen. Als historisch bezeichnen die Menschen oft Tage, an denen etwas ganz Neues begonnen hat, noch öfter aber Tage, an denen ein Wunder geschehen ist. Ein Wunder. Heute ist der zweite Tag in meinem kurzen Leben, an dem ein Wunder geschehen ist.
Ich höre den Aufschrei. Mein Sturz vom Pferd, so lang er sich auch hingezogen hat, scheint zu Ende zu gehen. Yeonjae hatte mir vorgeschlagen, mich nach dem Rennen neu zu lackieren, denn mein Lack war an vielen Stellen schon abgeblättert. Welche Farbe ich denn wolle. Grün, so wie bisher, hätte eigentlich gut zu meinem Namen gepasst, aber wie ich so im ersten Stock saß und aus dem Fenster sah, sagte ich: »Blau«. Yeonjae war einverstanden.
Yeonjae. Familienname: Woo. Woo Yeonjae. Dieser Name ist genauso wichtig wie der von Today. Sie ist diejenige, die mich gerettet und ausgewählt hat. Meine Welt. Wenn sie wüsste, dass ich sie so nenne, würde sie sicher die Stirn krausziehen und mir einen rätselhaften Blick zuwerfen, leicht ungehalten, aber ohne jede Spur von Abneigung.
Es war Yeonjae, die Today und mich zurück auf die Rennbahn gebracht hat. Sie war es, die für das zweite Wunder gesorgt hat. Ein ganz gewöhnlicher, aber doch sehr besonderer und mutiger Mensch.
Meine Beine haben sich nun vollkommen von Todays Körper gelöst. Today galoppiert in einer Geschwindigkeit von fünfzig Stundenkilometern. Nicht zu schnell und nicht zu langsam. Befreit vom Druck der Welt, wird sie in gleichbleibender Geschwindigkeit in das Leben zurückkehren, das sich nun vor ihr auftut.
Vor ein paar Tagen noch war es beschlossene Sache gewesen, dass Today eingeschläfert und ich entsorgt werden sollte. Doch nun galoppiert sie wieder über die Rennbahn. Und ich stürze. Beim Aufprall werde ich in sämtliche Einzelteile zerschellen. Eine solche Prophezeiung würden Menschen wohl mit Instinkt erklären, ich aber generiere Resultate, die auf exakten Daten und Berechnungen beruhen. Meine Zukunft kennt keine fehlerhaften Prognosen. Und nun soll davon die Rede sein, was mir in der kurzen Zeit, die ich bis hierhin erlebt habe, widerfahren ist.
Mein Name ist Koli. Ich heiße so, weil meine Farbe der eines Brokkoli ähnelt.
KOLI
Bevor er Yeonjae traf, trug Koli den Namen C-27.
Er wurde im Jahre 2035 im koreanischen Daejeon aus Bauteilen amerikanischer, chinesischer und japanischer Produktion zusammengesetzt. Doch im Gegensatz zu anderen Humanoiden, die wie er als Jockey für Pferderennen produziert wurden, war ihm im letzten Schritt der Produktionsphase versehentlich ein falscher Softwarechip eingesetzt worden. Der Chip war einem Forschungspraktikanten, der sich am Fließband aufgehalten hatte, um einen Bericht zu schreiben, aus der Tasche gefallen, ein Chip, der Informationen zu kognitiven Fähigkeiten und Lernkompetenz enthielt und für noch im Entwicklungsstadium befindliche selbstlernende Humanoide gedacht war, also keineswegs für solche, die im Pferderennsport zum Einsatz kamen. Der Praktikant hatte seit vier Tagen nicht geschlafen, war vollkommen übermüdet und hatte dementsprechend Mühe, überhaupt die Augen offenzuhalten. Als er nun am letzten Produktionsgang auf den Betriebsleiter traf und zur Begrüßung seine Visitenkarte zückte, war ihm der Chip heruntergefallen. Da er die Visitenkarte in seinem Portemonnaie nicht gleich hatte finden können und erst eine Weile darin hatte herumsuchen müssen, war ihm der Verlust überhaupt nicht aufgefallen. Mit den Gedanken schon in seinem Bett und gleichsam bereits im Halbschlaf, hatte er die Fabrik schließlich verlassen. Der für diesen Abschnitt der Produktionsanlage zuständige Putzdienst hatte den heruntergefallenen Chip dann gefunden und ihn kurzerhand in den nächsten Behälter mit Computerchips geworfen.
Es waren also gleich zwei Dinge passiert, die nicht hätten passieren dürfen: zum einen, dass der Praktikant den Chip hatte fallen lassen, zum anderen, dass der Putzdienst diesen einfach in den falschen Behälter geworfen hatte. Zwei Fehler, die einer Maschine niemals unterlaufen wären. So war es gewissermaßen menschliches Versagen gewesen, dem Koli seine Geburt verdankte.
Koli öffnete die Augen. Ein Angestellter rüttelte ihn ziemlich unsanft hin und her, um seine Sicherheitsinstallation zu überprüfen. Sein Hinterkopf war auf den Ständer gestoßen, und da dies bei Koli, anders als bei anderen Jockeyrobotern, als Wake-up-Signal kodiert war, hatte sich sein Hauptschalter eingeschaltet. Der Angestellte, der Koli keinerlei Aufmerksamkeit schenkte und das nun brennende Licht in dessen Augen nicht bemerkte, hievte ihn in den Laderaum und schloss die Tür.
Die aus mehreren Lastwagen bestehende Kolonne verließ Daejeon und fuhr in Richtung Seoul. Jedes Mal, wenn der selbstfahrende Laster sanft um eine Ecke bog, wurde Kolis Körper leicht hin- und herbewegt. Der Laderaum hatte ein schmales, längliches Fenster, damit man von draußen hineinsehen konnte. Dieses Fenster war für Koli die einzige Möglichkeit, einen Blick nach draußen zu werfen. Unermüdlich rollte der Laster über die nächtliche Autobahn, immer wieder Tunnel durchquerend, die von bläulich blitzendem Licht erhellt wurden. Es war noch etwa eine Stunde bis zu ihrer Ankunft, da sah Koli durch das Fenster die Sonne am Horizont aufgehen. Die Lichtstrahlen fielen durch die schmale Öffnung auf die Innenwand des Laderaums. Um dies genauer anzusehen, löste Koli mühsam seinen Kopf aus der Arretierung. Da erblickte er neben sich eine Reihe anderer Jockey-Humanoiden, die aber alle ausgeschaltet waren.
»Hallo?«
Es war das erste Mal, dass er feststellte, dass er eine Stimme besaß. Er sprach die anderen Roboter noch ein paarmal an, aber niemand antwortete. Er bemerkte, wie ihre Körper, der Bewegung des fahrenden Lastwagens folgend, mit leichtem Klappern hin- und herschaukelten. Dann richtete er seinen Blick wieder nach vorne. Er sah in ein hell leuchtendes Rot. Die Sonne war nun ganz aufgegangen.
»Strahlend.«
Koli war erstaunt darüber, welch hohe Farbintensität dort draußen in der Welt herrschte, und auch darüber, dass er über die entsprechende Begrifflichkeit verfügte. Er fragte sich, wie weit sein Sprachvermögen wohl reichte. Er sah aus dem Fenster und artikulierte im Randommodus Wörter, die ihm einfielen. Prächtig. Hübsch. Schön. Gelb. Rot. Blau. Schnell. Furchterregend. Haarsträubend. Kühl. Kalt. Heiß. Stechend. Schmerzhaft. Anstrengend. Qualvoll … Dabei kam er auch auf einige Begriffe, die sich mit Adjektiven nicht adäquat zum Ausdruck bringen ließen.
Koli sagte immer mehr Wörter. Der Laderaum füllte sich mit Wörtern. Kurz bevor er ganz von Wörtern voll war, erreichte der Lastwagen sein Fahrtziel, und auch Kolis Vokabular war an sein Ende gelangt. Tausend Wörter. Tausend Wörter waren ihm eingefallen. Die Zahl der Sätze, die sich daraus bilden ließen, würde noch erheblich höher liegen. Koli fragte sich, wie viele Sätze er wohl zustande bringen würde, doch da öffnete sich die Tür des Laderaums. Der Mitarbeiter stellte erschrocken fest, dass Kolis Licht brannte, und drückte rasch auf den Ausschalter. Nun konnte Koli keine Sätze mehr bilden.
Als er die Augen wieder öffnete, befand er sich in einer Kammer, an drei Seiten von Betonwänden umgeben. Es gab kein Fenster, und die Tür bestand aus einem Eisengitter. In dieser Kammer konnte man zwar stehen oder hocken, beim Sitzen aber nicht die Beine ausstrecken oder sich hinlegen. Das an der Wand befestigte Ladekabel war mit Kolis Nacken verbunden. Er zog den Stecker heraus und stand auf. Den Kopf vorstrecken konnte er nicht. Er griff nach den engstehenden Gitterstäben in der Tür. In der Zelle gegenüber erblickte er einen anderen Jockey-Humanoiden.
»Hallo?«
Der andere wandte den Kopf. Sein Gesicht war rot lackiert, und die Nummer auf seiner Brust lautete F-16.
»Was machst du da?«, fragte Koli. F-16 antwortete nicht, sondern sah ihn nur an. Koli fragte:
»Weißt du, wo wir hier sind?«
Am Hals von F-16 blinkte ein Lämpchen, doch noch immer kam keine Antwort. Koli fragte nicht weiter, sondern hielt nur den Blick auf sein Gegenüber gerichtet. Dass die Zeit verging, war ersichtlich anhand des Sekundenzeigers der Uhr, die an der Zellenwand angebracht war, doch dafür, wie lange sich diese Zeit hinzog, hatte Koli kein Gefühl. Während er F-16 musterte, registrierte er lediglich, dass der Sekundenzeiger anderthalb Runden auf dem Zifferblatt drehte.
Am nächsten Tag stellte sich heraus, weshalb F-16 nicht geantwortet hatte. Es kamen ein Mann in schwarzem Mantel und zwei Frauen in Fliegerjacken, um F-16 abzuholen. Der Mann, eine Zigarette rauchend, meinte: »Sag ich doch, das Ding ist kaputt. Gibt keinen Mucks mehr von sich. Mitnehmen und gegen einen anderen auswechseln. Und den Neuen vorher genau auf mögliche Defekte überprüfen.«
F-16 kam in eine kleine Box und wurde mitgenommen. Koli versuchte noch, ihm nachzuschauen, konnte seinen Kopf aber nicht durch die Gitterstäbe der Tür stecken und nahm nur das Geräusch der sich entfernenden Schritte wahr. Er sah die leere Zelle. Und dann geschah etwas Eigenartiges. Die Uhr in seiner Kammer war zweifelsfrei vollkommen in Ordnung, und doch schien die Zeit plötzlich langsamer zu vergehen. Für diese Abweichung gab es keine Erklärung. Koli nahm lediglich wahr, dass in diesem Augenblick etwas nicht stimmte.
Zweiundfünfzig Stunden später öffnete sich die Tür. Wieder erschien der Mann im schwarzen Mantel, diesmal in Begleitung von vier weiteren Männern.
»Komm mit.«
Aufgrund der Zigarette in seinem Mund war seine Aussprache undeutlich, aber Koli verstand die Anweisung ohne Schwierigkeiten und setzte sich in Bewegung. Er folgte den Männern aus dem Gebäude ins Freie. Sie gingen die zu beiden Seiten eingezäunte Straße entlang. Der Weg war von kahlen Bäumen flankiert, und bei jedem Schritt raschelte das trockene Laub unter ihren Füßen.
»Rascheln.«
Koli formte das Wort mit den Lippen nach. Einer der Männer schien das dahingemurmelte Wort mitbekommen zu haben, denn er warf ihm einen Blick von der Seite zu, sagte aber nichts. Sie erreichten eine großräumig angelegte Pferderennbahn und betraten das Wettkampfgelände. Koli blickte sich um und sah die leeren Zuschauerränge. Auf dem Rasen standen neunzehn Jockey-Humanoiden in einer Reihe. Koli stellte sich ganz ans Ende. An diesem Tag sah er zum ersten Mal ein Pferd. Das Pferd, das für ihn vorgesehen war, war eine schwarze Stute namens Today.
Der Mann im schwarzen Mantel stellte in der Mitte des Stadions einen Stuhl auf und setzte sich. Die Roboterjockeys stiegen einer nach dem anderen auf ihre Pferde und begannen langsam eine Runde zu drehen. Nach einer Weile gingen die Pferde in einen leichten Galopp über. Manche Jockeys hielten sich in sicherer Haltung eine Runde lang im Sattel, andere verloren das Gleichgewicht und stürzten vom Pferd. Der Mann nahm das Geschehen aufmerksam, aber kommentarlos zur Kenntnis. Ein Mitarbeiter stand daneben und führte sorgsam Protokoll.
Als Koli an der Reihe war, erschien ein Mann, der – wie sein Namensschild zu erkennen gab – Do Minju hieß, ergriff Todays Zügel, führte sie auf die Rennstrecke und tätschelte ihr kräftig den Hals. Koli stand daneben und sah zu. Minju befahl Koli, den Sattel zu ergreifen, in den Steigbügel zu treten und sich dann auf den Rücken des Pferdes zu schwingen. Aber Koli tätschelte zunächst einmal, genauso wie Minju es vor ihm getan hatte, den Hals des Pferdes. Minju lachte etwas unsicher und fragte, was Koli denn da tue.
Koli fragte seinerseits: »Wozu macht man das?«
Minju überlegte kurz und sagte dann: »Um mit dem Pferd zu kommunizieren. Um ihm mitzuteilen: Jetzt steige ich gleich auf deinen Rücken.«
»Man berührt es doch nur mit der Hand, wie versteht das Pferd denn, was gemeint ist?«
»Das ist so eine Art Code. Eine Übereinkunft.«
»Eine Übereinkunft.«
Koli wiederholte das Wort. Eine Übereinkunft war etwas Praktisches. Sie bedurfte offenbar nicht vieler Worte. Den Hals tätscheln, die Zügel fest im Griff halten, die Sporen geben, ein paar anfeuernde Rufe – und schon galoppierte ein Pferd, mit dem man sich noch nie unterhalten hatte, über die Rennbahn.
Koli tätschelte dem Pferd noch einmal den Hals, setzte den Fuß in den Steigbügel und schwang sich auf den Sattel. Er begann langsam seine Runde zu drehen, zunächst die Grundsitzhaltung beibehaltend. Die Hüfte straff durchgestreckt. Wenn Kopf, Schulter, Hüfte und Ferse senkrecht zum Erdboden stehen, federt die Hüfte die Stöße des galoppierenden Pferdes ab. Die besondere Konstruktion seiner Hüfte, die so gefertigt war, dass sie sich den Bewegungen des Pferdes flexibel anpasste, ersparte Koli jeden zusätzlichen Kraftaufwand. Er blickte geradeaus, dann auf seine Hände, die Zügel fest im Griff, dann auf seine Füße, seitlich herabbaumelnd.
»Immer nach vorne gucken! Nicht zur Seite!«, ermahnte ihn Minju, der nebenherlief und versuchte, mit dem Pferd Schritt zu halten. Koli schaute wieder nach vorne.
»Das fühlt sich anders an, als mit dem Lastwagen zu fahren«, sagte er.
Minju warf Koli einen leicht stutzigen Blick zu. Dann erklärte er, dass nun der Galopp beginnen werde. Koli setzte die Füße auf Minjus Anweisung hin in den oberen Steigbügel, hob sein Gesäß aus dem Sattel, presste die Unterschenkel an den Körper des Pferdes und beugte den Oberkörper nach vorne, beständig das Gleichgewicht haltend. Minju erklärte, dass es sich hierbei um den sogenannten »Forward seat« handele. Auf sein Signal hin begann Today allmählich das Tempo zu erhöhen. Der untere Teil seiner Gelenkkonstruktion, die bis zum Fußgelenk reichte, absorbierte, ohne dass Koli Kraft hätte aufwenden müssen, die Bewegungen des Pferdes, und die am Gesäß installierte Hydraulik federte die vertikalen Stöße des Sattels ab. Alles war so entworfen worden, dass Today möglichst wenig von Koli spürte.
Je schneller Today lief, desto kräftiger blies der Wind. Koli registrierte dies anhand der wehenden Mähne des Pferdes. Es war doch bemerkenswert, wie die vielen einzelnen Haare der Mähne alle derselben fließenden Bewegung folgten wie ein einziger Organismus. Koli spürte plötzlich den Impuls, die Mähne berühren zu wollen. Er ließ die Zügel los und streckte die Hand aus. Er fühlte nichts. Aber der Anblick der wehenden Mähne, die zwischen seinen Fingern zu fließen schien, war faszinierend.
In diesem Augenblick kam er aus dem Gleichgewicht und begann heftig zu schwanken. Minju, der dies auch von Weitem sofort bemerkt hatte, rief ihm zu, er solle sofort die Zügel straffen. Koli befolgte die Anweisung, und Today blieb stehen. Minju kam quer durch das Stadion angelaufen. Außer Atem blieb er neben Koli stehen.
»Du darfst die Zügel nicht loslassen. Warum hast du das gemacht?«
Es war weniger eine Frage als vielmehr eine Rüge, aber Koli, der den Ton dieser Äußerung nicht erfasste, antwortete vollkommen ruhig:
»Ich wollte einmal die Mähne anfassen.«
Auf Minjus Stirn begannen sich drei dicke Falten abzuzeichnen, und die rechte Augenbraue rutschte ein Stück nach oben. Den Bewegungen seiner Gesichtsmuskulatur nach zu urteilen, handelte es sich weder um Freude, Unzufriedenheit oder Zorn, sondern um eine Emotion, die etwas komplexer zu sein schien. Offenbar hatte Minju nicht ganz verstanden, was Koli da eben gesagt hatte. Doch er fragte nicht weiter, sondern beschränkte sich – noch immer außer Atem von seinem Sprint über den Rasen – auf die knappe Anweisung, dass Koli nun vom Pferd steigen solle. Mit leichtem Bedauern tat Koli, was man von ihm verlangte. Und tätschelte Today noch einmal den Hals.
Das kurze Training war beendet, und Koli kehrte zurück in seine Zelle. Als er sah, wie Minju die elektronische Chipkarte hervorholte, um die Gittertür zu verriegeln, fragte er: »Kann die Tür nicht offen bleiben?«
Minju hielt die Karte an das Gerät, und die automatische Verriegelung schloss sich. Koli fragte: »Hast du Sorge, dass ich verschwinden könnte, wenn die Tür nicht abgeschlossen ist? Vertraust du mir nicht?«
»So sind nun einmal die Vorschriften. Nichts zu machen.«
Koli nickte. Er bat nicht weiter darum, die Tür unverriegelt zu lassen. Die Einhaltung von Vorschriften war wichtig. Er wusste, dass eine geordnete Gesellschaft nur auf der Grundlage eingehaltener Vorschriften möglich war. Auch Koli selbst war mit einigen Regeln ausgestattet worden. Eine bestand darin, dass er niemals einen Menschen angreifen dürfe, eine andere darin, dass er die Befehle der Menschen befolgen müsse. Er sagte zu Minju:
»Teilen Sie mir bitte mit, falls die Vorschriften geändert werden.«
Minju verließ wortlos die Jockeykammer.
Von nun an fand jeden Tag ein fünfstündiges Training statt. Das hieß nicht, dass fünf Stunden lang ununterbrochen trainiert worden wäre. Tatsächlich bestand ein Großteil des Trainings aus Wartezeit. Dann stand Koli dort im großen Stadion und betrachtete den Himmel und die Bäume, die außerhalb des Wettkampfgeländes zu sehen waren. Der Himmel sah an jedem Tag und zu jeder Stunde anders aus. Oft war er blau, aber manchmal mischte sich dieses Blau auch mit einer violetten, rosafarbenen, gelblichen oder grauen Tönung. Koli wusste nicht recht, wie diese Farben wohl zu bezeichnen wären, und bildete Komposita wie »blau-violett« oder »grau-gelb«. Es brauchte wohl Tausende und Abertausende von Wörtern, um die Welt zu beschreiben. Und bei diesem Gedanken befiel ihn auch die Sorge, dass ja dort draußen in der Welt vielleicht tatsächlich bereits so viele Wörter existierten, er sie nur nicht kannte. Wie würde er all diese Wörter lernen können?
Der Himmel sah jedes Mal anders aus, besonders aber gefiel er Koli, wenn er bewölkt war. »Gefallen« bedeutete in diesem Zusammenhang, dass er den Himmel dann besonders oft und besonders lange betrachtete. Die Wolken, die alle unterschiedlich geformt und unterschiedlich dick waren. An denen man sehen konnte, dass der Himmel keine Fläche, sondern ein Raum war. Die nicht zu Boden fielen, sondern sich am Himmel bewegten, umhergetrieben vom Wind. Das war etwas, das Koli aus Gründen der Gravitation nicht konnte. Eines Tages sagte Koli zu Minju, dass er gerne einmal die Wolken berühren würde. Minju überhörte die Bemerkung.
Koli war nun jeden Tag mit Today zusammen. Nie vergaß er, ihr den Hals zu tätscheln, und manchmal fügte er auch ein paar Worte hinzu. Minju bemerkte dies, sagte aber nichts weiter dazu.
Koli fiel mit der Zeit auf, dass die anderen Humanoiden im Gegensatz zu ihm niemals den Himmel betrachteten, das Pferd am Hals tätschelten oder Minju von sich aus ansprachen. Es musste sich bei ihm um eine Fehlfunktion handeln. Auch dass sich damals der Hauptschalter von alleine angeschaltet hatte, musste damit zusammenhängen, dass irgendein Teil in ihm nicht einwandfrei funktionierte. Aber darüber hinaus stellte sich Koli keine weiteren Fragen. Er fragte sich nicht, weshalb er diese Gedanken eigentlich hatte, wieso er neue Wörter lernen wollte und warum er in seiner engen Zelle die Zeit abzuschätzen versuchte. All seine Reaktionen erfolgten augenblicklich und waren stets auf das unmittelbar Sichtbare gerichtet. In seiner Kammer dachte er nicht an den Himmel, auf der Rennbahn fragte er sich nicht, wie viel Zeit wohl vergangen sei, und wenn er auf dem Pferd saß, war er nicht daran interessiert, sein Vokabular zu erweitern.
Manchmal allerdings geschah es, dass ihm vollkommen unerwartet an bestimmten Orten besondere Sätze einfielen. Koli vermutete, dass sich in seinem Körper ein Raum befand, in dem all diese Sätze gespeichert waren, und dass die Sätze von Zeit zu Zeit daraus hervorsprangen. Als sie wieder einmal vor der Jockeykammer ankamen, fragte Koli:
»Warum macht man Wettkämpfe mit Pferden und Reitern?«
Minju machte ein ratloses Gesicht. Diese Frage schien ihm schwieriger zu beantworten als »Wofür braucht man dieses oder jenes Ding?«, »Warum ist der Himmel blau?«, »Warum regnet es?« oder »Warum liegt hier Sand auf dem Boden?«. Minju hatte eigentlich keine Lust, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, aber ein wenig Zeit, um eine halbwegs angemessene Antwort zu finden, nahm er sich doch. Für Koli war Minju ein netter Mensch. Immerhin antwortete er, wenn er etwas gefragt wurde, selbst wenn die Antwort manchmal auch nur lautete: »Ich weiß es nicht.« Im Gegensatz dazu zuckten der Mann im schwarzen Mantel oder die anderen Männer, die sich hier manchmal blicken ließen, nicht einmal mit der Wimper, wenn Koli sie mit einem höflichen »Guten Tag« begrüßte.
»Weil es Spaß macht«, antwortete Minju schließlich und fand die Antwort selber ein bisschen billig, aber eine bessere Erklärung fiel ihm im Augenblick nicht ein. Vielleicht war dies ja sogar genau die richtige Antwort. Wenn es keinen Spaß machen würde, gäbe es Pferderennen ja vermutlich schon längst nicht mehr. Der Grund, weshalb seit Jahrtausenden Pferderennen ausgetragen wurden, konnte doch eigentlich nur der sein, dass es eben Spaß machte.
»Wem macht es Spaß? Den Pferden?«
»Nein, den Menschen.«
»Wenn es den Menschen Spaß macht, warum laufen dann die Pferde? Dann müssten doch eigentlich die Menschen laufen.«
Beinahe hätte Minju lachen müssen, aber er verkniff es sich.
»Das Zuschauen macht Spaß. Es wird auch darauf gewettet, welches Pferd gewinnt. Und Wettrennen, wo Menschen gegeneinander antreten, gibt es auch. Aber das ist etwas anderes als ein Pferderennen.«
»Und warum müssen die Pferde dann laufen?«
»Den Pferden macht das Laufen ja auch Spaß.«
Minju klang inzwischen leicht genervt. Er wollte die Konversation rasch beenden, aber Koli, dem dies nicht bewusst war, fragte konsequent weiter.
»Woher weiß man denn, dass es den Pferden Spaß macht?«
»Nun, ich glaube, es wird jetzt Zeit, dass wir …«
»Bitte sagen Sie es mir.«
»Was denn?«
»Ich möchte auch wissen, ob es Today Spaß macht. Woran kann man das erkennen?«
Wenn Minju ihm gesagt hätte, dass es jetzt genug sei mit der Fragerei, hätte Koli keinen Widerspruch eingelegt. Aber Minju beschloss, die Frage nicht zu ignorieren, und führte Koli zu dem Gebäude, in dem die Pferde untergebracht waren.
Vor Todays Box hielt er an. Today steckte ihr Maul durch die Gitterstäbe. Minju streichelte ihr die Nase und begrüßte sie.
»Warum berühren Sie sie da?«
»Das ist so ähnlich, wie wenn man dem Pferd den Hals tätschelt, das bedeutet: Ich kümmere mich um dich.«
Koli wollte es Minju gleichtun und streckte die Hand aus, aber mit seinen anderthalb Metern Körpergröße gelang es ihm nicht recht, Todays Nasenrücken zu streicheln. Er schaffte es gerade einmal, ihre Nase ein wenig mit der Hand zu umfassen. Minju hätte eigentlich gerne gefragt, warum Koli der emotionale Kontakt mit dem Tier so wichtig war, sagte aber nichts. Die Vorstellung, einem Roboter eine solche Frage zu stellen, kam ihm doch zu seltsam vor.
Minju ging zu einem Kasten, der dort im Pferdestall stand, und kam mit einer erdverkrusteten Mohrrübe zurück. Diese war dünner und länglicher als die Mohrrüben, die zum Kochen verwendet wurden, auch war sie nicht so gerade gewachsen. Was im Gemüseladen nicht dem gewünschten Standard entsprach, landete hier. Diese mageren Mohrrüben wurden für das Training der noch neuen Pferde verwendet und dienten zuweilen als kleine Zwischenmahlzeit, wenn die Pferde kein gewöhnliches Futter und kein Heu bekommen konnten. Today begann etwas heftiger zu atmen, vielleicht hatte sie den Geruch der Mohrrübe gewittert. Minju bedeckte Todays Nase mit der flachen Hand und bedeutete ihr zu warten.
»Nun steig mal auf. Ich helfe dir.«
Minju hielt das Pferd an der Schulter fest, sodass Koli aufsteigen konnte. Koli umklammerte Todays Rücken und kletterte nach oben. Ohne Sattel auf dem Pferderücken zu sitzen, war gar nicht schlecht. Die Haut oder das Fell des Tieres konnte Koli zwar nicht spüren, aber wie er so die Kurve des Pferderückens betrachtete, erschien sie ihm nicht sehr steil, und er fühlte keine Unsicherheit, vielleicht auch aufgrund der langen Trainingszeit, die er nun bereits im Sattel verbracht hatte.
»Hast du ein bestimmtes Gefühl? Kannst du etwas spüren?«
»Feine Empfindungen, die über die Haut übertragen werden, spüre ich nicht. Hitze oder Kälte auch nicht. Leichte Vibrationen aber nehme ich wahr.«
»Gut. Lehn dich nach vorne und umgreif Todays Hals.«
Koli folgte Minjus Anweisung und umschlang den Hals des Pferdes, während Minju Today mit einer Mohrrübe fütterte. Koli nahm wahr, wie ihr Körper durch die Kaubewegungen schwach zitterte und sich dann in Erwartung weiteren Futters leicht bewegte, wie ihr Puls sich ein wenig beschleunigte und ihre Atmung nun etwas heftiger wurde. Kleine, aber deutlich wahrnehmbare Veränderungen.
»Ob ihr das gefällt?«, fragte er.
»Natürlich. Sie hat doch etwas Leckeres zu essen bekommen«, antwortete Minju.
Ganz sicher war sich Minju zwar nicht, aber er hatte schon das Gefühl, dass es Today gefiel. Und er hatte auch den Eindruck, das Koli sich über seine Antwort freute, aber diesen Gedanken verwarf er schnell wieder. Koli mochte in gewisser Hinsicht seine Besonderheiten haben, ihm aber eine eigene Gefühlswelt zuzusprechen, ging doch zu weit. Minju fragte sich zwar, woher Kolis Neugier denn rühren mochte, ob es vielleicht ein Phänomen war, das bei einigen wenigen Roboterjockeys eben auftrat, oder ob Koli vielleicht der einzige Humanoid auf der Welt war, der sich so verhielt; mit Antworten auf diese Fragen aber würde er nicht rechnen können. Diese Informationen lagen für jemanden wie Minju, der ja nur rein zufällig mit Jockey-Humanoiden in Berührung gekommen war, schlicht außer Reichweite.
Koli schloss die Augen und spürte das leichte Zittern von Todays Körper. Die Vorstellung aber, dass Koli in diesem Moment etwas aufgegangen sein könnte, war wohl eher Illusion und vielleicht einfach Minjus Überheblichkeit und Unkenntnis geschuldet.
Minju ließ Koli nun erst einmal wieder absteigen. Für heute reiche es, er solle nun zurück in seine Kammer gehen – eine Anweisung, die Koli anstandslos befolgte.
Als er wieder in seiner Zelle hockte, erinnerte er sich an das leichte Zittern, das er gespürt hatte, als er auf Todays Rücken gesessen hatte. Und seinem Datenspeicher fügte er das Wort »Freude« hinzu.
Am nächsten Tag sah Koli, dass Minju recht gehabt hatte. Als Today in hohem Tempo galoppierte, ließ Koli noch einmal die Zügel los und legte Today die Hand auf den Nacken. Das Zittern, dass er nun spürte, war heftiger und intensiver als am Tag zuvor, als Today die Mohrrübe bekommen hatte. Für Koli stand fest, dass, so wie er selbst dafür gefertigt worden war, auf dem Rücken eines Pferdes zu sitzen und Rennen zu bestreiten, auch dieses Lebewesen von jemandem dafür gebaut worden sein musste, schnell zu laufen. Und nun, da er erfahren hatte, dass Today so etwas wie Glück empfand, kam er zu dem Schluss, dass ihre Glücksempfindung bedeuten müsse, dass auch er selber glücklich sei. Todays Mähne wehte fließend im Wind, und ihr Körper schauderte vor Glück. Koli fühlte den schnellen Herzschlag des Pferdes. Today, bist du glücklich? Dann bin ich es auch.
Von einem bestimmten Zeitpunkt an war es nicht mehr Minju, sondern Koli, der vor dem Rennen Todays Hals tätschelte. Ihre Zeiten verbesserten sich allmählich und damit auch Todays Marktwert. Eines Tages, als einer der Bodyguards unmittelbar vor dem Rennen den Pferdesportkanal eingeschaltet hatte, hörte Koli die Stimme eines Kommentators:
»Today und ihr Jockey atmen geradezu im Einklang. Und hier sehen wir das Ergebnis!«
Atmen. Das Wort kannte Koli. Er wusste, was es bedeutete, und so wusste er auch, dass er selber nicht atmete. Chemische Reaktionen zwischen Körper und Luft, Dinge wie Absorbierung, Spaltung und Gasausstoß waren Lebewesen vorbehalten. Kolis Körper tat nichts von alldem. Koli konsumierte, akkumulierte und konvertierte in seinem Körper Energie. Warum aber war dann davon die Rede, dass er atme?
»Das ist ein bildlicher Ausdruck. Das bedeutet einfach, dass ihr gut zusammenpasst. Dass ihr ein gutes Team seid«, erklärte Minju. Koli dachte, das Minju wohl recht habe, aber ganz wahrhaben wollte er es nicht. Er hatte irgendwie das Gefühl, dass auch er selbst tatsächlich atmete. Minju atmete, ohne darüber nachzudenken, und bei jedem Atemzug schwoll sein Körper zunächst ein klein wenig an und schrumpfte dann wieder ein bisschen in sich zusammen. So war das bei allen Menschen und Tieren, denen Koli bisher begegnet war. Wenn man atmete, bewegte sich der Körper ganz von selbst. Auch bei Koli kam es vor, dass sich sein Körper unwillkürlich bewegte. Wenn er auf Todays Rücken saß und sie über die Rennbahn rasten. Zwar schwoll sein Körper dann nicht an, aber er bewegte sich, Todays Bewegungen folgend, leicht auf und ab wippend, ohne dass ihm dies irgendjemand befohlen hätte.
»Wenn ich mit Today galoppiere, dann atme ich auch. Im gleichen Rhythmus wie Today. Könnte man das nicht auch als bildlichen Ausdruck benutzen?«
»Ja, klar, könnte man.«
Jedes Mal, wenn er auf Todays Rücken dahingaloppierte, atmete er. Und wenn man davon ausging, dass nur Lebewesen atmen können, dann war Koli in diesen Momenten ein Lebewesen, ein lebendiges Wesen. Koli war lebendig.
So dachte er sich das. Dass er immer dann lebendig war, wenn Today ihr Rennen lief. Doch was bedeutete es eigentlich, lebendig zu sein?
Danach aber fragte er Minju nicht. Today wurde mittlerweile zu einem Preis von mehr als fünfzig Millionen Won gehandelt, und da ihnen infolgedessen nun ein eigener Manager zur Seite gestellt wurde, sahen sie Minju kaum noch. Als Koli dem neuen Manager erklärte, dass er lebendig sei, meinte der bloß kopfschüttelnd: »Irgendwo ’ne Sicherung durchgebrannt?«
Koli sehnte die Tage herbei, an denen er Minju wieder treffen würde und in aller Ruhe mit ihm sprechen könnte, doch dazu sollte es vorerst nicht kommen. Das teure Pferd und sein Reiter wurden nun manchmal im Lastwagen zu Auswärtsrennen befördert, wobei Today im engen Innenraum des Transporters nicht nur fressen, sondern auch ihre Exkremente ausscheiden musste und weder gewaschen wurde noch sich hinlegen und ausruhen konnte. Alles, was Koli für sie tun konnte, war, ihr den Hals zu tätscheln. Es kam nun kaum noch vor, dass Todays Herz in schnelles, freudiges Pochen geriet, und ihr Blick war meist trüb.
Sobald sie aber auf die Rennbahn kam, rannte sie. Koli hatte das Gefühl, dass sie einander nun immer ähnlicher wurden, je länger sie zusammen waren. Auch Today war nur dann lebendig, wenn sie lief. Und um lebendig zu sein, musste sie rennen.
Zwei Monate später bekam Koli eine Peitsche in die Hand gedrückt. Der Manager befahl ihm, dass er Today im Rennen damit auf den Hintern schlagen solle. Koli tat, was man ihm gesagt hatte. Und immer wenn sie die Peitsche spürte, strengte Today sich an, noch schneller zu laufen. Doch seltsamerweise schien sie, je schneller sie rannte, innerlich immer stiller zu werden. Das war für Koli unbegreiflich. Wie konnte es sein, dass sie nicht glücklich war? Nur wenn sie lief, konnte Today doch spüren, dass sie lebendig war, aber aus irgendeinem Grund war sie dabei nun nicht mehr glücklich. Koli nahm sich vor, diesen Punkt Minju gegenüber anzusprechen.
Als es Today gelang, die magische Grenze von einhundert Stundenkilometern zu durchbrechen, bedeutete dies neuen koreanischen Rekord. Mittlerweile wurde sie zu neunstelligen Beträgen gehandelt. Dies hieß allerdings nicht, dass sich für sie deshalb viel geändert hätte. Zwar bekam sie nun etwas öfter eine der Mohrrüben, die sie so gerne fraß, doch freute sie sich darüber nicht mehr so sehr wie früher. »Durchhalten! Nur noch ein kleines Stück!«, flüsterte ihr Koli während des Rennens oft ins Ohr. Und jedes Mal schien Today zu antworten: »Das tut mir weh! Ich kann nicht mehr!«
Wenn Minju noch da gewesen wäre, hätte er vielleicht etwas dagegen tun können. Er hätte Koli nicht einfach ignoriert. Wenn Koli aber dem Manager von Todays Schmerzen berichtete, tat dieser, als hätte er es nicht gehört, oder schnauzte ihn an, er solle den Mund halten. Also sagte Koli nichts mehr. Und drei Monate, nachdem sie den neuen Rekord aufgestellt hatte, brachen Todays Leistungen ein.
Hatte sie bis kurz vor Schluss noch an der Spitze gelegen, ließ ihr Tempo auf den letzten Metern nun deutlich nach, und sie wurde auf Platz zwei, fünf, ja sogar neun durchgereicht. Sie erntete Spott, ihr Marktwert fiel rapide, und schließlich interessierte sich niemand mehr für sie. All das war Koli egal, aber dass Today, die vor Gelenkschmerzen kaum noch gehen konnte, nicht versorgt wurde, konnte er nicht einfach mit ansehen. Er sagte jedem, der ihm über den Weg lief, dass Today eine angemessene Behandlung und eine Wettkampfpause brauche. Doch niemand hörte auf ihn. So musste sie mit Mohrrüben als Schmerzmittel vorliebnehmen und weiterhin zu Rennen antreten. Und Koli dachte:
Wenn das so weitergeht, stirbt sie.
Und deshalb beschloss Koli an diesem Tag im Spätsommer, als die Zuschauerränge der Galopprennbahn bis auf den letzten Platz besetzt waren, sich aus dem Sattel fallen zu lassen. Denn er wusste, dass es an seinem Gewicht lag, dass das Rennen für Today so kräftezehrend war. Ihm war aber auch klar, dass Today, wenn sie die Rennbahn erst einmal betreten hatte, nicht mehr zu bremsen wäre und die Gefahr bestand, dass sie, wenn sie das Rennen unter diesen Umständen beendete, vielleicht nie wieder würde laufen können. So schien es ihm das Beste, eine Disqualifikation herbeizuführen. Koli schwankte einen Moment lang zwischen zwei ihm obliegenden Pflichten: Einerseits bestand der Grund seines Daseins darin, im Rennen über die volle Distanz zu gehen, andererseits war es seine Aufgabe, Today das Leben zu retten. Er brauchte nicht lange, um sich für Letzteres zu entscheiden. Er musste Today retten.
Koli blickte auf den großen Bildschirm über ihm, der einen weiten blauen Himmel zeigte, und fand einen Spalt, durch den das Sonnenlicht hindurchfiel. Unzählige Sonnenstrahlen schienen durch die enge Öffnung zu drängen, so wie die allerersten Sonnenstrahlen, die Koli gesehen hatte, damals, als er im Lastwagen gefahren war. Wenn der Bildschirm nicht gewesen wäre, hätte es ihm noch besser gefallen. Und wenn er mit Today nicht über die Rennbahn, sondern eine grüne Wiese galoppiert wäre.
Koli sah, wie hinter ihnen die anderen Pferde herangaloppierten. Aber dann ließ er sich fallen, und die Pferdehufe, mit dem Gewicht und dem Tempo eines Lastwagens, zermalmten ihm Becken und Beine. Today lebte. Kolis Existenz aber besaß nun keinen Wert mehr.
So endete der erste Akt in Kolis Leben.
Kolis letzter Wunsch, nicht in die Jockeyzelle gebracht zu werden, wo es ihm nicht gefiel, wurde ihm erfüllt, und man legte ihn auf den Heuhaufen neben den Stallungen, von wo aus er in den Himmel blicken konnte. In wenigen Tagen würde das Entsorgungsunternehmen kommen, um ihn abzuholen, man würde ihn in seine Einzelteile zerlegen, um diese dann vielleicht in andere Maschinen einzubauen, oder man würde die Antriebselemente herausnehmen und sein Gehäuse im Museum für Pferderennsport ausstellen, als Erinnerung an den Jockey, der mit dem einstigen Spitzenrennpferd Today seinerzeit stets »im Einklang geatmet« hatte. Wie er so an sein Ende dachte, spürte er zwar keinerlei Emotionen, aber doch den Impuls, zum Himmel hinaufzublicken, so lange er nur konnte. Ohne zu wissen, dass auch die Menschen dies tun, wenn sie Bedauern empfinden.
Da sah er ein Mädchen, das in seine Richtung blickte. Sie trug Jeans, ein schwarzes T-Shirt und eine ähnliche Frisur wie Minju, nur dass ihre Haare ein wenig zerzaust wirkten. Im Sonnenlicht konnte man erkennen, wie sich unzählige Staubteilchen auf ihr offenes Haar legten.
»Guten Tag«, begrüßte Koli das Mädchen. Er erkannte sofort, dass dieses Mädchen mit den neugierigen Augen, die unablässig auf ihn gerichtet waren, seine Rettung sein würde. Und dass er dies erkannte, lag an der Art, wie sie atmete.
»Kann ich etwas für dich tun?«, fragte Koli.
Das Mädchen zögerte, trat nun aber an den Heuhaufen heran und besah sich Kolis zerborstenen Unterleib.
»Nicht so schlimm«, sagte Koli. »Da kann man ohnehin nichts mehr machen. Ich bin beim Rennen vom Pferd gefallen und unter die Hufe der nachfolgenden Pferde geraten. Da war ich selber schuld. Man muss voll konzentriert sein, aber ich musste plötzlich daran denken, dass der Himmel blau ist. Und dann habe ich mir vorgestellt, wie ich bei blauem Himmel über eine Wiese galoppiere. Bei echtem blauem Himmel, nicht bei einem blauen Himmel auf dem Bildschirm. Bist du schon einmal über eine echte Wiese gelaufen?«
Er war neugierig auf die Antwort des Mädchens, aber in diesem Moment betrat Minju den Stall, und das Mädchen verschwand nach draußen, nicht ohne Koli beim Hinausgehen noch einen verstohlenen Blick zuzuwerfen.
Am nächsten Tag wurde Koli abgeschaltet.
Das Letzte, was er noch mitbekam, war, wie Minju am Telefon flehentlich versuchte, jemanden von irgendetwas zu überzeugen. »Bei den wenigen brauchbaren Teilen bekommt man doch kaum achthunderttausend Won. Der Verkauf an den Teilezulieferer ist außerdem illegal, also was soll das denn? Ich bin überhaupt nicht kleinlich! Ja, verstehe. Ich soll denen das so verklickern, dass die es nicht melden, schon klar. Aber so einer bin ich nicht, das sag ich Ihnen!«
Dass Minju in so kurzer Zeit so viele verschiedene Emotionen zeigte, sah Koli zum ersten Mal. Nachdem Minju mit dem Telefon am Ohr eine Weile aufgeregt im Pferdestall hin- und hergelaufen war, legte er schließlich auf und kam zu Koli herüber. Er lächelte. »Da kannst du schön weiterleben!«, sagte er. Und dann schaltete er Kolis Hauptschalter aus. Das Wort »weiterleben« speicherte Koli noch schnell, damit er es nicht vergaß.
Als er die Augen wieder öffnete, stand das Mädchen vor ihm, das er damals gesehen hatte. Er lag nun nicht mehr auf dem Heuhaufen, sondern in einem Zimmer im ersten Stock einer Privatwohnung. Das Mädchen saß Koli gegenüber und begann zu sprechen.
»Woo Yeonjae.«
Das war ihr Name.
»Und du heißt Brokkoli.«
Koli sagte nichts.
»Kurz: Koli.«
Das war von nun an sein Name.
So wurde er zu Koli. Und nun ist es Zeit, die Geschichte des großartigen Mädchens zu erzählen, das den Vorhang zum zweiten Akt in Kolis Leben öffnete.
YEONJAE
Das erste Mal, dass Yeonjae von der rechten Bahn abkam, war, soweit sie sich erinnern konnte, mit zehn Jahren gewesen.
An jenem Tag war sie nach dem Unterricht noch in der Schule geblieben, um für den Staffellauf beim Sportfest zu trainieren, das ein paar Tage später stattfinden sollte. Insgesamt sechs Klassen bildeten jeweils zwei Teams, für die je ein Mannschaftsführer verantwortlich war. Mit Ausnahme des letzten Läufers lief jeder eine halbe Runde. Yeonjae, Mannschaftsführerin von Klasse 3 und unangefochten die Schnellste unter ihren ansonsten in etwa gleich starken Klassenkameraden, sollte als Letzte laufen. Teamchef der zweiten Klassenhälfte war Yeonjaes Klassenlehrer. Dieser setzte große Erwartungen in Yeonjae. Er konnte sich unschwer vorstellen, dass irgendeiner der anderen Schüler durch ein Missgeschick straucheln oder stürzen und die Mannschaft dadurch im Rennen zurückwerfen würde, doch wenn die flinke Yeonjae zuletzt liefe, könnte man den Rückstand am Ende vielleicht wieder wettmachen, und so verlangte er von ihr, dass sie unbedingt ihr Bestes geben solle. Vielleicht lag es daran, dass ihr Laufstil im Vergleich zu den anderen wesentlich leichtfüßiger wirkte oder dass ihr Gesichtsausdruck beim Laufen stets vollkommen unverkrampft blieb – jedenfalls pflegte er jeden ihrer Schritte mit einem laut fordernden Ausruf zu begleiten: »Mehr! Mehr! Mehr!« Das trommelnde Stakkato seiner gepresst klingenden Stimme war sie mittlerweile gewohnt.
Doch dann kam der Augenblick, in dem sie das Gebrüll nicht länger ertragen konnte. Und in diesem Moment verließ sie die vorgegebene Laufstrecke. Ein wenig schade war es natürlich schon, dass dies gerade am Tag des Sportfestes geschah. Als es auf die letzte Kurve zuging, bog sie nicht ab, sondern lief einfach geradeaus weiter. Um sie herum wurde es still. Ob es daran lag, dass die Anfeuerungsrufe nun aufgrund der großen Entfernung nicht mehr zu hören waren, oder daran, dass allen infolge von Yeonjaes unvorhergesehener Aktion der Atem stockte, war unklar. Yeonjae hatte jedenfalls von der penetranten Aufforderung, sie solle noch schneller laufen, einfach nur die Nase voll gehabt und deshalb die Bahn verlassen, das Schultor durchquert und ihren Lauf unbeirrt in anderer Richtung fortgesetzt, bis der Weg irgendwann zu Ende war.
Am nächsten Tag hatte der Lehrer Yeonjae vor die Klasse treten lassen und sie gefragt, warum sie gestern weggelaufen sei. Es tat ihr durchaus leid, dass sie mit ihrem Verhalten die Trainingsbemühungen ihrer Klassenkameraden zunichtegemacht hatte. Aber was sollte sie tun, nun ließ sich die Sache ja nicht mehr rückgängig machen. Und so sagte sie: Durch die Anfeuerung und die Aufforderung, sie solle noch schneller laufen, sei sie so schnell geworden, dass sie ihre eigene Geschwindigkeit einfach nicht mehr im Griff gehabt habe. Gefragt, wie schnell sie denn gelaufen sei, erwiderte sie, dass sie bis zur Galopprennbahn gelaufen sei und dort mit den dahinpreschenden Pferden habe mithalten können. Daraufhin hatte der Klassenlehrer mit zornesrotem Gesicht das Klassenzimmer verlassen. Yeonjae wurde von ihren Mitschülern umringt. Das mit der Pferderennbahn nahm man ihr zwar nicht so ganz ab, aber unter aufgeregtem Geplapper berichtete man ihr, dass der Schulrektor am gestrigen Tag, nachdem Yeonjae mit dem Tempo eines Rennpferdes aus dem Stadion hinausgelaufen war, noch eine ganze Weile ratlos ins Mikrofon gestammelt habe.
Yeonjae lächelte nur. Was sie gesagt hatte, stimmte zwar nicht ganz, aber es war auch nicht absichtlich gelogen. Sie war wirklich bis zur Pferderennbahn gelaufen und hatte gesehen, wie die Pferde dort trainierten. Gemeinsam mit ihnen gelaufen war sie allerdings nicht.
Sie hatte das Gefühl, als könnten die rasant dahinpreschenden Pferde und die Jockey-Humanoiden auf ihrem Rücken, sicher im Sattel sitzend und die Zügel fest im Griff, mühelos die ganze Erde umrunden. Als das erste Pferd die Ziellinie überquerte, leuchtete auf der großen Anzeigetafel die Geschwindigkeit auf: achtzig Stundenkilometer. Diesmal war es nur ein Training gewesen, und von den Tribünen waren keinerlei Anfeuerungsrufe gekommen, aber Yeonjae war es gewohnt, am Wochenende den aufbrausenden Jubel zu hören, der vom Stadion herüberklang. Sicher hätten die Leute dort in diesem Moment vor Begeisterung gejubelt. Achtzig Stundenkilometer waren für sie durchaus ein Grund, lauthals Beifall zu spenden. Wegen dieser Geschwindigkeiten bejubelten und beneideten sie die Pferde. Denn ein Mensch würde niemals so schnell laufen können.
Manchmal erinnerte sich Yeonjae, wie sie damals als Zehnjährige die Laufstrecke verlassen hatte, und dachte sich, dass sie so weit hätte laufen sollen, dass sie nicht mehr hätte zurückkehren können. Nicht nur bis zur Pferderennbahn, sondern bis zum Ende der koreanischen Halbinsel. Aber nach der einen verpassten Chance kam so schnell keine zweite. Denn nach ihrem aufsehenerregenden Verhalten beim letzten Wettkampf gab man ihr nun nicht mehr die Gelegenheit, zum Rennen anzutreten. Wie sie so auf damals zurückblickte, wurde ihr nun klar, dass es ihr eigentlich nicht darum gegangen war, dem Stadion zu entkommen, sondern dass sie im Grunde aus dieser Gegend weggewollt hatte. Was nicht bedeutete, dass sie gewusst hätte, wohin sie denn stattdessen hätte gehen wollen. Aber sie wusste, dass auch diese Gedanken ihr letztlich nicht weiterhalfen. Sondern nur eine einstweilige Rechtfertigung für ihr Verhalten darstellten. Wenn sie es wirklich gewollt hätte, hätte sie damals weglaufen müssen. Damals, lange bevor ihr nun diese Gedanken kamen.
Yeonjae starrte auf die monatliche Lohnabrechnung auf ihrem Handy und überprüfte zur Sicherheit noch einmal die Anzahl der Nullen. 800 000 Won. Es stimmte. Diesmal waren es 50 000 Won mehr als beim letzten Mal. Eine Art Abfindungsgeld zum Arbeitsausstieg. Als Abfindung allerdings reichlich mickrig, also vielleicht eher eine Art abschließender Bonus. Oder eine Entschädigung. Sie konnte den Betrag noch so lange begutachten, darauf, dass er plötzlich in die Höhe schießen würde, bestand keine Aussicht, und so steckte sie ihr Handy wieder in die Tasche. Den Blick des Ladeninhabers, der zu fragen schien: »Mit der Abrechnung alles okay?«, quittierte sie mit wortlosem Kopfnicken.
»Nächsten Monat wird der Mindeststundenlohn schon wieder angehoben. Ich als Ladenbesitzer muss ja auch irgendwie leben. Man kommt gerade so über die Runden, ohne Aushilfskräfte könnte ich den Laden gar nicht führen, aber die kosten mich inzwischen schon die Hälfte meines Gewinns. Man muss sich das vorstellen: Die Hälfte geht für Lohnzahlungen drauf! Wenn die den Mindestlohn jetzt schon wieder erhöhen, kann ich eigentlich gleich dichtmachen. Oder etwa nicht?«
Yeonjae sagte nichts dazu. Der Ladenchef erwartete wohl auch nicht unbedingt ihre Zustimmung. Es war vielleicht eher der Versuch einer Rechtfertigung, im Sinne von: »Tut mir echt leid, aber ich kann ja gar nicht anders, als dich zu entlassen.« Wer aber war es denn, der sich hier zu beklagen hatte? Der Ladenchef, der sich um sein Geschäft sorgte, oder die Oberstufenschülerin, die ab nächstem Monat zusehen musste, wie sie ihre Lebensunterhaltskosten zusammenbekam? Yeonjae verkniff sich einen Kommentar. Immerhin hatte sich der Ladenchef bis zuletzt ihr gegenüber einigermaßen anständig verhalten.
Ganz am Anfang hatte er Yeonjae mit ihren sechzehn Jahren nicht einstellen wollen. Als sie ihm in Schuluniform gegenübergestanden und ihm forsch ihren Lebenslauf hingehalten hatte, hatte sie nur spöttisches Gelächter geerntet. »Hätteste dir nicht anstatt dieser Schuluniform wenigstens was anderes anziehen können?«, fragte er, offenbar um ihr zu verstehen zu geben, dass jemand, der noch zur Schule ging, keine Aussicht auf die Stelle habe. Yeonjae hatte das schon verstanden. Aber trotzdem war sie einfach mal in Schuluniform aufgekreuzt, obwohl in der Stellenausschreibung im Internet gestanden hatte, dass man für die Stelle volljährig sein müsse. Und natürlich kam sie auch am nächsten Tag wieder, diesmal in ihrer normalen Kleidung. Wieder warf der Ladenchef nicht einmal einen Blick auf ihren Lebenslauf. »Muss ich mich jetzt auch noch schminken oder was?« Auf ihre bissige Bemerkung hin erwiderte er nur: »Das ist doch bei Oberstufenschülerinnen sowieso schon Standard, oder nicht?« Aber ganz gleich, die Stelle könne sie jedenfalls vergessen.
Yeonjae kam auch am nächsten Tag wieder. Das mit dem Schminken war wahrscheinlich nicht ganz ernst gemeint gewesen, und so hatte sie sich die diesbezügliche Mühe geschenkt. Diesmal machte der Ladenchef ihre Hoffnung erneut sogleich zunichte, indem er ihr mitteilte, dass er bereits jemand anderen eingestellt habe. Doch schon kurz darauf sollte sich das Blatt zu Yeonjaes Gunsten wenden. Den Ladenchef erreichte eine SMS, in der der ausgewählte Bewerber ihm mitteilte, dass er bereits anderswo Arbeit gefunden habe und die Stelle daher leider nicht antreten könne. Und wie der Inhaber nun dort am für Kunden vorgesehenen Plastiktisch des Ladens saß, mit tiefen Sorgenfalten auf der Stirn, nutzte Yeonjae sogleich die Gelegenheit, um ihm erneut ihren Lebenslauf unter die Nase zu halten.
»Solange Sie mir nicht kündigen, werde ich mit der Arbeit hier nicht aufhören. Den Antrag zur Beschäftigung von Minderjährigen hab ich schon ausgefüllt, die Bestätigung meiner Eltern und des Schulleiters hab ich auch bekommen. Ich habe das beim örtlichen Arbeitsamt eingereicht, noch ist es zwar nicht offiziell, aber die Genehmigung müsste in nächster Zeit erteilt werden. Das ist alles ganz legal, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Wenn Sie mir einen ordentlichen Arbeitsvertrag schreiben, melde ich das auch nicht bei den Behörden. Ich geh Freitag- oder Samstagabend nie aus, das heißt, es kommt auch nicht vor, dass ich mich verspäte oder ausfalle, weil ich tags zuvor zu viel getrunken hätte. Und die Zigarettensorten hab ich alle auswendig gelernt, das kann ich Ihnen gerne gleich mal demonstrieren.«
Bevor Yeonjae ihm alle Zigarettensorten aufsagen konnte, warf er einen Blick auf ihren Lebenslauf. Als er fragte, ob sie am nächsten Tag anfangen könne, erwiderte sie eilfertig, von ihr aus könne es auch jetzt sofort losgehen.
Der Ladenchef war trotz seiner fast vierzig Jahre noch immer unverheiratet, hatte auch nicht vor, in der Zukunft zu heiraten, und hegte kein besonderes Interesse daran, einer schrittweisen konventionellen Lebensplanung zu folgen. Mit anderen Worten, er kümmerte sich nicht um ein gewöhnliches Leben, wie andere Leute es einem vorgaben, oder überhaupt um das Leben anderer Leute. Dass er Yeonjae nicht ein einziges Mal nach ihren familiären Verhältnissen befragt hatte, sagte eigentlich alles. Bonuszahlungen gab es bei ihm zwar nicht, aber auch verspätete Lohnzahlungen waren bei ihm kein einziges Mal vorgekommen. Yeonjae fand, dass der Stil des Ladenchefs im Grunde gut zu ihr passte. Sie war davon ausgegangen, dass sie, wenn kein Malheur passierte, in diesem Laden würde arbeiten können, bis sie volljährig wäre. Aber nun war schon nach sieben Monaten Schluss – nicht im Traum hätte sie sich das vorstellen können.
»Alle strampeln sich doch ab, um irgendwie zu überleben. In ein paar Monaten kommst du ins zweite Oberstufenjahr, da musst du dich ohnehin um die Schule kümmern. Also, Mädchen, lerne! Alle anderen gehen am Wochenende in die Nachmittags- oder Abendschule, um zusätzlichen Unterricht zu bekommen. Bringt doch nichts, jetzt groß Geld verdienen zu wollen. Später, da kannst du richtig Geld verdienen.«
Warum kam er ihr jetzt zum Abschied plötzlich so onkelhaft? Wieder entgegnete Yeonjae nichts. Von der Tür zum Lager her hörte man ein Geräusch. Yeonjae wandte den Kopf. Die Tür öffnete sich, und heraus kam Betty, die Dienstleistungsroboterin, ein paar Kartons mit Waren auf dem Arm. Betty hielt Yeonjae offenbar für eine Kundin, denn auf ihrem Gesichtsdisplay zeichnete sich ein Lächeln ab.
»Herzlich willkommen. Wenn Sie Hilfe benötigen, rufen Sie einfach nach Betty. Das bin ich.«
»Äh …«
Yeonjae setzte ein bitteres Lächeln auf. Der Chef blickte etwas verlegen drein. Hatte er nicht gesagt, er werde niemals mit Robotern arbeiten? Und dass für ihn immer schon die zwischenmenschliche Beziehung der Arbeitskollegen von entscheidender Bedeutung gewesen sei? Yeonjae war sprachlos. Der Chef schien ihre Gedanken erraten zu haben, denn nun begann er ungefragt, sich zu rechtfertigen.
»So einer ist wesentlich billiger als eine menschliche Aushilfskraft. Außerdem verfügt Betty über wesentlich mehr Funktionen. Die weiß das Haltbarkeitsdatum aller Waren in den Auslagen, die kann mithilfe des Ausweisfotos die Identität von Kunden checken, die kann vierundzwanzig Stunden rund um die Uhr alles aufnehmen …«
Mit einem flüchtigen Seitenblick nahm der Chef Yeonjaes Gesichtsausdruck wahr, und er vernuschelte den Rest dessen, was er wohl noch hatte sagen wollen.
»Ich mein ja nur.«
Vielleicht um dem Eindruck vorzubeugen, plötzlich kleinlaut geworden zu sein, erhob er nun seine Stimme wieder und fuhr fort:
»Warum wohl wird Betty heutzutage von allen benutzt? Weil die Personalkosten steigen und weil man ja auch von irgendetwas leben muss. Bettys Anschaffungskosten sind erst mal ziemlich hoch, okay, aber langfristig ist sie weitaus günstiger. Hör mal, ich hab deine Kündigung schon ganz schön lange hinausgezögert. Und immer pünktlich Lohn gezahlt und dich an freien Tagen auch nicht kommen lassen.«
Yeonjae sagte nichts.





























