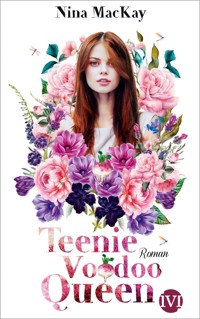
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
»Mein Name ist Dawn Decent und ich bin die wohl mieseste Voodoohexe des Universums.« Die Sache mit der Voodoohexen-Abendschule hatte sich Dawn wirklich anders vorgestellt. Aber dann bedroht eine Naturkatastrophe ihre Heimatstadt New Orleans und zwingt Dawn, mit den Loas – götterähnlichen Voodoo-Geistwesen – zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit einem ziemlich attraktiven Ex-Alligator und einem vorübergehend sterblichen Loa stellt sie sich den dunklen Voodoomächten, um ihre Stadt zu retten. Während Dawns Mitschülerinnen sie schwer um die beiden Jungs an ihrer Seite beneiden, zieht Dawn in einen schier aussichtslosen Kampf, in dem sie nicht nur ihr Herz riskiert sondern auch weit mehr als ihr eigenes Leben ... Der neue Roman der Erfolgsautorin von »Plötzlich Banshee«!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Lesen was ich will!
www.lesen-was-ich-will.de
ISBN 978-3-492-99090-5
© ivi, ein Imprint der Piper Verlag GmbH, München 2018
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: Getty Images/ Dmitry Ageev; FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalt
Cover & Impressum
Widmung
Vorwort
1 – Die Skateboardfahrer waren …
2 – Gerade als ich den Fuß …
3 – Am nächsten Tag …
4 – Jax verzog seine Lippen …
5 – Von unserer Hütte aus …
6 – Während ich noch wie erstarrt …
7 – Hinter Lin runzelte …
Bisher noch unbekannte Person
Dawn
8 – Machst du mir was …
9 – Oh große Erzulie, …
10 – Die fensterlose Kammer …
Lin
Bisher noch unbekannte Person
Dawn
11 – Vor der Tür …
Jax
12 – Vor Dawns Hütte …
Dawn
13 – Als er immer noch …
Jax
Dawn
14 – »Schokolade also?«, …
Bisher noch unbekannte Person
Dawn
15 – Die Schule lag …
Hope
Dawn
16 – Nach einer Dreiviertelstunde …
Lin
Dawn
17 – Nur noch etwa zehn Schritte, …
Jax
Dawn
18 – Während er Dawns Ausführungen …
Jax
Dawn
Bisher unbekannte Person
Dawn
19 – Als sich irgendwann Stille …
Lin
Dawn
Lin
Dawn
Lin
20 – Später, sehr viel später, …
Dawn
Jax
Melinda Lavelle
Dawn
21 – Freitagabend fluchte ich …
Epilog
Danksagung
Für meine Leser, die mich immer nach mehr und noch mehr Büchern fragen.
Für euch werde ich noch bis zu meinem letzten Atemzug schreiben.
Und für meine allerliebsten Reitschüler vom Lautersheimer Gutshof, denen ich diese Widmung versprochen habe. Auftrag ausgeführt!
Vorwort
Dieses Buch wurde von meiner Faszination für Voodoo, insbesondere für die Loas, inspiriert sowie von dem Gedanken, wie eine Voodoohexen-Abendschule in der heutigen Zeit aussehen könnte.
Nachdem ich Bilder vom St. John’s Eve, einem rituellen Voodoo-Festival in New Orleans im Internet gefunden hatte, kam mir plötzlich dieses Bild einer modernen, bunt gemischten Voodoo-Klasse in den Sinn. Ähnlich wie bei diesem Festival.
In der Realität ist Voodoo natürlich nicht so, wie es im Buch dargestellt wird. Wenn ihr euch also mit einem Topf und Schokolade in den Sumpf stellt und zu zaubern versucht, wird dies eher nicht von Erfolg gekrönt sein.
Voodoo ist uraltes Wissen, unendliche Weisheit, die jenseits unserer Vorstellungskraft liegt und nichts mit zaubern in diesem Sinne zu tun hat. Der Grundstein von Voodoo, das eigentlich original Vaudou/Vodou heißt, liegt in Benin (Quidah) Afrika, nicht in Haiti oder New Orleans. Aber diese Stadt, gerade weil sie ganz anders mit dem Thema umgeht, habe ich als Setting für »Teenie Voodoo Queen« gewählt.
Ich empfehle eine Reise nach New Orleans, auch wenn Voodoo dort sehr touristisch gehandhabt wird. Wenn ihr es tut, bitte bringt mir ein Gris-Gris mit!
Ich danke der Voodoo-Agentur Maerlyn Rituals in Malaga für die freundliche, kompetente Beratung und Einladung nach Afrika zu einem echten Voodooritual. Ich freue mich sehr über den Kontakt und bin nun noch faszinierter von Voodoo als vorher.
Ich weiß jetzt, dass echte Voodoopriester in Benin über meine Idee einer Voodoo-Abendschule nur milde lächeln würden. Sie geben ihr Wissen innerhalb der Familien nach strengen Maßstäben weiter und eine Schule mit Voodooschülern ist in ihren Augen undenkbar, aber ich hoffe, die Geschichte wird euch trotzdem Spaß machen, so wie mir.
1
Die Skateboardfahrer waren die schlimmsten. Immer. Irrtum ausgeschlossen.
Mit eingezogenem Kopf rannte ich die roten Backsteinstufen bis zum Schuleingang empor, während sie mich hinter meinem Rücken auspfiffen. Dass mir wegen der hohen Luftfeuchtigkeit die Haare an den Wangen klebten, ignorierte ich dabei. Schon seit einer Weile manifestierte sich in mir der Verdacht, dass sie eine Art Punktesystem entwickelt hatten. Blöden Witz landen – drei Punkte, Anfängerlevel. An mir auf dem Skateboard vorbeirasen und die Schulbücher aus dem Arm reißen – glatte zehn. Eher was für Fortgeschrittene. Ja, ich ahnte es, aber das war nicht mal mein wirkliches Problem. Ein paar fiese Skater gehörten wohl in das Leben jeden geplagten Teenagers, da hätte ich drübergestanden (und ab und zu neue Bücher gekauft, die vertrugen das Durch-die-Luft-Fliegen nämlich immer schlechter). Ich hätte sie hassen können, wie jeder andere normale Gemobbte, also den einfachen Weg nehmen können. Aber irgendwie schien das nicht mein Ding zu sein, und ich (oder mein Stammhirn oder wer auch immer) reagierte leider beim Anblick ihres Anführers Marco mit Herzrasen und Taumelschritt, hervorgerufen durch Knie, weich wie angeschmolzene Marshmallows. Wie konnte man nur aussehen wie Johnny Depp in jungen Jahren und dann so gemein sein? Ich traute mir kaum zu, dieses Rätsel noch zu Lebzeiten zu lüften.
»Dawny-Dawn!« Verschiedene Jungenstimmen in meinem Rücken, aber Marcos war nicht darunter. Seine Stimme hätte ich überall erkannt.
Ich heftete meinen Blick auf die Stufen, die hinauf zur Schule führten. Auf die makellos sauberen Steine, die in ihrer Farbe Schrumpfköpfen ähnelten, halbrund abgeschliffen.
»Wieso hext du dich nicht einfach schlank oder hübsch? Lernt man das heutzutage nicht mehr im Hexenunterricht?«, rief mir ein Junge im Stimmbruch nach, der sich anhörte wie ein Frosch im Mixer.
Wenn der wüsste …
Der Krächzer wurde zu meinem grenzenlosen Erstaunen von der Skaterclique toleriert. Was mich anging, da passte ihnen anscheinend das Gesamtpaket nicht. Mit Pickeln, einer großen Nase und leichtem Übergewicht überschritt ich wohl deutlich die Toleranzgrenze der Jungs auf vier Rollen. Und so sorgten sie täglich aufs Neue dafür, dass ich diesen Umstand auch ja nicht vergaß.
Als ich durch die große Flügeltür in die Eingangshalle stolperte, wandte ich mich sofort nach rechts, wo ich mich nach Luft schnappend gegen die Wand lehnte. Dieser Morgen fing ja schon mal gut an. Für einen kurzen Moment schloss ich die Augen.
»Liebe Pubertät, wirklich, ich habe sehr über deinen Scherz gelacht. Jetzt könntest du aber bei Gelegenheit anfangen, in meinem Fall ein Gespür für Proportionen zu entwickeln und meine Nasenlänge zugunsten meines zu kurz geratenen Oberkörpers etwa um die Hälfte reduzieren«, murmelte ich vor mich hin. Ehrlich. Ich sah aus wie Klaus – die Kartoffel. Aus der Fernsehwerbung. Die mit der Knollennase.
Zum absoluten Über-Überfluss war heute auch noch der Tag vor Mardi Gras. Und das bedeutete, dass an diesem Montag in der ganzen Schule Perlenketten verteilt wurden. Mit anderen Worten: Der schrecklichste Schultag des Jahres hatte soeben begonnen …
Mardi Gras. Laut singende, tanzende Paraden, die durch die Straßen von New Orleans zogen. Männer, die diese lästigen goldenen, violetten oder grünen Perlenketten aus Plastik schönen Frauen schenkten, um dafür mit einem Kuss belohnt zu werden. Je mehr bunte Perlenketten eine Frau an diesen Tagen um den Hals trug, als desto attraktiver galt sie. Unnötig zu erwähnen, dass ich bis heute vergeblich auf einen Perlenkettenverteiler wartete, der auch mich als Halskettenträgerin und damit potenzielle Küsserin in Erwägung zog. Dass die Jungs mir auswichen, ja mich sogar »übersahen«, damit es nicht zum eben beschriebenen Szenario kommen konnte, das versuchte ich zu verdrängen. Seufzend stieß ich mich mit dem Fuß von der Wand ab. Meine abgetragene Kleidung half mir nicht unbedingt dabei, mein Ansehen bei anderen – oder mir selbst – ein wenig aufzubessern.
In einem Fenster überprüfte ich, ob wenigstens mein schwarz glänzender Haarreif an Ort und Stelle saß. Er hatte meiner Mutter gehört und war eins der wenigen Erinnerungsstücke, die mir von meinen Eltern geblieben waren. Tatsächlich tat er auch heute sein Bestes, meine karottenroten Haare zurückzuhalten, die man mit viel gutem Willen als lasch oder dünn bezeichnen konnte. Und das war schon schmeichelhaft.
Auf dem Weg zu meinem Spind schickte mir das Schicksal – wohl in einem Anfall von Zockerlaune – Carlton Pearl über den Weg, die mit ihren Freundinnen gerade hochaktuelle News austauschte. Die Pearl-Clique wirkte mit ihren kurzen pinken Röcken wie eine rosa Wolke, die auf neonfarbenen Stilettos durch die Flure schwebte. Wahrscheinlich um unterprivilegierten Mitschülern wie mir das Wegsehen unmöglich zu machen, sei es aus Faszination oder reiner Ratlosigkeit angesichts dieses Modeunfalls. Selbst als Vierjährige hatte ich mehr Geschmack beim Heraussuchen von passenden Schuhen zu den Outfits meiner Barbiepuppen bewiesen, aber die Pearl-Clique trug diese farbigen Augenkrebsrisiken mit einem Selbstbewusstsein, das ich nur bewundern konnte.
Die Leitstute der pinken Herde hatte mich leider entdeckt und steuerte nun zielstrebig auf mich zu. Um ihren Hals klapperten bunte Perlenketten umeinander.
»Ah, Dawn, die kleine Bitch, oh – ich meine natürlich Witch.« In gespieltem Entsetzen schlug sich Carlton gegen die Stirn.
Ja, und dieser Witz wurde auch nie alt.
Carlton strich sich ihre blonden Haarwellen über die Schulter. »Wie viele Mardi-Gras-Ketten hast du bisher abgestaubt? Ojemine, wie ich sehe, keine einzige!«
Neben ihr kicherte Brooke, die einzige Brünette in diesem blonden Barbie-Club. »Carlton hat schon vierzehn Ketten geschenkt bekommen, wir anderen mindestens sechs. Und dabei hat der Unterricht noch nicht mal angefangen. Ein Hoch auf wischfesten Lippenstift.« Sie warf einen Kussmund mit übertrieben ausladender Geste in meine Richtung.
»Na, da hoffe ich doch für euch, dass ihr keinen Herpes gratis mit dazubekommt«, erwiderte ich so gelassen wie möglich.
Dass es mich wurmte, nie so eine Kette bekommen zu haben, musste die Pearl-Clique ja nicht wissen. Gerade als ich mich mit gesenktem Kopf an den Size-Zero-Barbies, die mich alle um mindestens einen Kopf überragten, vorbeiquetschen wollte, packte sie mich am Oberarm. Leider wurde man Carlton Pearl nie so schnell wieder los, wie erhofft. »Mardi Gras und kein einziger Junge möchte einen Kuss von dir? Gut, dass wir für dich vorgesorgt haben!«
Oh, oh, das hörte sich gar nicht gut an …
Und da stand ich nun, wie ein Sack Rüben eingekreist von Antilopen mit glänzendem Fell, und wartete auf die Gemeinheit, die sicherlich gleich über mich hereinbrechen würde.
»Serena hat zufälligerweise einen Schweinekopf für den Biologieunterricht mitgebracht. Serena!«, forderte sie eins ihrer Barbiepüppchen auf. Der Blick ihrer blauen Augen bohrte sich dabei unablässig in meinen.
Die Gerufene reichte ihr tatsächlich einen durchsichtigen Müllsack mit einem abgetrennten Schweinekopf. Die Zunge des Schweins hing heraus, als wollte es an einem Eis lecken. Unwillkürlich verwandelte sich mein Hals in eine staubtrockene Wüste, während Bilder mit allen möglichen widerlichsten Szenarien an meinem inneren Auge vorbeirasten.
Serena hingegen wirkte ganz gelassen, geradezu professionell, wie sie den Schweinekopf handhabte. Ihr Dad führte ein angesagtes Grillrestaurant, weshalb sie wohl erstens an Schweineköpfe herankam und zweitens kein Problem mit deren Anblick hatte. Nicht so wie ich. Nachher, beim Sezieren von Schweineaugen im Biounterricht, hatte ich fest eingeplant, einen Schwächeanfall vorzutäuschen.
Jetzt holte Serena das tote Resttier, bei genauerem Hinsehen begriff ich, dass es sich um ein Ferkel handelte, auch noch aus der Tüte! Ein Würgen unterdrückend, versuchte ich Carltons Arm abzuschütteln.
Nun, da die sprichwörtliche Katze, oder in diesem Fall das Schwein, aus dem Sack war, bildete sich eine Schülertraube um uns – allesamt mit gezückten Smartphones.
»Mr Piggles sagt, du bekommst eine wunderschöne goldene Kette, wenn du ihm einen Kuss gibst!« Serena wackelte an einem Ohr des armen Ferkels, damit es so aussah, als würde es reden.
Gut, bei einer Grillrestaurantbesitzerstochter durfte man wohl keine überhöhten Ansprüche an natürliches Schauspieltalent stellen, aber immerhin hatte es gereicht, damit mir dämmerte, was das ganze Theater und die Anspielung auf die Ketten sollte. Die Pearl-Clique wollte, dass ich dem toten Schwein einen Kuss gab. Und die pummelige Dawn ärgern stellte sowieso eins ihrer liebsten Hobbys dar.
Wieder zog ich an meinem Arm, diesmal heftiger.
Auf ein Nicken von Carlton hin ergriff Leonor, oder wie ich sie nannte »Leoparden-Leo« – denn sie trug fast jeden Tag ein Shirt oder ein Accessoire im Leopardenlook –, meinen anderen Arm.
Meine Bücher fielen mit einem lauten Klatsch-Pong-Klonk zu Boden. Ich saß in der Falle. Sofort begann ich zu zappeln, versuchte nach ihnen zu treten, wand mich in den Griffen. Nur waren Carlton und Leoparden-Leo leider hartnäckiger als mexikanische Wanderarbeiter, die um eine Ziege stritten. Mit anderen Worten: Sie ließen nicht los.
Die Schülermenge um uns herum war inzwischen auf etwa drei Dutzend angewachsen, angeschwemmt in der Hoffnung, Augenzeuge eines dramatischen Ereignisses zu werden.
»Nein wirklich, ich verzichte!« So gut wie möglich versuchte ich das Zittern meiner Knie zu unterdrücken. Doch genauso gut hätte ich einem Justin-Bieber-Fanclub ausreden können, die neuesten T-Shirts seiner Fan-Kollektion zu kaufen.
»Küss das Schwein!«, verlangte nun Carlton. Das boshafte Lächeln in ihrem Gesicht entging mir nicht.
»Küss das Schwein!«, echote Brooke.
»Küss das Schwein!«, forderte Marco, Anführer der Skater-Clique, der direkt hinter Serena und dem Schweinekopf aufgetaucht war.
Mein Herz wurde so kalt wie Carltons falsches Lächeln. Oh nein, nicht der schöne Marco. Das musste ein Albtraum sein!
Doch ich wusste nur zu gut, dass meine Albträume des Nachts weniger schlimm waren als mein wirkliches Leben an der Highschool. Von dem Abendunterricht in der Voodoohexen-Abendschule einmal abgesehen, wo es ähnlich zuging. Mittlerweile zappelte ich wie wild, bog den Rücken durch, versuchte sogar zu beißen. Aber kein Pearl-Girl gab nur einen Fingerbreit nach. Aussichtslos.
»Küss das Schwein, küss das Schwein!«, echote die Menge.
Marco hob eine Faust. »Zungenkuss! Zungenkuss!«
Sämtliche Smartphones waren auf mich gerichtet, und die Wahrscheinlichkeit, dass die Besitzer in den nächsten Minuten Videos mit Titeln wie »Dawns erster Kuss« auf YouTube hochladen würden, lag bei garantierten 100 Prozent. Ach, verdammt, ich wusste doch, dass ich den Tag vor Mardi Gras mehr als alles andere auf der Welt hasste!
Eine Welle der Verzweiflung überrollte mich und ich versuchte meine Hände auszustrecken, um Carlton damit über ihr ach so perfektes Gesicht zu kratzen. Nur leider sah sie meine Aktion voraus und griff nach meinem Handgelenk.
»Los, komm schon, Dawn, es ist Mardi Gras und das Publikum will einen Kuss«, säuselte Leoparden-Leo. Aus den Augenwinkeln konnte ich erkennen, dass sie mit der freien Hand eine goldene Perlenkette schwenkte.
Allerdings konnte ich meinen Blick gerade einfach nicht von dem Schweinekopf abwenden, der Unheil verkündend vor mir in der Luft schwebte.
Sollte der Schweinekuss stattfinden, würde das einen legendären Eintrag in den Gemeinheits-Chroniken der Pearl-Clique zur Folge haben.
In einem letzten Ausbruchsversuch duckte ich mich nach unten weg und nutzte mein Körpergewicht, um die beiden neon-beschuhten Barbies mit mir zu reißen.
Brooke quietschte, doch Carlton packte mich einfach an den Haaren und riss mich wieder nach oben. Dabei erwischte sie meinen Haarreif am linken Ohr.
Als der Haarreif meiner Mutter brach, knackte es, als sei jemand auf einen Ast getreten. Und das war der Moment, in dem ich die Tränen kaum noch zurückhalten konnte.
Nicht mein Haarreif.
»Dawny-Dawn! Du wirst Mr Piggles doch keinen Korb geben wollen?« Carlton spielte die Empörte. »Das würde seine Gefühle verletzen!«
»Genau«, mischte sich Marco ein. Lässig blies er sich seine verwuschelten Ponyfransen aus der Stirn. »Und jetzt knutsch endlich.« Unter anderen Umständen, wenn Marco damit sich und nicht das Schwein gemeint hätte, wäre dieser Befehl fast romantisch gewesen.
»Kuss, Kuss, Kuss!« Um uns herum wurden die Rufe lauter. Die Schaulustigen forderten einen Kuss für das Schwein. Unter gesenkten Lidern scannte ich die Menge. Niemand trat hervor, um diesem Unsinn Einhalt zu gebieten. Wohin ich auch blickte, überall sah ich nur in hämisch verzerrte Gesichter und Handykameras. Super.
»Küss das Schwein!« Serena wurde wohl langsam ungeduldig, denn jetzt kam sie näher mit dem toten Ferkel, das sie immer noch an den Ohren gepackt hielt. Fast erinnerte sie mich an eine Mutter, die wollte, dass ihr Kind endlich den Brei aß.
Von hinten schubste mich Marco einen Schritt nach vorn. »Zungenkuss. Los! Ich will was sehen!« Jedes Wort von ihm war wie lähmendes Gift in meinem Körper.
»Kuss, Kuss, Kuss!«, brüllten seine Freunde aus der Skater-Clique.
Ich hatte keine Chance, machte mich innerlich schon bereit für den widerwärtigsten Kuss, der je einem Mädchen auf diesem Planeten zuteilgeworden war.
Drei.
Zwei.
…
Glücklicherweise bog in diesem Moment meine Geschichtslehrerin Mrs Kingsley in den Schulflur ein. Als sie die Massenversammlung um mich herum bemerkte, blieb sie abrupt stehen.
»Was ist denn hier los?« Mit einem Blick hatte sie die Situation anscheinend erfasst und ihre randlose Brille auf die Nasenspitze geschoben. Das tat sie immer, um uns mit ihren kleinen, intelligenten Augen über die Brille hinweg anzustarren. Die Hände in die Hüften gestemmt, die braunen Haare zu einem lockeren Knoten Version Nestbau hochgesteckt, wirkte sie wie eine sehr aufgebrachte Vogelscheuche – obwohl sie die dreißig gerade erst überschritten hatte.
»Hi, Mrs Kingsley.« Marco, der Charmeur, schob sich vor mich, sodass er mit seinem muskulösen Oberkörper das Schwein und mich verdeckte. Dann zog er seine Charmebolzennummer ab, um Mrs Kingsley um den Finger zu wickeln. Doch von seinem Zahnpastalächeln und dem lässigen Durch-die-Haare-Streifen ließ sich meine Lieblingslehrerin, die fast fünfzehn Jahre älter war als er, nicht beeindrucken.
Bevor sie den Mund öffnete, verschränkte sie die Arme vor der Brust.
»Alle sofort in ihre Klassen. Und Serena, du gibst mir die Tüte für den Biologieunterricht. Ich werde das Schwein Mrs Demeter aushändigen, so wie du es eigentlich vor Schulbeginn hättest tun sollen. Sei froh, wenn ich dir dafür keinen Tadel eintrage.«
Mit geschürzten Lippen übergab Serena Mr Piggles, den viele von uns heute wohl oder übel noch in Mrs Demeters Biounterricht wiedersehen würden, in seiner Plastiktüte an Mrs Kingsley.
New Orleans war schon eine sehr eigenwillige Stadt, in der nichts Verwerfliches daran gefunden wurde, dass Mädchen tote Tiere mit sich herumschleppten. Eine Stadt, deren Einwohner mit dem Tod anders umgingen als Menschen an allen anderen Orten der Welt und ihn gewissermaßen zelebrierten. Und Serena war noch nicht mal eine angehende Voodoohexe – so wie ich.
Gleichzeitig ertönte der Schulgong. Der grausige Montag vor Mardi Gras hatte somit offiziell begonnen. So schnell, wie sie gekommen waren, entfernten sich die Schaulustigen wieder, allerdings nur unter Protestgemurre. Und mit reichlich Plastikperlengeklimper.
Zurück blieb einzig und allein ich, das Haar komplett verstrubbelt und mit zitternden Knien. Warum hatten sie es nur immer auf mich abgesehen? Spürten sie, dass ich nicht war wie sie? Die These, dass die Pearl-Clique (und zu meinem Leidwesen auch Super-Marco) nur einem fast vergessenen Instinktverhalten folgte und artfremde Hexen ausgrenzte, ohne selbst zu kapieren, wieso, entlastete sie in meinen Augen aber nicht. Und das war schlimm, denn es bedeutete, dass Marco mit oder ohne Johnny-Depp-Faktor einfach nur ein dämlicher Vollidiot war. Diese Erkenntnis schmerzte fast mehr als die Demütigung durch die Perlhühner um Carlton.
An der nächsten Ecke hielt Mrs Kingsley noch einmal inne. Als wäre ihr gerade erst eingefallen, dass man nach traumatischen Ereignissen wie diesem mit den betroffenen Schülern sprach, drehte sie sich langsam in meine Richtung.
»Alles in Ordnung mit dir, Dawn?«
Ich hob den Kopf. Anstatt zu antworten, sah ich ihr einfach nur in die Augen. Eigentlich sollte sie mich verstehen. Aber wahrscheinlich war sie durch den Schweinekopf, den sie in der Plastiktüte auf Armeslänge von sich hielt, genauso verstört wie ich. Außerdem war Mrs Kingsley mit Abstand meine Lieblingslehrerin, und ich wusste, wie zerstreut sie sein konnte. Ebendieses Chaos-Gen war es, was ich an ihr so liebte.
»Ach, was rede ich da?« Sie kratzte sich mit der freien Hand am Kopf, wobei sie sich beinahe selbst die Brille von der Nase stieß. »Hoppla.« Da sie damit wahrscheinlich die Brille meinte, schwieg ich weiter. »Also … am besten sprechen wir nach Geschichte über den Vorfall, in Ordnung?«
Ich nickte. Wortlos. Wahrscheinlich stand ich noch unter Schock, denn mein Unterkiefer fühlte sich wie zugefroren an.
Doch Mrs Kingsley schien das zufriedenzustellen. Nach einem kurzen Nicken nahm sie die Abzweigung in den Gang mit den Biologieräumen.
Damit war ich nun vollkommen allein im Flur.
Dieser verfluchte Mardi-Gras-Brauch! Was hatte ich von diesem Fest meiner Stadt außer Ärger und einer verstrubbelten Frisur? Da fiel mir Moms Haarreif wieder ein. Vor Anspannung wurden meine Fingerspitzen ganz feucht, dennoch gelang es mir, den Reif aus meinen Haaren zu ziehen.
Ich betastete das schwarze Ding vorsichtig. Zerbrochen. Eins meiner liebsten Erinnerungsstücke an meine verstorbene Mom.
Jetzt flossen die Tränen. Ungehindert bahnten sie sich ihren Weg nach draußen, tropften schließlich auf den Haarreif.
Der Wirbelsturm letzten Sommer, der beinahe so stark wie der Hurrikan Katrina im August 2005 gewesen war, hatte mir meine Eltern und unser Haus genommen. Und mit ihnen waren auch alle persönlichen Gegenstände und sämtliche Erinnerungen von mir gerissen worden. Ich selbst hatte nur knapp überlebt. Melinda Lavelle, eine Freundin meiner Mutter aus ihrer Voodoohexengemeinschaft und zudem meine Patentante, hatte mich danach bei sich am Rande der Stadt wohnen lassen. Doch seit ein paar Wochen lebte ich vollkommen allein in der kleinen Hütte im Sumpf. Melinda hatte sich aufgemacht, um »die bösen Mächte in New Orleans aufzuhalten«, was auch immer das zu bedeuten hatte.
Schließlich wischte ich mir energisch über die Augen. Weinen würde ich zu Hause, wenn ich allein war, aber nicht vor den Augen von bösartigen Mitschülern und ihren aktivierten Smartphonecams. Vorsichtig ließ ich die Haarreif-Überreste in meine Schultasche gleiten.
Mit dem tröstlichen Gedanken, dass ich die komplette Pearl-Clique inklusive Marco und seine Skater-Gang in Steckrüben verwandeln konnte, wenn ich wollte, ging ich in mein Klassenzimmer. Steckrüben waren meine Spezialität in der Voodoohexen-Abendschule. Wie Frösche. Genau genommen waren sie deshalb meine Spezialität, weil ich außer diesen beiden keine anderen Zauber auf die Reihe bekam. Ich seufzte und hörte selbst, wie frustriert ich klang. Aber immerhin: Ich arbeitete daran! Mittlerweile hatte ich sogar herausgefunden, dass das gar keine Steckrüben waren, die ich ungewollt wie am laufenden Band produzierte, sondern europäische Zuckerrüben, die man in New Orleans gar nicht kannte. Ihr spitzes Ende und der süßliche Geruch hatten mich darauf gebracht! So kam ich auch auf meinen Plan B im Leben, wenn ich überall sonst versagen sollte: mein eigenes Zucker-Imperium! Ich hatte dazu bereits recherchiert, und nach ersten Hochrechnungen meinerseits sah es gar nicht schlecht für mich aus. Die Zuckerindustrie boomte, und ich konnte jederzeit einsteigen, Kohle scheffeln, und dann würde Carlton-Pearl … ja, was eigentlich? Sich hoffentlich vor Neid spontan selbst entzünden. Oder sich eben, wenn ich mit den Fingern schnipste, in eine Zuckerrübe verwandeln. Dann konnte ich sie anschließend gewinnbringend auf dem Weltmarkt loswerden.
Manche Lösungen im Leben sind doch unerwartet einfach.
Den ganzen Tag über hielt ich den Kopf gesenkt, versuchte die Mädchen mit ihren schimmernden Perlenketten zu ignorieren. Die Pearl-Clique ihrerseits tat ihr Bestes, meinen Plan zu vereiteln. Mit einem fast schon peinlichen Topmodel-Gehabe, das sie sich in kommerziellen Castingshows abgeguckt haben mussten, catwalkten sie durch die Flure der Lafayette High und grinsten mich dabei herausfordernd an. Kurz überlegte ich, davon ein Video zu drehen, um sie in zehn Jahren mit dem Material erpressen zu können, aber dafür war ich dann doch zu schlecht drauf. Außerdem hatte mein ehemaliger Psychologe immer gepredigt, dass mein Sarkasmus mir ausreichend half, all meinen Stress abzubauen. Es war keine Gewalt oder kriminelle Energie nötig.
Und die Bio-Sezierstunde, in der Mr Piggles vor unser aller Augen zerschnippelt wurde, trug nicht dazu bei, dass es besser wurde. Vielmehr war ich die ganze Stunde über damit beschäftigt, nicht noch vor dem Mittagessen mein Frühstück wiederzusehen.
Gegen Ende der Geschichtsstunde kam Mr Murphy, unser gut aussehender Mathelehrer mit seinen dunklen, kinnlangen Locken, in die Klasse, um etwas Wichtiges mit Mrs Kingsley zu besprechen, während wir unsere Arbeitsblätter ausfüllten. Alle um mich herum verdrehten die Augen. Jeder wusste, dass Mr Murphy auf Mrs Kingsley stand. Und sie schien nichts dagegen unternehmen zu wollen. Im Gegenteil.
Gerade versuchte sich Mr Murphy lässig am Lehrerpult abzustützen, verfehlte es jedoch und wäre beinahe mit dem Kopf auf die Tischplatte geknallt, wenn ihn Mrs Kingsley nicht im letzten Moment an einem seiner Hosenträger festgehalten hätte.
Hinter mir stöhnte Leoparden-Leo laut auf. Die beiden jungen Lehrer waren alleine für sich genommen schon peinlich genug, beide zusammen kamen einer Naturkatastrophe gleich. Erdbeben, Ebola oder Serenas giftgrüne High Heels waren nichts dagegen. Leider fühlten sie sich auch offensichtlich außerstande, mit ihren Flirtereien wenigstens zu warten, bis sich der Klassenraum geleert hatte.
So arbeiteten sie live weiter daran, ihre Lehrer-Souveränität vor den Schülern zu untergraben. Leider vergaß Mrs Kingsley im Hormontaumel völlig, dass sie eigentlich mit mir nach dem Unterricht verabredet war, und winkte die Klasse nach dem Klingeln einfach so nach draußen. Dieser Vorfall markierte den absoluten Tiefpunkt an diesem Tag. Na gut, den zweiten Tiefpunkt nach der Begegnung mit Mr Piggles.
Halt, nein. Heute war Montag, und damit hatte ich unglücklicherweise noch den Unterricht an der Voodoohexen-Abendschule vor mir.
Direkt nach dem Highschool-Unterricht nahm ich den Bus in den Süden der Stadt. Ein eigenes Auto wäre eine Erleichterung gewesen, aber das war absolut nicht drin. Die Voodooschule lag am Rande des Sumpfs in einem riesigen, villenähnlichen Holzhaus an einer alten Obstplantage. Mehrere Schutzzauber verbargen das zweistöckige Gebäude mitsamt seinen Ländereien vor den neugierigen Blicken normaler Menschen ohne Voodoomagie, kurz MoVs genannt. Ja, wir bildeten den Plural nicht ganz korrekt, aber um das zu lernen, ging man auch nicht auf eine Voodoo-Abendschule.
An jedem Montag, Mittwoch und Freitag hatte ich hier von fünf bis acht Uhr abends Unterricht. Die Ausbildung an der Abendschule dauerte vier Jahre und man begann im Herbst nach seinem siebzehnten Geburtstag damit.
Selbstverständlich lehrte man uns dort nur weiße Voodoomagie, keine schwarze.
Meine Patentante Melinda hatte es sich zum Ziel gesetzt, Voodoopriester, Schamanen und Hexenmeister, die schwarze Magie ausübten, aufzuspüren und vor das Bondieu-Tribunal zu stellen. Das Tribunal des höchsten Gottes unseres Glaubens – Bondieu. Darin entschieden Richter über das Schicksal der abtrünnigen schwarzen Voodoohexen.
Da fiel mir ein, ich hatte komplett vergessen, meine Voodoo-Hausarbeit fertigzustellen! Eine Anrufung unserer Loa. Beim heiligen Bondieu! Immer vergaß ich, mit den Geistern zu sprechen!
Beim Voodooglauben verhielt es sich nämlich so: Unser Gott Bondieu war groß, zu groß. Praktisch zu gewaltig, um einfach so zu ihm zu sprechen. Nicht einmal die mächtigsten Voodoopriester, Hexenmeister und Schamanen trauten sich, ihn anzurufen. Doch dazu gab es die Loas. Jedes Kind, das in unserer Gemeinschaft aufwuchs, wurde dazu erzogen, die Loas anzurufen, göttliche Geistwesen, Vermittler sozusagen, die das jeweilige Gebet Bondieu überbrachten. Das Tückische an Loas war allerdings, dass sie sowohl eine gute als auch eine böse Seite hatten, zwei Gesichter sozusagen. Weiß und schwarz. Wohltätigkeit und Zerstörung.
Die Loa unserer Voodoogemeinschaft war Erzulie Freda, Schutz-Loa von New Orleans. Geist von Liebe und Schönheit. Eine mütterliche, wohltätige Loa, die in ihren Träumen die Zukunft sehen konnte.
Ich hielt einen Moment inne, als ich aus dem Bus ausstieg. Der Kragen meines grünen Regencapes kratzte an meinem Hals. Unglücklicherweise hatte Erzulie bisher noch keins meiner Gebete erhört. Sicherlich hatte die Loa dagegen Hope O’Letta, der klassenbesten Voodooschülerin, ein Zeichen gesandt, dass sie erhört wurde. Und ich … na ja. Mittlerweile war es sowieso zu spät. Ich hatte keine Zeit mehr. Wo sollte ich jetzt auf die Schnelle Schokolade oder Silberschmuck herbekommen? Die Opfergaben, die Erzulie am liebsten hatte.
Ich beschleunigte meine Schritte. Inzwischen war es dämmrig geworden im Sumpfgebiet von New Orleans. Wolken hatten sich vor die Sonne geschoben. Aber das machte nichts. Der Sumpf war quasi mein Zuhause. Das Grillengezirpe beruhigte mich eher, als dass es mich ängstigte, während ich den verschlungenen Pfad entlang zur Abendschule hastete.
Wenigstens hatte ich an der Voodooschule eine Freundin. Shannon Blackwood.
Shannon wurde ebenso wie ich in der Voodooschule gehänselt. Der einzige Punkt, den die magische Abendschule mit der absolut nichtmagischen Highschool gemein hatte.
Seit Melinda fort war, ohne dass ich wusste, ob und wann sie zurückkehren würde, war Shannon zu meiner einzigen Vertrauten geworden. Die Einzige, mit der ich reden konnte. Meine Außenseiterrolle an der Voodooschule hatte im Gegensatz zur Highschool leider nichts mit dem Revierverhalten meiner Mitschüler zu tun. Das lag vor allem an meinen unterirdisch schlechten Voodoozaubern.
Bevor ich die Veranda mit der weißen Holztür betrat, die den Eingang zur »New Orleans Night School of Voodoo Magic« markierte, straffte ich die Schultern. Ein Kribbeln lief mir über die Oberarme. Am liebsten wäre ich jetzt nach Hause gerannt und hätte mich unter dem Küchentisch zu einer Kugel zusammengerollt. Selbst nach all den Monaten hasste ich dieses muffige, gruselige Gebäude, das aussah wie eine Filmkulisse aus diesem Kitsch-Streifen »Vom Winde verweht«, immer noch. Madame Laveau, die mächtigste Voodoopriesterin in New Orleans, die diese Schule leitete, war ein riesiger Fan der alten Südstaatenzeit.
Gerade als ich die Verandastufen emporsteigen wollte, fiel mir auf, dass ich in etwas Schleimiges getreten war. Natürlich. Das konnte ja wieder nur mir passieren!
Als ich an mir heruntersah, bemerkte ich, dass mein linker Stiefel in einem Haufen halb verdautem Fleisch steckte. Ausgewürgtes Alligatorfrühstück. Wenn das Schicksal vorgehabt hatte, mich so für Mr Piggles zu entschädigen, dann musste da in der Programmierung irgendwas schiefgelaufen sein. Der Tag konnte für mich nur noch besser werden. Oder? Wenn Hope O’Letta gleich laut mit ihren Mardi-Gras-Perlenketten angab, sicherlich.
So gut es ging, streifte ich den Alligatormagenschleim an einer Ecke der Holztreppe ab. Dann erklomm ich die Veranda und zog am Knauf der alten Holztür, die verärgert knarrte. Fast fühlte ich mich so, als würde ich eins dieser Gruselhäuser in Freizeitparks betreten. Nur, dass ich hier seit vier Monaten die Hexe im Häuschen war und keiner dieser hilflosen MoVs, die sich von so etwas einschüchtern ließen. Ich war hier die Gruselhexe! Ein kleines Lächeln stahl sich auf meine Lippen – das erste an diesem Tag.
Leider verging mir das schnell wieder, denn als Nächstes bemerkte ich, dass der Schulflur verlassen und vollkommen dunkel vor mir lag. Die Deckenleuchten waren ausgeschaltet und auch das Betätigen des Lichtschalters ließ sie nicht zum Leben erwachen. Ganz eindeutig war hier etwas faul. Aber egal. Schließlich war ich eine (halbwegs) fähige Voodoohexe und die Schatten sollten sich besser vor mir fürchten. Energisch reckte ich das Kinn. So ein bisschen Dunkelheit konnte mir nichts anhaben.
2
Gerade als ich den Fuß über die Schwelle setzte, flackerten die Deckenlampen einmal kurz auf, erloschen dann jedoch sofort wieder.
Das war merkwürdig. Aber wahrscheinlich nur ein technischer Defekt. Die New Orleans Night School of Voodoo Magic war ein sicherer Ort. Zumindest versuchte ich mir das einzureden. MoVs konnten die Schule noch nicht einmal sehen, wenn sie nicht gerade (wie einige nichtmagische Elternteile) von uns eingeladen wurden, also konnte hier auch kein Kettensägenmörder auf mich lauern.
Außer, der Mörder ist eine Voodoohexe, flüsterte eine Stimme in meinem Kopf.
»Hallo?« Selbst meine eigene Stimme klang nicht sehr überzeugt. Um meine zitternden Hände zu beruhigen, schob ich sie in die Taschen meines Regencapes. Der billige grüne Stoff raschelte. Da waren sie wieder, meine übertriebenen Angstzustände nach dem Tod meiner Eltern.
Eigentlich war der Gang nur etwa zwanzig Schritte lang, teilte sich dann in zwei neue Gänge auf, von denen ich den linken zu meinem Klassenzimmer nehmen musste. Zwanzig Schritte. Das war nicht so schlimm, selbst im Dunkeln eine kurze Strecke. Meine rechte Hand fand mein uraltes Handy in der Jackentasche, klammerte sich darum wie um einen Dolch. Sobald ich es einschaltete, warf es einen bläulichen Schein an die Wände. Alle Türen im Flur waren verschlossen. Niemand außer mir hielt sich hier auf.
Das bläuliche Licht erkundete die Holzwände, dann den Boden. Noch fünfzehn Schritte. Eine Holzdiele knarrte.
Ganz plötzlich flackerte etwas am Ende des Flurs auf. Der Lichtschein einer schwachen Glühbirne erfasste etwas, oder besser gesagt jemanden. Ohne Vorankündigung, ohne Geräusche. Ich blinzelte. Eine Gestalt stand aufrecht auf einem Stuhl und – ich musste einen Schrei unterdrücken – die Gestalt hatte sich einen Strick um den Hals gelegt. Hope O’Letta, die wohl talentierteste junge Voodoohexe der Schule, sah mir direkt ins Gesicht. In ihren Augen schimmerte der Wahnsinn, ein irres Lächeln umspielte die dunklen Lippen.
Heilige Scheiße!
Hope war Afroamerikanerin und atemberaubend schön wie ein Popstar. Kam normalerweise ausnahmslos mit perfekt geglätteten Haaren zur Schule, doch heute standen ihr die Haare in ihrer Naturkrause stumpf vom Kopf ab. Aber das war nicht mal das Schlimmste. Denn Hope O’Letta hatte offensichtlich diesen Moment gewählt, um sich im Schulflur zu erhängen.
Mein Herz setzte einen Takt lang aus. Wenn sie den Stuhl unter ihren Füßen wegtrat, würde ihr das Seil das Genick brechen. »Hope?« Meine Stimme war kaum mehr als ein schrilles Jaulen. Ich wollte auf sie zueilen, stolperte dabei jedoch über meine eigenen Füße. Das Handy fiel mir aus der Hand und mein Kopf krachte gegen die Wand. Was darauf folgte, glich einem absoluten Albtraum: Sterne tanzten vor meinen Augen. Ich hob einen Arm in die Richtung, in der ich Hope vermutete. »Hope. Nein, tu’s nicht!«
Nach ein paar Sekunden konnte ich endlich wieder klar sehen. Glücklicherweise hatte das Handy den Sturz überlebt. Und ich auch, nicht zu vergessen.
Nachdem ich es mir geschnappt hatte, rappelte ich mich auf, um auf Hope zuzulaufen.
»Warum? Das macht keinen Sinn, Hope!« Meine Stimme krächzte in Panik, während mir die Worte unkontrolliert über die Lippen kamen. Dieser Tag konkurrierte langsam wirklich mit meinen Albträumen um den Titel »Grauenhaftester Tag des Jahres«.
Noch vier Schritte. Gleich war ich bei ihr. Vollkommen ausdruckslos stand sie da. Die dunklen Augen auf einen unsichtbaren Punkt hinter mir gerichtet. Obwohl ich Hope ungefähr genauso gern mochte wie giftige Sumpfpilze zum Frühstück, konnte ich sie nicht sterben lassen, so viel stand fest. Ich musste versuchen, sie aufzuhalten, ihr notfalls eigenhändig den Strick vom Hals reißen.
Doch dann, als ich schon kurz davor war, die Hand nach ihr auszustrecken, geschah das Unfassbare. Hope sprang vom Stuhl. Einfach so. Mit einem kleinen Hopser, der mich an einen Frosch erinnerte. Es knackte, dann baumelten ihre Füße etwa zwei Handbreit über dem Boden. Ein kurzes Zucken, gefolgt von absoluter Stille. So knapp!
»Nein!« Mit einem gewaltigen Sprung überwand ich die Distanz zwischen uns, schnappte mir Hopes Beine, um sie nach oben zu drücken. So würde sie wenigstens nicht ersticken. Falls sie noch lebte. Das Knacken und ihr leblos herabhängender Körper ließen meine Hoffnung diesbezüglich allerdings wegschmelzen wie eine Schokoladenraspel im heißen Opfertopf.
»Hilfe! Kann mir jemand helfen?« Hope zu halten stellte sich als gar nicht so einfach heraus, vor allem dann, wenn man selbst kurz davor war, vor Panik in Ohnmacht zu fallen.
»Hilfe!« Wo steckten die anderen Schüler?
Ein Kichern ertönte aus dem Gang links von mir. Da es immer noch vollkommen dunkel war und das Handy in meiner Hand gerade Hopes Jeans von hinten beleuchtete, konnte ich nichts erkennen.
Und dann tauchten drei Gestalten aus dem Gang auf, bei deren Anblick mir die Augen aus den Höhlen traten. Cynthia, Electra und Hope! Aber … aber Hope hatte sich doch gerade erhängt! Verwirrt legte ich den Kopf in den Nacken, um nach oben zu der toten Hope zu spähen. Gleichzeitig schalteten sich die Deckenlampen im Flur endlich wieder komplett ein. Tatsächlich. Zwei Hopes im exakt gleichen Outfit. Jeans und weißes Top, milchkaffeebraune Haut. Nur dass die Haare der Toten wie out-of-bed aussahen, wohingegen die der lebendigen Hope glatt und glänzend bis über ihre Schultern fielen.
Und dann geschah etwas sehr Merkwürdiges. Die Haut der toten Hope und ihre Klamotten begannen zu verschwimmen. Ein leises Puff war zu hören, und damit löste sich die tote Hope in Luft auf. In meinen Armen. Ohne einen Piep zu sagen.
»Heilige Erzulie! Was geht hier vor?«
Cynthia, Electra und Hope kicherten. Rasch steigerte sich das Kichern zu einem ausgeprägten Gelächter, das von den Wänden seltsam geisterhaft verstärkt wurde. Am liebsten hätte ich sie geschüttelt, denn offensichtlich wussten sie, was hier los war. Langsam dämmerte es mir zwar selbst, aber ich musste es von Hope hören.
Cynthia, die wie Hope Afroamerikanerin war, ihre Haare jedoch im Gegensatz zu Hope immer kahl rasierte und beinahe jeden Tag eine andere Perücke trug, japste vor Lachen, als würde sie gleich ersticken. Ihre Stupsnase zuckte.
»Warum? Das macht keinen Sinn, Hope!«, äffte sie mich nach. Die Haare ihrer silbernen Perücke, die in Form eines Bobs geschnitten war, schwangen vor und zurück. Bei mir war schon mehrfach der Verdacht aufgekommen, dass sie in den Ferien in einem dieser Hairshops arbeitete, in denen man sich für ein Taschengeld Haarverlängerungen in einer sechsstündigen Prozedur einflechten lassen konnte. Sicher bekamen die Mitarbeiter Sonderkonditionen bei Synthetikperücken aller Art.
»Also wirklich. Das war zu göttlich«, stimmte Hope in Cynthias Lachen ein.
»Ja, zu gut!« Vor lauter Lachen musste sich Electra mit den Händen an den Knien abstützen, um nicht umzufallen.
Electra war die einzige Hellhäutige in diesem Hexen-Strebertrio. Ihr Haar glänzte dennoch fast so dunkel wie Hopes. »Hat dir Hopes Demonstration gefallen, Dawn? Ihre Projektionen sind nahezu perfekt, obwohl wir erst Freitag den ersten Kurs dazu hatten.«
Das stimmte. Und langsam verstand ich. Madame Laveau hatte uns erst am Freitag einen Einführungskurs gegeben, in dem sie erklärt hatte, dass wir in diesem Trimester lernen würden, wie man eine Projektion seiner selbst erschuf. Reale Abbilder von uns, die etwas für einen erledigen konnten und sich auflösten, sobald der Auftrag erfüllt war. Aber wie hatte Hope es so schnell fertiggebracht, eine beinahe perfekte Projektion hinzubekommen? Wenn ich darüber nachdachte, fiel mir auf, dass sie doch nicht ganz so perfekt gewesen war. Wenn man berücksichtigte, dass die Projektion Hope-untypische krause Haare gehabt und nicht gesprochen hatte.
Dennoch. Sie hatten mich mal wieder reingelegt. Nur das war der Zweck dieser kleinen Show gewesen. Dawn erschrecken. Ich hätte es wissen müssen. Als ob Hope selbstmordgefährdet wäre. Im Leben nicht! Die talentierteste Junghexe der Voodooschule …
Zwei Sekunden später drückte sich Shannon an den dreien vorbei.
»Also echt. Ist das euer Ernst?« Ihre eisblauen Augen funkelten. Als ich meine einzige Freundin weit und breit auftauchen sah, erfasste mich eine Welle der Erleichterung. Doch irgendetwas stimmte nicht. Shannons dunkelbraune Haarmähne sah verstrubbelt aus, so als hätte sie sich erst kürzlich vor Zorn die Haare gerauft. »Komm, Dawn, die haben sie nicht mehr alle.« Sie packte meinen Arm, wobei mir beinahe erneut mein Handy aus der Hand gefallen wäre. Dann zog sie mich in Richtung Klassenzimmer. »Die können uns mal …«
»… reinlegen meinst du?«, rief uns Hope hinterher.
»Ja, das können wir!« Cynthias Gackern klang wie das Lachen einer Hyäne. Selbst die Holzperlen an ihrer Kette klapperten verächtlich unter ihrer Brustkorbbewegung.
Wenigstens hatten die drei ihren Spaß.
»Tut mir leid, ich wollte sie aufhalten, aber sie hatten mich in der Toilette eingesperrt. Tucker hat mich eben erst gefunden.« Shannon sah aufrichtig betrübt aus.
Tucker war der einzige Junge in unserer kleinen Voodooklasse.
»Nicht deine Schuld«, murmelte ich. Und es war ja auch nicht das erste Mal, dass Hope und ihre Mitläufer mir einen Streich spielten. Mit der Zeit ertrug man die Demütigung auch immer besser, fand ich. Jedenfalls wurde es irgendwie erträglicher, damit umzugehen.
Madame Laveau saß bereits an ihrem Schreibtisch vor der Tafel.
Wie immer steckte ihre rundliche Statur in einem bodenlangen afrikanischen Kleid in schreienden Farben und verwirrenden Mustern. Dazu passend trug sie einen goldenen Turban und auffällige Halsketten, meist mehrere auf einmal, so wie heute. Ich nahm an, sie hing an diesem Look, um die Bindung zu ihren Vorfahren nicht zu verlieren, die aus Westafrika in die USA eingewandert waren.
Der typische Kräutergeruch umfing mich, als ich den Klassenraum betrat. Überall an den dunklen Holzwänden hingen Bündel von getrockneten Pflanzen, was zugegeben ein bisschen klischeeträchtig für eine Voodooschule anmutete (aber nicht weniger als die Gesamterscheinung von Madame Laveau).
Tucker lehnte mit Joann, die – wie alle wussten – heimlich auf ihn stand, am Fensterbrett und starrte hinaus in die Dunkelheit. Heute hatte er sich einen Blitz an den Schläfen einrasiert. Tucker trug die Haare immer extrem kurz, was ihm dank seiner dunklen Haut überragend stand. Neben seiner sorgfältig geplanten Voodoohexenmeister-Karriere versuchte er sich in seiner Freizeit als Rapper.
Als er uns hereinkommen hörte, hob er eine Augenbraue.
Sobald Shannon ihm zunickte, wandte er sich wieder dem Fenster zu. Tucker redete nie mehr als nötig. Außer es ging um einen Rap-Battle oder so.
Einen Moment dankte ich Erzulie dafür, dass Voodoohexen nicht viel auf den Mardi-Gras-Brauch gaben und deshalb heute nicht mit Perlenketten-Aktionen in der Voodooschule zu rechnen war. Den Stress konnten wir Tucker sowieso nicht zumuten.
Aber wenn doch, wem hätte er wohl eine Kette geschenkt? Madame Laveau ganz sicher nicht, zumal an ihrem Hals keine Kapazitäten mehr frei waren.
Gerade als ich mich auf den Weg zu meinem Pult in der ersten Reihe machte, nahm ich wahr, wie Madame Laveaus Hände unkontrolliert zuckten. In einer normalen Schule hätte man jetzt Alarm geschlagen und einen Arzt geholt, aber bei uns war das noch kein Grund für erhöhten Puls. Ich schaute genauer hin, sah die Augenlider meiner Lehrerin flattern, bis nur noch das Weiße ihrer Augen sichtbar war, was bei ihrem dunklen Hautton besonders herausstach. Im Gegensatz zu ihrer berühmten Vorfahrin Marie Laveau, die laut unseren Geschichtsbüchern eine recht helle Kreolin gewesen war, wirkte meine Lehrerin wie eine Voodoohexe aus den Hollywoodfilmen. Jedenfalls, wie man sich Mambos in Benin oder Gambia so vorstellte. Allerdings befanden wir uns in New Orleans, wo Voodoo irgendwie anders war.
Touristischer, pflegte meine Tante Melinda gerne zu sagen.
»Etwas wird passieren«, murmelte Madame Laveau vor sich hin. »Etwas wird passieren. Etwas wird passieren. New Orleans ist nicht sicher …« Ihre Augen starrten ins Leere.
»Madame Laveau?« Langsam zog ich mir Tasche und Regencape über den Kopf. Nachdem ich beides über meine Stuhllehne gehängt hatte, machte ich einen Schritt auf sie zu. »Madame Laveau?«
Etwas an ihrer Atmung veränderte sich. Auf einmal wirkte sie gehetzt. »Schwarz … alles schwarz … keine Zukunft …«
Gut, das war jetzt doch etwas ungewöhnlich, sogar für eine Voodooklasse.
Unsicher, was zu tun war, winkte ich Shannon heran. »Irgendwas ist mit ihr. Ein Anfall vielleicht?«
Shannon besah sich unsere Lehrerin, die gerade etwas auf Kreolisch brabbelte, was sich wie »Die Stadt wird untergehen!« anhörte. Allerdings befand sich mein Kreolisch auf einem Niveau mit meinen Voodookräften, daher konnte ich mich auch irren. Vielleicht wollte sie uns ja nur auf leicht dramatische Art mitteilen, dass wir alle eine Eins in Transformationslehre bekamen, wer wusste das schon?
»Madame Laveau!« Shannon schnipste mit den Fingern vor dem Gesicht unserer Voodoopriesterin herum. »Ich glaube, sie hat eine Art Vision.« Gerade schob sich Shannon die Ärmel ihrer schwarzen Bluse hoch, da packte ich sie am Arm. »Was hast du vor?«
Meine einzige Freundin in dieser versumpften Schule blinzelte mich unschuldig an. »Nichts.«
Nichts. Ist klar.
Ihre Haare hatte sie zwar wieder in Ordnung gebracht, allerdings blitzte jetzt etwas Verwegenes in Shannons Augen auf.
Schöner Mist. Ich wusste, was jetzt kommen würde. Wenn es um Geheimnisse ging, war Shannon wie ein Jagdhund auf der Pirsch, und leider hatte sie gerade eine Spur aufgenommen, die sie verfolgen würde, bis wir beide – wie jedes Mal – bis zum Hals in der Scheiße steckten.
Ich wollte sie noch aufhalten, aber Shannon fuhr sich bereits mit ihren spitzen Fingernägeln über die Nagelhaut an ihrem Mittelfinger. Sofort erschien ein winziger roter Riss.
»Shannon … Sie ist die Mambo!« Meine Stimme klang kleinlaut. Normalerweise hielt ich mich zurück bei Shannons verrückten Ideen, beziehungsweise saß es am Ende mit ihr aus, aber das hier ging zu weit! Madame Laveau war unsere Mambo, die oberste, mächtigste Priesterin – fast eine Königin nach MoV-Maßstäben! Von einer Mambo ließ man verdammt noch mal die Griffel! Priesterinnen von ihrem Rang gingen mit Mächten um, die jenseits unserer Vorstellungskraft lagen, aber mit Vernunftargumenten konnte ich Shannon in solchen Momenten nicht kommen.
»Ich will aber sehen, was sie sieht!«, maulte Shannon im Ton einer Vierjährigen, die sich nicht damit abfinden konnte, dass die Zirkusvorstellung vorbei war und es nach Hause ging.
Mittlerweile hatten auch Tucker und Joann mitbekommen, was hier lief.
»Shannon, willst du dich etwa in Madame Laveaus Vision einschleichen? Wenn sie dich erwischt, fliegst du vielleicht.« Joann sah uns eindringlich an und mir schwante Übles. Wieso war ich automatisch immer mit im Boot, wenn Shannon Mist baute? Am Ende flogen wir beide – eine von uns aus Solidarität – von der Schule.
»Unwahrscheinlich. Aber ich könnte ihr helfen, aus der Vision die richtigen Schlüsse zu ziehen. Anscheinend geht es um unsere Stadt.« Den letzten Worten verlieh Shannon einen patriotischen Unterton, als würde sie gleich für die Stadt ihrer Väter in den Bürgerkrieg ziehen. Das fand ich dann doch etwas übertrieben.
Dennoch – niemand von uns konnte verhindern, dass sich Shannon einen Blutstropfen aus dem Mittelfinger quetschte und ihn auf ihre Stirn schmierte. Ein Notgroschen-Opfer für Erzulie, um Beistand zu erbitten, mehr war eben gerade nicht verfügbar. Ich hoffte, dass es nicht reichen würde und ich auch die nächsten Monate in dieser Schule verbringen durfte, aber natürlich bekam Shannon es hin. Sie legte eine Hand auf Madame Laveaus Arm, die gerade wieder etwas von einer Katastrophe murmelte. Eine Sekunde später erschauerte Shannon. Ihr Blick wurde leer, bevor sich ihre Augen nach innen verdrehten, bis man auch bei ihr nur noch das Weiße darin sah. Beinahe hätte ich mich übergeben. Meine Gedanken glitten zu einer ähnlichen Szene mit Mr Piggels an diesem Morgen.
»Und?«, fragten Tucker, Joann und ich wie aus einem Mund, als sich Shannon etwa zwanzig Sekunden später von unserer Lehrerin löste. Doch sie riss nur ihre Augen auf, die mich Erzulie sei Dank wieder im Normalzustand fixierten.
»Sie wacht auf. Schnell weg!« Anstatt von der Vision zu berichten, schubste mich Shannon zu meinem Platz. Im Laufen wischte sie sich den Blutstropfen von der Stirn. Auch Tucker und Joann sahen zu, dass sie davonkamen. Denn Madame Laveau war tatsächlich im Begriff aufzuwachen und wir hingen alle an unserer Voodooausbildung. Jetzt half nur noch unschuldig gucken und hoffen.
Die Mambo räusperte sich, fuhr sich mit der Zunge über die Lippe, bevor sie die Augen aufschlug. Wie in eine bequeme Jacke schien sie zurück in die Realität zu schlüpfen. Nie zuvor hatte ich etwas Vergleichbares gesehen … Obwohl Tante Melinda ab und zu ebenfalls von nächtlichen Visionen gesprochen hatte. Eine Bewegung vor mir riss mich aus meinen Gedanken. Madame Laveau hatte mich ins Visier genommen.
Das war so klar. Danke, Shannon. Ich stellte mich schon auf eine wilde Rechtfertigungsarie ein, aber Madame Laveau sagte erstaunlicherweise nichts und läutete stattdessen die goldene Glocke auf ihrem Schreibtisch.
Wenig später kamen Hope, Cynthia und Electra in die Klasse hereinstolziert. Wahrscheinlich glaubten sie immer noch an das Gerücht, dass der Letzte, der zur Party kommt, der Wichtigste und Interessanteste ist.
Ich rutschte auf meinem Stuhl hin und her. Ob die Mambo etwas bemerkt hatte? Unbestritten war sie eine der klügsten Frauen, die ich kannte.
Voller Unbehagen warf ich Shannon einen Blick zu. Doch die tat so, als seien ihre Fingernägel heute besonders interessant. Na, super. Ich würde also bis zum Ende der Night School warten müssen, bis mir Shannon erzählte, was sie gesehen hatte.
Heute stand zuerst Transformationslehre auf dem Stundenplan, was wir aber gern als Verwandlungsunterricht bezeichneten, denn in dieser Stunde lernten wir Pferdeäpfel in Karotten und Knöpfe in Butterbrote zu verwandeln und so weiter. Ein unbestritten nützliches Fach und vielleicht das wichtigste für meine Zukunft als Zucker-Mogul oder Züchterin seltener Teichfroscharten.
Danach stand montags Einführung in die Nekromantie auf dem Stundenplan. In dieser Stunde brachte uns Madame Laveau unter anderem bei, Projektionen von uns selbst zu erschaffen, wobei ich mir vornahm, nie wieder auf so einen Mist reinzufallen.
Diverse Lektionen über Totenerweckung und Zombiebeschwörung hatte man uns ebenfalls in Aussicht gestellt. Das war allerdings mehr so theoretisch. Falls man mal einen Zombie brauchte, der einem half, zu Halloween kleine Kinder zu erschrecken oder so. Alles andere klang mir zu sehr nach schwarzer Magie. Schwarze Voodoomagier erschufen gewöhnlich Zombies, um schwere Arbeiten verrichten zu lassen. Aber das war glücklicherweise schon lange verboten in New Orleans.
Unnötig zu erwähnen, dass ich in beiden Kursen regelmäßig versagte und nichts auf die Reihe bekam, wenn man von den obligatorischen Fröschen und Zuckerrüben einmal absah. Seit ich an der Voodoohexen-Abendschule unterrichtet wurde, war die Froschpopulation im Sumpf jedenfalls deutlich angestiegen. Was die Zuckerrüben mit Fröschen verband, das hatte sich mir bis heute noch nicht ganz erschlossen, aber wie hieß es so schön? Nimm hin, was du nicht ändern kannst. Ich setzte darauf, dass die Frösche von allein auswanderten, wenn es ihnen durch meine Schuld zu eng wurde. Es gab ja auch Wanderkröten, das war etwas ganz Normales …
Nach einem weiteren prüfenden Blick in Shannons und meine Richtung, der etwas länger auf Shannons Stirn haften blieb, begann Madame Laveau endlich mit dem Unterricht.
»Wir sind vollzählig. Wunderbar. Ich würde sagen, wir starten mit den Hausaufgaben von Freitag. Wer möchte anfangen?«
Oh, scheiße! Ich rutschte tiefer in meinen Sitz.
Natürlich schoss Hopes Arm augenblicklich in die Höhe. Da sie direkt hinter mir saß, konnte ich sogar den Luftzug spüren.
»Hope. Fang an.« Sichtlich gespannt setzte sich Madame Laveau auf ihr Pult.
»Freitag habe ich am Sumpf eine Silberkette geopfert, mit dem Ritual von Seite 78, Voodoo-Handbuch. Das mit dem Johanniskraut.«
An dieser Stelle stieß Shannon einen Seufzer aus. Im Prinzip war ich da ganz ihrer Meinung. In den nächsten Minuten beschrieb Hope gestenreich ihr Opferritual, während ich meine gesamte Willenskraft aufbringen musste, um nicht mit dem Kopf auf den Tisch zu sinken. Mit letzter Kraft täuschte ich gelegentlich interessierte Blicke in ihre Richtung vor. Trotzdem konnte ich es nicht vermeiden, zweimal aus dem Sekundenschlaf hochzufahren.
Im Grunde genommen hatte Hope Folgendes getan: eine Menge Kräuter verbrannt, Erzulie ein Loblied gesungen, eine Silberkette in ihren Opfertopf geworfen – und sicherlich total bescheuert dabei ausgesehen. Ich kicherte.
»Lacht da etwa unsere Froschkönigin? Man fragt sich ernsthaft, worüber. Immerhin hat Erzulie mir ein Zeichen gesandt!«
»Ach ja?«, krächzte ich.
»Ja. Kurz nachdem ich die Kette hineingeworfen hatte, haben sich die Flammen des Feuers rosa verfärbt!«
Kurz überlegte ich, ob ich den Begriff »optische Täuschung« in den Raum stellen sollte, ließ es dann aber doch bleiben … Rosa war zwar die Farbe, die im Voodooglauben unserer Loa Erzulie zugeordnet war, aber das mit dem Feuer konnte jeder behaupten. Obwohl die Mambo Lügen in Bezug auf Hausaufgaben normalerweise durchschaute.
Schnell warf ich Madame Laveau einen Blick zu.
Die Mambo hatte die Augen zusammengekniffen, sagte aber nichts. Offensichtlich hatte sie die Geschichte geschluckt.
Ich musste also in Erwägung ziehen, dass Hope die Wahrheit sagte. Erzulie hatte ihr ein Zeichen gesandt!
Ein kleines bisschen spürte ich Neid in mir aufflammen. Das war ein wichtiger Schritt in der Voodooausbildung. Denn zunächst funktionierten die Zauber von Voodooschülern nur, wenn sie im Namen eines Loas etwas opferten und Kräuter verbrannten. Dann, wenn der Loa einem wohl gesonnen war, unterstützte er den Zauber, damit er gelang. Einige Junghexen, aber das kam selten vor, hatten sogar das Glück, dass ein Loa quasi in sie hineinschlüpfte, um den Zauber auszuführen. Das galt als große Ehre. Obwohl es für mich an Besessenheit grenzte.
Selbstverständlich war Hope ganz scharf darauf, einmal von einem Loa »geritten« zu werden, wie man es in Voodookreisen nannte.
Zwar gab es in meinen Augen reizvollere Dinge, aber die Macht eines Loa zu spüren und dadurch große Zauber ausführen zu können stellte ich mir schon aufregend vor. Eine Zeile aus dem Voodoohandbuch für Junghexen kam mir in den Sinn, die mir zum Thema »Besessenheit« besonders in Erinnerung geblieben war:
Ein von einem Loa einmal Besessener ist danach sein Leben lang spirituell eng mit dem Geistwesen verbunden. Häufig ist es der Loa, der diese Verbindung mit der Voodoohexe oder dem Hexenmeister wünscht.
Das klang irgendwie nach einer Auserwähltengeschichte aus einem Fantasyroman. Schon spannend …
»Und du, Dawn?«, riss mich Madame Laveaus Stimme aus meinen Gedanken.
»Ich, ähm …« Vorsichtshalber zog ich den Kopf ein. »Hab die Hausaufgaben vergessen. Verzeihung.«
Die Mambo warf mir einen durchdringenden Blick zu. »Du musst üben, Dawn. Gerade du brauchst alle Hilfe, die du von den Loas bekommen kannst.«
Ich seufzte. »Ja, ich weiß.«
»Ist Melinda inzwischen zurück?«, hakte sie nach.
»Nein, aber ich komme gut alleine klar, keine Sorge.«
Die Mambo neigte den Kopf, wobei ihr goldener Turban gefährlich ins Wanken geriet.
»Wirklich«, setzte ich hinzu, bemüht, etwas mehr Nachdruck in meine Stimme zu legen. Unter meiner Bluse spürte ich, wie eine Schweißperle über meinen Brustkorb bis zum Bauchnabel davonrobbte. »Ich bin siebzehn, in fünf Monaten werde ich achtzehn.« Was ich jetzt auf keinen Fall brauchen konnte, war eine besorgte Madame Laveau, die mich vorsorglich in einem Heim unterbrachte. Und das nur, weil Melinda noch nicht von ihrer Mission zurückgekehrt war.
Endlich hatte auch der letzte Voodooschüler von seinen Hausaufgaben berichtet.
»Also gut.« Madame Laveau klatschte in die Hände. »Zeit für eine neue Lektion.«
Jetzt wurde es spannend. Alle starrten sie aufmerksam an, selbst Shannon wagte nicht einmal zu atmen. Eine Brise Macht schien die Mambo zu umwabern, als sie fortfuhr: »Ihr wisst bereits, dass schwarze Voodoomagie zwar stärker als weiße ist, gewissermaßen effizienter –«
Das stimmte, allerdings war bei schwarzer Voodoomagie das Opfer auch größer, um den Zauber in Gang zu setzen. Ich hatte schon von Hexenmeistern gehört, die Kinder geopfert hatten, um deren Blut für schwarzmagische Zauber zu verwenden.
»Allerdings gibt es für uns, die wir nur weiße Voodoomagie praktizieren, einen kleinen Trick, dessen wir uns jetzt bedienen werden«, fuhr Madame Laveau fort. »Und zwar: Ein Gegenstand, der bereits mit schwarzer Magie aufgeladen wurde, lässt sich von uns leichter in etwas anderes verwandeln als gewöhnliche unmagische Gegenstände. Auch nach einer nur geringen Opfergabe. Wir nutzen die schwarze Magie und drehen sie einfach um. Einleuchtend, oder?« Madame Laveau öffnete den Wandschrank an der Tafel. Eine Kiste kam zum Vorschein, aus der sie nacheinander zwei Glaskästen hervorzog und auf ihr Pult stellte. Beide Kästen waren mit samtenen Tüchern verhangen, die wie aus Tiefseeblau gewoben schienen. Sie reichten bis zum Boden, sodass wir nicht erkennen konnten, was sich darunter verbarg. Was mich jedoch sofort beunruhigte, war, dass die Kästen von Zeit zu Zeit vibrierten. Wie zwei aufgeregte Wecker.
»Einen ähnlichen Vorteil haben wir, wenn wir ein Tier, das dem dunklen Glauben zugeordnet ist, also Schlangen, Alligatoren, Skorpione und so weiter, in ein friedliches Tier verwandeln wollen, das dem weißen Voodooglauben zugeordnet wird.«
Oh, das war neu für mich.
»Fangen wir an! Holt euch etwas Sumpfkraut, und dann los!«
Mit einer schwungvollen Bewegung entfernte sie das Abdecktuch vom linken Glasquader.
Alle inklusive mir rissen die Augen auf.
In diesem Aquarium krochen die merkwürdigsten Gegenstände übereinander. Eine goldene Armbanduhr kämpfte mit einem Brieföffner und ein Taschenmesser verfolgte einen Ring, der in einem verzweifelten Fluchtversuch durch den Glaskasten kullerte. Es blitzte und blinkte wie auf einem Jahrmarktstand. Gleichzeitig strahlten die Gegenstände einen gewissen tierischen Jagdinstinkt aus. Animalisch und bösartig.
Interessant.
»Hier hätten wir also Gegenstände, die mit schwarzer Voodoomagie aufgeladen wurden.«
So, als hätten die Gegenstände Madame Laveau gehört, verharrten sie sofort in ihren Bewegungen, fielen klappernd zu Boden, als wollten sie den Anschein erwecken, das harmloseste Taschenmesser oder die unschuldigste Uhr der Welt zu sein.
Noch interessanter.
Offenbar verfügten sie über ein gewisses Maß an Intelligenz. Gewalttätige Intelligenz, aber immerhin. Insgesamt beherbergte der Kasten sieben magische Objekte, also für jeden Schüler eines zum Üben.
Natürlich war Hope die Erste, die mit einem Bündel Sumpfkraut in der Hand vor Madame Laveau stand. Unsere Priesterin hatte noch nicht einmal Zeit, den Opfertopf sowie die weiteren Opfergaben aus dem Schrank zu holen.
Ungeduldig wartete Hope darauf, dass Madame Laveau endlich etwas Zeitungspapier in den alten Topf warf, um es anschließend in Flammen aufgehen zu lassen.
Sichtlich amüsiert reichte die Mambo Hope eine Tafel Bitterschokolade.
»Such dir eins der Objekte aus und verwandle es mit Erzulies Hilfe in ein Schmuckstück deiner Wahl.«
Schneller als ich gucken konnte, schnappte sich Hope eine rubinrote Halskette, die eben noch wie eine Spinne im Glaskasten herumgekrochen war. In einer fließenden Bewegung warf sie das Sumpfkraut in den Topf. Danach hielt sie die Bitterschokolade, die sie eilig aus der Verpackung geschält hatte, über die züngelnden Flammen.
Die Kette, die sich jetzt um ihr Handgelenk wand, hielt sie dabei mit der linken Hand in die Höhe. Funken stoben. Es knisterte, als hätte jemand Brausepulver hineingeworfen.
»O große Erzulie Freda – nimm mein Opfer an. Ich bin für immer die Deine, führe alle Zauber in deinem Namen aus. Mach aus dieser Kette ein Armband für mich«, bat Hope, ohne Luft zu holen. »Wandle die schwarze in weiße Magie um!« Die letzten Worte keuchte sie, ganz außer Atem.
In der Voodoomagie gab es keine Zaubersprüche. Man ließ sich von seinem Bauchgefühl leiten, sprach das aus, was einem in den Sinn kam. Mit etwas Glück erhörten einen die Loas und vollbrachten zusammen mit der Junghexe ein kleines Wunder.
Alle Schüler starrten wie gebannt auf Hope. So auch ich.
Die Flammen tauchten ihre milchkaffeebraune Haut in ein sanftes Licht. Gleichzeitig spiegelte sich das Feuer in ihren Augen, was ihr den Ausdruck einer Wahnsinnigen verlieh. Sie ließ die Schokolade fallen, und natürlich, alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen, verwandelte sich die Kette in ein funkelndes Armband, und zwar so breit wie drei meiner Finger.
»Gut gemacht.« Madame Laveau nickte anerkennend, während Hope sich wie blöd freute, dass Erzulie sie erhört hatte. »Wer ist der Nächste?«
Als Antwort schoben Electra und Joann Tucker nach vorn. Ganz wie erwartet. Wahrscheinlich weil die beiden den Körperkontakt zu Tucker genossen, vermutete ich.
Todesmutig griff sich Tucker das Taschenmesser, zuckte noch nicht mal mit einer Augenbraue. Sobald das schwarzmagische Objekt begriff, dass es ihm an den Kragen gehen sollte, drohte es Tucker mit ausgefahrenen Schneideblättern und einem Flaschenöffner. Erst als er beide Hände mit viel Druck um das widerspenstige Ding gelegt hatte, gab es nach ein paar Sekunden auf. Der Blitz an seiner Schläfe hüpfte.
Joann seufzte verzückt, als hätte er soeben eine Horde südmexikanischer Bullen mit bloßen Händen erlegt.
Wahrlich eine Meisterleistung. Dennoch konnte ich nachvollziehen, was sie an dem Jungen fand. Geheimnisvoll und schweigsam hatte definitiv etwas.
Drei Minuten später hielt Tucker anstelle des Taschenmessers eine Kette mit silbernem Totenkopfanhänger in den Händen. Genau wie vermutet, nickte Madame Laveau auch ihm zu.
Unauffällig machte ich einen Schritt rückwärts, in der Hoffnung als Letzte an die Reihe zu kommen, am besten nachdem es bereits geklingelt hatte und alle anderen in die Pause verschwunden waren. Natürlich ging mein Plan so was von ganz und gar nicht auf.
Am Ende blieben ich und die silberne Taschenuhr übrig. Alle anderen bewunderten ihre neuen Schmuckstücke, während die Mambo mich näher heranwinkte.
»Dawn, du bist dran.«
»Als ob wir nicht schon alle wüssten, wie das endet«, flüsterte Hope Cynthia ins Ohr, die daraufhin loskicherte. Am liebsten hätte ich ihr die Kunsthaarperücke in den Mund gestopft, aber wir hatten ja Unterricht.
Nachdem ich noch einmal tief Luft geholt hatte, griff ich in den Glaskasten.
Zunächst verzog sich die Taschenuhr in die hinterste Ecke des Kastens. Mit ihrem aufklappbaren Deckel erinnerte sie mich an eine zornige Miesmuschel. Als sie die Glaswand erreichte, schaltete sie auf Angriff, schnappte nach meinen Fingern. Das fing ja gut an. Aber was hatte ich anderes erwartet? Das war schwarze Magie.
Schließlich gelang es mir, die Uhr ohne größere Bisswunden zu packen.
Shannon stieß einen kleinen Jubelschrei aus. Das schwere Collier, das sie aus einem Armband gezaubert hatte, klimperte.
Einigermaßen zufrieden mit mir wandte ich mich den Kräutern und der Schokolade zu, doch da passierte es: Mit einem gezielten Biss in meinen Daumen befreite sich die Taschenuhr aus meinem Griff. Als wäre das nicht schon schlimm genug gewesen, kroch die Uhr in Windeseile durch die Klasse, direkt nachdem sie zu Boden gefallen war. Ohne nachzudenken, warf ich mich auf sie, doch das kleine Zahnradbiest war clever. Mit ihrem Deckel katapultierte sie sich selbst zwischen meinen schweißnassen Fingern hindurch, bevor ich meine Hand ganz um sie geschlossen hatte. Dann hüpfte sie wie eins dieser Aufziehspielzeuge unter den nächsten Tisch. Bei Bondieu, warum immer ich? Natürlich musste ich den einzigen Gegenstand mit ADHS erwischen. Zeitgleich stemmte ich mich auf alle viere und nahm die Verfolgung auf.
Um mich herum sprangen die anderen Voodooschüler einen Schritt zurück. Schreie wurden laut. Aus dem Augenwinkel sah ich Joanns goldene Sandaletten auf einen Stuhl springen. Sicher nur eine Masche, um bei Tucker zu landen. Zum Beispiel durch einen im Anschluss folgenden Ohnmachtsanfall. Gar keine schlechte Idee. In Ohnmacht gefallen wäre ich jetzt auch gerne – andererseits konnte ich es partout nicht leiden, wenn mich eine winzige Taschenuhr an der Nase herumführte. Die Ohnmacht würde ich mir für später aufheben müssen.
»Bleib stehen!«, presste ich hervor. Was für ein Befehl für eine Uhr!
Glücklicherweise schaffte ich es im nächsten Augenblick tatsächlich, das freche Tick-Tack-Ding zu packen. Ich bedachte sie mit einem Blick, bei dem sogar Big Ben sofort alle Zeiger angehalten hätte, dann stemmte ich mich hoch, um zur Präsentation meines Fangs eine lässige Siegerpose einzunehmen. Das hätte ich besser sein lassen, denn natürlich stieß ich mir dabei den Kopf so heftig an der Tischplatte, dass ich nur noch Sterne sah.
Ach, verflixt!
![Legend Academy. Fluchbrecher [Band 1] - Nina MacKay - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/772c68a658e46ed2fbdb754d7c6cfb3e/w200_u90.jpg)

![Legend Academy. Mythenzorn [Band 2] - Nina MacKay - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/d0e8182539fbe22b4134f6f78de3a2ee/w200_u90.jpg)


























