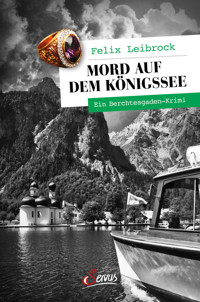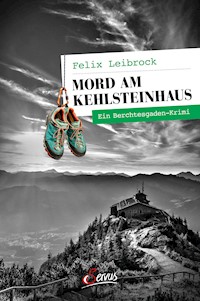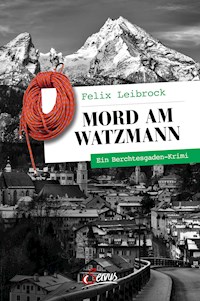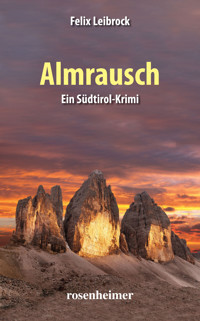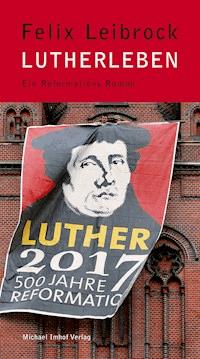Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Salier Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Im Jahre 1778 wird die schwangere Henriette Immermann im Park gegenüber Goethes Gartenhaus furchtbar misshandelt. 2009 fällt ein Antiquariatsbuchhändler in Halle einem grausamen Ritualmord zum Opfer. Zwei Ereignisse, die auf mysteriöse Weise zusammenhängen. Die Spuren führen in die Bibliothek der Herzogin Anna Amalia, wo im Jahre 2004 der junge Amerikaner Rammy Carranza ein ehrgeiziges wissenschaftliches Projekt betreibt. Doch da geschieht die Katastrophe: In der Herzogin Anna Amalia Bibliothek tobt ein Brand. Als die frisch nach Thüringen berufene Kriminalkommissarin Gülcan Aydin von der Polizeiinspektion Jena die Ermittlungen in Weimar aufnimmt, wird ihr klar, dass hinter den Vorgängen eines der größten Geheimnisse der Menschheit steht: Der Bauplan des berühmten Salomonischen Tempels ... "Tempelbrand" ist ein Krimi voller Dramatik und Spannung, der wie nebenbei ein lebendiges Bild von Weimars reicher Kultur bietet. Die Weimarer Handlungsorte lassen sich in einem zweistündigen Spaziergang nacherleben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TEMPELBRAND
EIN WEIMAR-KRIMI
FELIX LEIBROCK
INHALT
1. In einer Augustnacht des Jahres 1778
2. Freitag, 27. August 2004
3. Dienstag, 8. September 2009
4. Im September 1779
5. Samstag, 28. August 2004
6. Mittwoch, 9. September 2009
7. Im Oktober 1779
8. Montag, 30. August 2004
9. Donnerstag, 10. September 2009
10. Im Oktober 1779
11. Dienstag, 31. August 2004
12. Freitag, 11. September 2009
13. Im Dezember 1779
14. Mittwoch, 1. September 2004
15. Montag, 14. September 2009
16. 23. und 24. Dezember 1779
17. Donnerstag, 2. September 2004
18. Dienstag, 15. September 2009
19. Mittwoch, 16. September 2009
20. 17. bis 24. September 2009
21. 25. September bis 8. Oktober 2009
22. Freitag, 9. Oktober 2009
23. Samstag, 10. Oktober 2009
Über den Autor
Salier Verlag . Leipzig und Hildburghausen
Print:ISBN 978-3-939611-57-8
eBook EPUB: ISBN 978-3-96285-176-7
Originalausgabe
1. Auflage 2010
Copyright © 2010 by Salier Verlag, Leipzig und Hildburghausen
Alle Rechte vorbehalten.
Umschlaggestaltung: Christine Friedrich-Leye, Leipzig
www.salierverlag.de
Da sprach Salomo:
Die Sonne hat der Herr an den Himmel gestellt;
er hat aber gesagt, er wolle im Dunkeln wohnen.
1. Könige 8,12
Grafik: Christine Friedrich-Leye
IN EINER AUGUSTNACHT DES JAHRES 1778
Die Stadt schlief. Nur die Konturen des Gartenhauses waren im fahlen Mondlicht zu erkennen.
Heftig pochte das Herz der jungen Frau. Das blonde Haar zerzaust, das Gesicht blass, stolperte sie den Hang zur Ilm hinunter. Rechts hatte sie der Doktor fest gepackt, links der entschlossen blickende Vater, der in seiner anderen Hand eine unruhig flackernde Fackel hielt.
„Pschscht!“, zischte er der Tochter zu, „niemand darf uns hören. Hör auf zu stöhnen.“
Der Doktor trug einen Koffer mit sich, den er jetzt in die Wiese direkt neben die knorrige Eiche abstellte. Still floss die Ilm an den drei gespenstisch wirkenden Personen vorüber. Ein paar Äste knarrten im Wind, ein Kauz schoss mit einem jähen Laut über die drei Gestalten hinweg.
Mit einer Schnur fesselte der Vater die Tochter an beiden Händen und band sie an der Eiche fest. Der Doktor kramte indes allerlei Stabmagneten, die einen in Zylinder-, die anderen in Quaderform, aus seinem Koffer. Über viele Umwege hatte er sich die Magneten vom Jesuiten und Hofastronomen Maximilian Hell aus Wien verschafft.
„Henriette“, raunte er dem Mädchen zu, dem der Vater den Mund mit einem Tuch zugebunden hatte. Es warf seinen Kopf hin- und her und hatte die Augen vor Schreck weit aufgerissen.
„Henriette, vertraue mir! Werde ruhig. Ich werde deinen Fehler besiegen. In mir wirkt die notwendige Kraft. Sieh zu den Sternen. Sie stehen günstig für unsere Behandlung. Die Mächte außerhalb dieser Welt sind dir wohlgesinnt. Glaube mir. Vertraue mir!“
Während er sprach hatte der Doktor begonnen, mit einem Magneten vor Henriettes Kopf hin- und herzufahren. Gleichzeitig fixierte er das Mädchen scharf mit seinen Augen. Monoton wiederholte er immer wieder den einen Satz: „Vertraue mir!“ Leicht verunsichert bemerkte er, dass der Träger von Henriettes Kleid auf einer Seite heruntergerutscht war und die bleiche Schulter freigab.
„Vertraue mir!“ Das Mädchen schaute immer noch entgeistert, hob jetzt den Blick zum Sternenhimmel. Kurz drehte sich der Doktor nach Henriettes Vater um. Doch der war, wie verabredet, in das Dunkel der Nacht zurückgetreten, um den Doktor bei seiner Behandlung nicht abzulenken. Als der Doktor ihn nicht sah, tastete er mit seinem Magneten nach dem anderen Träger des Kleides und versuchte ihn herunterzustreifen. Henriette schien dies nicht zu bemerken, so abwesend starrte sie jetzt zum Himmel. Doch der Träger löste sich nicht von der Schulter und der Doktor ließ von diesem Treiben ab.
„Vertraue mir! Sieh mich an!“ Mit blitzenden Augen herrschte der Doktor das Mädchen an. Sein offener Mund gab eine gewaltige Zahnlücke am unteren Kiefer frei. Er nahm einen weiteren Stabmagneten und drückte ihn dem Mädchen in die Hand.
„Halte den Stab an den Baum! Seitlich von dir! Der Stab muss den Baum berühren! Ich werde den Baum jetzt magnetisieren!“
Schon hatte er damit begonnen, den Baum mit seinem Stabmagneten zu umkreisen und immer wieder dagegen zu schlagen. Etwa zehn Minuten dauerte diese Prozedur. Eine Zeitspanne, die Henriette endlos schien. Ihre Blicke wanderten immer wieder vom Doktor zum Sternenhimmel und ab und zu in Richtung ihres Vaters, der aber nirgends zu sehen war. Nur lose hielt sie den Stab an den Baum.
„Jetzt werde ich dich berühren. Sowohl mit meinen Händen als auch mit meinem Stab! Zuletzt werde ich meine Energie über deinen Bauch kommen lassen, damit die ungewünschte Brut verschwindet. Dein Leib sei ein Tempel der Reinheit!“
Bei diesen bedrohlich hingehauchten Worten war Henriettes Vater aus dem Dunkel hervorgetreten. Der Doktor blinzelte dem Vater zu. Beruhigt trat dieser wieder ab. Der Vater dachte an die Scham, die über seine Familie käme, sollte der uneheliche Balg zur Welt kommen. Welch ein Glück, dass er den Doktor aus Halle gestern im Schwarzen Bären kennen gelernt hatte! Von berühmten Wunderheilern hatte der Doktor sein Handwerk gelernt, etwa vom Vorarlberger Priester und Teufelsaustreiber Johann Joseph Gaßner und vom Doktor Mesmer aus Konstanz. Nur diesem Doktor aus Halle konnte es noch möglich sein, die schon weit gediehene Leibesfrucht zu beseitigen. Zu lange hatte Henriette das Geheimnis gehütet. Nur über ihre Leiche wollte sie verraten, wer der Vater des Kindes war. Auch wenn die Summe hoch war, wollte er sie gerne dem Doktor zahlen, sollte es ihm gelingen, die Ehre seiner Familie zu retten. Als Meister der Goldschmiedekunst hatte er sich einen Namen weit über die Grenzen der Stadt hinaus gemacht. Der durfte nicht besudelt werden!
Dicht vor Henriette stehend, begann der Doktor jetzt mit seinen schwitzigen Händen die Schläfen des Mädchens gleichmäßig auf beiden Seiten mit einer glibbrigen Masse einzuschmieren, die er aus einer weißen Dose herauspulte. Dann nahm er einen Magneten und ließ ihn an den Schläfen rotieren. Sein Oberkörper berührte bei diesem Kreisen leicht den sich wölbenden Busen des Mädchens. Der unangenehme Geruch seines Mundes, entweder vom mittäglichen Zwiebelfleisch oder den fauligen Zähnen oder von beidem herrührend, tat ein Übriges, dass Henriette angewidert den Kopf von ihm zu wenden versuchte. Doch der Doktor verstärkte nun seinen Druck auf die Schläfen, um den Kopf zusätzlich zwischen seinen Händen zu fixieren. Irgendwann resignierte das Mädchen und ließ es mit sich geschehen.
„Meine Energie komme über dich und gehe in dich. Vertraue mir! Meine Energie komme über dich!“
Mit nachlassendem Widerstand des Mädchens ebbte auch die Stimme des Doktors ab und ging in ein leises Brabbeln einer Litanei über.
Apathisch schaute Henriette ins Leere. Der Doktor nahm seine Hände von ihren Schläfen und drückte nun den Stabmagneten leicht in ihren Unterleib. Sie schrie auf, doch das straff gespannte Taschentuch um ihren Mund dämpfte die Stimme. Der kleinwüchsige Mediziner begab sich auf die Knie und drückte seinen Stab immer tiefer in den Bauch des Mädchens. Kurz blickte er sich nach dem Vater um, doch von diesem war nichts zu sehen. Mit seinen dürren Fingern begann er nun, direkt in den Bauch des Mädchens zu kratzen. Henriette bäumte sich mit den Füßen auf und versuchte mit letzter Kraft, nach dem gierig blickenden Mann zu treten.
„Herr Vater, komm er mal herbei!“ Mit jämmerlicher Stimme erklärte er dem Vater, er könne so nicht weiter arbeiten. Die Tochter verweigere sich der Behandlung. Er möge sie bitte an den Füßen auch fesseln. Nachdem der Vater dies getan hatte – die Tochter wehrte sich heftig aber vergeblich –, wartete der Doktor, bis sich der Goldschmied wieder in die Nacht entfernt hatte. Dann setzte er sein Treiben fort, stieß wechselweise mit dem Stab dem Mädchen in den Unterleib oder quetschte die Bauchwölbung zwischen seinen Fingern. Fast eine Viertelstunde dauerte die Tortur. Dann rief er den Vater und bat ihn um sofortige Bezahlung. Er müsse sogleich in die Stadt, um die erste Kutsche Richtung Leipzig zu nehmen. Dort wolle er mit seinem Verlag über das Manuskript verhandeln, in dem er alle seine medizinischen Forschungen der Wissenschaft zur Diskussion stelle. Auch die Behandlung seiner, des Goldschmiedes Tochter könne eventuell Eingang in das Buch finden. Bei Interesse könne der Vater gerne subskribieren. Henriette möge er erst abbinden, wenn sie ihre Krise überwunden habe. Die Krise sei nach einer Behandlung ganz normal und äußere sich in lautem Schreien, Aggression gegenüber dem Arzt, Wahnbildern und körperlichen Schmerzen. Aus seiner Erfahrung heraus sei es besser, wenn der Arzt bei diesen Krisen nicht dabei sei. Vielmehr habe es sich als günstig erwiesen, wenn die Angehörigen mittels eines Magneten die Krise selbst zu überwinden helfen.
„Hier, diesen Magneten überlasse ich ihm. Fahre er damit seiner Tochter hin und wieder über den Bauch und über die Schläfen. Dann löst sich die Krise. Die Behandlung war in jedem Falle erfolgreich. Der Name seiner Familie wird nicht beschädigt.“
Hurtig packte er seinen Koffer, steckte die Taler ein, die ihm der Goldschmiedemeister überlassen hatte und stürmte über die Ilmbrücke. Zu Jahresbeginn habe sich hier, so hatte ihm Henriettes Vater gestern beim Bier in der Schenke erzählt, eine junge Offizierstochter aus Liebeskummer in der Ilm das Leben genommen. Den Werther soll sie dabeigehabt haben. Doch dafür fehlten ihm jetzt Blick und Zeit.
Kaum hatte er den Hang über der Ilm durch den Felsenaufgang erstiegen, hörte er den markerschütternden Schrei einer anderen verzweifelten jungen Frau. Ihm schien, als ob im Gartenhaus ein Licht aufflackerte.
Am nächsten Tag hatte Henriette den Abgang ihres Kindes zu beweinen.
FREITAG, 27. AUGUST 2004
Rammy Carranza sprach fließend deutsch, mit leichtem texanischen Akzent. Gelernt hatte er die Sprache in der Schule und bei einem längeren Aufenthalt vor zwei Jahren an der deutschen Partnerschule seines Colleges in Trier. Er packte seine Tasche ins Schließfach, ging am Pförtner der Herzogin Anna Amalia Bibliothek vorbei, raunte ihm ein „Morgen“ zu, was dieser, wie jeden Morgen, nur mit einem scheuen Blick und einem undefinierbaren Laut quittierte, und begab sich an den Ausleihschalter.
Die großgewachsene Bibliothekarin mit dem langen schwarzen Haar setzte ihre Brille auf, fragte ihn, was er bestellt habe, und sah alle Leihscheine durch.
„Alles ist an Ihrem Arbeitsplatz im Lesesaal. Tut mir leid. Leider kann keins der Bücher außer Haus entliehen werden.“
Rammy Carranza dankte höflich, ging durch den Katalogsaal und betrat den Lesesaal durch die Glastür. Er war der erste Benutzer an diesem Morgen, so dass er sich nicht bemühen musste, besonders leise zu sein.
„Rammy Carranza“, gab er sich der Aufsichtskraft zu erkennen. Wortlos, mit einem leichten Tadel im Blick, weil er trotz des leeren Lesesaales nicht geflüstert hatte, suchte sie das Regal hinter sich ab und schob ihm dann einen Stapel Bücher hin, die meisten in Ganzleder gebunden, mit goldgeprägter Schrift, zum Teil mit leichten Schabspuren auf dem Einband und kleinen Einrissen am Buchrücken. Folio, Quart und Oktav, – fast jedes der Bücher schien ein anderes Format zu haben.
Rammy Carranza liebte diese frühe Stunde: Er, alleine, in einer der für die klassische deutsche Literatur reichsten und bedeutendsten Bibliotheken, außer der Aufsichtskraft nur noch umgeben von ehrwürdigen Büchern aus dem Magazinbestand, von denen einige schon Goethe selbst in der Hand gehabt haben dürfte. Bücher, deren Deutsch ihm oft fremd erschien und das er sich nur mühsam übersetzen konnte. Bücher aber auch, die ihm das Gefühl vermittelten, dass viele Amerikaner sich zu wenig für dieses good old Europe interessierten, obwohl es die Wurzel der abendländischen und damit ihrer eigenen Kultur war. Die Weimarer Bibliothek war ihm zum heiligen Ort geworden, zum Büchertempel.
Mit einem wohligen Schauer schlug er vergnügt das erste Buch des Stapels auf. In den drei Wochen, die er jetzt in Weimar verbracht hatte, war ihm das zum Ritual geworden: Das erste Buch hatte mit seinem eigentlichen Thema, weswegen er in der Bibliothek forschte, nichts zu tun, vielmehr hatte er es mehr zufällig aus dem Katalog ausgewählt. Nur aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts sollte es sein. Eine halbe Stunde räumte er sich für die Lektüre ein. Auf diese Weise hoffte er, sich eine größere Allgemeinbildung über die Zeit der Aufklärung und der Weimarer Klassik zu verschaffen.
Er nahm den Band, besah kurz die Rückenprägung, strich sanft über das goldene Supralibros „AA“, das das Buch als Besitz der Herzogin Anna Amalia auswies, und schlug das Titelblatt auf. Sorgsam las er jedes Wort:
Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntniß und Menschenliebe von Johann Caspar Lavater. Gott schuf den Menschen sich zum Bilde! Erster Versuch. Mit vielen Kupfern, las er oberhalb der Kupfervignette. Leipzig und Winterthur 1775, Weidmanns Erben und Reich, und Heinrich Steiner und Compagnie.
„Was für ein Titel!“, murmelte er. Fasziniert blätterte er weiter. Abwechselnd betrachtete er die Kupfertafeln mit den Porträtstichen, gezeichnet von führenden Silhouetteuren des aufgeklärten Zeitalters, und versenkte sich in die Theorie des Züricher Pfarrers Johann Caspar Lavater. Dieser behauptete, er könne den Charakter eines Menschen an seinem Äußeren erkennen, genauer gesagt an seinen Gesichtszügen. Für seine Theorie erhob er den Anspruch der Wissenschaft und nannte die Lehre Physiognomik.
Rammy fand den Grundgedanken bestechend, hatte er doch selbst eine ähnliche Theorie entwickelt: Er war fest überzeugt, jeder Mensch ähnele in seiner äußeren Erscheinungsweise einem ganz bestimmten Tier. So wie man Tieren spezifische Eigenschaften zuordnen könne, so könne man das auch auf den jeweiligen Menschen übertragen, der diesem Tier ähnele. Listig wie ein Fuchs, klug wie eine Schlange, vorsichtig wie ein Reh, und so weiter. Doch gegenüber Lavater war seine Theorie nicht so empirisch untermauert, bezeichnender Weise äußerte er sie nur auf Partys und nicht im College-Unterricht.
,Silhouetteur, also Zeichner von Porträtumrissen, was für ein Beruf!‘, sinnierte der junge Amerikaner. War nicht auch der junge Werther ein solcher? Trieb er nicht einen Kult um das Porträt seiner unerreichbaren Angebeteten, um Lottes Schattenriss? Wurde dieser Schattenriss nicht zum Sinnbild von Leben und Tod, Liebe und Sterben? Hatte er sie nicht in seinem Abschiedsbrief mit „Liebes Schattenbild!“ angesprochen? Bild und wirkliche Person, sie waren nicht mehr zu trennen. Aber warum kannte man Lavaters Theorie heute kaum noch? Sicherlich war sie in andere, verfeinerte Wissenschaften eingegangen, war Teil der empirischen Psychologie, der Anthropologie, der …
Ein Geräusch an der Tür des Lesesaals riss Rammy aus der Welt des 18. Jahrhunderts. Ein anderer Nutzer, der mit seinem grauen Kollarhemd wie ein Geistlicher aussah, holte sich seine Bücher an der Aufsichtstheke ab. Rammy klappte Lavaters Buch zu und konzentrierte sich auf den eigentlichen Grund seines Bibliotheksaufenthalts. Er erinnerte sich, wie es zu dieser Europa- und Weimar-Reise gekommen war: Sein großes Interesse an der Weimarer Klassik war dem Präsidenten des Rotary Clubs in Austin/Texas zu Ohren gekommen. Zu einem Vortrag in diesem Club eingeladen, hatten sich die anwesenden Rotarier begeistert über Rammys Wissen gezeigt und ihm ein vierwöchiges Stipendium in Weimar gewährt. Angeregt von einem Architekten und einem Geschichtsprofessor im Rotary Club Austin, hatte er sich ein ehrgeiziges Thema vorgenommen: Das Bauhaus, jene große Architektur- und Kunstbewegung hatte 1919 in Weimar ihren Anfang genommen. Die führenden Repräsentanten des Bauhaus waren später über Dessau und Berlin vor den Nazis vor allem in die USA geflohen. Das Erscheinungsbild vieler amerikanischer Städte, ihre Physiognomie, wie sich Rammy jetzt nach Lavaters Lektüre sagte, war stark von Bauhaus-Architekten beeinflusst, etwa von Walter Gropius und seinen Schülern. Was sich Rammys amerikanische Mentoren von ihm wünschten, war ein Blick in Architekturbücher der Goethezeit. Sie schlugen ihm vor, die Frage zu behandeln, ob es Zufall war, dass die Bauhaus-Künstler in Weimar ihren Stil und ihre Schule begründeten, oder ob sie bewusst an Traditionen der Goethezeit anknüpften. Der Leitsatz der Weimarer Klassik, von Johann Joachim Winkelmann beim Anblick griechischer Statuen in Italien 1755 formuliert, war Rammys Ansatzpunkt: „Edle Einfalt, stille Größe!“ Einfache, klare Linienführungen, schlichte Konturen, Reduktion auf das Wesentliche, das schien die Weimarer Klassik mit dem Bauhaus zu einen. Oft ging ihm dieser Gedanke durch den Kopf. Ganz in der Nähe des Van-de-Velde-Hauses in der Belvederer Allee bei einem Rotarier-Freund seines Vaters untergebracht, passierte er dieses Gebäude jeden Morgen beim Gang in die Bibliothek. Von dort aus überquerte er die Ilm über die alte Steinbrücke, um dann am Deutschen Bienenmuseum in den Park an der Ilm einzubiegen. Er liebte diesen Augenblick, wenn er den Geruch der auch im Herbst noch satten Wiesen einatmete. Richtung Innenstadt passierte er das oberhalb des Ilmhangs gelegene Römische Haus, majestätisch und schlicht zugleich, Sinnbild für die Umsetzung der winkelmannschen Formel in der Gestaltung des Parkes, um dann, bewusst den kleinen Umweg in Kauf nehmend, das Haus am Horn, einziges Baudokument der Weimarer Bauhauszeit und ursprünglich als Keimzelle einer ganzen Siedlung gedacht, auf seinem Weg zu streifen. Hier musste es Parallelen zwischen Bauhaus und Weimarer Klassik geben, auch bewusste Anleihen! Jedenfalls lieh er sich täglich Folianten mit Grundrissen und Architekturzeichnungen der Goethezeit aus, soweit sie in Bücher Eingang gefunden hatten. Im städtischen Bauaufsichtsamt hatte man ihm den Einblick in die historischen Pläne aus nicht näher benannten Gründen verweigert. Offenbar misstraute man einem 19-jährigen Amerikaner, erzählte ihm etwas von schwierigen Lagerungsbedingungen und Möglichkeiten nur für den internen Gebrauch. Im Thüringischen Hauptstaatsarchiv wagte er daraufhin gar nicht erst anzufragen. Nur gut, dass ihm die Bibliothek einen Leserausweis ausgestellt hatte. Ein Herr aus dem Rotary Club in Weimar hatte sich persönlich für ihn bei der Bibliotheksleitung verwendet.
Eine Stunde vor Schließung der Bibliothek atmete Rammy Carranza hörbar auf. Zwar blieben ihm nur noch fünf Tage in Weimar, doch für seinen Vortrag hatte er schon so viele Fakten zusammengetragen, dass es allemal für einige Thesen reichen würde. Einen größeren Anspruch erhob er vorläufig auch nicht. Später, da würde er vielleicht Germanistik und Architektur studieren und gerne nach Weimar zurückkehren, um das Thema zu vertiefen.
Noch eine Stunde! Er nahm den Oktavband zur Hand, den er sich eigens für diese Musestunde am Ende der Bibliothekszeit ausgeliehen hatte. Wieder strich er behutsam, ja ehrfurchtsvoll über die Goldprägung des Einbandes, dann schlug er ihn auf. Der Verfasser hieß Doktor Ignatius Furrer, das Buch war 1779 in Leipzig erschienen. Rammy überflog den umfänglichen Titel: Remedium oder von dero wunderlichen Erscheinungen im Bereich der Medizin, dem Dr. Mesmer und dem Pfarrer Gaßner zu verdanken und allhiero in eine Synthesis zusammengefasst, dem maladen Menschen Abhilfe gewährend durch theoretische Erwägungen und praktische Beispiele.
Der junge Amerikaner seufzte. Das schien ihm doch eine etwas schwere Kost für die letzte Stunde zu sein. Unkonzentriert blätterte er im Buch herum. Erst das letzte Kapitel weckte sein Interesse: Wie einem Fräulein Abhilfe verschaffet werden kann bei einer unerwünschten Geburt in einem extremen Falle, so bei Gefährdung des Lebens von Mutter und Kind, mit Hilfe der eigenen Kräfte und von Stabmagneten.
Rammy las, wie dieser Doktor Furrer vorschlug, die werdende Mutter mit einem Stabmagneten leicht zu berühren, und zwar an Schläfe und Stirn, oder dass die Schwangere einen Baum mit einem Stabmagneten berühren solle. In keinem Falle aber dürfe der Bauch des Fräuleins berührt werden, das betonte Doktor Furrer mehrfach, der Bauch sei heilig wie das Innerste eines Tempels und ein Abgang nur mittels Fluidum von Kräften möglich. Ein leichtes Schütteln überkam Rammy bei der Vorstellung, wie dieser gestelzt redende Doktor um ein junges Mädchen herumhüpfte. Aber wenn er auf diese Weise das Leben der Mutter retten konnte, warum nicht. Was sollte das Kind, wenn es gleich als Waise auf die Welt käme und mit der Schuld beladen wäre, den Tod der Mutter durch seine Geburt verursacht zu haben. Noch ehe eine andere Stimme in seinem Inneren Protest gegen diese Sichtweise anmelden konnte, klappte Rammy das Buch zu. Genug für heute!
Rammy zögerte, stand da nicht etwas auf den hinteren Innendeckel geschrieben? Nur aus dem Augenwinkel hatte Rammy eine Kritzelei wahrgenommen. Er schlug das Buch wieder auf, und tatsächlich: Am Schluss des Buches war etwas von Hand geschrieben, klein am unteren Rand! Nur mühsam entzifferte Rammy Buchstaben und Worte in roter Schrift:
A.T.S. R.C. HA-S-D. Das Geheimniß des H. 1143
Noch weiter unten, schon fast auf dem Steg des Einbanddeckels, standen mit schwarzer Tinte geschrieben die Sätze:
Wenige in jeder Generation haben es über die Weltalter weitergetragen. Doch itzo ist es an der Zeit, es zu lüften. Zu viele dunkle Kräfte missbrauchen es. Inc. 122a
Für einen Augenblick glaubte Rammy, einer Täuschung aufzusitzen. Hatte er zu lange gearbeitet? A.T.S. Und: R.C. Was hatte es damit für eine Bewandtnis? Und wer war H., der Geheimnisbewahrer? Und was bedeutete die Zahl 1143? Inc. 122a klang wie die Signatur eines Buches. Er überlegte, wen er wegen des rätselhaften Eintrags befragen könnte. Jemanden aus der Bibliothek? Oder jemanden aus dem Weimarer Rotary Club? Aber die sehe ich erst am Montagabend wieder, sagte er sich, wenn ich mich bei deren Meeting verabschiede und bedanke für die Gastfreundschaft. Rammy war ratlos. Er schrieb sich den Text vom Inneren des Buchdeckels ab und ging dann mit den Büchern zur Abgabestelle.
„Alle zurück ins Magazin?“, fragte die Bibliothekarin.
„Ja, bis auf dieses.“ Er zeigte auf das Buch des Doktor Furrer.
Bevor er nach Hause ging, schlenderte er noch durch die Schillerstraße. Gegenüber dem Schillerhaus setzte er sich an den Tisch eines Straßencafés und bestellte einen Cappuccino. Sein Blick wanderte zum Fenster von Schillers Studierstube. Hier hat der große Schwabe den „Wilhelm Tell“ geschrieben, erinnerte sich Rammy. Nie war Schiller in der Schweiz, und dennoch hatte er sich die Szenerie dort genial imaginiert. Er hatte gelesen, dass sein berühmter Landsmann, der Schriftsteller Mark Twain, die Gegend um den Vierwaldstätter See mit Schillers Drama in der Hand erkundet hatte. Vor und nach ihm noch viele andere mehr. Schiller, ein wirklich großer Dramatiker. Und Historiker! Hatte er nicht in Jena seine Antrittsvorlesung zu einem historischen Thema gehalten?
Historiker, Historiker, Rammy hatte eine Idee, wen er wegen des kryptischen Eintrags in Doktor Furrers Buch befragen konnte. Er zahlte und eilte durch den Park an der Ilm nach Hause, nur überholt von ein paar Joggern.
In seinem Zimmer in der Belvederer Allee hatte er Internet-Anschluss. Auch Professor Kornblum, der Historiker aus dem Rotary Club in Austin war in seinem Verteiler. Rammy unterrichtete ihn in einer Mail über seine Entdeckung und sandte ihm den zufällig gefundenen Texteintrag im Buch des Ignatius Furrer. Ob er eine Erklärung für den Eintrag habe, wenn ja, möge er ihm dies möglichst bis Montagfrüh mitteilen. Gerade hatte er den Computer ausgeschaltet, da klingelte sein Handy. Sein Dad war in der Leitung. Er wollte die Flugverbindungen für Freitag nächster Woche wissen, damit er ihn am Flughafen in Austin abholen könne. Noch vier Bibliothekstage hatte Rammy Zeit, das Geheimnis zu lüften. Er wusste, welches Buch er schnellstmöglich ausleihen wollte.
Inc. 122a, wenn das eine Signatur war, enthielt das zugehörige Buch vielleicht den Schlüssel für die Auflösung des rätselhaften Eintrags. Er erinnerte sich an ein Gespräch mit Professor Kornblum bei einem Rotary-Meeting in Austin. Was ihn an den den alten Bibliotheken in Europa fasziniere, hatte ihm Kornblum mit flackerndem Blick zugeraunt, seien die vielen verborgenen Zeichen und Symbole in den ledernen und pergamentenen Folianten. Damals hatte Rammy das nicht richtig verstanden, jetzt überkam ihn das Gefühl, einem solchen Geheimnis auf der Spur zu sein.
DIENSTAG, 8. SEPTEMBER 2009
Halle an der Saale. Der Rentner Fridolin Hempel liebte seine Heimatstadt, die Spannung zwischen Geschichte und Gegenwart: Händelhaus und Ha-Neu, uralte Salzmythen und moderne Chemieindustrie, die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen. Nur die Hochstraße vor den Franckeschen Stiftungen war ihm ein Ärgernis. Das Waisenhaus und all die anderen Einrichtungen des August Hermann Francke, für Hempel waren sie wesentlicher Bestandteil von Halles Identität, zugleich ein Dorn im Auge ehemaliger religionsfeindlicher Stadtoberen, die die Hochstraße bauten, um das beeindruckende Zeugnis christlicher Sozialarbeit zuzumauern. Dass er den Abriss der Hochstraße noch erleben würde, mochte er nicht so recht glauben. Aber schon jetzt hatte er sich vorgenommen, im Falle eines Falles dann höchstpersönlich das Halleluja aus Händels Messias auf einem Stuhl stehend einen ganzen Tag lang in Halles Fußgängerzone zu singen.
Fridolin Hempel war, wie viele Hallenser, Frühaufsteher. Seit acht Jahren befolgte er Morgen für Morgen das gleiche Ritual. Exakt um 6 Uhr begann er seine Morgengymnastik, wechselweise zu Musik von Händel oder der Gruppe De Randfichten, die erzgebirgische Volksmusik spielte und den Rentner besonders bei den Hüft- und Schulterübungen bestens motivierte. Nach kurzer, kalter Dusche frisierte er sich sein Resthaar, nahm die dritten Zähne aus dem Nachtbad und kontrollierte im langen Spiegel neben der Kommode, ob alles saß: Hut, Pullunder, Hemdkragen. Spätestens jetzt begann Hasso, sein Rauhaardackel, aufgeregt mit dem Schwanz zu wedeln. Das Tier wusste: Gassi gehen war angesagt!
Die Route war jeden Morgen dieselbe. So auch heute. Nichts deutete auf etwas Ungewöhnliches hin. Hempel und Hund verließen das Haus in der Kleinen Marktstraße, wo er sich eine kleine Dachgeschosswohnung gemietet hatte. Der Witwer, seine Frau war just bei Eintritt seines Ruhestandes an einem Schlaganfall gestorben, zog den Reißverschluss der Sommerjacke bis oben zu und drückte den Hut fester auf den Kopf. Ein frischer Wind kündigte den Herbst an. Blätter tanzten auf der Straße, nach denen Hasso vergeblich schnappte. Hempel ging an der Südseite der St. Ulrich-Kirche vorbei und bog dahinter in die Leipziger Straße ein. In der Hand hielt er einen Leinenbeutel, in dem er bald zwei Brötchen alter Backart und ein Dinkelbrot, 500 Gramm, verstauen würde. Die Geschäftsleute in der Leipziger Straße bauten ihre Truhen und Tische vor den Geschäften auf und hofften, wie jeden Tag, auf bessere Umsätze als am Tag zuvor.
„Tag, Herr Hempel!“, riefen ihm einige Händler zu. Auch wenn er nur über eine kleine Rente verfügte und sich nur selten etwas in den Geschäften leisten konnte, kannte man ihn. Denn immer wieder sprach er die Geschäftsleute an und versuchte, sie an trüben Tagen mit schlechten Umsätzen ein wenig aufzuheitern. Am Marktplatz angekommen, betrat er die Bäckerei, orderte das Gewünschte, hielt einen kurzen Schwatz über die heraufziehende Regenfront und verabschiedete sich wie jeden Tag mit einem „Bis morgen!“
Hasso hinterließ an manchem Pfosten seine Duftnote, nur kurz irritiert vom wütenden Bellen einer Deutschen Dogge. Doch wenige Sekunden später zog Hasso wieder ungestört seine Bahnen und sein Herrchen pfiff ein frohes Lied vor sich hin.
Beim Antiquar Wilfried von Radestock bellte Hasso unvermittelt auf.
„Ruhig, Hasso, der Herr von Radestock ist noch nicht im Geschäft. Sieh, hier, da steht doch Geschlossen drauf. Der macht vielleicht einen großen Ankauf.“
Er zeigte mit dem Finger auf das mit einem silbernen Kettchen an einem Haftknopf befestigte und schief hängende Schild.
Einmal war der Antiquar von Radestock in Fridolin Hempels Wohnung gewesen. Der Rentner hatte sich entschieden, dem Antiquar einige seiner Klassiker-Ausgaben anzubieten, um sich die karge Rente etwas aufzubessern: Den fünfbändigen Schiller, den zehnbändigen Goethe, den dreibändigen Herder. Wie war er enttäuscht, als ihm Herr von Radestock in aller Deutlichkeit beschied: „Die Ausgaben haben einen hohen persönlichen Wert. Aber auf dem Markt gibt’s die zu Tausenden und keiner kauft die mehr. Wer liest schon noch Klassiker? Und die, die es müssen, also die Schülerinnen und Schüler, die kaufen sich billige Reclam-Ausgaben und schon gar keine Gesamtausgaben mehr. Danke für den Kaffee und tut mir leid.“
Schon Tage zuvor hatte sich Fridolin die leuchtenden Augen des Herrn Antiquars ausgemalt, wenn er die Klassiker-Ausgaben aus den 1920er Jahren zu sehen bekäme, immerhin ein Erbstück der Großeltern. Und jetzt diese Pleite!
Der guten Beziehung zu von Radestock hatte dieses Erlebnis aber keinen Abbruch getan. Zu oft hatte er den Antiquar einfach so in seinem Laden besucht. Viel Wissenswertes hatte er erfahren, über Buchbindetechniken, Geheimgesellschaften im 18. Jahrhundert oder die Heilrezepturen der Hildegard von Bingen. Fast täglich schaute er in die Auslagen des winzigen Schaufensters, das verstaubt war und in dem mehrere Fliegen den Kampf gegen die Scheibe verloren hatten und jetzt als Leichname ausgestellt waren.
„Ruhig, Hasso! Was hast du nur?“
Herr Hempel trat an das Schaufenster. Genau die gleiche Auslage wie gestern: Drei Stahlstiche von Halle aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, eine Chronik der Franckeschen Stiftungen, eine Händel-Biographie. Schon wollte er sich wieder abwenden, doch Hasso riss heftig an der Leine und zog ihn Richtung Eingang.
„Hasso, jetzt hör aber auf, der Herr Antiquar ist doch gar nicht da!“
Hempels Magen meldete dringenden Frühstücksbedarf an. Widerwillig gab er dem Drängen des Hundes nach und drückte die Klinke der Eingangstür. Zu seiner Überraschung war sie offen. Nanu, hatte der Herr Antiquar vergessen, das Schild umzudrehen?
„Herr von Radestock?“, rief Hempel in den kleinen Verkaufsraum. Niemand antwortete, nur Hasso bellte jetzt unaufhörlich und zerrte wild an der Leine.
„Herrschaft, Hasso, hörst du jetzt auf!“, fauchte ihn sein Herrchen an.
Der Rentner hatte ein ungutes Gefühl, als er sich jetzt dem Lagerraum näherte, der nicht viel größer als der Verkaufsraum und durch einen Vorhang von diesem abgetrennt war. Nur einmal hatte ihm Herr von Radestock einen kurzen Blick in den Verhau von alten Büchern, Stichen und Halle-Souvenirs gewährt. Jetzt hatte Hempel das Gefühl, einen verbotenen Raum zu betreten.
Ängstlich schob er den Vorhang beiseite, immer wieder „Herr von Radestock?“ rufend. Mit einem Ruck zog er den Vorhang wieder zusammen. Was er für einen Sekundenbruchteil gesehen hatte, erschreckte ihn zutiefst. Er wich einen Schritt zurück und stieß sich den Rücken an einem Regal. Hasso bellte nicht mehr. Fridolin Hempel klammerte die altersfleckigen Hände in den rückwärtigen Verkaufstresen. Sein Gehirn pulsierte. Er war wie gelähmt. Endlose Sekunden vergingen, bis er sich zusammenriss und auf die Straße stürmte. Nebenan bauten Vietnamesen ihre Obst- und Gemüsestände auf.
„Schnell, bitte, rufen Sie die Polizei. Ein Toter. Und ganz viel Blut! Hier!“, stammelte der alte Herr. Er zeigte auf die Ladentür des Antiquars.
Drei Minuten später fuhr ein Einsatzwagen der Polizei durch die Fußgängerzone und hielt vor der Tür des Antiquariats. Die beiden Polizeibeamten baten die Passanten und Geschäftsleute, die sich mittlerweile versammelt hatten, draußen zu warten. Niemand solle sich vom Ort entfernen, man brauche Zeugen.
Nach einer Minute kamen die Polizisten wieder aus dem Antiquariat heraus auf die Leipziger Straße, der jüngere blass um die Nase und mit leicht zitternden Händen.
„Spann das Absperrband hier um den Eingang“, rief ihm der Ältere zu und drückte ihm eine rot-weiße Rolle in die Hand. Er ging zum Auto, telefonierte und fragte dann, wer die Leiche gefunden habe. Herr Hempel hatte verstohlen an einem der Brötchen gekaut und gab sich jetzt mit vollem Mund zu erkennen.
„Ich fass es nicht, da findet der Herr eine Leiche und jetzt isst er in aller Seelenruhe Brötchen!“ Der Polizeibeamte war gereizt, ob vom Anblick der Leiche oder weil er sich mit solchen Kommentaren Respekt verschaffen wollte, war nicht auszumachen.
Zwei weitere Polizeiautos, ein Polizeibus und ein ziviler Audi trafen ein. Die Spurensicherer zogen sich nach dem Aussteigen aus dem Bus ihre Ganzkörperanzüge über, die ihnen das Aussehen von Astronauten oder Teletubbies verliehen. Sie betraten das Antiquariat, der Herr im braunen Cordanzug hinter ihnen erkundigte sich bei den Streifenpolizisten nach Zeugen und gab sich gegenüber Fridolin Hempel als Kriminaloberrat Bernd Reimann zu erkennen.
„Sie haben das Opfer als Erster gesehen? Erzählen Sie mal bitte, wie Sie den Toten entdeckt haben und ob Sie irgendwas am Tatort verändert haben.“
„Also der Herr von Radestock, der war ja schon mal bei mir zu Hause“, hob Hempel an, „dem wollte ich meine Klassiker-Ausgaben verkaufen, den fünfbändigen Schiller, den zehnbändigen …“
„Herr Hempel, bitte beantworten Sie meine Frage!“, fuhr der Kommissar dazwischen. Nach kurzer Befragung bat er den Rentner, seine Adresse bei einem Kollegen des Einsatzwagens zu hinterlassen und verabschiedete ihn.
„Ach, halt, Herr, ähm, Herr Hempel, eine Frage noch: Wer kaufte denn so bei dem Herrn von Radestock? Was waren das für Kunden?“
Herr Hempel kratzte sich am linken Ohr.
„Also, wie gesagt, meine Klassiker wollte er nicht. Ich hatte ihm ja den fünfbändigen Schiller …“
Reimann schaute streng und vorwurfsvoll.
„Ja, also, wenn ich mal bei ihm im Geschäft war“, konzentrierte sich Hempel, „dann kamen da ab und zu Touristen. Manchmal waren das aber auch Leute, die sich für so esoterische Sachen interessierten. Bücher aus dem 18. Jahrhundert mit Geheimwissen, Alchemie und ähnliches. Diese Bücher hat er für richtig viel Geld verkauft. Er hat sowieso mehr Umsatz über Versand gemacht. Glaub ich jedenfalls. Denn von den paar Leuten, die hier mal reinkamen, konnte er unmöglich leben.“
Der Kommissar nickte dem Rentner zu.
„Danke, es kann sein, dass wir Sie noch mal befragen müssen.“
Reimann betrat jetzt das Antiquariatsgeschäft. Die Spurenermittler pinselten den ganzen Eingangsbereich mit einem weißen Pulver ein, nahmen Haarproben vom Boden, und der inzwischen eingetroffene Pathologe untersuchte die Leiche. Trotz seiner Routine fiel es dem Kommissar schwer, beim Anblick der Leiche die Contenance zu wahren. Das Opfer lag auf dem Rücken, die Arme seitlich von sich gestreckt, so dass er den ganzen schmalen Raum ausfüllte. Der Kopf lag in einer großen, klebrigen Blutlache. Einen Augenblick dauerte es, bis Reimann erkannte, was das besonders Grauenhafte an dieser Leiche war: Der oder die Täter hatten dem Opfer die Augen ausgestochen und außerdem Nase und Oberlippe abgeschnitten. Erst jetzt sah er die abgetrennten blutverschmierten Körperteile, die unter dem seitwärts gekippten Schädel hervorschauten. War das Opfer bei lebendigem Leibe massakriert und ist ihm das Gesicht zerschnitten worden?
Wie der in seiner Tasche befindliche Ausweis zeigte, war Wilfried von Radestock 60 Jahre alt und wohnte in Halle-Neustadt. Er war stark übergewichtig, und Kommissar Reimann versuchte sich vorzustellen, wie sich der schwere Mann in dem kleinen Laden zwischen den Regalen und der Theke hin- und herbewegt hatte.
Er wandte sich an den Pathologen: „Todesursache war wohl ein Schuss oder mehrere in die Schläfe? Doch dem Täter, den Tätern hatte der bloße Tod nicht genügt. Sie wollten an der Leiche auch etwas demonstrieren. Oder vermuten Sie, dass die Täter das Opfer schon vor Todeseintritt verstümmelt haben?“
Der Pathologe Dr. Feustel nickte.
„Also viel kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Aber allem Anschein nach haben die Täter das Opfer im Laden getötet und dann hierher geschleift. Dafür sprechen die Blutspuren hier“, der Pathologe deutete auf die Bodenschwelle zum Lagerraum, „und hier“, jetzt wies er auf dunkelrote Flecke an der Schublade unterhalb der Ladentheke hin.
„Und müssen wir von den Tätern sprechen?“
„Tja, schauen Sie sich das Opfer doch mal an. Der wiegt locker 130 Kilo. Würden Sie dieses Gewicht alleine packen? Theoretisch ist das zwar möglich. Aber dann muss der Täter sehr kräftig sein.“
Kommissar Reimann stimmte zu.
„Und, ähm, was sagt uns die Verstümmelung des Gesichts?“
Der Pathologe beugte sich über das Opfer, sah sich noch mal ganz genau die Augenhöhlen an.
„Das muss ein abgestumpfter Täter gewesen sein, der vielleicht nicht zum ersten Mal gemordet hat. Oder jemand, der mit toten Menschen oder Tieren zu tun hat. Zum Beispiel ein Fleischer. Oder ein Bestatter.“
Der Kommissar zögerte einen Augenblick: „Oder ein Pathologe!“, fügte er tonlos hinzu.
Dr. Feustel lächelte: „Wollen Sie ein Alibi. Ich war heute Nacht zu Hause. Im Bett. Neben mir meine Frau. Sie können Sie anrufen.“
„Das mache ich später, wenn sich der Verdacht erhärtet“, erwiderte Reimann schlagfertig. „Aber mal im Ernst: Wann glauben Sie, ist der Tod eingetreten?“
„Sie haben eine gewählte Sprache“, lobte Dr. Feustel süffisant, „der Tod ist eingetreten. Wollen Sie nicht fragen, wann die Tat passiert ist. Denn dass dieser Mann keines natürlichen Todes gestorben ist, ist ja klar. Nun gut, die fortgeschrittene Leichenstarre über den großen Gelenken deutet auf einen Todeszeitpunkt zwischen 22 Uhr gestern Abend und 5 Uhr heute früh hin. Genaueres eventuell nach den Blutuntersuchungen im Labor. Und übrigens: Wir haben erst ein Auge des Opfers gefunden.“
Während der Pathologe sprach, hatte Reimann die Verkaufstheke mit abgesucht. Wo er auch hinschaute, sah er nur Bücher. Die einzige Ausnahme war ein Brett im Regal, das sich im Rücken der Theke befand und auf dem einige Frischhalteboxen, zwei angeschwärzte Bananen und eine halbvolle Flasche Mineralwasser deponiert waren. Was er in beiden Räumen gänzlich vermisste, war ein Computer oder irgendetwas, das auf Versandhandel hindeutete. Von der Durchsuchung der Wohnung versprach er sich Aufschlüsse.
„Kann ich?“, fragte er den Spurensucher, der an der Schubladentheke Blutpartikel abkratzte. Dabei zeigte Reimann auf die Bücher, die auf der Theke lagen. Der Mann nickte. Anschauen ginge, aber mitnehmen könne der Kommissar die Bücher nicht, die müssten ins Labor zur Untersuchung. Er reichte dem Kommissar ein Paar Handschuhe.
So ehrfurchtsvoll der Kommissar die Bücher in die Hand nahm, strahlten sie doch die Würde des Denkens früherer Jahrhunderte aus, so wenig konnte er mit den Titeln etwas anfangen. Sammlung von Briefen und Aufsätzen über die Gaßnerischen und Schrepferischen Geisterbeschwörungen, las er auf dem Titelblatt eines stark beriebenen Halblederbandes. Als Autor war ein Johann Salomo Semler benannt. Die Sammlung enthielt demnach das erste und zweite Stück und war 1776 in Halle an der Saale verlegt worden. Er legte das Buch zur Seite und nahm ein nur wenige Seiten umfassendes, gedrucktes Schreiben über die Magnetkur von Herrn A. Mesmer, Doktor der Arzneygelährtheit, an einen auswärtigen Arzt zur Hand, das 1775 in Wien erschienen war. Einige Seiten waren stockfleckig und eine Stimme in Reimann murmelte etwas von Altpapier, er fand sich aber eines Besseren belehrt, als er auf der letzten Seite einen Preis von 800 Euro mit Bleistift aufgeschrieben sah, darunter drei Buchstaben, die, so vermutete der Kommissar, eine Chiffre für den Einkaufspreis des Antiquars waren. Ein drittes Buch war unschwer als Produkt unserer Zeit zu erkennen, hatte es doch einen Schutzumschlag und auf diesem stand der Name des französischen Autors und in schwarz-roter Schrift, ein loderndes Feuer signalisierend, der Titel Die Entdeckung des Lebensfeuers. Franz Anton Mesmer. Eine Biographie.
Gerade wollte er die Bücher zurücklegen, da fiel ihm unter dem Stapel und unter allerlei Papier ein flachgedrückter Buchrücken auf. Er war mit Leder überzogen, im Folioformat, doch nirgends war ein Buchblock zu entdecken, an dem dieser Rücken fehlte. Was ihm jedoch besonders auffiel, waren Spuren fast getrockneten Blutes, die seine weißen Kunststoffhandschuhe einfärbten, als er ihn in die Hand nahm. Die Goldprägung war fast vollkommen abgeblättert, doch nach einer Weile glaubte er, ein paar Buchstaben und Ziffern zu erkennen. Er schrieb sie auf einen Zettel:
T
S
R
C
H
A
S
B
1
1
4
3
→
Ganz unten am Steg des Buchrückens entzifferte er: Inc. 125. Nur schwach erkannte er am oberen Steg zwei eingravierte Buchstaben: Zwei Mal ein geschwungenes großes A.