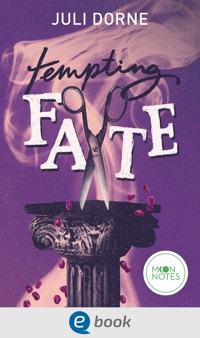
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Prickelnd geht es weiter mit Taru und Rio: Können sie ihre Geschichte neu schreiben? Nach den Enthüllungen von Pandora weiß Rio nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Sie soll eine Schicksalsgöttin sein? Trost erhofft sie sich von Taru, der jedoch in seiner eigenen Finsternis zu versinken droht und scheinbar nicht in der Lage ist, sie aufzufangen. Bitterlich enttäuscht von ihm, begibt Rio sich schließlich auf den Olymp – das Epizentrum der Götterwelt. Hier findet sie eine zweite Familie und endlich erste Antworten. Niemand Geringeres als Zeus nimmt sich ihrer an und treibt ihre Ernennung als Schicksalsgöttin voran, die sie für immer an den Olymp binden würde. Was Taru auf den Plan ruft. Schon einmal hat er seine einzige Liebe an Zeus verloren, und er ist nicht bereit, das ein zweites Mal zuzulassen. Was er dabei nicht bedacht hat: Rio ist keine Frau, die gerettet werden muss. Vielmehr ist sie wild entschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn sie es dabei mit Taru aufnehmen muss – und mit dem Göttervater himself. Göttliche Fantasy! Nach "Fighting Fate" hat Juli Dorne mit "Tempting Fate" grandios nachgelegt. - Band 2 der packenden "Fate"-Story: Fortsetzung der feministischen Romantasy mit Bodyguard-Thema. - Griechische Mythologie neu, modern und fesselnd interpretiert. Herzklopfen garantiert – New Adult Buch für Jugendliche und junge Erwachsene ab 16 Jahren. - Du hast "Percy Jackson" geliebt und konntest von der Serie "Lucifer" nicht genug bekommen? Dann lass dir die schicksalhafte Geschichte von Rio und Taru auf keinen Fall entgehen. - Ein atemberaubender Kampf gegen den Göttervater Zeus: Du musst ihn gewinnen, willst du dein Schicksal selbst bestimmen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Sammlungen
Ähnliche
Über dieses Buch
Nach den Enthüllungen von Pandora weiß Rio nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Sie soll eine Schicksalsgöttin sein? Trost erhofft sie sich von Taru, der jedoch in seiner eigenen Finsternis zu versinken droht und nicht in der Lage zu sein scheint, sie aufzufangen. Bitterlich enttäuscht von ihm, begibt Rio sich schließlich auf den Olymp – das Epizentrum der Götterwelt. Hier findet sie eine zweite Familie und endlich erste Antworten. Niemand Geringeres als Zeus nimmt sich ihrer an und treibt ihre Ernennung als Schicksalsgöttin voran, die sie für immer an den Olymp binden würde.
Was Taru auf den Plan ruft. Schon einmal hat er seine einzige Liebe an Zeus verloren, und er ist nicht bereit, das noch einmal zuzulassen. Was er dabei nicht bedacht hat: Rio ist keine Frau, die man retten muss. Und sie ist wild entschlossen, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Auch wenn sie es dabei mit Taru aufnehmen muss – und mit dem Göttervater himself.
Liebe*r Leser*in,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de
Schau gern hinten nach, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Inhalte in diesem Buch. (Um keinem*r Leser*in etwas zu spoilern, steht der Hinweis hinten im Buch.)
»Take courage, my heart: you have been through worse than this.«
— Homer, The Odyssey 20:18
Playlist
Fallen Star – The Neighbourhood
Sleeptalk (Reimagined) – Dayseeker
Dancing With Your Ghost – Sasha Alex Sloan
Drowned in Emotion – Caskets
exile (feat. Bon Iver) – Taylor Swift, Bon Iver
Gone – Blake Rose
The Night We Met – Lord Huron
My Underworld (feat. Corey Taylor) – Tonight Alive
Figure You Out – VOILÀ
Karma – MARINA
My Blood – Echos
Cure For Me – AURORA
THEDEATHOFPIECEANDMIND – Bad Omens
Plastic Hearts (Live) – Miley Cyrus
Like A God – Lia Marie Johnson
My name reprise – 2nd Moon
Fire On Fire – Sam Smith
Runaway – Dream on Dreamer
Petricor – Ludovico Einaudi, Daniel Hope
Teil 1Dunkelheit
1
Rio
»Es ist wirklich alles okay«, wiederholte ich zum gefühlt hundertsten Mal, was Dixie nur mit einem Augenrollen quittierte. Sie beugte sich noch etwas nach vorn, fast so, als wollte sie durch die purpur- und blau changierenden Flammen des Hadestelefons, die sich um ihr Gesicht züngelten, kommen und sich selbst davon überzeugen.
Vor einer Woche hatte ich diesen seltsamen Raum aus schwarzem Stein mit dem mächtigen Thron aus dem gleichen Material zum ersten Mal gesehen. Mittendrin Dixies wütende Stimme, die aus den flackernden Flammen erklang. Sie hatte mir erzählt, dass dieser Raum Teil des Hades war und sie deshalb mit uns – besser gesagt: mit mir – sprechen konnte. Direkt aus dem Hades heraus, ein Telefon in eine andere Welt.
Vor einem Monat hätte ich darüber gelacht. Jetzt war es meine Realität.
Dixie verengte ihre smaragdgrünen Augen und betrachtete mich eingehend, was mein Herz zum Flattern brachte. Sie konnte die Ängste von Menschen riechen, und meine Angst, die seit unserer Ankunft in New York ihre eisernen Schlingen um mich gelegt hatte, musste unheimlich stinken. Genauso wie die Schuld darüber, dass ich Dixie anlog.
Hoffentlich würde das Hadestelefon Dixies Kräfte blockieren.
»Na gut«, gab sie sich zufrieden, und ich unterdrückte ein erleichtertes Ausatmen. »Ich glaube dir. Aber sobald ich das Gefühl bekomme, dass es nicht so ist, schicke ich Rhada.«
»Nein!«, widersprach ich schnell. Zu schnell. Dixies Augenbrauen zogen sich als Antwort zusammen. Aber sollte Rhada hier auftauchen, würde ich Taru wohl gar nicht mehr zu Gesicht bekommen. »Ich meine, das ist nicht nötig. Wirklich. Taru ist einfach nur grummelig, wie immer.«
Was für eine Untertreibung. Es wäre sogar schön, wenn Taru einfach nur grummelig wäre. Er war nichts. Es fühlte sich an, als existiere er nicht mehr. Wie ein Schatten, den man nur bei einem bestimmten Lichteinfall entdeckte.
Die Wahrheit über das, was wirklich in Pandoras Palast geschehen war, konnte ich Dixie nicht erzählen. Wenn sie wüsste, wer ich wirklich war – wer ich sein sollte –, würde sie mich nicht mehr als Rio sehen. Ich konnte mich ja selbst kaum ansehen. Und Taru … Ich verbannte die Gedanken an ihn, die mit einem scheinbar magischen Band an meine Tränendrüsen gekoppelt waren, schnell in jene Schublade, in der ich auch das ganze andere Zeug verwahrte, über das ich nicht nachdenken wollte.
»Erklär mir noch mal, weshalb Pandora – die mächtigste Frau im gesamten Universum – den Fluch nicht von Taru nehmen konnte.« Dixie lehnte sich wieder auf dem Thron zurück, auf dem für gewöhnlich Hades, der Herrscher der Unterwelt, saß, um mit seinem Sohn sprechen zu können. »Vielleicht können Hades oder Persephone mit ihr sprechen. Jetzt, wo ihr sie gefunden habt. Ich meine, sie gehören quasi alle dem ›Wir hassen Zeus‹-Club an. Wenn sie es nur wüsste, dann könnten wir noch einmal versuchen, sie zu überzeugen …«
»Sie weiß alles«, unterbrach ich Dixie und fühlte mich mit jedem Wort schlechter, obwohl dieser Satz näher an der Wahrheit lag als alles andere, was ich Dixie bisher gesagt hatte. »Wir haben alles versucht.«
Ich hatte ihr die Lüge aufgetischt, Pandora könnte Taru nicht helfen, weil sie nicht wüsste, wie. Dummerweise hatte Dixie das als simple Weigerung ihrerseits interpretiert und war seitdem wild entschlossen, Pandora vom Gegenteil zu überzeugen. Ich hatte ihr schlecht erzählen können, dass Atropos … dass ich diejenige war, die diesen Fluch von Taru nehmen konnte. Es musste die Schicksalsgöttin sein, die er geliebt hatte – das war die Bedingung, um den Fluch zu brechen. Nur wusste ich weder, wie ich das anstellen sollte, noch glaubte ich, wirklich eine Göttin zu sein.
Wäre ich eine, dann wäre ich doch mächtig, oder? Wäre ich eine verdammte Schicksalsgöttin, hätte ich abwenden können, dass meine Mom uns verließ. Ich hätte meinem Dad so viel Kummer erspart. Ich hätte Dixie vor ihrem Beinahe-Tod bewahren können. Ich hätte Taru helfen können.
Nur war alles, was ich tun konnte, bedeutungslos.
»Okay, okay«, gab sich Dixie geschlagen. »Aber wenn irgendetwas ist, dann melde dich, ja? Und sag Taru, dass er sich auch gerne blicken lassen kann. Ich fühle mich beinahe schon persönlich beleidigt, dass er mir sein prächtiges Dreiviertelgott-Gesicht vorenthält.«
Ich zwang mir ein Lächeln auf, während Dixie breit in das Feuer grinste und sich ihre Haare über die Schulter warf. Ich würde Tarus prächtiges Dreiviertelgott-Gesicht auch gerne wiedersehen. Jedenfalls öfter als nur in diesen kurzen Momenten in der Nacht.
Zwei Wochen waren vergangen, seitdem wir von Pandora zurückgekehrt waren und Taru sich in seinem Büro verschanzt hatte. Nur ab und zu, wenn ich Glück hatte, stand seine Tür offen. Doch die Stille zwischen uns war so laut, dass ich es kaum aushielt, länger bei ihm zu bleiben. Sobald ich zurück in dem Gästezimmer war, in dem ich neuerdings wohnte, presste ich mir die Hände auf die Ohren, damit das Rauschen meines Blutes die Stille vertrieb.
Die einzige Gesellschaft, die mir blieb, waren Alpträume.
Ich träumte oft von der Nacht, in der Mom verschwunden war. Von der Dunkelheit, ihren schroffen Anweisungen, zu verschwinden, und von anderen Worten, die ich nicht verstand, weil mich dieses schwarze Nichts wie Watte umhüllte. Und dann träumte ich von ihr. Atropos. Von langen Stränden aus Stein und Knochen, eingetaucht in das Licht des immerwährenden Sonnenuntergangs. Ich träumte von hellen Lichtern, von süßen Gerüchen und von zwei Frauen, die mich anflehten, nicht zu gehen. Und ich träumte vom weißen, kalten Stein, mit dessen eisiger Oberfläche ich zu verschmelzen schien. Es war Atropos’ … mein Tod, von dem ich träumte.
Das waren die Nächte, in denen ich kein Auge zubekam und mich stattdessen auf die warmen Fliesen der Dusche setzte, damit das heiße Wasser die Kälte in meinen Gliedern vertrieb. Es waren die einzigen Nächte, in denen ich Taru sah.
Während ich unter dem herabprasselnden Wasser saß, lehnte er an der gläsernen Duschwand, seine Arme umspielt von Schatten. Und sobald ich aus der Dusche trat, verschwand er.
Auch in dieser Nacht hatte er wieder neben mir gewacht. Erst als meine Haut schrumpelig war und New York in rosarotes Licht getaucht wurde, hatte ich das Wasser abgestellt. Doch noch bevor der letzte Tropfen den Boden berühren konnte, war Taru schon weg gewesen.
»Wann kommst du wieder?«, fragte ich Dixie mit wackeliger Stimme und versuchte, mich mit aller Macht auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren.
Ein mitfühlender Ausdruck legte sich auf ihr Gesicht. Sie war viel zu aufmerksam. Meine Hoffnung, sie würde mich nicht lesen können, geriet ins Wanken.
»Oh, Süße, ich weiß es nicht.« Sie senkte den Kopf, dass ihre langen Haare wieder über die Schulter fielen. »Es war wirklich knapp, und Persephone glaubt, dass ich noch Wochen brauche, um mich zu erholen. Meine Seele war kurz davor, ins Nichts zu fallen.«
Ich schluckte und konnte nur nicken. Die Erinnerungen daran, wie Dixie voller Blut auf meinem Bett im Penthouse gelegen hatte, wie sie aufgehört hatte zu atmen, waren noch viel zu präsent. »Dixie …«
»Aber bald nerve ich euch wieder.« Sie hob den Kopf und strahlte mich an. »Bis dahin wird die Zeit sicher wie im Flug vergehen, immerhin habt ihr das Penthouse gerade ganz für euch allein. Ich will gar nicht wissen, wo –«
Dixie wurde von einer hellen Frauenstimme unterbrochen. Sie drehte ihren Kopf und lächelte. »Ich muss los, Rio. Persephone und Hades haben irgendeinen unterweltlichen Kram geplant, an dem ich als Tarus Vertretung teilnehmen soll, da unser Prinz sich immer noch weigert, den Hades zu betreten. Aber wie auch immer.« Sie wedelte mit der Hand, warf ihre Haare wieder über die Schulter und wurde ernst. »Ich bin bald wieder da, und dann regeln wir die Dinge gemeinsam. Wir sind jetzt eine Familie, Rio.«
»Okay«, murmelte ich leise.
»Wir reden morgen wieder, ja?« Dixie suchte zwischen den kleiner werdenden Flammen meinen Blick. Und als ihre Augen schimmerten, viel zu grün für einen gewöhnlichen Menschen, fragte ich mich, ob sie mich nicht schon die ganze Zeit über gelesen hatte.
Wir verabschiedeten uns. Ich blieb noch einen Moment länger auf dem kalten Thron sitzen und sah zu den schwarzen, glatt polierten Steinwänden, die ohne die blauen Flammen des Hadestelefons kalt und finster wirkten. Es war immer noch unglaublich, dass dieser Raum ein direkter Teil der Unterwelt war. Mitten in New York.
Ich fuhr mit den Händen über mein Gesicht, um mich auf die dröhnende Stille im Penthouse vorzubereiten.
Es nützte nichts. Länger konnte und wollte ich hier nicht verharren und verließ den magischen Raum. Das Klicken des Türschlosses hallte unnatürlich laut nach und bescherte mir eine Gänsehaut. Mit leisen Schritten lief ich die dunkle Treppe mit den metallenen Handläufen hinauf und steuerte Tarus Büro in der unsinnigen Hoffnung an, seine Tür würde offen stehen. Vielleicht war er heute bereit, mit mir zu reden.
Doch die Enttäuschung überschwemmte mich wie ein Regenschauer und ließ mich kalt und klamm zurück.
Die Tür war verschlossen.
Der Fahrstuhl erreichte das Erdgeschoss des Marquand-Gebäudes, und erst jetzt konnte ich meine Hände lockern. Nur das Brennen, das meine Fingernägel auf meinen Handflächen hinterlassen hatten, blieb als Erinnerung an Tarus verschlossene Tür zurück.
Roter Teppich, marmorierte Säulen und goldene Blumentöpfe begrüßten mich, als ich in das Foyer trat. Es herrschte ein belebtes Treiben. Einige der Bewohner wollten in das angrenzende Restaurant, andere warteten an der Rezeption, um sich ein Taxi rufen zu lassen, und eine Traube von Frauen in eleganten Businesskostümen lief auf einen der Konferenzräume zu.
Es wirkte weiterhin wie ein Traum, dass ich nun hier wohnte, wo ich doch noch vor mehr als einem Monat darum bangen musste, meine Wohnung in Murray Hill überhaupt behalten zu können. Doch dank der Drohungen der Götter konnte ich dort nicht mehr wohnen, und ich hatte sie gekündigt.
Jetzt wünschte ich, ich hätte es nicht getan. Vielleicht wäre es für Taru einfacher, die Geschehnisse zu verarbeiten, wenn ich nicht in seiner Nähe wäre. Ich wollte mir gar nicht vorstellen, wie retraumatisierend es für ihn sein musste, dass ich Atropos sein sollte. Die Frau, die er geliebt hatte und für deren Tod er sich verantwortlich fühlte.
Ich schlängelte mich zwischen den Menschen hindurch und hoffte, unentdeckt an der Rezeption vorbeizukommen. Auf meine Brust hatte sich dieser immense Druck gelegt, und Nonas aufmerksamer Blick würde alles nur schlimmer machen.
Außerdem brauchte ich dringend frische Luft.
Ich brauchte Bewegung und wollte fremden Gesprächen lauschen, damit ich mich mit dem Leben anderer Menschen von meinem eigenen Chaos ablenken konnte.
Hätte ich meinen Job im Theater noch, würde ich mich in den Pausen auf die Bühne schleichen und meine liebsten Monologe rezitieren und die berühmtesten Soli singen. Ich würde die Augen schließen und mir vorstellen, ich wäre Velma aus Chicago, Eliza aus My Fair Lady oder Christine aus Das Phantom der Oper. Ich wäre einfach jemand anderes.
Was für ein grässliches Paradoxon, dass ich genau das war. Jemand anderes. Nicht mehr die freakige Rio, die versuchte, sich mit Minijobs über Wasser zu halten, um ihren Dad nicht zu belasten und ihr Studium, wie auch ihre überteuerte Wohnung, bezahlen zu können. Die sich abkapselte, selbst von ihrem besten Freund, damit niemand bemerkte, dass unheimliche Wesen in dunklen Ecken auftauchten und die Dunkelheit Angst bedeutete. Ich hatte mir mein Leben lang gewünscht, nicht ich zu sein, nicht die Version, vor der ich mich fürchtete. Normal zu sein. Jetzt war ich weder normal noch eine Version, vor der ich mich nicht fürchtete. Im Gegenteil. Ich bekam kaum ein Auge zu, wenn ich daran dachte, wer ich war. Wer ich sein sollte.
Ich schluckte gegen den immer stärker werdenden Druck in meinem Hals an, der den in meiner Brust nur noch verstärkte, und versuchte gerade, mich an einem Mann mit dunklem Trenchcoat vorbei hinaus auf die Madison Avenue zu drücken, als ich meinen Namen hörte.
Für einen Moment schloss ich die Augen und wünschte, ich könnte auch für Nona so unsichtbar werden, wie ich es für die Erinnyen war.
Keine Chance.
»Rio, warte.« Nona trat vor mich, ihre kurzen Haare waren zerzaust, wie an jenem Tag, als die Dunkelheit vor mir in der Gasse erschienen war und verschwand, sobald Nona auftauchte. Damals hatte sie mir gesagt, dass sie es ebenfalls gesehen hatte. Doch die anfängliche Erleichterung, nicht verrückt zu sein, war einer Erkenntnis gewichen, die mir nicht gefiel. Wenn Nona diese Dunkelheit, anders als alle anderen Menschen um mich herum, gesehen hatte, bedeutete das, dass sie zumindest irgendwie etwas mit dem Olymp zu tun haben musste. Aber hätte Taru sie nicht erkennen müssen, als wir in dieses süße Café in Chelsea gefahren waren, um den Vertrag zu unterschreiben? Er hatte sich nichts anmerken lassen. Und er hätte mir doch sicher davon erzählt, wenn Nona Teil seiner Welt wäre. Oder?
»Hi, Nona«, sagte ich nur und versuchte, ein freundliches Gesicht aufzusetzen. Vielleicht hatte sie ja vergessen, was geschehen war.
»Wir müssen reden«, setzte sie an und beugte sich zu mir, dass mir der süße Geruch ihres Parfüms entgegenschlug. Sie betrachtete mich mit diesem aufmerksamen Blick, vor dem ich fliehen wollte. Sie hatte es definitiv nicht vergessen. »Über diese Dunkelheit und über das, was du über Namtaru zu wissen glaubst.«
»Namtaru?«, echote ich ungläubig. Wie konnte sie Tarus richtigen Namen kennen? Ich wusste, dass er sich hier auf der Erde nur als Taru vorstellte. »Woher …«
»Ich kenne Namtaru besser, als du glaubst.«
Schock rauschte durch meine Venen und ließ mich für einen Moment diesen grässlichen Druck in meiner Brust vergessen. »Ich muss mit dir darüber reden, Rio. Und wo warst du die letzten Tage? Ich habe versucht, dich zu finden, ich dachte schon, er –« Nona schüttelte den Kopf, trat noch näher an mich heran und ich glaubte tatsächlich, so etwas wie Sorge in ihren Augen aufleuchten zu sehen.
Ich musste hier raus. Ich konnte mich jetzt nicht damit auseinandersetzen, was wir beide in dieser Gasse gesehen hatten oder woher sie Tarus richtigen Namen kannte.
»Ich war … unterwegs«, murmelte ich und wollte mich endlich aus diesem furchtbar engen Foyer drücken. Von wegen, der Schock vertrieb den Druck. Es wurde nur noch schlimmer. »Ich muss jetzt los, Nona. Ich kann echt nicht –«
»Rio, bitte. Ich muss wirklich, wirklich mit dir reden, sonst … sonst …« Nona verstummte und strich sich eine imaginäre Haarsträhne hinter die Ohren. Ein Schauer rauschte über meinen Rücken, als sie flehend nach meinen Händen griff, fast wie dieses lästige Kribbeln eines sich ankündigenden Déjà-vus. »Einige Dinge haben sich ziemlich drastisch verändert, und dort, wo ich herkomme …« Nona stockte, sie schien nach den richtigen Worten zu suchen.
»Wo du herkommst?« Ich sah sie an. »Michigan?«
»Nein, nicht Michigan.« Sie schluckte, und eine Vorahnung beschlich mich. »Ich … ich lebe normalerweise auf dem Olymp.«
Plötzlich fühlte es sich an, als würde jegliche Energie aus dem überfüllten Foyer gezogen. Als würden alle Anwesenden den Atem anhalten und zu flimmernden Gestalten werden. Nonas Augen veränderten sich. Das dunkle Braun, das vor wenigen Sekunden noch panisch und matt gewirkt hatte, wurde heller. Die Farbe schien aus der Iris zu fließen, bis ein kaltes, fast schon flüssiges Quecksilbergrau zurückblieb. Das gleiche Grau, das mich seit zwei Wochen in meinen Albträumen verfolgte.
Ich hatte gedacht, es wären Atropos’ Augen gewesen. Ich hatte mich geirrt.
Es war Nona.
Ich stolperte einige Schritte zurück, blieb irgendwo mit meinem Fuß hängen. »Wer bist du? Was bist du? Warum … warum sind deine Augen anders? Wie –« Ehe ich mich versehen konnte, landete ich auf dem harten Marmorboden. Kalter Stein unter meinen Händen. Der empörte Ruf desjenigen, über den ich gefallen sein musste, drang kaum zu mir durch. Weißes Rauschen legte sich auf meine Ohren. Alles, was ich wahrnahm, war dieser schrecklich kalte Boden. Bilder jagten durch meinen Kopf, getarnt als Erinnerungen. Es waren nicht meine, und doch war ich die Protagonistin in der Situation.
Ein Röcheln erklang. Mein Röcheln. Ich wurde auf den weißen Steinboden geworfen. Vor mir breite Stufen. Ich versuchte, meinen Blick zu heben, doch alles tat weh. Selbst meine Augen zu bewegen, schien mir unmöglich. Mein ganzer Körper war so … so kalt.
»Tut doch etwas … irgendetwas, verdammt! Sie stirbt, seht ihr denn nicht … Vater. Vater, bitte. Du kannst nicht …«
»Ruhe!« Eine donnernde Stimme unterbrach das Schluchzen, während eine andere, viel dunklere Stimme leise Worte murmelte. »Es ist ihr eigenes Vergehen. Ihr Faden ist durchtrennt. Wir können nichts tun.«
Ein Raunen ging durch den Raum, lautes Flüstern folgte, ich verstand kein Wort. Wo war ich nur? Und weshalb … weshalb gehorchte mir mein Körper nicht? Erneut versuchte ich, mich aufzustemmen. Meine Arme reagierten nicht.
»Nein!« Die schluchzende Stimme wurde mit jedem Nein verzweifelter. Ich wollte zu ihr eilen. Diese Stimme, sie kam mir so bekannt vor … so vertraut … Ich musste etwas sagen. Worte formten sich schon in meinem Mund, nur ein weiteres klägliches Röcheln erklang. Ich wusste, dass ich starb. Ich wusste es, weil es der Traum war, der mich seit zwei Wochen verfolgte.
»Nein, nein, nein. Ich kann das nicht … ich … Du bist ein verfluchtes Monster! Du hast …«
»Beende, was du angefangen hast, Göttermörder.«
»Rio! Rio, komm zu dir!«
Die Taubheit verschwand, nur mein rasendes Herz und die eisige Kälte blieben, während Nona mich mit einer Berührung an meiner Schulter zurück in die Realität zog. Das Rauschen in meinen Ohren wurde leiser und die Geräusche des Foyers klarer. Ein Mann neben mir telefonierte und deutete auf mich. Neben mir lag ein Koffer, er musste ihm gehören. Ich richtete mich auf, blinzelte und konzentrierte mich auf Nonas Gesicht.
»Was ist eben passiert? Was hast du gesehen?«, fragte sie.
»Mir geht’s gut«, hörte ich mich mit schwacher Stimme sagen. Am liebsten würde ich mich unter die heiße Dusche retten. Ich musste diese arktische Kälte aus mir bekommen. »Mir geht’s gut.« Ich fuhr mir übers Gesicht. Meine Hände waren nass und fast so kalt wie der Boden, auf dem ich in dieser Erinnerung gelegen hatte.
Ich hatte Atropos’ Tod durchlebt. Seit dem Besuch bei Pandora tauchten immer mehr solcher Träume – nein, Erinnerungen – auf. Aber immer, wenn ich versuchte, mich an die Details zu erinnern, verschwamm alles zu undurchsichtigen Wirbeln an Bildern. Mein Kopf schmerzte, je länger ich darüber nachdachte.
»Miss, der Krankenwagen ist in weniger als zehn Minuten hier!« Ein fremdes, besorgtes Gesicht schob sich in mein Sichtfeld. Sofort rappelte ich mich auf.
»Nein, bitte. Das ist nicht nötig … ich …« Ich strich über meine Jeans, um diesem rauen Gefühl des Steins unter meinen Fingerspitzen zu entkommen. Panisch drehte ich mich zu Nona. Was wollte ich tun? Ich konnte nicht in ein Krankenhaus. Dort würde ich nur wieder seltsam angesehen werden. Sie würden mir Blut abnehmen und Fragen stellen, auf die ich nun Antworten hatte, die mir aber wieder niemand glauben würde. Das ertrug ich heute nicht.
»Ich habe nur zu wenig gegessen«, log ich. Seit drei Tagen futterte ich ausschließlich Pizza und Überreste von Hershey’s Schokolade, die ich in Dixies Zimmer gefunden hatte. »Mir geht es gut. Wirklich. Tut mir leid, dass ich Ihnen diesen Schrecken eingejagt habe.«
»Das geht nicht, der Krankenwagen ist schon unterwegs.« Der Mann nahm das Telefon von seinem Ohr und sah mich entrüstet an. »Das ist kein Taxi, das man einfach abbestellen kann.« Ich warf dem Mann einen entschuldigenden Blick zu und wollte gerade etwas sagen, da zog Nona mich zu der Sitzecke mit den edlen Sesseln. Der Mann warf uns weiter böse Blicke zu.
»Komm mit mir, Rio. Dann können wir in Ruhe reden«, sagte Nona, bevor ich mich auf einen der roten Sessel setzen konnte. Ich schüttelte den Kopf.
»Rio, bitte. Du glaubst ja wohl nicht, dass Namtaru dir helfen wird. Du bist ihm egal, für ihn bist du nur eine Marionette in seinem Spiel gegen meinen … gegen die Götter. Ich kann dir helfen.«
»Woher weißt du, dass ich Hilfe brauche?« Ich überging den Kommentar zu Taru. Ich würde nicht zulassen, dass Nona diese Zweifel befeuerte, die sich seit unserer Rückkehr von Pandora in meinem Kopf entwickelt hatten.
Nona legte den Kopf schief und deutete vielsagend zu der Stelle, wo ich zuvor noch auf dem Boden gelegen hatte. »Du hast Visionen«, erklärte sie mit leiser Stimme und bestätigte damit, dass auch meine Albträume vielmehr Atropos’ Erinnerungen waren. »Diese Visionen werden erst verschwinden, wenn du die Wahrheit kennst. Ich kann dir dabei helfen.«
Die Wahrheit hatte mir schon einmal nicht geholfen. Danach war nur alles schlimmer geworden. Ich wusste nicht, ob ich nicht doch lieber unwissend weiterleben wollte. Was waren schon ein paar Visionen?
Heulende Sirenen lenkten meine Aufmerksamkeit auf die Madison Avenue. Irgendwas musste ich tun, wenn ich nicht in einen Krankenwagen gesteckt werden wollte. Zurück in das Penthouse wollte ich nicht, vor allem nicht zusammen mit Nona. Sie machte nicht den Eindruck, als würde sie sich davon abhalten lassen. Außerdem war ich dieser furchtbaren Stille gerade erst entkommen.
»Okay«, sagte ich. »Lass uns gehen. Ich brauche einen Spaziergang.«
2
Rio
Kalte Novemberluft schlug mir entgegen. Manhattans Geräuschkulisse aus hupenden Autos, tickenden Ampeln und dem Murmeln der Menschen vertrieb den letzten Rest des Rauschens aus meinen Ohren. Während es sich angefühlt hatte, als würde sich die Kälte des Marmorbodens in meine Haut einbrennen, war der frische Wind, der verloren gegangene Flugblätter aufwirbeln ließ, wie eine zärtliche Berührung.
Ich lief mit Nona die Madison Avenue entlang, bis wir die Fifth Avenue erreichten und den Central Park betraten. Die Bäume hatten bereits alle Blätter verloren, der Winter kam mit großen Schritten auf New York zu.
Sofort musste ich an Tarus und meine erste Begegnung denken, als der Herbst die Bäume noch bunt gefärbt hatte. Als ich noch nichts über die Götter, Erinnyen und meinen Platz zwischen ihnen gewusst hatte. Ich sah Taru vor mir, wie er am Südeingang des Central Parks stand, mit einem entzückten Funkeln in den Augen, weil er das erste Mal seit Jahrhunderten sein Apartment verlassen hatte, ohne dass ihn die Erinnyen verfolgten. Jetzt verließ er noch nicht einmal mehr sein Büro.
Und das alles wegen mir und weil ich war, wer ich war.
Nona und ich liefen eine ganze Weile schweigend nebeneinander. Die Bewegung tat mir gut und half, die Erinnerung an Atropos in die Schublade zu stecken, die mittlerweile überquoll. Es war nur eine Frage der Zeit, bis sie einfach aufplatzen würde.
Wir erreichten den Inscope Arch, einen der Tunnel im Central Park, der aussah wie ein verwunschenes Tor zu einer anderen Welt, mit saftig grünen Hügeln und kleinen Höhlenwohnungen. Nur gelangte man in die gleiche Realität, die man auf den Stufen in den Tunnel hinter sich ließ.
»Willst du mir erzählen, was passiert ist?« Nonas Stimme klang behutsam, aber ich hörte deutlich die Dringlichkeit darin.
Ich presste die Lippen aufeinander und richtete den Blick auf meine Füße, die in meinen geliebten Docs steckten. Ich wusste nicht, wie viel ich ihr erzählen konnte. Ob ich ihr trauen konnte. Wieder gab es so vieles, was ich nicht wusste. Wenn sie wirklich dem Olymp angehörte, gehörte sie zu jenen Personen, die für Tarus Strafe verantwortlich waren und damit auch für meinen … Atropos’ Tod, oder?
»Mein richtiger Name ist Klotho.«
»Was?« Überrascht sah ich auf.
Ein enttäuschtes Lächeln legte sich auf ihre Lippen. Sie schien sich eine andere Reaktion von mir erhofft zu haben. »Ich bin eine Schicksalsgöttin. Eine der drei, um genau zu sein«, fuhr sie fort.
Ich blieb stehen. Mein Herz setzte einen Schlag aus, als sich die Puzzleteile langsam zusammenfügten. Wenn Nona Klotho hieß und eine der Schicksalsgöttinnen war … eine der drei … bedeutete das – »Ich habe vor Jahrhunderten meine Schwester verloren. Ihr Name war …«
»Atropos«, kam es gleichzeitig aus unseren Mündern. Leise aus ihrem, verzweifelt aus meinem.
»Du bist es wirklich«, fügte sie noch leiser hinzu.
Das konnte nicht sein. Alles in mir krampfte sich zusammen, während der Schock meine Welt in Schieflage brachte. Ich stolperte. Das zweite Mal an diesem Tag. Doch diesmal fiel ich nicht, sondern spürte den feuchten, kalten Stein des Inscope Arch in meinem Rücken. Wie er sich durch meine violette Regenjacke drückte, wie ich langsam daran herunterrutschte, weil mich meine Beine nicht mehr halten konnten. Weil sie unter dem Gewicht all der Lügen, all der aufgedeckten Wahrheiten und diesem furchtbaren Druck in mir nachgaben.
Sollte Wahrheit nicht befreiend sein? Hatte Medusa nicht in ihrem Labor in Ägypten genau das gesagt? Warum fühlte es sich dann an, als würde ich mit jedem weiteren Fünkchen Wahrheit in ein grausames Verlies gesperrt werden?
Ich presste die Augen zusammen, damit die Welt endlich aufhören würde, sich zu drehen, und hoffte, dass wenn ich nichts sah, mich auch nichts mehr erreichen konnte. Ich wollte die Tatsachen und die neuen Erkenntnisse aussperren, so wie ich es mit der Erinnerung an das Verschwinden meiner Mom getan hatte. Nichts mehr sehen, nichts mehr hören, nichts mehr sagen, wie diese verfluchten Affen-Emojis, die Jake in seiner Tinder-Bio stehen hatte. Ich brauchte einen vierten Affen, einen, der Gefühle ausschalten konnte, denn es war so verdammt anstrengend, zu fühlen.
Doch als ich meine Augen öffnete, war da keine Dunkelheit, die mich vor der Realität schützen konnte, sondern Nona, die eigentlich Klotho war und vor mir hockte. Mich mit traurigen Augen ansah, während der Novemberwind durch den Tunnel rauschte, als wollte er so schnell aus der Situation entfliehen wie ich. Diesmal gab es aber kein Entkommen, keine Flucht.
»Anscheinend habe ich meine Schwester wiedergefunden.« Nona legte ihre Hände auf meine Knie, die ich an meinen Körper gezogen haben musste. Ihre grauen Augen funkelten wie frisch polierte Diamanten.
»Erzähl mir alles«, sagte ich mit zittriger Stimme. »Und lass kein Detail aus.«
»Klotho, Lachesis und Atropos«, wiederholte Nona … Klotho zum zweiten Mal, während ich die Tasse meiner heißen Schokolade auf den Tisch stellte. Klotho hatte mich nach meinem Zusammenbruch auf die Beine gezogen und in das nächstbeste Café in einer Seitenstraße der Fifth Avenue gezogen. »Es gibt nur uns drei. Wir bestimmen das Schicksal der Menschheit. Du … Atropos durchschnitt den Lebensfaden der Menschen, Lachesis bemisst die Länge, und ich spinne ihn.«
»Aber du bist jetzt hier … wer spinnt dann den Faden?«, fragte ich, immer noch furchtbar verwirrt. Während ich das Offensichtlichste – dass vor mir meine Schwester saß – zu ignorieren versuchte. »Irgendwo habe ich mal gelesen, dass jede Sekunde vier Babys geboren werden. Wie soll das funktionieren?«
Klothos Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »So einfach ist es nicht. Die Lebensfäden werden schon lange vor der Geburt gesponnen. Das Schicksal eines Menschen wird geschrieben, bevor er geboren wird. Ich habe also immer einen kleinen Puffer.« Klotho nahm einen Schluck ihres gelben Tees und schien kurz zu überlegen, wie sie es am besten erklären sollte. »Egal, wie lang oder kurz ein Lebensfaden wird, wir sehen den Anfang, lange bevor ein neues Leben entsteht. Jeder Faden hat seine Berechtigung, genauso wie jede Entscheidung, ob ein Leben entstehen soll oder nicht. Das ist etwas, das nicht immer in unserer Hand liegt.«
Ich nickte. »Was ist mit dem Durchtrennen des Fadens? Ist das auch so einfach? Und wessen Aufgabe ist es jetzt, da Atropos …«
Als Nona auf ihren Teller sah, auf dem die Überreste ihres Carrot Cakes lagen, erhielt ich bereits meine Antwort. »Wenn der Faden gesponnen und bemessen wurde, wird auch das Ende festgelegt, und Lachesis und ich – wir haben diese Aufgabe übernommen. Zumindest bei den Menschen. In unserem Leben gibt es kein Ende. Es … es hätte keins geben sollen.« Klotho lehnte sich leicht nach vorn und betrachtete mich mit einem neugierigen Blick. »Doch wenn jemand stirbt, dann ist es endgültig. Da sollte es keine Ausnahmen geben. Das Leben meiner Schwester hätte vorbei sein sollen, dennoch habe ich ihre Seele in dir gespürt. Einen Teil, der mich schon im Foyer des Marquands gerufen hat.« Nona legte den Kopf schief.
Auch ich erinnerte mich an den Moment, als ich Nona das erste Mal gesehen hatte. Es war der Tag gewesen, an dem ich Taru zum ersten Mal abgeholt hatte, um kurz darauf den Vertrag zu unterschreiben. Ich dachte, sie hätte mich wegen Taru so seltsam angesehen.
»Und als diese Dunkelheit auftauchte, mitten auf der Straße, und du sie sehen konntest, wusste ich, dass du kein gewöhnlicher Mensch bist, auch kein einfaches göttliches Wesen. Wie kann –«
»Weißt du, was es war? Diese Dunkelheit?« Mein Herz wummerte bei dieser Frage, und mein Hals wurde trocken, doch ich traute mich nicht, nach meiner Tasse Kakao zu greifen, aus Angst, ich würde ihn mit meinen zitternden Händen verschütten.
»Nein.« Klotho schüttelte den Kopf. »Der einzig lebendige Gott, der Schatten beschwören kann, ist Namtaru. Ich dachte, er wäre in diesem Moment bei dir …«
»Er war es nicht. Taru war …« Ich verstummte und versuchte, nicht so sehr darüber nachzudenken, wieder keine Erklärung für die Dunkelheit bekommen zu haben. »Er war zu dem Zeitpunkt nicht da.«
All das, was nach dem Auftauchen der Dunkelheit passiert war, überschwemmte meine Gedanken. Dixies Verletzungen, Tarus blutverschmiertes Gesicht, seine Verzweiflung, sein Schmerz – all das fühlte sich so weit entfernt an und nicht, als wäre es gerade mal knapp zwei Wochen her.
Klothos Augenbrauen zogen sich zusammen, doch als sie zum Sprechen ansetzen wollte, kam ich ihr zuvor: »Wie ist es passiert? Wie bin ich … wie ist Atropos gestorben?«
Sofort bereute ich meine Frage. Klotho presste die Lippen zusammen und senkte den Blick, während das Grau ihrer Augen beinahe flüssig wurde.
»Tut mir leid«, sagte ich schnell. »Sie war deine Schwester, ich hätte nicht fragen sollen. Es ist nur … ich habe so viele Fragen und –«
»Du bist meine Schwester, Rio. Es gibt keinen Unterschied zwischen euch. Ihre Seele und deine, es sind die gleichen«, unterbrach Klotho mich. Ihr Blick suchte meinen, während ich hilflos durch das gut besuchte Café sah, um irgendwie mit diesen neuen Informationen klarzukommen. Weshalb fühlte es sich nur so falsch an, an mich als Atropos zu denken? Sollte diese Erkenntnis nicht befreiend sein? Warum fühlte ich mich mit jedem Augenblick nur immer weniger wie ich selbst? »Atropos war schon immer … sie war es leid, den Faden der Menschen zu durchtrennen«, setzte Klotho an, und ich war froh darüber, dass sie von Atropos und nicht von mir sprach. So konnte ich mir einreden, dass es nicht meine Vergangenheit war. »Mit jedem Tod starb auch etwas von ihr. Sie hasste es, dass sie beinahe grausamer war als Hades selbst. Sie sagte mir, dass sie ein Mal den Hauch von Leben spüren will, um die kalten Hände des Todes ertragen zu können.« Ich schluckte, als Klotho aufsah. »Sie war schon immer die Dramatische von uns. Manchmal stahl sie sich heimlich aus der Schicksalshalle, um den Tragödien und Komödien der Olympier zu lauschen, die die Bewohner der Akropolis aufführten. Sie war regelrecht besessen vom Schauspiel.« Klotho schüttelte den Kopf und lächelte leicht, sie schien in den schönen Erinnerungen an ihre Schwester zu schwelgen.
Mich erwischte diese Tatsache wie ein stürmisches Gewitter. Atropos hatte Schauspielerei geliebt … war das der Grund, weshalb auch ich es liebte? War es Teil ihrer Persönlichkeit statt meiner? Und war das der Grund, weshalb Taru so vielen der Tragödien und Stücke der Götter gelauscht hatte? Hatte er das zusammen mit Atropos getan? Ich schob meine Hände unter den Tisch und presste sie fest auf meine Oberschenkel, als Klotho weitersprach. »Irgendwann reichte es ihr nicht mehr, nur zuzusehen. Sie wollte mehr, und sollte sie nicht mehr bekommen, würde sie vergessen wollen. Wie ich dir ja schon gesagt habe, hat unser Leben kein Ende. Man kann uns also nicht so leicht umbringen. Sogar ein Gott ist einfacher zu töten. Wir … wir sind anders als die anderen Olympier, durch unsere Adern fließt das reinste Blut der Göttlichkeit. Wäre Atropos einfach nur in den Fluss Lethe gegangen, wäre sie nicht gestorben, sie hätte nur alles vergessen. Der Fluss Lethe ist …«
»Der Fluss des Vergessens, ich weiß.« Ich erinnerte mich nur zu gut an das, was Taru mir auf Hawaii erzählt hatte, kurz bevor wir seiner Mutter und den anderen Nymphen begegnet waren, um den Ariadnefaden zu besorgen. Jener Faden, der uns im Labyrinth des Minotaurus das Leben gerettet hatte. Nur Seelen, die dem Fluss Lethe übergeben wurden, gelangten nicht in den Hades. Diese Seelen gerieten ins Nichts. »Tut mir leid, erzähl bitte weiter. Ich … ich weiß kaum etwas über sie. Taru spricht nicht darüber.«
»Natürlich nicht.« Ein ärgerliches Schnauben entkam Klotho, doch sie fuhr fort. »Als meine Schwester an den Fluss Lethe ging, traf sie jemanden, der mehr wert war als zu vergessen. Es war Namtaru, der Bastardsohn des Hades, und meine Schwester verliebte sich in ihn.« Klotho stoppte, holte kurz Luft, ehe sie weitersprach. Ich saß nur stocksteif auf meinem Stuhl. Jeder Muskel in meinem Körper war angespannt. In diesem Moment wurde die zuvor abstrakte Geschichte zu grausamer Realität. Es war Tarus Vergangenheit. Meine Vergangenheit, an die ich mich nicht erinnerte. »Natürlich verliebte sie sich ausgerechnet in ihn. Sie sprach nicht über ihn, nannte nie seinen Namen, aber ich wusste, dass es jemanden gab, der sie überzeugt hatte, nicht mehr vergessen zu wollen. Meine Schwester, die dem Tod eigentlich entfliehen wollte, verliebte sich in ihn. Es klingt beinahe wie eine Komödie aus eurer Menschenwelt, oder?« Ein trockenes Lachen entkam Klotho, während in ihren Augen Tränen schimmerten. »Sie verschwand immer öfter und kam mit rosigen Wangen zurück. Lachesis sagte mir, dass wir sie lieben lassen sollten. Aber in unserem Leben hatte Liebe keinen Platz. Das Schicksal hatte diese Art der Gefühle nicht für uns vorhergesehen, und Grausames passiert, wenn man sich dem Schicksal widersetzt.« Gänsehaut rieselte bei diesem Satz über meinen Körper. Wollte sie mir diese Warnung mitgeben, bevor es auch für mich zu spät war? »Namtaru verführte sie. Er manipulierte sie, weil sie etwas so Kostbares war, dass sein Ansehen bei den anderen Göttern steigen würde. Immerhin war uns allen bekannt, was man sich über den Schattenprinz erzählte. Er war bereit, alles dafür zu tun, um den gleichen Respekt zu erhalten wie sein Vater. Ich lief mit meinen Sorgen zu unserem Vater, doch auch er versuchte mich nur zu beruhigen. Der nichtsnutzige Schattenprinz, schwach, weil das Nymphenblut in ihm die Göttlichkeit verwässerte, wollte sich an meiner Schwester bereichern. Also setzte er ihr den Floh ins Ohr, dass es wahres Leben nur außerhalb des Olymps gäbe. Dass sie diesen verlassen müsste.«
»Das glaube ich nicht«, setzte ich an und schüttelte den Kopf. »Taru … er würde nicht …«
»Er würde nicht so selbstsüchtig sein?« Klotho zog ihre Augenbrauen hoch. »Dann erklär mir, Rio, wie kommt es, dass ich dir diese Geschichte erzähle und nicht Namtaru? Und wenn er nicht so selbstsüchtig ist, wieso lässt er dich gerade so leiden, wenn er dir doch auch all deine Fragen beantworten könnte?«
»Ich weiß nicht … es …« Meine kläglichen Erklärungsversuche zerschellten an Klothos eisernem Gesichtsausdruck. »Es geht ihm nicht gut, er –«
»Er grämt sich, weil Atropos nicht tot ist, weil er sein Ziel nicht erreicht hat, die Anerkennung der anderen Götter zu bekommen. Er wollte gefürchtet werden, um endlich respektiert zu werden und darum hat er meine Schwester umgebracht und wird es wieder tun.« Klotho verschränkte die Arme vor der Brust und hob ihr Kinn. »Was glaubst du, weshalb meine Schwester seinen Vorschlag, den Olymp zu verlassen, so bereitwillig annahm, obwohl sie wusste, dass sie sterben würde, wenn sie ihr Zuhause verlässt? Namtaru ist der Sohn des Hades, desjenigen, der Persephone seiner Mutter Demeter raubte und sie in seinen Palast der Abscheulichkeiten sperrte. Er hat vom Meister der Manipulation gelernt. Er hat gelernt, wie man die Schwäche seines Gegenübers herausfindet und sie sich selbst zunutze macht.«
Wieder schüttelte ich nur den Kopf. All das machte keinen Sinn. Das war nicht der Taru, den ich kennengelernt hatte. Nicht das Bild, das ich mir von seinem Vater gemacht hatte. Dieser Mann würde keine Frau entführen und sie bei sich einsperren. Nicht, wenn es der gleiche Mann war, der misshandelten Frauen ein sicheres Zuhause bot. Und genauso wenig konnte Taru Atropos manipuliert haben. Er konnte sie nicht mutwillig umgebracht haben. Er hatte sie geliebt. Ich hatte es gesehen, immer wenn ihr Name fiel. Und ich hatte geglaubt, dass er auch mich liebte … oder zumindest mehr als nur freundschaftliche Gefühle für mich hegte.
»Das sind alles nur Anschuldigungen. Keine Beweise, nichts …«
»Keine Beweise?«, rief Klotho so laut, dass sich einige der anderen Cafébesucher erschrocken zu uns umdrehten. »Rio, der beste Beweis bist du! Er hat einst Atropos manipuliert, und nun manipuliert er dich. Weshalb sonst hat er kein Wort über Atropos verloren? Und ich frage dich noch einmal: Warum erzähle ich dir ihre Geschichte, wenn er es genauso gut könnte? Es ging einfach immer nur um ihn.« Klotho legte ihren Unterarm auf den Tisch, die Handfläche zeigte nach oben. »Ich bin deine Schwester. Ich sehe, wie schlecht es dir geht. Solltest du dich so fühlen, wenn er dich doch eigentlich glücklich macht?«
»Es geht dabei nicht um Taru«, entgegnete ich ihr ungeduldig und sah auf ihre Hand. Vielleicht war sie meine Schwester, aber ich kannte sie kaum. Ich wusste kaum etwas über sie, oder woher sie kam. Gleichzeitig wusste ich auch so wenig über Taru. Ich … ich wusste nichts mehr. »Ich brauche Antworten. Ich brauche die Wahrheit. Es ist alles so … kompliziert, und ich weiß nicht mehr, wer ich bin und …«
»Ich kann dir dabei helfen, Rio.« Klotho zog ihre Hand zurück. Ihre Mimik wurde weicher, ihre Augen sanfter.
»Wie?«
»Begleite mich auf den Olymp.«
3
Rio
Ich war nicht bereit, und ich wollte ganz sicher nicht wieder ins Penthouse. Genauso wenig wollte ich auf den Olymp. Wenn ich erst dort war, gab es kein Zurück mehr. Keine Chance mehr, mir einzureden, dass ich nicht Atropos wäre. Ich würde meiner Vergangenheit gegenüberstehen. Darum hatte ich Klothos Angebot abgelehnt, was sie nur mit einem traurigen Nicken quittiert hatte. Und doch hatte sie mir ihre Adresse in Manhattan genannt, damit ich sie jederzeit finden könnte.
Ich wusste, dass es an der Zeit war, mich dem zu stellen, wovor ich seit zwei Wochen davonlief. Ich würde heute mit Taru reden. Ich konnte dieses Schweigen zwischen uns nicht mehr ertragen. Nicht nach allem, was mir Klotho erzählt hatte. Der Schock saß immer noch in meiner Magenkuhle. Ich hatte zwei Schwestern. Klotho und Lachesis, sie waren meine Familie. Was das wohl für meine menschliche Familie bedeutete? Waren sie dadurch weniger meine Familie? Mein Dad weniger mein Dad? Und … meine Mom?
Ich schluckte gegen die Übelkeit an, die neben der bitteren Erkenntnis über meine neue Familie und das, was zwischen Taru und Atropos gewesen war, auch ihre Krallen in meinen Magen geschlagen hatte.
Taru hatte es gewusst. Er hatte all das gewusst, nachdem Pandora uns eröffnet hatte, wer ich war, und er hatte mir nichts gesagt. Nichts davon. Er hatte sich eingeschlossen und mich ausgeschlossen.
Es ging einfach immer nur um ihn.
Klothos Worte hallten unaufhörlich in meinem Kopf wider. Ich glaubte immer noch nicht, dass Taru Atropos wirklich umgebracht hatte. Und doch … hatte er mir nie wirklich von ihr erzählt und was genau mit ihr geschehen war.
Das Ping des Fahrstuhls ließ mich zusammenzucken.
Ich streckte meinen Rücken durch, als ich aus dem Aufzug trat, fest entschlossen, in Tarus dummes Büro zu stürmen. Zur Not würde ich so lange gegen die Tür hämmern, bis sie nachgab. Ich war eine verdammte Göttin, irgendwelche Kräfte musste ich doch besitzen! Mit großen Schritten lief ich auf die Bürotür zu, als ich aus dem anderen Teil des Penthouses ein Geräusch vernahm.
Mein Herz stolperte, und ich warf einen letzten Blick zur Tür. Vielleicht hatte Dixie doch Rhada geschickt und er konnte bereits zu Taru durchdringen. Immerhin war er sein Bruder.
Doch als ich die Bibliothek erreichte, von wo ich Tarus Stimme nun deutlich wahrnahm, war niemand anderes da. Kein Rhada. Nur Taru, der vor dem leeren Aquarium stand. Ich hatte mich schon immer gewundert, weshalb er es bis auf ein wenig Deko nicht befüllte. Noch nicht einmal Wasser befand sich hinter der Glasfront, die sich über die halbe Wand erstreckte.
Als ich die Flügeltür weiter aufschob, erkannte ich jedoch, dass ich falsch gelegen hatte. In dem Aquarium gab es Fische, nur waren sie nicht … sie wirkten nicht wie echte Fische. Ihre Körper waren beinahe durchsichtig. Blau fluoreszierend schlängelten sie sich durch den wasserleeren Tank.
»Bitte«, hörte ich Taru leise zu einem Fisch mit weit aufgerissenem Mund sagen. Die leeren Augen waren direkt auf Taru gerichtet. Er sprach mit seltsamen Geisterfischen und nicht mit mir? Seit zwei Wochen schloss er sich in seinem Büro ein und ging mir aus dem Weg. Er sah mich noch nicht einmal an. Und das einzige Wesen, mit dem er sprach, war ein verdammter Fisch? »Es muss –«
Ich musste ein Geräusch gemacht haben. Sofort verstummte Taru und drehte sich langsam vom Aquarium weg.
Sein Blick traf meinen. Das Blau seiner Iriden wirkte selbst auf die Entfernung, zwischen Tür und Aquarium, matt. Tiefe Schatten lagen unter seinen Augen, die beinahe dunkler waren als die nachtschwarzen Schatten, die sich bereits um seine Hände schlängelten.
Diese dunklen Wirbel waren neu. Sie wirkten wie ein Schutzschild.
»Taru …« Langsam trat ich in den Raum, er wich sofort einen Schritt zurück. Er wirkte so … stumpf. Als wäre er nicht mehr als ein verblasstes Abbild seiner selbst. Ein Gemälde, das zu lange in der Sonne gehangen hatte und aus dem die Farben nun langsam schwanden.
Meine Wut, die mich auf dem Weg hierher angetrieben hatte, wurde von einer tiefen Sorge überlagert.
Die Schatten krochen empor, bis sie um seinen Kopf waberten. Ich spürte, wie Tränen gegen meine Augen drückten. »Bitte, lass uns reden. Ich … ich weiß, was passiert ist. Mit dir und Atropos. Mit … uns.«
Sein Kopf zuckte zurück, seine Augen weiteten sich, und eine Emotion huschte über sein Gesicht. Eine Mischung aus Reue und … etwas anderem. Etwas, das ich nicht benennen konnte, das jedoch so viel schlimmer war als die Kälte, die ich in meinen Träumen spürte. Er sah mich an, als wäre ich einer meiner Albträume.
Ich lief weiter auf ihn zu. Ich brauchte seine Nähe, ich musste wissen, dass er nicht genauso geisterhaft war wie die Fische im Aquarium. Ich musste wissen, dass er noch da war. Tränen sammelten sich nun in meinen Augen, getrieben von der Verzweiflung, ihn so nah vor mir zu spüren, ihn aber nicht erreichen zu können. Die Einsamkeit, die den Raum zwischen uns füllte, war so greifbar, als wäre sie eine unüberwindbare Barriere. Doch bevor ich auch nur die Hand nach ihm ausstrecken konnte, bauschten sich die Schatten um ihn auf. Dort, wo Taru vor einer Sekunde noch gestanden hatte, war nichts mehr. Als ich mich umdrehte, sah ich, wie auch die letzten Schatten den Raum verließen und hinter sich die Tür schlossen.
Ich war allein. Selbst die Geisterfische waren nicht mehr da.
Heißes Wasser prasselte auf meinen Kopf. Es vermischte sich mit meinen Tränen, die von dem rhythmischen Tropfen überschwemmt wurden. Mein Atem ging zu abgehackt, mein Herz klopfte zu schnell in meiner Brust. Immer noch glaubte mein Körper, kurz vor dem Tod zu stehen. Aber ich war lebendig, und die Hitze auf meiner Haut war der beste Beweis dafür.
Wieder hatte ich von Atropos’ Tod geträumt. Wieder hatte ich auf diesem unsagbar kalten Stein gelegen, Tarus gequälte Schreie gehört, während die Welt um mich herum zu einem endlosen weißen Rauschen wurde. Ich presste die Hände auf meine Ohren, um meinen eigenen Puls zu hören. Ein weiterer Beweis, dass ich noch lebte. Dass ich immer noch Rio war. Zumindest mein Körper. Wer ich wirklich war, war zu einer weit entfernten Antwort geworden.
Ich hob den Kopf, als ich eine Bewegung wahrnahm. Taru setzte sich, wie auch schon die Nächte zuvor, auf den dunklen Fliesenboden. Er lehnte sich diesmal jedoch nicht gegen die Glaswand der Dusche. Er sah mich an, und ich hätte schwören können, dass die dunklen Ringe unter seinen Augen noch eine Nuance schwärzer geworden waren. Vielleicht lag es aber auch an dem bläulichen Licht der New Yorker Nacht.
Ich nahm die Hände von den Ohren. Meine Augen weiteten sich, als er seine Hand zum Griff der Duschwand ausstreckte. Er schob sie auf, bis einzelne Tropfen des Duschstrahls ihn trafen. Seine Augenbrauen zogen sich zusammen, als er mich betrachtete. Ich sah, wie er schluckte und näher an mich heranrutschte. Nah genug, dass sich unsere Hände berühren konnten. Und doch rührte er sich nicht weiter.
Ich wünschte, es wäre genug. Ich wünschte, dass mir seine Geste, sein Auf-mich-Zukommen in diesem Moment gereicht hätte. Zu spät für mich. Neue Tränen sammelten sich in meinen Augen, die selbst das Duschwasser nicht aufhalten konnten. Denn in diesem Moment verstand ich, dass Taru mir nicht das geben konnte, was ich so sehr brauchte, und es brach mir das Herz, weil ich wusste, dass auch ich ihm nicht das geben konnte, was er brauchte.
Er konnte mir keine Antworten geben.
Und ich war nicht genug, um ihm zu helfen, dieses Trauma zu überwinden. Ich war weder genug Rio, noch war ich genug Atropos.
Und genau deshalb musste ich gehen.
Etwas, das ich schon längst hätte tun sollen.
Aber ich hatte nicht gewusst, wohin. Und irgendwie war das viel schlimmer, als nicht zu wissen, wer ich war.
Es war das erste Mal, dass ich mir nicht die Ohren zuhielt, während ich weinte. Ich presste meine Knie eng an meinen Körper. Aus Angst, sonst einfach auseinanderzubrechen. Meine Schluchzer und das Rauschen des Wassers waren die einzigen Geräusche im Raum. Noch nie hatte ich mir die Stille so sehr zurückgewünscht.
Erst als meine Augen von den vielen Tränen brannten und das Zittern meinen Körper verließ, sah ich auf. Tarus Gesicht war ausdruckslos.
»Sie haben dich gefunden.« Seine Stimme war leise und rau, als hätte er stundenlang geschrien. Der einzige Hinweis darauf, dass er etwas fühlte. Ein Schauer rieselte über meinen Körper. Er sprach von Atropos. Von seiner Atropos und nicht von der, die vor ihm saß. »Und sie wollen dich zurück.«
»Ich hätte es von dir erfahren sollen. Du … du hättest mir sagen sollen, dass ich Schwestern habe. Du hättest mir irgendetwas sagen sollen.«
Taru wandte den Blick ab und lehnte seinen Kopf gegen die Fliesen. Er schloss die Augen, schluckte mehrmals, bis er mich wieder ansehen konnte. Sein Gesicht war immer noch undurchschaubar, die gleiche Maske, die ich gesehen hatte, als Dixie beinahe gestorben war. Die gleiche verfluchte Maske wie jedes Mal, wenn Atropos zur Sprache kam und er mich ansah. Wenn er Rio ansah.
Und ich fragte mich, ob er Atropos je so angesehen hatte.
4
Taru
Ich blinzelte. Einmal. Zweimal. Jemand stand über mich gebeugt. Er wurde nicht scharf.
Leises Rauschen drang an mein Ohr, wurde deutlicher, bis ich das Hupen der Autos und das Röhren von Motoren erkannte. Ich war in New York. Zumindest mein Bewusstsein. Die Wärme des Hades’ verflog. Statt Atropos’ Augen aus meinem Traum, blickten mir weiße ohne Iris entgegen. Rhada.
Ich wollte wieder verschwinden.
»Taru!« Erneut drang Rhadas Stimme zu mir durch. Sein Gesicht vor meinen Augen war verschwommen. »Wie lange liegst du hier schon?«
Liegen? Hatte ich nicht eben erst gesehen, wie Rio aus dem Bad verschwunden war? Hatte ich nicht vor zwei Sekunden erst das grässliche Ping des Fahrstuhls gehört? Wie lange war es her? Ich hatte jegliches Gefühl dafür verloren. Alles, woran ich denken konnte, wenn ich es mir erlaubte, zu denken, war, wie sehr ich Rio verletzt hatte. Ich hatte sie in diese Welt hineingezogen. Wegen mir weinte sie Nacht für Nacht unter der Dusche, und ich … ich war ein Feigling.
Die Schuld zerfraß mich, weil ich ihr das Gleiche angetan hatte wie Atropos. Weil ich ihr Schmerzen zugefügt hatte. Doch es war die Abscheu vor mir selbst, die mich immer weiter in die Arme meiner Schatten trieb. Die Gedanken an Atropos – dass sie leben sollte, dass sie Rio sein sollte – waren zu viel, zu schmerzhaft gewesen, sodass ich mich der Taubheit überlassen hatte. Die Schatten hatten das lodernde Hadesfeuer eingedämmt, bevor ich noch mehr Schaden anrichten konnte, nur damit ich mir ein weiteres Mal beweisen konnte, wie schwach ich war. Wie wenig Kontrolle ich über mich selbst hatte.
Die Schatten agierten für mich, und ich fühlte mich nur noch grässlicher.
Ich hatte geglaubt, Atropos sterben zu sehen wäre das Schlimmste gewesen, was mir je hätte passieren können, und dieses Apartment nicht verlassen zu dürfen eine grausame Strafe. Aber es war nichts, verglichen mit dem Wissen, dass Atropos die ganze Zeit in meiner Nähe gewesen war. Dass ein Teil von ihr so greifbar war und ich zu blind, um es zu sehen.
Aber wie hätte ich es auch sehen sollen? Alles, was ich gesehen hatte, alles, was ich wollte, war Rio.
Rhada fluchte und ein Windhauch sagte mir, dass ich ihn von mir gestoßen hatte. Nicht ich – meine Schatten.
»Verschwinde«, hörte ich mich schwach murmeln. »Mir geht’s gut.«
»Das sehe ich.«
Ich ignorierte ihn und legte einen Arm über mein Gesicht.
»Ich komme wieder, Bruder.«
Die Nacht war zu hell und dieses Leben zu laut. Meine Schatten umhüllten mich sofort. Ihre Kühle strich über meine Haut und verschlang alles, was mich auch nur annähernd an sie erinnern könnte.
Ein weiterer Name, den ich verbannen würde.
Eine weitere Liebe, die ich verloren hatte.
Die Schatten überlagerten augenblicklich das dumpfe Gefühl in meiner Brust und füllten mich aus, bis es keinen Platz mehr dafür gab.
Kein Platz für Gefühle.
Kein Platz für Schwäche.
Mit einem dumpfen Geräusch landete ich auf dem Boden. Mein Kopf rauschte, als ich mich auf die Ellenbogen stützte, während der Atem in meinen Lungen rasselte. Ich brauchte einen Moment, um mich zu orientieren. Ich war nicht mehr beim Tribunal, kniete nicht mehr auf dem weißen Marmorboden. Um mich herum waren keine Götter, keine Blicke bohrten sich voller Verachtung in mich wie tausend winzige Nadelspitzen. Ich war in New York, doch mein Körper weigerte sich, das zu akzeptieren.
Ächzend rollte ich mich auf den Rücken, neben mir die helle Couch im Wohnbereich des Apartments. Ich schloss die Augen, riss sie jedoch sofort wieder auf, als die Bilder zurückkehrten. Atropos’ Tod verfolgte mich schon eine abscheuliche Ewigkeit lang, doch diesmal war es anders. Nicht Atropos war vor meinen Augen gestorben, sondern Rio. Rios schwarzes Haar, das die Blutlache um sie herum aufsaugte. Ihre braunen Augen, stumpf, als das Leben aus ihnen wich, und ihre sonst so rosigen Wangen, fast so bleich wie der Boden, auf dem sie lag.
Ich fuhr mir mit den Händen über das Gesicht. Spürte, wie die Schatten in sanften Bewegungen um mich herumschwirrten. Selbst sie waren nicht stark genug, um dieses erdrückende Gefühl komplett zu übertönen. Immer mehr von ihnen wirbelten um mich herum, ließen mich immer weiter in die willkommene Taubheit führen. Mit ihnen verschwanden die Gefühle. Der Schmerz wurde schwächer, mein Körper schwerer. Ich driftete davon, immer weiter in die Dunkelheit.
Ein Fluch ertönte. Die Schatten kräuselten sich vor Verwirrung. Eine Berührung an meiner Schulter. Seit wann fühlten sich die Schatten so real an? Hatten sie nun komplett die Kontrolle übernommen?
Ich schüttelte leicht den Kopf, um das leise Flüstern zu verscheuchen. Es war nicht wichtig. Sollten mich die Schatten doch verschlingen. Ich war bereit.
Das Flüstern wurde lauter. Ich versuchte, durch die Schatten etwas zu hören. Sie waren zu dicht, schirmten mich von meiner Umgebung ab. Mir fehlte die Kraft, sie zurückzurufen.
Plötzlich war das Gefühl des weichen Teppichs, auf dem ich zuvor noch gelegen hatte, weg. Mein Kopf sackte nach vorn, ein Druck unter meinen Armen. Eine zarte Berührung an meiner Wange.
»Er muss hier weg«, flüsterte einer meiner Schatten.
»Ich kümmere mich darum«, kam es von einem anderen. »Wo ist sie?«
Rio? War sie gegangen? War sie zurück? Würde sie überhaupt zurückkehren?
Aber es war egal.
Ich brauchte sie nicht.
Ich brauchte sie.
Ich wollte nie wieder jemanden brauchen.
»Nicht hier. Etwas ist passiert.« Der erste Schatten klang besorgt. Erst da fiel mir auf, dass ich meine Schatten noch nie hatte reden hören. »Sieh dir an, wie es hier aussieht. Ein verdammtes Schlachtfeld.«
»Lass uns gehen.«
Ich zog die Augenbrauen zusammen, als ein süßlicher Geruch in meine Nase stieg, der altbekannte Geschmack von Honig legte sich auf meine Zunge. Was zum Hades passierte hier? Wo brachten mich meine Schatten hin?
Mein Herz begann zu rasen. Zu sehr erinnerte mich der Geruch an den Olymp. An den Ort, wo all der Schrecken begonnen hatte. Meine Füße wollten sich gegen den Boden stemmen, doch ich hatte keine Kontrolle über sie. Ich versuchte, die Schatten zu verscheuchen, sie sollten verschwinden. Alles sollte verschwinden.
Ich brauchte die Kontrolle zurück.
Mit aller Macht versuchte ich, das Hadesfeuer durch meine Venen zu jagen, doch alles, was ich erreichte, war ein warmer Schauer, als würde die Sonne meine Haut streifen.
»Beruhige dich, Bruder. Du bist zu Hause.«
Bruder? Warum klang einer meiner Schatten wie Rhada, verdammt?
Ein leises Lachen erklang. Dixie. »Du nervst ihn selbst in diesem seltsamen Delirium.«
Der andere Schatten, den mein Unterbewusstsein als Rhada abgespeichert hatte, antwortete etwas, doch es geriet in den Hintergrund, als das warme Licht eines immerwährenden Sonnenuntergangs durch meine Dunkelheit brach. Ich blinzelte mehrmals. Eine Gestalt trat vor mich, und als sich meine Augen an das sanfte Licht gewöhnt hatten, wusste ich, wo ich war.
Der Herrscher der Unterwelt war gekommen, um mich zu begrüßen. Mein Vater.
»Willkommen zurück, Namtaru.«
5
Rio
Vor mir erstreckten sich weiße Tempel und Pflanzen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Violette, blau und silbrig schimmernde Blüten. Weiße, braune und nachtschwarze Pferde mit großen Flügeln am Himmel, der voller flauschiger Wolken hing. Die Luft wirkte golden – alles wirkte golden, reich und lebendig. Auf der satten Wiese unter mir tollten zwei kleine Kinder mit Hufen statt Beinen – die Satyrn, wie Klotho erklärt hatte. Sie jagten sich, lachten und jauchzten auf, als sie mit übermenschlicher Kraft über einen kunstvoll getrimmten Busch in Form einer Harfe sprangen.
Normalerweise hätte ich mich mal wieder gefragt, ob ich den Verstand verlor. Aber diese Frage brauchte ich mir hier nicht zu stellen.
Ich war auf dem Olymp. Ich war wirklich hier.
Meine Finger umklammerten den kühlen Stein des Geländers, auf dem Balkon, der sich an meinem Zimmer anschloss und in den Rosengarten zeigte. Ich befand mich im Tempel von Apollon, dem Gott des Lichts, der Musik und der Zukunft. Letzteres hatte sich bestätigt, als Klotho und ich hier aufgetaucht waren. Für mich war bereits ein Zimmer vorbereitet gewesen. Frische Kleidung – sanfte, pastellfarbene Stoffe mit goldenen Steinen bestickt – hing im Schrank, und eine heiße Wanne war ebenfalls eingelassen. Doch gesehen hatte ich den Gastgeber noch nicht. Klotho hatte mir gesagt, dass er die meiste Zeit im Pantheon, dem Haupttempel der Olympier, oder in Zeus’ Tempel war. Auch Klotho war nicht hier im Tempel geblieben, sie lebte zusammen mit Lachesis, meiner anderen Schwester, in der Schicksalshalle.
Auch sie hatte ich noch nicht gesehen und das, obwohl ich schon fast eine Woche hier war. Doch als ich Klotho danach gefragt hatte, hatte sie mich um Geduld gebeten. Dinge müssten vorbereitet werden. Was auch immer. Mir sollte es recht sein, solange ich meine Fragen beantwortet bekäme.
Ein leichter Anflug von Panik, der Knoten in meiner Brust, der sich seit meiner Abreise in New York nicht mehr gelockert hatte, zog sich noch einen Moment fester. Es war alles so schnell gegangen, und mittlerweile krochen Zweifel in mir empor, ob es die richtige Entscheidung gewesen war, Taru und New York zu verlassen. Ich hatte noch nicht einmal Dad und Jake Bescheid gegeben. Als ich versucht hatte, sie von hier aus anzurufen, war das Display meines Handys einfach dunkel geblieben. Sicher hatte das etwas mit göttlichem Zeug zu tun, weshalb Technik hier nicht funktionierte. Daraufhin hatte ich Klotho gebeten, Dad und Jake einen Brief zu bringen. Sie hatte nur genickt, aber ob sie es wirklich getan hatte, wusste ich nicht.
Kurz war ich davor gewesen, auch Taru einen Brief zu schreiben, hatte es dann aber verworfen. Wahrscheinlich war es ihm sowieso egal, wo ich war.





























