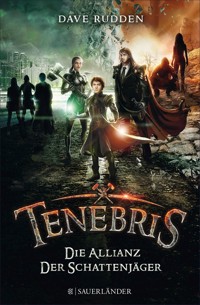
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Kinder- und Jugend-E-Books
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Shadow Knights
- Sprache: Deutsch
Flucht ist zwecklos. Den Schattendämonen entrinnt keiner. Sie kommen aus dem Reich Tenebris, einem düsteren Paralleluniversum, und bringen Chaos und Zerstörung. Seit Jahrhunderten steht nur eins zwischen diesen finsteren Mächten und der Menschheit: die Allianz der Schattenjäger! Von alldem wusste der 13-jährige Denizen bisher nichts. Sein Leben in einem Waisenhaus in Irland war alles andere als ein großes Abenteuer. Doch plötzlich steckt er mittendrin im Kampf der Schattenjäger. Er soll sich ihrem Geheimbund in Dublin anschließen und ihre geheime Magie erlernen. Denn eine neue Bedrohung ist aus Tenebris gekommen – und bringt die ganze Welt in Gefahr! Für alle Fans von Skulduggery Pleasant, Percy Jackson und Artemis Fowl Der packende Auftakt zu einem Action-Fantasy-Epos, das man nicht mehr aus der Hand legen kann!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2016
Sammlungen
Ähnliche
Dave Rudden
Tenebris
Die Allianz der Schattenjäger
FISCHER E-Books
Inhalt
Für Eilish, wie versprochen
If you aren’t in over your head, how do you know how tall you are?
T.S. Eliot
Prolog
Tick
Rückblickend war es ein Fehler gewesen, Bücher ins Waisenhaus zu bringen.
Direktor Ackerby klopfte gegen den Rand seiner Teetasse. Die ganze Unordnung, die das mit sich bringt, dachte er.
Unten rannten Kinder durch den Schatten, den sein Turmbüro in den Hof warf – in Grüppchen erzählten sie sich Neuigkeiten, das aufgeregte Geplapper ließ ihre Stimmen lauter werden. Sämtliche Gespräche drehten sich natürlich um die Besucher. So war das nun mal, wenn man zweihundertfünfzig Mädchen und Jungen zusammensperrte. Als in der Woche zuvor eine Drossel gegen ein Klassenzimmerfenster geflogen war, hatten die Waisen tagelang über nichts anderes geredet. Ob sie ihr einen Namen gegeben hatten? Es würde ihn nicht wundern.
Sein Blick wanderte zu den tieferliegenden Gebäuden. Das Waisenhaus von Crosscaper klammerte sich an den Abhang, als hätte jemand es dort fallen lassen – eine graue Ansammlung von Türmen und flachen, wuchtigen Wohngebäuden, die zitterten, wenn der Wind zu scharf blies, und schwitzten, sobald es zu warm war.
Andere Waisenhäuser kämpften darum, nicht trostlos zu sein, doch Ackerby hatte immer den Eindruck gehabt, dass Crosscaper sich genau darin gefiel; das Waisenhaus schien zu wissen, dass das Stöhnen seines maroden Mauerwerks und das Klappern der Fensterrahmen ganzen Wohnhäusern voller Kinder Albträume bescheren würde.
»Sir?«
Die Stimme seines Sekretärs knarzte aus der Sprechanlage, und Ackerby drückte auf den Knopf, um zu antworten.
»Ja?«
»Ihr Zwei-Uhr-Termin ist hier, Sir. Soll ich die Besucher hereinschicken?«
Der Direktor hörte ihn kaum. Er starrte auf den neuesten Anbau, der aus dem wohltuenden Grau Crosscapers herausstach wie ein gesunder Mensch auf einer Krankenstation. Strahlend weiße Mauern. Neue glänzende Fenster. Eine Tür, die sich nicht quietschend öffnete, sondern mit einem Flüstern, als erzähle sie ein Geheimnis. Davor warteten, wie jeden Tag seit der Eröffnung, Kinder.
Die Bibliothek. Als würde ihnen der Schulkaplan nicht schon genügend Unfug in die Köpfe setzen.
Die Gegensprechanlage möpte schon wieder. »Sir?«
Ackerby seufzte. Er hatte einige der zerfledderten Bücher in der Bibliothek durchgeblättert und genau das vorgefunden, was er befürchtet hatte. Sein eigenes Büro war mit schönen ledergebundenen Werken bestückt (das Wort Buch war schrecklich unpassend – es waren Kompendien, es waren Folianten, es waren Bände), mit der Art Bücher, die man mit Handschuhen anfasste – wenn man sie denn überhaupt anfasste.
Einige, sinnierte er stolz, waren noch nie aufgeschlagen worden.
Die Bibliotheksbücher hingegen wurden so oft gelesen, dass sie schon fast auseinanderfielen. Wovon sie handelten? Es waren zahllose Geschichten über adlige Waisen, die aus dem Elend gerettet wurden, und sie hatten bewirkt, dass hoffnungsvolle Kinder nun bei jedem Besucher die Taschen packten, bereit für ihr neues Leben als Zauberer, Krieger oder vermeintlicher König.
Ackerby rümpfte die Nase. Auserwählte. Hätte man sie gewollt, wären sie nicht in Crosscaper.
»Ja, schicken Sie sie herein. Und bringen Sie Tee.« Er überlegte einen Moment. »Nein, keinen Tee.«
Direktor Ackerby hielt nichts davon, Besucher zu verhätscheln. Diese Begegnungen verlangten Kunstfertigkeit. Inspektoren ließ man zehn Minuten warten; das war nicht lang genug, um sie zu verärgern, sie durften sich aber auch nicht zu wichtig fühlen. Anwälte wurden unverzüglich vorgelassen (man wusste nie, wer am Ende die Rechnung bezahlen würde), mögliche Eltern mussten eine halbe Stunde warten, um zu prüfen, wie ernst es ihnen war.
Ackerby vertrat die Meinung, wer nicht damit umgehen konnte, schlechten Kaffee zu trinken und eine ein Jahr alte Ausgabe von Kaufen oder Mieten durchzublättern, verdiene eindeutig kein Kind.
»Mr Ackerby?«
In der Tür seines Büros standen Schatten.
Ackerby mochte es schummrig. Es sparte Geld, und er hatte die vage Vorstellung, es könne sich möglicherweise sogar günstig auf die Kinder auswirken – vielleicht ihre Augen trainieren. Die Besucher waren an der Stelle stehen geblieben, wo weder das Licht von Ackerbys Tischlampe noch der Schimmer aus dem Gang hinfiel. Ihre Gesichter waren unscharf und nicht zu erkennen.
Einen Augenblick lang war Ackerby nicht sicher, ob es sich überhaupt um Menschen handelte.
»Vielen Dank, dass Sie uns so kurzfristig empfangen«, sagte der kleinere der Besucher. »Beschäftigten Menschen raube ich nur ungern Zeit.«
Das Paar trat gleichzeitig vor – die Frau war groß und dünn, ihre Wirbelsäule hatte die Krümmung eines alten Kleiderbügels, das fransig auf Kinnlänge geschnittene Haar die Farbe von Kreide, und ihre Kleider und ihre Haut waren frostweiß. Der Mann neben ihr war fahl und rund wie ein Gänseei. Sein dichter farbloser Lockenschopf wippte und tanzte auf dem Kopf, als wolle er fliehen. Als er Ackerby die Hand entgegenstreckte, raschelte seine Weste.
Normalerweise hätte Ackerby, während er sich nach ihrem Namen erkundigte, entschlossen (und vielleicht ein wenig kalt) gelächelt und die Hände der Besucher etwas zu kräftig gedrückt. Ackerby war stolz auf seinen Händedruck. Er hatte Bücher zu diesem Thema gewälzt. Ein fester und schmerzhafter Händedruck – so machte man bei einer Besprechung klar, wer der Chef war.
Der Mann in der Weste ergriff seine Hand. »Nichtstuern die Zeit zu stehlen ist selbstverständlich überhaupt kein Verbrechen.«
Schmerz.
Abwesend nahm Ackerby wahr, dass seine Handknochen dumpf knackten, als der Besucher sie zusammenquetschte – das Geräusch erinnerte an eine Plastikflasche, die wieder Form annahm. In seinem Kopf machten die Bücher, die er über die Macht eines kräftigen Händedrucks gelesen hatte, verschwommenen Schaubildern aus medizinischen Fachbüchern Platz, die rasch völliger Leere wichen.
Als der Mann in der Weste seine Hand losließ, unterdrückte Ackerby das Bedürfnis, erleichtert nach Luft zu schnappen. Der Besucher ließ sich fröhlich lächelnd und zufrieden seufzend in einen Sessel fallen und bedeutete dem Direktor, sich zu ihm zu setzen.
Im Mundwinkel der Frau hing eine unangezündete Zigarette. Sie rührte sich nicht. Sie starrte bloß.
Als der Schmerz in Ackerbys Hand nachließ, fing er sich wieder. Er befiehlt mir, mich hinzusetzen? In meinem eigenen Büro?
Ackerby stolzierte um seinen Schreibtisch, drehte sich auf dem Absatz um und musterte seine Besucher mit kaltem Blick. Hinter seinem Schreibtisch zu stehen hob seine Stimmung. Er redete sich ein, es sei bloß Stolz auf die Einrichtung, nicht etwa das wohltuende Gefühl, ein Stück massive Eiche zwischen sich und dem Mann in der Weste zu haben.
»Einen schönen Nachmittag«, sagte Ackerby, obwohl er es nicht so meinte, und es auch ganz bestimmt kein schöner Nachmittag war. »Willkommen im Waisenhaus von Crosscaper. Und mit wem habe ich die Ehre?«
Seine Beklemmung nahm zu, als die Besucher ihn weiter mit ausdrucksloser Miene anstarrten. Er konnte nicht benennen, was nicht stimmte, aber es lag etwas … Kalkulierendes in ihrem Blick. Als würden sie etwas über Ackerby ausrechnen, eine Gleichung, die eher unerfreulich für ihn ausfiele.
»Ihre Namen«, wiederholte Ackerby, und obwohl keinerlei Anlass bestand, eine derart einfache Frage zu erläutern, hörte er sich stammeln: »Für unseren Terminkalender. Unsere Akten, wollte ich sagen.«
Der Satz hing in der Luft und starb eines langsamen Hungertodes.
»Namen?«, fragte der Mann in der Weste nach einer Ewigkeit. »Ach ja, Namen. Verzeihen Sie. Wir sind neu.« Der Blick seiner dunklen Augen flatterte durchs Büro, bevor er sich schließlich wieder für Ackerby entschied. Die Bewegung ließ an eine Fliege denken. »Ich mag den Namen Ellicott. Ich bin erfreut, Sie kennenzulernen.«
Bisher hatte das Gespräch keinen Anlass zu Freude gegeben, aber eine solche Bemerkung konnte man einfach nicht im Raum stehenlassen. Ackerby rang sich ein Lächeln ab. »Ja, natürlich. Freut mich, Sie –« Er sah ihn fragend an. »Was meinen Sie mit neu?«
Das Lächeln des Mannes wurde breiter.
»Da Sie sicher sehr beschäftigt sind, werden wir von Ihrer Zeit so wenig wie möglich in Anspruch nehmen. Wir suchen einen Jungen. Denizen Hardwick.«
Ackerby benötigte einen Moment, bis er ein Bild vor sich sah. Das war ganz normal – dafür gab es schließlich Akten, und man bekam ja keine Extrapunkte dafür, wenn man alles auswendig herunterrattern konnte. Hardwick war … klein. Unscheinbar. Hatte … Haare. Braun? Rot?
Der Direktor runzelte die Stirn. Das Einzige, woran er sich bei dem Jungen erinnerte, war, dass er nie besonders viel Papierkrieg verursacht hatte, die einzige Eigenschaft bei einem Kind, die Ackerby tatsächlich mochte.
Aber da war doch noch etwas … etwas, woran er sich nicht erinnern konnte …
»Was ist mit ihm?«, fragte Ackerby.
Die Zigarette wanderte langsam in den anderen Mundwinkel der Frau.
»Ist er hier untergebracht?« Der Mann klopfte sich so laut mit den Knöcheln gegen den Kiefer, dass der Direktor zusammenzuckte. »Ausgezeichnet. Wir suchen seit langem nach ihm. Wir sind … Verwandte von ihm. Cousins.«
Ackerbys Magen krampfte sich zusammen. Dieser Ellicott tischte ihm Lügen auf. Da war sich Ackerby sicher. Er konnte nicht sagen, warum, aber ein solches Lächeln passte nicht zu einem Cousin, es sei denn, selbiger war eine Spinne.
»Das muss ich in meinen Unterlagen nachprüfen«, antwortete Ackerby steif. Das war sein Standardspruch, wenn er die Antwort auf eine Frage bereits kannte, aber seiner Missbilligung Ausdruck verleihen wollte, dass man sie ihm gestellt hatte. »Der Name kommt mir bekannt vor, aber –«
»Wir werden Ihre Zeit nicht lange in Anspruch nehmen, Direktor Ackerby«, sagte der Mann in der Weste. »Wir möchten nur einige Dinge wissen. Erstens, ist er schon dreizehn?«
Ah. Deshalb hatte er sich an Denizen erinnern können.
»Ja, das ist er in der Tat«, sagte er. »Sein Geburtstag war vor einigen Wochen.« Er blickte auf seinen Tisch. »Ich sollte eine Karte unterschreiben … Ich bin sicher, dass ich sie gesehen habe …«
»Die Karte ist unwichtig«, murmelte der Mann. »Wir haben lange nach Denizen gesucht. Es ist bedauerlich, dass wir die Feier verpasst haben.« Die Worte krabbelten wie Kakerlaken von seiner Zunge. »Aber egal. Wo ist er gerade?«
»In diesem Moment?«
Der Mann spielte an den Knöpfen seiner Weste herum. »An seinem dreizehnten Geburtstag sollte jemand kommen. Vielleicht ein anderer … Verwandter. Er sollte kommen, um ihn in ein völlig neues Leben zu bringen.« Seine Wulstlippen verzogen sich zu einem freudlosen Lächeln. »Aufregend. Wir würden gern wissen, wohin sie gegangen sind. Und wo sich Denizen Hardwick nun aufhält.«
»Oh«, sagte Ackerby. »Er ist unten.«
Der Blick des Mannes wurde durchdringender. »Wie bitte?«
»Er ist unten. Beim Unterricht, vermute ich.« Der Direktor von Crosscaper richtete sich hochmütig auf. »Ich weiß ja nicht, woher Sie Ihre Informationen beziehen, Sir, aber Denizen Hardwick wurde von niemandem in ein neues Leben weggebracht. Er lebt nach wie vor hier, dreizehnter Geburtstag hin oder her.«
Das Paar warf sich Blicke zu.
»Ist das … ein Problem?«, fragte Ackerby. Sein plötzlicher Anflug von Trotz verflüchtigte sich ebenso schnell, wie er gekommen war. Er wusste nicht, wer diese Menschen waren, und ihre Fragen gingen ihm auf die Nerven.
»Nein«, sagte der Mann langsam, als ließe er sich das Wort auf der Zunge zergehen. »Kein Problem. Und er bekam keinen Besuch?«
»An seinem Geburtstag?«, fragte Ackerby verwirrt. Er konnte dem Gespräch nicht mehr folgen, hinter den Augen spürte er den Anflug von Kopfschmerzen. Mit einem Mal dröhnte ihm das Pochen seines Herzschlags in den Ohren.
»Grundsätzlich«, sagte der Mann. »Aber vor allem an diesem Tag. Ob irgendjemand kam.«
Ackerby schüttelte den Kopf. Die Augen des Mannes waren … seltsam. Sie glitzerten mit einer kalten, metallischen Helligkeit. Ackerby konnte sich nicht entscheiden, was schwieriger war – diesem Blick standzuhalten oder sich abzuwenden.
»Gut. Also. Ist an seinem Geburtstag irgendetwas Merkwürdiges passiert? Zwischen Mitternacht und Mitternacht. Irgendetwas Eigenartiges, das Ihnen aufgefallen wäre.«
Ackerbys Kopfschmerzen wurden stärker.
»Sir, ich würde Sie bitten –«
»Es ist eine einfache Frage, Direktor. Hat etwas gebrannt, ist etwas verschwunden, gab es Verletzungen, räumliche oder lichtbedingte Verzerrungen, Schatten, die sich seltsam bewegten …«
Auf Ackerbys Stirn bildete sich Schweiß. Seine Geduld, mit der es auch sonst schon nicht zum Besten stand, war erschöpft.
»Sir, ich weiß nicht, welchen Wahnvorstellungen Sie im Moment nachhängen, aber diese Fragerei ergibt keinen Sinn. Sie können hier nicht einfach ohne Ausweispapiere, ohne Unterlagen hereinschneien und mir Fragen stellen, ob sich Schatten seltsam bewegt haben! Für wen halten Sie sich?«
Der Mann, der sich als Ellicott vorgestellt hatte, seufzte und legte eine pummelige Hand an die Schläfe. Er kniff die Augen zusammen wie ein enttäuschter Onkel, und plötzlich nahm Ackerby das Geräusch wahr. Es war leise, aufgrund des Widerhalls seiner eigenen Stimme kaum hörbar.
Ein Ticken.
Es unterstrich die Worte seiner Besucher so schnell und leise wie der Herzschlag eines Vogels. Ackerby sah auf die Digitaluhr auf seinem Schreibtisch und wandte für eine Sekunde den Blick von dem Paar ab.
Die Frau in Weiß knurrte ihn an.
Der Laut entwich ihren Lippen wie eine Flut von Schmutz, es war ein laut rauschendes, hungriges Knurren. Als sie auf ihn zustolziert kam, glänzte etwas zwischen ihren Zähnen. Der Mann in der Weste erhob sich und stellte sich neben sie.
Sein Kopf zuckte zur Seite, er erinnerte an eine Schlange, die sich jeden Moment auf ihr Opfer stürzen wollte.
Der Kopf der Frau zuckte auf genau dieselbe Art.
Als Ackerby blinzelte, war die Frau in Weiß in der Dunkelheit hinter ihm verschwunden. Hände legten sich um seinen Hals und zwangen ihn auf die Knie. Er spürte ihren Atem in seinem Nacken, kalt und schnell –
– Ellicotts Stimme war ein Schnurren.
Bedauerlich. Sehr bedauerlich.
Als sich der Mann in der Weste vor ihn kniete und ihn anstarrte, bohrten sich die Worte wie eisige Nadeln in Ackerbys Hirn. Die Frau in Weiß hielt ihn fest. Ihre bleichen Finger glichen einer eisernen Kralle, und obwohl Ackerby nicht zu den kleinen Männern zählte, war es ihm unmöglich, sich zu bewegen. Ebenso gut hätte er versuchen können zu fliegen.
Ich dachte, wir könnten uns das ersparen. Nach einer gewissen Zeit können wir … überzeugend sein. Schmerzhaft überzeugend. Leider haben wir es eilig.
Das Ticken schwoll zu einem Dröhnen an. Plötzlich bekam Ackerby keine Luft mehr.
Sie werden uns von jedem Besucher erzählen. Jedem Beobachter. Jedem Brief. Jedem Kontakt, den Denizen hatte, seit man ihn hierhergebracht hat. Absolut alles.
Die Augen des Mannes funkelten.
Familie liegt uns sehr am Herzen.
Er nickte seiner Begleiterin zu, von Profi zu Profi, dann brach die Frau dem Direktor mit sanftem Fingerdruck das Schlüsselbein. Ackerby schrie auf.
Er konnte nicht sagen, wie lange sie ihn festhielten. Eine Stunde, vielleicht weniger – lange genug, dass Direktor Ackerby jede Tatsache hervorkramen konnte, die er über Denizen Hardwick wusste. Es war nicht viel, aber die Besucher ließen ihn alles immer und immer und immer wieder aufsagen.
Denizen war im Alter von zwei Jahren im Waisenhaus von Crosscaper abgeliefert worden. Er hatte weder Besuch noch Briefe bekommen, und sein dreizehnter Geburtstag war ereignislos verlaufen. Erst als der Direktor zu schluchzen begann und sich zum vierten Mal wiederholte, löste sich die eiserne Klammer um sein Schlüsselbein.
Schwankend, von Sinnen und auf Knien kam es Ackerby vor, als sähe er das Paar deutlicher, als er je irgendjemanden gesehen hatte.
Das pendelnde Zucken ihrer Köpfe.
Die eigenartige Härte ihrer Haut, die sich wie Fingernägel oder Zähne anfühlte.
Ihr strahlendes und leeres Lächeln.
Seltsam, sagte der Mann in der Weste zu sich selbst, als sie fertig waren. Wenn sie ihn nicht an seinem Geburtstag besucht hat … ist er vermutlich uninteressant für sie und somit nutzlos für uns. Nun denn. Eine Verwechslung passt uns besser als Symmetrie.
Er tätschelte Ackerbys tränenfeuchte Wange.
Danke, sagte er. Die Frau in Weiß deutete spöttisch eine tiefe Verbeugung an. Sie machten sich zum Gehen bereit, doch dann wandte sich der Mann zu Ackerby um, als sei ihm noch etwas eingefallen.
Sie haben uns weitergeholfen, Direktor Ackerby. Und mir gefällt dieser Ort. Er schnüffelte, als genieße er den Geruch. Sie haben große Schmerzen, und vielleicht möchten Sie diese im Gegenzug nun an dem jungen Denizen auslassen. Wir verstehen das. Wir sind einverstanden.
Das Ticken war nun leiser.
Nur ein wenig mehr Elend in der Welt.
Einige Meter weiter fiel eine Tür ins Schloss.
Mehr verlangen wir nicht.
1 Abwesende Tanten
Vier Monate später – 2. Oktober
»Ich habe keine Tante.«
Denizen Hardwick starrte skeptisch auf den Zettel in seiner Hand. So betrachtete er die meisten Dinge, und sein Gesicht war wie geschaffen dafür – schmale Wangen, eine lange Nase, Augen von der Farbe und Schärfe eines Nagels.
Der Zettel, der auf seinem Bett im Schlafsaal 4E lag, wurde mit einer Extradosis Skepsis aufgenommen, dass es Denizen überraschte, dass er nicht an den Rändern verkohlte.
DEINE TANTE HAT SICH GEMELDET. SIE NIMMT DICH EINIGE TAGE ZU SICH. DU WIRST UM 18.00 UHR ABGEHOLT. PACK EINE TASCHE. DIREKTOR ACKERBY
»Ich habe keine Tante«, wiederholte Denizen. Es klang auch beim zweiten Mal lächerlich.
»Na ja, das stimmt anscheinend nicht ganz«, sagte sein bester Freund Simon Hayes, der den Zettel ebenfalls anstarrte. »Du hast bloß noch keine Tante kennengelernt.«
Schlafsaal 4E war ein langer Raum mit hohen Decken, die eine ideale Fläche für Spinnweben boten. Riesige Fenster luden das fahle Oktoberlicht ein, darin zu verlöschen, und von Zeit zu Zeit klapperten die Fensterrahmen im Wind.
Von den zwölf Betten waren in dieser Mittagspause zehn leer. Die meisten Waisen von Crosscaper hielten sich im Freien auf, Sonnenlicht war im Oktober schließlich ein seltenes Geschenk, außerdem hatten sie keine geheimnisvolle Nachricht erhalten, die sie anstarren konnten.
Denizen fuhr sich mit der Hand durch die wirren roten Haare. Er war klein für sein Alter, und wenn nicht noch ein verspäteter Wachstumsschub eintrat, würde er auch in jedem anderen Alter klein sein. Die Sommersprossen, die seine Wangen und seine Nase im Sommer heimsuchten, waren, mit Ausnahme des einen Exemplars auf seiner Lippe, zu einsamen verirrten Punkten verblasst.
Er hatte nicht gewusst, dass man auch auf der Lippe Sommersprossen haben konnte. Vielleicht war Denizen der einzige Mensch mit einer Lippensommersprosse. Vielleicht war es ein Schicksalsmal, das ihn für Großes vorherbestimmte … aber das bezweifelte er. Denizen Hardwick war keiner, der an außergewöhnliche Umstände glaubte – an Sommersprossen, die einen heraushoben, oder bedeutungsvolle Muttermale oder zufällige Tanten.
Denizen Hardwick war ein Skeptiker.
»Ich habe keine – hör zu, wenn ich tatsächlich eine Tante hätte, wo war sie dann die letzten elf Jahre?«
»Liefert das Papier irgendeinen Hinweis?«, fragte Simon. In der neuen Bibliothek gab es eine Sammlung von Kriminalromanen, und Simon interessierte sich gerade brennend dafür, welche Schlussfolgerungen man aus kleinsten Details ziehen konnte.
Bereitwillig untersuchte Denizen die Nachricht. Leider konnte er nur feststellen, dass sie auf gelbem Papier geschrieben war, somit aus dem Büro des Direktors stammte und deshalb ebenso wenig angezweifelt werden konnte wie das Prinzip der Schwerkraft. Ansonsten enthielt sie rücksichtsloserweise keinerlei Hinweis.
»Nein«, sagte er. »Leider nicht.«
Simons und Denizens Betten standen nebeneinander, und das schon, seitdem sie beide drei Jahre alt waren und unten im Schlafsaal 1A gewohnt hatten. Es war der Beginn einer Freundschaft gewesen. Verstohlenes Büchertauschen in der Nacht, ein wissbegieriges Wesen und eine gemeinsame Abneigung gegen Sport hatten dafür gesorgt, dass sie fortbestand.
Es gab vieles, was Denizen an Simon mochte, am allermeisten mochte er jedoch, dass Simon Gelassenheit ausstrahlte wie die Sonne Wärme. In Simons Nähe konnte man einfach nicht verärgert sein. Ebenso unmöglich war es, sich über Simon zu ärgern. Ein Gespräch mit ihm war so beruhigend wie die kühle Seite des Kopfkissens.
Entweder war es schlicht Zufall oder aber Beste-Freunde-Osmose, Simon hatte sich jedenfalls alles an Größe geschnappt, was Denizen fehlte. Sein riesiger Wintermantel machte seinen mageren Körper nicht massiger, und wie er dort auf seinem Bett lag, erinnerte er an eine Krähe mit Schal.
»Aber warum jetzt?«, fragte Denizen. »Warum nimmt sie plötzlich Kontakt zu mir auf?«
»Vielleicht hat sie lange gebraucht, um dich zu finden?«, mutmaßte Simon. »Oder sie hat abgewartet, bis du älter bist?« Er überlegte einen Moment. »Vielleicht ist sie oft auf Reisen, und du musstest ein bestimmtes Alter haben, um sie begleiten zu können. Oder um allein in ihrer Riesenvilla zu bleiben.«
»Riesenvilla?«
»Vielleicht.«
»Ich bezweifle, dass sie eine Riesenvilla hat.«
»Könnte doch sein. Vielleicht ist sie eine superreiche Spionin. Das würde ihre lange Abwesenheit erklären. Oder vielleicht stellt sie auch Schokolade her.«
Denizen verdrehte die Augen.
»Eine spionierende Schokoladenherstellerin«, bekräftigte Simon grinsend. »Die internationale Krisen durch den ausgeklügelten Einsatz von Nougat löst.«
Ein Teil von Denizen wusste, dass er wahrscheinlich aufgeregter sein sollte. Eine Verwandte, die aus dem Nichts auftauchte und ihn zu sich holen wollte? Für die meisten anderen Kinder und Jugendlichen in Crosscaper war das der größte Lebenstraum.
Doch genau das machte Denizen Sorge. Träume waren eine verzwickte Sache. Er hatte wirklich immer nur einen einzigen geträumt, zumindest bis vor ein paar Monaten.
Seit dem Sommer verfolgten ihn die dunklen Korridore von Crosscaper im Schlaf. Eine Gestalt in Weiß schwebte durch sie hindurch, als sei sie eine Motte aus Glas. In dem Traum verweilte die Gestalt vor jedem Schlafsaal und berührte mit milchhäutigen Händen eine Tür nach der anderen, bis sie seinen Saal fand und hineinschlüpfte …
Er schüttelte den Kopf. Eindeutig kein Traum, der in sein reales Leben überschwappen sollte.
Vielleicht hatte Simon recht. Vielleicht war seine Tante eine Schokoladenspionin. Vielleicht war Denizens Leben im Begriff, sich zu ändern, und in Zukunft würde es weniger Skepsis geben. Und mehr im Nahkampf eingesetzte Haselnusscreme.
Sein Bett quietschte, als er sich daraufplumpsen ließ. Wie alles in Crosscaper fiel es allmählich auseinander. Die Waisen waren auf Abgelegtes und Spenden angewiesen, und da weder Simon noch Denizen in den Bereich der Durchschnittsgröße fielen, bekamen sie von allem das Schlechteste – eher zusammengeflickte als abgelegte Kleidungsstücke, die mit Unmengen von Sicherheitsnadeln zusammengehalten wurden und die Jungen bei jeder Bewegung wie Ameisen klackern ließen.
Dass sein Bett knarrte, beunruhigte Denizen nicht weiter – es lagen zu viele Bücher darunter, als dass es unter ihm hätte zusammenbrechen können.
Einer von Simons Romandetektiven hatte geäußert, der Inhalt des Bücherregals sage viel über eine Person aus. Die nähere Betrachtung von Denizens Büchersammlung verriet einem bloß, dass er das Lesen liebte. Neben einem Schmachtroman lag ein Band über italienische Politik zur Zeit der Renaissance (die Bücher der Crosscaper Bibliothek waren allesamt Spenden, und Denizen zerbrach sich schon seit Jahren den Kopf darüber, wer einem Waisenhaus Bücher über längst vergangene Staatsführung spendete), und auch wenn manche der Bände abgegriffener aussahen als andere, war jedes Buch so oft gelesen worden, dass der Einband zerfleddert war.
Vielleicht besitzt meine Tante Bücher, überlegte Denizen, verwarf die Idee jedoch schnell, bevor sie Gestalt annehmen konnte.
Er war nicht auf dem Weg zu einer neuen Familie. Er war nicht auf dem Weg in ein neues Leben. Er wurde weggebracht, damit eine Fremde ihn begutachten konnte. Falls die geheimnisvolle Tante danach beschloss, ihn wiedersehen zu wollen, schön, er würde sich jedenfalls keinen Hoffnungen hingeben, um anschließend nur enttäuscht zu werden.
Und als Erstes würde er sie dazu bringen, seine Fragen zu beantworten.
Simon hatte das Thema nicht angeschnitten. Das brauchte er auch nicht – er kannte Denizen zu gut. Denizen war eines der wenigen Kinder in Crosscaper, die überhaupt nichts über ihre Eltern wussten. Oh, er kannte ihren Nachnamen. Er wusste, dass sie … Nun ja, er wusste, dass er aus gutem Grund in einem Waisenhaus war, auch wenn er keine konkrete Vorstellung hatte, aus welchem.
Simon kannte den Grund. Seine Eltern waren bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Mr Colford, ihr Englischlehrer, fuhr Simon jedes Jahr an ihrem Todestag zum Grab. Michael Flannigan, zwei Betten links von Simon, hatte seine Eltern bei einem Brand verloren. Samantha Hastings’ Mutter war tot, weil … Nun, das erzählte sie nicht, und in Crosscaper galt das ungeschriebene Gesetz: Wenn jemand nicht darüber sprechen wollte, hatte niemand das Recht nachzubohren.
Denizen hingegen wusste es einfach nicht.
Es war der einzige andere Traum, den er je geträumt hatte. Eine Frau – klein wie er selbst, obwohl sich das nicht genau sagen ließ, weil er zu ihr aufblickte. Sie hielt ihn in den Armen. Sie duftete nach Erdbeeren. Ihr Lied … irgendetwas über Dunkelheit …
An seinen Vater hatte Denizen keinerlei Erinnerung.
Simon lächelte ihn verständnisvoll an. Er wusste genau, woran Denizen dachte.
»Hör zu«, sagte er, als die Klingel das Ende der Mittagspause verkündete. »Ich muss zum Unterricht. Ich werde Ms Hynes Bescheid sagen, dass du nicht kommen kannst, weil du packen musst.«
»Das dauert ungefähr zehn Minuten. Ich brauche nicht –«
»Du hast recht«, unterbrach Simon. »Ich werde ihr sagen, dass du gleich nachkommst. Vielleicht kannst du fragen, ob sie dir ein paar Hausaufgaben für unterwegs gibt.«
»Ah«, sagte Denizen grinsend. »Sicher.«
Sie starrten sich verlegen an.
»Es sind nur ein, zwei Tage«, murmelte Denizen. »Vielleicht bin ich morgen schon wieder zu Hause.«
»Bestimmt«, sagte Simon. »Ja. Hör zu. Mach dir eine schöne Zeit, ja? Rede mit ihr. Versuch, die Dinge nicht unnötig kompliziert zu machen. Lass dich von ihr verwöhnen, falls sie Schuldgefühle hat, dass sie nicht für dich da war. Lass dich überraschen – okay? Viel Glück.«
Denizen liebte Wörter, aber das bedeutete noch lange nicht, dass ihm immer die Wörter einfielen, die er gerade brauchte. Er schlang die Arme um Simon und drückte ihn hastig.
Danach war er mit der zerknitterten Nachricht in der Hand allein.
Draußen auf dem Hof wurde es ruhiger. Denizen seufzte. So schön es war, ein paar Unterrichtsstunden ausfallen zu lassen – er hätte sich sowieso nicht konzentrieren können, die Wörter verschollene Tante taumelten wie eine Biene im Glas durch seinen Schädel –, er hätte gern Gesellschaft gehabt. Nun war er allein mit seinen Gedanken und wälzte sie unablässig hin und her.
Denizen Hardwick hatte eine Tante. Wo war sie die ganze Zeit gewesen?
Vielleicht hatte sie nicht gewusst, dass es ihn gab. Es passierte ständig, dass sich Familien zerstritten – sowohl in dem Liebesroman als auch in dem Politikbuch war es das Hauptthema gewesen –, vielleicht hatte sie ihn erst jetzt gefunden. War sie eine Schwester seiner Mutter oder seines Vaters? Was war vorgefallen, dass sie den Kontakt zueinander verloren hatten?
Sein Magen rumorte. Es gab so vieles, was er sie fragen wollte. Würde sie weinen? Er würde nicht weinen – das wäre furchtbar. Aber sie vielleicht. Würde es Umarmungen geben? Würde sich das komisch anfühlen?
Denizen versuchte, sich das Treffen vorzustellen. Die Frau wäre … klein, nahm er an, und hätte vielleicht seine Augen und Haare. Seine Vorstellungskraft hatte wenig Anknüpfungspunkte. In seinem Kopf formte sich das Bild einer molligen rothaarigen Frau, ihre Züge waren eine eigenartige Mischung aus seinen eigenen und denen der Crosscaper-Köchin Mrs Mollins – der tantenhaftesten Frau, die er kannte.
In seiner Vorstellung fiel der Mollins-Tante-Zwitter auf die Knie und begann bei seinem Anblick zu schluchzen. Denizen wand sich. Das Bild löste ein unbehagliches Gefühl in ihm aus. Andererseits, wenn verlegenes Tantenumarmen Fragen zu seiner Vergangenheit beantwortete …
Wenn es nach Denizen ging, konnte es gar nicht schnell genug 18.00 Uhr werden.
2 Kein Roman
Die Sonne versank am Horizont und nahm den Tag mit.
Es war Viertel vor sechs, und Denizen stand mit einer Tasche zu seinen Füßen im großen Hof von Crosscaper. Das Packen hatte länger gedauert als angenommen. Was nimmt man mit, wenn man zu einer überraschend aufgetauchten Tante fährt?
Am Ende hatte er sich für ein paar Wechselsachen und einen Wintermantel entschieden. Da er keine Ahnung hatte, wohin er fahren würde, konnte man nicht mehr von ihm erwarten. Falls das seiner Tante Ungelegenheiten verursachte, tja, das hatte man davon, wenn man sich so geheimnisvoll gab.
Von Zeit zu Zeit schaute Denizen zur Eingangstür von Crosscaper, als wolle er sich vergewissern, dass das Waisenhaus noch da war. Albern. Er ging schließlich nur für eine Nacht weg. Seine Bücher waren hier. Er musste zurückkommen. Seine Tante wollte ihn doch nur zum Abendessen einladen und ihr schlechtes Gewissen beruhigen, weil sie sich die meiste Zeit seines Lebens nicht um ihn gekümmert hatte.
Für ihn war das in Ordnung – Denizen war jahrelang gut allein zurechtgekommen. Er brauchte niemanden, der plötzlich auftauchte und ihm zu helfen versuchte.
Wenn sie ihm jedoch sämtliche Fragen beantwortete, die ihm zu seinen Eltern einfielen – Augenfarbe, Haarfarbe, Lieblingsgericht –, würde er mitspielen. Er war versucht gewesen, eine Liste aufzustellen, hatte den Gedanken aber wieder verworfen, weil es verschroben wirken könnte. Vielleicht auch nicht. Vielleicht gab es keine Norm, was verschroben war und was nicht. Im Ernst, wie oft kam so etwas vor?
Er drehte sich noch einmal um. Crosscaper war nicht immer ein Waisenhaus gewesen; die Unterrichtsräume waren aus neuem hellen Stein, die Wohnhäuser mit ihren Spitzen, Türmen und dem finster dreinblickenden Strebewerk schienen hingegen wesentlich älter zu sein. Und wozu waren eigentlich die hohen Steinmauern da? Denizen hatte sie schon immer ein bisschen übertrieben gefunden. Waisenhäuser mussten Mauern haben, damit … niemand ausreißen konnte vermutlich, aber wenn Waisen früher nicht wesentlich größer gewesen waren und Feuer gespuckt hatten, dann waren diese Mauern eindeutig zu einem anderen Zweck errichtet worden.
Auch das Tor hatte etwas Burgähnliches – ein Ungetüm aus Färber-Eiche und Eisen, auf dem jahrhundertelang Wind und Regen narbige Schrammen hinterlassen hatten. Als Denizen noch jünger gewesen war, hatte er jede Kerbe im Holz befühlt und sich dabei längst vergangene Schlachten ausgemalt, das wütende Gegeneinanderklirren feindlicher Schwerter.
Das Tor markierte die Grenzen seiner Kindheit, es war der Anfang und das Ende von allem, was er kannte.
Direktor Ackerby ging wortlos an Denizen vorbei, streckte einen langen Arm aus und richtete eine schwarze Fernbedienung auf die Torflügel. Sie öffneten sich surrend an schweren elektrischen Scharnieren, die hell und glänzend vom altersdunklen Holz abstachen. Dahinter war die Bucht und ein breiter Streifen Meer zu erkennen.
Das Waisenhaus von Crosscaper war das westlichste Gebäude Irlands. Aus unerfindlichen Gründen war Mr Flynn, Denizens Geographielehrer, darauf immer ziemlich stolz gewesen, als sei die Erde keine Kugel und »am westlichsten« würde nicht einfach nur »bis du ein Stück weitergehst« bedeuten.
Etwas weiter den Hang hinauf erhoben sich die Klippen von Benmore und der gekrümmte Finger der Landspitze von Moyteoge (seit Generationen verwünscht von Menschen mit Rechtschreibschwäche), westlich davon war nur noch der Ozean – eine graue Welthälfte davon, die bis zur Ostküste Amerikas reichte. Denizens Klasse war einmal die Klippen hinaufgestiegen, um den eisenfarbenen Schimmer des Meeres zu betrachten, die Luft hatte nach Salz und Leere geschmeckt.
Die meisten Schüler hatten lieber nach Osten zur kleinen runden Bucht von Keem Bay geschaut, zu den Dörfern und der Brücke zum Festland – auf Irland in blassen Grünschattierungen –, doch Denizen hatte das Meer fasziniert. Es war hypnotisch. So viel Raum, so viel Trostlosigkeit. Dort wurden Stürme geboren.
Er spähte verstohlen zu Ackerby. Es war der Blick, mit dem alle den Direktor ansahen – als hätte man es mit einem der Gorgonen zu tun. Ihm in die Augen zu sehen hatte zur Folge, dass er den Blick erwiderte.
In diesem Moment starrte der Direktor jedoch bloß in den Abend, sein langes Gesicht drückte Missbilligung aus. Vorsichtig gestattete sich Denizen einen eingehenderen Blick. Es war merkwürdig, jemanden unverhohlen anzustarren, den man sonst immer nur aus dem Augenwinkel gemustert hatte. Es ließ Ackerby … kleiner wirken.
Ohne das Geheimnisvolle eines verstohlenen Blicks ähnelte der Direktor einem dieser Reiher, die von einem ölverseuchten Strand gerettet worden waren – verkrümmt und langsam und elend. Bis vor einem Monat war sein einer Arm sogar wie ein Flügel mit einer Schlinge hochgebunden gewesen. Jeden anderen aus dem Lehrkörper hätte Denizen wahrscheinlich gefragt, was passiert war, nicht so Ackerby. Der Direktor sprach nicht mit Kindern. Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn er es einmal tat, bezeichnete er sie als Junge oder Mädchen, als könne er sich partout nicht an den lateinischen Namen irgendeines exotischen Insekts erinnern. In der letzten Zeit hatte man ihn kaum außerhalb seines Büros gesehen. Über die Gründe waren jede Menge Gerüchte im Umlauf gewesen.
Da sie beide schweigend in die Dunkelheit starrten, hörte Denizen den Wagen, bevor er ihn sah.
So fernab der Zivilisation war die ländliche Gegend totenstill, auch wenn man im Sommer entfernt die Urlauber in Keem Bay mit ihren dicken schwerfälligen Autos hörte, die wie Hummeln brummten.
Der nahende Wagen klang völlig anders. Das Geräusch seines Motors hallte in der Dunkelheit wie die Atemzüge einer großen Katze – es klang nicht wie ein Löwe oder Tiger, sondern wie etwas Älteres, etwas Prähistorisches. Denizen spürte die Vibration des Knurrens in seiner Brust.
Als der Wagen durch das Tor fuhr, glänzte er selbst in der Dunkelheit. Er war eine gewaltige Masse aus Glas und nachtschwarzem Metall, riesengroß und alt und durchdringend nach Öl riechend. Die Scheiben waren dunkel getönt und schüttelten das Licht ab, das aus den Fenstern von Crosscaper schimmerte. Der Wagen hielt knurrend an, und die Scheinwerfer schalteten sich mit einem Geräusch an, als würde ein Blitz in ein Kissen einschlagen. Brrssch-tschick. Die Lichter waren so grell, dass sie alles andere auslöschten. Zwischen den Zwillingsspeeren aus Licht wirbelten Staubpartikel auf, und sowohl Denizen als auch Ackerby wichen einen Schritt zurück.
Verwirrt blinzelte Denizen in die gleißenden Scheinwerfer. Er ist ohne Licht hier hochgefahren?
Die Tür öffnete sich.
Während sich seine Augen noch an die Helligkeit gewöhnten, bestand Denizens erster Eindruck von dem Besucher aus Geräuschen: das schlangenähnliche Klappern des zurücksurrenden Gurtes, das Knarzen von Lederschuhen auf Kies und ein langes zufriedenes Seufzen, während ein Gesicht in die Kälte gehalten wurde.
Der Besucher lächelte. »’n Abend.«
Denizen runzelte die Stirn. Er beherrschte viele Arten des Stirnrunzelns. Dieses war Nummer dreizehn – das ›Fragende Stirnrunzeln‹. Er hatte zwar keine Erfahrung mit Tanten, aber aus irgendeinem Grund hatte er eine weibliche Person erwartet.
Vielleicht war es der Chauffeur? Das würde zum Wagen passen, aber trugen Chauffeure nicht immer eine Livree? Schirmmützen und seitlich geknöpfte Jacken und hielten sich kerzengerade wie Soldaten?
Diesen Mann würde man nicht mal auf hundert Meter an eine Militäreinheit heranlassen, ob mit Uniform oder ohne. Denizen hätte nicht genau erklären können, was ihn auf den Gedanken brachte – die Mähne langer dunkler Haare, die dem Besucher auf die Schultern fiel, oder der teure kohlenfarbene Anzug. Während der Mann näher kam, beschloss Denizen, dass es an seinem Lächeln liegen musste.
Mit einem solchen Lächeln konnte man nicht in der Armee sein. Dieser Mann lächelte wie ein Fassadenkletterer.
»Jensen Interceptor«, sagte er. Als er Denizens Gesichtsausdruck bemerkte, wurde sein Lächeln noch breiter. »Ich meine den Wagen. Mir würde niemand einen solchen Namen durchgehen lassen.« Er umfasste Denizens Hand mit behandschuhten Fingern und schüttelte sie kräftig.
»Ich bin Graham McCarron.«
»Ah«, sagte Ackerby.
Denizen hatte ihn noch nie zuvor sprachlos erlebt. Vielleicht lag es daran, dass McCarron zuerst Denizen die Hand geschüttelt hatte – Erwachsene lebten in einem Geheimclub, und man tanzte nicht aus der Reihe, indem man ein Kind wie einen Ebenbürtigen behandelte –, vielleicht lag es aber auch an McCarron selbst. Er hatte die Ausstrahlung eines Menschen, der andere oft sprachlos machte. Vielleicht stahl sein Lächeln die Worte.
Die beiden Männer schüttelten sich die Hand.
»Direktor Ackerby. Erfreut.«
»Tatsächlich?«, fragte McCarron, dann wandte er sich wieder Denizen zu, als hätte er überhaupt nichts gesagt. Denizen spürte, wie sich ein kleines Lächeln auf seinem Gesicht ausbreitete. Es gab ihm den Mut zu sprechen.
»Sind Sie … ist meine Tante im Wagen?« Filme hatten Denizen gelehrt, dass wirklich wichtige Personen nicht aussteigen mussten. Die anderen stiegen zu ihnen in den Wagen, um mit ihnen zu reden.
»Sie ist bei der Arbeit«, sagte der Mann, »deshalb hat sie mich geschickt, um dich abzuholen. Ich bin ein Kollege.« Er betrachtete das lustlos zusammengesackte Gemäuer, das Denizen elf von dreizehn Jahren beherbergt hatte.
»Nun ja, hübsch hier«, sagte er aufgeräumt. »Hat irgendwie einen …«, er schien nach den richtigen Worten zu suchen, »… düster-hoffnungslosen Charme. Guter Ort, um traurig zu sein, kann ich mir vorstellen.«
Denizens Augenbrauen wanderten nach oben. Die Kinder in Crosscaper wurden nicht mit Glacéhandschuhen angefasst. Man gestand ihnen zu, dass ihnen etwas Schlimmes widerfahren war und dass etwas Schlimmes der Grund war, dass sie nicht zu Hause bei einer Familie lebten, aber da das Schlimme jedem der Kinder widerfahren war, galt es auch nicht als Drama. Die Anzahl der Menschen mit Eltern, die Denizen in seinem Leben getroffen hatte, ließ sich an zwei Händen abzählen. Es war einfach etwas, womit man leben musste.
Und trotzdem hatte Denizen noch nie zuvor jemanden so unverblümt sagen hören, dass Crosscaper trostlos sei. Er warf einen Seitenblick auf Ackerby, weil er sehen wollte, ob der Direktor das Waisenhaus in Schutz nehmen würde, aber Ackerby schien nicht die Absicht zu haben, ein Streitgespräch anzufangen.
Im Gegenteil … Ackerby wirkte besorgt. Besorgter, als Denizen ihn je zuvor gesehen hatte. Der Direktor hatte immer einen missmutigen Gesichtsausdruck, den finsteren Blick eines Mannes, der sich schlecht behandelt fühlte und die Welt verabscheute. Aber das hier war etwas völlig anderes. Ackerby sah verängstigt aus.
»Sir? Ist alles –«
»Vielleicht möchten Sie beide kurz reden«, sagte McCarron und rieb mit einem eilig aus der Hosentasche gezogenen Taschentuch einen imaginären Fleck vom Kotflügel des Interceptors. »Tränenreicher Abschied und so.«
Ackerby sah Denizen nicht an. Stattdessen stieß er leise zwischen zusammengepressten Lippen hervor: »Es tut mir leid, Junge. Ich kann nichts … Ich kann nichts … Vielleicht wird alles gut. Ja. Ja. Familie.« Der Direktor ließ McCarron nicht aus den Augen. »Familie liegt uns sehr am Herzen …« Er zuckte zusammen.
»Jungs?« McCarron starrte sie mit dem Taschentuch in der Hand an. Ackerby blinzelte und rieb sich das Gesicht. Der Direktor sah wirklich krank aus.
»Geh schon«, sagte er mit schwacher Stimme.
Denizens Nummer dreizehn, das ›Fragende Stirnrunzeln‹, wurde von Nummer acht abgelöst – dem ›Mir Scheint Etwas Wichtiges Entgangen Zu Sein, Und Das Ist Voll Unfair, Denn Hier Geht Es Um Mich‹.
Leider schien Denizen nicht viele Optionen zu haben, und so stieg er ein und nahm seine Tasche auf den Schoß, nachdem McCarron die Beifahrertür geöffnet hatte. Im Wagen war es im Vergleich zum kalten Abend wohlig warm. Der Innenraum des Jensen Interceptors bestand aus weißem Leder und Holzarmaturen und machte seinem imposanten Namen alle Ehre. Bei geschlossener Tür hätte Denizen ohne weiteres glauben können, in einem Aufklärer-U-Boot oder einem Kampfflugzeug zu sitzen.
Ackerby und McCarron unterhielten sich.
»Muss ich irgendwo unterschreiben, dass ich ihn abgeholt habe, oder …?«
»Nein, nein … gehen … gehen Sie einfach.«
Absurderweise ärgerte sich Denizen ein wenig darüber, wie schnell Ackerby ihn übergab. Man könnte denken, jemand hielte ihm eine Pistole auf die Brust. McCarron stieg neben ihm ein. Er strich mit behandschuhten Händen über das Lenkrad, als würde er den Kopf eines geliebten Hundes tätscheln, und stieß einen glücklichen Seufzer aus, bevor er sich an Denizen wandte.
»Bist du bereit?«
Sein Tonfall hatte etwas sehr Endgültiges, und Denizen zögerte einen Moment, bevor er antwortete.
Zu Hause kann viele verschiedene Dinge bedeuten.
Es kann der Ort sein, an dem man sich am sichersten fühlt. Der Ort, an dem man gewiss sein kann, dass sich immer jemand um einen kümmert. Es kann ein Ort sein, den man so gut kennt, dass man sich in völliger Dunkelheit zurechtfinden würde – ein Ort, den man ebenso gut kennt wie die Form des eigenen Gesichts.
Für Denizen bedeutete zu Hause der Ort, an dem es keine Überraschungen gab. Der Ort, an dem er wusste, wie alles ablief. Vertraut war zugegebenermaßen nicht gleichbedeutend mit angenehm, aber Vorhersehbarkeit hatte ihre Vorzüge.
Denizen kannte Crosscaper. Er wusste, wie es funktionierte. Das Tor vor ihm führte bloß in die Ungewissheit. Das Vorhersehbare mochte seine Annehmlichkeiten haben, aber das Unbekannte war genau das – ein Geheimnis, das möglicherweise alle Antworten auf die Fragen enthielt, die er sich schon sein ganzes Leben lang gestellt hatte. Wer er war. Wer seine Eltern gewesen waren.
Hier in Crosscaper würde er sie niemals finden.
»Es kann losgehen«, erwiderte Denizen ruhig.
3 Der Albtraumengel
Lange Zeit fuhren sie, ohne ein Wort zu wechseln.
Die Straße lag wie ein Schneidermaßband um die Berghänge. Auf einer Seite war verschwommen eine hohe Felswand zu erkennen, auf der anderen ein kümmerlicher Grünstreifen – bevölkert von furchtlos umherstolzierenden Schafen – und dahinter in schwindelerregender Tiefe das mondbeschienene Meer.
McCarron stieß im Vorbeifahren einen langen leisen Pfiff aus.
Denizen war völlig in Gedanken versunken. Wie lange sollte er warten, bevor er McCarron fragte, warum er nachts in einem schwarzen Wagen eine Küstenstraße ohne Licht hinaufgefahren war?
Nun waren die Scheinwerfer eingeschaltet, sonst wäre Denizen auch vor Angst gestorben. Vielleicht hatte er einfach nicht richtig hingeschaut. Vielleicht waren sie auf die niedrigste Stufe gestellt gewesen … aber das war ja die Sache mit der Dunkelheit auf dem Land – es war dunkel. Er hätte sogar gesehen, wenn jemand die Straße mit einem brennenden Streichholz hochgelaufen wäre.
Ein Dorf nach dem anderen flog vorbei – Dooagh, Keel, Achill Sound –, dann die Brücke zum Festland, sie war so lang, dass der Wagen für einen Moment zu schweben schien, zwischen den Lichtern hinter ihnen und denen vor ihnen bestand keine Verbindung. Während die Landschaft hinter ihnen immer mehr verschwand, schwoll das Schnurren des Wagens zu einem kehligen Knurren an.
Denizen zählte die Kilometer im Kopf mit. Weiter als Achill Sound war er noch nie gewesen. Alles vor Crosscaper zählte nicht – das war ein anderes Kapitel seines Lebens, eines, dessen Seiten zusammenklebten und das nicht lesenswert war.
Bei jedem zurückgelegten Kilometer überlief ihn unwillkürlich ein seltsamer Schauer der Erregung. Jedes Schild fügte seiner inneren Landkarte mehr Abstand und mehr Namen hinzu. Lough Feeagh, Newport, Castlebar …
»Bis Dublin wird es noch ein paar Stunden dauern«, sagte McCarron irgendwann. »Du kannst ruhig ein bisschen schlafen.«
Und etwas verpassen? Nein danke. Denizen riskierte lieber einen Blick, um sich McCarron genauer anzuschauen.
Er mochte dreißig, vielleicht auch ziemlich verlebte fünfundzwanzig sein und wurde für seine Dienste bei Denizens Tante offenbar gut bezahlt. Sowohl McCarron als auch Ackerby hatten Anzüge getragen; doch während Ackerbys geschlottert hatte wie jedes andere Kleidungsstück in Crosscaper, saß McCarrons Anzug wie eine zweite Haut. Seine Krawattennadel hatte die Form eines Schwerts.
Und er hatte Narben. Bei jeder Straßenlaterne warf Denizen einen verstohlenen Blick zu ihm herüber. Es war nicht nur eine Narbe – es war ein filigranes Netz silbriger Linien auf einer Gesichtshälfte. Am meisten stach eine weißliche wulstige Stelle heraus. Sie ähnelte ein wenig der Narbe auf Simons Hand, die er sich bei dem Autounfall zugezogen hatte, der seine Eltern getötet hatte. Aus der Haut war alle Farbe und alles Leben gewichen, was sie bleich und tot aussehen ließ. Es bedeutete, dass die Narben alt waren. Wirklich alt.
Er brauchte einen Moment, bis McCarrons Worte zu ihm durchdrangen. »Wir fahren nach Dublin?«, fragte Denizen. »Dort wohnt meine Tante?«
McCarron nickte. Nun gut, damit ist schon mal eine Frage beantwortet. Denizen versuchte, das verräterische, aufgeregte Schaudern zu unterdrücken. Da er überhaupt nichts über seine Familie wusste, war er für jede noch so kleine neue Information äußerst dankbar.
Und eine Stadt. Ich habe noch nie zuvor eine Stadt gesehen.
Er hustete, und Stirnrunzeln Nummer vier – ›Nichts Anmerken Lassen‹ – rasselte wie eine Falltür herunter. Er würde seine Tante verhören. Er würde sich von nichts ablenken lassen. Das hier war kein Schulausflug. Bei diesem Einsatz ging es darum, Fakten herauszufinden.
Als Denizen sich im Sitz zurücklehnte, knarzte das Leder.
»Nur zu«, sagte McCarron, als sie die nächste Stadt hinter sich ließen.
»Was?«, fragte Denizen.
»Nur zu. Frag mich.«
»Ich weiß nicht, was Sie –«
Auf McCarrons Gesicht erschien wieder das Fassadenklettererlächeln. »Ich an deiner Stelle würde alles Mögliche über deine Tante wissen wollen. Um gewappnet zu sein, sozusagen.«
»Sollte ich das?«, fragte Denizen. »Gewappnet sein, meine ich.« Angst schlich sich in seine Stimme. »Ich weiß überhaupt nichts über sie.«
Hatte sie sich deshalb ferngehalten? Es wäre doch typisch, wenn die Verwandte, die nach all der Zeit auftauchte, sich als irgendeine Verrückte herausstellen würde. Es wäre die Erklärung, warum man ihn nicht bei ihr untergebracht hatte.
»Wie heißt sie?«, fragte er plötzlich. Beginn mit den grundlegenden Sachen.
»Vivian«, antwortete McCarron. »Vivian Hardwick. Obwohl ich nicht mit Vivian anfangen würde. Vivian muss man sich in gewisser Weise verdienen. Tante Vivian? Tantchen?« Über sein Gesicht huschte ein merkwürdiger Ausdruck. »Auf keinen Fall Tantchen.«
»Oh«, sagte Denizen. »Wie soll ich sie dann nennen?«
»Ich vermute, die meiste Zeit wird sie reden«, sagte McCarron. »Aber mit einem ordentlichen Miss wirst du nichts falsch machen. Ms Hardwick.«
Sie fuhren ein paar Minuten schweigend, und Denizen ließ sich McCarrons Worte durch den Kopf gehen. »Kennen Sie meine Tante schon lange?« Denizens Stimme klang zögerlich. »Haben Sie … haben Sie meine Eltern gekannt?«
McCarron brauchte eine Weile, bis er antwortete.
»Bedaure, Kleiner. Bis heute Morgen wusste ich nicht mal, dass es dich gibt.«
Denizen entfuhr ein enttäuschtes Seufzen.
Behandschuhte Finger trommelten auf das Lenkrad. »Hör zu, die nächsten Tage werden vermutlich recht hektisch sein, aber wenn ich eines hundertprozentig weiß: Ihr Hardwicks seid hart im Nehmen. Du wirst das schon packen.«
Ihr Hardwicks. Das klang seltsam. Er hatte noch nie im Plural über seinen Namen nachgedacht.
»Danke, Mr McCarron.«
McCarron grinste ihn an.
»Meine Freunde nennen mich Grey.«
Denizen ließ die Landschaft mit halbgeschlossenen Augen an sich vorüberziehen. Regen prasselte gegen die Fensterscheiben, aber das schläfrige Wageninnere bestand nur aus Wärme und dem Glühwürmchenglimmen der Armaturenbeleuchtung.
Sie fuhren durch Häuseransammlungen, die sich wärmesuchend aneinanderschmiegten, Städte und Wälder und Bruchstücke von Träumen. Es war derselbe Traum, den Denizen immer träumte – von seiner Mutter, ihrer Wärme und ihrem Erdbeerduft. Die Vertrautheit tröstete ihn.
Er rutschte halb schlafend, halb wach auf seinem Sitz hin und her. Sie sagte etwas. Er hatte die Worte so oft geträumt, aber nie begriffen, was sie bedeuten sollten …
Mit einem Mal wachte Denizen auf. Er hatte … da war etwas Wichtiges gewesen, aber als er versuchte, es zu fassen, war es ihm entglitten, hatte sich wie Nebel verflüchtigt. Er hatte einen unangenehmen Geschmack im Mund. Sein Magen rumorte. Er schüttelte den Kopf, um ihn klar zu bekommen.
»Wir sind gleich da«, sagte McCarr– Grey. »Ich habe einen Anruf bekommen, dass ich mich um etwas … kümmern soll.« Seine Stimme klang gutgelaunt, hatte aber einen angespannten Unterton.
Die Landschaft hatte sich verändert – Felder und Wälder waren penibel geschnittenem Gras auf künstlich angelegten Wällen gewichen, dem schmutzig grauen Beton von Überführungen und dem rußschwarzen Stahl von Sicherheitsgeländern. Brücken flogen als Schattenstreifen über ihnen vorbei. Ein Stück weiter sah Denizen einen Tunnel, in dessen Mündung goldene Lichter leuchteten.
Sie flackerten. Zuckten in ihren Fassungen.
Auf Denizens Stirn bildete sich Schweiß. Eine weitere Brücke warf Schatten auf sie. Die Geschwindigkeit des Wagens und die Weichheit, mit der er über den Asphalt glitt, vermittelten das Gefühl, der Interceptor würde fallen, als würden sich die Räder jeden Moment sanft von der Straße ablösen und der Wagen würde sich überschlagend in die Tiefe stürzen.
Denizen schluckte. »Haben Sie …« Brechreiz brannte ihm in der Kehle. Er spürte ein ungesundes Ziehen im Magen, öligen Schweiß auf der Stirn. Er kämpfte, um die Worte herauszubekommen. »Mir ist ein bisschen –«
»Denizen?«
Er krallte sich an seinen Sicherheitsgurt. »Mir ist nicht gut. Mir ist ein bisschen – Mir ist –«
»Nicht den Gurt öffnen«, sagte Grey scharf.
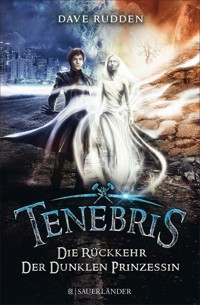















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)












