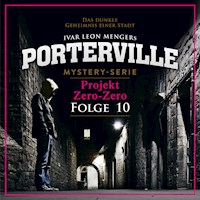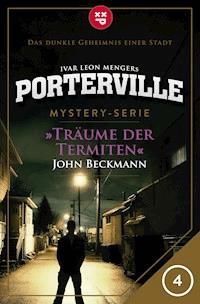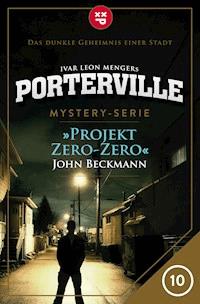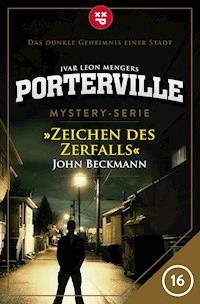Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Psychothriller GmbH E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Terminal 3
- Sprache: Deutsch
Eine ruhige Nacht im Terminal 3. Alles geht seinen gewohnten Gang, bis ein aufgeregter junger Mann Lennard Fanlay von einer erschreckenden Beobachtung erzählt. Duane Parker plagen hingegen ganz andere Sorgen: Er jagt einen Verräter in den Reihen der TSA. Und Karen Donovan bereitet sich im Airport Hotel auf die Ankunft des Birmanen vor. Doch dann kommt alles anders geplant ... Drei Menschen. Drei Schicksale. Eine Geschichte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 106
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ivar Leon Mengers „Terminal 3“
„Was im Verborgenen liegt“
John Beckmann
- Originalausgabe -
1. Auflage 2013
ISBN 978-3-942261-42-5
Lektorat: Hendrik Buchna
Illustration: Stefanie Bemmann
Covergestaltung: Ivar Leon Menger
Psychothriller GmbH
www.psychothriller.de
Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der mechanischen, elektronischen oder fotografischen Vervielfältigung, der Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen, des Nachdrucks in Zeitschriften oder Zeitungen, des öffentlichen Vortrags, der Verfilmung, der Vertonung als Hörbuch oder -spiel, oder der Dramatisierung, der Übertragung durch Rundfunk, Fernsehen, Video oder Internet, auch einzelner Text- und Bildteile, sowie der Übersetzung in andere Sprachen.
Ein Buch zu schreiben, dauert Monate. Es zu kopieren, nur Sekunden. Bleiben Sie deshalb fair und verteilen Sie Ihre persönliche Ausgabe bitte nicht im Internet. Vielen Dank und natürlich viel Spaß beim Lesen! Ivar Leon Menger
Lennard Fanlay
Gate C 33. Der letzte Flug des Tages. Beijing Airlines nach Shanghai.
Die Transitbereiche der anderen Terminals sind bereits geschlossen. Die Mittelachse, der kilometerlange Gang, der tagsüber die Gates miteinander verbindet, liegt im Dämmerlicht der Nachtbeleuchtung. An der Grenze zu Terminal 2 wird sie durch eine verschiebbare Glaswand unterbrochen. Hier passiert heute nichts mehr. Nur C33 ist noch nicht zur Ruhe gekommen.
Es ist kurz vor halb eins. Das Boarding verzögert sich seit einer halben Stunde, weil der Sitz des Co-Piloten ausgetauscht werden muss. Die Stimmung im Gate ist angespannt, besonders unter den Krawattenträgern. Man befürchtet, der Flug könne storniert werden. Man hat wichtige Termine am nächsten Morgen in einer anderen Zeitzone.
Ich lehne etwas abseits an einem der Pfeiler und warte darauf, dass auch mein Bereich endlich geschlossen werden kann. Wie ein Restaurantbesitzer, der nach einem langen Tag darauf wartet, dass seine letzten Gäste gehen, damit er den Laden zuschließen kann.
Ich hole das Handy aus der Hosentasche und überlege, Kim anzurufen. Sie ist bei einer Freundin in Idaho. Um etwas Abstand zu gewinnen, wie sie sagte. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet soll und noch weniger weiß ich, ob mir das gefällt. Es ist spät. Kurz vor halb eins. In Idaho ist es vielleicht sogar schon eine Stunde später. Ich wähle Kims Nummer. Mein Anruf wird direkt zu ihrer Mailbox weitergeleitet. Wahrscheinlich ist ihr Akku mal wieder leer.
Auf der Mittelachse schiebt sich eine der großen Reinigungsmaschinen über die matt glänzenden Fliesen. Ich versuche zu erkennen, ob Kenny am Steuer sitzt, doch die Maschine ist zu weit entfernt.
Ein mehrstimmiges Surren kündigt Nachzügler an. Zwei asiatische Männer mit Pilotenuniformen und Handgepäck-Trolleys. Sie steuern auf den Gate-Schalter zu. Anscheinend ist der Sitz inzwischen ausgewechselt worden. Die Piloten verschwinden in der Schleuse. Kurz darauf verkünden die Bildschirme im Gate die frohe Botschaft: Bereit zum Boarding.
In Sekundenschnelle bildet sich eine akkurate Schlange vor dem Gate-Schalter. Geschäftsmänner mit Terminen in Übersee sind die diszipliniertesten Reisenden, die man sich vorstellen kann. Auch die wenigen Urlauber sind glücklich, dass es nun endlich losgeht.
Ein auffallend großer, junger Mann bleibt allein auf einer der Wartebänke zurück. Sein Anzug ist hell und aus Leinen, die Krawatte fehlt. Die abgewetzte Ledertasche neben ihm passt nicht so recht in das Bild eines typischen Geschäftsmanns. Genauso wenig wie der schwarze, schlichte Haarreif und die blonden Locken, die glänzen, als hätte er sie mit Bratenfett frisiert. Soll wahrscheinlich aussehen, wie bei einem europäischen Fußballspieler. Tut es aber nicht.
Anstatt sich anzustellen, schaut der junge Mann sich suchend um. Als sein Blick auf mich fällt, springt er plötzlich auf und kommt mit schnellen Schritten näher.
„Sie sind Mr. Fanlay?“, flüstert er und beugt sich zu mir hinunter. „Der Sicherheitschef.“
Ich nicke und versuche, etwas Abstand zwischen uns zu bringen, was sich aufgrund des Pfeilers in meinem Rücken als schwierig gestaltet.
„Sie müssen verhindern, dass das Flugzeug startet!“
Sein Atem riecht nach Kaffee und Magensäure. Nicht nur aufgrund des Geruchs fühle ich mich in die Enge getrieben, also verschaffe ich mir mit einer Hand auf seiner Schulter etwas Platz zum Durchatmen.
„Warum sollte ich das tun?“
„Weil …“, beginnt er und muss sich augenscheinlich zurückhalten, um mir nicht gleich wieder auf die Pelle zu rücken. „Weil … Es befindet sich eine Bombe an Bord!“
Dieses Wort mit den fünf Buchstaben, dieses Wort mit den zwei Bs ändert die Situation von Grund auf. Laut ausgesprochen in einem beliebigen Flughafen der Vereinigten Staaten setzt es unwiderruflich eine ganze Reihe von Reaktionen in Gang, die für alle Beteiligten zumeist höchst unerfreuliche Folgen haben.
„Ich hoffe für Sie, dass das kein Scherz ist“, sage ich, weil es noch immer Spinner gibt, die einfach nicht wahrhaben wollen, welche Wirkung das Wort mit den zwei Bs hat.
Der junge Mann schüttelt den Kopf. Seine Stirn glänzt im Deckenlicht als hätte er auch sie eingefettet.
„Woher wissen Sie davon?“, frage ich und hole mein Handy heraus, weil es jetzt sowieso kein Zurück mehr gibt.
„Ich habe es gehört.“ Er beugt sich wieder zu mir hinunter. „Die Piloten haben darüber gesprochen, bevor sie an Bord gingen.“
Er zeigt in Richtung der Schleuse. Die Schlange davor ist beinahe verschwunden.
„Was genau haben Sie gehört?“
„Ich … ich hab nicht alles verstanden. Mein Mandarin ist gut, aber nicht perfekt.“ Er starrt mich mit großen Augen an. „Doch bei einem Satz, bei einem Satz bin ich mir ganz sicher: Ist die Bombe an ihrem Platz? Das hat der größere Pilot den anderen gefragt.“
Ich schätze die Entfernung zwischen dem Platz, auf dem der junge, aufgeregte Mann gerade eben noch gesessen hat, und dem Laufweg der Piloten ab. Mindestens fünf, sechs Meter. Vielleicht sogar noch mehr.
„Sie könnten sich verhört haben“, sage ich.
„Ich kann‘s beweisen.“
Seine Hand gleitet in sein Jackett.
Reflexartig packe ich seinen Unterarm. „Ganz langsam!“
Ich drücke zu, damit er versteht, dass es mir ernst ist.
Die Hand noch immer in der Innentasche, glotzt er mich verständnislos an. „Ich hab‘s aufgenommen! Mit meinem Handy! Ich habe das Gespräch aufgezeichnet.“
Obwohl wir uns im Transitbereich befinden, und er mindestens einen Körperscanner durchlaufen musste, um hierher zu gelangen, läge er schon längst vor Elektroschocks zuckend am Boden, hätte er dieselbe Show mit einem TSA-Beamten durchgezogen.
„Sie können es sich selbst anhören, wenn Sie mir nicht glauben!“, zischt er stattdessen und weiß wahrscheinlich gar nicht, was für ein Glück er hat.
„Mein Chinesisch ist etwas eingerostet“, entgegne ich, doch der Junge hat seinen Sinn für Humor leider bereits ausgeschwitzt.
„Dann holen Sie einen Dolmetscher!“
Vielleicht ist er wirklich nur ein Spinner. Spinner sind meist schwer zu erkennen, weil es so viele unterschiedliche Arten von ihnen gibt. Doch die Angst in seinen Augen ist echt.
„Ich flehe Sie an: Diese Maschine darf nicht starten!“
Ich nicke und wähle die erste von insgesamt drei Telefonnummern.
Es werden kurze Gespräche. Uns bleibt keine Zeit für lange Erklärungen.
Das Wort mit den zwei Bs macht sie ohnehin überflüssig.
Karen Donell
„Das ist absolut inakzeptabel.“
Mr. Marquez schüttelt den Kopf.
„Inakzeptabel“, sagt er noch einmal und betont dabei jede Silbe einzeln. „Das Airport-Hotel hat es sich zur Aufgabe gemacht, auch den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.“
Er lehnt sich zurück. Die Sitzfläche seines Bürosessels ist so hoch ist, dass seine Füße in der Luft baumeln. Wie ein kleiner Junge, der am Vater-Sohn-Tag einen unbeobachteten Augenblick lang Chef spielt. Leider dauert dieser Moment bereits 14 Monate an.
„Derartige Schlampigkeiten können wir uns einfach nicht erlauben!“, fährt Mr. Marquez fort und hebt vor Empörung sogar seinen Zeigefinger, was nur sehr selten passiert, da er sich für seine kleinen Hände schämt.
Alles hier ist zu groß für ihn: der Schreibtisch, das Büro, die Verantwortung. Nur der Anzug sitzt perfekt. Maßgeschneidert. Als Schicht-Manager kann er es sich leisten.
„Ich hatte gehofft, dass Sie das inzwischen verstanden haben.“ Er räuspert sich und faltet seine Kinderhände vor einer silbergrauen Weste. „Karen …“
Mein Blick löst sich von den großen goldfarbenen Knöpfen.
„Ich hatte gehofft, dass wir dieses Gespräch nicht noch einmal führen müssten“, verkündet der Mund mit dem dünnen Bartkranz. Die Augenbrauen, die kaum dicker als der Bartkranz sind, rutschen nach oben und schaffen Raum für eine kurze Stille. Ob sie dazu dient, mich zu Wort kommen zu lassen, ist schwer einzuschätzen.
Ich versuche es trotzdem. „Mr. Marquez, das Problem hierbei ist –“
Sofort schnellt das kleine Männchen in seinem viel zu großen Sessel nach vorne und erklärt mir, was das Problem ist.
„Die Rezeption war schon wieder nicht besetzt! Über fünfzehn Minuten lang! Die Rezeption muss immer besetzt sein. Auch nachts!“
„Mrs. Miller aus Zimmer 213 hatte einen Migräneanfall –“, setze ich an, doch Marquez interessiert sich mehr für Zahlen als für Menschen.
„Fünfzehn Minuten!“
„Und bat mich, ihr Kopfschmerztabletten hinaufzubringen“, bringe ich den Satz zu Ende.
„Nein“, entgegnet er und schafft es tatsächlich, mich aus der Bahn zu werfen.
„Wie meinen Sie das? Nein?“, frage ich irritiert.
„Das ist nicht der Grund, Karen“, stellt Mr. Marquez fest.
„Aber ich habe Ihnen doch gerade –“
„Der wahre Grund ist, dass Sie ein Problem mit Autoritäten haben.“
Mr. Marquez‘ Augenbrauen gehen erneut auf die Reise, der Bartkranz wird zum Oval. Sein Gesicht sagt: Das ist schade, aber es ist leider nun mal so.
„Ich finde das nicht fair“, sage ich.
„Fair“, wiederholt er, als würde er das Wort zum ersten Mal hören, und beginnt, unruhig in seinem Sessel hin- und herzurutschen, als wäre ihm dessen Größe gerade erst bewusst geworden.
„Fair …“, sagt er noch einmal.
Ich erkenne die Zeichen und versuche zu retten, was zu retten ist.
„Wir sind ganz einfach unterbesetzt.“
Doch es ist zu spät.
„Ich sage Ihnen einmal, was nicht fair ist!“, keift das Männchen in dem silbergrauen Dreiteiler. Seine Stimme schraubt sich gefährlich in die Höhe. „Nicht fair ist, dass die Servicebeurteilung vor der Tür steht! Nicht fair ist, dass wir morgen einen der mächtigsten Männer Birmas erwarten, und Sie es trotz allem nicht für nötig halten, die einfachsten Anweisungen zu befolgen! Und das, obwohl wir uns sogar den Luxus leisten, zwei“, Zeige- und Mittelfinger stechen in die Luft, „zwei Nacht-Rezeptionisten zu beschäftigen! Wo ist Henry überhaupt? Wofür bezahle ich diesen Kerl eigentlich?“
Selbstverständlich ist es nicht Mr. Marquez, der unser Gehalt bezahlt. Er ist nur der Nacht-Manager, der unter dem Tages-Manager, der unter dem Geschäftsführer steht. Doch ich entscheide mich für die geringfügig diplomatischere Antwort.
„Henry sorgt dafür, dass die Rezeption besetzt ist, während ich bei Ihnen bin.“
Mr. Marquez‘ Stimme erreicht Regionen, die Hunde zum Jaulen bringen. „So kann ich kein Hotel führen! Wie stellen Sie sich das vor, Karen? Wie soll ich … Ich meine ...“ Er stockt. „Man kann doch nicht von mir erwarten … Karen, ernsthaft!“
Er schaut mich an. Sein Blick bettelt um Zustimmung. Dann schlägt er die Hände vors Gesicht.
Ich stehe auf, weil ich weiß, was nun folgt. 14 Monate können eine lange Zeit sein.
Bis zur Tür sind es nicht mehr als vier Schritte. Trotzdem höre ich noch den ersten Schluchzer. Den ersten von vielen.
Beim Fahrstuhl fällt die Anspannung von mir ab und mir wird kurz schwindelig, doch bereits als die Kabine nach unten gleitet, ist es wieder vorbei.
Alles wird gut, sage ich zu mir.
Immer wieder.
Alles wird gut.
Henry wartet schon auf mich. Er schwitzt noch mehr als sonst.
„Was wollte er?“
„Das Übliche“, sage ich, weil mir keine passendere Beschreibung für diesen Wahnsinn einfällt.
Henry folgt mir.
„Ich habe ihn gesehen“, raunt er dicht neben meinem Ohr. „Karen, ich habe ihn gesehen!“ Seinem Tonfall nach zu urteilen, könnte er auch den Antichrist meinen. „Du musst es mir sagen.“
Wir bleiben stehen. Ein feiner Hauch von Zwiebelsuppe liegt in der Luft.
Henry starrt mich aus rotgeränderten Augen heraus an. Der Fleck auf seinem Revers ist ebenfalls rot, jedoch zwei Töne dunkler.
„Schmeißt er mich raus?“, fragt Henry.
Ich starre auf sein Revers. Wahrscheinlich getrockneter Ketchup. „Er schmeißt dich nicht raus. Er …“ Ich suche nach aufmunternden Worten und lande bei: „Es ist alles in Ordnung, okay?“
„Ich muss es wissen!“, sagt er und geht zur Schnappatmung über. „Bin ich meinen Job los?“
„Henry, schau auf meine Lippen: Du bist nicht gefeuert. Okay?“
Er nickt. Das Schnaufen wird leiser.
„Denk doch mal nach. Warum sollte Mr. Marquez mich in sein Büro rufen, wenn er dich feuern will?“
Henrys Augen weiten sich wieder. „Hat er dich etwa rausgeworfen?“
„Nein, verdammt, niemand wurde rausgeworfen!“, sage ich viel zu laut, doch zum Glück ist die Lobby außer uns beiden leer. Nur Henry zuckt zusammen.
Ich schüttele den Kopf. „Tut mir leid …“
„Schon gut“, sagt Henry.
Mein Blick fällt auf die Uhr über der Rezeption. Null Uhr einundvierzig. Viel zu früh, um schon die Nerven zu verlieren. Die Nacht ist noch lang.
Ich schaue auf den verwaisten Empfangstresen, dorthin, wo jetzt eigentlich Henry stehen sollte, um unsere Gäste mit einem verbindlichen Lächeln zu begrüßen und sage: „Es ist alles in Ordnung. Mach dir bitte keine Sorgen.“
Es klingt erstaunlich überzeugend.