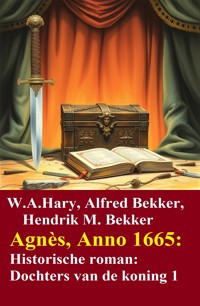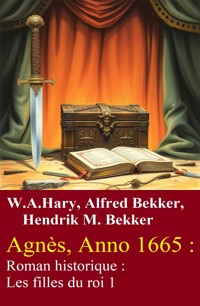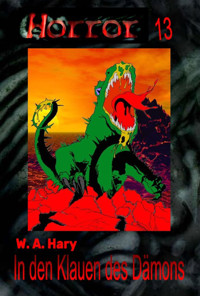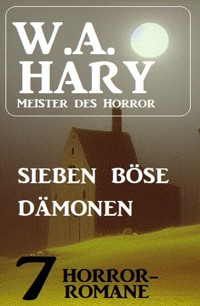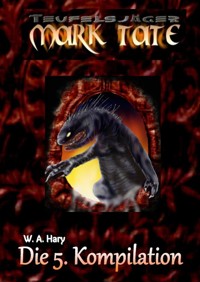
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
TEUFELSJÄGER: Die 5. Kompilation
W. A. Hary: „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 21 bis 25 der laufenden Serie!“
Plötzliche Übelkeit übermannte sie. Vergeblich suchte sie nach Halt. Alles drehte sich um sie. Der Boden kippte nach oben. Sie sank zusammen. Ein unterdrücktes Stöhnen kam über ihre Lippen.
Etwas lähmte ihr Denken.
Sie kniff fest die Lider zusammen, bekämpfte den Schwindelanfall und spürte dabei, wie sich ihr Körper mit einem eiskalten Schweißfilm überzog. Jetzt war sie nicht einmal mehr zum Stöhnen fähig.
Dieses unbekannte Etwas tastete die Windungen ihres Gehirns entlang. Es war schmerzhaft.
Hilflos wand sie sich am Boden, kämpfte weiter einen verzweifelten Kampf, in dem der Sieger schon von vornherein feststand. Sie hatte keine Chance, denn der Gegner griff aus dem Unsichtbaren an.
Und dann war May Harris nicht mehr Herrin ihrer Sinne.
Eine fremde, bösartige Macht hatte sie übermannt.
Achtung: Alte Rechtschreibung, denn die Romane „spielen“ in den Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts! Zur Erinnerung: Da gab es auch noch kein „Handy“!
________________________________________
Urheberrechte am Grundkonzept zu Beginn der Serie Teufelsjäger: Wilfried A. Hary!
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch)
by hary-production.de
Nähere Angaben zum Autor siehe hier: de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_A._Hary
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
TEUFELSJÄGER: Die 5. Kompilation
„Diese Kompilation beinhaltet die Bände 21 bis 25 der laufenden Serie!“
Nähere Angaben zum Autor siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_A._HaryBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Wichtiger Hinweis
Diese Serie erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Seit Band 21 wird sie hier nahtlos fortgesetzt! Jeder Band (siehe Druckausgaben hier: http://www.hary.li) ist jederzeit nachbestellbar.
TEUFELSJÄGER
Die 5. Kompilation
W. A. Hary: „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 21 bis 25 der laufenden Serie!“
Achtung: Alte Rechtschreibung, denn die Romane „spielen“ in den Siebzigern des vergangenen Jahrhunderts! Zur Erinnerung: Da gab es auch noch kein „Handy“!
Impressum
Alleinige Urheberrechte an der Serie: Wilfried A. Hary
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch) by www.hary-production.de
ISSN 1614-3329
Copyright dieser Fassung 2016 by www.HARY-PRODUCTION.de
Canadastr. 30 * D-66482 Zweibrücken
Telefon: 06332-481150
www.HaryPro.de
eMail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jedweder Art nur mit schriftlicher Genehmigung von Hary-Production.
Covergestaltung: Anistasius
Vorwort
Plötzliche Übelkeit übermannte sie. Vergeblich suchte sie nach Halt. Alles drehte sich um sie. Der Boden kippte nach oben. Sie sank zusammen. Ein unterdrücktes Stöhnen kam über ihre Lippen.
Etwas lähmte ihr Denken.
Sie kniff fest die Lider zusammen, bekämpfte den Schwindelanfall und spürte dabei, wie sich ihr Körper mit einem eiskalten Schweißfilm überzog. Jetzt war sie nicht einmal mehr zum Stöhnen fähig.
Dieses unbekannte Etwas tastete die Windungen ihres Gehirns entlang. Es war schmerzhaft.
Hilflos wand sie sich am Boden, kämpfte weiter einen verzweifelten Kampf, in dem der Sieger schon von vornherein feststand. Sie hatte keine Chance, denn der Gegner griff aus dem Unsichtbaren an.
Und dann war May Harris nicht mehr Herrin ihrer Sinne.
Eine fremde, bösartige Macht hatte sie übermannt.
1
Ich bog in die Sutherland Avenue im Londoner Stadtteil Paddington, der durch einen Krimi von Agatha Christie zu Berühmtheit gelangt war, und suchte nach einem Parkplatz. Es war Nachmittag, und ich hatte entgegen sonst Glück. Ich stellte meinen Mietwagen, einen Minicooper, nur fünfzig Schritte von der Wohnung meiner Freundin May Harris entfernt ab. Ich hatte mit ihr telefoniert, und wir wollten zusammen ausgehen.
Ich stieg umständlich aus dem Wagen und klappte den Wagenschlag zu. Der Verkehr hier in der Sutherland Avenue war mäßig, aber über den Dächern lag das Brausen der Großstadt. Eine Geräuschkulisse, die höchstens des Nachts abebbte.
Ich klingelte bei May. Sie wohnte in einem Haus mit zehn Wohnungen. Früher waren wir zusammen gewesen. Aber May fühlte sich in meinem Apartment nicht besonders wohl. Das war auch kein Wunder. Ich hatte die Wände voll hängen mit Dämonenmasken und dergleichen Dingen mehr.
Das war auch notwendig. Als Privatdetektiv hatte ich schließlich den Schwarzen Mächten den Kampf angesagt. Mit Hilfe meines Schavalls, einem geheimnisvollen Amulett, war ich als Mark Tate durchaus ein ernstzunehmender Gegner, wie sich inzwischen herausgestellt hatte. Und all die Utensilien in meiner Wohnung dienten zu meinem zusätzlichen Schutz. Das hatte sich reichlich bewährt.
May Harris mochte das durchaus einsehen, aber ihre Aversion gegen mein Apartment blieb. Sie war inzwischen ausgezogen, was jedoch unser Verhältnis keineswegs trübte.
May öffnete nicht.
Abermals versuchte ich es.
Leichte Unruhe ergriff mich.
War etwas Unvorhergesehenes passiert?
Erst als ich das vierte Mal läutete, knackte es in der Sprechanlage.
»Ja?« Es klang müde.
»Ich bin es, Mark.«
»Okay!«
Das war alles. Eine steile Falte erschien auf meiner Stirn. Der Türsummer ertönte. Ich drückte auf und betrat das Haus. Unwillkürlich tastete ich nach meinem Schavall, der an einer Halskette unter dem Hemd hing. Er fühlte sich ganz normal an, reagierte nicht auf irgendwelche unsichtbare magische Einflüsse. Aber das beruhigte mich nur wenig.
Ich verzichtete auf den Fahrstuhl, der in einem der oberen Stockwerke hing, und stieg die Treppe hinauf, dabei immer drei Stufen auf einmal nehmend. Vor der Tür zu Mays Wohnung verhielt ich. Sie war geschlossen. Ich mußte abermals klingeln.
May Harris öffnete. Es war, als zögere sie.
Ich blickte ihr in das Gesicht. Sie war Brillenträgerin, und die Augen hinter den Gläsern waren verquollen. Ihr Gesicht war kreidebleich. Sie mußte sich an der Wand abstützen. Wankend stand sie vor mir.
Ich erschrak.
»May, was ist denn los? Du warst doch vorhin noch in Ordnung, als wir zusammen telefoniert haben.«
Sie winkte schwach ab.
»Mach dir keine Sorgen, Mark, es ist nichts Besonderes. Ich kenne das von früher.«
Sie machte den Weg frei, und ich trat in die Wohnung.
»Ich brauche wieder eine neue Brille«, eröffnete sie.
Ich musterte sie überrascht.
»Soll das heißen, daß zwischen deinem Zustand und der Tatsache, daß du... neue Gläser brauchst, ein Zusammenhang besteht?«
Sie nickte.
»Mein Augenlicht wird langsam schwächer. Damit haben auch andere zu kämpfen. Ich hätte die Zeichen der letzten Zeit richtig deuten sollen. Oft hatte ich Kopfschmerzen, migräneartig. Die Gläser sind inzwischen zu schwach.«
Ich schüttelte den Kopf. May Harris sprach, als suche sie krampfhaft nach einer Ausrede. Aber ich sagte nichts in dieser Richtung, sondern wartete ab.
Sie zuckte die Achseln.
»Tut mir leid, Mark, aber ich muß erst zu meinem Optiker. Wir müssen die ganze Sache verschieben. Es dauert ja nicht lange. Wenn ich zu Fuß gehe, bin ich in ein paar Minuten dort. Du kannst derweil hier warten.«
»Aber ich könnte dich doch hinfahren«, bot ich an.
Sie winkte mit beiden Händen ab.
»Nein, es ist nicht notwendig. Besser, wenn ich einen kleinen Spaziergang mache. Es kommt immer so plötzlich. Wie gesagt, nachdem sich die ersten Kopfschmerzen angekündigt haben, packt es mich praktisch von einem Moment zum anderen. - Aber was soll ich dir das zu erklären versuchen. Es ist halt so und muß von mir hingenommen werden.«
Ich nickte wenig überzeugt.
May griff nach ihrem Mantel. Ich half ihr hinein.
Als ich ihr einen Kuß gab, drückte ich absichtlich den Schavall gegen sie. Aber das Amulett reagierte auch diesmal nicht.
War alles in Ordnung und täuschte sich mein sechster Sinn, den ich mir als Privatdetektiv erworben hatte?
*
Mit raumgreifenden Schritten eilte sie über die Straße. Jetzt machte sie nicht mehr diesen angeschlagenen Eindruck. Ihre Eile ließ fast den Schluß zu, daß sie es kaum erwarten konnte, an ihr Ziel zu kommen.
Ich duckte mich in den dunklen Hauseingang und behielt sie im Auge.
Erst als sie die nächste Straßenecke erreicht hatte, wagte ich, die Verfolgung wieder aufzunehmen.
May Harris war nicht auf den Kopf gefallen. Sie würde einen Verfolger sehr schnell entdecken. Doch sie blickte sich kein einziges Mal um, als wäre sie sicher, daß ich ihrem Wunsch entsprach und in ihrer Wohnung auf sie wartete. Sie hatte mir sogar den Fernseher eingeschaltet, bevor sie gegangen war.
Ich hätte es nicht ausgehalten. Mein sechster Sinn marterte mich. Ich brauchte einfach Gewißheit. Auch wenn der Schavall diesmal nicht vor den Einflüssen eventueller magischer Kräfte warnte. Aus Erfahrung wußte ich, daß auf das Amulett nicht immer Verlaß war. Es entwickelte zuweilen ein recht eigensinniges Eigenleben.
May geriet für kurze Zeit aus meinem Blickfeld. Ich sprintete los und erreichte keuchend die Straßenecke, um die sie gebogen war. Weiter vorn ging sie.
Ich hatte keine Ahnung, wer der Optiker war, zu dem sie angeblich mußte.
May Harris bewegte sich sehr zielstrebig. Sie machte keine Umwege. Auch das war ein Beweis dafür, daß sie nichts von meiner Verfolgung wußte.
*
Hatte sie behauptet, es sei nur wenige Minuten Weg, so stellte sich bald heraus, daß dies eine glatte Lüge war.
Fast eine dreiviertel Stunde waren wir unterwegs. Ich fürchtete schon, daß wir nie an ein Ziel kommen würden. Die Gegend wurde düsterer. Am Horizont schickte die heraufkommende Nacht ihre ersten Schatten voraus.
Ich blickte auf meine Armbanduhr. Hatte der Optikerladen überhaupt noch offen?
Er hatte!
May Harris erreichte ein uraltes, blatternarbiges Gebäude. Die Fenster waren dunkel und wirkten wie die leeren Augenhöhlen eines Totenschädels.
Der Vergleich ließ mich unwillkürlich schaudern. Abermals tastete ich nach meinem Schavall, den ich auch Dämonenauge nannte. Nur, um die Feststellung zu machen, daß er nach wie vor neutral blieb. Er wirkte wie ein etwas kitschiges Schmuckstück in seiner metallenen Einfassung, in der er wie ein Auge aussah.
Der Laden war ungepflegt, heruntergekommen. Es mutete fast wie ein Wunder an, daß er sich überhaupt über Wasser halten konnte.
Zwei Dinge waren für mich interessant: Erstens, daß May nicht gelogen hatte, als sie von dem notwendig gewordenen Besuch beim Optiker sprach, und zweitens, was suchte May ausgerechnet in einem solchen Laden? Es gab schließlich genügend renommierte Optiker in London.
Warum vertraute sie sich ausgerechnet diesem hier an?
Als ich mich dem Haus näherte, bildete sich eine Gänsehaut auf meinem Rücken. Die ganze Sache gefiel mir immer weniger.
May öffnete die Eingangstür. Eine Glocke sprang an, die bis auf die Straße zu hören war.
Ich zuckte zusammen, als die Straßenbeleuchtung aufflammte. Es war, als hätte May mit dem Öffnen der Tür einen Kontakt ausgelöst.
Ich betrat eine Einfahrt und beobachtete weiter. Das Haus war keine vierzig Schritte von mir entfernt. Auch im Laden brannte jetzt Licht. Ich gewahrte den Schatten Mays und wagte es, noch näher heranzugehen.
May stand vor einer hüfthohen Theke aus Holz. Ein Schatten bewegte sich auf sie zu, erreichte sie. Aus dem diffusen Halbdunkel des Ladens schälten sich die Umrisse eines Menschen. Der Schein der Deckenlampe fiel auf ein runzliges Gesicht.
Ein dünnlippiger Mund verzog sich zu einem satanischen Grinsen. Braune Zähne wurden gebleckt.
Es sah aus, als würde sich der Mann jeden Augenblick auf May stürzen. In den Augen des Optikers glühte ein Feuer auf, das vom Teufel persönlich geschürt zu werden schien.
Er sagte etwas. Ich hörte nichts, konnte die Worte jedoch von seinem Mund ablesen: »Dann bist du also dem Ruf gefolgt, May.«
»Ja«, antwortete sie, und auch ihre Worte ahnte ich mehr, als daß ich sie wirklich aufnehmen konnte: »Es ist wieder soweit.«
Meine Gedanken bewegten sich im Kreis. Ich versuchte zu begreifen. War das wirklich meine Freundin May Harris? Sie erschien völlig verändert und sprach mit dem Optiker wie mit einem alten Freund.
Jetzt bog sie ihren Oberkörper zurück und lachte grell. Es war so laut, daß ich es draußen hören konnte. Schaurig hallte es in meinen Ohren. Ich wich einen Schritt zurück und versuchte, Herr über das Chaos zu werden, das in meinem Innern entstanden war.
Der Gedanke kam in mir auf, daß ein Dämon May Harris in Besitz genommen hatte. Aber warum hatte dann der Schavall nicht reagiert?
Heiße Wut packte mich. Ich wollte dem Spuk ein rasches Ende bereiten und ging auf den Eingang zu. Keinen Augenblick dachte ich, daß dies ein Fehler sein könnte.
Bevor ich nach der Türklinke griff, riskierte ich einen Blick ins Innere des Ladens. Die Deckenlampe übergoß die Szene mit unwirklichem Licht. Es war, als sähe ich eine Darstellung in einem Wachsfigurenkabinett.
Es reichte nicht dazu aus, mich dazu zu bewegen, meinen einmal gefaßten Entschluß rückgängig zu machen.
Ich wollte den Laden betreten.
Als ich endlich die Hand nach der Türklinke ausstreckte, geschah es. Ein greller Blitz löste sich und fuhr in meinen Arm. Er raste durch meinen Körper, und dann schien etwas in meinem Kopf zu explodieren.
Ich taumelte ein paar Schritte zurück, verlor jedoch nicht den Boden unter den Füßen und konnte mich wieder fangen. Verständnislos stierte ich auf den Ladeneingang. Der Schavall an meiner Brust glühte so intensiv, daß er seinem Beinamen Dämonenauge alle Ehre machte.
Mir wurde klar, daß er mir wahrscheinlich das Leben gerettet hatte.
Was war passiert?
*
Ich ballte die Hände zu Fäusten und schritt abermals auf das Haus zu. Kurz davor besann ich mich und umschloß mit der Rechten das Amulett. Vorsichtig schob ich mich vorwärts, bis ich die Tür fast berührte.
Da sprühten Funken auf, tanzten aggressiv über meinen Körper, ohne mir etwas anhaben zu können. Es war, als wäre ich in ein elektrisches Feld geraten, und dieses Feld bildete ein unsichtbares Hindernis, das ich nicht einmal mit dem Schavall durchbrechen konnte, denn der Gegner war schlau genug, sich dem direkten Zugritt des Schavalls zu entziehen. Das Dämonenauge kam erst voll zum Einsatz, wenn sich die magischen Kräfte direkt dagegen wandten. Das war hier nicht der Fall. Das magische Feld diente der passiven Verteidigung.
Es blieb mir nichts anderes übrig, als mich wieder zurückzuziehen.
Und abermals blickte ich in den schäbigen Optikerladen. Nichts hatte sich verändert. Jemand schien durchsichtiges Wachs über die beiden gegossen zu haben. Die Augen des Optikers wirkten wie Glas. Sie waren ohne Leben. May hatte halb die Hand gehoben. In dieser Stellung war sie erstarrt.
Und während ich beobachtete, verlor sie langsam das Gleichgewicht und kippte nach vorn.
Auch der Optiker kam zu Fall.
Wie Schaufensterpuppen fielen sie gegeneinander. Zwischen ihnen war plötzlich keine Theke mehr. Da war gar nichts außer ihnen.
Es geschah inmitten dem Lichtkegel, der mir im Augenblick viel heller erschien als die ganze Zeit über.
Zeitlupenhaft trafen der Optiker und May zusammen und - zerbrachen. Sie zerbrachen wie Porzellan, zerbröckelten, sanken in sich zusammen. Nur noch ein Häufchen Sand, aus dem noch Trümmer herausragten, ein einzelner Arm und ein Fuß blieben übrig.
Das Grauen trieb mir den kalten Schweiß auf die Stirn.
In diesem Augenblick erlosch das Licht im Inneren des Ladens.
Stille breitete sich aus.
*
Erst jetzt fiel mir auf, daß ich mutterseelenallein war. Gehetzt blickte ich mich um. Die Straßenlampen spendeten dürftiges Licht, und die Häuser dahinter wirkten wie billige Kulisse.
Was verbarg sich hinter ihrer Fassade?
Ich erkannte, daß ich überhaupt nicht mehr wußte, wo ich mich befand. Ich war May Harris gefolgt. War sie von einer fremden Macht dazu benutzt worden, mich in die Falle zu locken?
Ich spürte die Hitze, die vom Schavall ausging. Sie konnte mir nichts anhaben, war jedoch unangenehm. Ja, hier waren magische Kräfte am Werk, und ich schien im Blickpunkt ihres Interesses zu stehen. Doch sie griffen nicht direkt an.
Und dann war alles vorbei. Die Umgebung wirkte wieder normal.
Schwere Schritte wurden vernehmbar. Sie hallten von den düsteren Hausfassaden wider. Kein Licht war in den Fenstern, als wären die Häuser unbewohnt.
Die Schritte kamen direkt auf mich zu.
Tack, tack, tack!
Dazwischen ein schleifendes Geräusch. Ich bekam eine Gänsehaut, rührte mich jedoch nicht von der Stelle, stierte in die Richtung, aus der die Laute ertönten. Ein Schatten löste sich aus der Dunkelheit, trat in den Schein einer Straßenlampe. Ich sah ein altes, runzliges Gesicht und glaubte einen Moment lang, es wäre das Antlitz des Optikers. Aber er war es nicht.
Trübe Augen blickten mich an. Der Alte war in einen langen, viel zu weiten Mantel gekleidet und wirkte wie ein Stadtstreicher. Vielleicht war es auch einer. Das linke Bein schleifte er ein wenig nach.
Er zögerte, als wüßte er nicht genau, was von mir zu halten war.
Ich schaute weg und tat so, als würde ich mich für das Haus des Optikers interessieren. Der Alte näherte sich.
Als er auf meiner Höhe war, wandte ich mich ihm wieder zu. »Guten Abend!« sagte ich freundlich.
Er wurde schneller, tat so, als hätte er nichts gehört.
Aber ich ließ nicht locker. »Entschuldigen Sie bitte, ich hätte eine Frage.«
Der Alte wandte nicht den Kopf. Er drehte mir seinen Rücken zu, lief so schnell er konnte davon.
»Moment!« rief ich ihm nach. »Ich wollte wissen, wer in diesem Haus hier wohnt.«
Es war, als wäre er gegen eine Wand gelaufen. Abrupt verhielt er im Schritt. Ich sah, daß er zitterte wie Espenlaub.
Ohne sich umzudrehen, keuchte er:
»Der Teufel, Fremder! Der Teufel persönlich! Gehen Sie weg, lassen Sie mich zufrieden! Ich will nichts mit dem Teufel zu tun haben.«
Mit diesen Worten ging er weiter.
Nachdenklich runzelte ich die Stirn. Meine Gedanken pendelten zwischen dem, was der Alte gesagt hatte, und der Tatsache hin und her, daß sich May Harris in dem Gebäude befand.
War sie wirklich freiwillig hergekommen?
Ich kannte die Zusammenhänge noch nicht, aber auf jeden Fall war May in Gefahr. Es war meine verdammte Pflicht, ihr zu helfen.
Ich trat auf die finstere Einfahrt an der Seite zu. Wenn ich von vorn nicht in das Gebäude kam, so gab es vielleicht hier einen Weg?
Obwohl sich meine Augen an das schlechte Licht gewöhnt hatten, hatte ich alle Schwierigkeiten, in der Einfahrt zurechtzukommen. Ich verfluchte die Tatsache, keine Lampe bei mir zu haben. Aber diese hätte mich nur verraten. Denn es war nicht Rechtens, auf diese Art und Weise in ein fremdes Anwesen einzudringen.
Ich schritt weiter und stolperte beinahe über einen Mülleimer. Sie standen in einer Reihe längs der Begrenzungsmauer. Der Boden war mit Unrat übersät. Es roch unangenehm nach Abfall und Dreck.
Vor mir öffnete sich ein kleiner Hinterhof, umschlossen von Mauern, von denen der Verputz längst abgebröckelt war. Sie waren teilweise bemoost, und in den Löchern hatte sich gewiß allerlei Ungeziefer eingenistet.
Ich überwand meine Abscheu und suchte mit den Augen die Rückfront des Gebäudes ab. Da war eine Hintertür. Sie wurde von dem Lichtermeer der Großstadt, das seinen dürftigen Schein über die Dächer der Häuser hinwegsandte, nur sehr unzureichend beleuchtet. Der Mond hatte sich hinter eine Wolkenbank verzogen, als wollte er von dem, was in dieser Nacht unten auf der Erde geschah, nichts mitbekommen.
Ich steuerte auf die Tür zu. Sie stand einen Spaltbreit offen. Es sah aus wie eine Einladung.
Doch auch hier gab es dieses unsichtbare Hindernis. Ich spürte seinen Einfluß, als ich mich näherte, und zog mich sofort wieder zurück, um nicht abermals die hier wirkenden magischen Kräfte auf mich aufmerksam zu machen.
Der Schavall erwärmte sich nur kurz. Dann erkaltete er wieder.
Ich überlegte, was zu tun wäre.
Eigentlich gab es für mich nur eine einzige Möglichkeit: Ich war gezwungen, den Schavall abzulegen, wollte ich das Gebäude wirklich betreten. Ohne ihn würde sich die magische Kraft nicht gegen mich wenden. Setzte ich ihn jedoch direkt ein, würde man May vielleicht rasch an einen anderen Ort bringen. Gewonnen war damit nichts.
Vielleicht erwartete mich aber auch eine Falle?
Ich ging in Gedanken noch einmal das Vorangegangene durch. Es war offensichtlich, daß sich der Gegner auf May Harris konzentrierte.
Hatte sie nicht in ihrer Wohnung behauptet, es sei nicht das erste Mal, daß sie so etwas erlebte?
Mir fiel unwillkürlich Mays ehemaliger Mann ein. Er war zu seinen Lebzeiten das Oberhaupt einer Sekte von Teufelsanbetern gewesen und hatte enorme magische Fähigkeiten besessen. May war von ihm behandelt worden wie eine Sklavin.
Jeder Schritt von May war von ihm überwacht worden. Sie hatte Furchtbares durchgemacht. Es wurde so schlimm, daß sie ihm den Tod gewünscht hatte.
Aber mit seinem Tode war die Sache längst nicht beendet gewesen.
Als Dämon war er zurückgekehrt.
May Harris war es gelungen, zu fliehen. In dieser Zeit traf sie mich, und gemeinsam machten wir der Sache ein Ende. Tab Furlong, Chefinspektor bei New Scotland Yard, seine Frau Kathryn, ehemalige Ballerina mit bitteren Erfahrungen, was Schwarze Magie betraf, und mein Freund Don Cooper halfen dabei, dem Dämon den Garaus zu machen.
War das alte Gemäuer und das Optikergeschäft das Erbe von Edgar Harris, dem Magier und späteren Dämon? Gab es einen Zusammenhang?
Ich war geneigt, das anzunehmen.
Es war mit ein Grund, warum ich zu dem Entschluß kam, das Äußerste zu versuchen.
Nein, hier ging es wahrlich nicht um mich, sondern in erster Linie um May Harris.
Und sie brauchte meine Hilfe - mehr denn je!
Deshalb legte ich den Schavall ab.
Suchend schaute ich mich um. Wo sollte ich ihn plazieren?
Die Mülleimer ließen den Schluß zu, daß sie schon lange nicht mehr geleert worden waren. Wahrscheinlich war das auch so bald nicht der Fall. Eigentlich ein ideales Versteck.
2
Als ich die Tür des Hintereingangs berührte, geschah nichts. Das unsichtbare Hindernis schien nicht mehr zu existieren. Wurde es nur durch den Einfluß des Schavalls mobilisiert?
Ich hatte ein flaues Gefühl im Magen, als ich eintrat.
Kaum war das geschehen, als die Tür krachend hinter mir ins Schloß fiel.
Donnernd pflanzte sich der Laut im Haus fort.
Ich unterdrückte aufkeimende Panik und versuchte, die Tür wieder zu öffnen. Es mißlang mir.
Und die sich rasch ausbreitende Stille überfiel mich wie ein hungriges Tier.
Ich stand wie erstarrt, lauschte in diese grauenvolle Stille hinein. Wo war die Geräuschkulisse der Millionenstadt London?
Es schien, als hätte ich eine andere Welt betreten, eine fremdartige, unwirkliche Welt. Und in der Dunkelheit lauerte das Nichts.
Ich kam mir verloren vor, abgeschnitten vom Nabel der Welt, des Lebens, des Daseins. Chaotische Gefühle suchten mich heim. Ich konnte mich ihrer nicht erwehren.
Ich brauchte alle Willenskraft, mich von der Stelle zu bewegen. Dabei kamen mir Beschwörungsformeln der Schwarzen Magie in den Sinn. Aufgrund meines Berufes und der Aufgaben, die ich mir gestellt hatte, war es unausbleiblich gewesen, daß ich mich mit diesen Dingen intensiv beschäftigte. Und so wußte ich nicht nur eine ganze Menge über Weiße Magie, sondern kannte mich leidlich mit den bösen Mächten des Jenseitigen aus.
Es war die einzige Möglichkeit jetzt. Durch die Beschwörungsformeln baute ich einen kleinen Schutzwall um mich auf. Ich signalisierte dem magischen Feld des Bösen gewissermaßen Solidarität. Das rettete mich.
Meine Fingerspitzen berührten ein Hindernis. Es war die Gangwand. Sie fühlte sich warm an wie ein lebendiges Wesen. Ich überwand meine Abscheu und tastete mich weiter.
Schmutzig war die Wand. Es raschelte zu meinen Füßen. Ratten? Etwas huschte wieselflink über meinen Handrücken, hinterließ einen brennenden Schmerz. Ich ignorierte auch das.
Dank meines täglichen Trainings gelang es mir trotz der inneren Anspannung, mich in Teiltrance zu versetzen. Das erhöhte die Wirkung. Die Schwarzen Kräfte prallten von mir ab.
Da war ein Lichtschimmer, diffus, unkenntlich, aber dennoch wahrnehmbar. Ich konzentrierte meine Aufmerksamkeit darauf, löste die Hände von der Wand.
Unwirkliches Dämmerlicht entstand ringsum. Es drang durch einen schmalen Türspalt und eine blinde Fensterscheibe. Alles machte einen verwahrlosten und heruntergekommenen Eindruck.
Ich wandte den Blick ab, blieb dicht vor der Tür stehen. Führte sie in den Laden hinein?
Ich lauschte. Gedämpfte Stimmen.
Durch das Schlüsselloch war nur ein kleiner Lichtkreis zu erkennen. Wenn ich mehr sehen wollte, mußte ich die Tür schon öffnen.
Das tat ich dann auch, ging dabei vorsichtig zu Werke.
Obwohl das Haus ungepflegt war, gaben die Angeln kein Geräusch von sich. Das konnte ich nur begrüßen.
Die Tür war jetzt weit genug offen, daß ich mehr erkennen konnte.
Da war die hölzerne Theke, staubige Glasvitrinen mit ausgestellten Brillen, eine altmodische Registrierkasse. Dahinter ein wackliger Stuhl. In der Ecke stand eine Sesselgruppe mit speckigen Bezügen. Der Aschenbecher auf dem Rauchtischchen dazwischen quoll von Zigarettenstummeln fast über.
Die Fensterscheiben waren staubverklebt. Ein Wunder, daß ich von draußen überhaupt etwas hatte erkennen können.
Aber hatte ich das tatsächlich? War ich nicht einfach nur von Trugbildern genarrt worden?
Der Laden war menschenleer. Die Stimmen kamen aus dem Nebenraum. Sorgfältig darauf achtend, keinen Laut zu verursachen, drang ich in den Laden ein. Vor Anspannung verkrampfte sich mein Magen. Ich malte mir lieber nicht aus, was passieren würde, wenn man mich entdeckte.
Eine der Stimmen gehörte eindeutig May Harris.
Ich erreichte die Theke. Es gab nur einen Durchgang, der von einem hochgeklappten Brett markiert wurde. Die niedrige Pendeltür ließ sich ohne Schwierigkeiten bewegen. Dabei knarrte sie leise. Erschrocken hielt ich inne, aber die beiden im Nebenraum schienen es nicht gehört zu haben. Verkrampft ging ich weiter, hielt hinter mir die Pendeltür fest.
Auch im Nebenraum brannte Licht. Der Optiker hatte eine knarrende Stimme, die manchmal an ein rostige Metallgelenke erinnerte. Er sprach seltsam monoton, wie beschwörend. Und als May antwortete, tat sie das in ähnlicher Manier, so als befände sie sich in tiefster Trance.
Ich biß die Zähne zusammen, daß es knirschte, als ich mich auf die Verbindungstür zubewegte.
Sie stand einen Spaltbreit offen, so daß ich keine Schwierigkeiten hatte, hindurchzusehen.
May Harris saß auf einem Stuhl. Sie wirkte apathisch. Ihre Augen waren groß, rund und leer, der Blick starr geradeaus gerichtet.
»Du hast also deinen Mann umgebracht«, sagte der Optiker gerade. »Weiter!«
Sie wandte dem Optiker langsam ihr Gesicht zu.
Er hielt sich mit der linken Hand an ihrer Stuhllehne fest, stand etwas seitlich versetzt, leicht gebückt, wie lauernd. Die Rechte war zur Faust geballt.
Ich mußte an mich halten, um nicht einzugreifen, denn das hätte wenig genutzt. Es hätte Mays Lage nur erschwert, denn dann wäre auch ich unweigerlich in die Klauen der fremdartigen Macht geraten, die dieses Haus hier beherrschte.
Ging die Gefahr von dem Optiker aus?
War er ein Magier? Oder barg das Gemäuer ein furchtbares Geheimnis, und der Optiker war nur ein Sklave?
Ich vermochte diese Fragen nicht zu beantworten - noch nicht.
*
Der Geist von May Harris war vollständig gefangen, und doch gelang es ihm, die Erinnerung zu verweigern.
Immer wieder sprach der Optiker auf sie ein.
Sie kannte seinen Namen: Maurice Vernier. Er war gebürtiger Franzose, sprach jedoch Englisch wie seine Muttersprache.
Maurice Vernier wollte sie zwingen, sich zu erinnern, zu erzählen, was inzwischen geschehen war.
Aber sie wollte nicht!
Und dann gab sie allmählich ihren Widerstand auf,
»Du hast deinen Mann umgebracht«, sagte er. »Weiter!«
Und sie erzählte weiter, obwohl sie es nicht wollte. Dicke Schweißperlen traten auf ihre Stirn. Es strengte sie entsetzlich an, doch gegen diese Übermacht konnte sie einfach nichts tun.
»Ja, ich habe ihn umgebracht, um erst später zu erfahren, daß er rechtzeitig meine Absicht erkannt hatte, ja sogar einen Plan darauf aufbaute. Systematisch hat er mich gequält, mich so lange provoziert, bis ich für die Tat bereit war - freiwillig bereit war, denn das war wichtig. Die Verbindung zwischen Mörder und Opfer ist die stärkste, die es gibt. Deshalb kehrte er als Toter zurück, um sich mit mir endgültig zu vereinen. Wir wären eine Einheit geworden. Er hätte mich in sich aufgenommen und aus meinen Lebenskräften geschöpft. Aber dazu kam es nicht.«
Noch einmal entstand vor ihrem geistigen Auge das Bild, als ihr Mann, Edgar Harris, umgekommen war. Sie sah den Wagen, der mit hoher Geschwindigkeit von der Straße abkam und gegen einen Baum raste.
Etwas umkrampfte Mays Herz. Persönlich war sie nicht dabei gewesen. Dennoch konnte sie sich an jedes Detail erinnern. Wie dank einer Vision. Eigentlich hatte sie sich nie Gedanken darüber gemacht...
Jedenfalls, sie hatte Edgar in den Tod rasen lassen. Es hatte einfach sein müssen.
Und dann hatte sie sein Geist zum Friedhof gelockt.
Er war als Dämon wieder zurückgekehrt und hatte sie verfolgt.
May war die Flucht gelungen. Und dann...
»Wieso kam es nicht dazu? Sprich!« Die brutale Stimme unterbrach ihre Gedanken.
May Harris antwortete auch diesmal gegen ihren Willen:
»Ich traf einen Mann mit Namen Mark Tate!«
Einen Moment lang herrschte atemlose Spannung, herrschte Schweigen.
*
»Wer ist Mark Tate?« bohrte der Optiker im Namen der Schwarzen Mächte.
»Er ist ein Londoner Privatdetektiv, der sich dem Kampf gegen den Einfluß Schwarzer Mächte auf die Geschicke der Menschen verschworen hat.«
»Operiert er allein?«
Einen Moment lang erfolgte keine Antwort. Dann kam es monoton und gepreßt: »Nein, er hat Freunde: Don Cooper, ebenfalls ein Londoner, Lord Frank Burgess von Schloß Pannymoore. Sie sind neben mir seine engsten Vertrauten. Auch Tab Furlong, Chefinspektor von New Scotland Yard, kann man zu diesem Kreis zählen. Und seine Frau Kathryn.
Mark Tates wichtigstes Hilfsmittel jedoch ist der sogenannte Schavall.«
Jetzt sprudelten die Worte nur so aus ihr heraus. Hatte sich der Block endgültig gelöst? Wer hatte ihn eigentlich errichtet? May selbst?
»Der Schavall ist ein besonderer Stein, der wahrscheinlich aus reiner magischer Energie besteht. Unglaubliche Kräfte wohnen in ihm, die jedoch niemand bewußt steuern kann und die sich oft selbständig machen und zuweilen auch gegen Mark Tate selbst, den Besitzer des Schavalls, gerichtet sind. Es ist Mark noch nicht gelungen, auch nur einen Teil der Geheimnisse zu lösen, die das Dämonenauge umgeben. Ja, das ist sein Beiname: Dämonenauge. In der Tat wirkt der Stein wie eine rote Pupille, während die Einfassung das Auge bildet.«
»Und er war es, der den Meister endgültig vernichtete?« Haß sprach aus diesen Worten. Der Optiker zitterte vor Wut. Er machte Anstalten, auf die hilflose May Harris einzuschlagen, beherrschte sich jedoch im letzten Moment.
Ahnungslos antwortete May: »Ja, er war es, und seine Freunde halfen ihm dabei. Ohne sie hätte er es nie geschafft - ohne sie und Kathryn Furlong, der Ehefrau des Chefinspektors.«
»Dann soll er dafür büßen - im Namen unseres Meisters!« schrie der Optiker.
Seine Rechte öffnete sich, schnellte vor, berührte Mays Stirn. May Harris schrie auf vor Schmerzen. Als sich die Hand zurückzog, befand sich auf ihrer Stirn ein Mal.
Ich stand stocksteif vor Schrecken. Auch jetzt griff ich nicht ein. May Harris sank schlaff auf dem Stuhl zusammen.
Sie hatte das Bewußtsein verloren.
Ich schaute nach dem Optiker. Wie von Sinnen tanzte dieser herum.
Plötzlich warf er die Arme hoch, richtete seinen Blick gegen die Decke.
»Meister, jetzt weiß ich, warum du mich nicht mehr hörst und warum es dir versagt ist, mir Signale zu senden. Lange Zeit harrte ich hier aus, gemäß deinem Auftrag. Ich wartete auf dich, ohne daß du ein Zeichen gabst. Ich weiß nun, warum das so war. Die Freunde von May Harris haben dich vernichtet. Ich aber werde dein Erbe antreten und furchtbare Rache nehmen. Die Macht, die du hinterlassen hast, liegt bei mir in guten Händen. Ich werde mich deiner würdig erweisen. - Sieh hin und erkenne dich selber!«
Eine furchtbare Verwandlung ging mit dem Optiker vor. Hatte er trotz allem noch wie ein Mensch gewirkt, so änderte sich das sehr rasch.
Seine Konturen verschwammen. Der Optiker wurde zu einem grauenvollen Geschöpf.
Ein weißer Umhang bedeckte seinen Körper. Die Kapuze war tief in die Stirn gezogen. Darunter wurde ein Knochenschädel sichtbar. In den leeren Höhlen nistete das nackte Grauen. Auch Hände und Füße waren nur noch blanke Knochen.
Jetzt war es vollzogen. Der Optiker hatte die Gestalt seines Meisters angenommen.
War es ihm tatsächlich gelungen oder war das hier nur ein weiteres Trugbild, erzeugt durch die Kräfte der Schwarzen Magie, damit ihr Verbündeter seinem Meister ähnlich wurde?
Das Schauerwesen wandte sich May Harris zu. Sofort erwachte sie aus ihrer Bewußtlosigkeit. Aus weit aufgerissenen Augen starrte sie die Gestalt an.
Die Ohnmacht, nicht eingreifen zu können, brachte mich schier zur Raserei. Aber ich mußte Zurückhaltung üben. Gegen die Macht, die sich hier konzentrierte, war ich absolut hilflos. Ich konnte nur beobachten und Informationen sammeln.
Wie ein Dieb würde ich mich danach davonschleichen, um Unterstützung zu mobilisieren.
Hoffentlich gelang mir das auch. Hoffentlich gab es überhaupt ein Entrinnen für mich, und hoffentlich war ich nicht längst schon Gefangener gleich May.
Der Unheimliche widmete sich wieder meiner Freundin. Er wollte mehr erfahren über meine Person.
Und May erzählte bereitwillig, was sie über mich wußte.
Und dann wurde sie zum Aufstehen aufgefordert. Gemeinsam gingen die beiden auf eine Verbindungstür zu, die ich erst jetzt entdeckte. Sie verschwanden dahinter.
Ich schlich mich in den Raum, blickte mich kurz um.
Er war karg eingerichtet. Es gab einen großen Bücherschrank, einen Aktenschrank mit gläsernen Türen, einen Schreibtisch, vor dem sich die Szene abgespielt hatte. Die Wände waren grau und hatten es seit langem nötig, gestrichen oder frisch tapeziert zu werden. Es roch unangenehm.
Die Zwischentür war nur angelehnt. Ich blickte durch das Schlüsselloch und sah eine typische Optikerwerkstadt. Der Unheimliche machte sich an irgendwelchen Werkzeugen zu schaffen. Dabei stellte ich fest, daß er sich wieder ein wenig zurückverwandelt hatte in ein menschliches Wesen. Also doch nur ein Trugbild, das langsam an Wirkung verlor?
Es war offensichtlich, was er beabsichtigte.
Das einzige, was den allgemeinen Eindruck störte, war der steinerne Tisch in der Ecke. Schwarze Kerzen waren darauf aufgestellt.
Der Optiker schliff die Gläser für eine neue Brille. Zwischendurch entzündete er die Kerzen und führte ein paar Rituale durch.
Dann war es soweit.
Unwillkürlich hielt ich den Atem an.
Die Brille war fertig, aber der Optiker verpaßte sie May Harris nicht sofort. Er ging damit zum Tisch und hielt eine Art Ansprache.
»Ich mußte warten, Meister, bis die Zeit gekommen war. So hast du es mir befohlen. In regelmäßigen Abständen muß die Brille von May Harris erneuert werden. Jetzt ist es wieder soweit. Deshalb ging mein Ruf hinaus und wurde von ihr gehört. Ich walte meines Amtes, um meine Rache vorzubereiten. Und die Kräfte, die du mir zur Verfügung gestellt hast, werden mit mir sein.«
Was redete er immer wieder von Kräften, die er dem Meister, also Edgar Harris, verdankte?
In der Tat schienen ungeheure Energien in dem Gemäuer ringsum zu schlummern, die auf den Optiker überflossen, wenn er es wünschte.
Was band sie eigentlich? Wie hatte es Edgar Harris geschafft, sie hier zu fesseln?
Ein unglaubliches Geheimnis, das es zu ergründen galt. Ja, es war sogar lebenswichtig für meine Freunde und mich - vielleicht auch für die gesamte Menschheit?
Der Optiker führte ein weiteres Ritual durch. Lange dauerte es nicht mehr. Dabei verwandelte er sich weiter zurück, bis er genauso aussah wie zuvor. Nichts ließ mehr an den Unheimlichen mit dem weißen Umhang erinnern.
Er nahm die Brille und ritzte Symbole hinein. Dabei zerkratzte er zwangsläufig die Gläser in einem Maße, daß die Brille wieder unbrauchbar wurde.
Er legte sie auf den steinernen Tisch, plazierte sie sorgfältig, faltete die Arme in der Art eines buddhistischen Mönches und verbeugte sich.
Ein greller Blitz zuckte auf, der in die Brille fuhr.
Der Optiker stand auf und nahm die Brille in die Hand. Er begutachtete die Gläser.
Ich hatte die eingeritzten Symbole sogar von meinem Standort aus sehen können. Jetzt schienen sie verschwunden zu sein.
Der Optiker bewegte sich mit theatralischen Gesten auf May Harris zu.
Erst jetzt wurde mir bewußt, daß ihre alte Brille inzwischen verschwunden war. Es schien, als hätte sie sich aufgelöst. Wann war das geschehen? Ich konnte mich nicht erinnern. Vielleicht während des Rituals? Er setzte May die Brille auf. Dabei löste sich die Tätowierung von ihrer Stirn und flatterte wie ein aufgeregter Vogel durch die Luft, bewegte sich auf den Altar zu und verschwand.
Der Optiker bog sich vor Lachen, und dieses Lachen klang so schaurig, daß es mir den Schweiß aus allen Poren trieb.
May Harris verlor den starren Gesichtsausdruck. Leben kehrte in ihre Züge zurück.
Und dann fiel sie in sein Lachen ein.
*
Was hatte das alles zu bedeuten?
Ich zog mich zurück, hörte das irre Gelächter nebenan und zweifelte ernsthaft an meinem Verstand.
Es war klar, daß die Brille magisch präpariert war. Warum war das geschehen? Was sollte es bei May Harris bewirken? War Sie jetzt eine Verbündete der Unheimlichen? Und vorher? Die Brille, die sie vorher gehabt hatte, war doch offensichtlich ebenfalls präpariert gewesen. Vielleicht hatte sie deshalb die Dämonenbanner in meiner Wohnung nicht ertragen können?
Ich vermochte es nicht zu sagen, befürchtete jedoch das Schlimmste.
Es war an der Zeit, daß ich mich zurückzog. Ich wußte genug, wandte mich dem Laden wieder zu.
Ich kam nur bis zur Tür, als abrupt das Gelächter abbrach. Im selben Augenblick klangen Schritte im Laden auf, schwere Schritte, die genau auf mich zukamen. Ich glaubte, asthmatisches Keuchen zu hören.
Verzweifelt schaute ich mich nach einer Deckung um.
Jetzt trat der Optiker aus dem Nebenraum, mit May in seiner Begleitung.
Es schien keinen Ausweg mehr für mich zu geben.
Die Tür zum Laden stand offen. Die Schritte waren heran.
Im letzten Augenblick konnte ich hinter dem Türblatt verschwinden.
Jetzt traten auch May Harris und der Optiker ein. Sie konnten mich nicht sehen, und ich wagte kaum zu atmen.
Aufmerksam spähte ich durch den Spalt zwischen Türblatt und Türrahmen.
Die Schritte verstummten. Ich hörte scharfes Schnauben, konnte jedoch niemanden sehen.
Niemanden?
War da nicht ein dunkler Schatten?
Mehr nicht. Nur ein Schatten!
Das war kein Mensch, der hier stand. Ein Geisterwesen, nicht von dieser Welt.
Der Optiker blieb vor dem Durchgang zum Laden stehen. Er sagte etwas, was ich nicht verstehen konnte. Es war einer Sprache entliehen, die mir fremd war.
Abgrundtiefes Stöhnen war die Antwort, was mir die Haare zu Berge trieb. Es verstummte so plötzlich wie es entstanden war, und dann lachte der Optiker heiser.
Ich sah ihn nicht, lauschte nur gebannt.
May trat zu ihm.
»Du bist mächtig, Maurice Vernier«, flüsterte sie ehrfürchtig, »sehr mächtig!«
Sein Gelächter schwoll an.
»Ja, du hast recht, May Harris, und kein Sterblicher sollte es wagen, mit mir den Kampf aufzunehmen.«
Der Schatten im Türrahmen bewegte sich. Er flackerte wie eine schwarze Flamme, und dann blähte er sich auf. Ein Gluthauch wehte raubte mir den Atem. Ich spürte, wie etwas über mein Gesicht tastete, in Nase und Mund eindrang, mein Inneres aufzuzehren begann.
Verzweifelt rang ich nach Luft. Ich stieß einen Fluch der Weißen Magie aus.
Dies geschah mehr unbewußt. Es war die einzige Möglichkeit für mich, dem Zugriff des Unsichtbaren zu entgehen.
Schlagartig ließ der Schatten von mir ab.
Ich stieß die Tür zu, die gegen den Optiker prallte, den May Harris Maurice Vernier genannt hatte.
Doch er stand wie ein Fels. Die Tür konnte ihm nichts anhaben. Noch immer lachte er. Es klang häßlich und schauerlich.
Ich verließ meine Deckung.
Sein Gesicht war zur grausamen, abstoßenden Maske verzerrt. Ein Glühen war in seinen Augen.
Der Schatten flackerte, raste plötzlich auf mich zu.
Maurice Vernier machte ein paar Gesten mit der Hand. Gleichzeitig manifestierte sich der Geist zu einem Horrorgeschöpf. Heißer Atem blies mir ins Gesicht. Ich riß abwehrend die Hände hoch, doch sie fuhren durch leere Luft.
Abermals gab ich Beschwörungsformeln der Weißen Magie von mir.
Es nutzte. Der Geist wurde zurückgetrieben.
Doch erneut aufbrausendes Gelächter Verniers war der Beweis, daß ich den Kampf längst nicht gewonnen hatte.
Er berührte den Schatten mit der rechten Hand, woraufhin sich dieser auflöste wie eine zerplatzende Seifenblase. Dann hob er die Arme. Blitze zuckten aus seinen Augen, trafen mich.
Ich stöhnte auf. Unglaubliche Pein durchraste meinen Körper. Ich krümmte mich zusammen, verlor den Boden unter den Füßen, landete auf dem schmutzigen Parkett.
Meine Hände suchten vergeblich nach einem Halt. Ich verlor den Kontakt mit der Wirklichkeit.
3
May Harris wohnte dem Ganzen ohne innere Anteilnahme bei.
Maurice Vernier zeigte all seinen Triumph.
»Lächerlich«, keifte er. »Wie konnte eine solch niedere Kreatur wie Mark Tate der Welt der Geister und Dämonen so großen Schaden zufügen? Er ist ein Sterblicher und hat sich als solcher zu beugen.« Er wandte sich an May. »Was ist mit den anderen?« Langsam, wie in Zeitlupe, wandte sie ihm das Gesicht zu. »Ich bin bereit, mein Meister«, sagte sie monoton.
Er nickte zufrieden. »So wende dich diesem Don Cooper und auch Lord Frank Burgess zu. Es scheint mir wichtig, ihnen zunächst einmal unsere Aufmerksamkeit zu widmen. An Chefinspektor Tab Furlong und seine Frau können wir später denken. Ihr Part wird noch kommen, schätze ich.«
Er hob die Arme über den Kopf, breitete sie aus und rief ein paar Beschwörungen.
Sofort trat die Wirkung ein.
Konturenlose Wesen sprangen in die Mitte des Raumes. Ein Raunen lag in der Luft.
Ein Großteil des Lichtes, das die Deckenbeleuchtung spendete, wurde verschluckt. Die Augen des Optikers und Magiers glühten.
Er ließ die Arme wieder sinken und schaute zu, wie sich seine Horrorgeschöpfe um den leblosen Körper von Mark Tate kümmerten. Er schwebte empor, bis er sich einen Yard über dem Boden befand. Sein Gesicht war grauenverzerrt, die Augen geschlossen. Die gnädige Bewußtlosigkeit, die ihn überkommen hatte, schützte seinen Verstand vor der völligen Zerstörung.
Im Moment hatte der Magier wenig Interesse an ihm. Er hatte anderes zu tun.
Hier war er sozusagen auf dem Abstellgleis gewesen. Erst durch May Harris, die er nur gerufen hatte, weil die Zeit dafür reif gewesen war, hatte er von den Dingen erfahren, die sich inzwischen abgespielt hatten. Er würde alles wieder in den Griff bekommen. Nicht umsonst hatte ihm einst Edgar Harris - der mächtige Edgar Harris - ein solches Machtpotential überlassen, denn das Gebäude barg in der Tat ein Geheimnis. Maurice Vernier würde die Mittel zu nutzen wissen, die ihm zur Verfügung standen.
Mark Tate schwebte hinaus, durchquerte den Laden.
Maurice Vernier gönnte ihm keinen Blick mehr. Er wußte, was mit dem Londoner Privatdetektiv geschehen würde.
Abermals wandte er sich an May Harris.
»Du weißt, was du zu tun hast. Vor allem ist es wichtig, den Schavall in unseren Besitz zu bekommen. Er ist, so glaube ich, von unschätzbarem Wert. Ohne ihn ist dieser Mark Tate ein Nichts, ein Niemand, der hilflos ist gegenüber dem, was die Welt der Dämonen zu bieten hat.«
May Harris nickte gehorsam.
Leben kehrte in sie zurück. Ihr Gesicht bekam wieder Farbe. Beinahe wirkte sie normal. Nur wer um die Dinge wußte, erkannte, daß es nicht so war.
»Ja, Meister!«
Sie drehte sich herum und ging. Dabei bewegte sie sich wie immer.
Sie durchquerte den Laden und betrat den Gang zur Hintertür. Licht brauchte sie keines anzumachen. Sie kannte sich auch in der Dunkelheit aus.
Die Hintertür öffnete sich vor ihr, obwohl niemand sie berührt hatte.
May Harris kam in den schmutzigen Hof. Wie witternd hob sie den Kopf, entschied sich für eine bestimmte Richtung.
Sie wußte ganz genau, wo der Schavall zu finden war. Sie hatte ihn geortet - besser gesagt die Macht, die sie beherrschte und der sie jetzt gehörte.
Mit dem Fuß stocherte sie in dem Papierabfall hinter den Mülltonnen herum. Der Schavall strahlte so intensiv, daß die Helligkeit einen rötlichen Schein verbreitete, der an Intensität stetig zunahm.
May Harris blickte direkt in den strahlenden Punkt hinein.
Plötzlich wurde ihr schwindlig.
Sie wollte sich nach dem Schavall bücken, wollte ihn an sich nehmen.
Es blieb bei der Absicht. Die Glieder folgten nicht mehr ihrem Willen. Der rötliche Schein tastete ihren Körper ab, drang durch die Kleidung, prickelte auf ihrer Haut wie tausend feine Nadelspitzen, erreichte ihren Kopf und nahm Besitz von ihren Augen. Glutrot wurden sie.
Schmerzen entstanden in ihrem Kopf.
Lichtkaskaden zuckten vor ihrem geistigen Auge, gleißend hell.
Ihr Bewußtsein flackerte, wollte sich von der schrecklichen Macht befreien, die sie beherrschte.
Einen Moment lang sah es aus, als würde sie diese Macht auch tatsächlich überwinden.
Ein letztes Aufbäumen.
Und dann schien eine Riesenfaust zuzuschlagen.
May Harris wurde mehrere Yards frei durch die Luft geschleudert. Die Verbindung mit dem roten Glühen des Schavalls riß.
May fiel zu Boden und blieb leblos liegen.
*
Maurice Vernier zuckte zusammen. Sein Gesicht verzerrte sich zur schmerzvollen Grimasse. Ein heiseres Knurren entrang sich seiner Kehle. Er ballte die Hände zu Fäusten und biß die Zähne zusammen.
Ein eigenartiges Knistern lag plötzlich in der Luft, als würden unglaubliche Energien übertragen.
Nein, Maurice Vernier war nicht selber ein Dämon. Er war im Grunde genommen ein Mensch geblieben - aber einer, der es verstand, die Kräfte des Jenseitigen anzuzapfen. Daß ihm das gelang, verdankte er Edgar Harris. Er war dem Magier und späteren Dämon immer sehr ergeben gewesen. Das hatte sich jetzt ausgezahlt.
»Der Meister hat mich mit ewigem Leben für meine Dienste belohnt«, murmelte er tonlos vor sich hin. »Ich habe sein Erbe nunmehr angetreten und werde es zu verteidigen wissen.«
Vernier konzentrierte sich wieder auf das, was zur gleichen Zeit im Hof passierte.
Vor seinem geistigen Auge erschien May Harris, die scheinbar ohne Leben war.
Die dämonischen Kräfte in ihr hatten sich gegen den Schavall zur Wehr gesetzt. Der Sieger hatte praktisch schon von vornherein festgestanden. Nein, einem Amulett wie dem Schavall konnte man nichts entgegensetzen.
Maurice Vernier erkannte das mit aller Deutlichkeit. Deshalb hatte er blitzschnell eingegriffen, die dämonischen Kräfte abgeschottet, die das Haus beherrschten und an das sie gebunden waren.
Der Kampf war dadurch beendet worden. Keine magische Energie wandte sich nunmehr gegen den Schavall, um ihn abzuwehren.
Das Ergebnis war allerdings auch gewesen, daß May Harris durch die Luft geschleudert worden war...
Jetzt wandte sich der Optiker und Magier der aparten Frau wieder zu. Er erforschte ihr schlafendes Bewußtsein.
Die dämonische Macht des Hauses wollte mit der ihr eigenen Brutalität zugreifen, aber Maurice Vernier hielt sie rechtzeitig zurück. Er wollte nicht, daß May Harris Schaden zugefügt wurde. Dafür war sie im Moment noch zu wertvoll. Erst mußten die Freunde von Mark Tate ausgeschaltet werden. Das war vorrangig, denn es bestand die Gefahr, daß sie durch Mark Tates Verschwinden mißtrauisch wurden und begannen, Maßnahmen zu ergreifen. Erst wenn die Gefahr aus dieser Richtung beseitigt war, konnte es sich der Magier leisten, andere Probleme zu lösen. Er würde seine Macht systematisch ausbauen und eines Tages so mächtig sein, daß er erheblichen Einfluß auf die Geschicke der Menschheit nehmen konnte.
Das war sein Fernziel. Und wie es im Augenblick aussah, würde er das auch erreichen.
Er weckte May Harris. Sie wurde wieder von den geistigen Kräften des Hauses beherrscht und stand auf. Bei ihrem Sturz hatte sie Glück gehabt. Es war ihr wenig passiert, und die Prellungen, Hautabschürfungen und dergleichen, die sie sich zugezogen hatte, wurden durch die magischen Kräfte rasch geheilt.
Sie näherte sich zum zweiten Male dem Schavall, von Maurice Vernier motiviert, der alles mitbekam, als wäre er sie selber.
Kurz vor dem Dämonenauge blieb sie stehen.
Der Schavall glühte leicht. Er reagierte auf die Anwesenheit der dämonischen Kräfte. Aber da nichts direkt auf ihn einwirkte, blieb er neutral, griff er May Harris nicht an.
Maurice Vernier war unschlüssig. Was sollte er mit dem Dämonenauge anfangen?
Er beriet sich mit der verbündeten Macht.
Im Haus wisperte und raunte es. Die Wände knackten vernehmlich.
Dann wurde die Entscheidung gefällt.
Maurice Vernier verließ seinen Laden durch die rückwärtige Tür und trat auf den Hof hinaus.
May Harris wandte ihm den Rücken zu. Unsichtbare Bande gab es zwischen ihnen beiden. May bewegte sich nicht von der Stelle. Wie gebannt starrte sie auf den Schavall, und Maurice Vernier schaute durch ihre Augen und sah: Der Schavall begann schlagartig, intensiv zu glühen, als würde er jetzt doch zu einem Angriff ansetzen.
Maurice Vernier spürte, wie sich seine Nackenhaare sträubten. Er bekam auf einmal einen gehörigen Respekt vor dem Dämonenauge.
Zum wiederholten Male verfluchte er die Tatsache, sich nicht auf direktem Wege wehren zu können. Es mußte ihm gelingen, das magische Amulett zu neutralisieren. Dann würde es keine Wirkung mehr haben und nicht mehr das beeinträchtigen, was innerhalb des Hauses und seiner Sphäre geschah.
Maurice Vernier dirigierte May zur Seite und nahm ihren Platz ein.
May stand jetzt zwei Schritte abseits, und die unbekannte Macht gab durch sie dem Magier Schützenhilfe.
Eine Dunstglocke bildete sich über dem Schavall. Sie wurde aus dem Nichts geschaffen.
Die Wirkung ließ noch auf sich warten. Das Dämonenauge reagierte überhaupt nicht darauf.
Immer deutlicher wurde die Glocke sichtbar. Die wallenden Nebelfetzen beruhigten sich, formierten sich.
Jetzt war der Schavall nicht mehr zu sehen.
Dann wurde die Glocke durchsichtig, war sie nicht mehr als nur ein leichtes Flimmern in der Luft.
Der Schavall glühte noch stärker. Die Glocke aus magischer Energie senkte sich herab, verengte sich gleichzeitig. Mehr und mehr formte sie sich zu einer Kugel, die mit ihrer Schale den Schavall umgab.
Aber auch diese Form war nicht endgültig.
Allmählich nahm sie die Gestalt des Dämonenauges an. Die Konturen wurden immer feiner nachgezeichnet, bis sich die Kugel genau angepaßt hatte. Sie umgab jetzt den Schavall wie eine zweite Haut und war von ungewöhnlicher Stärke.
Doch der Schavall wurde nicht direkt beeinflußt. Deshalb setzte er sich auch nicht zur Wehr.
Die Sphäre, die ihn nun umgab, hüllte ihn berührungslos ein.
Erleichtert richtete sich Maurice Vernier auf. Er hatte es geschafft. Jetzt würde ihnen der Schavall nicht mehr gefährlich werden können. Später würde Vernier versuchen, ihn von einem unbeeinflußten Menschen entfernen zu lassen. Aber das hatte jetzt Zeit. Anderes war viel dringender. Er wollte es endlich hinter sich bringen.
Er sah May Harris noch nicht einmal an. Aber sie wußte auch so, was ihre Aufgabe war.
Wortlos ging sie an Maurice Vernier vorüber, der wieder das Haus betrat.
Der Schavall hatte sich beruhigt. Er lag wie ein kitschiges Amulett, das jemand achtlos weggeworfen hatte, von einem Haufen Papierabfälle verborgen hinter den Mülltonnen. Niemand würde ihn sehen können, auch wenn er direkt daran vorbeiging.
Maurice Vernier und die mit ihm verbündete geheimnisvolle Macht hatten ganze Arbeit geleistet, was ihn betraf.
Doch Vernier war auch klar, daß es von Vorteil sein würde, wenn er mehr über dieses Amulett erfuhr. Niemand anderes als Mark Tate würde ihm dabei Rede und Antwort stehen müssen.
Er gratulierte sich zu dem Entschluß, ihn nicht zu vernichten, sondern erst einmal gefangenzunehmen.
Sofort ging er zum unterirdischen Verlies des Teufelsjägers, der sich immer noch in einem komaähnlichen Zustand befand.
Vernier mobilisierte die Kräfte, die ihm zur Verfügung standen, und konzentrierte sich auf Mark Tate. Der Teufelsjäger glitt in eine Art Hypnoschlaf hinüber, der dazu diente, seinen Geist zu öffnen.
Seltsam, es gelang Vernier nicht.
Das irritierte den Magier im höchsten Maße. War es ihm nicht ein Leichtes gewesen, den Teufelsjäger zu überwältigen? Und wieso war es ihm jetzt nicht möglich, seinen Geist vollends in Besitz zu nehmen?
Da war mehr als nur die Macht des Schavalls, die Mark Tate zur Seite stand. Da war etwas mit seinem Geist, das ihn erheblich von einem normalen Sterblichen unterschied. Es bedeutete zwar keine direkte Macht, aber etwas anderes:
Es war, als würden seine magischen Sinne den Geist eines Unsterblichen berühren, wenn Vernier sich mit Mark Tate beschäftigte! Niemand würde Mark Tate vernichten können. Vielleicht seinen Körper, ja, aber niemals seinen Geist, denn dieser war den Mächten des Guten geweiht, und selbst der Beeinflussung dieses Geistes waren Grenzen gesetzt.
Noch einmal gratulierte sich der Magier zu dem Entschluß, den Teufelsjäger nicht zu vernichten. Er hätte nur diesen Körper vernichtet, aber der Feind wäre geblieben, um vielleicht eines Tages Mittel und Wege zu finden, sich an ihm zu rächen - in welcher Form auch immer!
Vernier wußte nicht genau, was das eigentliche Geheimnis von Mark Tate war, und ahnte auch, daß es ihm niemals gelingen würde, dieses Geheimnis vollends zu lösen, aber er würde sich damit doch noch beschäftigen müssen - dann, wenn die Zeit gekommen war.
Jetzt mußte er sich zunächst einmal um sein Erbe kümmern. Schließlich hatte er erst erfahren, daß er das Erbe des Dämons Edgar Harris überhaupt anzutreten hatte...
*
Irgendwo war ein fernes Licht. Ich irrte durch finstere Räume auf der Suche nach der Wirklichkeit. Das Licht lockte und forderte. Ich bewegte mich unwillkürlich darauf zu.
Doch dann zögerte ich. Beklemmung wurde in mir wach - Beklemmung und Angst - Angst vor der Realität des Erwachens.
Ich stöhnte auf, und dieses Stöhnen kehrte über den Umweg meiner Ohren zu meinem Verstand zurück, trieb mich weiter dem Licht zu.
Ich ruderte mit den Armen, begann zu schreien, und plötzlich begann ich, mich nach dem Licht zu sehnen, mich eher zu fürchten vor der Finsternis des Vergessens, denn unsichtbar schien da ein Dämon zu hocken, der auf mich lauerte...
Schreiend fuhr ich von meinem Lager auf. Das Licht entpuppte sich als nackte Birne, die an der Decke pendelte und unruhigen Schein verbreitete.
Verständnislos schaute ich mich um.
Der Raum war klein und beengte mich. Das Lager war primitiv. Kratzende Decken lagen darauf. Die Wände waren grau und beschmutzt. Ein Fenster fehlte. Außer dem primitiven Bett waren nur noch ein Tisch und ein Stuhl vorhanden. Auf dem Tisch stand eine verbeulte Waschschüssel aus Metall.
Ich versuchte, mich zu erheben. Es gelang mir nur mit Mühe, ich fühlte mich wie gerädert.
Ich erinnerte mich an den Traum, den ich gehabt hatte, in dem ich gefangen war in unergründlicher Finsternis. Es schauderte mich. Was war geschehen?
Nur allmählich sickerte die Erinnerung in mein Bewußtsein. Der Optiker und May Harris! Es durchzuckte mich wie ein Blitz, weckte meine Lebensgeister. Ich war überwältigt worden! Nein, gegen diese Allmacht hatte ich keine Chance gehabt. Für den Optiker war es eine Kleinigkeit gewesen, meiner habhaft zu werden. Ab wann hatte er von meiner Anwesenheit gewußt? Ich vermochte es nicht zu sagen, aber es war letztlich ohne Bedeutung. Wichtiger war es, den Blick in die Zukunft zu richten, den Versuch zu machen, diesem Gefängnis hier zu entrinnen, denn daß es sich um ein Gefängnis handelte, daran gab es keine Zweifel.
Man hatte mich in eine Art Verlies gesteckt. Warum gab man sich mit mir eigentlich so viel Mühe? Warum war mir nicht das gleiche passiert wie May Harris? Auch darauf wußte ich keine Antwort.
Nur eine Tür führte aus dem schmalen, unterirdischen Raum. Sie bestand aus dicken Eichenbohlen. Eine Türklinke oder ein Schloß waren nicht erkennbar.
Ich ging hinüber und drückte dagegen.
Die Tür ließ sich nicht öffnen,
Ich steigerte den Druck, begann, gegen das Holz zu hämmern. Draußen hallte es dumpf wider. Das Echo pflanzte sich fort und verlor sich in der Ferne.
Meine Bemühungen blieben ohne Erfolg. Ich mußte es aufgeben.
Meine Hände tasteten über die Wände. Gefesselt hatte man mich gottlob nicht.
Wie konnte ich die Flucht schaffen?
Es erschien aussichtslos, aber ich gab die Hoffnung erst auf, als ich jeden Winkel untersucht hatte. Die Wände waren aus dicken Steinquadern errichtet. Was jenseits dieser Mauern lag, ahnte ich nicht einmal.
Die Schwarzen Mächte hatten über mich triumphiert. Aber ich fragte mich, warum sie sich nicht mehr weiter mit meiner Person beschäftigten.
War es eine Art Ruhe vor dem schrecklichen Sturm?
Welche Teufelei hatte man noch mit mir vor?
*
Ich hatte mich wieder auf dem Lager ausgestreckt und die Augen geschlossen. Ich dachte an den Schavall. Ja, er war meine einzige Möglichkeit, von hier wegzukommen.
Ich konzentrierte mich auf ihn. Auch wenn er nicht direkt bei mir war, gab es eine lose Verbindung zwischen uns.
Reichte sie aus, den Schavall herbeizurufen?
Ich versuchte es immer wieder - jedoch ohne Erfolg. War die Verbindung doch gerissen? Oder waren die abschirmenden Kräfte ringsum einfach nur zu stark?
Ich gab es nach einer Weile auf.
Gerade als ich das Lager wieder verlassen wollte, durchzuckte mich ein brennender Schmerz.
Im nächsten Augenblick hatte ich das Gefühl, man hätte mir etwas entrissen - etwas, was mir gehörte.
Es dauerte eine Weile, bis ich begriff:
Jetzt erst war die Verbindung zwischen mir und dem Amulett endgültig gerissen. Es war dem Gegner längst gelungen, den Schavall auszutricksen. Deshalb hatte ich ihn nicht mehr rufen können.
Es schmerzte mich.
Hatte man sich nur deshalb nicht näher mit mir beschäftigt, weil man sich vor dem Eingreifen des Schavalls gefürchtet hatte? Es war eine Möglichkeit. Aber wenn dem so war, dann würde ich mich jetzt in großer Gefahr befinden.
Allerdings: Wieso konnte ich denn so sicher sein, daß man sich bisher nicht um mich gekümmert hatte? Ich war schließlich ohne Bewußtsein gewesen!
Ein leises Gelächter wehte zu mir hin. Ich erschrak und blickte in die Runde. Woher war der Laut gekommen? Von draußen?
Wieder dieses leise Gelächter, das aus der Ecke des Verlieses zu kommen schien. Etwas bewegte sich.
Mit gemischten Gefühlen trat ich näher heran.
Eine Spinne kam mir träge entgegengekrabbelt.
Das Gelächter wiederholte sich, diesmal eindringlicher. Ich war einen verrückten Moment lang davon überzeugt, nur die Spinne könnte es ausgestoßen haben.
Ich fuhr herum.
Aus dem Nichts schälten sich die Konturen eines Menschen.
»Ich habe bemerkt, daß du längst schon erwacht bist. Bald werde ich mehr Zeit für dich haben, Mark Tate. Übe dich inzwischen in Geduld. Vielleicht läßt sich doch noch etwas anfangen mit dir? Ich brauche Sklaven für die Armee, die ich aufbauen werde. Leider können wir dieses Gemäuer nicht verlassen und sind auf Verbündete angewiesen. Wenn wir deiner Freunde habhaft geworden sind, nehmen wir die Sache in Angriff.«
»Warum hast du May Harris ausgeschickt und nicht mich?«
»Ich wollte keine unnötige Zeit verlieren, und sie ist mir sicherer. Sie wird nichts falsch machen und ihrer Rolle voll gerecht werden. Dich hingegen hätte ich sorgfältig vorbereiten müssen. Das ersparte ich mir. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, nicht wahr?«
»Wie lange schon hast du Macht über meine Freundin, und warum habe ich nie etwas davon gemerkt? Selbst der Schavall hat nie darauf reagiert.«
Die schattenhafte Gestalt bog sich förmlich vor Lachen. Gleichzeitig verblaßte die Erscheinung. Die schauerlichen Laute verloren sich. Ich war wieder allein - allein mit meinen Gedanken, allein mit meinem Bangen um die Zukunft und unser aller Schicksal.
Der Magier hatte mir seine Überlegenheit demonstriert.
War ich ihm wirklich auf Gedeih und Verderb ausgeliefert?
Ich lauschte in mich hinein, aber da war keinerlei Resonanz.
Ich setzte mich auf die karge Liege.
4
Don Cooper war hochgewachsen, hatte die Figur eines griechischen jungen Gottes. Er hielt viel von Sport, und es gab kaum eine Sportart, in der er nicht zu Hause war. Das schmale Oberlippenbärtchen gab ihm das Aussehen eines Don Juan. In der Tat brauchte er sich über Erfolg beim schwachen Geschlecht nicht zu beklagen.
Mark Tate war manchmal nicht gerade erfreut darüber. Er hatte in dieser Hinsicht etwas andere Vorstellungen, aber er akzeptierte und tolerierte andererseits die Lebensweise seines Freundes.
Don Cooper war der geborene Abenteurer. Ausgerüstet mit einem guten finanziellen Polster hatte er jahrelang die ganze Welt bereist. Erst seit er an der Seite von Mark Tate gegen die Kräfte des Bösen kämpfte, war er ein wenig seßhafter geworden.
An diesem Abend erwartete Don Cooper Besuch - weiblichen Besuch.
Er blickte auf seine Armbanduhr. Es war kurz vor neun. Eigentlich hatte Betty Miles schon um acht kommen wollen. Don Cooper ärgerte sich, denn nichts haßte er mehr als Unpünktlichkeit.
Er saß vor dem Fernseher, ohne überhaupt zu sehen, was sich auf dem Bildschirm abspielte.
Da schlug das Telefon an.
Don Cooper betrachtete den Apparat wie einen Feind. Ob es Betty Miles war? Vielleicht war etwas dazwischen gekommen?
Viel wußte er über Betty nicht. Sie war eine Neueroberung. Erst vorige Woche war er ihr zum ersten Male begegnet.
Don Cooper stellte das Whiskyglas zurück, an dem er gerade hatte nippen wollen, und stand auf. Nach dem vierten Läuten hob er ab.
»Du bist es, Don?« hörte er eine weibliche Stimme. Nein, das war nicht die von Betty Miles.
»May?« fragte Don überrascht.
»Ja, Don. Bist du allein?«
»Was gibt es?«
»Erst muß ich wissen, ob du allein bist!«
»Ja, ich erwartete Besuch, wurde aber versetzt«, knurrte Don. Gern hatte er es nicht zugegeben.
Was war mit May Harris? Ihre Stimme klang aufgeregt.
»Paß auf, Don, es ist etwas passiert. Ich kann es dir allerdings nicht am Telefon sagen. Besser, ich komme bei dir vorbei.«
Don schaute ein weiteres Mal auf seine Armbanduhr und wiegte bedenklich mit dem Kopf. Ob Betty Miles doch noch kommen würde? Egal! sagte er sich. Wenn May keinen dringenden Grund gehabt hätte, hätte sie sich nicht an ihn gewandt.
»Von wo aus rufst du an?«
»Von daheim.«
»Okay, du kannst kommen. Falls mein Besuch doch noch eintrifft, hat er Pech gehabt.«
May atmete erleichtert auf.
»Ich bin sofort bei dir«, versprach sie und hängte ein.
Don Cooper starrte nachdenklich auf den Hörer in seiner Hand. Irgendwie gefiel ihm die ganze Sache nicht. Was war mit May los?
Er überlegte kurz, dann drückte er mit dem Daumen auf die Telefongabel und wählte eine Nummer. Es war die Nummer von Mark Tate. Auf der anderen Seite läutete es. Aber es ging niemand dran. Don Cooper zuckte die Achseln und hängte wieder auf.
Inzwischen war neun Uhr überschritten. Er hatte die Hoffnung aufgegeben, mit Betty Miles einen langen Abend zu verbringen.
Don Cooper beschäftigte sich in Gedanken damit. Es lenkte ihn vom eigenartigen Benehmen Mays ab.
*
May Harris war zu Fuß zu ihrer Wohnung zurückgekehrt. Sie war dabei sehr schnell gegangen. Die geheimnisvolle Macht, die sie beherrschte, hatte sie nicht ermüden lassen. Nicht einmal ihr Atem hatte sich beschleunigt.
Tatsächlich hatte sie Don von ihrer Wohnung aus angerufen. Jetzt lief sie zum Parkplatz und setzte sich in Marks Minicooper. Damit fuhr sie zu Don Coopers Wohnung.
Don besaß ein Penthouse hoch über den Dächern von London. Eigentlich war es für eine Einzelperson viel zu groß, aber er liebte es, Platz um sich herum zu haben. Vor Jahren hatte er es gekauft. Erst in letzter Zeit war er dazu gekommen, es regelmäßiger zu bewohnen. Sonst war er gewissermaßen nur besuchsweise in London gewesen.
Gemeinsam mit seinem Bruder hatte er beim Tod seiner Eltern ein riesiges Vermögen geerbt. Dons Bruder war sehr geschäftstüchtig, weshalb er im Testament auch mit dem Fortführen der Geschäfte bedacht worden war. Don hingegen bekam monatlich eine bestimmte Summe, mit der er auskommen mußte. Aber auf seinen augedehnten Reisen hatte auch er eine Menge für die Geschäfte seines Bruders getan. Er verstand sich zwar mit ihm nicht sonderlich, aber es waren oftmals wichtige Verbindungen ins Ausland durch Don Cooper zustande gekommen.
Einmal hatte Mark Tate ihn nach dem Bruder gefragt, aber Don hatte nur ausweichend Antwort gegeben. Solange er sich wieder in London befand, hatte er Ronald nicht ein einziges Mal besucht.
May Harris erreichte ihr Ziel und stellte den Wagen in die Tiefgarage. Mit dem Fahrstuhl fuhr sie hinauf.
Fiebriger Glanz trat in ihre Augen. Ihre Lippen waren fest aufeinander gepreßt und bildeten schmale, weiße Striche.
Als der Fahrstuhl stoppte, zögerte sie einen Moment lang, als versuche ihr Ich, sich gegen die stummen Befehle des Unheimlichen zu wehren. Doch sie hatte keine Chance.
Sie verließ die Liftkabine und überquerte den kurzen Flur.
Don Cooper schien geahnt zu haben, daß sie bereits da war, denn er öffnete die Tür.
»He«, rief er aus, als er May sah. »Was ist eigentlich los mit dir? Warum hast du mir am Telefon...?« Weiter kam er nicht. Ein eigenartiges Strahlen brach aus den Augen von May Harris, raste auf Don zu, hüllte ihn sekundenlang ein.
Stocksteif stand er da, zu keiner Regung fähig. Das Strahlen wurde intensiver. Da bewegte sich etwas hinter ihm in der Wohnung. Eine junge Frau; sie war schlank, hellblond und - sehr wütend.
»Ist das die Frau, die du erwartest?« rief sie voller Zorn aus. Sie machte Anstalten, sich an Don Cooper vorbeizuschieben, aber dieser wich nicht von der Stelle. Da erst bemerkte die Blondine, was vor sich ging. Das Strahlen griff auch auf sie über. Sie schrie entsetzt auf und prallte zurück. Damit geriet sie aus dem Einflußbereich.
May Harris war einen Moment lang irritiert. Dieser Moment genügte Don Cooper.
Er ließ sich einfach nach hinten fallen. So geriet auch er aus dem direkten Einflußbereich.
May Harris stieß ein Fauchen aus, das an das zornige Gebaren eines Raubtieres erinnern ließ. Sie sprang vor.
»Betty!« brüllte Don Cooper. Er wollte aufspringen, doch die Beine versagten ihm den Dienst.
»Betty!« wiederholte er.
Betty Miles, die inzwischen doch gekommen war, warf sich - noch immer schreiend - herum und flüchtete tiefer in die Wohnung. Sie konnte sich zwar nicht erklären, was da vor sich ging, aber es erschien ihr besser, die Flucht zu ergreifen.
May Harris war heran. Don lag am Boden. Sein Körper war wie gelähmt.
May kümmerte sich nicht mehr um ihn. Sie setzte über ihn hinweg und Betty hinterher. Aber... wo war diese denn eigentlich abgeblieben?
Aufmerksam schaute sie sich um. Wohin hatte sich Betty Miles gewandt?
May Harris lief ins Wohnzimmer. Sie kannte sich recht gut hier aus.
Die Tür zur Terrasse stand sperrangelweit offen. Die Dachterrasse umschloß das Penthouse. Auch May nahm den Weg nach draußen.
Gerade verschwand die blonde Betty Miles um die nächste Ecke. May setzte ihr nach.
Betty stieg durch das offene Fenster ins Schlafzimmer und wollte zur Tür. Aber May Harris war schneller.
Abermals brach ein lähmender Strahl aus ihren Augen, holte Betty ein, ließ sie erstarren.
May Harris ging auf Betty Miles zu.
»Wer bist du?« fragte sie monoton.
»Betty Miles.«
»Was suchst du hier?«
»Ich war verabredet mit Don Cooper, verspätete mich allerdings.«
Betty antwortete gegen ihren Willen. Die Macht, die auf sie einwirkte, beeinträchtigte zwar nicht ihr Bewußtsein, aber ihre freie Willensentscheidung.
»Erzähle!« forderte May Harris auf. »Was weißt du über Don Cooper?«
»Nicht viel. Ich lernte ihn letzte Woche kennen und bin zum zweiten Male hier. Er war sehr ungehalten, als ich kam, sagte, daß er jemanden erwarte, eine Frau. Ich wurde eifersüchtig. Plötzlich waren Sie da.«
Das Strahlen wurde intensiver. Nur noch verschwommen waren die Umrisse von Betty Miles sichtbar. Dann erlosch es plötzlich. Bettys Augen wurden glasig.
»Du wirst alles vergessen, was du hier erlebt hast! Als du kamst, hatte Don eine andere Frau bei sich. Du hast ihm eine Szene gemacht und willst ihn nie mehr sehen! Auch anrufen wirst du nicht! Wütend bist du auf ihn! Er ist für dich erledigt - für alle Zeiten.«
»Ja«, antwortete Betty leise. Sie nickte. Und dann stolzierte sie mit steifen Schritten hinaus.
May Harris blickte ihr nach, bis sie das Penthouse verlassen hatte.
Da erst fiel der Besessenen auf, daß Don Cooper nicht mehr auf seinem Platz lag.
*
Don Cooper hatte alle Kräfte aufgeboten, zu denen er fähig war. Er wußte nicht, was mit May Harris passiert war, aber sie war gefährlich für ihn.
Betty konnte er nicht mehr helfen. Er hoffte, daß ihr nichts passierte.
Auf allen vieren bewegte er sich vorwärts. Die Adern schwollen auf seiner Stirn. So sehr strengte es ihn an.
Er erreichte die Tür neben dem Schlafzimmer. Dabei hörte er die Unterhaltung zwischen Betty Miles und May Harris.
Gottlob war die Tür nur angelehnt. Er hätte es nicht geschafft, sich soweit aufzurichten, um sie zu öffnen.
Hier hatte er seine Sammlung untergebracht. Der Raum neben dem Schlafzimmer war voll mit Andenken an seine Reisen. Er hielt zwar nicht viel von solchen Anhängseln, aber es handelte sich um Geschenke, die er nicht hatte abschlagen können.
Es befanden sich eine Menge Utensilien darunter, die Werkzeuge der Magie waren.
Don Cooper nahm ein kleines Krummschwert an sich. Es stammte aus Asien und hatte einst angeblich einem japanischen Samurai gehört, der in China den Tod gefunden hatte. Das Schwert sollte dem Samurai übernatürliche Kräfte verliehen haben. Erst durch einen mächtigen Gegenzauber wäre er besiegbar geworden.
Don hielt das Schwert mit beiden Händen fest und kroch zur Tür zurück.
Eben verließ Betty Miles das Penthouse.
May Harris stieß ein katzenhaftes Fauchen aus und wirbelte um die eigene Achse.
Blitze zuckten aus ihren weit aufgerissenen Augen.
Sie war mehr als nur eine gewöhnliche Besessene. Der Teufel persönlich schien sie geworden zu sein. War es denn sogar möglich, daß dies hier in Wahrheit ein Dämon war, der nur die äußere Gestalt von May angenommen hatte?
Die Blitze zuckten auf Don Cooper zu, fuhren in das Schwert - und verpufften wirkungslos.
Zum ersten Male erwies sich, daß die Legende um das Schwert einen wahren Kern hatte.
May Harris runzelte die Stirn. Dann machte sie auf dem Absatz kehrt und verließ die Wohnung.
Don Cooper blieb noch ein paar Sekunden liegen. Er konnte nicht begreifen, was geschehen war.
Allmählich wich die Lähmung aus seinem Körper. Er war in der Lage, wieder aufzustehen.
May Harris hatte die Wohnungstür hinter sich zugezogen. Don lief hinüber und lugte durch den Spion.
Eben setzte sich die Liftkabine in Bewegung. Sie sank abwärts. Der Flur vor der Tür schien leer zu sein.
Don starrte auf das Schwert in seiner Hand. Er konnte sich nicht vorstellen, daß die Wirkung der Waffe so groß gewesen war, daß sie May Harris zur Flucht veranlaßt hatte.
Er öffnete die Tür nach draußen.