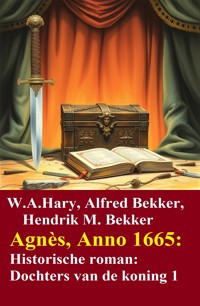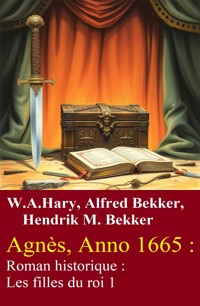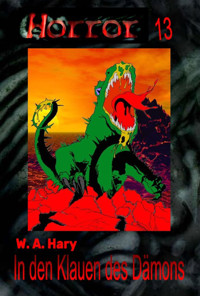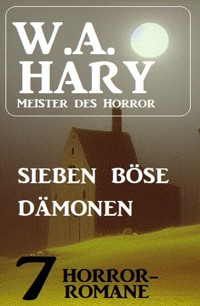9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Kompilationen sind Sammlungen mehrerer Romane in einem Buch. Das gibt es auch für die Serie TEUFELSJÄGER Mark Tate. Zum Beispiel jetzt krachneu sowohl als eBook als auch gedruckt:
TEUFELSJÄGER: Die 7. Kompilation
- A. Hary: „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 31 bis 40 der laufenden Serie!“
Enthalten in der 7. Kompilation:
31 »Nur der Tote spielt sein Lied«
32 »Die Hölle hat ein Zimmer frei«
33 »Geisterherzen bricht man nicht«
34 »Satan bittet zum Tanz«
35 »Im Garten der Düfte«
36 »Böse Geister spuken besser«
37 »Roboter gegen das Böse«
38 »Die Schwarze Mafia«
39 »Monsterparty im Jenseits«
40 »Ein Dämon rechnet ab«
Alle von W. A. Hary!
________________________________________
Urheberrechte am Grundkonzept zu Beginn der Serie Teufelsjäger: Wilfried A. Hary!
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch)
by hary-production.de
Diese Serie erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Seit Band 21 wird sie hier nahtlos fortgesetzt! Jeder Band ist jederzeit nachbestellbar.
Nähere Angaben zum Autor siehe hier: de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_A._Hary
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
TEUFELSJÄGER: Die 7. Kompilation
„Diese Kompilation beinhaltet die Bände 31 bis 40 der laufenden Serie!“
Nähere Angaben zum Autor siehe hier: http://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_A._HaryBookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenTitel
Wichtiger Hinweis
Diese Serie erschien bei Kelter im Jahr 2002 in 20 Bänden und dreht sich rund um Teufelsjäger Mark Tate. Seit Band 21 wird sie hier nahtlos fortgesetzt! Jeder Band (siehe Druckausgaben hier: http://www.hary.li) ist jederzeit nachbestellbar.
TEUFELSJÄGER
Die 7. Kompilation
W. A. Hary: „Diese Kompilation beinhaltet die Bände 31 bis 40 der laufenden Serie!“
Enthalten in der 7. Kompilation:
31 »Nur der Tote spielt sein Lied«
32 »Die Hölle hat ein Zimmer frei«
33 »Geisterherzen bricht man nicht«
34 »Satan bittet zum Tanz«
35 »Im Garten der Düfte«
36 »Böse Geister spuken besser«
37 »Roboter gegen das Böse«
38 »Die Schwarze Mafia«
39 »Monsterparty im Jenseits«
40 »Ein Dämon rechnet ab«
Impressum
Alleinige Urheberrechte an der Serie: Wilfried A. Hary
Copyright Realisierung und Folgekonzept aller Erscheinungsformen (einschließlich eBook, Print und Hörbuch) by www.hary-production.de
ISSN 1614-3329
Copyright dieser Fassung 2018 by www.HARY-PRODUCTION.de
Canadastr. 30 * D-66482 Zweibrücken
Telefon: 06332-481150
www.HaryPro.de
eMail: [email protected]
Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck und Vervielfältigung jedweder Art nur mit schriftlicher Genehmigung von Hary-Production.
Covergestaltung: Anistasius
TEUFELSJÄGER 031
Nur der Tote spielt sein Lied
W. A. Hary: „…und bittet damit zum Tanz!“
»Hilfe!« schrie jemand am Telefon.
Ich erschrak.
Es schnürte mir die Kehle zu. Meine Hand umklammerte den Hörer so fest, daß die Knöchel weiß hervortraten. Ich bemerkte es nicht einmal.
»Hilfe, Mark Tate!«
Endlich überwand ich mein Erschrecken, war ich fähig, einen klaren Gedanken zu fassen.
»Wer sind Sie? Was ist los? Von wo rufen Sie an?« Das waren die fundamentalen Fragen.
»Ich...«, ein Gurgeln, »...ich bin in Helsinki und...« Ein Knacken in der Leitung. Die Verbindung war unterbrochen.
Ich wollte es nicht wahrhaben, weshalb ich noch mehrmals in den Hörer rief: »Hallo, hallo! So melden Sie sich doch!«
Die Leitung blieb tot.
1
May Harris drehte sich verschlafen im Bett herum und sah mich an. Plötzlich war sie hellwach.
»Mein Gott, Mark, was hast du denn?«
Ich brauchte eine Weile, bis ich mich einigermaßen gefangen hatte.
»Ein Hilferuf«, klärte ich sie auf. »Ein Hilferuf aus Helsinki. Der Mann sprach Englisch.«
»Ein Engländer also? Wer war es?«
Ich zuckte die Achseln.
»Leider kam er nicht mehr dazu, mir das zu sagen. Jemand oder etwas hat es verhindert.«
May Harris warf die Decke beiseite und sprang auf. Flüchtig glitt mein Blick über ihre nackte, schlanke Gestalt. Ich fand sie schön. May war meine Freundin - mehr als das sogar: Meine große Liebe, Lebensgefährtin! Ja, wir liebten uns.
May kam zu mir, packte mich an den Schultern, forschte in meinem kreidebleichen Gesicht.
»Hast du die Stimme wenigstens erkannt?«
»Ich bin nicht sicher!«
May Harris war eine Weiße Hexe. Oft genug hatte sie ihre Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Jetzt setzte sie Magie ein, um meine Gedanken zu unterstützen. Ich ließ sie gewähren.
Es war früh am Morgen, zu einer Zeit also, da sich Weiße Magie gut entfalten konnte.
Unsere Blicke trafen sich. Ich spürte die Resonanz in ihrem Innern. Im Geiste klangen die Worte des unbekannten Anrufers wider. May Harris vernahm sie.
Wir dachten an diesselbe Person:
Steve Candall! Besser: Dr. Steve Candall, ein Archäologe. Er war dabei gewesen, als die Ruine von Ardon nahe Kairo ausgegraben worden war. Diese Ruine war vor Tausenden von Jahren Kultstätte der Dämonen gewesen. Jetzt gab es sie nicht mehr. Mein Schavall, das geheimnisvolle Amulett, das ich stets bei mir trug, hatte sie vernichtet.
Zuvor jedoch hatte Dr. Helen Sanders, ebenfalls Archäologin, die magischen Energien, die in dem Gemäuer steckten, auf sich vereint.
Helen Sander lebte - falls man das überhaupt noch Leben nennen durfte - und sie war derzeit unser primärer Feind.
Und Helen Sanders hatte mit Steve Candall ein besonderes Verhältnis!
»Wir müssen nach Helsinki!« sagte May Harris brüchig. Der Kontakt schwand. »Wir müssen hin - koste es, was es wolle!«
Ich nickte nur.
2
In aller Eile zogen wir uns an. Für die morgendliche Hygiene nahmen wir uns weniger Zeit als normal. Denn ein kurzer Anruf am Flughafen trieb uns zur Eile an. Hoffentlich schafften wir es noch, die Maschine nach Skandinavien zu erreichen. Dann waren wir spätestens am Mittag in Helsinki, der Hauptstadt Finnlands.
Ehe wir gingen, rief ich noch kurz auf Schloß Pannymoore an. Gestern erst hatten wir uns von Lord Frank Burgess und Don Cooper getrennt. Wir hatten gemeinsam mit den beiden zum Schloß hinausfahren wollen, es uns jedoch anders überlegt, um die Gelegenheit wahrzunehmen, einmal allein zu sein: May Harris und ich, Mark Tate.
Dieser Umstand hatte es erst ermöglicht, diesen Anruf zu erhalten.
Purer Zufall.
Vielleicht rettete er Steve Candall das Leben?
Obwohl - bis wir in Helsinki waren, mochte es dennoch zu spät sein. In dem Hilferuf hatte alle Verzweiflung gelegen, deren ein Mensch fähig sein konnte.
Don Cooper war am Apparat. Mit knappen Sätzen klärte ich ihn auf, während May in der offenen Tür stand und drängte.
»Wenn du uns brauchst, Mark - Anruf genügt! Wir kommen so schnell wie möglich nach!«
Das glaubte ich ihm aufs Wort. Don Cooper hatte einen Pilotenschein. Erforderlichenfalls charterte er eine Maschine.
Ich machte Schluß und eilte May Harris nach, die bereits den Fahrstuhl gerufen hatte.
Wir stiegen ein, und dann ging es abwärts. Viel Gepäck hatten wir nicht - soviel wir halt in der kurzen Zeit zusammenkramen konnten. Lange würde unser Aufenthalt in Helsinki sowieso nicht dauern.
Das glaubten wir zumindest.
3
Dr. Steve Candall schrie wie am Spieß. Er war vornübergefallen, direkt auf das Telefon. Dadurch war die Verbindung unterbrochen worden. Er schrie und preßte beide Fäuste gegen die Stirn.
Das Schränkchen mit dem Telefon kippte um. Er landete am Boden, schrie immerfort, bis er nach Luft schnappen mußte. Und da hörte er das Klopfen an der Tür.
»Mr. Candall?« Eine sehr besorgte Stimme. »Mr. Candall, was ist denn los?« Die Stimme einer Frau. »Mr. Candall, so antworten Sie doch!«
Steve Candall konnte sich an nichts erinnern. Verständnislos und mit glasigen Augen schaute er sich um. Er sah das Durcheinander, erhob sich ächzend.
»Was - was...?« stotterte er. Mühsam kam er auf die Beine.
»Dr. Candall?« Das war die Stimme von Gilberte Bujold, einer Kollegin. Sie wohnte im Zimmer nebenan. Es war üblich unter ihnen, sich nicht mit Titeln anzusprechen. Das hatten sie nach ihrer gemeinsamen Arbeit in Ägypten so ausgemacht. Nur Professor Barlow bildete darin eine Ausnahme.
Wenn Gilberte Bujold, die Französin, Doktor zu Candall sagte, dann stimmte etwas nicht.
Candall wankte zur Tür, öffnete.
Da stand sie, die zierliche Archäologin aus Frankreich, völlig verstört. Sie betrachtete Steve Candall von Kopf bis Fuß, erwartete offensichtlich, etwas Furchtbares zu sehen. Aber Candall erschien heil, wenn auch mitgenommen.
Pfeifend ließ sie die Luft entweichen.
»Oh, Gott, Mr. Candall, Sie haben so geschrien! Was ist denn passiert?
Ihr Blick ging an ihm vorbei ins Zimmer. Aus ihrer Perspektive konnte sie das umgefallene Schränkchen nicht sehen.
»Geschrien?« echote Steve Candall irritiert. »Aber ich bitte Sie, ich...«
»Ja, doch, Mr. Candall!« beharrte Gilberte Bujold. Sie reckte den Hals und sah jetzt das Schränkchen doch. Ihre Augen weiteten sich.
Ehe sie etwas sagen konnte, eilte Professor Barlow herbei. Sie waren alle in diesem Gang einquartiert.
»Mann, was machen Sie denn für Sachen?« rief er atemlos und reichlich unkonventionell. »Sie bringen ja das ganze Hotel durcheinander - und das morgens um diese Zeit.«
Auch er erwartete, etwas Schlimmes zu sehen und entdeckte auch nur das Schränkchen.
Steve Candall, der junge, breitschultrige und sehr sportliche Wissenschaftler, wirkte sehr ratlos. Er zuckte die Achseln.
»Ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich schlief tief und fest und fand mich drüben am Boden wieder.«
Professor Barlow atmete auf.
»Ein böser Traum, was?« Er klopfte Steve Candall auf die Schulter. »Na, ist ja nicht so tragisch. Die Wände sind schallisoliert in dem vornehmen Kasten hier. Hat bestimmt außer uns niemand mitgekriegt, sonst wäre der Gang voll mit Schaulustigen.«
»War es denn so schlimm?« erkundigte sich Steve Candall ungläubig.
»Wenn Sie das nicht wissen...« Professor Barlow schob sich an ihm vorbei, sah sich im Zimmer um. Das Bett war zerwühlt, Steve Candall war noch in seinen Schlafanzug gekleidet. Der Professor ging zum Schränkchen und stellte es an seinen Platz. Kurz lauschte er am Telefonhörer. Er überlegte. Dann drückte er die Taste.
»Rezeption Hotel Royal!« meldete sich eine Stimme.
»Sagen Sie, wurde von diesem Telefon aus gesprochen?«
»Moment, Sir - ja, Sir, bis vor einer Minute!«
»Haben Sie die Nummer?«
»Nein, Sir, ich - äh, Sir, warum fragen Sie?«
»Hier Professor Barlow. Ich rufe im Auftrag von Mr. Candall an. Ihm wurde schlecht. Er ist im Moment nicht ansprechbar.«
»Aber, das ist ja schlimm, Professor. Ich rufe sofort einen Arzt!«
»Nicht notwendig!« bremste der Professor. »Wir kümmern uns schon um ihn. Beantworten Sie doch endlich meine Frage!«
»Aber natürlich, Professor. Moment, ich sehe nach. Wissen Sie, ich habe den Anschluß nicht selber vermittelt, sondern der Nachtportier. Soeben war Schichtwechsel.« Er deckte anscheinend die Hand auf die Sprechmuschel. Es rauschte. Man hörte entfernte Stimmen. Dann meldete sich der Portier wieder.
»Ja, Sir, es wurde tatsächlich von Dr. Candall telefoniert. Aber mein Kollege hat ihm nur das Amt vermittelt. Nach den Gebühreneinheiten zu urteilen war es ein Gespräch ins Ausland.«
»Danke, das wollte ich wissen.« Professor Barlow legte auf.
Unterdessen waren die beiden ins Zimmer getreten. Barlow ging an ihnen vorbei, blickte auf den Flur hinaus. Keine Menschenseele zu sehen. Sorgfältig schloß er die Tür.
Seine Miene war sehr ernst, als er sich an seinen Mitarbeiter Steve Candall wandte.
»Was hat das zu bedeuten?«
Steve gab sich völlig durcheinander. Er begriff überhaupt nicht, was um ihn herum vorging.
Barlow klärte ihn darüber auf, was der Portier gesagt hatte, und schloß: »Es war nur so eine Idee. Deshalb habe ich gefragt.«
»Um Gottes willen, das muß ein Irrtum sein!« verteidigte sich Steve Candall. »Ich müßte doch wissen, ob ich telefoniert habe oder nicht!«
Professor Barlow ging ein paarmal auf und ab und blieb vor Candall stehen. Gilberte Bujold rührte sich nicht von der Stelle. Sie sah einmal den Professor an und zum anderen Mal Steve Candall. Dabei schien sie zu überlegen, welcher von beiden nun den Verstand verloren hatte.
»Sie können sich wirklich an nichts erinnern?«
Candall schüttelte heftig den Kopf.
»Wissen Sie, Doktor, was ich glaube?«
Candall blieb die Antwort schuldig. Barlow fuhr fort: »Ich glaube, der höllische Reigen beginnt erneut!«
»Was?« riefen Gilberte und Steve wie aus einem Mund.
Barlow beschwichtigte mit beiden Händen.
»Ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Es erscheint mir auch besser, wenn außer uns niemand davon erfährt. Aber setzen wir uns und zählen die Fakten zusammen.«
Sie gehorchten. Professor Barlow sagte: »Es begann bei der Ruine von Ardon nahe Kairo. Aus unerklärlichen Gründen war das Gemäuer vollkommen erhalten, ohne nennenswerte Witterungseinflüsse. Später fanden wir heraus, warum das so war: Die Ruine war eine dämonische Kultstätte im tiefsten Altertum, vollgeladen mit magischer Energie. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubten wir alle nicht an so etwas. Jetzt gab es den Beweis. Unsere Aufgabe war es nun, das Geheimnis der Ruine zu hüten, um uns nicht lächerlich zu machen, zumal die Ruine inzwischen spurlos verschwunden war - vernichtet von einem gewissen Mark Tate und dessen Amulett mit Namen Schavall. Die gesamte Fachwelt hätte uns nicht nur verlacht, sondern man hätte dafür gesorgt, daß wir in eine Heilanstalt gekommen wären.
Das ist die Ausgangsposition. Es gelang uns, die Geschichte lange hinauszuzögern. Jetzt beschlossen wir, doch damit an die Fachwelt heranzutreten - im Rahmen des Archäologenkongresses hier in Helsinki. Es ist der Grund unserer Anwesenheit. Heute abend soll der Kongreß beginnen. Wir sind gut vorbereitet.
Noch etwas: Eine aus unserer Mitte verschwand damals ebenfalls spurlos. Später starb sie unter geheimnisvollen Umständen. Ich betone das Wort geheimnisvoll, denn offiziell hieß es, daß sie im Kugelhagel der ausnahmsweise mit Schußwaffen ausgerüsteten Londoner Polizei starb. Sie habe mit Terroraktionen von sich reden lassen.
Nun, wir wissen es besser: Dr. Helen Sanders wurde damals zur Hexe! Seitdem dienten ihr die magischen Energien der Ruine von Ardon - denn die wurden damals von Mark Tate nicht vernichtet! Und als ihr Körper starb, blieb vielleicht ihr dämonischer Geist am Leben.«
Steve Candall wagte zum ersten Mal, den Professor zu unterbrechen. »Sie meinen doch nicht etwa, die Hexe sei hier und versuche, unsere geplante Aktion zu verhindern?«
Professor Barlow nickte ernst.
»Es ist ein Umstand, den ich immer wieder in Betracht zog, obwohl ich niemals etwas in dieser Richtung äußerte. Und jetzt scheint meine schlimmste Ahnung bestätigt zu sein. Bedenken Sie, was wir mit Mark Tate abgesprochen haben. Wir fragten ihn, ob die Hexe nunmehr ausgeschaltet sei. Er bejahte es - zu dem damaligen Zeitpunkt. Vielleicht aber sieht es gegenwärtig anders aus? Vielleicht mußte Mark Tate seine Meinung berichtigen - nur hat er uns dann nicht mehr erreichen können, weil wir bereits hier in Helsinki waren - ohne Nachricht über unseren Aufenthaltsort zu hinterlassen. Wir mußten schließlich in aller Ruhe alles Zusammengetragene auswerten.«
Steve Candall stöhnte auf. Er lehnte den Kopf zurück, schloß die Augen. Noch einmal zogen die Geschehnisse vor seinem geistigen Auge vorüber. Sie waren so wach in seiner Erinnerung, als sei alles erst gestern geschehen.
Denn Helen Sanders, die Frau, die zur schrecklichen Hexe und nach dem Tode ihres Körpers laut Barlows Theorie gar zur Dämonenhexe reifte, war seine Geliebte gewesen!
Niemand wußte es sicher, doch sie ahnten es.
Er hatte die Frau verloren, die er mit jeder Faser seines Daseins geliebt hatte. Inzwischen glaubte er, den Schmerz überwunden zu haben, und hier in Helsinki hatten sich die Kollegen rührend um ihn bemüht. Das taten sie im Moment ja auch.
Helen! dachte er verzweifelt, warum mußte alles so kommen? Warum konnten wir nicht zusammenbleiben wie jedes andere sich liebende Paar auch? Du hast dich der Schwarzen Magie verschrieben!
Steve Candall öffnete die Augen wieder. »Ich hoffe, Professor, daß Sie sich irren, daß dies hier nichts zu bedeuten hat!«
Professor Barlow nickte ihm zu. »Ich hoffe es auch, mein Junge, denn daß es mit dir begann, gibt mir sehr zu denken. Wir kennen deine Verbindung mit Helen Sanders nicht - deine frühere Verbindung. Ihr habt es vortrefflich verstanden, es zu verheimlichen.«
»Kunststück, es hatte gerade erst begonnen, als sich all die schrecklichen Dinge ereigneten!« sagte Steve bitter.
»Nun gut, Steve, lassen wir das. Doch eines müssen Sie mir versprechen: Melden Sie mir alles, auch die geringste Kleinigkeit! Jede Unregelmäßigkeit kann einen Hinweis bergen. Sie wissen, was auf dem Spiel steht. Wir wollen das Unmögliche wagen und haben uns demgemäß vorbereitet. Eine Panne bricht uns alle das Genick - sowohl beruflich als auch privat. Vielleicht kostet es sogar unser... Leben!«
Nach diesen bedeutsamen Worten erhob er sich.
Gilberte Bujold folgte seinem Beispiel nicht.
»Moment!« sagte sie. »Bis jetzt habe ich mich herausgehalten, aber eine konkrete Frage: Warum rufen wir nicht einfach diesen Mark Tate in London an und befragen ihn über die Hexe Sanders?«
Es gab Steve einen Stich ins Herz, wenn man so von Helen sprach. Obwohl »seine« Helen nicht mehr existierte.
Professor Barlow blieb stehen. Er legte die Stirn in Falten.
Steve Candall betrachtete ihn fasziniert. Das Alter des Professors war nicht zu schätzen. Er konnte sowohl vierzig als auch sechzig sein. Eine Kapazität auf seinem Gebiet. Sie hatten damals bei der Ruine von Ardon eine Menge von ihm gelernt.
Barlow entschied sich. »Also gut, das übernehme ich. Wartet hier. Ich gehe in mein Zimmer und krame die Nummer heraus. Vielleicht ist es gar nicht mal so eine schlechte Idee?«
Er eilte hinaus.
Während seiner Abwesenheit sprachen die beiden kein einziges Wort. Steve Candall blickte gedankenverloren zum Fenster. Draußen war die Hauptstadt Finnlands lange schon erwacht. Die geschlossenen Fenster ließen es nicht zu, daß der Verkehrslärm heraufbrandete.
Seit vier Wochen wohnten sie bereits in diesem Hotel. Oft genug hatte Steve einen Blick über die Skyline geschickt. Helsinki war auf einer Halbinsel errichtet und verteilte sich auch auf die umliegenden kleineren Inseln. Es gab rege Verbindungen hinüber - sogar per Straße, falls es baulich nicht zu große Anforderungen gestellt hatte.
Das Land war flach und so konnte man die Stadt gut überblicken.
Von seinem Sitzplatz aus sah Steve Candall den Fernsehturm. Von hier wurde sämtliches Rundfunkprogramm des Landes ausgestrahlt - überwiegend in den beiden Landessprachen Finnisch und Schwedisch.
Steve Candall spürte, daß er beobachtet wurde. Sein Blick begegnete dem von Gilberte Bujold.
Sie war wahrlich keine Schönheit, aber in letzter Zeit hatte sie sich verändert. Jetzt erst fiel es Steve Candall auf. Sie kleidete sich adretter, lernte mehr und mehr, etwas aus ihrem Typ zu machen.
Wenn sie so weitermacht, wird sie doch noch zu einer wahren Schönheit! dachte Steve in einer seltsamen Mischung von Spott und Bewunderung.
Und dann las er etwas in ihrem Blick, was ihn im ersten Augenblick erschreckte.
4
Professor Barlow war schnell wieder zurück. Er führte sein unentbehrliches Notizbuch mit, blätterte es noch im Laufen durch. Gedankenverloren stieß er die Tür zu.
»Möchte wissen, unter was ich Mark Tate eingetragen habe. Ich... Ach, da ist er ja!« Er trat zum Telefon und ließ sich das Amt geben. Dann wählte er. Es war eine lange Nummer.
Während er lauschte, klappte er das Büchlein zu und steckte es weg.
Professor Barlow mußte große Geduld aufbringen. Niemand hob am anderen Ende der Leitung ab.
Das war auch nicht der Fall, als es der Professor noch ein zweites und ein drittes Mal versuchte. Resignierend gab er es endlich auf.
»Schade, aber nicht zu ändern. Vielleicht sollten wir es heute mittag noch einmal versuchen?«
Gilberte Bujold schlug vor: »Oder bei diesem Schloß Pannymoore?«
»Nein, das hat keinen Zweck! Ich habe nicht einmal die Nummer vom Schloß. Vielleicht gibt es dort auch kein Telefon? Ich versuche es heute mittag wieder mit derselben Nummer!«
Wenn Professor Barlow einen Entschluß gefaßt hatte, dann war es schier unmöglich, ihn davon abzubringen.
Normalerweise waren seine Entschlüsse bombenfest und verläßlich. Diesmal war Gilberte nicht so überzeugt davon. Trotzdem beherrschte sie sich und sagte nichts mehr.
Sie sah wieder nach Steve Candall. Dieser dachte bestürzt: Es erscheint unmöglich und doch ist es wahr: Gilberte liebt mich! Warum, zum Teufel, habe ich das nie zuvor bemerkt? Nein, während unserer Arbeit in Ägypten hatte es bei ihr noch nicht begonnen. Das ist sicher. Sie war vollkommen konzentriert auf ihre wissenschaftliche Arbeit. In ihrem Denken gab es keinen Platz für mich.
Aber jetzt!
Professor Barlow unterbrach seine Gedankengänge: »Wenigstens können wir das als Beweis dafür werten, daß Steve nicht Mark Tate angerufen hat!«
Gerade darin irrte sich der Professor gewaltig, doch wie hätte er das ahnen können? Er war im Moment etwas verwirrt und hatte schwerste Bedenken.
Dabei hatten die Verwirrungen und Mißlichkeiten erst begonnen.
5
»Ich frage mich, was Steve Candall in Helsinki treibt!« sagte May Harris unterwegs. »Hoffentlich hat er uns keinen Bären aufgebunden - falls er es wirklich war!«
Ich sah sie überrascht an.
»Wie, Zweifel?«
»Sind doch erlaubt, oder?«
Sie hatte es eine Spur zu barsch gesagt. Nicht daß ich etwas gegen die mitunter unberechenbaren Launen einer Frau hätte, aber May Harris war zumindest in einer Beziehung eine Besonderheit: Sie war eine Weiße Hexe, mit ausgeprägten magischen Kräften ausgestattet, die sie ausschließlich zur Bekämpfung des Bösen einsetzte.
Und wenn sie eine solche Stimmung zeigte, dann mußte das nicht unbedingt bedeuten, daß sie einfach nur schlecht gelaunt war!
Ich enthielt mich zunächst eines Kommentares. Als May nicht auf mich achtete, tastete ich verstohlen nach meinem Schavall. Das Amulett hing wie immer an der Halskette unter dem Hemd. Es hatte durch die metallene Einfassung die Form eines Auges, wobei der geheimnisvolle Stein die Pupille darstellte. Glutrot begann sie zu leuchten, wenn sie in den Bereich von Magie kam. Dadurch war sie ein hervorragendes Barometer für magische Einflüsse. Aber auch andere Fähigkeiten steckten in dem Schavall. Mit ihm hätte ich die Welt aus den Angeln heben können - nur gehorchte er mir nicht so, wie ich es mir wünschte. Er besaß ein Eigenleben, das geheimnisvoller war als seine Herkunft!
Als meine Linke ihn berührte, durchzuckten mich Warnimpulse. Im nächsten Augenblick wurde es glutheiß. Eine Hitze, die mir, dem Träger des Amuletts, nicht schadete.
»Raus!« schrie ich geistesgegenwärtig und stieß die Tür auf.
Der Wagen hatte gerade eine Ampel verlassen und fuhr gottlob nicht so schnell. Dennoch kam ich hart auf dem Straßenasphalt auf. Ich glaubte, sämtliche Knochen im Leib gebrochen zu haben, doch hatte ich nur Sorge um May.
Aber May Harris hatte mich wohl verstanden. Sie wußte endlich zu deuten, was sie so unruhig und nervös machte. May sprang ebenfalls aus dem fahrenden Fahrzeug, nur Sekundenbruchteile nach mir.
Damit hatte sie rechtzeitig gehandelt!
Der Wagen fuhr nur zehn Schritte ohne Steuerung. Da der Druck auf das Gaspedal fehlte, verlangsamte er rapide seine Geschwindigkeit.
Und dann schien von unten her eine Riesenfaust durch ihn hindurchzustoßen. Eine feurige Lohe schoß zum Himmel, wabernde Glutwolken hüllten den Wagen ein.
Ich lag auf dem Bauch und hatte Schwierigkeiten, das Geschehene zu begreifen.
Ringsum infernalisches Hupen und sofort anschließend quietschende Reifen. Eine Kreuzung in London war auch um diese frühe Zeit gut frequentiert. Der Verkehr in London gehörte zu den dichtesten in Europa.
Ein Auto hielt nur handbreit hinter mir. Beinahe hätte es mich überrollt.
Der Fahrer kam nicht dazu, mich auszuschimpfen. Er stierte auf das brennende Autowrack.
Eine kleinere Detonation. Metallfetzen flogen umher, gefährdeten Fußgänger, die eilig Deckung suchten.
Da sprang May Harris plötzlich auf und rannte zu dem Hölleninferno hinüber.
»May!« brüllte ich warnend, sprang ebenfalls auf die Beine, wagte es jedoch nicht, mich dem Feuer zu nähern. Es konnte jeden Augenblick eine erneute Detonation geben. Ich hätte mein Leben gefährdet.
Doch was tat May? Sie schien keine Angst zu haben, näherte sich den Flammen so dicht, daß ich befürchten mußte, sie würde jeden Augenblick Feuer fangen.
Nichts dergleichen geschah. Sie starrte wie gebannt ins Feuer.
Als sie sich mir zuwandte, war ihr Gesicht kreidebleich. Sie wich vor der Hitze zurück, trat an meine Seite.
Ein Mann eilte herbei. Er hielt in den Händen einen Feuerlöscher.
»Um Gottes willen, was ist denn hier passiert? Eine Höllenmaschine in Ihrem Auto? Diese verdammten Terroristen!«
Ich klärte ihn nicht darüber auf, daß die Genannten diesmal nicht ihre Hände im Spiel hatten.
Er rannte zum Feuer und entleerte seinen Löscher. Mit Erfolg.
Und als ein zweiter Mann hinzukam und seinen Feuerlöscher einsetzte, blieb nur noch schwelende Glut übrig - und ein Wrack, das Schrottwert hatte - einschließlich unserem Gepäck.
»Der Anschlag hatte eine Doppelfunktion«, sagte May Harris leise genug, daß nur ich es verstehen konnte. »Jemand versuchte, uns umzubringen und kalkulierte mit ein, daß wir davonkommen. Aber es wird uns leider aufhalten. Die Maschine kriegen wir nicht. Bis zur nächsten müssen wir höllisch aufpassen, daß wir sie überhaupt erleben!«
»Was hast du eigentlich gesehen?« fragte ich ebenso leise zurück. »Warum bist du zum Feuer gelaufen?«
»Die Höllenmaschine wurde durch Magie gezündet. Die magische Anordnung war gut getarnt, obwohl meine Sinne darauf unterschwellig reagierten. Die Handschrift habe ich im Feuer erkannt.«
»Die Hexe Sanders?«
»Ich bin vollkommen überzeugt davon!« bestätigte May Harris. »Sie hatte wenig Zeit - sie oder ihr Handlanger, vor dem wir uns fürderhin in acht nehmen müssen. Deshalb die magische Zündung.«
Wir kamen nicht mehr dazu, uns weiter über dieses Thema zu unterhalten. Die schrillen Sirenen der Polizei näherten sich. Jemand hatte sie benachrichtigt. Die Kreuzung war auf diese Weise blockiert. Niemand wagte es, dem Wrack zu nahe zu kommen. Vielleicht erwartete man, daß erneut ein Feuer ausbrechen konnte?
Wir durften uns beinahe als Statisten in dem mysteriösen Spiel ansehen. Alles lief automatisch ab.
Die Beamten nahmen sich unser an. Wir gaben zu Protokoll, über Absicht und Täter nichts sagen zu können. Ein seltsames Geräusch habe mich aufgeschreckt. Dann habe ich gesehen, daß etwas mit dem Armaturenbrett nicht stimmte. Meine Reaktion darauf sei unwillkürlich erfolgt - und in letzter Sekunde.
Ich zeigte meine Lizenz als Privatdetektiv und verlangte ein Gespräch mit Tab Furlong. Tab war Chefinspektor beim Yard. Das half. Man erledigte sämtliche Formalitäten und ließ uns laufen. Tab bat mich am Telefon, im Schloß anzurufen. Ich konnte nicht frei sprechen, da es nur so von Polizisten wimmelte.
Mit dem Taxi fuhren wir endlich weiter zum Flughafen.
May Harris behielt recht. Wir kamen zu spät und mußten uns auf eine Wartezeit am Flughafen gefaßt machen.
6
Unser Ziel war der Flughafen Gatwich. Wir unterhielten uns nicht unterwegs. Schweigend saßen wir nebeneinander. Ein kurzer Umweg zu meiner Wohnung hatte wenigstens dafür gesorgt, daß wir wieder ordentlich gekleidet waren. Außer einer Zahnbürste mit Zubehör hatten wir kein Gepäck mehr mit. Wir hatten den Taxifahrer nicht zu lange warten lassen wollen.
»Halten Sie vor dem Haupteingang!« bat ich den Mann. Er nickte nur.
Und dann fuhr er am Haupteingang vorbei! Er drückte sogar noch aufs Gas, als müßte er ein Rennen gewinnen.
Blitzschnell griff ich nach dem Schavall.
Schon wieder Erhitzung. Mit May brauchte ich mich nicht abzusprechen. Der Taxifahrer hielt genau auf eine Mauer zu. Ein Aussteigen wäre diesmal Selbstmord gewesen. Aber die Mauer brachte uns ohnedies den Tod, wenn kein Wunder geschah.
Es ist ein Fehler, in ausweglosen Situationen auf Wunder zu harren. Dann gibt es nämlich kein Entrinnen. Man muß schon selber etwas dazu beitragen.
May und ich taten das in wahrer Teamarbeit. Ich nahm den Schavall von der Kette und drückte ihm den Fahrer gegen die Stirn.
Vorher war sein Körper so hart wie Holz gewesen - unmöglich, ihn vom Steuer wegzuzerren. Jetzt, durch die Berührung mit dem Schavall, geschah etwas Furchtbares mit ihm. Er schrie gellend. Der Schavall fraß sich regelrecht in seine Stirn. Rauch quoll auf. Sein Körper wurde schlaff. Der Fuß blieb unverändert auf dem Gaspedal.
Da mußte May Harris auf den Plan treten. Sie bewies wieder einmal, daß sie nicht nur ein ausgebildete Weiße Hexe war, sondern auch sonst zu handeln wußte.
Mit der Behendigkeit einer Katze flankte sie über die Sitzlehne. Dabei konnte sie dem Allmächtigen danken, daß nicht mehr alle Taxies mit Trennscheibe ausgerüstet waren.
Rücksichtslos kickte sie das Bein des Fahrers vom Gaspedal und kurbelte am Lenkrad.
Der Fahrer zuckte konvulsivisch. Seine Hände fuchtelten gegen seine Stirn. Halb war das Dämonenauge schon darin. Es glühte und machte seinem Beinamen alle Ehre.
Der Wagen schleuderte wild, brach nach der Seite hin aus.
Es war einfach nicht zu schaffen. Der Wagen verlangsamte zwar seine Geschwindigkeit, aber nicht beträchtlich genug.
Ich klammerte mich so fest an den Taxifahrer, daß ich genügend Halt bekam. Dabei drückte ich ihn in den Sitz.
Seitlich traf der Wagen gegen die Mauer. Ein fürchterliches Krachen und Bersten von Metall, das Klirren von Glas. Irgendeine Verstrebung wimmerte. Die Reifen radierten kreischend über den Asphalt.
Der Wagen prallte zurück, schlitterte parallel zur Mauer weiter, traf wieder dagegen.
Eine wahre Höllenfahrt, die irgendwann endete.
Wir sahen uns an. Es erschien uns jetzt tatsächlich wie ein Wunder, daß wir überlebt hatten.
Dann erst achteten wir auf den Wagen. Er war nur noch ein Wrack. Wie sollten wir hinauskommen?
Natürlich waren wir noch nicht außer Gefahr. Wenn wir Pech hatten, setzte sich das Wrack in Brand und endete so wie mein Mietfahrzeug an diesem selben Morgen.
Das zweite Mal, daß es jemand auf unser Leben abgesehen hatte. Nur diesmal mit weitaus mehr Erfolg!
Die gesamte Karosserie war verzogen. Ohne Gewalteinwirkung kamen wir nicht hinaus.
Der Taxifahrer schrie nicht mehr. Er stöhnte nur noch.
Und dann stieg kein Qualm mehr von seiner Stirn auf. Der Schavall wurde neutral. Ich konnte ihn an mich nehmen. An der Stirn blieb nicht einmal ein Kratzer. Der Schavall hatte samtliche magischen Einflüsse neutralisiert.
Der Fahrer blinzelte verwirrt. Er konnte einfach nicht begreifen, was um ihn herum los war.
Da erst stellte er fest, daß er in einem Wrack saß.
»Schnell!« drängte ich, ehe er Fragen stellen konnte - Fragen, die nur unnötig Zeit raubten. »Wir müssen hinaus!«
Schon hatte ich die Jacke ausgezogen, sie um meinen Arm gewickelt. Wie ein Besessener hieb ich auf das Fenster ein. Ja, das war die einzige Chance, die uns blieb. Unfaßbar, daß die Scheiben den Aufprall überhaupt überstanden hatten. Normalerweise stöhnte man über die liederliche Art, mit der heutzutage PKWs gebaut wurden, und jetzt erwies sich die Scheibe als so stabil, daß sie einfach nicht brechen wollte.
»Die Windschutzscheibe!« rief der Taxifahrer aus. Er hatte sich von seinem Schock zwar noch nicht erholt, zeigte jedoch, daß er schnell umdenken konnte.
Ehe May reagieren konnte, griff er in die Kartentasche und brachte eine kleine Brechstange hervor. Lag die dort zur Selbstverteidigung in Notfällen?
Mit der kleinen Brechstange hieb er auf die Windschutzscheibe ein. Mit Erfolg! Das Verbundglas brach. Noch mehrmals, und dann konnte der Mann die Scherbenreste beseitigen.
Er half May Harris, obwohl die gewiß nicht der Hilfe bedurfte. Mit ihrer katzengleichen Behendigkeit war es für sie eine Kleinigkeit, hinauszuklettern.
Ich ließ mich über die Sitzlehnen rutschen. Die Windschutzscheibe war wesentlich größer als die Seitenscheibe. Also war es auch leichter, nach draußen zu gelangen.
Wir schafften es alle drei in Rekordzeit. In einer Entfernung von zwanzig Schritten blieben wir stehen.
Beim Wrack geschah nichts. Gemartertes Blech knackte. Das war alles. Wir hätten uns gar nicht so zu beeilen brauchen.
»Geht doch nicht hoch wie eine Rakete!« kommentierte der Taxifahrer verbissen. »Etwas hat den Motor abgewürgt - rechtzeitig. Das verringert das Explosionsrisiko.«
Er mußte es ja wissen.
Jetzt fixierte er mich.
»He, Sie hatten doch eben erst so ein Ding hinter sich gebracht. Mann, Sie sind ein Todeskandidat und setzen sich ausgerechnet in meine Kutsche?«
»Moment mal!« verteidigte ich mich. »Schließlich ist es Ihr Wagen und wir beide waren nur Beifahrer. Friedlich saßen wir hinten, als Sie wie ein Wahnsinniger auf die Mauer zufuhren. Wenn meine Freundin nicht eingegriffen hätte...«
»Das ist doch die Höhe!« Der Taxifahrer regte sich auf. Wahrscheinlich tat er es nur, um die weichen Knie loszubekommen, die er sich bei dem Vorkommnis eingehandelt hatte.
Mehr Gelegenheit für einen Disput auf offener Straße bekamen wir nicht. Vom Flughafengebäude und auch vom Parkplatz rannten Leute herbei. Ich erkannte mehrere Polizistenuniformen.
Ja, der Taxifahrer hatte schon recht. Ich mußte mir eine ordentliche Geschichte ausdenken, um die Polizisten zu beruhigen. Möglicherweise nahmen sie May und mich einfach in Schutzhaft. Dann konnten wir die Reise nach Helsinki endgültig abbuchen.
7
Es kam anders. Zunächst beschäftigten sie sich mit dem Taxifahrer. Der Arme konnte sich an nichts erinnern, leugnete jede Schuld. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Von Mitleid gepeinigt sagte ich deshalb aus: »Muß ein technischer Defekt gewesen sein. Wir wollten vor dem Haupteingang halten. Da schoß der Wagen auf einmal davon. Alles ging so schnell... Ich glaube, der Mann hier hat uns das Leben gerettet!«
Mit großen Augen sah mich der Taxifahrer an. Aber er reagierte auch diesmal schnell, nahm den Ball auf, den ich ihm zugespielt hatte.
»Ja, das klingt einigermaßen einleuchtend. Ich kann es mir nicht erklären. Auf jeden Fall muß das Wrack untersucht werden - genauestens. Ein technisches Versagen. Verdammt, ich kriege es nicht mehr zusammen. Tatsächlich, es ging dermaßen schnell...«
»Achtung!« kreischte eine Frauenstimme. Gaffer, die sich eingefunden hatten und von der Polizei kaum zurückgehalten werden konnten.
Alle sahen zum Wrack hinüber - nicht zu der Frau. Das war auch gut so. Sie hatte als einzige das kleine Feuer im Motorenraum entdeckt.
Also war es doch schlimmer als vermutet!
Also taten wir doch gut daran, das Wrack so schnell wie möglich zu verlassen!
Wir warfen uns zu Boden - genau dort, wo wir gerade standen.
Ein paar ältere Leute waren viel zu langsam. Gottlob befanden sich weit genug weg.
Ich dachte an die Formulierung des Taxifahrers: Das Wrack ging hoch wie eine Rakete! Ein ohrenbetäubendes Donnern, als die Motorhaube hochstob. Umeinanderwirbelnd wehte sie davon wie ein Blatt im Herbstwind, begleitet von Rauchschwaden. Ein kleineres Metallteil sirrte wie eine wütende Hornisse knapp an meinem Ohr vorbei und schepperte über den Boden.
Ich riskierte einen Blick hinüber.
»Der Tank!« warnte ich.
Richtig, der war noch intakt. Die schwelende Glut würde dafür sorgen, daß das nicht mehr lange so blieb.
Prompt sprangen alle auf und rannten in Richtung Hauptgebäude. Wir hatten es kaum erreicht, als es die zweite Detonation gab. Und das brennende Wrack, eine wahre Gluthölle, in der alles vernichtet wurde, was einen brauchbaren Hinweis auf die zitierte technische Störung hätte geben können, glich haargenau dem Bild, das wir an diesem Morgen schon einmal gesehen hatten.
Ich spürte den Kloß in meiner Kehle.
May Harris war ganz nahe. Sie murmelte: »Die Hexe hat das getan. Normalerweise wäre das Wrack nicht mehr hochgegangen. Sie hat es mit ihren magischen Kräften angezündet. Diesmal geht sie kein Risiko ein. Niemand soll etwas von ihrer Tätigkeit erfahren. Das ist der Beweis, daß es ausnahmsweise nicht in erster Linie um uns geht.«
»Um wen sonst?«
»Wer ist denn hier der Detektiv - du oder ich?«
»Manch ein Laie hat sogar Sherlock Holmes wertvolle Hinweise und Denkanstöße geliefert - habe ich mir sagen lassen.«
»Na gut, Sherlock Holmes, ausnahmsweise: Steve Candall!«
»Deine Logik ist bestechend. Glaubst du wirklich, da wäre ich allein nie drauf gekommen?«
»Doch, aber Steve Candall ist möglicherweise nur eine Randfigur? Wir wissen noch immer nicht, was er in Helsinki treibt. Es muß etwas sein, was die Hexe in Anspruch nimmt. Sie hat mehrmals versucht, uns auszuschalten - nicht nur heute. Bisher hat sie alles unglaublich sorgfältig vorbereitet und dann die Falle zuschnappen lassen. Nur in diesen beiden Fällen heute morgen hat sie aus dem Stegreif die Dinge wachsen lassen. Sie hat auf umfangreiche Vorbereitungen verzichtet. Ein Zeichen, daß Candalls Anruf echt war und keine weitere Finte der Hexe.«
»Ich höre sofort auf, über Laien zu lästern!« versprach ich feierlich.
Wir folgten den Flughafenpolizisten. Es mußte mal wieder ein Protokoll aufgenommen werden.
Wenn das so weitergeht, dachte ich bitter, kommen wir sogar in Übung. Nur werden wir Helsinki niemals sehen - und wenn, dann ist es längst zu spät.
Helen Sanders - am liebsten hätte ich es geschrien -, eines Tages werde ich es schaffen, dir das Handwerk zu legen! Vielleicht dauert das gar nicht mehr so lange?
8
Es hatte keinen Sinn mehr, sich ins Bett zu legen. Keiner der drei dachte an Schlaf. Es war zwar in der Nacht sehr spät geworden und sie wollten sich mit den anderen erst nach dem Mittagessen zusammensetzen, aber sie fühlten sich nicht müde. Professor Barlow schien regelrecht darauf zu warten, daß wieder etwas geschah.
Nach zwei Stunden, während denen effektiv nichts geschehen war, was er hätte als Zeichen magischer Einflüsse werten können, zog er sich zurück. Er wollte noch einmal seine Akten sichten und später mit ihnen beiden ein paar wichtige Punkte durchsprechen.
Steve Candall hielt es für einen Vorwand. Doch hatte er nichts einzuwenden.
Obwohl sein Herz unwillkürlich einige Takte zu schnell schlug und er Barlow am liebsten zurückgerufen hätte.
Denn jetzt war er mit Gilberte Bujold allein! Eine Situation, die ihm ganz und gar nicht gefiel.
Als hätte ich Angst vor ihr! gestand er sich ein. Angst? Warum? Weil eine Frau ihn liebte?
All die Wochen, die seit damals vergangen waren, hatte er nur an die eine gedacht - an Helen Sanders. Unbegreiflich für ihn, daß sie sich gegen ihn und für Schwarze Magie entschieden hatte. Er wußte, daß ihre Liebe keine Heuchelei gewesen war. Sie wollte mit ihm zusammen sein, mit ihm glücklich werden.
Es war alles ganz anders gekommen! Eine wahrlich schwere Entscheidung für eine Frau, nicht für eine echte Hexe. Das Böse hatte überwogen.
Ich bin darüber hinweg! sagte er sich. Nicht, daß er es sich einredete, sondern es war tatsächlich so. Zwar dachte er noch immer an Helen Sanders, aber längst nicht mehr voller Sehnsucht im Herzen.
Die Arbeit war Schuld daran. Er hatte sich darin vertieft, hatte darin Vergessen gesucht. Nicht ohne Erfolg.
Er begegnete dem Blick von Gilberte Bujold. Ahnte sie, was in ihm vorging? Ahnte sie es?
Sie lächelte verkrampft - und dann nickte sie: verständnisvoll, bereit, ihm Hilfe zu leisten!
»Gilberte!« Verzweiflung schwang mit. Er ballte die Hände zu Fäusten, beugte sich über den Tisch, starrte ihr ins Gesicht.
Sie hielt stand. Ihr Lächeln festigte sich.
»Ja?« fragte sie leise.
>Mir ist nie aufgefallen, wie süß doch ihr französischer Akzent klingt.< Gilberte war eine Kollegin, mehr nicht. Eine Wissenschaftlerin durch und durch, ohne Männergeschichten, ohne Extravaganzen. Und jetzt das!
»Warum liebst du mich?« fragte er. Er lauschte den Worten nach und fand sie schrecklich albern. Führte er sich nicht auf wie ein Halbwüchsiger vor dem ersten Rendezvous mit einem Mädchen seiner Klasse?
Schlimmer noch: Ihm wurde heiß! Gewiß war sein Kopf puterrot.
Es war keine Verlegenheit, sondern ein Gefühl, das aus seinem Innern kam. Dort hatte es geschlummert, verdrängt durch andere Dinge: durch die Gedanken an Helen beispielsweise!
Er schüttelte den Kopf. Nein, das war unmöglich. Wie könnte er die Liebe der zierlichen Französin erwidern? Sein Gefühl hatte Helen gehört!
Aber war Helen nicht damals schon eine Hexe gewesen? Ihre Kräfte hatten geschlummert wie seine Gefühle zu Gilberte. Die Ruine von Ardon hatte die Kräfte gefördert, ihr bewußt gemacht, wer und was sie wirklich war: eine Hexe eben, für die es keine Liebe zu einem Normalsterblichen geben durfte!
Vielleicht hatte sie sogar mit ihren Fähigkeiten nachgeholfen, um ihn, Steve, für sich zu entflammen, damit sie ihn ausnutzen konnte?
Steve schlug die Hände vor das Gesicht. Er war total durcheinander, wußte nicht mehr, was er denken sollte. Er mit Liebeskummer? Wer hätte das gedacht?
Ausgerechnet Steve Candall!
Auf dem College hatte man ihn einen Schürzenjäger geschimpft, bis er gemerkt hatte, daß Herzensbrechen als Sport nichts taugte. Es war vielmehr eine Gemeinheit. Ein Reifeprozeß, mehr nicht. Er war vom Halbwüchsigen zum Mann geworden - zu einem Mann, der genau wußte, was er wollte, und sich nicht mehr mit Halbheiten zufrieden gab. Deshalb hatte er sich von der sogenannten Geschlechterfront zurückgezogen, war er ernsthaft geworden.
Bis Helen Sanders!
Und jetzt: bis Gilberte Bujold!
Sie streckte ihm die Hände über den Tisch hinweg entgegen - und er ergriff sie. Eine unbewußte Handlung. Er wußte in diesem Moment wirklich nicht, was er tat.
Als er den Druck ihrer weichen Hände spürte und ihre feuchten Augen sah, wurde ihm schlagartig wohler. Er fühlte sich irgendwie befreit. Von was befreit?
Sie sagte es ihm: »Du bist nicht mehr allein, Steve! Auf mich kannst du zählen!«
Sein Gesicht war ruhig und entspannt. Stahl sich nicht eine Träne in die Augenwinkel?
Steve Candall stand auf. Er nickte.
»Ich weiß es jetzt!«
Der Tisch trennte sie. Sie beseitigten das Hindernis, flogen sich in die Arme.
Zwei Liebende am Ziel einer quälenden Sehnsucht.
Und da gab es eine Störung, die in ihrer Brutalität doppelt wirkte!
Plötzlich waren sie nicht mehr allein, und der Jemand, der zu ihnen gekommen war mit einer Aura des Bösen, hatte zum Eintreten weder Türen noch Fenster benutzt.
Die Hexe erschien aus dem Nichts!
9
Nach einer Zeit, die uns beiden endlos vorkam, landeten wir endlich in der Abflughalle. In einer halben Stunde würde die nächste Maschine nach Helsinki gehen.
Wir saßen nahe dem Ausgang. Immer wieder tastete ich nach meinem Schavall. Ich traute dem Frieden nicht. Die Hexe würde gewiß ein weiteres Mal versuchen, den Abflug zu verhindern oder zumindest zu verzögern.
Seit dem letzten spektakulären Ereignis war es ruhig geblieben. Doch das hatte wenig zu sagen. Gewiß war die Hexe nur mit Vorbereitungen zu ihrer nächsten Schandtat beschäftigt.
Ich dachte an das Flugzeug und erschrak.
May schien auf denselben Gedanken zu kommen: »Hoffentlich vergreift sie sich nicht an der Maschine. Auf den Taxifahrer hat sie schon keine Rücksicht genommen. Er wäre mit uns zu Tode gekommen. Sollen unseretwegen alle Mitreisenden sterben? Können wir das überhaupt verantworten?«
»Ein echtes Problem!« knirschte ich. »Wenn wir hierbleiben, ist überhaupt nichts gewonnen. Die Macht der Hexe ist groß. Das weißt du so gut wie ich. Vielleicht wächst sie sogar noch?«
»Ich denke gerade an den Lord und an Don Cooper. Es war ein Fehler, sie nicht in den Fall mit einzubeziehen. Vielleicht sollten wir diesen Fehler wiedergutmachen?«
»Du meinst, sie anrufen und herbestellen? Und dann mit einem Privatcharter die Reise unternehmen?« Ich wiegte bedenklich mit dem Kopf. »Wenn die Hexe wirklich einen Anschlag auf die Maschine da draußen geplant hat, dann führt sie ihn auch durch - ob wir mitfliegen oder nicht. Wir sollten auf die Kraft des Schavalls vertrauen.«
»Das tun wir die ganze Zeit schon, und mit welchem Ergebnis?«
Ihre Worte waren nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber ich hatte auch Gegenargumente.
»Wir wußten die Zeichen nur nicht zu deuten, obwohl sie sichtbar genug waren. Du hast mit deiner inneren Unruhe gekämpft - beim ersten Mal. An einen Anschlag dachtest du nicht. Beim Taxi war es ähnlich. Die Hexe muß den armen Fahrer beeinflußt haben, als wir daheim Zwischenstation machten. Zeit genug hatte sie dazu. Wir durften nichts merken. Auch der Schavall durfte nicht aktiviert werden. Doch glaube mir, May, wir sollten ein wenig zuversichtlicher werden und daran denken, daß die Hexe nicht nur uns als Problem am Hals hat. Seien wir künftig vorsichtiger und machen die Augen auf.«
»Wie sieht das in der Praxis aus?«
»Ich werde die Hand nicht mehr vom Schavall lassen, und du konzentrierst dich auf die Maschine, wenn wir einsteigen. Falls es eine Falle gibt, wird sie bemerkt!«
»Du bist sehr optimistisch, Mark.«
»Immer, wenn mir keine andere Wahl bleibt. Oder glaubst du, mit einem Privatcharter würden wir sicherer reisen? Bis Don und Frank hier sind, kann die Hexe alles gemütlich vorbereiten. Nein, der Ausgang wäre noch ungewisser.«
Wahrscheinlich wäre die Diskussion noch weitergegangen, bis wir in der Maschine gehockt hätten. Aber da kam ein Mann auf uns zu. Er lächelte. Ich betrachtete ihn von Kopf bis Fuß und war sicher, ihn nicht zu kennen. Dabei war auf mein Gedächtnis Verlaß.
Was wollte er von uns?
Und daß er etwas wollte, wurde immer offensichtlicher, je näher er kam.
Vor mir blieb er stehen. Ich schickte einen hilfesuchenden Blick zu May. Die zuckte nur die Achseln. Also auch unbekannt für sie. Aber ich bemerkte, daß sie sich auf den Fremden konzentrierte. Um seine Gedanken zu erfassen? Ich wußte aus Erfahrung, daß das nicht immer funktionierte. Magische Energien sind anderen Gesetzen unterworfen. Sie sind nicht immer im gleichen Maße verfügbar.
Der Fremde deutete eine knappe Verbeugung an. So benahm sich niemand, der einen völlig Unbekannten vor sich wußte.
»Sie sind doch Mark Tate, nicht wahr?«
Ich nickte automatisch.
»Mein Name ist Hencock - Charles Hencock!«
Auch der Name war mir nicht geläufig. Ärger erwuchs mir. Ich öffnete den Mund, um eine etwas unfeine Bemerkung zu machen. Schließlich war an diesem Tag schon genug passiert. Ein Ausrutscher wäre durchaus verzeihlich.
Hencock wehrte mit beiden Armen ab.
»Nicht doch, Mr. Tate, ich sehe schon, Sie sind nicht sehr erfreut über die Störung durch mich! Ich will Sie auch nicht unnötig belästigen.«
»Es würde mir schon genügen, wenn ich etwas über Ihr Begehren wüßte!« bemerkte ich bissig. Nein, das hatte ich mir wahrlich nicht verkneifen können.
Charles Hencock erschien todunglücklich.
»Ich muß mich wirklich in aller Form bei Ihnen entschuldigen, Mr. Tate, aber ich... Na ja, Mr. Tate, ich will nicht soviel um den heißen Brei reden. Sie haben schon recht: Aufklärung tut not...«
Ich stellte nur fest, daß der Mann sehr konfus redete und ich absolut nicht gewillt war, mir das länger anzuhören. Auf der anderen Seite wollte ich nicht zu barsch mit ihm umgehen und ihn mir mit ein paar deftigen Worten vom Leib halten. Deshalb stand ich auf und zwang mich zu einem Lächeln.
Sogleich ging es Hencock besser. Vielleicht würde er jetzt endlich zu einem zusammenhängenden Satz kommen?
Ich half ihm: »Sie brauchen sich keine Gedanken zu machen, Mr. Hencock. Eigentlich müßte ich mich entschuldigen! Nun, Mr. Hencock, was haben Sie denn auf dem Herzen?«
Ich sah ihm in die Augen und entdeckte ein eigentümliches Flackern.
»Es - es ist nicht so einfach zu erklären, Mr. Tate. Äh, Sie sind doch Privatdetektiv, nicht wahr?«
»Ja, das bin ich.«
»Ich - ich habe es rein zufällig mitbekommen. Ich sah auch das Unglück draußen vor dem Eingang. Es - es war wahrlich knapp - und äußerst mysteriös, finden Sie nicht auch?«
Ich zupfte die Augenbrauen hoch. Es bereitete mir einige Schwierigkeiten, höflich zu bleiben. Eines jedoch hatte Hencock geschafft: Meine Neugierde an seiner Person zu wecken!
Er fuhr fort: »Ich verfolgte das weitere. Hat nicht einer der Polizisten gesagt: >Als ob Sie das Schicksal von der Reise abhalten möchte, Mr. Tate!< Gewiß hat er es halb im Scherz gemeint.«
»Ich frage mich, woher Sie das wissen? Diese Bemerkung wurde im Verbandlungszimmer der Polizei gemacht!« Damit zeigte ich ihm offen mein Mißtrauen.
»Damit Sie sehen, Mr. Tate, daß ich ehrlich zu Ihnen bin: Ich habe an der Tür gelauscht1«
Ich betrachtete ihn von Kopf bis Fuß: Ein schmächtiger Mann. Sehr schmal in den Schultern, aufgeschossen, aber nicht hager. Irgendwie erschien er weich und sensibel. Eine leichte Hakennase, die ihn jedoch nicht unsympathisch machte. Die Hände waren feingliedrig wie die eines begabten Musikers. Er sprach ein gepflegtes Englisch, das einen hohen Bildungsstand signalisierte.
>Wer, zum Teufel, ist dieser Charles Hencock eigentlich?
Und was, um alles in der Welt, will er nun wirklich von mir?<
Laut fragte ich: »Gelauscht? Und was hat Sie zu dieser - hm - ungebührlichen Handlungsweise animiert?«
»Eine gewisse Parallelität, Mr. Tate. Mir passieren nämlich ähnliche Dinge wie Ihnen! Mit einem wesentlichen Unterschied: Ich bin weniger sportlich als Sie beide und weit weniger flexibel, was extreme Situationen betrifft. Dafür habe ich ein sagenhaftes Glück. Dem allein verdanke ich, daß ich noch am Leben bin.«
>Ein Verrückter!< schoß es mir durch den Kopf. >Muß ich die Verrückten denn immer anlocken wie Motten das Licht?<
»Mr. Tate, Sie kennen mich offensichtlich nicht. Deshalb will ich Ihnen etwas über meine Person sagen: Ich bin Violinsolist! Gemeinsam mit Ihnen werde ich die Reise nach Helsinki antreten. Es findet dort ein Archäologenkongreß statt. Heute abend beginnt er. Mir gelang es, freizubekommen und mir den Zugang zu diesem Kongreß zu erkaufen, denn Archäologie ist mein Hobby.«
Er griff in die Innentasche seines Jacketts, während ich mich bemühte, das eben Gehörte zu verdauen. Seine Hand brachte ein paar Zeitungsausschnitte hervor. Sie zitterte, als er mir die Ausschnitte übergab.
Das Papier wirkte ein wenig mitgenommen, als hätte jemand die Ausschnitte mindestens hundertmal gelesen.
Ich wußte nicht, wozu das dienen sollte. Trotzdem konzentrierte ich meine Aufmerksamkeit auf die Ausschnitte.
»Stammen alle von den letzten Tagen!« klärte mich der Geigenvirtuose Charles Hencock auf.
Kein Wunder, daß ich ihn nicht kannte: Was klassische Musik im zeitgenössischen Gewand betraf, war ich noch nie ein Experte gewesen. Er konnte mir also viel erzählen, ohne daß es unbedingt der Wahrheit entsprechen mußte.
Und dann erkannte ich, daß ich die Beweise schon in der Hand hatte.
Zunächst las ich nur die Schlagzeilen: »Berühmter Musiker vom Pech verfolgt!« - »Mordanschläge auf Charles Hencock?« - »Charles Hencock: Das ist kein Zufall!« - »Mordanschläge durch Magie?« - Hencock: »Ich fühle mich bereits als toter Mann!«
Ich ließ die Ausschnitte sinken, blickte Hencock an. Seine Miene war verzerrt, als würde er jeden Augenblick zu weinen beginnen. Der Mann war mit den Nerven total am Ende.
»Ich - ich kann nicht mehr spielen, Mr. Tate. Meine Nerven machen es nicht mehr. Deshalb haben sie mir auch freigegeben. Bitte, helfen Sie mir!«
»Wie kommen Sie ausgerechnet an mich?«
»Ich - ich habe Ihren Namen von einem guten Bekannten erfahren: Ernest Leighton! Ich kam ins Gespräch mit ihm. Er ist hoher Regierungsbeamter. Sie kennen ihn doch, oder?«
Natürlich kannte ich Ernest Leighton - schon seit vielen Jahren, bevor er so hoch an der Spitze der Erfolgsleiter angelangt war. Er hatte mir oftmals Aufträge besorgt.
Und jetzt auch Charles Hencock?
Ich konnte es leider nicht überprüfen. Dazu hätte ich anrufen müssen, wozu keine Gelegenheit mehr war.
»Bitte begeben Sie sich zum Ausgang!« sagte eine der freundlichen Hostessen über Lautsprecher. »Halten Sie bitte auch Ihre Bordkarten bereit!«
»Ich kenne ihn, ja!« sagte ich zu Hencock. Ringsum herrschte allgemeine Aufbruchstimmung. Ich wurde kribbelig und wollte ebenfalls zum Ausgang.
»Und dann, Mr. Tate, war das vor der Flugzeughalle. Ich habe Ihren Namen gehört und wußte sofort, daß nur Sie mir helfen können.«
»Ich verstehe noch immer nicht, wie Sie darauf kommen. Das alles ist doch kein Grund.«
So mißtrauisch war ich selten. Ich wußte selbst nicht warum.
»Das Schlimme ist, Mr. Tate, ich kenne meinen Gegner!« Kunstpause. »Noch etwas, Mr. Tate: Ich hege die berechtigte Vermutung, daß es sich bei unseren Gegnern um ein und dieselbe Person handelt: Um eine geheimnisvolle Frau, um eine Hexe! Deshalb nur habe ich mich an Sie gewendet. Was, glauben Sie, was mir die Polizei erzählt, wenn ich mit dieser Geschichte dort aufkreuze?«
Ich sah nach May Harris. Sie war ungewöhnlich ernst und zurückhaltend.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Mr. Hencock: Sie überlassen mir erst mal die Zeitungsausschnitte. Dann reden wir später an Bord der Maschine weiter. Es sieht so aus, als wäre sie nur höchstens zur Hälfte besetzt. Es wird sich schon eine Gelegenheit zum Gespräch ergeben.«
Ich mußte den Mann loswerden. Schließlich wollten wir erst die Sicherheit des Flugzeuges checken. Dazu brauchten wir weder Zeugen noch Störenfriede.
Charles Hencock zeigte sich erstaunlich einsichtig. Es mochte daran liegen, weil er darin eine Chance sah. Es schien ihm wirklich ernst zu sein.
Wir ließen Hencock vorgehen und bildeten das Schlußlicht.
»Wenn du dich immer so kundenfeindlich benimmst, mein lieber Herr Privatdetektiv, dann kriegst du bald keine Aufträge mehr!« zischte mir May zu.
»Ich benehme mich sonst anders, ehrlich. Nur bin ich bei diesem Hencock aus ungewissen Gründen unwahrscheinlich mißtrauisch. - Und was ist mit dir? Du hast dich auch recht zurückhaltend benommen. Hast überhaupt keinen Grund, mir Vorwürfe zu machen!«
»Ich habe versucht, seine Gedanken zu lesen, Mark.«
»Na und?«
»Fehlanzeige!«
»Inwiefern?« _
»Als wäre dieser Hencock überhaupt nicht vorhanden. Genauso könnte ich mich auf irgendeinen x-beliebigen Punkt in der Luft konzentrieren und versuchen, dessen Gedanken zu erraten: Da ist absolut nichts!«
»Unmöglich!«
»Ich kann es mir selber nicht erklären. Ja, unfaßbar!«
»Meinst du, es droht uns eine Gefahr von ihm?«
»Wie soll ich denn das beurteilen, Darling, wenn ich ihn nur mit meinen normalen fünf Sinnen wahrnehmen kann?«
Ich bohrte nicht mehr weiter. Es brachte einfach nichts.
Die Figur des Charles Hencock war und blieb geheimnisvoll - und ausgerechnet zu einem Zeitpunkt mußte ich auf ihn treffen, da ich gewiß andere Sorgen zu bewältigen hatte.
Doch dann dachte ich an die seltsame Parallelität. Behauptete Hencock nicht, daß er mit mir denselben Gegner teilte: die Hexe Helen Sanders?
Nein, den Namen hatte er nicht genannt, aber...
Ärgerlich schob ich alle Gedanken daran beiseite. Es war jetzt viel wichtiger, mich auf den Schavall und auf eventuelle Warnsignale von ihm zu konzentrieren.
Flüchtig sah ich die hochgewachsene Gestalt in der Reihe vor mir: Charles Hencock mit seinem kleinen Geigenkasten. Er nahm überhaupt keine Notiz von mir. Weil er meinen Wunsch respektierte, daß wir erst während des Fluges miteinander verhandelten?
Es fiel mir wirklich schwer, nicht mehr an ihn zu denken.
10
Die Hexe erschien nur wenige Schritte von dem Pärchen entfernt. Sie bemerkten beide ihr Kommen. Ihre Köpfe flogen herum. Nacktes Grauen verdrängte die tiefen Gefühle, die sie füreinander hegten.
Etwas verdunkelte das Fenster, als hätte sich eine schwarze Wolke vor das Antlitz der Sonne geschoben. In die entstehende Düsterheit grellte ein Licht. Es schmerzte in den Augen.
Der Lichtpunkt vergrößerte sich rasch, nahm kontinuierlich dazu an Intensivität ab, verwandelte sich in eine strahlende Aura. War es ein Tor zu einer jenseitigen Welt? Diffuse Schatten bewegten sich dahinter. Der Schein blieb unruhig.
Eine Gestalt erschien darin.
Die Dämonenhexe Helen Sanders war nackt, aber die Aura ließ ihren Körper undeutlich erscheinen, wie unter einem dünnen Schleier.
So schön war Helen Sanders nie zuvor gewesen - nicht zu Zeiten ihres normalen Lebens. Steve Candall wurde das bewußt, als sich die Aura verengte und sie einhüllte wie eine zweite Haut. Das Gesicht wurde deutlicher.
Dominierend blieben dabei die Augen. Ein magisches Feuer loderte darin, ein Feuer, das Menschen vernichten konnte.
Diese schrecklichen Augen richteten sich auf die zierliche Französin.
Helen Sanders trat näher. Die Aura machte jede Bewegung mit, doch erschien es dabei, als bliebe ein rauchiger Schleier zurück, der rasch verblaßte.
Ihre festen Brüste wippten. Die Hexe war die personifizierte Versuchung. Doch ihr überaus begehrenswerter Anblick, der das Herz eines jeden Mannes höherschlagen ließ, sein Blut schier zum Kochen brachte und seine Sinne verwirrte, ließ Steve Candall kalt. Nein, das war längst nicht mehr »seine« Helen. Dies war ein Wesen der Hölle, das Böse schlechthin.
Ihr flammender Blick traf Gilberte Bujold, um sie in die Knie zu zwingen.
Warum? fragte sich Steve Candall verzweifelt. Was verbindet mich noch mit Helen? Kann es sein, daß sie Besitzansprüche hegt? Wie ist das möglich? Sie hat auf mich verzichtet zugunsten der höllischen Mächte, mit denen sie seitdem im Bunde steht.
Er konnte es nicht begreifen. Auch war er unfähig, in das Geschehen in irgendeiner Form einzugreifen. Er stand nur da, drückte Gilberte Bujold fest an sich und hatte um sie, die er wirklich liebte, schreckliche Angst.
Die Hexe sagte kein Wort. Sie näherte sich bis auf einen Schritt, ließ Gilberte Bujold nicht aus den Augen.
Etwas stimmte nicht! Steve Candall bekam es erst heraus, als er sich von der Hexe abwandte und nach der Französin sah.
Gilberte Bujold erwiderte den Blick. Sie tat es trotzig. Es schien ihr egal zu sein, was das für Folgen für sie haben konnte.
Helen Sanders verstrahlte überreichlich ihre negativen Energien. Steve Candall wußte in diesem Augenblick, daß sie Gilberte vernichten wollte.
Doch es gelang ihr nicht!
Gilberte Bujold war eine Frau, die mit ganzem Herzen liebte. Bei einer solchen Frau versuchte sich das Böse vergebens.
Es konnte ihr ebensowenig geschehen wie einem Wahnsinnigen - vielleicht weil wahre Liebe ein gutes Stück Wahnsinn ist?
Steves Gedanken drehten sich im Kreis. Er hatte sich zwangsläufig mit Magie beschäftigen müssen und wußte deshalb einigermaßen um die Gesetzesmäßigkeiten.
Magie ist kein Mittel, die Naturgesetze zu verbiegen oder gar unwirksam zu machen. Magie ist ein Teil der Naturgesetze - jener Teil, den ein normaler Mensch nie begreifen kann. Es ist denjenigen überlassen, die damit umzugehen wissen.
Und wo die Naturgesetze dank Magie scheinbar überwunden werden, geschieht in Wahrheit etwas anderes: Die Gesetze der Magie werden voll wirksam!
Das war fast wissenschaftlich und deshalb ein Umstand, den Steve mit seinem besonders geschulten Verstand durchaus erfassen konnte.
»Weiche!« fauchte Gilberte Bujold. »Weiche, Hexe, Werkzeug des Satans! Hier ist eine Insel des Friedens, eine Insel der Liebe, zu der du keinen Zutritt mehr hast. Mach deine magischen Kräfte wirksam! Sie prallen ab oder werden absorbiert wie Regen von einem glühenden Stein. Ohne Chancen, ihm etwas anzuhaben.«
Die Hexe stieß ein abgrundtiefes Stöhnen aus. Ihr schönes Gesicht verzerrte sich. Sie wich einen Schritt zurück. Die Aura befreite die Nacktheit ihres makellosen Körpers. Nie zuvor hatte Steve Candall eine so schöne Frau gesehen.
Ruhig tastete sein Blick diesen Körper ab - wie der Architekt sein Bauwerk bewundert. Keine Begierde erwachte in ihm, sondern nur ein gewisses Maß an Bewunderung.
Bis er erfaßte, was für eine Schönheit das war: Eine Schönheit, die das Böse verbergen sollte!
Er erinnerte sich an ein Sprichwort: »Schönheit ist perfekte Tarnung, um das wahre Wesen eines Menschen zu vertuschen!«
Plötzlich widerte ihn dieser Körper an. Er hätte ausspeien mögen.
Und Helen Sanders spürte diesen Widerwillen ganz deutlich. Sie zuckte zusammen wie unter einem Peitschenhieb. Sie, die mächtige Hexe, die tausend Menschen auf einmal total versklaven konnte, traf auf eine Macht, der sie nicht gewachsen schien. Und diese Macht war eigentlich keiner magischen Natur: Es war nur die wahre Zuneigung zweier Menschen füreinander!
Es spielte dabei überhaupt keine Rolle, wie lange diese Zuneigung bereits währte. Sie war da wie ein Bollwerk gegen alles, was dem feindlich gesinnt war.
Die Hexe mußte kapitulieren. Sie tat es auf ihre Art. Nicht, daß sie sich zähneknirschend zurückzog.
Auf einmal warf sie den Kopf in den Nacken, daß ihre langen Haare flogen. Ein eiskalter Lufthauch wehte durch das Hotelzimmer, spielte mit den Haaren.
Auf einmal hatte die Hexe ein schleierähnliches Gewand an, das der Wind bauschte und vorn gegen ihr Körperprofil preßte. Sie bog ihren Oberkörper etwas zurück - und dann lachte sie. Ihr schallendes Gelächter brach sich an den Wänden, wurde zu einem Sturm, der gegen die beiden Liebenden anbrandete, ohne sie jedoch von der Stelle bewegen zu können.
Abrupt brach Helen Sanders ab. Ihr flammender Blick richtete sich auf die beiden.
»Euer Triumph kommt zu früh!« kreischte sie. »Ihr kennt meine Macht noch nicht. Die Ruine von Ardon hat sie mir geschenkt. Ich habe alle Energien in mich aufgesogen, bediene mich ihrer, habe damit weitere Quellen angezapft. Ich bin bereits stark genug, um die Welt mit meinen negativen Kräften zu überrollen. Aber ich lasse mir Zeit, denn ich bin unsterblich. Es gibt Gegner, die ich nacheinander ausschalte, ehe ich mich geruhsam ans Werk mache. Die Welt wird vor mir erzittern. Die Mächtigen der Erde werden mir wimmernd und um Gnade flehend zu Füßen liegen.
Dies ist kein leeres Geschwätz, sondern der Fluch des Satans. Ich werde es sein, der diesen Fluch erfüllt!«
Mit einem Donnerschlag verschwand Helen Sanders.
Alles war wieder wie vordem. Nichts hatte sich verändert. Nichts verändert? Schluchzend warf sich Gilberte in die Arme des Geliebten.
Beruhigend streichelte Steve Candall über ihr seidiges Haar. Er küßte ihren Scheitel.
Gilberte Bujold war eine tapfere Frau. Sie fing sich schnell, sah an Steve empor.
»Was soll nur werden?«
Sein Gesicht wirkte hart und kantig. Er schien in den letzten Minuten um Jahre gealtert zu sein.
»Wir haben uns dieses Schicksal nicht selbst ausgesucht. Es ist das Los des Menschen, daß er seinem Schicksal begegnet oder untergeht. Wir werden nicht untergehen, Gilberte, weil wir uns lieben. Wir sollten uns vielmehr Sorgen machen um die anderen.«
»Glaubst du denn wirklich, daß sie keine Möglichkeiten hat, gegen uns persönlich anzugehen?«
»Ich weiß inzwischen eine Menge über Magie und deren Gesetzesmäßigkeiten, aber nicht genug, um diese Frage erschöpfend zu beantworten. Du hast es selbst erlebt. Sie hat einen Versuch gestartet und ist dabei gescheitert. Das nächste Mal, so fürchte ich, wird sie die Umstände besser kennen und auch besser darauf eingehen. Dann sind ihre Erfolgsaussichten wieder wesentlich höher.«
»Warum hat sie das getan? Warum kam sie? Warum wollte sie mich vernichten?«
»Ich weiß es ehrlich nicht, Liebling! Es sieht so aus, als wollte sie das Geheimnis von Ardon unter allen Umständen wahren. Vielleicht, um nicht andere Magier oder andere Hexen darauf aufmerksam zu machen? Es gibt unglaublich viele Diener der Hölle. Daß sie uns nicht längst schon unterjocht haben, liegt einfach an der Rivalität, die sie untereinander hegen - und an ihren Gegnern, den Teufelsjägern, Hexenjägern, Dämonenkillern, den Kämpfern für das Gute, den Vertretern der Weißen Magie. Mark Tate und seine Freunde gehören zu diesem Kreis. Genauso wie ein gewisser David Murphy oder Ranulf O'Hale. Es gibt noch andere, die wir nicht kennen. Ein jeder mit seiner Methode, ein jeder auf seinem Platz. Gegen das Böse, wo immer sie es antreffen.«
»Wenn Mark Tate nur herkommen würde!« sagte Gilberte Bujold. Sie wünschte es sich inbrünstig. Auf einmal setzte sie alle Hoffnungen auf diesen Mann.
Steve zuckte die Achseln. »Wir sollten noch einmal versuchen, ihn telefonisch zu erreichen. Aber ich kenne seine Nummer nicht.«
»Der Professor hat sie doch!«
Sie löste sich von Steve und eilte zur Tür. Bevor Gilberte ihr Ziel erreichte, öffnete sich die Tür und Professor Barlow stand im Rahmen.
»Nicht notwendig!« sagte er heiser. Er hielt etwas in der Hand. Da er die Hand geschlossen hatte, konnte man den Gegenstand nicht erkennen.
Aus ungewissen Gründen war Steve auf einmal sehr neugierig darauf.
Professor Barlow trat ein und schloß hinter sich.
»Ich habe alles mitbekommen!« eröffnete er.
Steve blickte ihm ins Gesicht und erschrak. Professor Barlow sah schlimm aus. Als wäre er dem Teufel persönlich begegnet.
Der Professor angelte sich einen Stuhl und setzte sich.
»Die Würfel sind gefallen!« sagte er tonlos.
Die beiden hatten keine Ahnung, was der Professor mit diesen Worten meinte.
Gilberte fragte ihn: »Was wollen Sie damit sagen, Professor? Wegen was sind die Würfel gefallen?«
Ruckartig wandte er sich ihr zu.
»Wir können die geplante Aktion nicht durchführen!«
»Wie bitte?«
»Die Gefahr ist einfach zu groß.«
»Das ist doch nicht Ihr Ernst! Professor, seit vier Wochen wohnen wir in diesem Hotel. Sehen wir einmal ganz von den ungeheuren Kosten ab, denken wir nur an die Arbeit, die in allem steckt. Unsere Beweisführung ist lückenlos und wird die Welt der Archäologen aufhorchen lassen. In Zukunft werden sich wohl viele um das Enträtseln magischer Dinge aus der Antike kümmern. Da liegen einige Rätsel brach. Man muß sie entschlüsseln und unser Wissen in solchen Dingen erweitern. Vor Tausenden von Jahren waren uns die Menschen in dieser Beziehung weit überlegen. Heute klammert sich alles an Technik und Wissenschaft fest. Das Fundamentale wird einfach vernachlässigt.«
Professor Barlow schüttelte den Kopf.
»Mein Gott, so sehen Sie es doch ein, Gilberte! Ist denn nicht schon genug passiert?«
»Sie wissen, was sich hier abgespielt hat?« erkundigte sich Steve Candall mißtrauisch.
»Ja, Steve, ich weiß es!«
»Aber wieso...?«
Endlich öffnete Professor Barlow die Hand. Ein technisches Gerät lag darin.
»Das sind die Zauberdinge der Modernen. Jeder Mensch aus dem Altertum hätte geglaubt, es könnte uns gelingen, die Naturgesetze unwirksam zu machen. Wir wissen, daß es nicht geht. Ebenso wie es der Magier weiß - sein Vorteil uns gegenüber.« Eine Kunstpause. Dann: »Ich habe mich unter einem Vorwand zurückgezogen, ließ Sie bewußt allein. Dabei erlaubte ich mir, ein kleines Ei zurückzulassen.« Er deutete mit dem Daumen auf den Tisch. »Ein Abhörmikrofon in der Blumenvase. Das ist gewiß nicht originell, wie ich zugeben muß, dafür aber doppelt wirksam. Vielleicht hat es selbst die Hexe nicht geahnt? Oder es war ihr egal. Ich sollte ruhig alles wissen.«
Er legte das Ding, das er noch immer in der Hand hielt, auf den Tisch.