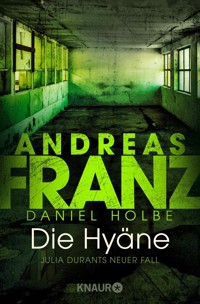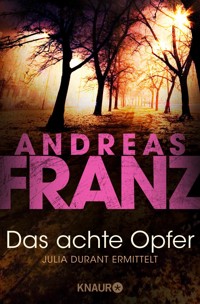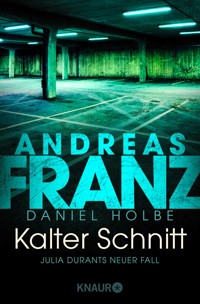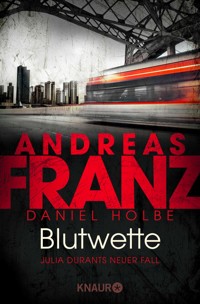9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Peter Brandt ermittelt
- Sprache: Deutsch
Kommissar Peter Brandt ist gerade aus einem Kurzurlaub mit seiner Freundin, der Staatsanwältin Elvira Klein, zurück, als er mit einem besonders seltsamen Mordfall konfrontiert wird. Am Mainufer in Offenbach wird eine Hausfrau tot aufgefunden. Das Merkwürdige daran: In ihrer Hand hält sie einen Olivenzweig, und in ihrem Mund findet man eine Olive und eine Taubenfeder. Sehr schnell stößt der Kommissar auf das Geheimnis der Toten: Sie ging offenbar einem äußerst lukrativen Nebenerwerb nach, genau wie zwei weitere Frauen, die in den letzten zwölf Monaten ermordet wurden. Peter Brandt betritt eine Welt aus religiösem Fanatismus, Gewalt und Rache. Teufelsleib von Andreas Franz: packender Thriller im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Andreas Franz
Teufelsleib
Ein Peter-Brandt-Krimi
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Kommissar Peter Brandt ist gerade aus einem Kurzurlaub mit seiner Freundin, der Staatsanwältin Elvira Klein, zurück, als er mit einem besonders seltsamen Mordfall konfrontiert wird. Am Mainufer in Offenbach wird eine Hausfrau tot aufgefunden. Das Merkwürdige daran: In ihrer Hand hält sie einen Olivenzweig, und in ihrem Mund findet man eine Olive und eine Taubenfeder.
Sehr schnell stößt der Kommissar auf das Geheimnis der Toten: Sie ging offenbar einem äußerst lukrativen Nebenerwerb nach, genau wie zwei weitere Frauen, die in den letzten zwölf Monaten ermordet wurden. Peter Brandt betritt eine Welt aus religiösem Fanatismus, Gewalt und Rache.
Inhaltsübersicht
[Motto]
Prolog
Montag
Montag, 4. Januar 2010
Donnerstag
Donnerstag, 14. Januar 2010, 16.30 Uhr
Donnerstag, 17.45 Uhr
Donnerstag, 20.35 Uhr
Freitag
Freitag, 9.40 Uhr
Freitag, 13.40 Uhr
Freitag, 15.25 Uhr
Freitag, 16.21 Uhr
Freitag, 17.05 Uhr
Freitag, 18.22 Uhr
Freitag, 19.56 Uhr
Freitag, 20.50 Uhr
Samstag
Samstag, 11.35 Uhr
Samstag, 16.10 Uhr
Samstag, 17.05 Uhr
Samstag, 17.10 Uhr
Samstag, 18.55 Uhr
Samstag, 19.00 Uhr
Samstag, 23.13 Uhr
Samstag, 23.35 Uhr
Sonntag
Sonntag, 6.45 Uhr
Sonntag, 12.25 Uhr
Sonntag, 18.45 Uhr
Sonntag, 16.10 Uhr
Sonntag, 17.35 Uhr
Montag
Montag, 2.44 Uhr
Montag, 0.06 Uhr
Montag, 3.27 Uhr
Montag, 3.40 Uhr
Montag, 4.35 Uhr
Montag, 4.44 Uhr
Montag, 5.10 Uhr
Montag, 9.04 Uhr
Montag, 12.20 Uhr
Epilog
Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er dabei nicht zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Friedrich Nietzsche
Prolog
Seine Miene war düster. Seine Gedanken waren düster. Alles um ihn herum war düster, obgleich die Sonne schien und viele fröhliche Menschen in seiner Nähe waren. Düster starrte er in die noch halbvolle Tasse Kaffee, düster auf das Stück Kuchen, das er bestellt hatte und das noch so auf dem Teller lag, wie die junge, hübsche Bedienung es ihm vor zehn Minuten gebracht hatte. Eine brünette junge Frau, die zu den vielen hübschen jungen Frauen zählte, die ihm tagtäglich über den Weg liefen und mit denen er so viel zu tun hatte.
Er hatte sich in die hinterste Ecke des Cafés zurückgezogen, während die meisten Gäste die warmen Strahlen des Frühlings auf den vor dem Café aufgestellten Stühlen genossen. Manche lasen Zeitung, manche unterhielten sich, manche hielten einfach nur das Gesicht in die Sonne. Singles, Pärchen, Ehepaare, Geschäftsleute, die für einen Moment hier Rast machten, als wollten sie den Winter abschütteln.
Doch ihm war nicht nach Sonne, in ihm waren keine Frühlingsgefühle, in ihm waren nur Dunkelheit und Hass. Hass auf die Welt, die Menschen, auf sich selbst.
Er nahm einen Schluck von dem Kaffee, biss von dem Kuchen ab und legte den Rest wieder auf den Teller. Seine Gedanken waren weit weg, auch wenn er alles um sich herum wahrnahm, die Geräusche von der Straße, die Unterhaltungen, das Klappern von Geschirr, die Espressomaschine, die ein ums andere Mal angeworfen wurde …
Er war allein, war immer allein gewesen. Seit seiner frühesten Kindheit abgestellt wie ein altes Möbelstück. Doch er hatte sich schon vor vielen, vielen Jahren damit abgefunden. Er ging seiner Arbeit nach, aber er pflegte kaum Kontakt zu seinen Kollegen, es gab lediglich eine Kollegin, die er gemocht hatte und mit der er einige Male ausgegangen war, ins Kino, ins Theater oder ins Restaurant. Einmal hatte er mit ihr geschlafen. Aber dann hatte er erfahren müssen, dass sie nur Freundschaft für ihn empfand und keine Liebe, dabei liebte er sie, ohne es ihr je gesagt zu haben. Als er sie fragte, ob sie sich vorstellen könne, dass mehr zwischen ihnen sein könnte, lachte sie, streichelte ihm über die Wange und antwortete, dies sei die falsche Frage. »Belassen wir’s so, wie es ist. Mehr möchte ich nicht, es würde unsere Freundschaft nur zerstören. Vielleicht wäre es auch ganz gut, wenn wir uns für eine Weile nicht treffen würden.«
»Warum?«, hatte er gefragt und gemeint, eine eiserne Faust in seinem Magen zu spüren.
»Warum was?«
»Was hast du gegen mich?«
»Ich habe doch nichts gegen dich, ich mag dich, aber Liebe … Mein Gott, was für ein großes Wort. Es gibt keine Liebe, das ist alles nur Chemie und Biologie, und das weißt du doch auch. Tut mir leid, aber es würde zwischen uns niemals funktionieren. Ich bin wie ein Schmetterling, der von Blüte zu Blüte fliegt. Akzeptiere das bitte. Du würdest nur unglücklich mit mir werden, oder, anders ausgedrückt, ich würde dich nur unglücklich machen. Ich glaube, es ist besser, wenn ich jetzt gehe. Sei nicht traurig, es war eine schöne Zeit.«
»Heißt das, du willst mich nicht mehr sehen? Nie mehr?«
»Ich weiß es nicht. Lassen wir es doch am besten, wie es einmal war – rein beruflich … Moment, mein Handy klingelt.«
Er erinnerte sich nur zu gut daran, wie Liane das Telefon aus ihrer Handtasche holte, wie ihre Miene sich aufhellte und ihr Gesicht aufzuleuchten schien. Wie sie sagte, sie werde in zehn Minuten da sein. Wie sie hinzufügte: »Nein, nicht jetzt, das erzähl ich dir später.« Wie sie das Telefon wieder in die Tasche steckte und meinte: »Ich muss leider los, eine Freundin braucht mich. Und denk noch mal über meine Worte nach. Ich will doch nur nicht, dass du verletzt bist. Wie gesagt, es würde nie funktionieren, weil diese ganz bestimmte Chemie bei uns nicht hinhaut. Und jetzt zieh nicht so ’ne Flunsch, es ist besser, wenn ich es dir jetzt sage als in ein paar Wochen oder Monaten. Und es war auch ganz gut so, dass wir nur einmal miteinander geschlafen haben. Im Nachhinein betrachtet war es ein Fehler.«
Sie war aufgestanden, hatte ihre Tasche genommen, ihm ein »Ciao, ciao« zugeworfen und war gegangen. Eine wunderschöne junge Frau, intelligent, aufgeschlossen, extrovertiert – und verlogen. Ein Fehler war es also gewesen, mit ihm geschlafen zu haben. Dabei war es für ihn die Erfüllung gewesen und die Hoffnung auf eine schöne Zukunft. Und nun hatte sie alles zunichte gemacht mit ein paar dahingeworfenen Worten, wie ein paar vergammelte Fleischhappen, die man einem verrotteten Köter zuwirft.
Liane hatte nicht gemerkt, wie er ihr gefolgt war, wie er beobachtete, dass sie zu einem älteren Mann in einen Porsche einstieg und diesen lange und innig küsste, bevor sie losfuhren.
Danach hatten sie sich nur noch bei der Arbeit gesehen, sie hatten sich hin und wieder unterhalten, Kaffee getrunken, und er hatte ihr erklärt, dass sie wohl recht gehabt hatte mit ihrem Vorschlag einer Auszeit.
Aber er hatte sie weiterhin beobachtet, sie wie ein Phantom auf Schritt und Tritt verfolgt, ohne dass sie davon etwas ahnte. Und immer traf sie sich mit diesem Mann, der mindestens fünfzehn, eher zwanzig Jahre älter war und ganz offensichtlich steinreich. Er hatte ihn in einem Porsche, einem Jaguar, einmal sogar in einem Bentley kommen sehen. Ein dekadenter alter Mann, dessen Geld für Liane wie ein Aphrodisiakum gewirkt haben musste.
Er war geduldig und ließ fast vier Monate verstreichen, bevor er sie an einem späten Mittwochabend, nachdem ihr Liebhaber gegangen war, zu Hause aufsuchte. Es war so leicht gewesen, er hatte um kurz nach halb elf geklingelt und gefragt, ob er kurz hochkommen könne, es ginge um etwas Berufliches und sei sehr dringend, er bräuchte unbedingt ihre Meinung. Er würde ihre Zeit auch nicht allzu lange in Anspruch nehmen.
Er solle hochkommen, hatte sie gesagt und die Tür geöffnet und ihn angelächelt. Ein Lächeln, das wie ein Zauber auf ihren Lippen lag und doch nicht aufrichtig war. Ein Lächeln, so verlogen wie alles an und in ihr. Das verlogene Lächeln eines Miststücks, einer geldgeilen Hure, die sich mit einem wie ihm nie länger abgeben würde. Zum Zeitvertreib war er gut genug gewesen, aber nur, damit sie keine Langeweile hatte. Wie in seinem ganzen Leben zuvor fühlte er sich auch von ihr benutzt.
Er trat in die Wohnung, in der er schon so oft gewesen war, wo sie sogar einmal miteinander geschlafen hatten, und nun kam es ihm so vor, als hatte sie ihn testen wollen, ob er gut genug für sie war. Oder sie hatten es einfach nur miteinander getrieben, weil sie ein paar Gläser Wein zu viel getrunken hatten. Für ihn war es trotzdem schön gewesen, weil er das erste Mal in seinem Leben richtig mit einer Frau geschlafen hatte.
»Was gibt es so Wichtiges?«, fragte sie und schenkte sich ein Glas Wein ein, ohne ihn zu fragen, ob er auch eines möchte. Ihre Stimme klang kühl, ein wenig abweisend sogar.
»Nur eine Kleinigkeit, bin auch gleich wieder weg.«
Er war nur knapp zehn Minuten geblieben.
Ihre Leiche wurde am nächsten Tag entdeckt. Zwei Messerstiche in Bauch und Herz. Vom Täter fehlte jede Spur. Alle, die mit ihr zu tun gehabt hatten, wurden von der Polizei vernommen, auch er. Die Befragung dauerte fünf, vielleicht sechs Minuten, dann wandten die Beamten sich anderen Kollegen zu. Bis heute hatte niemand auch nur die leiseste Ahnung, dass er sie umgebracht hatte.
Dieser Mord, den er in Darmstadt begangen hatte, lag nur knapp fünf Monate zurück, doch in den letzten Wochen, eigentlich schon seit Weihnachten, hatte eine unerklärliche Unruhe von ihm Besitz ergriffen, die er nicht unter Kontrolle bekam.
Die hübsche Bedienung kam an seinen Tisch und fragte ihn lächelnd, ob sie ihm noch einen Kaffee bringen solle. Seine düstere Miene hellte sich schlagartig auf, und er antwortete, dass er gerne noch einen Kaffee hätte. Sie ging an den Tresen, ein junger Mann schlich sich von hinten an sie heran, gab ihr einen Kuss auf den Hals und fasste sie kurz, doch kräftig an den Po. Sie lachte auf und meinte so leise, dass kaum einer es hören konnte, dass er sich das für später aufheben solle.
Sie brachte ihm den Kaffee, er bat um die Rechnung. Als er nach einer weiteren Viertelstunde das Café verließ, war ihm klar, dass er gewisse Gefühle und Triebe nie würde unterdrücken können. Und er wollte es gar nicht mehr, zu lange hatte er es versucht.
Auf dem Weg nach Hause begegnete er drei Menschen, die er kannte. Er unterhielt sich mit ihnen, war freundlich und zuvorkommend wie immer. Eine Maske, die er schnell aufgesetzt hatte und von der keiner wusste, dass es nur eine Maske war. Eine Maske, hinter der sich Abgründe auftaten.
Zu Hause angekommen, legte er eine CD ein, Ravels Bolero. Er dachte an den Film Zehn – die Traumfrau mit Dudley Moore und Bo Derek und schloss die Augen. Er würde es tun, er musste es tun. Und je länger diese Gedanken ihn beherrschten, desto stärker, ja unerträglich wurde dieser Druck. Im Kopf und in den Lenden.
Ihr werdet euch wundern, dachte er und stellte die Musik ein wenig lauter, während er mit geschlossenen Augen masturbierte. Er ejakulierte, doch der Druck blieb, und er wusste, es gab nur ein Mittel, diesen Druck loszuwerden. Er musste töten. Am nächsten Abend wurde die Leiche einer jungen Frau gefunden, die als Bedienung in einem Café in Frankfurt gearbeitet hatte. Der Druck war für eine Weile gewichen.
Montag
Montag, 4. Januar 2010
Peter Brandt und Elvira Klein hatten neun erholsame Tage an der Algarve verbracht. Es war bereits das vierte Mal, dass Brandt ohne seine Töchter Sarah und Michelle in Urlaub fuhr. Diese hatten es vorgezogen, den größten Teil der Weihnachtsferien bei ihrer Mutter in Spanien zu verbringen. Nur Heiligabend hatten sie noch gemeinsam begangen, Brandt, seine Eltern, Elvira Klein, Sarah, Michelle und Brandts Ex-Frau, die es sich nicht nehmen ließ, die Neue an seiner Seite zu begutachten, mit der er nun schon geraume Zeit zusammen war. Doch Brandt merkte schnell, dass sie lieber in Spanien geblieben wäre, denn so attraktiv und hübsch hatte sie sich die Klein, wie sie sie etwas abfällig nannte, nicht vorgestellt, auch wenn Sarah und Michelle ihr mit Sicherheit schon einiges über sie erzählt hatten. Nun, Erzählungen und das Sehen mit eigenen Augen waren zwei verschiedene Paar Schuhe. Obwohl sie sich bemühte, es gelang ihr nicht, den Neid auf die so deutlich Jüngere zu unterdrücken, und so ließ sie sich ein paarmal zu spöttischen Bemerkungen hinreißen (was Brandt aus früheren Zeiten nur zu gut kannte), die Elvira souverän ignorierte.
Als seine Ex ihn schließlich zur Seite nahm und mit einem maliziösen Unterton flüsterte: »Ist sie nicht um einiges zu jung und vor allem zu groß für dich, ich meine, sie ist doch bestimmt zehn Zentimeter größer?«, hatte er in seiner gewohnt gelassenen Art gekontert: »Acht Zentimeter. Und damit du dir keine Gedanken mehr zu machen brauchst, für mich ist sie die Größte, und damit meine ich: die beste Frau, die mir je begegnet ist.«
Daraufhin hatte seine Ex beleidigt den Mund gehalten. Dennoch war es insgesamt gesehen ein schöner Heiligabend gewesen, sie hatten gut gegessen und waren gegen Mitternacht zu Bett gegangen, da Sarah, Michelle und ihre Mutter bereits am Vormittag des ersten Weihnachtstages nach Spanien und Brandt und Klein nach Portugal fliegen wollten.
Brandt und Klein hatten in einem direkt über dem Meer liegenden Luxushotel gewohnt, hatten ausgedehnte Spaziergänge am schier endlosen Strand unternommen, waren an den südwestlichsten Punkt Europas gefahren, um sich den würzigen Duft des Meeres um die Nase wehen zu lassen, und sie hatten an einer großen Silvesterparty teilgenommen, wie Brandt noch keine zuvor erlebt hatte. Das Wetter hatte wunderbar mitgespielt, es gab nicht einen Moment, der ihnen den Urlaub vermiest hätte. Doch als sie am Sonntag, dem 3. Januar, spätabends zurückkehrten, kamen sie in die Kälte, es hatte geschneit, überhaupt war es bereits seit Mitte Dezember für die hiesigen Verhältnisse überaus kalt und schneereich gewesen. Sie fuhren mit dem Taxi vom Flughafen in Elviras Wohnung in der Frankfurter Innenstadt, wo Brandt sich schon seit längerem mindestens genauso oft aufhielt wie in seiner Wohnung in der Elisabethenstraße in Offenbach.
Seit über zwei Jahren waren er und Elvira Klein nun zusammen, und noch immer war da dieses Feuer, dieses Prickeln zwischen ihnen, was in erster Linie daran lag, dass sie auf einer Wellenlänge funkten und sich über fast alles unterhalten konnten. Zudem hatte Elvira Klein in ihm endlich einen Partner gefunden, an den sie sich anlehnen konnte und bei dem sie sich behütet fühlte. Der Bulle und die Staatsanwältin, wie Brandt ihre Beziehung scherzhaft nannte. Der Bulle und die Staatsanwältin, die sich anfangs überhaupt nicht hatten ausstehen können, zumindest gaben sie dies dem jeweils anderen zu verstehen, doch in ihrem tiefsten Innern hatten sie sich vom ersten Moment an gemocht. Brandt hatte gespürt, dass hinter der rauhen Schale, die Elvira Klein umgab, eine liebenswürdige, zuverlässige, aber auch verletzliche Frau steckte, was sie sogar im Beruf inzwischen einige Male gezeigt hatte, auch wenn sie sich gerne hart, unnachgiebig und tough gab. Die rauhe Schale diente einzig dazu, ihre Unsicherheit zu überspielen. Weder er noch sie hatten bei ihrem ersten Aufeinandertreffen geahnt, dass das Schicksal sie eines Tages zusammenführen würde.
Mittlerweile verstanden sie sich nahezu blind, es war, als hätten sie sich seit einer Ewigkeit gesucht, sich aber erst nach mehreren Jahren der Zusammenarbeit, die nicht immer einfach gewesen war, gefunden. Sie, die Anwaltstochter aus reichem Hause, und er, der im Vergleich zu ihrer Herkunft einfache Hauptkommissar, dessen Vater auch »nur« bei der Polizei gewesen war. Sie hatte nie in einer festen Beziehung gelebt, eine Singlefrau, wie man sie heutzutage haufenweise fand. Es hatte vor ihm auch nur einen Mann in ihrem Leben gegeben, doch die Sache, wie sie es nannte, war angeblich zu unbedeutend, als dass es sich gelohnt hätte, darüber zu sprechen. Er wusste nur, dass es eine lose Beziehung gewesen war, die nicht lange hielt.
Er hatte eine gescheiterte Ehe hinter sich, war alleinerziehender Vater von zwei mittlerweile fast erwachsenen und – wie er fand – bildhübschen Töchtern, das einzig Positive, was sie seiner Ansicht nach von ihrer Mutter hatten, einer rast- und ruhelosen Person, die nicht einmal jetzt zufrieden war, obwohl sie endlich mit dem Mann ihrer Träume, einem steinreichen Immobilienmakler, liiert war. Er bot ihr vor allem eines – Geld. Geld, das Brandt nie hatte, das sie aber trotzdem mit vollen Händen ausgegeben hatte. Zudem hatte sie sich ständig beschwert, dass er zu wenig tue, um auf der Karriereleiter nach oben zu klettern. Die Ehe war durch die ständige Nörgelei und Unzufriedenheit von Brandts Gattin schon früh zum Scheitern verurteilt gewesen, hatte aber immerhin fast zehn Jahre Bestand gehabt. Dann war sie eines Tages mir nichts, dir nichts verschwunden, nur einen Zettel hatte sie auf dem Tisch hinterlassen, auf dem sie ihm mitteilte, dass sie es mit ihm nicht mehr aushalte.
Am Ende waren viele Gehässigkeiten im Spiel gewesen, vor allem, als Brandt mit Zähnen und Klauen um das alleinige Sorgerecht für seine Töchter kämpfte und es schließlich auch bekam. Da er sie nicht gänzlich ihrer Mutter entziehen wollte, überließ er ihnen die Entscheidung, ob und wann sie ihre Mutter sehen wollten. Anfangs sahen sie ihre Mutter nur in unregelmäßigen Abständen, doch mittlerweile besuchten sie sie regelmäßig in ihrem Domizil in Spanien, wo sie, sofern sie nicht gerade auf Reisen war und in einem der fünf anderen über den Globus verteilten Häuser residierte, mit ihrem Mann eine mondäne Villa mit phantastischem Mittelmeerblick bewohnte.
Sie verwöhnte Sarah und Michelle nach allen Regeln der Kunst, und die Mädchen genossen es, vergaßen jedoch nie, wo ihre eigentliche Heimat war – in Offenbach, wo sie geboren und aufgewachsen waren. Sie waren nicht käuflich, aber warum sollten sie nicht annehmen, was ihre Mutter ihnen nicht auf einem silbernen, sondern einem goldenen Tablett servierte?
Seit Brandt mit Elvira zusammen war, verlief sein Leben in ruhigen und doch alles andere als langweiligen Bahnen. Zum ersten Mal meinte er, auf seinem Weg zu gehen und seinen Platz im Leben gefunden zu haben und dieses Leben auch endlich genießen zu dürfen. Er musste nicht mehr nur funktionieren und tun, was andere von ihm erwarteten und verlangten, sondern durfte sich auch einmal fallen lassen und die wenige freie Zeit genießen.
Brandt und Klein trennten Berufliches und Privates strikt, was anfangs nicht ganz einfach war, schließlich aber doch weitestgehend klappte. Sie war die Staatsanwältin, er der Ermittler. Sie stand über ihm, und er akzeptierte es, denn so hatten sie sich kennengelernt. Sie war Akademikerin, er ein »normaler« Kriminalkommissar. Aber nicht selten kam es vor – wie schon in der Zeit, bevor sie zusammenkamen –, dass sie unterschiedlicher Meinung waren, sie ihn anfauchte, was er gewöhnlich mit einem Schmunzeln oder einer lässigen Bemerkung abtat. Und nur wenige Stunden später war alles, was während des Tages gewesen war, so gut wie vergessen, und eigentlich, so hatten sie es sich vorgenommen, sprachen sie außerhalb der Dienstzeiten kaum über den Beruf und die Fälle, an denen sie gerade arbeiteten.
Seit einiger Zeit jedoch kamen sie nicht zur Ruhe, weshalb das Berufliche immer häufiger auch in ihr Privatleben eindrang. Sie hatten es mit einer ständigen Zunahme von Gewalttaten zu tun, die meisten von Jugendlichen und jungen Erwachsenen begangen, selbst Kinder, die noch nicht strafmündig waren, befanden sich darunter. Kinder – acht, neun, zehn Jahre alt –, die zum Teil eine für Beamte, Pädagogen und Psychologen erschreckende Grausamkeit an den Tag legten. Dabei handelte es sich nicht um kleinere Keilereien oder Ladendiebstähle, sondern um Kapitalverbrechen, für die die Kinder noch nicht belangt werden konnten.
Ein besonders erschreckender Fall betraf einen Elfjährigen, der Tränengas, einen Schlagring, ein Butterfly-Messer sowie einen Taser und einen Elektroschocker in seinem Schulranzen bei sich führte, als die Polizei den Schulranzen durchsuchte. Er behauptete, die Waffen von einem Mann gekauft zu haben, den er nicht näher kenne. Ins Visier der Fahnder war er geraten, nachdem eine Vierzehnjährige auf dem Nachhauseweg mit vorgehaltenem Messer gezwungen worden war, sich auszuziehen. Um sie mundtot zu machen, hatte der Täter mehrfach auf sie eingestochen und ihr Gesicht zerschnitten und sie anschließend neben dem Fußweg liegen gelassen. Das Mädchen überlebte, auch wenn sie fast drei Wochen im künstlichen Koma lag und ihr Gesicht erst in einigen Jahren nach zahlreichen Operationen einigermaßen wiederhergestellt sein würde. Doch ihre Seele würde diesen Nachmittag im April 2009 nie vergessen. Nachdem sie aufgewacht war, konnte sie sich an ihren Angreifer erinnern und aussagen, dass er auf dieselbe Schule ging wie sie. Warum der Junge diese brutale Tat begangen hatte, war bis heute im Dunkeln geblieben, da er schwieg, doch die Psychologen fanden nur eine Erklärung: Sie war hübsch und bei allen beliebt, während der Täter schon kurz nach seiner Einschulung von den Lehrern als schwer erziehbar eingestuft worden war. Obwohl sein IQ überdurchschnittlich hoch war, erhielt er keine entsprechende Förderung. Präpubertäre Frustration aufgrund Nichtbeachtetwerdens lautete die gutachterliche Diagnose, die so gut wie nichts über die Person aussagte. Unter präpubertärer Frustration und einer damit verbundenen Anstauung von Wut, Zorn und Hass litten mittlerweile viele Kinder. Doch bekämpft wurden meist nur die Symptome und nicht die Ursachen, und letztlich glaubte Brandt nicht an das Geschwafel einer präpubertären Frustration, sondern vermutete die Ursachen im sozialen Umfeld, doch die Mühe, das zu durchleuchten, machte sich keiner, da die chronische Unterbesetzung dies nicht zuließ.
Der Elfjährige lebte allein mit seiner Mutter und den sechs Geschwistern in einem heruntergekommenen Sozialbau in Lauterborn – wie so viele durch Straftaten auffällig gewordene Kinder stammte er aus miserablen sozialen Verhältnissen und hatte sich einem brutalen Leben auf der Straße schon früh angepasst, weil es für ihn keinen anderen, vernünftigen Lebensraum gab und die Zukunftschancen schon früh verbaut worden waren. Ein Leben auf der Straße, das seinen Anfang meist im Elternhaus nahm. Und nicht selten wurde das Klischee des saufenden Vaters, der schlampigen Mutter und der vermüllten Wohnung erfüllt.
In den vergangenen zwei Jahren hatten die Gewalttaten unter und von Jugendlichen überproportional zugenommen, ohne dass die Polizei oder das Jugendamt große Spielräume hatte, da in der Regel nur die Symptome, nicht aber die Ursachen bekämpft wurden. Viele Streifenpolizisten schoben Überstunden, auch Brandt und seine Kollegen hatten zahlreiche Zwölf- oder gar Vierzehnstundentage zu bewältigen. Dabei waren er und seine Kollegen vom K 11 für Kinder- und Jugendkriminalität in der Regel gar nicht zuständig, es sei denn, es handelte sich um ein Tötungsdelikt wie Mord, Totschlag oder fahrlässige Körperverletzung mit Todesfolge. Aber schon bald würde eine neue Abteilung geschaffen werden, mit einem Jugendkoordinator an der Spitze, verantwortlich für die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Jugendeinrichtungen, Sozialämtern und Jugendämtern. Vielleicht würde es helfen, die zunehmende Gewaltbereitschaft und Kriminalität langfristig im Keim zu ersticken, sollten alle Behörden und Institutionen an einem Strang ziehen und Präventionsmaßnahmen ergreifen.
Doch das war es nicht allein, was Brandt unzählige Überstunden und einige schlaflose Nächte verschafft hatte. Zwischen Mitte 2007 und Anfang 2009 hatte es »nur« neun Tötungsdelikte in seinem unmittelbaren Ermittlungsbereich Offenbach gegeben, die alle aufgeklärt worden waren. Sechs dieser Delikte hatten sich im häuslichen Bereich ereignet, zwei waren das traurige Resultat einer Prügelei, und Ende Dezember 2008 hatte ein Mann seinen Nebenbuhler die Treppe hinuntergestoßen. Das Opfer lag vier Wochen im Koma, bis die Ärzte die lebenserhaltenden Geräte abschalteten. Viermal waren Stichwerkzeuge eingesetzt worden, einmal war stumpfe Gewalt im Spiel, in einem Fall war ein angetrunkener und höchst aggressiver Mann, der bereits aktenkundig war, nach einer heftigen Auseinandersetzung mit seiner Lebensgefährtin unglücklich mit dem Hinterkopf gegen eine metallene Tischkante gestoßen und kurz darauf verstorben, nur einmal war eine Schusswaffe benutzt worden. Fünf der Opfer waren Frauen.
Einen aufsehenerregenden Fall hatte es gegeben, der keinen kaltließ: der Tod eines zweijährigen Mädchens, das verhungert und verdurstet und total eingedreckt in seinem Bett gefunden worden war. Ein Fall, der bundesweit für Schlagzeilen sorgte, aber schon bald in Vergessenheit geriet, weil derartige Tötungsdelikte sich häuften und schon fast zur Normalität gehörten. Ein kurzer, entsetzter Aufschrei der Medien und der Öffentlichkeit, der schnell verstummte.
Die Aufklärungsquote hätte bei hundert Prozent gelegen, gäbe es da nicht noch etwas anderes, was ihm nach wie vor Kopfzerbrechen bereitete, und weder er noch seine Kollegen wussten, in welche Richtung sie weiter ermitteln konnten.
Es ging um zwei höchst mysteriöse Frauenmorde. Begangen im letzten Jahr, einer vermutlich in Rumpenheim und einer in Bürgel, zwei aneinandergrenzende Stadtteile. Zwei Morde, die noch nicht einmal ansatzweise gelöst waren, da es nicht die geringsten Anhaltspunkte bezüglich der Motive oder gar in Richtung eines oder mehrerer Täter gab. Alle Ermittlungen waren im Sande verlaufen. Sämtliche Personen aus dem engeren und weiteren Umfeld der beiden Frauen waren zum Teil mehrfach befragt worden, doch keiner der Befragten verwickelte sich in Widersprüche, und jeder konnte ein wasserdichtes Alibi vorweisen. Zwei Morde, die womöglich niemals geklärt werden würden. Zwei Morde, zu denen vielleicht noch weitere hinzukommen würden, das sagte Brandts Bauchgefühl, und sein Bauch hatte ihn in der Vergangenheit selten im Stich gelassen. Wobei er hoffte, wenigstens diesmal unrecht zu behalten. Und doch sprach nicht nur sein Instinkt dafür: Denn bei beiden Morden handelte es sich allen bisherigen Erkenntnissen nach nicht um Beziehungstaten. Keine der beiden Frauen war, so die einhellige Meinung, im Affekt ermordet worden, sondern aus einem anderen Beweggrund: Trieb. Alle Ermittler waren sich einig, dass sie es mit einem oder zwei Triebtätern zu tun hatten, wobei Brandt der festen Überzeugung war, dass es sich um ein und denselben Täter handelte, auch wenn die Vorgehensweisen so unterschiedlich wie Tag und Nacht waren.
Die erste Tote, Anika Zeidler, war am Sonntag, dem 8. März 2009, gegen 15.30 Uhr in der Nähe der Rumpenheimer Fähre gefunden worden. Ihre Eltern hatten sie drei Tage zuvor als vermisst gemeldet, weil sie sie zuletzt am späten Nachmittag des 3. März gesehen und seitdem nichts mehr von ihr gehört hatten, was nicht ihre Art war, wie sie glaubhaft versicherten. Kein Anruf, kein Besuch. Bei Anrufen auf ihrem Handy sprang nur die Mailbox an.
Für die Polizei zunächst ein Routinefall, stammte Anika Zeidler (wie auch der elfjährige Vergewaltiger) ursprünglich doch aus einem Viertel, dem ein eher negativer Ruf anhaftete, wo die Kriminalitätsrate über dem Offenbacher Durchschnitt lag und die Arbeitslosenquote ebenfalls recht hoch war. Es kam nicht selten vor, dass junge Menschen sich von dort einfach auf und davon machten. Normalerweise aber blieben sie nicht lange weg, meldeten sich schon kurze Zeit später bei der Familie oder bei Freunden oder wurden von der Polizei aufgespürt.
Allerdings lebte Anika Zeidler schon seit fast drei Jahren nicht mehr zu Hause, sondern in einer kleinen Wohnung in Neu-Isenburg, wo sie in einem Callcenter arbeitete, wie ihre Eltern berichteten. Diese waren ebenso wie Anikas Bruder mehrfach zu ihrer Wohnung gefahren, doch sooft sie auch geklingelt hatten, niemand öffnete die Tür. Schließlich informierten sie die Polizei.
Die Wohnung wurde von der Polizei geöffnet und durchsucht, es fand sich jedoch kein Hinweis, wo sich Anika aufhalten könnte. Am 7. März wurde eine Handyortung durchgeführt – ohne Erfolg. Deshalb ging man davon aus, dass das Handy ausgeschaltet war. Daraufhin wurde seitens der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission beschlossen, am 9. März, einem Montag, Suchmeldungen in Presse und Funk zu veröffentlichen, wozu es jedoch nicht mehr kommen sollte. Denn am Nachmittag des 8. März, vier Tage nachdem sie von ihren Eltern und ihrem Bruder zum letzten Mal gesehen worden war, wurde Anika Zeidler von dem Hund eines Ehepaars in einem Gebüsch am Mainufer entdeckt.
Die junge Frau war zum Zeitpunkt ihrer Ermordung einundzwanzig Jahre alt gewesen, am Tag ihres Auffindens hätte sie Geburtstag gehabt. Der durchschnittlichen Lebenserwartung deutscher Frauen zufolge hatte sie gerade ein Viertel ihres Lebens hinter sich.
Die Rechtsmedizinerin Andrea Sievers hatte Wochenendbereitschaft gehabt. Und so hatten sie und Peter Brandt, deren Verhältnis nur noch beruflicher und dazu sehr kühler, bisweilen fast frostiger Natur war, gemeinsam vor der Toten gestanden. Sievers hatte kopfschüttelnd gesagt: »So jung und wie Müll entsorgt. Das lässt mich noch immer nicht kalt. Es gibt nur eines, was schlimmer ist, und das ist ein ermordetes Kind. Wenn ich nur wüsste, was in dem Kopf eines solchen Perversen vorgeht.«
»Wieso pervers?«, fragte Brandt lakonisch, der die Leiche als einer der Ersten vor Ort in Augenschein genommen und nichts Außergewöhnliches festgestellt hatte – außer dass die Frau tot war.
»Du stellst vielleicht Fragen! Ist es nicht pervers, wenn so eine junge Frau ohne erkenntlichen Grund umgebracht wird?« Sievers brachte es auf die Palme, dass er so ruhig und scheinbar teilnahmslos vor einer gewaltsam zu Tode gekommenen jungen Frau stand.
»Ob es einen Grund gab oder gibt, wird sich noch herausstellen, unsere Ermittlungen stehen ja noch ganz am Anfang«, hatte Brandt gelassen erwidert, auch wenn ihn der Mord alles andere als kaltließ, doch das brauchte niemand zu wissen. Natürlich fand er es auch diesmal erschütternd, eine ermordete junge Frau auf dem Tisch liegen zu sehen, doch in den mittlerweile fast dreißig Berufsjahren hatte er gelernt, inneren Abstand zu wahren. Zu viele Emotionen waren fehl am Platz, sie erschwerten nur die Ermittlungen. Er könnte dann nicht abschalten, brächte den Beruf mit nach Hause, würde unter Schlafproblemen leiden und damit über kurz oder lang unbrauchbar werden.
Sein Vater, ein ehemaliger Polizist, hatte ihn gelehrt, Berufliches und Privates strikt voneinander zu trennen, nur so könne er in diesem Knochenjob bestehen. Brandt hatte in den vielen Jahren einige Kollegen kennengelernt, die an ihrem Beruf zerbrochen waren, weil sie sich persönlich zu sehr einbrachten. Es gelang ihnen nicht, die Arbeit im Büro zu lassen. Sie flüchteten sich in Alkohol, manch einer in Tabletten oder andere Drogen, Ehen zerbrachen, weil die Frauen ihre Männer nicht mehr ertrugen, manche wurden krank, andere mussten in den vorzeitigen Ruhestand gehen. Zwei Kollegen hatten sich sogar das Leben genommen. Eines aber hatte auch Brandt bislang nicht ablegen können und wollen, Mitgefühl, nicht nur für die Opfer, sondern auch für die Angehörigen, Freunde und Bekannten. Und das war gut so, zeigte es ihm doch, dass er noch Gefühle hatte.
»Ja, aber sieh sie dir doch an«, sagte Sievers, die schon zu den Zeiten, als sie noch zusammen waren, nicht gut mit Brandts bisweilen stoischer Ruhe zurechtgekommen war. Sie deutete auf die unbekleidete Tote. »Was fällt dir auf?«
Brandt trat näher an den Tisch. »Klär mich auf, liebe Andrea.«
»Hör zu«, fauchte sie ihn an, »ich dachte, das Thema hätten wir durch. Ein für alle Mal, ich will nie wieder so von dir genannt werden. Du hast ja jetzt schließlich deine liebe Elvira. Hab ich mich deutlich genug ausgedrückt?«
»Entschuldigung, ich wollte nicht deine Gefühle verletzen …«
»Das hast du schon längst geschafft, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Sieh dir lieber die Kleine an.«
Er zuckte etwas ratlos die Schultern. »Was soll mir großartig auffallen, außer, dass sie zu Lebzeiten ausgesprochen hübsch war?«, sagte er immer noch ruhig. »Na ja, eigentlich ist sie’s ja immer noch«, fügte er hinzu.
»Bist du blind, oder was? Hier«, erwiderte sie mit funkelndem Blick und deutete mit der rechten Hand demonstrativ auf die Tote. »Es gibt keinerlei äußere Verletzungen, nicht einmal eine Drosselmarke am Hals, nur geringe petechiale Blutungen in den Augenbindehäuten und den Lidern, eine leichte Gesichtszyanose, aber keine Hämatome und auch keine sichtbaren Einblutungen in die Halsmuskulatur. Nicht einmal eine Exkoriation …«
»Gibt’s das auch auf Deutsch?«, fragte er lakonisch.
Andrea rollte mit den Augen und fuhr noch eine Spur gereizter fort: »Eine Exkoriation oder auch Hautabschürfung ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen. Was immer du an ihrem Hals auch siehst, es ist nur schwach ausgeprägt. Er hat nicht auf sie eingeschlagen oder eingestochen oder sonst was mit ihr getan …« Sie machte eine Pause, als müsse sie ihre Gedanken sortieren, strich sich mit einer Hand über die Stirn und sagte mit einer Stimme, die so kühl war wie der Raum: »Sei’s drum, als Laie würde man nichts Auffälliges entdecken, und ein in der äußeren Leichenschau unkundiger Allgemeinmediziner würde, hätte man die Leiche zu Hause in der Badewanne gefunden, möglicherweise auf dem Totenschein eine natürliche Todesursache ankreuzen. Sie sieht, und das musst du zugeben, praktisch unversehrt aus, was mit ziemlicher Sicherheit dafür spricht, dass sie nicht schon vor vier oder fünf Tagen umgebracht wurde, sondern vielleicht erst vor ein bis zwei Tagen, und dann hat der Täter sie einfach am Main entsorgt. Aber auch das finden wir schnell raus. Jetzt …«
»Wurde sie vergewaltigt?«, wurde sie von Brandt unterbrochen, dem nicht der Sinn nach einer ausführlichen Erläuterung stand und schon gar nicht nach einem Streit mit seiner ehemaligen Fast-Ehefrau, nur weil er vielleicht eine falsche Bemerkung machte. Seit ihrer Trennung war sie Single pur, und soweit er wusste, lebte sie momentan allein für ihre Arbeit.
»Wenn du mich ausreden lassen würdest«, entgegnete sie schnippisch, wie so oft, wenn sie sich begegneten, was zum Glück nicht mehr allzu oft vorkam. Sie atmete einmal tief durch und fuhr fort: »Ich habe sie zwar erst seit drei Stunden auf dem Tisch, habe aber bereits eine erste äußere Leichenschau vorgenommen und kann deine Frage verneinen. Nein, sie wurde nicht vergewaltigt, und ob sie Geschlechtsverkehr hatte, nun, das wird die Obduktion ergeben. Genaueres nach der Leichenöffnung. Das Protokoll bekommst du, sowie wir fertig sind und es getippt ist. Eins kann ich aber schon jetzt sagen, sollte sie Verkehr gehabt haben, dann war es kein erzwungener: kein gewaltsames Eindringen, keine entsprechenden Spuren im Vaginal- und Analbereich und so weiter. Und um deine mögliche nächste Frage auch gleich zu beantworten: Ich kann nicht sagen, ob sie auf den Strich gegangen ist. Das herauszufinden ist deine Aufgabe, Herr Hauptkommissar«, sagte sie bissig, ein Ton, den sie in den letzten knapp zwei Jahren häufig ihrer Stimme beimischte, wenn sie auf Brandt oder Elvira Klein traf. Eine Bissigkeit, die einzig und allein eine Ursache hatte – das Ende ihrer Beziehung und seine neue Liaison mit Elvira, Andreas einst bester Freundin. Aus der Freundschaft war Feindseligkeit geworden, obwohl Elvira Klein alles tat, um Andrea versöhnlicher zu stimmen. Sie hatte ihr mehrfach angeboten, sich unter vier Augen ausführlich auszutauschen, um Missverständnisse aus dem Weg zu räumen, doch Andrea hatte jedes Angebot kategorisch ausgeschlagen.
Dabei war es Andrea gewesen, die die Beziehung beendet hatte, mit einem ausführlichen Brief, in dem sie Brandt klarmachte, dass sie eine Auszeit benötige und ihre Zukunft ohne ihn zu gestalten beabsichtige. Doch als sie von seiner nur kurz darauf begonnenen Beziehung zu Elvira Klein erfuhr, wurde sie fuchsteufelswild und stellte es von nun an so dar, als habe Brandt Schluss gemacht.
Zwar war das mittlerweile Vergangenheit, dennoch gab es weiterhin unüberbrückbare Spannungen, die in erster Linie von Andrea Sievers ausgingen. Ihm tat es leid, dass ihre Beziehung so abrupt geendet hatte und der negative Nachhall bereits so lange anhielt.
Brandt war langsam und schweigend um den Tisch herumgegangen. Die Tote wirkte tatsächlich nahezu unversehrt, es sah fast so aus, als schlafe sie nur, wäre da nicht die auffällige Blässe der marmorierten Haut und der Lippen. Warum musstest du sterben?, dachte er, ohne sich seine Gedanken anmerken zu lassen. Warst du zur falschen Zeit am falschen Ort? Bist du einem Soziopathen zum Opfer gefallen? Aber so schön, wie du bist, könnte es auch sein, dass Eifersucht das Motiv war. Wir werden sehen. Nein, dachte er weiter, du warst nicht zur falschen Zeit am falschen Ort und da war auch kein Psychopath am Werk, sonst würdest du nicht so aussehen. So einer hätte dich traktiert und misshandelt und dich nicht vollständig bekleidet am Main abgelegt. Es muss etwa anderes geschehen sein. Aber was?
»Du, ich hab zu tun, falls du das noch nicht bemerkt hast«, riss Andrea ihn ziemlich rüde aus seinen Gedanken, ihr Blick war eisig, als wollte sie ihn nachträglich töten für das, was vor Jahren gewesen war. Es war einer dieser Momente, in denen sie ihre Sachlichkeit den Gefühlen opferte.
»Entschuldigung, ich hab nur gerade einiges durchgespielt. Womit wurde sie deiner Meinung nach erdrosselt? Sie wurde doch erdrosselt, wenn ich dich richtig verstanden habe, oder?«
»Davon können wir ausgehen. Aber womit? Keinesfalls mit einem Draht oder einer Schlinge, auch ein Seil oder Tau kann ich mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit ausschließen, sonst wären deutliche Spuren des Tatwerkzeugs in Form von Drosselmarken zu sehen. Vielleicht ein Tuch oder ein Schal, irgendwas in der Richtung.«
»Wie lange hat es gedauert?«
»Wie lange hat was gedauert? Nach so vielen Jahren bei der Polizei müsstest du eigentlich wissen, wie lange Erwürgen oder Erdrosseln dauert«, sagte sie schnippisch und sah ihn herausfordernd an. Doch Brandt ignorierte sowohl den Tonfall als auch den Blick. Und wenn sie ihn noch so sehr provozierte, er würde nicht darauf eingehen.
»Na ja, es gibt nun mal bestimmte Dinge, die dich partout nicht interessieren. Hab ich recht oder hab ich recht?«, startete sie einen erneuten Versuch, ihn aus der Reserve zu locken.
»Na ja, ganz ehrlich, ich habe erst zwei Fälle zu bearbeiten gehabt, wo jemand erwürgt wurde. Mich interessiert, ob sie lange leiden musste.«
Andrea atmete einmal tief durch. »Kann ich nicht sagen, Erwürgt oder erdrosselt zu werden ist kein schneller Tod. Man geht von vier bis sieben Minuten, manchmal auch zehn Minuten aus, bis der Tod eintritt, es sei denn, der Täter ist entsprechend ausgebildet und kann durch einen professionellen Druck mit beiden Daumen auf die Carotis eine sofortige Bewusstlosigkeit auslösen. Ansonsten ist es für das Opfer eine sehr qualvolle Angelegenheit. Ich kann mir einen schöneren Tod vorstellen.«
»Könnt ihr herausfinden, ob sie von hinten oder von vorn erdrosselt wurde?«
»Eine unserer leichtesten Übungen. Sonst noch was?«
»Und sie wurde definitiv erdrosselt und nicht erwürgt?«
»Mannomannomann!«, keifte sie ihn an, um gleich wieder ruhiger zu werden. »Wäre sie erwürgt worden, wäre ihr Hals rot und blau, das heißt, er wäre mit Hämatomen übersät. Sie wurde erdrosselt … Weißt du was, ich schlage vor, dass du beim nächsten Auffrischungskurs mal wieder bei uns vorbeischaust, sofern es deine kostbare Zeit erlaubt. Und wenn du dann schon hier bist, solltest du ausnahmsweise mal zuhören, wenn die äußeren Leichenmerkmale beschrieben werden. Nächste Woche ist es wieder so weit, dreißig Beamte sind geladen, und du hast meines Wissens auch eine Einladung erhalten. Es ist eine Pflichtveranstaltung, die du besuchen solltest, du könntest sonst Ärger bekommen. Kannst dir ja wie die meisten deiner ach so sensiblen Kollegen ein mit Parfum getränktes Taschentuch vor die Nase halten, wenn Bock und ich hier unten unseren Vortrag halten. Und du brauchst auch nicht dabei zu sein, wenn wir die Leiche öffnen. Aber ich würde dir dringendst raten, zu erscheinen.«
»Sag mal«, Brandt fuhr sich mit der Hand übers Kinn, als hätte er die letzten Sätze nicht gehört, »wieso hast du das vorhin mit dem Strich erwähnt? Ich wäre gar nicht auf den Gedanken gekommen, sie damit in Verbindung zu bringen.«
»Weiß auch nicht«, antwortete sie ausweichend.
»Ach komm, so was sagst du nicht einfach so.« Er sah sie durchdringend an, denn er spürte, dass sie ihm etwas verschwieg.
Sie mied seinen Blick und drehte sich gleich wieder zu der Toten hin. »Also gut, wenn du’s unbedingt wissen willst: Es ist ein Bauchgefühl. Vielleicht ihre Kleidung, vielleicht der kleine, aber edle Parfumflakon, der sich in ihrer sündhaft teuren Handtasche befand. Und außerdem, sie ist einundzwanzig und trägt verdammt teure Unterwäsche, um nicht zu sagen Reizwäsche. Entweder hatte sie einen reichen Freund, von dem niemand etwas wissen durfte und der das Außergewöhnliche liebte, oder sie hat sich durch Prostitution etwas nebenbei verdient. Für mich gibt’s nur diese beiden Möglichkeiten. Ich tippe auf Zweiteres.«
»Du sprichst immer mehr in Rätseln«, sagte Brandt mit gerunzelter Stirn.
»Okay«, erwiderte Andrea Sievers und setzte sich auf einen Hocker, ihre eben noch miese Laune schien mit einem Mal verflogen, denn sie fühlte sich ihm für einen Augenblick überlegen, indem sie ihm auf die Sprünge half und Ermittlerin spielte. »Du hast sie ja gesehen, als sie gefunden wurde. Sie hatte Designerklamotten an, Gucci, La Perla, Manolos … Dazu trug sie Schmuck, den man nicht in irgendeinem Laden kriegt, da muss man schon zu einem exklusiven Juwelier gehen, und die sind bekanntlich auch in einer Region wie Frankfurt nicht an jeder Straßenecke zu finden. An der Hauptwache gibt’s einen, ich komm jetzt nicht auf den Namen, da bekommst du alles, sofern du das nötige Kleingeld hast. Allein ihre Uhr hat ein kleines Vermögen gekostet, eine Vacheron Constantin, falls dir das was sagt. Ich hab die Uhr gegoogelt, sie hat einen Neuwert von sechzigtausend, das ist fast mein Jahresgehalt. Die Manolos sind dagegen ein Schnäppchen, der Preis liegt irgendwo zwischen fünfhundert und tausend Euro. Auch das Parfum wird mein Bad niemals von innen sehen, viel zu teuer, fünfzig Milliliter knapp vierhundert Euro. Und dann eben noch die Klamotten, die auch noch mal so fünf- bis sechstausend ausmachen.«
Sie machte eine Pause und sah Brandt an. Mit aufeinandergepressten Lippen registrierte sie jede seiner Reaktionen, als wollte sie seine Gedanken lesen, doch sein nachdenklicher Blick verriet ihr nichts.
Als würde er ihren forschenden Blick nicht registrieren, murmelte er: »Sie hat doch in einer kleinen Zweizimmerwohnung in Neu-Isenburg gelebt. Ich war gestern in der Bude drin, da war nichts, was irgendeinen größeren materiellen Wert gehabt hätte.«
»Offiziell hat sie dort gewohnt und war auch da gemeldet, vielleicht einfach nur, um einen gewissen Schein zu wahren«, wurde er von Sievers unterbrochen. »Sie hat jedoch mit Sicherheit noch eine andere Bleibe gehabt, von der keiner etwas wusste oder wissen durfte. Höchstens Insider, falls sie tatsächlich im horizontalen Gewerbe tätig war oder einen reichen Freund hatte. Sie war jedenfalls nicht die, die ihre Eltern kannten. Die Anika Zeidler, die ich auf den Tisch gekriegt habe, hat meines Erachtens ein Doppelleben geführt, ich habe keine andere Erklärung. Den Rest überlasse ich deiner Phantasie.«
»Sie hat in Neu-Isenburg gewohnt«, brummte Brandt noch eine Spur nachdenklicher, »das haben mir ihre Eltern bestätigt. Aber die gehören zur klassischen Hartz-IV-Schicht …«
»Was meinst du mit ›klassischer Hartz-IV-Schicht‹? Seit wann gibt es Hartz IV?«, unterbrach sie ihn spöttisch. »Klassisch! Das klingt nach alt, antiquiert oder was immer, dabei gibt es diesen Mist erst seit ein paar Jahren.«
»Du weißt genau, wie ich das meine«, entgegnete Brandt zum ersten Mal an diesem späten Nachmittag leicht unwirsch, unter anderem, weil er von Andrea in seinem Gedankengang unterbrochen worden war.
»Also gut, inwiefern gehören sie zur klassischen Hartz-IV-Schicht? Wie sieht die denn aus? Versoffen, bekifft, vulgär …«
Wieder ging Brandt auf die Provokation nicht ein, sondern antwortete ruhig und gelassen: »Die Zeidlers haben keine Arbeit, kaum Geld, sie sind nicht versifft, ganz im Gegenteil, die Wohnung war die beiden Male, wenn ich hinkam, picobello in Schuss. Die würden mit Sicherheit gerne raus aus dem Milieu, aber wie es aussieht, gibt ihnen keiner mehr eine Chance. Mit Mitte vierzig bist du eben raus, das ist die brutale Wahrheit in unserem Land … Sie sind aber gläubige Christen, sie besuchen jeden Sonntag die Kirche. Im Übrigen auch diese junge Dame.« Er deutete auf die Tote.
»Sie ging in die Kirche?«, fragte Andrea mit gerunzelter Stirn. »Das ist selten geworden bei jungen Leuten, heißt es. Na ja, Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel.«
»Mag sein. In jedem Fall war Sonntag ihr Familientag, Anika kam immer gegen neun, dann ging sie mit ihren Eltern und dem Bruder in die Kirche, sie aßen gemeinsam zu Mittag und verbrachten in der Regel auch den Nachmittag zusammen, bis sie abends wieder zu sich nach Hause fuhr. Eine heile Welt, bis auf den materiellen Notstand natürlich.«
»Okay, und weiter? In diesem Land leben Millionen Menschen an oder unterhalb der Armutsgrenze. Vor allem die Kinderarmut nimmt rasant zu.«
»Nichts und weiter. Wo sind die Klamotten und Wertsachen?« Bewusst wechselte er das Thema, denn er wollte sich mit Andrea nicht auf eine Grundsatzdiskussion über die Armut in Deutschland einlassen, zu oft schon war er in den letzten Jahren damit konfrontiert worden.
»Noch hier, werden aber gleich von der KTU abgeholt. Willst du sie vorher noch mal sehen?«
»Ich wäre dir sehr dankbar«, antwortete er und merkte dabei, wie er zunehmend gereizter wurde.
Sie führte ihn zu einem Tisch, wo jedes einzelne Kleidungsstück und Accessoire bereits separat eingetütet und beschriftet worden war, die erste Handlung nach Einlieferung der Toten. Brandt warf einen Blick darauf, nahm die Tüte mit der Uhr in die Hand und sagte lapidar: »Und so ein Teil kostet sechzigtausend? Da kann ich auch nicht mehr als die Zeit ablesen.«
»Du bist ein Banause. Da ist auch noch das winzigste Teil handgefertigt, so was hat nun mal seinen Preis … Und es ist doch immerhin ein schönes Accessoire. Schön und teuer.«
»Nee, nur schön teuer. Für kein Geld der Welt würde ich mir so was kaufen. Wie auch immer, sie hatte die Uhr um, und was sagt uns das? Dass du vermutlich recht hast mit deiner Einschätzung.«
»Oh, du gibst mir recht?«, fragte sie süffisant lächelnd. »Das ist ja fast schon ein Ritterschlag.«
»Ja, ausnahmsweise. Sie hatte entweder einen sehr begüterten Freund, oder sie ging tatsächlich anschaffen. Was meinst du?«
»Darüber zerbrich du dir mal den Kopf, und lass mich wissen, wenn du was rausgefunden hast. Du solltest drüber nachdenken, dass sie erst Anfang zwanzig war, als sie übern Jordan geschickt wurde. Da stellt sich mir doch unwillkürlich die Frage, wann hat sie angefangen, aus ihrem tristen Leben auszubrechen, und wie hat sie es geschafft, sich quasi eine zweite Identität zuzulegen?« Sie blickte auf die Uhr und meinte: »So, und wenn’s weiter nichts gibt, ich habe zu tun, die Kleine muss aufgemacht werden, Kollege Bock wird gleich hier sein, zusammen mit einer – Staatsanwältin …« Sie ließ den Satz unvollendet, nicht ohne ihm ein weiteres, äußerst süffisantes Lächeln zukommen zu lassen.
»Elvira ist dabei?«
»Was für ein kluges Köpfchen du doch bist. Noch was?«
»Nein. Wann kann ich mit dem Ergebnis rechnen?«
»Morgen, vielleicht auch erst übermorgen. Und jetzt raus, ich muss mich physisch und mental auf die Obduktion vorbereiten.«
Brandt verabschiedete sich. In seinem Wagen blieb er noch eine Zeitlang hinter dem Lenkrad sitzen und dachte nach. Er lehnte den Kopf gegen die Kopfstütze und schloss die Augen. Er war so in Gedanken versunken, dass er kaum ein Geräusch um sich herum wahrnahm.
Anika Zeidler, eins dreiundsechzig groß, dunkelbraune Haare, braune Augen, sehr schlank, beinahe fragil und dabei eine überaus ansehnliche Figur, wie Brandt sich in der Rechtsmedizin hatte vergewissern können, als sie nackt auf dem kalten Seziertisch lag. Eine junge Frau, die Träume und Hoffnungen gehabt hatte … wie alle Frauen in ihrem Alter. Die aber, so schien es, sich nicht mit ihrem Leben im sozialen Abseits abfinden wollte und offenbar einen Weg gefunden hatte, rechtzeitig einer tristen Zukunft zu entfliehen. Doch die Flucht hatte viel zu früh geendet. Eine junge Frau, die so etwas Zerbrechliches und Unschuldiges an sich hatte und die, da gab er Andrea recht, offensichtlich ein Doppelleben geführt hatte. Und da war noch etwas, was ihn irritierte, ihm fast Kopfzerbrechen bereitete – ihr Gesicht kam ihm bekannt vor, und es machte ihn wütend, nicht zu wissen, woher. Dabei hätte er Stein und Bein schwören können, sie schon einmal gesehen zu haben. Aber er konnte sich natürlich auch täuschen, denn sie sah wie so viele hübsche junge Frauen aus.
In den ersten Tagen liefen die Ermittlungen auf Hochtouren, doch was immer die Beamten auch taten, sämtliche Ansätze mündeten in einer Sackgasse. Es fand sich weder ein vermögender Freund noch der geringste Hinweis, Anika könnte als Prostituierte gearbeitet haben, auch wenn es nur die beiden Möglichkeiten zu geben schien, womit sie ihre aufwendige Kleidung und den Schmuck finanziert hatte. Es sei denn, sie hatte im Lotto gewonnen und niemand, nicht einmal ihre Familie durfte davon wissen. Doch auch eine Überprüfung in diese Richtung verlief negativ.
Als Brandt drei Tage nach dem Mord noch einmal in Anikas Wohnung war, dachte er unwillkürlich an das erste Mal, als er hier gewesen war. Das Apartment war sauber und aufgeräumt gewesen. Viel zu sauber und viel zu aufgeräumt, so, als wäre Anika nur selten hier gewesen, als diente diese Wohnung als Alibi für ihre Familie und mögliche Freunde von früher. Dieser Umstand fiel ihm erst jetzt auf, dabei hätte er schon beim ersten Betreten stutzig werden müssen. Ihm kamen Andreas Worte in den Sinn, die sagte, dass es vielleicht eine zweite Wohnung geben könnte. Je länger er darüber nachdachte, desto plausibler erschien ihm diese Theorie. Er besprach sich mit seinen Kollegen Nicole Eberl und Bernhard Spitzer, die sich seiner Meinung anschlossen. Sie würden diese Wohnung finden!
Und er glaubte auch nicht mehr, dass Anika in einem Callcenter gearbeitet hatte. Nie und nimmer hätte sie sich dann derart teuren Schmuck und Designerkleidung leisten können. Außerdem hätten sich gewiss längst Kollegen bei der Polizei gemeldet, schließlich war das Foto der Toten in verschiedenen Zeitungen gewesen. Doch es schien, als habe Anika zu keinem Menschen Kontakt gehabt, außer vielleicht zu solchen, die niemals zur Polizei gehen würden.
Die jungen Frauen aus der Nachbarschaft ihrer Eltern, die mit Anika Zeidler befreundet gewesen waren oder sie näher kannten, versicherten, nichts von einem möglichen Doppelleben gewusst zu haben. Wen immer man auch nach ihr fragte, die Antworten glichen sich beinahe aufs Haar. Allerdings hatte sie schon vor Jahren angedeutet, unbedingt aus dem asozialen Mief, wie sie es nannte, ausbrechen und sich irgendwo eine gescheite Existenz aufbauen zu wollen, doch wie und wo sie das schaffen wollte, verriet sie niemandem. Sie sagte nur, sie wolle nicht enden wie ihre Eltern, die mit Mitte vierzig schon keine Perspektive mehr hatten. Sie hatte keinen Freund und in der Vergangenheit auch nur zwei kurze Beziehungen gehabt, sie hatte die mittlere Reife mit Bravour bestanden und danach beschlossen, auch noch ihr Abitur zu machen, das sie ebenfalls überdurchschnittlich gut abschloss. Sie wollte studieren, was genau, konnte keiner sagen, nicht einmal ihre Eltern, mit denen sie kaum über ihre Zukunft gesprochen hatte.
Auch wenn Anika Zeidlers Eltern ordentliche und gut in die Gesellschaft integrierte Menschen waren, so verdichtete sich im Laufe der Ermittlungen der Eindruck, dass sie für sich keine Chance mehr sahen, je aus dem Hochhausghetto in der Hugo-Wolf-Straße in Lauterborn herauszukommen. Die Einzige, die es schon mit neunzehn geschafft hatte, war Anika gewesen. Und mit neunzehn hatte sie auch nach und nach den Kontakt zu ihren ehemaligen Freundinnen und ihrem Bekanntenkreis abgebrochen.
Anika meldete sich beinahe jeden Nachmittag gegen fünf bei ihren Eltern, meist handelte es sich um belanglose Telefonate, in denen sie von ihrer Arbeit berichtete, man sprach über dieses und jenes, ohne tiefschürfend zu werden. Das behielt man sich für den Sonntag vor.
Brandt konnte nicht verstehen, warum die Zeidlers so wenig über ihre Tochter wussten. Entweder war es Desinteresse, oder sie gewährten ihrer Tochter die Freiheit, die sie selbst nicht mehr hatten. Das Einzige, was er noch erfuhr, war, dass Anika hin und wieder mit einer Freundin, die ihre Familie jedoch noch nicht kennengelernt hatte, das Wochenende verbrachte. Sie sei aber die meiste Zeit auf ihrem Handy erreichbar gewesen. Brandt wurde daraufhin den Verdacht nicht los, dass ihm noch etwas verheimlicht wurde, doch er erhielt keine weiteren Informationen von der Familie.
Anika Zeidler war laut rechtsmedizinischem Gutachten zwischen Mitternacht und zwei Uhr morgens am 6. März getötet worden, stranguliert mit einem Schal, wie sich bei der Obduktion herausstellte, als Andrea Sievers und Prof. Bock kaum sichtbare Seidenfasern am Hals fanden. Sie war mindestens eine halbe Stunde von ihrem Peiniger gequält worden, bevor er sie von ihrem Leiden erlöste. Bei ihrem Auffinden war sie vollständig bekleidet gewesen, doch ob der Fundort auch der Tatort war, konnte nicht geklärt werden. Es war wie ein tiefes, dunkles Loch, in das die Ermittler blickten, ein unendlich tiefes und sehr, sehr dunkles Loch.
Wer war Anika Zeidler wirklich gewesen? Welches Geheimnis hatte sie mit ins Grab genommen? Je mehr Zeit verstrich, desto weniger glaubte Brandt daran, die Lösung irgendwann zu finden. Eine Theorie schien immer wahrscheinlicher – Anika Zeidler hatte keine Freundin, sondern einen vermögenden Freund gehabt, der ihr womöglich eine Wohnung eingerichtet hatte, und sie hatte ihn im Gegenzug mit anderen Annehmlichkeiten verwöhnt. Es war durchaus möglich, dass dieser Freund auch ihr Mörder war und die Wohnung weiterhin bezahlte, um nicht in Verdacht zu geraten. Oder sie gehörte ihm und er zog sich dorthin zurück, wenn er seine Ruhe haben wollte. Und er meldete sich nicht bei der Polizei, weil sonst sein Doppelleben aufgeflogen wäre. Sie gingen von einem älteren Mann mit Familie aus, zwischen vierzig und sechzig, der auf seinen guten Leumund achten musste. Ein Mann, der aus irgendeinem Grund zum Mörder geworden war. Vielleicht hatte Anika Forderungen gestellt, die zu erfüllen er nicht bereit war. Vielleicht wollte sie, dass er sich von seiner Frau trennte, vielleicht war er ihrer auch nur überdrüssig geworden. Vielleicht hatte sie ihn erpresst. Oder die Geschichte spielte in einem völlig anderen Milieu, dem der Callgirls und Edelhuren, und sie hatte es mit jemandem zu tun, vielleicht einem Freier, der Anika für sich allein haben wollte … Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Die gesamten Ermittlungen waren mit einem Vielleicht behaftet. Noch.
Zehn Tage waren seit dem Leichenfund verstrichen, als ein bis heute unbekannter Mann bei der Polizei anrief und behauptete, Anika zu kennen. Er nannte weder seinen Namen, noch konnte festgestellt werden, woher er anrief, da er seine Nummer unterdrückt hatte. Er erklärte, Anika habe als Edelprostituierte gearbeitet, und das seit ungefähr drei Jahren. Sie sei ein Profi gewesen und habe bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich Stammkunden aus einer sehr gehobenen und einflussreichen Klientel gehabt. Auch er selbst gehöre dazu, weshalb er seinen Namen nicht nennen wolle beziehungsweise könne. Auf die Frage von Brandt, ob er mit dem Mord an Anika etwas zu tun habe oder ob er jemanden kenne, dem er so etwas zutrauen würde, antwortete der Unbekannte mit einem klaren und energischen Nein. Er kenne zwar einige Personen, die zu den Kunden von Anika gehörten, doch keiner von ihnen käme in Frage, dafür würde er seine Hand ins Feuer legen. Bevor er auflegte, gab er der Polizei die Adresse, wo Anika ihr Gewerbe betrieb. Dabei handelte es sich um eine luxuriöse Maisonette-Wohnung in einem Hochhaus im Herzen Frankfurts. Als Brandt die Adresse notierte, musste er schlucken, lag das Haus doch nur wenige Schritte von dem entfernt, in dem Elvira Klein ihre Wohnung hatte. Neue Mainzer Straße. Eine Wohnung mit exklusivem Blick über die Dächer Frankfurts und auf die sagenhafte Skyline bis zum Taunus und den Odenwald, wie die Beamten sich überzeugen konnten.
Brandt begriff nun, warum sich erst so spät jemand bei der Polizei gemeldet hatte. Obwohl es einen Portier und Überwachungskameras gab, lebte man hier weitgehend anonym, viele Bewohner waren betuchte Geschäftsleute, etliche kamen nur sporadisch in ihre Wohnungen, weil sie ihren Hauptwohnsitz anderswo hatten und sich nur hier aufhielten, wenn sie in Frankfurt oder Umgebung zu tun hatten. Piloten, Banker, Geschäftsleute. Oder welche, die die Wohnung als Refugium brauchten, wenn sie ihre Ruhe haben wollten.
Die Durchsuchung verlief enttäuschend. Zwei Tage lang durchkämmten Nicole Eberl und Kollegen von der Spurensicherung die großzügig geschnittene Wohnung, ohne ein Adressbuch, einen Computer oder irgendetwas anderes zu finden, wo die Namen der Kunden aufgeführt waren. Es gab nicht einmal ein normales Telefon, und das Handy, von dem aus Anika regelmäßig mit ihren Eltern und ihrem Bruder telefoniert hatte, war zwar bei der Leiche gefunden worden, aber die geführten Telefonate waren ausschließlich mit ihrer Familie und ein paar Freunden und Bekannten. Man vermutete, dass schon vor der Polizei jemand hier gewesen war, um alle verdächtigen Spuren zu beseitigen. Jemand, der möglicherweise in diesem Haus wohnte und einen Schlüssel zu der Wohnung hatte. Brandt und seine Kollegen gingen davon aus, dass es sich tatsächlich um den anonymen Anrufer handelte. Er hatte alles weggeschafft, was auch nur im Entferntesten mit ihm und anderen Kunden von Anika Zeidler in Verbindung gebracht werden konnte. Einschließlich sämtlicher Kontoauszüge, weshalb man trotz aller Bemühungen nicht herausfand, bei welcher Bank oder Sparkasse sie ihr Geld hortete, obwohl man davon ausgehen musste, dass Anika Zeidler im Laufe der knapp drei Jahre ein kleines Vermögen angehäuft haben musste.
Anika Zeidler, zumindest so viel fanden die Ermittler heraus, hatte die Wohnung vor gut einem Jahr von einem Mann, der mittlerweile in die Toskana gezogen war, gekauft und bar bezahlt. Er konnte sich natürlich an die junge Frau erinnern und war hocherfreut gewesen, dass sie das Geld bar auf den Tisch gelegt hatte. Er habe sich gewundert, woher eine derart junge Frau so viel Geld hatte, doch er habe nicht nachgefragt. Und nein, es sei kein Mann bei ihr gewesen.
Brandt und seine Kollegen wussten nun zwar, womit Anika Zeidler ihr Geld verdient hatte, am Ende standen sie dennoch mit leeren Händen da. Sie suchten fieberhaft nach Personen, die in letzter Zeit Kontakt zu ihr gehabt hatten. Ergebnislos. Und die Frustration bei der Polizei, besonders bei Brandt und Eberl, nahm zu.
Die Ermittlungen liefen noch, wenn auch nicht mehr auf Hochtouren, als ein weiterer Mord an einer jungen Frau Offenbach erschütterte.
Es war der 14. August, ein unangenehm schwüler Tag, wie er so typisch für die Monate Juni bis September im Rhein-Main-Gebiet ist. Schwül, windstill und eine Sonne, die zwar den ganzen Tag schien, sich aber hinter faserigen Schleierwolken versteckte, dabei jedoch nichts von ihrer gewaltigen Kraft einbüßte. Das Leben lief langsamer ab, die Menschen waren gereizt.
An diesem Tag wurde Bettina Schubert in einem unscheinbaren Mehrparteienhaus inmitten mehrerer anderer unscheinbarer Häuser in Bürgel aufgefunden, nur knapp einen Kilometer vom ersten Tatort entfernt. Ein Haus, das ein fast perfekt getarntes Bordell war. Als man in der Nachbarschaft fragte, ob man von diesem Etablissement wisse, wurde dies einhellig verneint, auch wenn Brandt ahnte, dass einige der befragten Männer das Etablissement kannten: zehn Wohnungen, sämtlich vermietet an Teilzeitprostituierte, von denen manche nur wenige Monate blieben, während andere schon seit Jahren hier ihrem Geschäft nachgingen.
Zehn Wohnungen, in denen junge Frauen zwischen neunzehn und Anfang dreißig ihren Körper verkauften. Wohnungen, in denen kaum jemand nach dem Rechten sah und die Huren sich selbst überlassen waren, auch wenn sie aufeinander aufpassten, sofern sie nicht gerade selbst beschäftigt waren. Huren, die die Wohnungen ausschließlich fürs Geschäft nutzten und ansonsten ein mehr oder minder geregeltes Leben innerhalb der Gesellschaft führten. Ein Doppelleben, von dem die Menschen in ihrem Umfeld selten etwas ahnten. Huren, von denen es im Rhein-Main-Gebiet immer mehr gab. Huren, die in Offenbach, Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Heusenstamm, Hanau, Aschaffenburg lebten – oder auch in einem Dorf, wo jeder jeden kannte, wo nur niemand wusste und wissen durfte, welchem Gewerbe die Damen nachgingen. Dörfer oder kleine Städte wie Niederdorfelden, Schöneck, Bad Orb, Obertshausen, Egelsbach, Langen, Erbach, Michelstadt und viele mehr. Im Prinzip konnte jede Frau überall dem horizontalen Gewerbe nachgehen, da die Sperrgebietsverordnung in den meisten Gebieten aufgehoben worden war. Unter anderem in Offenbach, wo es nur einen winzigen Bereich gab, wo Prostitution untersagt war. Doch selbst dort hatten Beamte schon welche entdeckt. Ein lukratives Geschäft, das von der Nachfrage bestimmt wurde. Da das Angebot zunehmend größer wurde, waren die Preise in den vergangenen Jahren immer tiefer in den Keller gerutscht. Nur noch Luxushuren verdienten das große Geld. Für dreißig Euro bekam »Mann« häufig schon das volle Programm – von Huren, die sich meist so zurechtmachten, dass sie selbst von einem guten Bekannten oder Freund, sofern er sich in diese Gegend verlief, nicht erkannt wurden. Sie beherrschten alle Tricks, sich von der biederen Hausfrau in den männermordenden Vamp, von der unscheinbaren Studentin in die laszive Dame für gewisse Minuten oder auch Stunden zu verwandeln.
Die Polizei kannte das Haus in Bürgel schon lange und duldete diese Form der Prostitution. Das Einzige, was von den dort tätigen Damen vom Gesundheitsamt verlangt wurde, war, dass sie sich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten untersuchen ließen und sich einem HIV-Test unterzogen. Insgesamt hatte es sich bis vor einem Jahr um zehn Frauen gehandelt, doch nun waren es nur noch neun.
Während man bei Anika Zeidler nicht wusste, ob der Fundort auch der Tatort war, wurde Bettina Schubert definitiv in ihrer Wohnung ermordet, in der sie ihre Freier empfing.
Bettina Schubert war verheiratet gewesen, hatte einen siebenjährigen Sohn, der jedoch bei ihren Großeltern in Neuss lebte, und sie hatte, so ihr Mann, bei einer Spedition gearbeitet. Doch neben dieser Tätigkeit betrieb sie ein wesentlich einträglicheres Gewerbe, in dem sie an mindestens vier Tagen in der Woche pro Tag zwischen fünf und zehn Freier empfing. Zunächst sah es so aus, als wüssten weder ihr Mann noch ihre Freunde und Bekannten etwas über dieses Leben neben dem normalen Leben. Doch im Verlauf der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ihr Mann sehr wohl von der Arbeit seiner Frau Kenntnis hatte und seinen aktenkundigen Drogenkonsum und seine Spielsucht mit Hilfe ihrer Einnahmen finanzierte. Allerdings ließ sich dies nicht eindeutig beweisen.