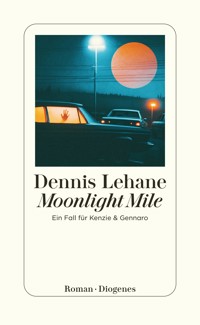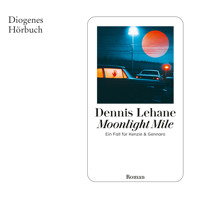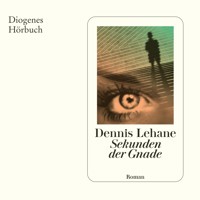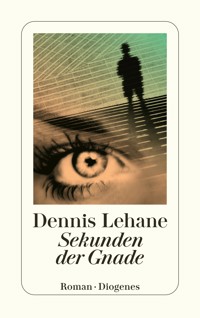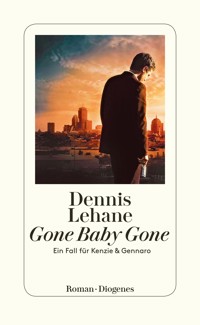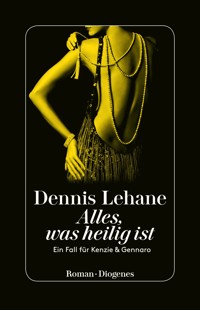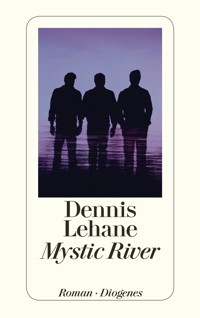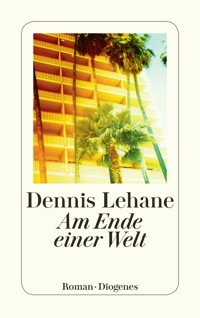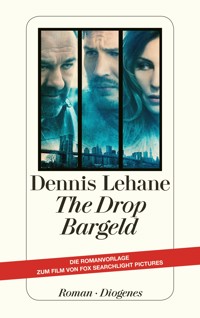
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Überfall auf eine zwielichtige Bar, die Beute: Mafiageld. Die Täter sind schnell gefasst, doch wer steckt wirklich hinter dieser selbstmörderischen Aktion? Ein übereifriger Polizist, ein aufgebrachter Mafiaboss, ein psychopathischer Gangster, und plötzlich sieht der stille Barkeeper Bob Saginowski ein Geheimnis ans Licht gezerrt, das er jahrzehntelang gehütet hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 242
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Dennis Lehane
The DropBargeld
Roman
Aus dem Amerikanischen von Steffen Jacobs
Titel der 2014 bei
William Morrow, New York,
erschienenen Originalausgabe: ›The Drop‹
Copyright © 2014 by Twentieth Century Fox Film
Corporation. All rights reserved
Umschlagfoto (Ausschnitt):
Filmplakat zur gleichnamigen Verfilmung
aus dem Jahr 2014
Copyright © 2014 by Twentieth Century Fox Film
Corporation. All rights reserved
Für Tom und Sarah
Was für eine Liebesgeschichte!
Alle deutschen Rechte vorbehalten
Copyright © 2014
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 06915 0 (1.Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60451 1
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
Indes empören wir uns: »Schwarze Schafe!«,
Im warmen Koben eingesperrt.
Die in der Kälte, haben sie’s gehört,
Mit Staunen, dass sie solcher Vorwurf traf?
Richard Burton, Black Sheep
[7] 1
Tierrettung
Bob fand den Hund zwei Tage nach Weihnachten. Das Viertel lag still in der Kälte, verkatert und aufgebläht. Er kam gerade von seiner üblichen Vier-bis-zwei-Schicht in Cousin Marvs Kneipe in den Flats, wo er seit fast zwei Jahrzehnten als Barkeeper arbeitete. An diesem Abend war nicht viel los gewesen. Millie saß wie immer auf dem Barhocker in der Ecke, nippte von Zeit zu Zeit an ihrem Tom Collins, sprach gelegentlich im Flüsterton mit sich selbst oder tat so, als ob sie fernsehen würde – Hauptsache, sie musste nicht in das Altersheim an der Edison Green zurück. Cousin Marv kam auch vorbei und lungerte eine Weile herum. Er behauptete, die Einnahmen mit der Kasse abgleichen zu wollen, aber die meiste Zeit saß er hinten, las das Rennprogramm und tippte SMS an seine Schwester Dottie.
Sie hätten vermutlich früh dichtgemacht, wären da nicht die Freunde von Richie Whelan gewesen, die das Millie gegenüberliegende Ende des Tresens in Beschlag genommen hatten und den ganzen Abend Trinksprüche auf ihren seit langem vermissten und wahrscheinlich toten Freund ausbrachten.
Auf den Tag genau zehn Jahre zuvor hatte Richie Whelan Cousin Marvs Kneipe verlassen, entweder um Gras [8] aufzutreiben oder ein paar Quaaludes (das war unter seinen Freunden Gegenstand mancher Debatte), und war nie wieder gesehen worden. Zu den Hinterbliebenen zählten neben seiner Freundin eine kleine Tochter, um die er sich nie gekümmert hatte und die bei ihrer Mutter in New Hampshire lebte, und ein Auto, das in der Werkstatt auf einen neuen Spoiler wartete. Deshalb waren sich auch alle so sicher, dass er tot war: Richie hätte dieses Auto nie zurückgelassen; er liebte den verdammten Wagen.
Sehr wenige Menschen nannten Richie bei seinem richtigen Vornamen. Alle kannten ihn als »Glory Days«, weil er andauernd von den ruhmreichen Tagen erzählte, in denen er als Quarterback für die East Buckingham High gespielt hatte. Er hatte die Mannschaft zu dem Rekordergebnis von 7:6 geführt, was kaum erwähnenswert schien, bis man sich ihre Ergebnisse zuvor und seitdem anschaute.
Und so versammelten sich in jener Nacht die Kumpel des seit langem vermissten und wahrscheinlich toten »Glory Days« in Cousin Marvs Kneipe – Sully, Donnie, Paul, Stevie, Sean und Jimmy – und schauten sich im Fernsehen an, wie die Celts von den Heat über das Spielfeld gescheucht wurden. Bob brachte ihnen gerade ungefragt die fünfte Runde – sie ging aufs Haus –, als in dem Spiel etwas geschah, das alle dazu brachte, die Arme in die Höhe zu werfen und laut aufzustöhnen oder zu rufen.
»Scheiße noch mal, ihr seid zu alt«, brüllte Sean in Richtung Bildschirm.
Paul sagte: »So alt sind die gar nicht.«
»Rondo hat LeBron gerade mit seinem beschissenen Rollator geblockt«, sagte Sean. »Und wie heißt dieses [9] Arschloch da, Bogans? Der hat doch einen Werbevertrag für Erwachsenenwindeln.«
Bob stellte die Drinks vor Jimmy ab, dem Schulbusfahrer.
»Hast du dazu auch ’ne Meinung?«, fragte Jimmy ihn.
Bob spürte, dass er errötete, wie oft, wenn Menschen ihn so direkt ansahen, dass er sich genötigt fühlte, ihren Blick zu erwidern. »Ich interessiere mich nicht so für Basketball.«
Sully, der in einer Zahlstelle an der Interstate 90 arbeitete, sagte: »Interessiert dich überhaupt irgendwas, Bob? Liest du gern? Schaust du dir The Bachelorette an?«
Die Jungs grinsten und glucksten, und Bob lächelte entschuldigend.
»Die Drinks gehen aufs Haus«, sagte er.
Er ging weg und ignorierte das Gequatsche hinter seinem Rücken.
Paul sagte: »Ich hab schon Tussis gesehen – echt geile Bräute –, die haben den Typen anzubaggern versucht. Keine Reaktion.«
»Vielleicht steht er auf Männer«, sagte Sully.
»Der Typ steht auf gar nichts.«
Sean erinnerte sich an seine Manieren, hob das Glas und prostete erst Bob und dann Cousin Marv zu. »Danke, Jungs.«
Marv, der jetzt hinter dem Tresen stand und eine Zeitung vor sich ausgebreitet hatte, lächelte und hob bestätigend sein Glas, ehe er sich wieder seiner Lektüre zuwandte.
Die anderen Jungs stießen beherzt an.
Sean sagte: »Bringt jemand einen Trinkspruch auf den alten Knaben aus?«
[10] Sully sagte: »Auf Richie ›Glory Days‹ Whelan, Abschlussklasse ’92 der East Bucky High und ein witziger Scheißkerl. Er ruhe in Frieden.«
Die anderen murmelten zustimmend und tranken, und Marv ging zu Bob hinüber, der gerade schmutzige Gläser in die Spüle stellte. Marv faltete seine Zeitung zusammen und musterte die Männer.
»Du gibst ihnen einen aus?«, fragte er Bob.
»Sie trinken auf einen toten Freund.«
»Wie lange ist der Bursche schon tot? Zehn Jahre?« Marv zog sich kopfschüttelnd den kurzen Ledermantel an, den er dauernd trug. Der Mantel war angesagt gewesen, als die beiden Flugzeuge in die Twin Towers krachten, und er war schon wieder out, als die Türme in sich zusammenfielen. »Es muss auch mal weitergehen im Leben, man kann nicht ewig Gratisdrinks aus einer Leiche schlagen.«
Bob spülte ein Glas aus, ehe er es in die Spülmaschine stellte, und schwieg.
Cousin Marv zog Handschuhe und Schal an. Er warf einen Blick in Millies Richtung. »Wo wir gerade dabei sind: Wir können sie nicht weiter die ganze Nacht lang auf ihrem Schemel reiten lassen, ohne dass sie ihre Drinks bezahlt.«
Bob stellte ein weiteres Glas auf der oberen Ablage ab. »Sie trinkt doch nicht viel.«
Marv beugte sich ganz nah zu ihm vor. »Wann hast du ihr zuletzt einen Drink berechnet? Und nach Mitternacht lässt du sie hier rauchen – glaub bloß nicht, dass ich das nicht wüsste. Das hier ist keine Suppenküche, sondern eine Bar. Entweder zahlt sie heute ihre gesamten Rückstände, oder sie kann erst wiederkommen, wenn sie es getan hat.«
[11] Bob sah ihn an; er sprach leise. »Das sind mindestens hundert Dollar.«
»Hundertvierzig, um genau zu sein.« Marv machte sich auf den Weg nach draußen, in der Tür blieb er stehen. Er zeigte auf den Weihnachtsschmuck in den Fenstern und über dem Tresen. »Ach, und Bob? Häng den Weihnachtsscheiß ab. Wir haben den siebenundzwanzigsten.«
Bob fragte: »Und was ist mit den Heiligen Drei Königen?«
Marv starrte ihn eine Weile wortlos an. »Da fällt mir echt nichts mehr ein«, sagte er und ging.
Nachdem das Spiel zu einem kläglichen Ende gekommen war und die Celtics den Gnadentod von Verwandten gestorben waren, denen sich niemand besonders nahefühlt, zogen Richie Whelans Freunde endlich ab und ließen Bob und die alte Millie allein zurück.
Während Bob den Besen durch die Kneipe schob, hustete Millie sich die Seele aus dem Leib: ein scheinbar nicht enden wollender Raucherhusten mit gewaltiger Schleimproduktion. Gerade, als ihr Erstickungstod unmittelbar bevorzustehen schien, hörte sie auf.
Bob legte auf seiner Besenrunde einen Halt neben ihr ein. »Alles in Ordnung?«
Millie winkte ab. »Alles bestens. Ich nehm noch einen.«
Bob ging um den Tresen herum. Weil er ihr nicht in die Augen sehen konnte, schaute er betreten auf den schwarzen Bodenbelag aus Gummi. »Tut mir leid, aber den muss ich dir berechnen. Ach, und Mill?« – Bob hätte sich am liebsten den Kopf weggeschossen, so peinlich war ihm die Situation – »Du musst deine Rechnung bezahlen.«
[12] »Oh.«
Bob schaute noch immer zu Boden. »Ja.«
Millie machte sich an der Sporttasche zu schaffen, die sie jeden Abend mitbrachte. »Klar doch, klar. Musst ja korrekt abrechnen. Klar.«
Die Sporttasche war alt, der seitliche Schriftzug verblichen. Sie kramte darin herum. Dann legte sie einen Dollarschein und zweiundsechzig Cent auf den Tresen. Kramte noch ein bisschen herum und brachte einen antiken Bilderrahmen ohne Bild zum Vorschein. Sie legte ihn auf den Tresen.
»Das ist Sterlingsilber von Water Street Jewelers«, sagte Millie. »Robert F. Kennedy hat da eine Armbanduhr für Ethel gekauft, Bob. Der ist was wert.«
Bob fragte: »Du hast kein Foto drin?«
Millie schaute auf die Uhr über dem Tresen. »Ist ausgeblichen.«
»Eins von dir?«, fragte Bob.
Millie nickte. »Mit den Kindern.«
Sie wühlte noch einmal in der Sporttasche. Bob stellte einen Aschenbecher vor sie hin. Sie sah zu ihm hoch. Er hätte gern ihre Hand getätschelt – eine tröstliche Geste à la »Du bist nicht allein« –, aber solche Gesten überließ man besser anderen Menschen. Menschen in Filmen zum Beispiel. Jedes Mal, wenn Bob so etwas versuchte, wirkte es peinlich.
Also drehte er sich um und machte ihr noch einen Drink.
Er brachte ihr das Glas. Nahm den Dollar vom Tresen und wandte sich wieder der Kasse zu.
Millie sagte: »Nein, nimm den…«
[13] Bob warf ihr einen Blick über die Schulter zu. »Schon gut.«
Bob kaufte seine Kleidung bei Target – ungefähr alle zwei Jahre neue T-Shirts, Jeans und Flanellhemden. Er fuhr einen Chevrolet Impala, seit sein Vater ihm im Jahr 1983 die Schlüssel dazu gegeben hatte, und weil er nie irgendwohin fuhr, kratzte der Tacho nicht einmal annähernd an der Hunderttausender-Marke. Sein Haus war bezahlt und die Grundsteuer ein Witz, denn mal ehrlich: Wer wollte in dieser Gegend leben? Wenn Bob also etwas hatte, das ihm kaum einer zugetraut hätte, dann war es genügend Geld. Er legte den Dollarschein in die Schublade. Griff in seine Hosentasche, zog ein Bündel Geldscheine hervor und schälte sieben Zwanziger ab, die er zu dem anderen Geld in die Schublade legte.
Als er sich umdrehte, hatte Millie das Kleingeld und den Bilderrahmen wieder in ihrer Sporttasche verstaut.
Millie trank, und Bob beendete seine Reinigungstour. Er kehrte hinter den Tresen zurück, und sie ließ die Eiswürfel in ihrem Glas klappern.
»Kennst du die Heiligen Drei Könige?«
»Klar«, sagte sie. »Sechster Januar.«
»Kein Mensch erinnert sich noch daran.«
»In meiner Jugend hat das was bedeutet«, sagte sie.
»Bei meinem Vater war’s genauso.«
Ihre Stimme nahm einen vage mitleidigen Klang an. »Aber heute nicht mehr.«
»Nein, heute nicht mehr«, stimmte Bob zu und fühlte ein Flattern in seiner Brust, als ob ein eingesperrter Vogel vergeblich den Weg nach draußen suchte.
[14] Millie nahm einen tiefen Zug von ihrer Zigarette und atmete genüsslich aus. Sie hustete noch ein paarmal und drückte den Stummel in den Aschenbecher. Zog einen schäbigen Wintermantel an und zottelte zur Tür. Bob machte ihr auf; draußen fiel ein wenig Schnee.
»Nacht, Bob.«
»Sei vorsichtig«, sagte Bob. »Könnte glatt sein.«
Am Achtundzwanzigsten war Sperrmüllabholung in diesem Teil der Flats, und die Anwohner hatten ihre Tonnen und allerlei Gerümpel auf den Gehsteig gestellt. Bob trottete daran vorbei nach Hause und betrachtete mit einer Mischung aus Belustigung und Verzweiflung, was die Leute alles loswerden wollten. So viel Spielzeug, das so schnell kaputtgegangen war. So viele Sachen, die eigentlich perfekt funktionierten, aber trotzdem weggeworfen wurden. Toaster, Fernsehgeräte, Mikrowellenherde, Stereoanlagen, Kleider, ferngesteuerte Autos und Flugzeuge und Monstertrucks, die mit einem Tropfen Klebstoff hier und einem Streifen Klebeband da wieder auf Vordermann gebracht werden konnten. Und es war ja nicht so, dass seine Nachbarn reich gewesen wären. Bob zählte längst nicht mehr mit, wie oft ihn nachts Ehestreitigkeiten über Geldfragen vom Einschlafen abgehalten hatten, wie viele Menschen er morgens mit sorgenvollen Gesichtern in die U-Bahn steigen sah, die mit schwitzigen Händen die Seite »Aushilfe gesucht« umklammert hielten. Er stand hinter ihnen in der Schlange in Jimmys Lebensmittelgeschäft, während sie ihre Essensmarken zählten, oder in der Bank, wenn sie ihre Sozialhilfeschecks einlösten. Einige hatten zwei Jobs, andere [15] konnten sich ihre Wohnungen nur mit staatlicher Unterstützung leisten, und wieder andere grübelten bei Cousin Marv über die Kümmernisse ihres Lebens, während ihre Augen in unsichtbare Weiten starrten und ihre Hände die Griffe von Bierkrügen umklammerten.
Trotzdem hatten sie sich was geleistet. Hatten ganze Gerüste aus Schulden errichtet, und gerade dann, wenn der wacklige Bau unter seinem eigenen Gewicht einzustürzen drohte, hatten sie sich auf Pump eine neue Wohnzimmergarnitur gekauft und die noch obendrauf geknallt. Und da sie sich etwas leisten mussten, mussten sie zum Ausgleich etwas wegwerfen. In den Müllbergen, die er sah, kam eine brutale Sucht zum Ausdruck, und er musste an Essen denken, das ausgeschissen worden war, obwohl es besser gar nicht erst auf den Tisch gekommen wäre.
Bob – sogar von diesem Ritual ausgeschlossen durch das Brandzeichen seiner Einsamkeit, seiner Unfähigkeit, jemanden für mehr als fünf Minuten und über ein banales Alltagsgespräch hinaus für sich zu interessieren – gab manchmal der Sünde des Hochmuts nach: Hochmut darüber, dass er selbst nicht so leichtsinnig konsumierte, nicht das Bedürfnis hatte, all das zu kaufen, was Fernsehen, Radio, Reklametafeln, Zeitschriften und Zeitungen einen zu kaufen aufforderten. Dem, was er sich wünschte, brächte ihn das nicht näher, denn das, was er sich wünschte, war das Ende seiner Einsamkeit – aber er wusste, dass es dafür keine Abhilfe gab.
Er lebte allein in seinem Elternhaus, und wenn es ihn mit all seinen Gerüchen und Erinnerungen und dunklen Sofas fast zu verschlingen drohte, hatten seine Fluchtversuche – [16] auf Gemeindefeste, zu Picknickausflügen und zu dieser einen, schrecklichen Veranstaltung einer Singlebörse – die Wunde noch tiefer klaffen lassen, so dass er Wochen damit verbrachte, sie zu verbinden und sich für seine Hoffnungen zu verfluchen. Dumme Hoffnung, flüsterte er in der Einsamkeit seines Wohnzimmers. Dumme, dumme Hoffnung.
Aber sie lebte trotzdem in ihm. In aller Stille und meistens hoffnungslos. Hoffnungslose Hoffnung, dachte er manchmal und brachte ein schwaches Lächeln zustande, so dass die Leute in der U-Bahn sich fragten, was zum Teufel Bob zum Lächeln brachte. Bob, der seltsame, einsame Barmann. Ein netter Typ, auf den man sich verlassen konnte, wenn es darum ging, beim Schneeschippen zu helfen oder eine Runde auszugeben, einer von den Guten, aber so schüchtern, dass man die meiste Zeit nicht verstand, was er sagte, bis man es schließlich aufgab, ihm höflich zunickte und sich jemand anderem zuwandte.
Bob wusste, wie sie über ihn redeten, und er konnte es ihnen nicht verdenken. Er verfügte über genügend Distanz zu sich selbst, um zu sehen, was sie sahen – einen hoffnungslosen Verlierer, der sich in Gesellschaft unbehaglich fühlte und anfällig für allerlei Ticks war: nervöses Augenzwinkern zum Beispiel, oder die Angewohnheit, beim Tagträumen den Kopf in seltsamen Winkeln seitwärts zu neigen. Ein Verlierer, der die anderen Verlierer im Vergleich ein wenig besser dastehen ließ.
»Sie haben so viel Liebe in Ihrem Herzen«, sagte Pater Regan zu Bob, als dieser bei der Beichte weinend zusammengebrochen war. Pater Regan brachte ihn in die [17] Sakristei, und sie tranken gemeinsam ein paar Gläser Single Malt, die der Geistliche in dem Wandschrank mit den Talaren versteckte. »Wirklich, Bob, jeder kann es sehen. Und ich bin mir sicher, dass eine gute, gottesfürchtige Frau diese Liebe eines Tages erkennen und erwidern wird.«
Wie erzählte man einem Mann Gottes etwas über die Welt der Menschen? Bob wusste, dass der Priester es gut mit ihm meinte, dass er theoretisch recht hatte. Doch die Erfahrung hatte Bob gelehrt, dass Frauen die Liebe in seinem Herzen zwar sahen, aber trotzdem ein Herz in einer attraktiveren Hülle bevorzugten. Und es lag nicht nur an den Frauen, es lag auch an ihm. Bob fehlte in diesen subtilen Dingen das Selbstvertrauen. Schon seit Jahren.
In dieser Nacht blieb er auf dem Bürgersteig stehen, spürte den tintenschwarzen Nachthimmel über dem Kopf und die Kälte in den Fingern und verschloss seine Augen vor dem Abend.
Er war daran gewöhnt. Er war daran gewöhnt.
Es war in Ordnung.
Man konnte ganz gut damit leben, wenn man nicht dagegen ankämpfte.
Mit geschlossenen Augen hörte er es – ein mattes Jammern, begleitet von leisem Kratzen und einem lauteren metallischen Scheppern. Er öffnete die Augen. Eine große Metalltonne, mit einem schweren Deckel fest verschlossen. Fünf Meter weiter, rechts auf dem Bürgersteig, unter dem grellgelben Licht der Straßenlampen. Sie wackelte ein wenig hin und her, und ihr Boden schabte über die Pflastersteine. Er beugte sich über die Tonne und hörte wieder dieses Jammern, das Geräusch eines Lebewesens, das nur noch [18] einen Atemzug von seinem letzten Schnaufer entfernt ist. Bob hob den schweren Deckel hoch.
Er musste sich durch allerlei Krempel hindurcharbeiten, um zu ihm zu gelangen. Auf verdrecktem Bettzeug und schimmligen Kissen stapelten sich eine Mikrowelle ohne Tür und fünf dicke Bände der Gelben Seiten, von denen der letzte aus dem Jahr 2005 stammte. Der Hund – entweder ein sehr kleines Exemplar oder ein Welpe – lag ganz unten, am Boden der Tonne, und als das Licht ihn traf, rollte er sich ein und verbarg den Kopf am Bauch. Er gab ein leises, glucksendes Winseln von sich und spannte seinen Körper noch mehr an. Seine Augen waren winzige Schlitze. Ein kümmerliches Etwas. Bob konnte die Rippen sehen. Kein Halsband. Er war braun, hatte eine weiße Schnauze und Pfoten, die für seinen Körper viel zu groß wirkten.
Das Winseln wurde lauter, als Bob in die Tonne griff und den Hund am Nackenspeck aus seinen eigenen Exkrementen hob. Bob kannte sich nicht besonders gut mit Hunden aus, aber den hier konnte man kaum für etwas anderes als einen Boxer halten. Und er war eindeutig ein Welpe, der jetzt seine großen braunen Augen öffnete und ihn ansah, während er ihn vor sich in die Höhe hielt.
Irgendwo, dessen war er sich sicher, schliefen zwei Menschen miteinander. Ein Mann und eine Frau. Ineinander verschlungen. Hinter einem dieser Rollläden im gelben Licht der Straßenlampen. Bob konnte sie da drinnen spüren: nackt und gesegnet. Und hier stand er, draußen in der Kälte, mit einem halbtoten Hund, der ihn anstarrte. Der vereiste Bürgersteig schimmerte wie Marmor, und der Wind war dunkel und grau wie Schlick.
[19] »Was haben Sie da?«
Bob drehte sich um und sah die Straße hinauf und hinab.
»Ich bin hier oben. Und es ist mein Müll, in dem Sie wühlen.«
Sie war auf der Veranda des dreistöckigen Apartmenthauses ein paar Meter weiter. Die Verandabeleuchtung war angeschaltet, und sie stand mit nackten Füßen zitternd da. Sie griff in die Tasche ihrer Kapuzenjacke und zog eine Schachtel Zigaretten heraus. Sie beobachtete ihn, während sie sich eine ansteckte.
»Ich habe einen Hund.« Bob hielt ihn hoch.
»Einen was?«
»Einen Hund. Einen Welpen. Boxer, glaube ich.«
Sie hustete Rauch aus. »Wer steckt denn einen Hund in die Mülltonne?«
»Ich weiß«, sagte er. »Ich glaube, er blutet.« Er ging einen Schritt auf die Veranda zu, und sie wich zurück.
»Wen kennen Sie, den ich kennen könnte?« Ein Mädchen aus der Stadt, das sein Misstrauen gegenüber einem Fremden nicht einfach so ablegte.
»Ich weiß nicht«, sagte Bob. »Wie steht’s mit Francie Hedges?«
Sie schüttelte den Kopf. »Kennen Sie die Sullivans?«
Das würde die Auswahl kaum eingrenzen. Nicht in dieser Gegend. Aus jedem Baum, den man schüttelte, fiel ein Sullivan. Meistens kam ein Sixpack hinterher. »Da kenne ich einige.«
Dieses Gespräch führte ins Leere. Der Welpe sah ihn an und zitterte noch mehr als die junge Frau.
»He«, sagte sie, »wohnen Sie in dieser Gemeinde?«
[20] »Die nächste da drüben.« Er deutete mit dem Kopf nach links. »Saint Dom.«
»Gehen Sie in die Kirche?«
»An den meisten Sonntagen.«
»Dann kennen Sie Pater Pete?«
»Pete Regan?«, sagte er. »Klar.«
Sie brachte ein Handy zum Vorschein. »Wie heißen Sie?«
»Bob«, sagte er. »Bob Saginowski.«
Sie hielt ihr Handy hoch und schoss ein Foto von ihm. Er wusste kaum, wie ihm geschah, sonst wäre er sich wenigstens mit der Hand durchs Haar gefahren.
Bob wartete, während sie aus dem Lichtschein trat, das Handy in der Hand. Er starrte den Welpen an. Der Welpe starrte zurück, als wollte er sagen: Wie bin ich denn hierhin geraten?« Bob berührte seine Nase mit dem Zeigefinger. Der Welpe zwinkerte mit seinen riesigen Augen. Für einen Augenblick vergaß Bob all seine Sünden.
»Das Foto ist gerade rausgegangen«, sagte sie aus der Dunkelheit. »An Pater Pete und sechs andere Leute.«
Bob sah in die Dunkelheit und sagte nichts.
»Nadia«, sagte die junge Frau und trat wieder ins Licht. »Bringen Sie ihn hoch, Bob.«
Sie wuschen ihn in Nadias Spüle, trockneten ihn ab und trugen ihn zu ihrem Küchentisch.
Nadia war klein. Eine knotige Narbe verlief wie ein Seil unter ihrem Kehlkopf. Die Narbe war dunkelrot, das Grinsen eines betrunkenen Zirkusclowns. Nadias Gesicht war ein winziger Mond, mit Aknenarben übersät, und ihre kleinen Augen erinnerten an Herzchenanhänger. Schultern, die [21] aussahen, als würden sie an den Armen weniger enden als sich auflösen. Ellbogen wie plattgedrückte Bierdosen. Ein blonder Bubikopf, mit Locken zu beiden Seiten ihres ovalen Gesichts. »Das ist kein Boxer.« Bob sah sich kurz in ihren Augen gespiegelt, ehe sie den Welpen auf dem Küchentisch absetzte. »Das ist ein American Staffordshire Terrier.«
Bob wusste, dass er aus ihrem Tonfall etwas Bestimmtes heraushören sollte, aber er wusste nicht, was es war, und so schwieg er.
Als die Stille zu lange andauerte, sah sie wieder zu ihm hoch. »Ein Pitbull.«
»Das ist ein Pitbull?«
Sie nickte und tupfte noch einmal die Kopfwunde des Welpen ab. Jemand habe auf ihn eingeprügelt, erklärte sie. Ihn vermutlich bewusstlos geschlagen, für tot gehalten und in den Müll geworfen.
»Warum?«, fragte Bob.
Sie sah ihn an, und ihre runden Augen wurden noch runder und größer. »Einfach so.« Sie zuckte mit den Achseln und setzte die Untersuchung des Hundes fort. »Ich hab mal im Tierschutz gearbeitet. Kennen Sie das Tierheim an der Shawmut? Ich war da tierärztliche Fachkraft. Ehe ich gemerkt habe, dass das nicht mein Ding ist. Ist sehr schwierig bei dieser Rasse…«
»Was?«
»Jemanden für sie zu finden«, sagte sie. »Ein neues Zuhause für sie zu finden.«
»Ich kenne mich mit Hunden nicht aus. Ich hatte nie einen. Ich lebe allein. Ich bin einfach nur an dieser Tonne [22] vorbeigekommen.« Bob wurde von dem verzweifelten Verlangen gepackt, sich selbst zu erklären, sein ganzes Leben zu erklären. »Ich bin einfach nicht…« Er hörte den Wind draußen, ein schwarzes Rasseln. Regentropfen oder Hagelkörner schlugen hart gegen die Fenster. Nadia hob die linke Vorderpfote des Welpen hoch – die anderen drei Pfoten waren braun, aber diese war weiß mit pfirsichfarbenen Sprenkeln. Sie ließ die Pfote fallen, als wäre sie ansteckend. Sie wandte sich wieder der Kopfwunde zu und untersuchte das rechte Ohr, an dessen Spitze – Bob hatte es bis jetzt noch nicht bemerkt – ein Stück fehlte.
»Er wird überleben«, sagte sie. »Sie brauchen eine Schlafkiste und Futter und noch paar andere Sachen.«
»Nein«, sagte Bob, »Sie haben mich nicht richtig verstanden.«
Sie neigte ihren Kopf zur Seite und warf ihm einen Blick zu, der sagte, dass sie ihn völlig verstanden habe.
»Ich kann das nicht. Ich habe ihn bloß gefunden. Ich wollte ihn zurückbringen.«
»Zu dem, der ihn geschlagen und dem Tod überlassen hat?«
»Nein, nein. Eher jemandem wie… der Behörde.«
»Das wäre das Tierheim«, sagte sie. »Die geben dem Eigentümer sieben Tage Zeit, ihn abzuholen, und dann…«
»Der Typ, der ihn geschlagen hat? Der kriegt eine zweite Chance?«
Sie sah ihn stirnrunzelnd an und nickte. »Wenn er ihn nicht abholt« – sie hob das Ohr des Welpen an und spähte hinein – »dann wird man versuchen, für den kleinen Burschen jemanden zu finden. Aber es ist schwierig, ein [23] Zuhause für sie zu finden. Pitbulls. Und meistens…« Sie schaute Bob an. »Meistens will die niemand haben.«
Bob spürte, dass eine Welle der Traurigkeit von ihr ausging, und er war sofort beschämt. Er wusste nicht, womit, aber er hatte ihr weh getan. Hatte Schmerz verursacht. Hatte diese junge Frau enttäuscht. »Ich…«, setzte er an. »Es ist nur…«
Sie schaute kurz zu ihm hoch. »Ja?«
Bob sah den Welpen an. Nach dem langen Tag in der Tonne, sicher auch infolge des Schlags, hingen seine Lider schwer herab. Immerhin hatte er zu zittern aufgehört.
»Sie könnten ihn nehmen«, sagte Bob. »Sie haben da gearbeitet, das sagten Sie doch. Sie…«
Sie schüttelte den Kopf. »Ich kann mich nicht mal um mich selbst kümmern.« Sie schüttelte den Kopf erneut. »Und ich arbeite zu viel. Zu den seltsamsten Zeiten. Unvorhersehbar.«
»Können Sie mir Zeit bis Sonntagmorgen geben?« Bob hatte keine Ahnung, wie diese Worte seinen Mund verlassen hatten, denn er erinnerte sich nicht daran, sie formuliert oder auch nur gedacht zu haben.
Die junge Frau musterte ihn aufmerksam. »Sie sagen das nicht bloß so? Wenn Sie ihn nämlich nicht bis Sonntagmittag abholen, fliegt er da zur Hintertür raus. Ohne Scheiß.«
»Dann also Sonntag.« Bob sagte das mit einer Überzeugtheit, die er tatsächlich empfand. »Ganz bestimmt.«
»Ja?«
»Ja.« Bob kam sich wie ein Verrückter vor. So leicht wie eine Oblate beim Abendmahl. »Ja.«
[24] 2
Unendlich
Die tägliche 7-Uhr-Messe in Saint Dominic hatte schon vor Bobs Geburt keine Menschenmengen angezogen. Aber jetzt schmolz die karge Zahl der Besucher mit jedem Monat dahin.
Am Morgen nachdem er den Hund gefunden hatte, konnte er aus der zehnten Reihe deutlich hören, wie der Saum von Pater Regans Talar über den Marmorboden vor dem Altar strich. Die einzigen Kirchenbesucher – klar, es war ein rauher Morgen: eisglatte Straßen und ein kalter Wind, den man förmlich sehen konnte – waren Bob, die Witwe Malone, Theresa Coe, frühere Leiterin der SaintDom-Schule (als es noch eine Saint-Dom-Schule gab), der alte Williams und der puerto-ricanische Cop, dessen Name, da war sich Bob ziemlich sicher, Torres lautete.
Torres sah nicht wie ein Cop aus – seine Augen schauten freundlich, manchmal sogar humorvoll. Umso überraschender war es, das Pistolenhalfter an seiner Hüfte baumeln zu sehen, wenn er nach dem Abendmahl an seinen Platz auf der Kirchenbank zurückkehrte. Bob blieb beim Abendmahl immer sitzen, sehr zum Bedauern von Pater Regan, der mehrmals versucht hatte, ihn davon zu überzeugen, dass der Schaden durch eine nicht eingenommene Eucharistie, sollte er sich tatsächlich einer Todsünde schuldig gemacht [25] haben, weit schlimmer sei als der Schaden, der durch die Teilnahme am Sakrament verursacht werden konnte. Bob jedoch war als Katholik alter Schule erzogen worden, zu einer Zeit, als viel von der Vorhölle und noch mehr vom Fegefeuer die Rede gewesen war und als Nonnen ihre Herrschaft mit scharfen Linealhieben ausübten. Auch wenn Bob, theologisch gesehen, in den meisten Kirchenfragen ein Liberaler war, blieb er doch ein Traditionalist.
Saint Dom war eine ältere Kirche. Erbaut im späten neunzehnten Jahrhundert. Ein schönes Bauwerk – dunkles Mahagoni und Marmor in gebrochenem Weiß, hohe Buntglasfenster mit Darstellungen traurig dreinblickender Heiliger. Sie sah aus, wie eine Kirche aussehen soll. Die neueren Kirchen… Bob wusste nicht, was er mit denen anfangen sollte. Die Kirchenbänke waren zu hell, die Dachfenster zu zahlreich. Er fühlte sich in diesen Gotteshäusern, als ob er sein Leben feiern sollte, statt seinen Sünden nachzusinnen.
Aber in einer alten Kirche, einer Kirche mit Mahagoni und Marmor und dunklen Wandtäfelungen, einer Kirche von stiller Würde und weit zurückreichender Geschichte, konnte er sowohl über seine Hoffnungen als auch über seine Verfehlungen angemessen nachdenken.
Die anderen Gemeindemitglieder stellten sich in einer Reihe auf, um die Hostie in Empfang zu nehmen, während Bob kniend in seiner Bankreihe verharrte. Niemand war in seiner Nähe. Er war eine Insel.
Torres, der Cop, war jetzt an der Reihe. Ein gutaussehender Mann in den frühen Vierzigern, schon ein bisschen aufgeschwemmt. Er empfing die Hostie auf der Zunge, nicht in der hohlen Hand. Noch ein Traditionalist.
[26] Er drehte sich um, bekreuzigte sich, und seine Augen streiften kurz Bob, ehe er seine Bank erreichte.
»Erhebt Euch!«
Bob bekreuzigte sich und stand auf. Die Kniebank klappte er mit dem Fuß hoch.
Pater Pete hob seine Hand über die kleine Schar und schloss die Augen. »Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Diese Messe hat geendet. Nun gehet in Frieden, den Herrn zu lieben und ihm zu dienen. Amen.«
Bob verließ seine Bankreihe und ging den Mittelgang entlang. Am Ausgang tauchte er seine Finger in das Weihwasserbecken und bekreuzigte sich ein weiteres Mal. Torres tat dasselbe am Becken gegenüber. Er nickte ihm grüßend zu, wie ein vertrauter Fremder dem anderen zunickt. Bob erwiderte das Nicken, und sie traten durch verschiedene Ausgänge hinaus in die Kälte.
Bob begann gegen Mittag seine Schicht bei Cousin Marv, denn er mochte es, wenn nicht viel los war. Das gab ihm Zeit, über diese Welpensache nachzudenken, mit der er auf einmal konfrontiert war.
Die meisten nannten Marv aus purer Gewohnheit »Cousin Marv«, eine Tradition, die bis in Grundschulzeiten zurückreichte, auch wenn niemand sich mehr an den genauen Anlass erinnern konnte. Aber Marv war tatsächlich Bobs Cousin. Mütterlicherseits.
In den späten Achtzigern und frühen Neunzigern hatte Marv eine Gang angeführt. Sie hatte überwiegend aus [27]