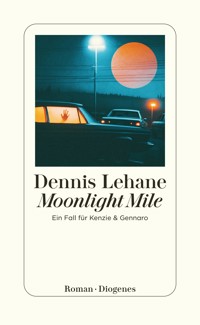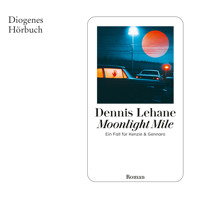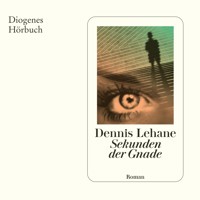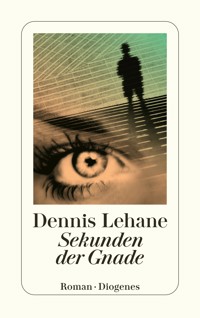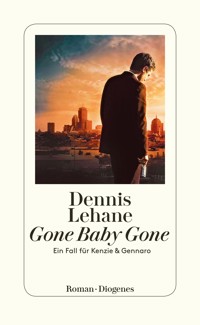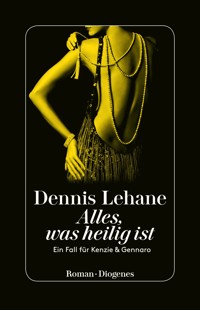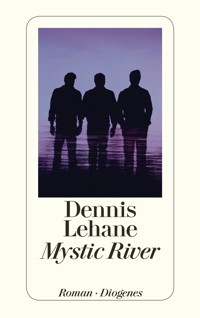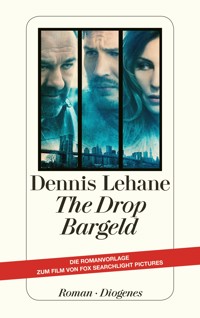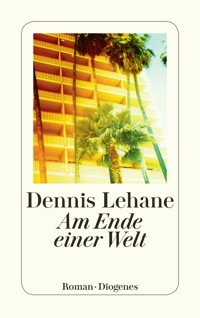10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes Verlag AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Rachel Childs hat alles, was man sich erträumt: ein Leben ohne finanzielle Sorgen, einen liebevollen Ehemann. Doch im Bruchteil einer Sekunde macht ausgerechnet dieser Mann ihr Leben zu einer Farce aus Betrug, Verrat und Gefahr. Nichts ist mehr, wie es scheint, und Rachel muss sich entscheiden: Wird sie kämpfen für das, was sie liebt, oder im Strudel einer unglaublichen Verschwörung untergehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Dennis Lehane
Der Abgrund in dir
ROMAN
Aus dem Amerikanischen von Steffen Jacobs und Peter Torberg
Diogenes
When you just give love and never get love
you’d better let love depart
I know it’s so, and yet I know
I can’t get you out of my heart
Buddy Johnson,
›Since I Fell For You‹
Maskiert trete ich auf.
René Descartes
Nach der Treppe
An einem Dienstag im Mai, im Alter von sechsunddreißig Jahren, erschoss Rachel ihren Mann. Er stolperte mit einem seltsam wissenden Gesichtsausdruck rücklings, als ob er schon immer geahnt hätte, dass sie es tun würde.
Gleichzeitig wirkte er auch überrascht. Sie nahm an, dass sie ähnlich aussah.
Ihre Mutter wäre nicht überrascht gewesen.
Ihre Mutter, die niemals verheiratet gewesen war, hatte einen berühmten Ratgeber geschrieben, wie man erfolgreich verheiratet blieb. Die einzelnen Kapitel waren nach Phasen benannt, welche Dr. Elizabeth Childs in allen Beziehungen ausgemacht hatte, die mit gegenseitiger Zuneigung begannen. Das Buch trug den Titel Die Treppe und war so erfolgreich, dass man ihre Mutter überzeugte (»nötigte«, hätte sie gesagt), zwei Fortsetzungen zu schreiben, Höher auf der Treppe und Treppenstufen: ein Arbeitsbuch, von denen sich jedes ein wenig schlechter verkaufte als das vorangegangene.
Insgeheim hielt ihre Mutter alle drei Bücher für »emotional unausgegorene Quacksalbereien«, aber sie bewahrte sich in ihrem Herzen eine wehmütige Zuneigung für Die Treppe, denn ihr war beim Schreiben nicht klar gewesen, wie wenig sie tatsächlich wusste. Das sagte sie Rachel, als diese zehn war. Im selben Sommer, sie hatte schon einige ihrer Nachmittagscocktails gekippt, sagte sie auch: »Ein Mann ist das, was er dir über sich erzählt, und das meiste davon sind Lügen. Schau ja nicht zu genau hin. Wenn du seine Lügen durchschaust, wird das für euch beide nur peinlich. Am besten kaufst du ihm den ganzen Quatsch einfach ab.«
Dann hatte ihre Mutter sie auf den Kopf geküsst. Ihre Wange getätschelt. Ihr gesagt, dass sie nichts zu befürchten habe.
Rachel war sieben gewesen, als Die Treppe erschien. Sie erinnerte sich an die endlosen Telefongespräche, die nie endende Abfolge von Reisen, die neu auflebende Zigarettensucht ihrer Mutter und den verzweifelten, seltsam abgeklärten Ruhm, der sie plötzlich ereilte. Sie erinnerte sich an ein Gefühl, das sie kaum ausdrücken konnte: dass nämlich ihre stets unglückliche Mutter mit wachsendem Erfolg nur verbitterter wurde. Viele Jahre später vermutete sie, dass der Ruhm und das Geld ihrer Mutter die Ausflüchte für ihre Unzufriedenheit nahmen. Zwar konnte sie die Probleme anderer Menschen hervorragend diagnostizieren, hatte aber keinen Schimmer, wie sie sich selbst analysieren sollte. So suchte sie ihr Leben lang nach Lösungen für Probleme, die ihr so tief in den Knochen steckten, dass sie sie gar nicht erkannte. Davon wusste Rachel mit sieben Jahren natürlich noch nichts, und auch nicht mit siebzehn. Sie wusste nur, dass ihre Mutter eine unglückliche Frau war – und folglich war Rachel ein unglückliches Kind.
Als Rachel ihren Mann erschoss, standen sie auf einem Boot in Boston Harbor. Ihr Mann hielt sich nur kurz auf den Beinen – sieben Sekunden? Zehn? –, ehe er vom Hinterdeck ins Wasser stürzte.
Aber in diesen letzten Sekunden wurde ein ganzer Katalog von Gefühlen in seinem Blick sichtbar.
Bestürzung. Selbstmitleid. Entsetzen. Eine Verlassenheit, die so umfassend war, dass sie ihn dreißig Jahre jünger machte und vor ihren Augen in einen Zehnjährigen verwandelte.
Wut natürlich. Empörung.
Eine plötzliche und erbitterte Entschlossenheit, als ob alles in Ordnung kommen würde, als ob er diese Sache gesund und munter überstehen würde, obwohl das Blut aus seinem Herzen floss und über die Hand, mit der er die Wunde bedeckte. Er war schließlich stark, er hatte alles, was in seinem Leben von Wert war, durch bloße Willenskraft erreicht, und mit Willenskraft würde er auch hier durchkommen.
Dann das Dämmern der Erkenntnis: nein, würde er nicht.
Er sah ihr direkt in die Augen, während das unbegreiflichste aller Gefühle sein Recht einforderte und alle anderen überlagerte:
Liebe.
Aber das war unmöglich.
Und dennoch …
Es konnte kein Zweifel daran bestehen. Wild, hilflos, rein. Rot erblühend und um sich greifend wie das Blut auf seinem Hemd.
Er formte die Wörter mit den Lippen, wie er es oft von der anderen Seite eines überfüllten Raumes aus getan hatte: Ich. Liebe. Dich.
Und dann fiel er aus dem Boot und verschwand unter der schwarzen Wasseroberfläche.
Wäre sie zwei Tage zuvor gefragt worden, ob sie ihren Mann liebte, hätte sie »ja« gesagt.
Wäre ihr dieselbe Frage gestellt worden, selbst noch während sie den Abzug drückte, hätte sie »ja« gesagt.
Ihre Mutter hatte ein Kapitel darüber geschrieben – Kapitel 13: »Missverhältnis«.
Oder war das nächste Kapitel – »Tod eines Mythos« – zutreffender?
Rachel wusste es nicht genau. Manchmal brachte sie die beiden durcheinander.
I
Rachel im Spiegel 1977–2010
1
Dreiundsiebzig Mal James
Rachel wurde im Pioneer Valley in West-Massachusetts geboren. Die Gegend war bekannt als die Region der fünf Colleges – Amherst, Hampshire, Mount Holyoke, Smith und die Universität Massachusetts –, und sie beschäftigte zweitausend Lehrkräfte, um fünfundzwanzigtausend Studenten zu unterrichten. Rachel wuchs in einer Welt der Cafés, Frühstückspensionen, weitläufigen öffentlichen Grünanlagen und altmodischen Holzschindelhäuser auf – Häuser mit umlaufenden Veranden und modrig riechenden Dachböden. Im Herbst begruben die Blätter die Straßen und Bürgersteige unter sich und blieben in den Zwischenräumen der Holzlattenzäune stecken. Manchen Winter deckte der Schnee das Tal so dicht zu, dass Stille zum vorherrschenden Geräusch wurde. Im Juli und August trug der Postbote die Briefe mit dem Fahrrad aus, eine altmodische Klingel am Lenker, und es kamen Touristen, welche die Theater und Antiquitätengeschäfte bevölkerten.
Ihr Vater hieß James. Sonst wusste sie wenig über ihn. Sie erinnerte sich an sein dunkles, gewelltes Haar und dass sein überraschend hervorbrechendes Lächeln immer ein wenig unsicher gewirkt hatte. Mindestens zweimal war er mit ihr auf einem Spielplatz mit einer dunkelgrünen Rutsche gewesen, über dem die Wolken von Berkshire so tief hingen, dass er das Kondenswasser von der Schaukel wischen musste, ehe er sie daraufsetzen konnte. Auf einem dieser Ausflüge hatte er sie zum Lachen gebracht, aber sie erinnerte sich nicht mehr, womit.
James war Lehrer an einem College gewesen. Sie hatte keine Ahnung, an welchem, und sie wusste auch nicht, ob er wissenschaftlicher Mitarbeiter, Dozent oder fest angestellter Professor gewesen war. Sie wusste nicht einmal, ob er an einem der »berühmten Fünf« unterrichtet hatte. Er hätte auch am Berkshire oder Springfield Technical, am Greenfield CC oder am Westfield State arbeiten können oder an irgendeinem der anderen Colleges, von denen es in der Region mindestens ein Dutzend gab.
Ihre Mutter unterrichtete am Mount Holyoke, als James die beiden verließ. Rachel war nicht mal drei Jahre alt und hätte später nicht mit Sicherheit sagen können, ob sie dabei gewesen war, als ihr Vater fortging, oder ob sie sich das bloß eingebildet hatte, um sich über seine Abwesenheit hinwegzutrösten. Sie hörte, wie die Stimme ihrer Mutter durch die Wände des kleinen Hauses an der Westbrook Road drang, das sie in jenem Jahr gemietet hatten. Hast du mich verstanden? Wenn du durch diese Tür gehst, werde ich dich aus meinem Leben auslöschen. Kurz darauf das dumpfe Poltern eines Koffers auf der Hintertreppe, gefolgt vom Zuschnappen der Kofferraumklappe. Das Krächzen und Pfeifen eines kalten Motors in einem kleinen Auto, der gegen das Anlassen protestiert. Dann Reifen, die über das herbstliche Laub und die gefrorene Erde gleiten, gefolgt von … Stille.
Vielleicht hatte ihre Mutter nicht geglaubt, dass er wirklich gehen würde. Vielleicht hatte sie sich nach seinem Weggang eingeredet, dass er zurückkehren würde. Als er fortblieb, verwandelte sich ihre Bestürzung in Hass, und der Hass steigerte sich ins Unermessliche.
»Er ist weg«, sagte sie, als Rachel ungefähr fünf war und begonnen hatte, hartnäckige Fragen nach seinem Verbleib zu stellen. »Er will nichts mit uns zu tun haben. Und das ist in Ordnung, Liebling, weil wir ihn nicht brauchen, um uns zu definieren.« Sie kniete vor Rachel nieder und strich ihr eine widerspenstige Haarsträhne hinter das Ohr. »Und jetzt werden wir nie wieder von ihm sprechen. Einverstanden?«
Aber natürlich sprach Rachel weiter von ihm und stellte ihre Fragen. Anfangs machte das ihre Mutter wütend; wilde Panik flammte dann in ihren Augen auf, und sie atmete scharf ein. Aber schließlich trat an die Stelle der Panik ein seltsames schwaches Lächeln. So schwach, dass man es kaum ein Lächeln nennen konnte, nur ein leises Aufwärtszucken ihres rechten Mundwinkels, das zugleich arrogant, bitter und triumphierend war.
Es dauerte Jahre, bis Rachel in diesem Lächeln den Entschluss ihrer Mutter erkannte (ob bewusst oder unbewusst, war ihr nie ganz klar), die Identität ihres Vaters zum zentralen Schlachtfeld eines Krieges zu machen, der Rachels gesamte Jugend bestimmen sollte.
Es begann damit, dass sie versprach, Rachel an ihrem sechzehnten Geburtstag James’ Nachnamen zu nennen, vorausgesetzt, dass Rachel bis dahin die nötige Reife zeigen würde. Aber in dem Sommer bevor sie sechzehn wurde, verhaftete man sie in einem gestohlenen Auto zusammen mit Jarod Marshall, mit dem sie sich eigentlich nie mehr hatte treffen wollen – so lautete zumindest das Versprechen, das sie ihrer Mutter gegeben hatte. Das nächste Stichtag war ihr Highschool-Abschluss, aber nach einem Ecstasy-Absturz hatte sie Glück, dass sie ihren Abschluss überhaupt bekam. Später, sagte ihre Mutter, später. Wenn sie aufs College ginge, und zwar auf ein »richtiges« College, dann, so sagte ihre Mutter, dann vielleicht.
Sie stritten dauernd deswegen. Rachel schrie und warf Sachen durch die Gegend, und das Lächeln ihrer Mutter wurde kälter und noch schwächer, als es sowieso schon war. Immer wieder fragte sie Rachel: »Warum?«
Warum willst du das wissen? Warum willst du einen Fremden kennenlernen, der niemals Teil deines Lebens war oder irgendetwas zu deiner finanziellen Sicherheit beigetragen hat? Solltest du nicht erst einmal herausfinden, was in dir selbst dich so unglücklich macht, ehe du in die Welt hinausgehst und einen Mann suchst, der dir keine Antworten geben kann und keinen Frieden?
»Weil er mein Vater ist!«, schrie Rachel immer wieder.
»Er ist nicht dein Vater«, sagte ihre Mutter mit einem Anflug salbungsvoller Anteilnahme. »Er ist mein Samenspender.«
Das sagte sie am Ende einer ihrer schlimmsten Auseinandersetzungen, dem Tschernobyl der Mutter-Tochter-Debatten. Rachel glitt geschlagen an der Wand des Wohnzimmers hinab und flüsterte: »Du bringst mich um.«
»Ich beschütze dich«, sagte ihre Mutter.
Rachel sah hoch und erkannte zu ihrem Entsetzen, dass es ihrer Mutter ernst war. Schlimmer noch, sie hielt sich an dieser Überzeugung aufrecht.
Als Rachel während ihres ersten Collegejahres in Boston in einem Einführungsseminar zum Thema »Britische Literaturwissenschaft seit 1550« saß, übersah ihre Mutter eine rote Ampel in Northampton, und ein Tanklaster fuhr mit Höchstgeschwindigkeit in die Flanke ihres Saab. Anfangs befürchtete man, dass der Benzintank bei dem Unfall leckgeschlagen sei, aber das stellte sich als unbegründete Sorge heraus. Feuerwehr und Rettungskräfte, die sogar aus dem entfernten Pittsfield gekommen waren, atmeten erleichtert auf, denn die Kreuzung befand sich in einem dichtbesiedelten Gebiet zwischen einem Altersheim und einer Vorschule.
Der Fahrer des Tanklasters erlitt ein leichtes Schleudertrauma und einen Bänderriss im Knie. Elizabeth Childs, die einst berühmte Autorin, starb bei dem Aufprall. Auch wenn ihre landesweite Prominenz längst abgeklungen war, so war sie doch immer noch eine glanzvolle regionale Berühmtheit. Sowohl der Berkshire Eagle als auch die Daily Hampshire Gazette druckten einen Nachruf auf dem unteren Teil ihrer Titelseiten, und ihr Begräbnis war gut besucht. Der anschließende Leichenschmaus allerdings weniger. Rachel verschenkte den Großteil des Essens an ein Obdachlosenheim. Sie sprach mit mehreren Freundinnen ihrer Mutter und einem Mann namens Giles Ellison, der am Amherst College Politikwissenschaften unterrichtete und, wie Rachel seit langem vermutet hatte, der Gelegenheitsliebhaber ihrer Mutter war. Sie sah sich in ihrer Annahme bestätigt, weil er kaum sprach und die Frauen ihn besonders aufmerksam behandelten. Giles, normalerweise ein geselliger Mensch, hob öfters zum Sprechen an, schloss den Mund dann aber wieder, als hätte er es sich anders überlegt. Er sah sich im Haus um, als ob er jede Kleinigkeit aufsaugen wollte, als ob ihm alles vertraut wäre und ihm einst Geborgenheit geschenkt hätte. Als ob dies alles wäre, was ihm von Elizabeth geblieben wäre, und er zu begreifen versuche, dass er nichts davon jemals wiedersehen würde. Es war ein regnerischer Apriltag, und das Wohnzimmerfenster, das auf die Old Mill Lane hinaussah, rahmte ihn ein. Rachel spürte ein ungeheures Mitleid für Giles Ellison in sich aufsteigen, wie er dastand und dem Ruhestand und Greisentum entgegenalterte. Er hatte gehofft, diese Lebensphase mit einer wehrhaften Löwin an seiner Seite durchzustehen, und nun musste er sie allein bewältigen. Es war wenig wahrscheinlich, dass er eine neue Partnerin finden würde, die ebenso intelligent und zornig war wie Elizabeth Childs.
Auf ihre ganz eigene schikanöse und bissige Art war sie eine strahlende Persönlichkeit gewesen. Sie betrat nicht einfach einen Raum, sie rauschte hinein. Sie lud Freunde und Kollegen nicht einfach zu sich ein, sie scharte sie um sich. Sie schien fast keinen Schlaf zu brauchen, sie wirkte nur selten müde, und niemand konnte sich erinnern, dass sie jemals krank gewesen war. Wenn Elizabeth Childs einen Raum verließ, dann merkte man das sogar dann noch, wenn man erst nach ihrem Weggang eingetroffen war. Und als Elizabeth Childs die Welt verließ, war es das gleiche Gefühl.
Überrascht stellte Rachel fest, wie wenig sie auf den Verlust ihrer Mutter vorbereitet war. Elizabeth hatte vieles verkörpert, das meiste – zumindest nach Ansicht ihrer Tochter – auf keineswegs positive Weise, aber sie war immer anwesend gewesen. Ohne Wenn und Aber. Und nun war sie unwiderruflich – und jäh – abwesend.
Aber Rachels eine und einzige Frage hatte sie überdauert. Und die Möglichkeit, eine Antwort darauf zu bekommen, war mit ihrer Mutter dahingegangen. Elizabeth war vielleicht nicht willens gewesen, ihr diese Antwort zu geben, aber sie hatte sie zweifellos gekannt. Nun tat das vielleicht niemand mehr.
Wie gut Giles und ihre Freundinnen, ihre Agentin und ihr Verleger Elizabeth Childs auch immer gekannt hatten – und sie alle beschrieben eine bestimmte Facette von ihr, die sich leicht, aber deutlich von der Frau unterschied, mit der Rachel zusammengelebt hatte –, keiner von ihnen hatte sie länger gekannt als Rachel.
»Ich wünschte, ich wüsste etwas über James«, sagte Ann Marie McCarron, Elizabeths älteste Freundin in dieser Gegend, zu Rachel, nachdem sie ausreichend getrunken hatten, um das heikle Thema anzusprechen. »Aber ich habe deine Mutter erst mehrere Monate nach ihrer Trennung kennengelernt. Ich erinnere mich noch, dass er in Connecticut unterrichtet hat.«
»Connecticut?« Sie saßen auf der verglasten Veranda, nicht mehr als zweiundzwanzig Meilen von der Grenze zu Connecticut entfernt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund war es Rachel nie in den Sinn gekommen, dass ihr Vater, statt an einem der »berühmten Fünf« oder einem der fünfzehn anderen Colleges diesseits der Berkshire Mountains zu unterrichten, genauso gut eine halbe Autostunde südlich in Connecticut gearbeitet haben könnte.
»Die Universität von Hartford?«, fragte sie.
Ann Marie brachte es fertig, gleichzeitig die Nase zu rümpfen und die Lippen zu spitzen. »Keine Ahnung. Könnte sein.« Sie schlang einen Arm um Rachel. »Ich wünschte, ich könnte helfen. Und ich wünschte auch, du könntest die Sache einfach auf sich beruhen lassen.«
»Warum?«, fragte Rachel (schon wieder dieses ewige Warum, dachte sie). »War er so schlimm?«
»Das wäre mir neu«, sagte Ann Marie schon etwas lallend und setzte ein trauriges Gesicht auf. Sie sah durch die Fensterscheibe in den grauen Nebel, der über den grauen Bergen hing, und sprach mit Nachdruck und einer gewissen Endgültigkeit: »Schätzchen, ich weiß bloß, dass er sein altes Leben hinter sich gelassen hat.«
In ihrem Testament hatte ihre Mutter ihr alles vererbt. Es war weniger, als Rachel vermutet hatte, aber mehr, als sie mit einundzwanzig brauchte. Wenn sie bescheiden lebte und das Geld geschickt anlegte, würde es vielleicht zehn Jahre lang reichen.
In einer verschlossenen Schublade im Arbeitszimmer fand sie die beiden Schuljahrbücher ihrer Mutter: North Adams High School und Smith College. Ihren Abschluss und ihren Doktor hatte sie an der Johns-Hopkins-Universität gemacht (mit neunundzwanzig, wie Rachel feststellte – ach herrje), aber der einzige Hinweis darauf waren die beiden gerahmten Urkunden, die neben dem Kamin an der Wand hingen. Sie ging die Jahrbücher in einem selbstauferlegten Schneckentempo dreimal gründlich durch. Alles in allem fand sie vier Fotos von ihrer Mutter, zwei offizielle und zwei, auf denen sie als Teil einer Gruppe zu sehen war. Im Jahrbuch des Smith College gab es keine Studenten mit dem Namen James, da es sich um eine reine Mädchenschule handelte. Dafür zwei Lehrer, doch von denen hatte keiner das richtige Alter oder schwarzes Haar. Im Jahrbuch der North Adams High School fand sie sechs Jungen namens James, von denen zwei – James McGuire und James Quinlan – in Frage kamen. Es dauerte eine halbe Stunde, bis sie am Computer der Bücherei von South Hadley herausgefunden hatte, dass James McGuire aus North Adams noch während seiner Collegezeit beim Wildwasserfahren verunglückt war; James Quinlan hatte einen Abschluss in Betriebswirtschaft an der Universität von Wake Forest gemacht. Er hatte North Carolina kaum jemals verlassen und eine erfolgreiche Ladenkette für Teakholzmöbel gegründet.
In dem Sommer, ehe sie das Haus verkaufte, stattete sie der Detektei Berkshire Security & Partner einen Besuch ab, wo sie Brian Delacroix kennenlernte. Der hochgewachsene Privatdetektiv war kaum älter als sie und bewegte sich mit der schlaksigen Gelassenheit eines Joggers. Sie trafen sich in seinem Büro im zweiten Stock eines Gebäudes im Gewerbegebiet von Chicopee. Das Büro war eine Schuhschachtel, es passten gerade mal Brian, ein Schreibtisch, zwei Computer und ein paar Aktenschränke hinein. Als sie fragte, wo die »Partner« aus dem Firmennamen seien, erklärte Brian, dass er dieser Partner sei. Die Zentrale befände sich in Worcester. Seine Zweigstelle in Chicopee funktioniere auf Franchisebasis und sei eine günstige Gelegenheit für ihn, erste Berufserfahrungen zu sammeln. Er bot an, sie an einen erfahreneren Kollegen weiterzuleiten, aber ihr war wirklich nicht danach zumute, wieder in ihr Auto zu steigen und den ganzen Weg nach Worcester zu fahren, also ging sie das Risiko ein und erzählte ihm, weshalb sie gekommen war. Brian stellte einige Fragen und notierte sich etwas auf einem gelben Notizblock. Er sah ihr oft genug in die Augen, um sie eine schlichte Sanftheit in seinem Wesen spüren zu lassen, die sein Alter Lügen strafte. Er erschien ihr ernsthaft, und da er neu in diesem Beruf war, hatte er seine Ehrlichkeit noch nicht verloren – sie wusste, dass sie damit richtiglag, als er ihr zwei Tage später riet, weder ihn noch einen anderen mit der Suche nach ihrem Vater zu beauftragen. Brian sagte ihr, dass er ihren Fall annehmen und ihr vierzig Arbeitsstunden in Rechnung stellen könne, ehe er mit derselben Einschätzung herausrückte, die er ihr jetzt anbot.
»Sie haben zu wenig Informationen, um diesen Mann zu finden.«
»Deshalb will ich Sie ja mit der Suche beauftragen.«
Er rutschte auf seinem Stuhl hin und her. »Ich habe ein bisschen recherchiert. Nichts Großartiges, nichts, was ich Ihnen berechnen würde –«
»Ich zahle.«
»– aber genug. Wenn er Trevor hieße oder, was weiß ich, Zachary, dann hätten wir vielleicht eine Chance, einen Mann aufzuspüren, der vor zwanzig Jahren an einer von mehr als zwei Dutzend höherer Bildungseinrichtungen in Massachusetts oder Connecticut unterrichtet hat. Aber ich habe eine schnelle Computeranalyse durchführen lassen, Miss Childs, und in den letzten zwanzig Jahren haben an den siebenundzwanzig Schulen, die in Frage kommen, nicht weniger als dreiundsiebzig« – er nickte angesichts ihrer schockierten Reaktion – »wissenschaftliche Assistenten, Aushilfslehrer, Gastprofessoren, Honorarprofessoren und Vollzeitprofessoren mit dem Vornamen James gearbeitet – einige nur ein Semester lang, andere in Festanstellung.«
»Kann man Personalakten mit Fotos bekommen?«
»Von einigen bestimmt, vielleicht von der Hälfte. Aber wenn er nicht zu dieser Hälfte gehört – und wie würden Sie ihn überhaupt erkennen wollen? –, dann müssten wir immer noch über fünfunddreißig andere Männer mit dem Namen James aufspüren, die der demographischen Wahrscheinlichkeit nach über das gesamte Land verstreut wären, und eine Möglichkeit finden, zwanzig Jahre alte Fotos von ihnen in die Hände zu bekommen. Dann würde ich Ihnen nicht vierzig Stunden Arbeit berechnen. Dann würde ich vierhundert berechnen. Und wir hätten immer noch keine Garantie, diesen Burschen ausfindig zu machen.«
Sie durchlief ein Wechselbad der Gefühle: Angst, Zorn, Hilflosigkeit – die weiteren Zorn hervorrief – und schließlich trotzige Wut über diesen Scheißkerl, der seine Arbeit nicht machen wollte. Gut, würde sie eben jemand anderen finden.
Er erkannte das alles in ihren Augen und an der Art, mit der sie nach ihrer Handtasche griff.
»Wenn Sie zu einer anderen Detektei gehen und die merken, dass Sie kürzlich eine Erbschaft gemacht haben, dann werden sie Ihnen das Geld aus der Tasche ziehen und trotzdem nichts herausfinden. Und dieser Diebstahl – denn etwas anderes ist es meiner Meinung nach nicht – wird völlig rechtmäßig sein. Dann sind Sie arm und immer noch vaterlos.« Er beugte sich vor und sprach mit sanfter Stimme: »Wo wurden Sie geboren?«
Sie neigte den Kopf in Richtung des südlichen Fensters. »Springfield.«
»Existiert eine Patientenakte?«
Sie nickte. »Mein Vater wird darin als ›unbekannt‹ vermerkt.«
»Aber Ihre Eltern waren damals ein Paar?«
Sie nickte wieder. »Einmal, als meine Mutter etwas getrunken hatte, erzählte sie mir, dass sie sich an dem Abend, als die Wehen einsetzten, gestritten hatten. Er verließ daraufhin die Stadt. Aus Wut hat sie sich nach der Geburt geweigert, dem Krankenhaus seinen Namen zu nennen.«
Sie saßen schweigend da. Dann fragte sie: »Sie wollen meinen Fall also nicht übernehmen?«
Brian Delacroix schüttelte den Kopf. »Lassen Sie es auf sich beruhen.«
Sie stand mit zitternden Händen auf und dankte ihm für seine Mühe.
Überall im Haus waren Fotos: im Nachttisch ihrer Mutter, in einer Kiste auf dem Dachboden, einer Schublade im Arbeitszimmer. Auf den meisten Fotos waren sie beide zu sehen. Rachel erkannte betroffen, wie deutlich die Liebe ihrer Mutter sich in ihren blassen Augen zeigte, auch wenn sie sogar auf den Fotos kompliziert wirkte: als ob sie gerade dabei sei, das Thema Mutterliebe noch einmal zu überdenken. Die restlichen Bilder zeigten Freunde, Kollegen aus der akademischen Welt und aus dem Verlagswesen. Die meisten waren auf Cocktailpartys und sommerlichen Grillfesten aufgenommen worden, und zwei in einer Kneipe mit Menschen, die Rachel zwar nicht kannte, die aber unverkennbar dem akademischen Milieu entstammten.
Zwei zeigten einen Mann mit dunklem, welligem Haar und einem unsicheren Lächeln.
Beim Verkauf des Hauses fand sie die Tagebücher ihrer Mutter. Zu diesem Zeitpunkt hatte Rachel ihr Studium an der Emerson bereits abgeschlossen und plante, Massachusetts zu verlassen, um in New York City weiterzustudieren. Das alte viktorianische Haus, in dem sie mit ihrer Mutter seit der dritten Klasse gewohnt hatte, beherbergte nur wenige schöne Erinnerungen und war ihr immer wie ein Geisterhaus vorgekommen. (»Das sind bloß Geister von der Fakultät«, hatte ihre Mutter immer gesagt, wenn vom Ende des Flurs ein unerklärliches Knarren zu ihnen drang oder auf dem Dachboden etwas mit dumpfem Knall aufschlug. »Die lesen da oben wahrscheinlich Chaucer und trinken Kräutertee.«)
Die Tagebücher waren nicht auf dem Dachboden. Sie befanden sich in einer Kiste im Keller, einfache linierte Aufsatzhefte, versteckt unter nachlässig verpackten ausländischen Ausgaben von Die Treppe. Die Einträge waren so planlos, wie ihre Mutter es zeit ihres Lebens gewesen war. Die Hälfte war undatiert, und es klafften monatelange, manchmal sogar jahrelange Lücken zwischen ihnen. Am häufigsten schrieb sie über Angst. Vor der Treppe waren es finanzielle Ängste: Sie würde als Psychologiedozentin niemals genug verdienen, um ihr Studentendarlehen abstottern zu können, geschweige denn, um ihre Tochter an eine anständige Privatschule und auf ein anständiges College schicken zu können. Als ihr Buch die Bestsellerlisten stürmte, wurde sie von der Angst heimgesucht, niemals eine angemessene Fortsetzung schreiben zu können. Sie hatte auch Angst, dass man ihr Buch zur Hochstapelei erklären würde, dass man sagen würde, es sei ein Beschiss, und dass dieser Beschiss auffliegen würde, sobald sie etwas Neues veröffentlichte. Diese Angst, wie sich herausstellen sollte, war nur allzu gerechtfertigt.
Aber die meisten Ängste galten Rachel. Rachel wurde Zeugin, wie sie sich von einem ungestümen, manchmal lästigen Freudenquell (»Sie hat diese unbändige Spielfreude … Sie hat ein so großes und schönes Herz, dass ich mich frage, was die Welt einmal daraus machen wird …«) in eine verzweifelte und selbstzerstörerische Querulantin verwandelte (»Die Selbstverletzungen machen mir fast weniger Sorge als die häufigen Partnerwechsel; sie ist doch erst dreizehn … Sie springt ins kalte Wasser und beschwert sich, dass es kalt ist, und ich bin diejenige, die sie verantwortlich macht.«).
Fünfzehn Seiten später hieß es: »Ich muss mich dieser Einsicht stellen: Ich war keine gute Mutter. Ich hatte noch nie Geduld für das unterentwickelte Stirnhirn. Ich bin zu bissig, will auf den Punkt kommen, obwohl ich eigentlich Geduld vorleben sollte. Ich fürchte, dass sie mit einer schroffen Reduktionistin aufwachsen musste. Und ohne Vater. Das hat sie innerlich ausgehöhlt.«
Einige Seiten später kam ihre Mutter erneut auf das Thema zu sprechen. »Ich fürchte, sie wird ihr Leben mit der Suche nach etwas verschwenden, womit sie ihre innere Leere füllen kann: kurzlebige Moden, Seelenklimbim, New-Age-Therapien, Kräutermedizin. Sie hält sich für rebellisch und widerspenstig, aber sie ist nur eines von beidem. Sie ist so schrecklich bedürftig.«
In einem undatierten Eintrag einige Seiten später schrieb Elizabeth Childs: »Jetzt ist sie krank, liegt in diesem fremden Bett und ist sogar noch bedürftiger als sonst. Immer wieder stellt sie die gleiche Frage: Wer ist er, Mutter? Sie sieht so zerbrechlich aus – sentimental und zerbrechlich. Sie hat so viele wunderbare Anlagen, meine liebste Rachel, aber stark ist sie nicht. Wenn ich ihr sage, wer James ist, wird sie ihn ausfindig machen. Er wird ihr das Herz brechen. Und warum sollte ich ihm diese Macht einräumen? Warum sollte ich ihm nach all diesen Jahren erlauben, sie noch einmal zu verletzen? Mit ihrem schönen, angeschlagenen Herz sein Spiel zu treiben? Erst heute habe ich ihn gesehen.«
Rachel, die auf der vorletzten Stufe der Kellertreppe saß, hielt den Atem an. Sie krampfte die Hände um das Tagebuch, und die Welt verschwamm vor ihren Augen.
Erst heute habe ich ihn gesehen.
»Er hat mich nicht bemerkt. Ich habe oben an der Straße geparkt. Er stand auf dem Rasen seines Hauses – das, in dem er wohnt, seit er uns verlassen hat. Und sie waren bei ihm: die Ersatzfrau, die Ersatzkinder. Seine Haare haben sich gelichtet, und um die Hüften und am Kinn ist er ganz schön wabbelig geworden. Ein schwacher Trost. Er ist glücklich. So wahr mir Gott helfe! Er ist glücklich. Und ist das nicht das Schlimmste, was hätte passieren können? Ich glaube nicht einmal, dass das Glück existiert – nicht als Ideal, nicht als echter Seinszustand. Glück ist etwas für kindische Gemüter; und dennoch ist er glücklich. Und dieses Glück würde er von der Tochter bedroht sehen, die er nie wollte – nach ihrer Geburt weniger denn je. Weil sie ihn an mich erinnerte. Daran, wie sehr er mich zu verabscheuen lernte. Er würde sie verletzen. Ich war der einzige Mensch in seinem Leben, der sich weigerte, ihn anzuhimmeln, und das würde er Rachel niemals verzeihen. Er würde glauben, dass ich ihr nicht viel Schmeichelhaftes über ihn erzählt hätte, und James war noch nie ein Mensch, der Kritik an seinem kostbaren, ernsthaften Selbst ertragen konnte.«
Rachel war nur ein einziges Mal in ihrem Leben bettlägerig gewesen, in ihrem zweiten Jahr an der Highschool. Sie hatte sich kurz vor den Weihnachtsferien mit dem Pfeifferschen Drüsenfieber angesteckt. Ein glücklicher Zeitpunkt, denn es dauerte dreizehn Tage, bis sie wieder aufstehen konnte, und fünf weitere, um genug Kraft für die Schule zu sammeln. Am Ende hatte sie trotzdem nur drei Tage Unterricht verpasst.
Und irgendwann in diesem Zeitraum hatte ihre Mutter James gesehen. Während sie Gastprofessorin am Wesleyan war. Sie wohnten in einem Haus in Connecticut zur Miete, in Middletown, und dort hatte das »fremde Bett« gestanden, an das Rachel gefesselt gewesen war. Ihre Mutter war – wie sie sich jetzt mit halb widerwilligem Stolz in Erinnerung rief – während ihrer gesamten Krankheit nur ein einziges Mal von ihrer Seite gewichen: um Lebensmittel und Wein zu kaufen. Rachel hatte eine Videokassette mit Pretty Woman angesehen, und als ihre Mutter zurückkehrte, war der Film noch nicht vorbei gewesen. Elizabeth hatte bei ihr Fieber gemessen und die Ansicht geäußert, dass Julia Roberts’ breites Grinsen »wahnsinnig nervtötend« sei, ehe sie mit den Einkaufstaschen in der Küche verschwunden war.
Als sie in Rachels Zimmer zurückkam, hielt sie ein Glas Wein in der einen Hand und einen warmen, feuchten Waschlappen in der anderen. Sie warf Rachel einen flehentlichen, hoffenden Blick zu und sagte: »Das haben wir doch ganz gut hingekriegt, oder?«
Rachel sah zu ihr hoch, während sie ihr den Waschlappen auf die Stirn legte. »Natürlich haben wir das«, sagte sie, denn in jenem Augenblick fühlte es sich wirklich so an.
Ihre Mutter tätschelte ihr die Wange und sah zum Fernseher hinüber, wo gerade das Ende des Films lief. Richard Gere, der Märchenprinz, war mit Blumen gekommen, um seine Märchennutte Julia zu retten. Er streckte ihr ungelenk die Blumen entgegen, Julia lachte und bekam feuchte Augen, im Hintergrund setzte laut die Musik ein.
Ihre Mutter sagte: »Also wirklich, jetzt reicht’s aber mit dem Gegrinse.«
Somit ließ sich der Tagebucheintrag auf Dezember 1992 datieren. Oder auf den frühen Januar 1993. Acht Jahre später wurde Rachel, auf einer Kellertreppe sitzend, klar, dass ihr Vater irgendwo in einem Umkreis von dreißig Meilen um Middletown gelebt hatte. Mehr konnten es nicht sein. Ihre Mutter war zu seinem Haus gefahren, hatte ihn und seine Familie beobachtet, und dann hatte sie ihre Einkäufe gemacht und im Spirituosenladen Wein gekauft – alles in weniger als zwei Stunden. Das hieß, dass James ganz in der Nähe unterrichtet haben musste, wahrscheinlich an der Universität Hartford.
»Falls er überhaupt noch unterrichtet hat«, sagte Brian Delacroix, als sie ihn anrief.
»Stimmt.«
Aber Brian pflichtete ihr bei, dass sie nun genug Informationen zum Weitermachen hätten, so dass er ihren Fall und ihr Geld annehmen und morgens trotzdem noch in den Spiegel sehen könne. Und so begannen Brian Delacroix und Berkshire Security & Partner im Spätsommer des Jahres 2001 mit den Ermittlungen zur Identität ihres Vaters.
Sie förderten nichts zutage.
Es gab keinen James, der in jenem Jahr an einer Hochschule im nördlichen Connecticut gelehrt hatte, den sie nicht bereits zuvor unter die Lupe genommen hatten. Einer hatte blondes Haar, einer war Afroamerikaner, und der dritte war siebenundzwanzig Jahre alt.
Wieder einmal hieß es, Rachel solle die Sache auf sich beruhen lassen.
»Ich gehe bald«, sagte Brian.
»Weg von hier?«
»Ja, aber ich will auch raus aus diesem Beruf. Ich will kein Privatdetektiv mehr sein. Es ist einfach zu trostlos. Den ganzen Tag lang muss ich Menschen enttäuschen, selbst dann, wenn ich ihnen liefere, wofür sie mich bezahlt haben. Es tut mir leid, dass ich Ihnen nicht helfen konnte, Rachel.«
Sie spürte eine Leere in sich. Noch ein Abschied. Ein weiterer Mensch in ihrem Leben, wie unwichtig er auch sein mochte, der sie verließ, ohne dass sie etwas dagegen tun konnte. Sie hatte keinen Einfluss darauf.
»Was wollen Sie tun?«, fragte sie.
»Ich gehe wahrscheinlich zurück nach Kanada.« Seine Stimme klang fest, als ob er eine Entscheidung getroffen hätte, die er schon sein ganzes Leben hatte treffen wollen.
»Sind Sie Kanadier?«
Er lachte leise. »Aber sicher doch.«
»Was erwartet Sie dort?«
»Die Holzfirma meiner Eltern. Wie steht’s mit Ihnen?«
»Das College ist prima. New York gerade nicht so.«
Es war der späte September des Jahres 2001, weniger als drei Wochen nach dem Anschlag auf das World Trade Center.
»Natürlich«, sagte er ernst. »Natürlich. Ich hoffe, dass sich für Sie alles zum Guten wendet. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Rachel.«
Sie war überrascht, wie intim ihr Name aus seinem Mund klang. Sie sah seine Augen vor sich, die Sanftheit in ihnen, und sie ärgerte sich ein bisschen, dass sie sich nicht schon früher eingestanden hatte, wie sehr sie sich zu ihm hingezogen fühlte. Sie hätten sich vielleicht zum Essen verabreden können.
»Kanada also?«
Wieder dieses leise Lachen. »Kanada.«
Sie verabschiedeten sich voneinander.
Ihre Kellerwohnung an der Waverly Place in Greenwich Village, nur wenige Gehminuten von der New York University entfernt, lag inmitten von Ruß und Asche, die noch Wochen nach 9/11 alles in Lower Manhattan bedeckten. Am Tag nach dem Anschlag hatte sich eine dicke staubige Schicht auf ihre Fensterbretter gelegt: eine Decke aus Haaren und Knochenstücken und Körperzellen, die immer mehr anwuchs, wie Schnee. Die Luft roch verbrannt. Nachmittags streifte sie ziellos herum. Einmal kam sie an der Notaufnahme des Krankenhauses St. Vincent vorbei, vor der Rollbahren aufgereiht standen für Patienten, die niemals eintrafen. In den folgenden Tagen tauchten an den Mauern und Zäunen des Krankenhauses immer mehr Fotos auf, die meisten mit einer einfachen Botschaft beschriftet: »Haben Sie diese Person gesehen?«
Nein, hatte sie nicht. All diese Personen waren fort.
Sie war von Verlusten umgeben, die um ein Vielfaches größer waren als alles, was sie in ihrem eigenen Leben erfahren hatte. Wo immer sie sich hinwandte, umgaben sie Trauer, nicht erhörte Gebete und ein umfassendes Chaos, das so viele Gestalten annahm – sexuelle, emotionale, psychologische, moralische –, dass es schnell zu einem Band wurde, das die Menschen miteinander verband.
Wir sind verloren, erkannte Rachel und beschloss, ihre eigenen Wunden so gut sie konnte zu verbinden und nicht mehr an ihnen zu kratzen.
In jenem Herbst stieß sie auf zwei Sätze in einem Tagebuch ihrer Mutter, die sie wochenlang wie ein Mantra vor dem Schlafengehen aufsagte:
James, hatte ihre Mutter geschrieben, war nie für uns bestimmt.
Und wir nie für ihn.
2
Blitze
Ihre erste Panikattacke erlitt Rachel im Herbst des Jahres 2001, kurz nach Thanksgiving. Sie ging die Christopher Street entlang und kam an einer jungen Frau vorbei, die auf einer schwarzen gusseisernen Treppe unter dem Vordach eines Apartmentgebäudes saß. Die Frau hatte die Hände vor das Gesicht geschlagen und schluchzte – damals kein ungewohnter Anblick in New York City. Die Menschen weinten in den Parks, auf öffentlichen Toiletten und in der U-Bahn, manche still, andere gepresst oder geräuschvoll. Tränen überall. Aber man musste immer noch nachfragen, sich immer noch vergewissern.
»Geht es Ihnen gut?« Rachel streckte den Arm aus, um die Frau zu berühren.
Die Frau zuckte zurück. »Was tun Sie da?«
»Ich will nur wissen, ob es Ihnen gutgeht.«
»Alles in Ordnung.« Das Gesicht der Frau war trocken. Sie rauchte eine Zigarette, was Rachel zuvor gar nicht aufgefallen war. »Geht es Ihnen gut?«
»Sicher«, sagte Rachel. »Ich wollte bloß –«
Die Frau reichte ihr einige Papiertaschentücher. Ihre Augen waren nicht gerötet. Sie hatte nicht die Hände vor das Gesicht geschlagen. Sie hatte eine Zigarette geraucht.
Rachel nahm die Taschentücher. Sie tupfte sich das Gesicht ab, fühlte den Tränenstrom dort, die Tropfen, die sich unter ihrer Nase sammelten und über Kinn und Wange liefen.
»Geht es Ihnen gut?«, wiederholte die Frau.
Sie sah Rachel an, als ob sie überhaupt nicht so wirke. Sie sah Rachel an, und dann sah sie an Rachel vorbei, als hoffte sie, jemand würde sie aus dieser Situation befreien.
Rachel murmelte ein paarmal »danke schön« und stolperte weiter. Sie schaffte es bis zu der Kreuzung an der Weehawken Street. Ein roter Transporter stand an der Ampel. Der Fahrer starrte Rachel aus blassen Augen an. Lächelte ihr mit nikotingelben Zähnen zu. Jetzt strömten nicht nur Tränen über ihr Gesicht, sondern auch Schweiß. Angst schnürte ihr den Hals zu. Sie spürte den Drang, etwas hervorzuwürgen, obwohl sie an diesem Morgen noch gar nichts gegessen hatte. Sie bekam keine Luft. Scheiße, sie konnte nicht atmen. Ihre Kehle ließ keine Luft durch. Sie konnte nicht mal mehr ihren Mund öffnen. Sie musste ihren Mund öffnen.
Der Fahrer stieg aus dem Transporter. Er kam mit seinen blassen Augen und dem bleichen Falkengesicht und den kurzgeschorenen roten Haaren auf sie zu, und als er sie erreichte …
War er schwarz. Und ein bisschen rundlich. Seine Zähne waren nicht gelb. Sie waren weiß wie Kopierpapier. Er kniete sich neben sie (wann hatte sie sich auf den Bürgersteig gesetzt?), und seine großen braunen Augen sahen sie besorgt an. »Alles in Ordnung? Soll ich jemanden anrufen, Miss? Können Sie aufstehen? Hier, nehmen Sie meine Hand.«
Sie nahm seine Hand, und er zog sie hoch, an der Kreuzung von der Weehawken und Christopher Street. Es war längst nicht mehr Vormittag. Die Sonne ging unter. Der Hudson hatte die Farbe von hellem Bernstein angenommen.
Der rundliche nette Mann nahm sie in den Arm, und sie weinte an seiner Schulter. Sie weinte, und er musste ihr versprechen, bei ihr zu bleiben und sie niemals zu verlassen.
»Nennen Sie mir Ihren Namen«, sagte sie. »Nennen Sie mir Ihren Namen.«
Sein Name war Kenneth Waterman, und natürlich sah sie ihn nie wieder. Er fuhr sie in seinem roten Transporter zu ihrer Wohnung zurück, und es war kein großer Kastenwagen, der nach Schmieröl und schmutziger Unterwäsche roch, wie sie sich das vorgestellt hatte, sondern ein Kleinbus mit Kindersitzen in der mittleren Reihe und Chipskrümeln auf den Bodenmatten. Kenneth Waterman hatte eine Frau und drei Kinder und lebte in Fresh Meadows in Queens. Er war Tischler. Er hielt vor ihrer Haustür und bot an, jemanden für sie anzurufen, aber sie versicherte ihm, dass es ihr jetzt wieder bessergehe. Alles in Ordnung. Die Stadt mache einen manchmal einfach fertig, nicht wahr?
Er sah sie lange und besorgt an, aber hinter ihnen staute sich der Verkehr, und die Abenddämmerung brach herein. Jemand hupte. Dann noch einer. Er gab ihr seine Visitenkarte – Kennys Kommoden – und sagte, sie könne ihn jederzeit anrufen. Sie bedankte sich und stieg aus. Als er wegfuhr, bemerkte sie, dass der Kleinbus nicht einmal rot war. Er war bronzefarben.
Sie ließ ihr nächstes Semester an der NYU sausen. Verließ kaum die Wohnung, außer, um zu ihrem Seelenklempner in Tribeca zu gehen. Er hieß Constantine Propkop, und alles, was er jemals von sich preisgab, war, dass seine Familie und Freunde ihn Connie nannten. Connie versuchte, Rachel davon zu überzeugen, dass sie die nationale Tragödie dazu benutze, die Tiefe ihres eigenen Traumas zu verleugnen, und dass sie sich damit ernsthaften Schaden zufüge.
»Mein Leben ist nicht tragisch«, sagte Rachel. »Klar war es manchmal traurig. Wessen Leben ist das nicht? Aber meine Mutter hat sich immer um mich gekümmert, wir hatten genug zu essen, und ich bin in einem hübschen Haus aufgewachsen. Alles andere sind doch Luxusprobleme, oder?«
Sie saßen in Connies kleinem Praxisraum, und er warf ihr einen Blick zu. »Ihre Mutter hat Ihnen eines Ihrer grundlegenden Rechte – das Wissen um die Vaterschaft – vorenthalten. Sie hat Sie emotionaler Tyrannei unterworfen, um Sie an sich zu binden.«
»Sie hat mich beschützt.«
»Wovor?«
»Na gut«, korrigierte sich Rachel, »sie hat geglaubt, dass sie mich vor mir selbst beschützt, vor dem, was ich mit dem Wissen anfangen könnte.«
»Ist das wirklich der Grund?«
»Welchen Grund sollte es sonst geben?« Rachel wäre am liebsten aus dem Fenster gesprungen.
»Wenn jemand etwas hat, das Sie nicht einfach nur wollen, sondern wirklich brauchen, was würden Sie diesem Menschen dann niemals antun?«
»Sagen Sie nicht, ›ihn hassen‹, denn gehasst habe ich sie.«
»Ihn verlassen«, sagte er. »Sie würden diesen Menschen niemals verlassen.«
»Meine Mutter war der unabhängigste Mensch, der mir jemals begegnet ist.«
»Sie konnte diesen Schein aufrechterhalten, weil Sie sich an sie geklammert haben. Aber was ist passiert, als Sie gegangen sind? Sobald sie gespürt hat, dass es Sie woanders hinzieht?«
Sie wusste, worauf er hinauswollte. Immerhin war sie die Tochter einer Psychologin. »Verdammt, Connie, lassen Sie diese Geschichte aus dem Spiel.«
»Welche Geschichte?«
»Es war ein Unfall.«
»Eine Frau, die Sie als überwach, überaufmerksam, überkompetent beschreiben? Die am Tag ihres Todes weder Drogen noch Alkohol im Blut hatte. Diese Frau übersieht am helllichten Tag ein Stoppschild?«
»Jetzt habe ich also meine Mutter umgebracht.«
»Ich wollte Ihnen das Gegenteil sagen.«
Rachel nahm ihren Mantel und ihre Tasche. »Meine Mutter hat nie als Psychologin praktiziert, weil sie nicht mit dilettantischen Quacksalbern wie Ihnen in einen Topf geworfen werden wollte.« Sie warf einen Blick auf die Diplome, die an der Wand hingen. »Abschluss an der Rutgers«, schnaubte sie verächtlich und stolzierte hinaus.
Tess Porter, ihre nächste Therapeutin, ging etwas sanfter vor, und die Fahrt zu ihrer Praxis war wesentlich kürzer. Sie sagte, dass sie in Rachels eigenem Tempo die Wahrheit über die Beziehung zu ihrer Mutter herausfinden würden. Bei Tess fühlte Rachel sich sicher. Connie hatte ihr immer das Gefühl gegeben, dass er gleich zum Schlag ausholen würde. Und so hatte sie stets versucht, ihn abzuwehren.
»Was würden Sie eigentlich zu ihm sagen, wenn Sie ihn fänden?«, fragte Tess eines Nachmittags.
»Ich weiß es nicht.«
»Haben Sie Angst?«
»Ja. Ja.«
»Vor ihm?«
»Was? Nein.« Sie dachte nach. »Nein. Nicht vor ihm. Nur vor der Situation. Wie soll das ablaufen? ›He, Dad! Wo zum Teufel hast du mein ganzes Leben lang gesteckt?‹«
Tess lachte leise, sagte dann aber: »Sie haben kurz gezögert. Als ich fragte, ob Sie Angst vor ihm hätten.«
»Wirklich?« Rachel starrte eine Zeitlang an die Decke. »Na ja, manchmal hat sie ziemlich widersprüchliche Sachen über ihn gesagt.«
»Zum Beispiel?«
»Meistens hat sie ihn als unmännlich beschrieben. ›Der arme süße James‹, hat sie gesagt, oder ›der liebe, sensible James‹. Und dabei hat sie die Augen verdreht. Nach außen hin war sie aber zu fortschrittlich, um zuzugeben, dass er ihr nicht männlich genug war. Ich erinnere mich, dass sie ein paarmal sagte: ›Du bist genauso boshaft wie dein Vater, Rachel.‹ Und ich dachte mir: ›Ich bin genauso boshaft wie meine Mutter, du Hexe!‹« Sie starrte wieder an die Decke. »›Sieh ihm in die Augen, und betrachte dich selbst.‹«
»Was sagten Sie?« Tess lehnte sich auf ihrem Sessel vor.
»Das hat sie mir ein paarmal gesagt. ›Sieh ihm in die Augen, und betrachte dich selbst. Dann sag mir, was du da entdeckst.‹«
»In welchem Zusammenhang war das?«
»Alkohol.«
Tess quittierte das mit einem schwachen Lächeln. »Aber was wollte sie Ihrer Meinung nach damit sagen?«
»Sie war stinksauer auf mich, beide Male. So viel weiß ich noch. Ich dachte immer, es würde heißen, dass er … Wenn er mich je sehen würde, wäre er …« Sie schüttelte den Kopf.
»Was?« Tess’ Stimme war sanft. »Wenn er Sie je sehen würde, wäre er was?«
Es dauerte eine Weile, bis sie ihre Fassung wiedergewonnen hatte. »Er wäre enttäuscht.«
»Enttäuscht?«
Rachel hielt ihrem Blick eine Weile stand. »Angewidert.«
Die Straße draußen verdunkelte sich, als ob etwas Gewaltiges, Jenseitiges die Sonne auslöschen und seine Schatten über die gesamte Stadt werfen würde. Ganz plötzlich begann Regen zu fallen. Der Donner klang wie die Reifen schwerer Laster, die eine alte Brücke überqueren. Der Blitz war ein fernes Bersten.
»Warum lächeln Sie?«, fragte Tess.
»Habe ich gelächelt?«
Sie nickte.
»Wegen etwas anderem, das meine Mutter gesagt hat, vor allem an Tagen wie diesem.« Rachel zog die Beine unter sich auf den Sitz. »Sie sagte, sie würde seinen Geruch vermissen. Als ich sie das erste Mal fragte, was sie meinen würde, wie er denn gerochen hätte, hat sie die Augen zugemacht, die Luft eingesogen und gesagt: ›Wie Blitze.‹«
Tess’ Augen weiteten sich ein wenig. »Entspricht das Ihrer Erinnerung an seinen Geruch?«
Rachel schüttelte den Kopf. »Er roch nach Kaffee.« Sie sah in die Regentropfen draußen vor dem Fenster. »Kaffee und Cordsamt.«
Sie erholte sich von jener ersten Panikattacke und ihrer leichten Platzangst im Frühsommer des Jahres 2002. Zufällig begegnete sie einem Kommilitonen, der wie sie im vergangenen Semester den Kurs »Fortgeschrittene Recherchetechniken« besucht hatte. Er hieß Patrick Mannion, und er war ausgesprochen rücksichtsvoll. Er war außerdem ein bisschen übergewichtig und besaß die unglückliche Angewohnheit zu schielen, wenn er etwas nicht richtig verstand – und das geschah oft, weil er fünfzig Prozent des Hörvermögens in seinem rechten Ohr bei einem Schlittenunfall in der Kindheit eingebüßt hatte.
Pat Mannion konnte kaum glauben, dass Rachel immer noch mit ihm sprach, obwohl sie sich bereits erschöpfend über den gemeinsam besuchten Kurs ausgetauscht hatten. Er traute seinen Ohren nicht, als sie vorschlug, etwas trinken zu gehen. Und sein Gesichtsausdruck, als sie ein paar Stunden später in seiner Wohnung standen und sie nach seiner Gürtelschnalle griff, war der eines Mannes, der mal eben nachschauen will, wie bewölkt der Himmel ist, und dann Engel über sich vorbeiziehen sieht. Dieser Ausdruck wich mehr oder weniger während der gesamten zwei Jahre, die ihre Beziehung andauerte, nicht aus seinem Gesicht.
Als sie schließlich Schluss mit ihm machte – so sanft, dass er fast glaubte, es wäre eine gemeinsam getroffene Entscheidung –, starrte er sie mit einer seltsamen, wilden Würde an und sagte: »Ich habe früher nie verstanden, warum du mit mir zusammen warst. Ich meine, du bist umwerfend und ich so … gar nicht.«
»Du bist –«
Er hob eine Hand, um sie zu unterbrechen. »Doch eines Tages, vor ungefähr sechs Monaten, dämmerte es mir. Für dich ist nicht die Liebe das Wichtigste, sondern Sicherheit. Ich habe schon geahnt, dass du mich früher oder später verlassen würdest, und zwar, ehe ich dich verlassen würde, weil – und das ich der wichtige Teil, Rach – weil ich dich nie verlassen würde.« Er warf ihr ein schönes verletztes Lächeln zu. »Und das war die ganze Zeit mein Daseinszweck.«
Nach dem Studium arbeitete Rachel ein Jahr lang beim Times Leader in Wilkes-Barre in Pennsylvania, dann kehrte sie nach Massachusetts zurück und bekam eine Stelle im Kulturteil des Patriot Ledger in Quincy. Eine Reportage, die sie über ethnisches Profiling bei der Polizei von Hingham schrieb, fand einigen Beifall – und genug Aufmerksamkeit, um ihr eine E-Mail von niemand anderem als Brian Delacroix einzubringen. Er sei geschäftlich unterwegs gewesen, und im Wartezimmer eines Holzhändlers in Brockton wäre ihm eine Ausgabe des Ledger in die Hände gefallen. Er wollte wissen, ob sie dieselbe Rachel Childs sei und ob sie ihren Vater gefunden habe.
Sie schrieb, sie sei dieselbe Rachel Childs und, nein, sie habe ihren Vater nicht gefunden. Ob er die Sache noch mal angehen wolle?
Geht nicht. Bin mit Arbeit zugeschüttet. Reisen reisen reisen. Geben Sie gut auf sich acht, Rachel. Sie werden nicht lange beim Ledger bleiben. Große Dinge erwarten Sie. Mir gefällt Ihr Stil.
Er sollte recht behalten. Ein Jahr später ließ sie den Lokaljournalismus hinter sich und begann beim Boston Globe.
Und dort machte Dr. Felix Browner sie ausfindig, der Gynäkologe ihrer Mutter. Die Betreffzeile seiner E-Mail lautete: »Ein alter Freund Ihrer Mom«, aber nachdem sie ihm geantwortet hatte, stellte sich schnell heraus, dass sie weniger eine Freundin als eine Patientin gewesen war. Soweit Rachel zurückdenken konnte, hatte ihre Mutter einen anderen Gynäkologen besucht. Als sie selbst in die Pubertät kam, brachte Elizabeth sie zu Dr. Veena Raho, welche die meisten jungen Frauen in ihrem Bekanntenkreis behandelte. Von Felix Browner hatte sie zuvor noch nie gehört. Aber er versicherte ihr, dass er der Arzt ihrer Mutter gewesen sei, als diese damals nach Massachusetts gekommen war, und sogar derjenige, der Rachel zur Welt gebracht hatte. Sie waren eine ganz Zapplige, schrieb er.
In einer späteren E-Mail schrieb er, dass er über wichtige Informationen über ihre Mutter verfüge, die er zwar mit ihr teilen wolle, aber nur unter vier Augen. Sie vereinbarten, sich auf halber Strecke zwischen Boston und seinem Wohnort Springfield zu treffen, und entschieden sich für ein Café in Millbury als Treffpunkt.
Vor dem Treffen googelte sie nach Dr. Browner, und das Ergebnis gab, wie sie bereits seit seiner ersten E-Mail befürchtet hatte, kein schmeichelhaftes Bild ab. Im Jahr zuvor, 2006, hatte man ihm ein Berufsverbot erteilt, weil mehrere Patientinnen Anschuldigungen wegen sexueller Nötigung oder sexueller Übergriffe erhoben hatten, von denen die ältesten bis in das Jahr 1976 zurückreichten, als der gute Doktor gerade mal eine Woche sein Medizinstudium abgeschlossen hatte.
Dr. Browner brachte zwei Rollkoffer voller Akten mit. Er war ungefähr zweiundsechzig Jahre alt und hatte dichtes silbergraues Haar, das er vorne kurz und hinten lang trug, was ihn wie einen Sportwagenfahrer und einen Fan des Countrysängers Jimmy Buffett aussehen ließ. Er trug hellblaue Jeans, Pennyloafer ohne Socken und ein Hawaiihemd unter einer schwarzen Leinensportjacke. Um seine Körpermitte hatte sich ein mindestens zehn Kilo schwerer Rettungsring gelegt, den er wie ein Statussymbol vor sich hertrug, und er gab sich jovial im Umgang mit der Kellnerin und den Bedienhilfen. Er kam ihr wie jemand vor, der von Fremden generell gemocht wird, aber verdutzt ist, wenn jemand nicht über seine Witze lacht.
Nachdem er seine Anteilnahme am Tod ihrer Mutter bekundet hatte, wiederholte er, was für ein zappeliges kleines Neugeborenes Rachel gewesen sei – »und so glitschig, als ob man Sie in Palmolive getaucht hätte«. Dann enthüllte er ein wenig atemlos, dass seine erste Anklägerin – »Nennen wir sie mal Lianne, und nicht nur, weil das ein wenig wie Lügen-Anne klingt, nicht wahr?« – mehrere seiner anderen Anklägerinnen kannte. Er zählte deren Namen an der Hand ab, und Rachel fragte sich sofort, ob er Pseudonyme verwendete oder das Recht der Frauen auf ihre Privatsphäre mit nonchalanter Gleichgültigkeit verletzte: Tonya, Marie, Ursula, Jane und Patty, sagte er, hatten alle miteinander zu tun.
»Na ja, die Region ist ja nicht so groß«, sagte Rachel. »Da kennen sich die Leute.«
»Ach ja?« Er schüttelte sein Zuckertütchen, ehe er es öffnete, und warf ihr ein kühles Lächeln zu. »Tatsächlich?« Er ließ den Zucker in den Kaffee rieseln und griff in einen seiner Rollkoffer. »Lügnerin Lianne hatte, wie ich herausgefunden habe, zahlreiche Liebhaber. Sie wurde zweimal geschieden und –«
»Doktor –«
Er hob die Hand, um sie zum Schweigen zu bringen. »Und bei einer weiteren Scheidung als die ›andere Frau‹ erwähnt. Patty ist eine heimliche Säuferin. Marie und Ursula haben Drogenprobleme, und Tonya – halten Sie die Luft an – hat noch einen anderen Arzt wegen sexueller Nötigung verklagt.« Er verdrehte in gespielter Entrüstung die Augen. »Stellen Sie sich das mal vor. Anscheinend gibt es eine Epidemie an lüsternen Ärzten in den Berkshires.«
Rachel kannte eine Tonya in den Berkshires. Tonya Fletcher. Sie leitete ein Hotel, das Minute Man Inn. Wirkte immer leicht abwesend und ein wenig verstört.
Dr. Browner ließ einen Papierstapel von der Größe eines Betonziegels auf den Tisch fallen und sah sie triumphierend an.
»Sie mögen wohl keine USB-Sticks«, sagte Rachel.
Er überging ihre Bemerkung. »Sehen Sie, ich weiß alles über diese Frauen. Sehen Sie?«
»Ja, das sehe ich«, sagte Rachel. »Und was habe ich damit zu tun?«
»Sie sollen mir helfen.« Er sagte es, als ob sich das von selbst verstünde.
»Und warum sollte ich das tun?«
»Weil ich unschuldig bin. Weil ich mir nicht das Geringste habe zuschulden kommen lassen.«
Er streckte ihr die offenen Handflächen auf dem Tisch entgegen. »Diese Hände bringen Menschen zur Welt. Sie haben auch Sie zur Welt gebracht, Rachel. Diese Hände waren das Erste, was Sie auf dieser Welt gehalten hat. Diese Hände.« Er starrte sie an, als wären sie seine zwei teuersten Schätze. »Diese Frauen haben meinen Namen in den Dreck gezogen.« Er verschränkte die Finger und sah auf sie hinab. »Meine Familie ist unter all dem Druck und Streit zerbrochen. Ich habe meine Praxis verloren.« Tränen glitzerten in seinen Augenlidern. »Das habe ich nicht verdient. Ganz bestimmt nicht.«
Rachel versuchte, ihm teilnahmsvoll zuzulächeln, vermutete aber, dass sie bloß angewidert wirkte. »Ich verstehe immer noch nicht, was Sie von mir wollen.«
Er lehnte sich auf seinem Stuhl zurück. »Sie sollen etwas über diese Frauen schreiben. Decken Sie auf, dass sie böse Absichten verfolgten, dass sie mich für ihre Zwecke auswählten. Dass sie geplant haben, mich zu zerstören, und dass ihnen das gelungen ist. Sie müssen büßen. Sie müssen widerrufen. Sie müssen bloßgestellt werden. Jetzt verklagen sie mich vor dem Zivilgericht. Wissen Sie, junge Dame, dass es im Durchschnitt eine Viertelmillion Dollar kostet, sich vor dem Zivilgericht verteidigen zu lassen? Nur verteidigen zu lassen. Ob man gewinnt oder verliert, zweihundertfünfzigtausend Dollar sind futsch. Wussten Sie das?«
Rachel hatte immer noch mit dem »junge Dame« zu tun, aber sie nickte.
»Dieser Hexenzirkel hat mich vergewaltigt. Welches Wort würde besser passen? Sie haben meinen guten Namen beschmutzt, meine Familie zerstört und meine Freunde entfremdet. Aber das reicht ihnen noch nicht. Nein. Jetzt wollen sie mich auch noch bluten sehen. Sie wollen an die wenigen Ersparnisse heran, die mir geblieben sind. Damit ich meine letzten Jahre als Bettler verbringe. Damit ich irgendwo auf einem Klappbett in einem Obdachlosenheim verrecke wie ein einsamer, elender Versager.« Er spreizte seine Finger über dem Papierstapel. »Auf diesen Seiten stehen alle dreckigen Fakten über diese dreckigen Weiber. Schreiben Sie darüber. Zeigen Sie der Welt, wer diese Frauen wirklich sind. Da steckt ein Pulitzerpreis für Sie drin, Rachel.«
»Ich bin nicht hier, um einen Pulitzerpreis zu bekommen«, sagte Rachel.
Seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. »Warum sind Sie dann hier?«
»Sie sagten, Sie hätten Informationen über meine Mutter.«
Er nickte. »Danach.«
»Wonach?«
»Nachdem Sie den Artikel geschrieben haben.«
»So kommen Sie bei mir nicht weiter«, sagte Rachel. »Wenn Sie Informationen über meine Mutter haben, dann nennen Sie mir die einfach, und dann sehen wir, ob –«
»Es geht nicht um Ihre Mutter. Es geht um Ihren Vater.« Seine Augen blitzten. »Wie Sie selbst sagten, es ist eine kleine Region. Die Leute reden. Und über Sie, meine Liebe, hat man sich erzählt, dass Elizabeth sich geweigert habe, Ihnen die Identität Ihres Vaters zu verraten. Wirklich, jeder aufrichtige Mensch in der Stadt hat Sie bedauert. Wir hätten Ihnen so gerne die Wahrheit gesagt, aber wir konnten es ja nicht. Na ja, ich schon. Ich habe Ihren Vater ziemlich gut gekannt. Aber so, wie die Schweigepflicht für Ärzte heutzutage nun mal geregelt ist, konnte ich seine Identität nicht gegen den Willen Ihrer Mutter aufdecken. Aber nun ist sie tot. Und ich darf nicht mehr praktizieren.« Er nahm einen Schluck von seinem Kaffee. »Also, Rachel, wollen Sie wissen, wer Ihr Vater ist?«
Rachel brauchte einen Augenblick, um ihre Stimme wiederzufinden. »Ja.«
»Wie war das?«
»Ja.«
Er quittierte das mit einem kurzen Augenzwinkern. »Dann schreiben Sie diesen verdammten Artikel, Schätzchen.«
3
JJ
Je mehr sich Rachel in das Thema vertiefte – in die Gerichtsakten und die von Browner gelieferten Unterlagen –, desto schlimmer wurde es. Wenn Dr. Felix Browner kein Serienvergewaltiger war, dann spielte er die Rolle überzeugender, als es Rachel seit langem gesehen hatte. Im Gefängnis saß er nur deshalb nicht, weil Lianne Fennigan, die einzige Frau, die innerhalb des Verjährungszeitraumes Anklage erhoben hatte, in der letzten Prozesswoche, kurz vor ihrem Zeugentermin, eine Überdosis Oxycontin genommen hatte. Lianne hatte zwar überlebt, den Termin jedoch in der Entzugsklinik statt im Zeugenstand verbracht, und so hatte der Staatsanwalt ein Gesuch akzeptiert, das den Entzug der ärztlichen Zulassung beinhaltete, außerdem eine sechsjährige Bewährungsstrafe, die Anrechnung von sechs Monaten Untersuchungshaft und ein Redeverbot. Aber keine Gefängnisstrafe.
Rachel schrieb ihre Reportage. Sie brachte sie zum Café in Millbury mit und zog sie aus der Tasche, nachdem sie sich Dr. Felix Browner gegenübergesetzt hatte. Er sah das schmale Papierbündel an, ließ sich aber nichts anmerken.
»Sie mögen wohl keine USB-Sticks.«
Sie gab mit einem knappen Lächeln zu verstehen, dass sie die Anspielung verstanden hatte. »Sie wirken so zufrieden.«
Das stimmte. Er hatte den Jimmy-Buffett-Look gegen ein weißes Hemd und einen dunkelbraunen Anzug ausgetauscht. Das Haar hatte er sich großzügig mit Gel zurückgekämmt. Seine raupenartigen Augenbrauen waren gestutzt. Er hatte einen gesunden Teint, und seine Augen glänzten hoffnungsvoll.
»Ich bin zufrieden, Rachel. Sie sehen auch phantastisch aus.«
»Danke.«
»Diese Bluse bringt das Grün in Ihren Augen gut zur Geltung.«
»Danke.«
»Ist Ihr Haar immer so seidig?«
»Ich war gerade beim Friseur.«
»Die Frisur steht Ihnen.«
Sie strahlte ihn an. Seine Augen traten hervor, und er gönnte sich ein kleines, privates Lachen. »Du liebes bisschen!«, sagte er.
Sie sagte nichts, nickte bloß wissend und hielt seinem Blick stand.
»Ich wette, Sie können den Pulitzerpreis schon riechen.«
»Ach«, sagte sie, »überstürzen wir mal nichts.« Sie reichte ihm den Artikel.
Er setzte sich bequem auf seinem Stuhl zurecht. »Wir sollten etwas zu trinken bestellen«, sagte er geistesabwesend, während er sich in den Text versenkte. Als er die erste Seite umblätterte, warf er ihr einen Blick zu, und sie lächelte aufmunternd. Er las weiter und runzelte die Stirn. Seine freudige Erwartung verwandelte sich in Entsetzen, dann in Verzweiflung und schließlich in Entrüstung.
»Hier steht«, sagte er und scheuchte die sich nähernde Kellnerin mit einer Handbewegung fort, »dass ich ein Vergewaltiger bin.«
»Irgendwie schon, nicht wahr?«
»Hier steht, dass die Drogensucht, der Alkoholismus und die sexuellen Schweinereien der Frauen meine Schuld sind.«
»Weil das stimmt.«
»Hier steht, ich hätte Sie zu erpressen versucht, damit Sie das Leben dieser Frauen ein zweites Mal zerstören.«
»Weil es so war.« Sie nickte freundlich. »Und Sie haben sie in meiner Gegenwart verleumdet. Ich wette, wenn ich mich mal ein bisschen in den Kneipen in Ihrer Umgebung umhöre, finde ich Beweise, dass Sie sie vor der Hälfte der männlichen Bevölkerung in West-Massachusetts verleumdet haben. Was ein Verstoß gegen Ihre Bewährungsauflagen wäre. Und das bedeutet, Felix, wenn der Globe diese Geschichte druckt, wandern Sie geradewegs in Zellenblock D.«
Sie lehnte sich zurück und sah zu, wie er nach Worten rang. Als er endlich aufsah, liefen seine Augen fast über von Märtyrertum und Ungläubigkeit.
»Diese Hände« – er hob sie in die Höhe – »haben Sie zur Welt gebracht.«
»Ihre Hände sind mir scheißegal«, sagte sie. »Wir haben jetzt eine neue Abmachung. Ich werde diese Geschichte nicht einreichen.«
»Danke.« Er setzte sich auf. »Gleich, als ich Sie sah, wusste ich –«
»Nennen Sie mir den Namen meines Vaters.«
»Natürlich, mit Vergnügen, aber lassen Sie uns doch erst mal einen Drink bestellen und darüber reden.«
Sie nahm ihm den Text aus der Hand. »Nennen Sie mir den Namen meines Vaters hier und jetzt, oder ich reiche diesen Artikel ein, und zwar« – sie zeigte zum Tresen – »von dem Telefon dort.«
Er sackte in seinem Stuhl zusammen und betrachtete den Deckenventilator, der sich mit rostigem Quietschen langsam über ihm drehte. »Sie nannte ihn JJ.«
Rachel steckte den Artikel in ihre Tasche zurück, um das Zittern zu verbergen, das sich von ihren Händen bis zu den Ellbogen ausbreitete. »Warum JJ?«
Er zuckte mit den Schultern, ein bedrängter, dem Schicksal ausgelieferter Bittsteller. »Was soll ich jetzt tun? Wovon werde ich leben?«
»Warum hat sie ihn JJ genannt?« Sie bemerkte, dass sie mit den Zähnen knirschte.
»Ihr seid alle gleich«, flüsterte er. »Ihr nehmt Männer aus, bis sie nichts mehr haben. Gute Männer. Ihr seid eine Pest.«
Sie stand auf.
»Setzen.« Er sagte es laut genug, dass zwei Gäste sich nach ihnen umsahen. »Bitte. Nein, nein. Einfach hinsetzen. Ich werde brav sein. Ich werde ein braver Junge sein.«
Sie setzte sich. Dr. Felix Browner zog ein einzelnes Blatt Papier aus seiner Jacketttasche. Es war alt und doppelt gefaltet. Er öffnete es und reichte es ihr über den Tisch. Ihre Hand zitterte noch stärker, als sie es nahm, aber das war ihr egal.
Oben auf dem Blatt stand der Name seiner Praxis: Dr. Browner – Fachklinik für Frauengesundheit. Darunter: »Anamnese des Kindsvaters«.
»Er kam nur zweimal in meine Praxis. Ich hatte den Eindruck, dass sie sich oft stritten. Manche Männer haben Angst vor Schwangerschaften. Sie legen sich ihnen um den Hals wie ein Galgenstrick.«
Unter »Nachname« hatte er in blauer Tinte und mit ordentlichen Blockbuchstaben »JAMES« geschrieben.
Deshalb hatten sie ihn nicht gefunden. James war sein Nachname.
Sein Vorname war Jeremy.
4
Gruppe B
Jeremy James hatte im September 1982 eine Vollzeitstelle am Connecticut College angenommen, einer kleinen geisteswissenschaftlichen Einrichtung in New London. Im selben Jahr hatte er ein Haus in Durham gekauft, einer Kleinstadt mit siebentausend Einwohnern, sechzig Meilen auf der I-91 entfernt von South Hadley, wo Rachel aufgewachsen war, und zehn Autominuten von dem Haus, das ihre Mutter in Middletown gemietet hatte, als Rachel so krank gewesen war.
Im Juli 1983 hatte er Maureen Widerman geheiratet. Theo, ihr erstes Kind, war im September 1984 zur Welt gekommen. Charlotte, das zweite, war 1986 als Weihnachtsbaby geboren worden. Ich habe Halbgeschwister, dachte Rachel, Blutsverwandte. Und zum ersten Mal seit dem Tod ihrer Mutter hatte sie das Gefühl, irgendwo im Universum verankert zu sein.
Nun, da sie seinen vollen Namen kannte, lag Jeremy James’ Leben in weniger als einer Stunde vor Rachel ausgebreitet – zumindest der öffentlich verzeichnete Teil. Im Jahr 1990 war er Privatdozent für Kunstgeschichte geworden und fünf Jahre später ordentlicher Professor auf Lebenszeit. Als Rachel ihn im Herbst 2007 aufspürte, hatte er bereits seit einem Vierteljahrhundert am Connecticut College gelehrt und leitete nun das Institut. Seine Frau Maureen Widerman-James war Kuratorin für Europäische Kunst am Wadsworth Atheneum in Hartford. Rachel fand mehrere Fotos von ihr im Netz, und ihr Blick war so sympathisch, dass sie beschloss, sie zu ihrer ersten Anlaufstelle zu machen. Auch von Jeremy James hatte sie Fotos gefunden. Er hatte jetzt eine Glatze und einen Vollbart und sah sehr gebildet und imposant aus.
Als sie bei Maureen Widerman-James anrief und ihren Namen nannte, trat nur eine winzige Pause ein, ehe Maureen sagte: »Fünfundzwanzig Jahre lang habe ich mich gefragt, wann du anrufen würdest. Du weißt gar nicht, was für eine Erleichterung es ist, endlich deine Stimme zu hören, Rachel.«