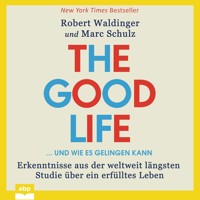19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel-Verlag
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
NEW YORK TIMES BESTSELLER
Was ist der Schlüssel zu einem guten Leben? Diese Frage beschäftigt alle Menschen und auch die längste je durchgeführte Glücksstudie weltweit. Die Harvard Study of Adult Development verfolgt das Leben ihrer Teilnehmer*innen seit mehr als 80 Jahren. Das einzigartige und aufschlussreiche Ergebnis dieser Studie findet sich in »The Good Life« wieder. Es handelt von der
Macht unserer Sozialkontakte und Beziehungen, ihrem Einfluss auf unsere Gesundheit und Zufriedenheit und wie wir durch sie Geist, Körper und Seele schützen können. Außerdem erklären Robert Waldinger und Marc Schulz, wie es möglich ist, starke Beziehungen – zur Partner*in, zu Freunden oder Kolleg*innen – aufzubauen, zu führen und dadurch erfüllter und zufriedener zu leben.
Mit Wärme, Weisheit, Wissenschaft und faszinierenden Lebensgeschichten eröffnet dieses Buch konkrete Wege, wie wir unser Leben durch unsere Verbindungen zu anderen Menschen glücklicher und sinnvoller gestalten können.
»Robert Waldinger und Marc Schulz begleiten uns auf eine kraftgebende Suche nach unserem größten Bedürfnis: sinnstiftende menschliche Verbindungen« Jay Shetty, Spiegel-Bestsellerautor von Das Think Like a Monk-Prinzip
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 567
Ähnliche
Buch
Was ist der Schlüssel zu einem guten Leben? Diese Frage beschäftigt alle Menschen und auch die längste je durchgeführte Glücksstudie weltweit, die Harvard Study of Adult Development. Das einzigartige und aufschlussreiche Ergebnis dieser Studie findet sich in The Good Life wieder. Es handelt von der Macht unserer Sozialkontakte und Beziehungen, ihrem Einfluss auf unsere Gesundheit und Zufriedenheit und wie wir durch sie Geist, Körper und Seele schützen können. Außerdem erklären die Autoren, wie es möglich ist, starke Beziehungen – zur Partner*in, zu Freunden oder Kolleg*innen – aufzubauen, zu führen und dadurch erfüllter zu leben.
Mit Wärme, Weisheit, Wissenschaft und faszinierenden Lebensgeschichten eröffnet dieses Buch konkrete Wege, wie wir unser Leben durch unsere Verbindungen zu anderen Menschen glücklicher und sinnvoller gestalten können.
Autoren
Dr. Robert Waldinger ist Professor für Psychiatrie an der Harvard Medical School und Direktor des Center for Psychodynamic Therapy and Research am Massachusetts General Hospital. Er ist der aktuelle Direktor der Harvard Study of Adult Development. Er praktiziert als Psychiater und Psychoanalytiker und ist außerdem Zen-Priester und -Lehrer.
Marc Schulz, PhD, ist stellvertretender Direktor der Harvard Study of Adult Development und Professor für Psychologie am Bryn Mawr College. Der Schwerpunkt seiner Forschung liegt auf Emotionen, Bewältigungsstrategien und Beziehungsdynamiken im Kontext der Erwachsenenentwicklung. Zudem ist er praktizierender Therapeut.
Robert Waldinger & Marc Schulz
THE GOOD LIFE
... UND WIE ES GELINGEN KANN
Erkenntnisse aus der weltweit längsten Studie über ein erfülltes Leben
Aus dem Amerikanischen von Ulrike Kretschmer
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.Wir haben uns bemüht, alle Rechteinhaber an den aufgeführten Zitaten ausfindig zu machen, verlagsüblich zu nennen und zu honorieren. Sollte uns dies im Einzelfall nicht möglich gewesen sein, bitten wir um Nachricht durch den Rechteinhaber. Kapiteln vorangestellte Zitate können als Destillat des jeweils nachfolgenden Kapitels gelesen werden.
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel The Good Life. Lessons from the World’s Longest Scientific Study of Happiness bei Simon & Schuster, New York. Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 Kösel-Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Copyright © 2023 by Robert Waldinger and Marc Schulz
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung: Favoritbuero, München, basierend auf dem Penguin Random House UK Cover, gestaltet von Luke Bird
Redaktion: Friederike Moldenhauer
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-27370-5V002
www.koesel.de
Für die Familien, in die wir geboren wurden,und die Familien, die wir mit erschaffen haben
Inhalt
Anmerkung der Autoren
1 Was macht ein gutes Leben aus?
2 Warum Beziehungen so wichtig sind
3 Beziehungen auf dem verschlungenen Pfad des Lebens
4 Soziale Fitness: Beziehungen in Form halten
5 Beziehungspflege – die beste Investition
6 Sich Schwierigkeiten in Beziehungen stellen
7 Der Mensch an unserer Seite: Wie intime Beziehungen das Leben prägen
8 Kernpunkt Familie
9 Gute Arbeitsbeziehungen
10 Alle Freunde sind wichtig
Zum guten Schluss: Es ist nie zu spät, um glücklich zu sein
Danksagung
Literatur
Anmerkungen
Anmerkung der Autoren
Die an der Harvard Medical School durchgeführte Study of Adult Development begleitete das Leben zweier Generationen von Menschen aus bestimmten Familien mehr als 80 Jahre lang. Eine solche Studie erfordert immenses Vertrauen. Und dieses Vertrauen kann nur entstehen, wenn Vertraulichkeit oberste Priorität hat und das Privatleben der Teilnehmenden geschützt ist. Aus diesem Grund haben wir die Namen und wiedererkennbaren Einzelheiten der betreffenden Personen geändert. Dennoch sind alle Zitate in diesem Buch entweder wörtlich wiedergegeben oder indirekt aus den Befragungen, Tonaufzeichnungen, Beobachtungen und anderen Daten der Studie zitiert.
1Was macht ein gutes Leben aus?
»Das Leben ist so kurz, dass keine Zeit bleibt für Gezänk, Entschuldigungen, Sodbrennen, Rufen nach Rechenschaft. Es bleibt nur Zeit, lediglich ein Augenblick sozusagen, für die Liebe.«1
MARKTWAIN
Beginnen wir mit einer Frage:
Wenn Sie, hier und jetzt, eine Entscheidung treffen müssten, die Ihnen den Weg zu zukünftiger Gesundheit und Zufriedenheit ebnet, welche Entscheidung wäre das?
Würden Sie beschließen, ab sofort jeden Monat mehr Geld auf die hohe Kante zu legen? Den Arbeitsplatz zu wechseln? Mehr zu reisen? Welcher Entschluss könnte am besten sicherstellen, dass Sie, wenn Sie am Ende Ihrer Tage zurückblicken, das Gefühl haben, ein gutes Leben gelebt zu haben?
Bei einer Umfrage im Jahr 2007 wurden Angehörige der Generation Y – in den 1980er- und 1990er-Jahren Geborene – gebeten, ihre wichtigsten Ziele im Leben anzugeben.2 76 Prozent der Befragten nannten Reichtum als oberstes Lebensziel. 50 Prozent hätten eines ihrer wichtigsten Lebensziele damit erreicht, berühmt geworden zu sein. Mehr als zehn Jahre später, die Millennials waren älter geworden, wurden in einer Reihe von Erhebungen ähnliche Fragen gestellt. Nun stand die Berühmtheit deutlich weiter unten auf der Liste, zu den obersten Zielen gehörten aber immer noch Dinge wie viel Geld zu haben, im Beruf erfolgreich zu sein und Schulden loszuwerden.
Diese häufigen und praktischen Ziele sind generationenübergreifend und an keine Nationalität gebunden. In vielen Ländern werden Kinder ab einem Alter, in dem sie noch kaum sprechen können, immer wieder gefragt, was sie einmal werden wollen, wenn sie groß sind – womit gemeint ist, welchen Beruf sie einmal ergreifen wollen. Lernen Erwachsene jemand Neues kennen, lautet eine der ersten Fragen: »Was machen Sie beruflich?« Oft wird Erfolg im Leben an Titel, Gehalt und Anerkennung der Leistung gemessen, auch wenn den meisten von uns klar ist, dass diese Dinge allein nicht zwangsläufig glücklich machen. Diejenigen, denen es gelingt, einige oder sogar alle Wünsche im Leben als erfüllt abzuhaken, fühlen sich hinterher in der Regel nicht viel anders als vorher.
In der Zwischenzeit werden wir den ganzen Tag mit Botschaften darüber bombardiert, was uns Glück beschert, was wir wollen sollten, wer was im Leben »richtig« macht. Die Werbung erzählt uns, diese – und nur diese – Joghurtmarke erhalte uns gesund, ein neues Smartphone bringe Freude in unser Leben und mit dieser oder jener Gesichtscreme blieben wir für immer jung.
Daneben gibt es aber auch weniger explizite Botschaften, die zum Alltag dazugehören. Kauft sich ein Freund ein neues Auto, fragen wir uns, ob nicht auch unser Leben mit einem neueren Auto besser wäre. Scrollen wir durch die sozialen Medien mit ihren Bildern von fantastischen Partys und traumhaften Stränden, vermissen wir eben jene Partys und Strände im eigenen Leben. Eher flüchtigen Bekannten, bei der Arbeit etwa oder ganz besonders in den sozialen Netzwerken, zeigen wir im Allgemeinen idealisierte Versionen unserer selbst. Wir präsentieren uns von unserer Schokoladenseite, und die Diskrepanz zwischen dem, was wir sehen, und dem, wie wir uns fühlen, lässt uns mit dem Gefühl zurück, wir kämen irgendwie zu kurz. Man könnte es auch so ausdrücken: Wir vergleichen unser Inneres mit dem Äußeren anderer Menschen.
Mit der Zeit entwickeln wir die unterschwellige, aber schwer abzuschüttelnde Vorstellung, dass unser Leben hier und jetzt stattfindet und das, was wir für ein zufriedenes Leben brauchen, dort ist, in der Zukunft, immer gerade außerhalb unserer Reichweite.
Betrachtet man das Leben durch diese Brille, lässt sich leicht glauben, ein gutes, ein zufriedenes Leben gäbe es gar nicht oder sei zumindest nur anderen möglich. Denn schließlich passt unser eigenes Leben kaum je zu dem Bild in unserem Kopf, das wir uns von einem guten Leben gemacht haben. Unser Leben ist immer zu chaotisch und zu kompliziert, um gut sein zu können.
Aber – Achtung, Spoileralarm: Ein zufriedenes Leben ist ein kompliziertes Leben. Für jeden.
Ein gutes Leben ist voller Freude … und Herausforderungen. Voller Liebe, aber auch voller Schmerz. Und es ist nicht plötzlich da, es entwickelt sich im Laufe der Zeit. Es ist ein Prozess, der Tumult, Ruhe, Leichtigkeit, Schwere, Kämpfe, Errungenschaften, Rückschläge, Sprünge nach vorn und schreckliche Stürze beinhaltet. Und natürlich endet ein gutes Leben immer mit dem Tod.3
Das klingt jetzt erst mal nicht so toll, das wissen wir.
Trotzdem müssen wir ehrlich sein: Das Leben ist, auch wenn es gut ist, nicht einfach. Es gibt nichts, was das Leben perfekt machen würde, und gäbe es etwas, käme kein gutes Leben dabei heraus.
Warum das so ist? Weil ein erfüllendes, ein gutes Leben aus genau den Dingen geschmiedet ist, die es schwer machen.
Dieses Buch basiert auf solider wissenschaftlicher Forschung. Herzstück ist die Harvard Study of Adult Development, ein außergewöhnliches wissenschaftliches Unterfangen, das 1938 begann und entgegen allen Erwartungen heute noch fortgesetzt wird. Bob ist vierter Leiter der Studie, Marc sein Stellvertreter. Die Studie hatte es sich zum Ziel gesetzt, mehr über die Gesundheit des Menschen herauszufinden, und zwar nicht anhand dessen, was ihn krank macht, sondern anhand dessen, was ihm guttut – ein für die damalige Zeit radikaler Ansatz. Im Rahmen dieser Studie wurden die Erfahrungen und Erlebnisse im Leben der Teilnehmenden mehr oder weniger so aufgezeichnet, wie sie gerade geschahen, von Problemen in der Kindheit über die erste Liebe bis zum Tod. Wie das Leben der Teilnehmenden war auch der Weg der Studie selbst lang und voller Wendungen: Die Forschenden verfeinerten ihre Methoden im Laufe der Jahrzehnte und dehnten sich aus, sodass sie heute drei Generationen und mehr als 1300 Kinder der ursprünglichen 724 Mitwirkenden umfasst. Diese Studie entwickelt sich immer noch weiter und ist mittlerweile die längste tiefgehende Längsschnitt- oder Verlaufsstudie zum Leben des Menschen, die je durchgeführt wurde.
Dennoch reicht keine Studie, auch nicht die umfangreichste aus, um umfassende Aussagen über das Leben des Menschen zuzulassen. Deshalb fußt dieses Buch zwar auf der Harvard-Studie, wird aber auf allen Seiten von Hunderten anderer wissenschaftlicher Studien gestützt, an denen Tausende von Menschen aus aller Welt teilnahmen. Zudem macht sich das Buch die Weisheit aus der jüngeren und älteren Vergangenheit zunutze – Ideen, die auch heute noch Bestand haben, die die moderne wissenschaftliche Sichtweise des menschlichen Erlebens spiegeln und bereichern. In diesem Buch geht es in erster Linie um die Macht von Beziehungen, und so ist es nur passend, dass es auch aus der langen und fruchtbaren Freundschaft zwischen den beiden Autoren heraus entstanden ist.
Letzten Endes aber würde es diesen Text nicht ohne die Menschen geben, die an der Harvard-Studie teilgenommen haben und deren Ehrlichkeit und Freigiebigkeit eine solche Studie überhaupt erst möglich machten.
Menschen wie Rosa und Henry Keane.
»Wovor haben Sie am meisten Angst?«
Rosa las die Frage laut vor und sah dann über den Küchentisch hinweg ihren Mann Henry an. Rosa und Henry waren beide über 70 und lebten nun schon seit über 50 Jahren in diesem Haus, hatten schon seit über 50 Jahren an den meisten Tagen zum Frühstück gemeinsam an diesem Tisch gesessen. Zwischen ihnen standen eine Kanne Tee, eine offene Packung Kekse (halb aufgegessen) und ein Aufnahmegerät. In einer Ecke des Raums stand außerdem eine Videokamera. Neben der Kamera saß eine junge Harvard-Forscherin namens Charlotte, die die beiden still beobachtete und sich dabei Notizen machte.
»Was für eine Frage«, sagte Rosa.
»Wovor habe ich am meisten Angst?«, fragte Henry Charlotte. »Oder wovor haben wir am meisten Angst?«
Rosa und Henry hielten sich nicht für besonders interessante Studienobjekte. Sie waren beide in bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen, hatten Mitte 20 geheiratet und fünf Kinder miteinander großgezogen. Sie hatten die Weltwirtschaftskrise erlebt und viele schwere Zeiten durchgemacht, sicher, aber das hatten alle anderen, die sie kannten, auch. Deshalb hatten sie auch nie verstanden, warum Forscher aus Harvard überhaupt an ihnen interessiert gewesen waren, geschweige denn immer noch waren; warum sie immer noch anriefen, Fragebogen sandten und gelegentlich quer über den Kontinent flogen, um sie zu Hause zu besuchen.
Als Studienmitarbeitende erstmals an die Tür geklopft und seine perplexen Eltern gefragt hatten, ob sie Aufzeichnungen über sein Leben machen durften, war Henry gerade einmal 14 Jahre alt gewesen und hatte im West End von Boston gewohnt, in einer Mietwohnung ohne fließendes Wasser. Als er Rosa im August 1954 geheiratet hatte, war die Studie in vollem Gange gewesen – den Aufzeichnungen zufolge hatte Henry sein Glück kaum fassen können, als sie Ja gesagt hatte –, und jetzt saßen sie hier, im Oktober 2004, zwei Monate nach ihrem 50. Hochzeitstag. Rosa war 2002 gebeten worden, direkter an der Studie teilzunehmen. Das wird ja auch mal Zeit, sagte sie. Harvard hatte Henrys Leben seit 1941 Jahr für Jahr mitverfolgt. Rosa dachte oft, es sei seltsam, dass er auch als älterer Mann noch immer daran teilnahm, weil er sonst doch so viel Wert auf seine Privatsphäre legte. Darauf entgegnete Henry, er fühle sich der Studie verpflichtet und schätze sie inzwischen auch, weil sie den Dingen einen gewissen Zusammenhang verleihe. Seit nun schon 63 Jahren erzählte er dem Forscherteam von seinem Leben. Er hatte den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern tatsächlich schon so viel und seit so langer Zeit von sich berichtet, dass er sich nicht mehr daran erinnern konnte, was sie von ihm wussten und was nicht. Sie wussten wahrscheinlich alles, nahm er an, darunter auch das, was er außer Rosa noch nie jemandem erzählt hatte, denn wann immer sie ihm eine Frage stellten, tat er sein Bestes, wahrheitsgetreu darauf zu antworten.
Und sie stellten eine Menge Fragen.
»Mr. Keane fühlte sich sichtlich geschmeichelt, dass ich eigens nach Grand Rapids gekommen war, um sie zu befragen«, schrieb Charlotte im Rahmen ihrer Feldnotizen. »Das schuf von vornherein eine positive Interviewatmosphäre. Mr. Keane stellte sich als sehr kooperativ und interessiert heraus. Seine Antworten waren nie vorschnell, häufig dachte er erst einige Augenblicke nach, bevor er etwas erwiderte. Er war sehr freundlich, in meinen Augen verkörperte er geradezu das Klischee des ruhigen Mannes aus Michigan.«
Bei ihrem zweitägigen Besuch hatte Charlotte eine lange, eine sehr lange Liste an Fragen dabei, die die Gesundheit der Keanes ebenso betrafen wie Rosas, Henrys und ihr gemeinsames Leben. Wie die meisten unserer jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Beginn des Berufslebens hatte sich auch Charlotte ganz persönlich Gedanken darüber gemacht, was ein gutes Leben überhaupt ist und wie sich ihre Entscheidungen von heute auf ihre Zukunft auswirken könnten. Konnte das Leben anderer ihr Aufschluss über ihr eigenes geben? Das konnte sie nur herausfinden, indem sie Fragen stellte und den beiden genau zuhörte. Was war diesem bestimmten Menschen wichtig? Was verlieh seinem Leben Sinn? Was hatte er aus seinen Erfahrungen gelernt? Was bedauerte oder bereute er? Jede Befragung bot Charlotte eine neue Gelegenheit, die Verbindung zu einem Menschen herzustellen, der im Leben schon weiter war als sie selbst, der aus anderen Lebensumständen kam, aus einem anderen Punkt in der Geschichte.
An diesem Tag interviewte sie Henry und Rosa gemeinsam; sie stellte ihnen ihre Fragen und zeichnete dann mit der Videokamera auf, wie die beiden miteinander über ihre größten Ängste sprachen. Zudem befragte sie Rosa und Henry auch getrennt in sogenannten »Attachment Interviews« (Bindungsinterviews). Anschließend wurden die Videoaufzeichnungen und Interviewabschriften in Boston ausgewertet: Die Art und Weise, wie Henry und Rosa übereinander sprachen, ihre nonverbalen Hinweise und viele andere Informationen wurden zu Daten über die Natur ihrer Bindung kodiert. Diese Daten flossen in ihre Akten ein und wurden so zu einem kleinen, aber wichtigen Teil eines gigantischen Datensatzes hinsichtlich dessen, was ein gelebtes Leben tatsächlich ausmacht.
Wovor haben Sie am meisten Angst? Charlotte hatte die jeweiligen Antworten der beiden in getrennten Interviews bereits aufgezeichnet, jetzt war es an der Zeit, miteinander über die Frage zu sprechen.
Und das gestaltete sich so:
»Irgendwie mag ich die schwierigen Fragen«, sagte Rosa.
»Na gut«, entgegnete Henry. »Dann fang du an.«
Rosa schwieg einen Moment und erzählte Henry dann, ihre größte Angst sei es, dass er ernsthaft krank werden oder sie einen weiteren Schlaganfall haben würde. Henry stimmte ihr zu: Das machte auch ihm Angst. Allerdings, fuhr er fort, seien sie jetzt an einem Punkt, an dem das irgendwann unausweichlich wäre. Anschließend sprachen sie ausführlich darüber, wie sich eine ernsthafte Erkrankung auf das Leben ihrer erwachsenen Kinder und auch auf sie selbst auswirken würde. Letztlich gestand Rosa zu, dass man nicht alles vorhersehen kann und dass es sinnlos ist, sich über Unvorhersehbares Gedanken zu machen, bevor es passiert ist.
»Haben Sie noch eine Frage?«, wandte sich Henry an Charlotte.
»Wovor hast du denn am meisten Angst, Hank?«, schob Rosa dazwischen.
»Ich hatte gehofft, du würdest vergessen, mich das zu fragen«, antwortete Henry. Beide lachten. Dann goss Henry Rosa noch etwas Tee ein, nahm sich einen weiteren Keks und schwieg eine Zeit lang.
»Die Frage an sich ist nicht schwer«, sagte er schließlich. »Ich will nur nicht darüber nachdenken, um ehrlich zu sein.«
»Die arme Frau ist den ganzen Weg aus Boston hierhergekommen. Du solltest ihr lieber antworten.«
»Es ist aber nicht schön.« Henrys Stimme bebte.
»Nur Mut.«
»Meine größte Angst ist, dass ich nicht als Erster sterben werde. Dass ich ohne dich übrig bleibe.«
An der Ecke des Bulfinch Triangle im West End von Boston, unweit der Stelle, an der Henry Keane als Kind gewohnt hat, steht das Lockhart Building, in dem sich heute das Büro der Forscher und Forscherinnen sowie die Aufzeichnungen der Harvard Study of Adult Development befinden, der längsten Studie zum Leben erwachsener Menschen, die je durchgeführt wurde.
Relativ weit hinten hängen in einem Aktenschrank mit der Aufschrift »KA–KE« die Akten von Henry und Rosa. Darin finden sich auch die vergilbten, am Rand ausgefransten Seiten von Henrys Aufnahmegespräch aus dem Jahr 1941. Die handschriftlichen Aufzeichnungen lassen sich dank der fließenden, geübten Schreibschrift des Fragestellers gut lesen. Wir erfahren, dass Henrys Familie zu den ärmsten in Boston gehörte und dass der 14-Jährige den Eindruck eines »stabilen, beherrschten Jugendlichen mit einem schlüssigen Blick auf die eigene Zukunft« erweckte. Wir erfahren auch, dass der junge Henry seiner Mutter sehr nahestand, seinen Vater aber verabscheute. Dessen Alkoholsucht zwang ihn dazu, Haupternährer der Familie zu sein. Bei einem besonders traumatischen Vorfall – Henry war etwa Anfang 20 – hatte sein Vater Henrys Verlobten erzählt, dass ihr Verlobungsring schuld daran sei, dass der Familie nun 300 Dollar fehlten. Da sie Angst davor gehabt hatte, dieser Familie nie entkommen zu können, hatte sie die Verlobung schließlich gelöst.
1953 sagte sich Henry endgültig von seinem Vater los. Er hatte eine Anstellung bei General Motors bekommen und zog nach Willow Run, Michigan. Dort begegnete er Rosa, dänische Einwanderin und eines von neun Kindern. Ein Jahr später waren die beiden verheiratet, noch später hatten sie selbst fünf Kinder. »Viele, aber nicht genug«, aus Rosas Sicht.
In den darauffolgenden zehn Jahren hatten Henry und Rosa es nicht leicht. 1959 erkrankte ihr fünfjähriger Sohn Robert an Kinderlähmung, was Rosas und Henrys Ehe auf eine harte Probe stellte und in der Familie zu Leid und Sorgen führte. Henry hatte bei GM als Monteur in der Fabrikhalle begonnen. Da er aufgrund von Roberts Erkrankung nicht zur Arbeit erschienen war, war er jedoch erst herabgestuft und dann entlassen worden – arbeitslos, mit drei Kindern, die ernährt werden wollten. Um irgendwie über die Runden zu kommen, nahm Rosa eine Stelle in der Lohnbuchhaltung der Stadt Willow Run an. Doch was zunächst eine Notlösung um der Familie willen gewesen war, entwickelte sich bald zu einer mehr als angenehmen Vollzeitbeschäftigung: Rosa war bei den Kolleginnen und Kollegen sehr beliebt und arbeitete schließlich 30 Jahre in diesem Beruf. Dabei baute sie Beziehungen zu Menschen auf, die sie alsbald als ihre zweite Familie betrachtete. Henry wechselte nach seiner Entlassung dreimal den Arbeitsplatz, bevor er 1963 schließlich zu GM zurückkehrte und zum Hallenaufseher aufstieg. Kurz darauf nahm er wieder Verbindung zu seinem Vater auf, der seine Alkoholsucht mittlerweile überwunden hatte, und verzieh ihm.
Henrys und Rosas Tochter Peggy, selbst schon über 50, ist ebenfalls Teilnehmerin der Studie. Sie weiß nicht, was ihre Eltern erzählt haben, dann wäre sie bei ihren Berichten über das Familienleben möglicherweise voreingenommen. Vielfältige Sichtweisen auf ein und dasselbe familiäre Umfeld sowie auf ein und dieselben Ereignisse helfen dabei, die Studiendaten zu erweitern und zu vertiefen. Sehen wir uns Peggys Akte an, erfahren wir, dass sie in dem Gefühl aufgewachsen ist, von ihren Eltern verstanden worden zu sein, dass sie immer versuchten, sie aufzumuntern, wenn sie Kummer hatte. Allgemein bewertete sie ihre Eltern als »sehr liebevoll«. Und im Einklang mit Henrys und Rosas Erzählungen über ihre Ehe äußerte auch Peggy, ihre Eltern hätten eine Trennung oder gar Scheidung nie in Erwägung gezogen.
1977 bewertete Henry im Alter von 50 Jahren sein Leben folgendermaßen:
Zustand der Ehe:AUSGEZEICHNET.
Stimmung im Laufe des vergangenen Jahres:AUSGEZEICHNET.
Körperliche Gesundheit in den letzten beiden Jahren:AUSGEZEICHNET.
Allerdings bestimmen wir den Grad von Henrys Gesundheit und Zufriedenheit ebenso wie den aller anderen Teilnehmenden nicht allein dadurch, dass wir sie und die ihnen Nahestehenden fragen, wie sie sich fühlen. Die Teilnehmenden gestatten es uns, durch viele verschiedene Brillen einen Blick auf ihr Wohlbefinden zu werfen, darunter etwa bildgebende Gehirnuntersuchungen, Bluttests oder auch Videoaufzeichnungen, in denen sie über ihre schlimmsten Sorgen sprechen. Wir nehmen Haarproben, um die Ausschüttung von Stresshormonen zu messen, bitten sie, uns ihre wichtigsten Ziele im Leben mitzuteilen, und sehen uns an, wie schnell die Herzfrequenz sinkt, nachdem wir sie mit einer schwierigen Denksportaufgabe konfrontiert haben. Dadurch erhalten wir tiefergehende und umfassendere Informationen darüber, wie jemand im Leben zurechtkommt.
Henry war ein zurückhaltender Mann, der sich jedoch ungeheuer für seine engsten Beziehungen engagierte, vor allem für die Verbindung zu Rosa und zu seinen Kindern, und diese Verbindungen verschafften ihm ein tiefes Gefühl der Sicherheit. Zudem wandte er einige sehr wirkungsvolle Bewältigungsstrategien an, die wir uns auf den nächsten Seiten noch näher ansehen werden. Dieses Fundament aus emotionaler Sicherheit, gepaart mit effektiver Problembewältigung, ermöglichte es Henry, wieder und wieder zu berichten, er sei »zufrieden« oder »glücklich«, selbst in den schwierigsten Zeiten, und das spiegelt sich sowohl in seiner Gesundheit als auch in seiner Lebensdauer wider.
2009, fünf Jahre nach Charlottes Besuch und 68 Jahre nach Henrys Aufnahmegespräch für die Studie, wurde Henrys größte Angst Wirklichkeit: Rosa starb. Weniger als sechs Wochen später folgte Henry ihr nach.
Ihre Tochter Peggy aber führt das Familienerbe fort. Erst vor Kurzem kam sie zu einem Interview in unsere Büros in Boston. Seit dem Alter von 29 Jahren lebt sie in einer glücklichen Beziehung mit ihrer Partnerin Susan, heute, im Alter von 57 Jahren, gibt sie an, weder einsam zu sein noch gesundheitliche Probleme zu haben. Sie ist angesehene Grundschullehrerin und ein aktives Mitglied ihrer Gemeinde. Doch der Pfad, der sie zu dieser glücklichen Zeit in ihrem Leben geführt hat, war qualvoll und verlangte Mut – wir werden später noch einmal zu Peggys Geschichte zurückkehren.
Die Investition im Leben
Was genau hatte es nun mit Henrys und Rosas Einstellung zum Leben auf sich, dass sie es auch in alles andere als rosigen Zeiten genießen konnten? Und womit hat Henrys und Rosas Geschichte oder jede andere Lebensgeschichte der Harvard-Studie Ihre Zeit und Aufmerksamkeit verdient?
Wenn es darum geht zu verstehen, was Menschen in ihrem Leben erleben, ist ein vollständiges Bild – die Entscheidungen, die sie treffen, die Pfade, denen sie folgen, und was das letztlich alles für sie bedeutet – fast nie zu bekommen. Das meiste, was wir über das Leben einer Person wissen, erfahren wir, wenn wir sie bitten, uns von ihrer Vergangenheit zu erzählen, und Erinnerungen sind leider lückenhaft. Versuchen Sie nur einmal, sich daran zu erinnern, was Sie am letzten Dienstag zu Abend gegessen haben oder mit wem Sie am heutigen Tag im letzten Jahr gesprochen haben. Sie werden schnell sehen, an wie viele Dinge in unserem Leben wir uns nicht erinnern. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Einzelheiten vergessen wir; zudem zeigen Experimente, dass sogar der Akt des Erinnerns selbst die Erinnerung verändern kann.4 Kurzum: Als Werkzeug, vergangene Ereignisse zu studieren, ist das menschliche Gedächtnis bestenfalls unpräzise und schlimmstenfalls erfinderisch.
Doch was, wenn wir ein Leben in seinem gesamten Verlauf betrachten könnten? Was, wenn wir Menschen ihr ganzes Leben lang begleiten könnten, von ihrer Zeit als Teenager bis ins hohe Alter hinein, um herauszufinden, was für die Gesundheit und Zufriedenheit der Betreffenden wirklich eine Rolle spielt, welche Investitionen sich am Ende wirklich bezahlt machen?
Genau das haben wir getan.
Seit nun schon 84 Jahren folgt die Harvard-Studie denselben Teilnehmenden. Es wurden Tausende von Fragen gestellt und Hunderte von Messungen vorgenommen, um festzuhalten, was den Menschen wirklich gesund erhält und glücklich macht. In all den Jahren der Studie hat sich ein Faktor als absolut entscheidend für die körperliche Gesundheit, die psychische Gesundheit und die Lebensdauer erwiesen. Und dieser Faktor ist im Gegensatz zu dem, was wahrscheinlich viele Menschen glauben, nicht der berufliche Erfolg, die regelmäßige Bewegung oder die gesunde Ernährung. Damit wir uns nicht missverstehen: Diese Dinge sind wichtig, sogar sehr wichtig. Doch eines ist noch wichtiger: erfüllende Beziehungen.
Gute, erfüllende Beziehungen sind sogar so wichtig, dass wir die gesamten 84 Studienjahre auf dieses eine Lebensprinzip, diese eine Investition im Leben eindampfen könnten, wenn wir müssten. Diese Erkenntnis wird von ähnlichen Ergebnissen aus einer großen Vielfalt anderer Studien gestützt: Gute, erfüllende Beziehungen sorgen dafür, dass wir gesünder und zufriedener sind. Punkt.
Wer also die eine Entscheidung treffen will, die die eigene Gesundheit und Zufriedenheit, das eigene Glück, am besten sicherstellt, dann sollte diese Entscheidung wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge darin bestehen, herzliche Beziehungen zu pflegen. Und zwar Beziehungen aller Art. Wie wir noch sehen werden, wird diese Entscheidung nicht nur einmal getroffen, sondern wieder und wieder, Sekunde für Sekunde, Woche für Woche und Jahr für Jahr. Diese Entscheidung, das belegt eine Studie nach der anderen, trägt maßgeblich zu anhaltender Freude und einem gelingenden Leben bei. Allerdings ist sie nicht immer leicht zu treffen. Als Individuum stehen wir uns sogar mit den besten Absichten immer wieder selbst im Weg; wir machen Fehler und werden von den Menschen, die wir lieben, verletzt. Der Weg zu einem guten, erfüllten Leben ist zwar kein leichter, doch ist es absolut möglich, seine Hindernisse und Unebenheiten erfolgreich zu meistern. Die Harvard Study of Adult Development zeigt diesen Weg auf.
Ein Schatz in Bostons West End
Begonnen hat die Harvard Study of Adult Development in Boston, als sich die USA gerade aus der Weltwirtschaftskrise herauskämpften. Als New-Deal-Projekte wie der Social Security Act – die Gesetzesgrundlage zur Sozialversicherung – und die Arbeitslosenversicherung Fahrt aufnahmen, kam allmählich auch ein wachsendes Interesse hinsichtlich der Frage auf, welche Faktoren zum Wohlbefinden des Menschen beitragen und welche sich negativ auswirken. Dieses Interesse führte zwei unabhängig voneinander agierende Gruppen von Wissenschaftlern in Boston dazu, Forschungsprojekte ins Leben zu rufen, die sich mit zwei sehr unterschiedlichen Gruppen von Jungen beschäftigten.
Die erste Gruppe bestand aus 268 Studenten am Harvard College, die man deshalb ausgewählt hatte, weil sie sich aller Wahrscheinlichkeit nach zu gesunden und ausgeglichenen Erwachsenen entwickeln würden. Ganz im Geist der Zeit, seinen Zeitgenossen aus der medizinischen Fachwelt aber weit voraus, wollte Arlie Bock, Harvards neuer Professor für Hygiene und Leiter der Student Health Services, den wissenschaftlichen Fokus nicht mehr darauf richten, was die Menschen krank macht, sondern darauf, was sie gesund erhält. Mindestens die Hälfte der ausgewählten Studienteilnehmer konnte Harvard nur mithilfe eines Stipendiums besuchen und indem sie sich mit Nebenjobs etwas für die Studiengebühr dazuverdiente; andere Teilnehmer kamen aus wohlhabenden Familien. Einige konnten ihre Wurzeln in Amerika bis zur Gründung der Nation zurückverfolgen, während 13 Prozent der Probanden Eltern hatten, die in die USA eingewandert waren.
Die zweite Gruppe bestand aus 456 Jungen aus Boston, darunter auch Henry Keane, für die man sich aus einem anderen Grund entschieden hatte: Sie stammten aus einigen sehr schwierigen Familien und am meisten benachteiligten Vierteln in Boston, hatten es aber im Alter von 14 Jahren größtenteils geschafft, sich von Jugendkriminalität fernzuhalten. Mehr als 60 Prozent dieser Heranwachsenden hatten zumindest einen Elternteil, der in die USA eingewandert war, meist aus armen Ländern Ost- und Westeuropas sowie Regionen des Nahen Ostens, etwa aus Syrien, Jordanien, dem Irak und der Türkei. Durch diese Herkunft und den Status als Einwanderer wurden sie gleich doppelt marginalisiert. Mit der von dem Rechtsanwalt Sheldon Glueck und der Sozialarbeiterin Eleanor Glueck initiierten Studie versuchte man herauszufinden, welche Faktoren eine Laufbahn als Krimineller verhinderten – und zumindest an dieser Front waren die Jungen ja erfolgreich gewesen.
Die beiden Studien begannen getrennt und mit unterschiedlichen Zielsetzungen, wurden später aber miteinander verschmolzen und firmieren heute unter ein und demselben Banner.
Als sie sich zur Teilnahme an ihrer jeweiligen Studie bereit erklärten, wurden alle zu Befragenden einem Aufnahmegespräch sowie einer ärztlichen Untersuchung unterzogen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler besuchten die Probanden zu Hause und unterhielten sich mit deren Eltern. Dann wurden aus den Teenagern Erwachsene, die allen möglichen Berufen nachgingen. Sie wurden Fabrikarbeiter oder Anwalt, Maurer oder Arzt. Manche wurden alkoholsüchtig, einige wenige entwickelten eine Schizophrenie. Einige erklommen die soziale Leiter von ganz unten bis ganz nach oben, andere traten die Reise genau umgekehrt an.
Die Gründer der Studie wären erstaunt und erfreut, dass sie auch heute noch läuft und einzigartige sowie immens wichtige Ergebnisse hervorbringt, die sie sich nie hätten träumen lassen. Und als derzeitiger Leiter der Studie (Bob) sowie dessen Stellvertreter (Marc) sind wir unendlich stolz darauf, Ihnen einige unserer Ergebnisse näherbringen zu dürfen.
Der lange Blick auf den Menschen
Der Mensch steckt voller Überraschungen und Widersprüche. Er ergibt nicht immer Sinn, noch nicht einmal (oder vielleicht vor allem nicht) für sich selbst. Die Harvard-Studie gibt uns ein einmaliges und ausgesprochen praktisches Werkzeug an die Hand, mit dem wir zumindest einige der natürlichen Rätsel des Menschen lösen können. Warum das so ist, wollen wir mit einem raschen Blick auf den wissenschaftlichen Kontext klären.
Studien zur Gesundheit und zum menschlichen Verhalten kann man in der Regel entweder der Kategorie Querschnitt- oder Längsschnittstudie zuordnen.5 Querschnittstudien schneiden sich gewissermaßen wie aus einem Kuchen zu einem gegebenen Zeitpunkt ein Stück aus der Welt, um sich dieses anzusehen. Die meisten Psychologie- und Gesundheitsstudien fallen in diese Kategorie, weil sie relativ kosteneffizient durchzuführen sind. Sie sind zeitlich begrenzt, der finanzielle Aufwand ist ebenfalls vorhersagbar. Allerdings kranken sie an einer grundsätzlichen Einschränkung, die Bob immer gern mit einem alten Witz demonstriert: Führte man ausschließlich Querschnittstudien durch, müsste man unweigerlich zu dem Schluss kommen, dass es Menschen in Miami gibt, die als Kubaner geboren wurden und als Juden sterben. Anders ausgedrückt: Querschnittstudien sind »Schnappschüsse« des Lebens, die Verbindungen zwischen zwei zusammenhanglosen Fakten suggerieren, da sie eine entscheidende Variable außen vor lassen: die Zeit.
Längsschnittstudien hingegen sind, wie der Name schon sagt, lang. Sie untersuchen das Leben bestimmter Menschen über einen gewissen Zeitraum hinweg. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten: Die erste, häufigere, haben wir bereits erwähnt: Man bittet die Menschen, aus ihrer Vergangenheit zu erzählen. Das wird auch retrospektive Studie genannt.
Doch wie ebenfalls bereits erwähnt, basieren diese Studien auf dem Gedächtnis. Dazu als Beispiel wieder Henry und Rosa. In den getrennten Interviews, die Charlotte 2004 führte, bat sie die beiden zu beschreiben, wie sie einander begegnet waren. Rosa zufolge war sie vor Henrys Truck auf dem Eis ausgerutscht, woraufhin Henry ihr aufgeholfen hatte, und später hatte sie ihn in einem Restaurant wiedergesehen, in das sie mit ihren Freundinnen zum Essen ausgegangen war.
»Es war lustig, wir haben viel gelacht«, so Rosa, »weil er zwei verschiedenfarbige Socken anhatte und ich dachte: ›Junge, der ist aber in einer schlechten Verfassung, er braucht dringend jemanden wie mich!‹«
Henry konnte sich ebenfalls daran erinnern, dass Rosa auf dem Eis ausgerutscht war.
»Irgendwann später habe ich sie dann in einem Café sitzen sehen, und sie hat mich dabei erwischt, wie ich ihr auf die Beine starrte. Ich habe aber nur gestarrt, weil sie zwei verschiedenfarbige Strümpfe anhatte, einen roten und einen schwarzen.«
Diese Art von Unstimmigkeit ist bei Paaren weit verbreitet, vermutlich kennt sie jeder, der schon einmal eine längere Beziehung hatte. Und jedes Mal wenn man sich bezüglich der Fakten des gemeinsamen Lebens nicht einig ist, wird man Zeuge des Versagens einer retrospektiven Studie.
Die Harvard-Studie aber ist nicht retro-, sie ist prospektiv. Hier werden die Teilnehmenden nach dem Leben, wie es ist, nicht, wie es war, gefragt. Wie in Henrys und Rosas Fall fragen wir manchmal zwar auch nach der Vergangenheit, dies aber nur, um zu erfahren, wie Ereignisse verarbeitet und in der Zukunft erinnert werden. Im Allgemeinen jedoch wollen wir ausschließlich etwas über die Gegenwart erfahren. Im genannten Beispiel wissen wir tatsächlich, welche Version der Socken-Strumpf-Geschichte die zutreffende ist, weil wir Henry dieselbe Frage – wie er Rosa kennengelernt hat – im Jahr ihrer Hochzeit gestellt haben.
»Ich hatte verschiedenfarbige Socken an, und das hat sie gemerkt«, lautete Henrys Antwort 1954. »Das würde mir heute dank Rosa nicht mehr passieren.«
Prospektive, lebensumspannende Studien wie die unsere sind extrem selten. Manchmal verlassen Teilnehmer die Studie, sie ändern den Namen oder ziehen um, ohne Bescheid zu sagen. Die finanziellen Mittel versiegen, die Forscherinnen und Forscher verlieren das Interesse. Im Durchschnitt behalten die meisten erfolgreichen prospektiven Längsschnittstudien nur etwa 30 bis 70 Prozent ihrer Teilnehmenden.6 Und dabei dauern manche dieser Studien nur einige Jahre. Die Harvard-Studie jedoch kann auf eine 84-prozentige Teilnehmerrate und das über 84 Jahre hinweg stolz sein – und sie ist immer noch in einer guten Verfassung.
Sehr viele Fragen
Jede Lebensgeschichte in unserer Längsschnittstudie fußt auf dem gesundheitlichen Zustand und den Gewohnheiten des Teilnehmers oder der Teilnehmerin. Es wird quasi eine Karte erstellt, in der die körperlichen Gegebenheiten sowie die Verhaltensweisen im Verlauf des Lebens verzeichnet sind. Um das gesundheitliche Bild zu vervollständigen, fragen wir regelmäßig Aspekte wie Gewicht, Maß an Bewegung, Nikotin- sowie Alkoholkonsum, Cholesterinspiegel, Operationen und eventuelle Komplikationen dabei ab – im Grunde also die gesamte Patientenakte. Wir halten aber auch andere grundlegende Fakten fest, etwa die berufliche Betätigung, die Anzahl enger Freunde, Hobbys und Freizeitbeschäftigungen. Auf einer tiefergehenden Ebene entwerfen wir zudem Fragen, mit denen wir die subjektive Wahrnehmung der Testpersonen und die weniger quantifizierbaren Aspekte ihres Lebens erforschen. Wir fragen nach der Zufriedenheit bei der Arbeit, in der Ehe, nach Methoden der Konfliktlösung, den psychischen Auswirkungen von Eheschließung und Scheidung, Geburten und Todesfällen. Wir fragen nach den berührendsten Erinnerungen an Mutter und Vater, nach der emotionalen Bindung (oder deren Fehlen) zu Geschwistern. Wir bitten unsere Teilnehmenden, uns detailliert von den schlimmsten Augenblicken in ihrem Leben zu erzählen und uns zu sagen, wen, wenn überhaupt jemanden, sie anrufen könnten, wenn sie mitten in der Nacht voller Angst aufwachen würden.
Wir halten die spirituellen Überzeugungen und politischen Vorlieben der Probandinnen und Probanden fest, wie oft sie in die Kirche gehen und sich an Gemeindeaktivitäten beteiligen, welche Ziele im Leben sie haben und was ihnen Sorgen bereitet. Viele unserer Teilnehmer waren im Krieg, sie kämpften und töteten und mussten mitansehen, wie ihre Kameraden getötet wurden – wir haben ihre Berichte aus erster Hand darüber sowie ihre Gedanken über das Erlebte.
Alle zwei Jahre verschicken wir umfangreiche Fragebogen, die auch Platz für offene, persönliche Antworten lassen, alle fünf Jahre nehmen wir Einsicht in die Patientenakten und etwa alle 15 Jahre treffen wir die Teilnehmenden von Angesicht zu Angesicht, beispielsweise auf einer Veranda in Florida oder in einem Café im nördlichen Wisconsin. Dann machen wir uns Notizen darüber, wie sie aussehen und sich verhalten, ob sie Blickkontakt meiden, was sie anhaben, in welchen Umständen sie leben.
Wir wissen, wer eine Alkoholsucht entwickelte und wer trockener Alkoholiker ist. Wir wissen, wer Reagan, wer Nixon, wer John F. Kennedy gewählt hat. Wir wissen sogar, wen Kennedy gewählt hat, denn er war einer unserer Teilnehmer, bis die Kennedy Library die Aufzeichnungen über ihn übernommen hat.
Wir fragten jedes Mal danach, wie es den Kindern ging, wenn die oder der Teilnehmende welche hatte. Heute fragen wir die Kinder selbst – Babyboomer-Frauen und -Männer –, und eines Tages, so hoffen wir, werden wir auch die Kinder ihrer Kinder fragen.
Wir haben Blutproben, DNA-Proben sowie jede Menge EKGs, MRTs, EEGs und Hirndiagnosen durch bildgebende Verfahren. Wir verfügen sogar über 25 Gehirne, in einem letzten Akt der Großzügigkeit von Teilnehmenden gespendet.
Was wir nicht wissen können, ist, wie oder ob diese Dinge in zukünftigen Studien genutzt werden. Die Wissenschaft entwickelt sich ebenso wie die Kultur stetig weiter, und so haben sich die meisten Daten aus der Vergangenheit der Studie zwar als nützlich erwiesen, doch beruhten einige Variablen, die zu Beginn der Studie höchst sorgfältig gemessen worden sind, auf ganz und gar fehlerhaften Annahmen.
1938 beispielsweise galt der Körpertyp als wichtiger Indikator nicht nur für die Intelligenz der betreffenden Person, sondern auch für deren Zufriedenheit im Leben – die mesomorphen, athletisch gebauten Typen hatten angeblich Vorteile in den meisten Lebensbereichen. Anhand der Form und der Wölbungen des Schädels wollte man die Persönlichkeit und geistigen Fähigkeiten eines Probanden erkennen. Eine der Aufnahmefragen lautete, aus welchen Gründen auch immer: »Sind Sie kitzlig?«. Diese Frage haben wir 40 Jahre lang gestellt, nur für den Fall.
Rückblickend können wir nach mehr als 80 Jahren nun sagen, dass derlei Vorstellungen als leicht seltsam bis schlichtweg falsch bezeichnet werden können. Deshalb ist es durchaus möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass einige der Daten, die wir heute erheben, in 80 Jahren ähnlich kopfschüttelnd oder ablehnend betrachtet werden.
Der Punkt ist: Jede Studie ist ein Produkt ihrer Zeit und der Menschen, die sie durchführen. Im Fall der Harvard-Studie waren diese Menschen überwiegend weiß, mittleren Alters, gebildet, heterosexuell und männlich. Aufgrund kultureller Voreingenommenheit und aufgrund der Tatsache, dass 1938 sowohl die Stadt Boston als auch das Harvard College fast ausschließlich aus weißen Einwohnern beziehungsweise Studierenden bestand, wählten die Studiengründer den bequemen Weg und befragten nur andere männliche Weiße. Ein damals verbreitetes Vorgehen und eine Geschichte, mit der sich die Harvard-Studie auseinandersetzen muss, auch wenn wir heute nach Kräften bemüht sind, sie zu korrigieren. Und obwohl es Ergebnisse gibt, die nur auf eine oder beide der Gruppen zutreffen, mit denen die Studie in den 1930er-Jahren begonnen wurde, so haben diese keinen Eingang in das vorliegende Buch gefunden. Zum Glück können wir die Ergebnisse der ursprünglichen Auswahl der Harvard-Studie heute mit unserer erweiterten Auswahl vergleichen, zu der auch die Frauen, Söhne und Töchter der ursprünglichen Teilnehmer gehören, ebenso wie mit Studien, die Menschen mit diverserem kulturellem und wirtschaftlichem Hintergrund, Geschlechtsidentitäten und Ethnien umfassen. Im Verlauf dieses Buchs werden wir die Ergebnisse, die von anderen Studien gestützt werden, besonders hervorheben – Ergebnisse, die auf Frauen, People of Color, Menschen, die sich als LGBTQ+ identifizieren, und eine ganze Palette sozioökonomischer Gruppen weltweit gleichermaßen zutreffen, auf alle von uns. Mit diesem Buch wollen wir offenlegen, was wir im Rahmen der Harvard-Studie über das Menschsein, über die universelle Erfahrung des Daseins gelernt haben.
Marc war über 25 Jahre lang Dozent an einem Frauencollege, und jedes Jahr boten sich neue intelligente, begeisterte Studentinnen an, zu seinen Forschungen zum Wohlergehen des Menschen und zur Entwicklung des menschlichen Lebens beizutragen. Eine dieser Studentinnen war Ananya aus Indien.7 Sie war besonders an dem Zusammenhang zwischen erlebtem Unglück und erwachsenem Zufriedensein interessiert. Marc erzählte Ananya von den umfangreichen Daten der Harvard-Studie, die das gesamte Erwachsenenleben Hunderter von Befragten widerspiegelten. Diese aber waren männlich, weiß und mehr als 70 Jahre vor Ananya auf die Welt gekommen. Sie fragte sich laut, was sie wohl aus dem Leben von Menschen lernen könne, die so ganz anders waren als sie selbst – aus dem Leben alter, weißer Männer, die vor langer Zeit geboren worden waren.
Marc schlug ihr vor, über das Wochenende die Akten eines einzigen Teilnehmers an der Harvard-Studie zu lesen, über die sie dann in der darauffolgenden Woche sprechen könnten. Ananya erschien voller Enthusiasmus zum nächsten Treffen und bat Marc, bevor dieser überhaupt den Mund aufmachen konnte, ihre Forschungsarbeit über die Männer der Harvard-Studie schreiben zu dürfen. Ihren Sinneswandel herbeigeführt hatte die Erfülltheit des Lebens, von dem sie in den Akten gelesen hatte. Obwohl sich die Einzelheiten im Leben dieses einzelnen Teilnehmers in so vielerlei Hinsicht von den ihren unterschieden – er war auf einem anderen Kontinent volljährig geworden, hatte weiße, keine braune Haut, war ein Mann, keine Frau, und hatte nie eine Uni besucht –, erkannte Ananya sich in dem seelisch Erlebten und den Herausforderungen dieses Mannes doch selbst wieder.
Ananyas Geschichte hat sich beinahe Jahr für Jahr wiederholt. Gerade in den letzten Jahren beschäftigten sich nicht nur die Psychologie, sondern auch die Medien mit der anhaltenden Ungleichberechtigung im Zusammenhang mit ethnischem und kulturellem Hintergrund. Bob selbst war ähnlich zögerlich, als ihm der Posten des Leiters der Harvard-Studie angeboten wurde. Auch er hatte Zweifel bezüglich der Relevanz der dokumentierten Lebensläufe und der Eignung einiger der angewandten Forschungsmethoden. Doch las auch er sich über das Wochenende ein paar Akten durch und war begeistert – ebenso wie Ananya es war und Sie es hoffentlich sein werden.
Ein ganzes Jahrhundert ist vergangen, seit die Teilnehmenden der ersten Stunde auf die Welt gekommen sind. Die Menschen sind so komplex wie eh und je, und so geht uns die Arbeit nie aus. Während die Harvard-Studie in ein neues Jahrzehnt voranschreitet, verfeinern und erweitern wir unsere Sammlung an Informationen immer mehr. Denn wir wissen, dass jedes einzelne Datenstück, jede persönliche Überlegung, jedes Gefühl im jeweiligen Moment das Bild der Conditio humana vervollständigt und in der Zukunft helfen kann, Fragen zu beantworten, die wir uns jetzt noch gar nicht vorstellen können. Aber natürlich kann kein Bild des menschlichen Lebens je vollständig sein.
Dennoch hoffen wir, dass Sie uns auf unserem Weg begleiten, einige der schwierigsten Fragen zur Entwicklung des Menschen zu beantworten. Warum scheinen Beziehungen der Schlüssel zu einem gelungenen Leben zu sein? Welche Faktoren in der frühen Kindheit tragen zur körperlichen und seelischen Gesundheit in den mittleren und späten Lebensjahren bei? Welche Faktoren sind untrennbar mit einer längeren Lebensdauer verknüpft? Oder mit gesunden Beziehungen? Kurzum:
Was macht ein gutes Leben aus?
Fragt man Menschen, was sie sich im Leben am meisten wünschen, bekommt man vielfach zur Antwort: »Ich möchte einfach nur glücklich sein.« Zugegebenermaßen würde Bob auf diese Frage dieselbe Antwort geben. Sie ist unglaublich vage und sagt doch irgendwie alles. Marc würde wahrscheinlich einen Augenblick nachdenken und dann sagen: »Das kann nicht alles sein.«
Doch was genau bedeutet »glücklich sein«? Wie sähe Ihr Leben aus, wenn Sie vollkommen glücklich wären?
Eine Möglichkeit, das zu klären, könnte darin bestehen, Menschen schlicht danach zu fragen, was sie glücklich machen würde, und sich dann auf die Suche nach Gemeinsamkeiten zu begeben. Wie wir allerdings noch sehen werden, gibt es eine bittere Wahrheit, die wir alle akzeptieren müssen: Wir sind nämlich unglaublich schlecht darin zu wissen, was gut für uns ist. Damit werden wir uns später noch befassen.
Wichtiger noch sind die unausgesprochenen, verinnerlichten Mythen darüber, was ein Leben zu einem glücklichen Leben macht. Davon gibt es viele, der größte unter ihnen ist aber wahrscheinlich die Vorstellung, dass Glück etwas ist, das man sich verdienen könne – wie eine Auszeichnung, die man sich rahmt und an die Wand hängt. Oder wie ein Ziel, das man erreicht, wenn man alle Hindernisse auf dem Weg dorthin überwunden hat, und wo man sich dann für den Rest seines Lebens ausruhen kann.
So funktioniert das natürlich nicht.
Vor mehr als 2000 Jahren benutzte Aristoteles einen Begriff, der in der Psychologie auch heute noch weit verbreitet ist: eudaimonia. Er beschreibt den Zustand tiefsten Wohlbefindens – den Zustand der Glückseligkeit –, in dem der Mensch das Gefühl hat, sein Leben habe einen Sinn und ein Ziel. Meist steht er im Gegensatz zum Begriff der hedonia, aus dem sich der Hedonismus ableitet und der sich auf das flüchtige Glück verschiedener sinnlicher Freuden bezieht. Man könnte es auch so ausdrücken: Hedonistisches Glück ist, wenn wir es uns gut gehen lassen, eudaimonisches Glück ist, wenn wir ein gutes Leben leben. Es bezeichnet das Gefühl, dass, unabhängig von diesem Augenblick, wie schön oder schrecklich er auch immer sein mag, das Leben etwas wert ist, dass es kostbar ist. Eudaimonie stellt die Art von Wohlbefinden dar, die sowohl in den Höhen des Lebens als auch in seinen Tiefen Bestand hat.
Doch keine Sorge: Wir werden nicht die ganze Zeit von Ihrem eudaimonischen Glück sprechen. Doch noch kurz dazu, wovon wir sprechen und was es bedeutet.
In der Psychologie gibt es hin und wieder Einwände gegen das Wort »Glück«, weil es im Grunde alles heißen kann, von einer vorübergehenden Freude bis hin zu einem beinahe mystischen Gefühl der eudaimonischen Erfüllung, die in Wirklichkeit nur sehr wenige Menschen erlangen. Deshalb haben sich in der psychologischen Populärliteratur statt Glück nuanciertere Begriffe wie »Gedeihen«, »Aufblühen« oder »Wohlergehen« und »Wohlfühlen« durchgesetzt. Diese Begriffe verwenden wir auch in diesem Buch. Marc spricht besonders gern von gedeihen oder aufblühen, weil sie ein aktives und konstantes Werden und nicht nur eine Stimmung suggerieren. Gelegentlich sprechen wir aber auch noch von »Glück« – aus dem schlichten Grund, weil die meisten Menschen diesen Begriff benutzen. Niemand fragt Sie nach Ihrem »menschlichen Gedeihen«. Wir fragen: »Bist du glücklich?« In unseren Unterhaltungen sprechen wir genau so über unsere Forschung. Wir reden von Gesundheit, Glück und Zufriedenheit, von Sinn, Zweck und Ziel. Was wir damit jedoch meinen, ist das eudaimonische Glück. Und im Grunde meinen die meisten Menschen das ebenfalls. Spricht ein Paar über das soeben geborene Enkelchen und sagt: »Wir sind sehr glücklich«, oder bezeichnet eine Frau in der Gesprächstherapie ihre Ehe als »unglücklich«, ist klar, dass sich das Wort »Glück« auf eine dauerhafte Lebensqualität bezieht und nicht auf ein vorübergehendes Gefühl. In diesem Sinn verwenden wir das Wort in diesem Buch.
Aus Daten wird ein Leben
Vielleicht fragen Sie sich, warum wir uns so sicher sind, dass Beziehungen eine solch zentrale Rolle für unsere Gesundheit und unsere Zufriedenheit spielen. Wie ist es möglich, Beziehungen von wirtschaftlichen Erwägungen, Glück oder Pech, einer schwierigen Kindheit oder jedem anderen wichtigen Umstand zu trennen, der darüber entscheidet, wie wir uns tagtäglich fühlen? Ist es überhaupt möglich, die Frage Was macht ein gutes Leben aus? zu beantworten?
Nachdem wir Hunderte von Menschenleben unter die Lupe genommen haben, können wir bestätigen, was wir alle tief in uns drin bereits wissen: Eine Unmenge von Faktoren tragen zur Zufriedenheit des Menschen bei. Das fragile Gleichgewicht von ökonomischen, sozialen, psychologischen und gesundheitlichen Aspekten ist komplex und ewig im Wandel begriffen. Selten kann man mit absoluter Bestimmtheit sagen, dass dieser oder jener Faktor dieses oder jenes Ergebnis hervorbringt – der Mensch steckt wie gesagt voller Überraschungen. Davon abgesehen gibt es jedoch tatsächlich Antworten auf die oben gestellte Frage. Sieht man sich dieselben Arten von Daten im Laufe der Zeit immer wieder an, Daten einer großen Anzahl von Menschen und aus vielen Studien, treten irgendwann Muster hervor und Prädikatoren – Anzeichen, anhand derer eine Vorhersage getroffen werden kann – für das menschliche Gedeihen zeigen sich. Aus den vielen Prädikatoren für Gesundheit und Zufriedenheit, von ausgewogener Ernährung über regelmäßige Bewegung bis zum ausreichenden Einkommen, sticht ein Leben voller erfüllter Beziehungen als besonders wirkungsvoll und nachhaltig hervor.
Die Harvard-Studie ist nicht die einzige Längsschnittstudie zum seelischen Gedeihen des Menschen, die sich über mehrere Jahrzehnte erstreckt. Wir sehen uns bewusst und beständig auch andere Studien an, um zu prüfen, ob die Ergebnisse auf andere Zeiträume und andere Menschen ebenfalls zutreffen. Jede Studie hat ihre ganz spezifischen Eigenheiten. Wiederholen sich die Ergebnisse in einer Vielzahl von Studien, sind sie wissenschaftlich zwingend.
Hier einige repräsentative Beispiele von Längsschnittstudien, die zusammen für zigtausend Menschen stehen:
Die British Cohort Studies8 (britische Kohortenstudien) umfassen fünf große, landesweit repräsentative Gruppen, die in bestimmten Jahren geboren wurden (beginnend mit einer Gruppe von Babyboomern, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg zur Welt kamen, bis jüngst zu einer Gruppe von Kindern, die Anfang der 2000er-Jahre geboren wurden); die Studien folgten den Probandinnen und Probanden ihr ganzes Leben lang.Die Mills Longitudinal Study folgte einer Gruppe von Frauen nach ihrem Highschoolabschluss im Jahr 1958.Die Dunedin Multidisciplinary Health and Development Study begann 1972 damit, 91 Prozent der Kinder aus einer kleinen Stadt in Neuseeland zu beobachten, und beobachtet sie heute noch ins mittlere Alter hinein (beziehungsweise jüngst die Kinder der ursprünglichen Testpersonen).9Die Kauai Longitudinal Study lief drei Jahrzehnte lang und umfasste alle Kinder, die 1955 auf der hawaiianischen Insel Kauai geboren worden waren. Die meisten Befragten hatten japanische, philippinische und/oder hawaiianische Wurzeln.10Die Chicago Health, Aging, and Social Relations Study (CHASRS) begann 2002 und untersuchte eine gemischte Gruppe von Männern und Frauen mittleren Alters über zehn Jahre lang.11Die Studie Healthy Aging in Neighborhoods of Diversity Across the Life Span (HANDLS) widmet sich seit 2004 der Art und des Ursprungs gesundheitlicher Unterschiede Tausender schwarzer und weißer Erwachsener im Alter zwischen 35 und 64 in Baltimore.12Die Student Council Study schließlich folgte ab 1947 Frauen und Männern, die zu Vertretern des Studierendenrats an den Universitäten in Bryn Mawr, Haverford und Swarthmore gewählt worden waren.13 Die Studie war teilweise von den Forschern designt worden, die auch die Harvard-Studie entwickelt hatten, und explizit auf Frauen ausgerichtet, da diese in die ursprüngliche Harvard-Studie nicht aufgenommen worden waren. Die Student Council Study wurde über mehr als drei Jahrzehnte hinweg durchgeführt, und das originale Archivmaterial ist erst vor Kurzem wiederentdeckt worden. Aufgrund ihrer Verbindung zur Harvard-Studie werden Sie einigen Probandinnen der Student Council Study auch in diesem Buch begegnen.Alle diese Studien belegen ebenso wie unsere Harvard-Studie, wie wichtig emotionale Beziehungen für den Menschen sind. Sie zeigen, dass Menschen, die enge Bindungen zu Familie, Freunden und der Gemeinde pflegen, insgesamt zufriedener – glücklicher – und körperlich gesünder sind als weniger gut eingebundene Menschen. Personen, die isolierter sind, als sie es sich wünschen, werden schneller und leichter krank als diejenigen, die sich mit anderen verbunden fühlen. Zudem sterben einsame Menschen früher. Leider nimmt dieses Gefühl der Isolation weltweit zu. Rund jede vierte Person in den USA klagt über Einsamkeit – das sind über 60 Millionen Betroffene. In China ist die Einsamkeit älterer Erwachsener in den vergangenen Jahren drastisch angestiegen14, in Großbritannien wurde gar ein Ministerium für Einsamkeit gegründet, da sich dieses Thema mittlerweile zu einem erheblichen Problem für die öffentliche Gesundheit entwickelt hat.
Wir sprechen hier von unseren Nachbarn, unseren Kindern, uns selbst. Es gibt unzählige gesellschaftliche, wirtschaftliche und technologische Gründe für die Einsamkeit, doch unabhängig davon könnte die Datenlage nicht eindeutiger sein: In unserer modernen, »vernetzten« Welt geht das Gespenst der Einsamkeit und sozialen Isolation um.
Vielleicht fragen Sie sich in diesem Augenblick, ob Sie etwas an Ihrem eigenen Leben ändern können. Sind die Eigenschaften, die aus uns einen geselligen oder zurückgezogenen Menschen machen, schlicht Bestandteil unserer Persönlichkeit? Ist es vorherbestimmt, ob wir geliebt werden oder einsam sind, glücklich oder unglücklich? Prägen uns die Erfahrungen, die wir in der Kindheit gemacht haben, für immer? Diese Fragen stellt man uns häufig. Und meist sind sie Ausdruck der Angst, dass es schon zu spät sein könnte.
Daran hatte auch die Harvard-Studie schwer zu knabbern. Ihr vorheriger Leiter, George Vaillant, hat einen Großteil seines Berufslebens damit verbracht herauszufinden, ob sich die Art, wie wir auf Schwierigkeiten reagieren – unsere Bewältigungsstrategien –, ändern kann. Dank seiner und der Arbeit anderer können wir auf die Frage Ist es zu spät für mich? mit einem klaren Nein antworten.
Es ist nie zu spät. Es stimmt, dass unsere Gene und Erfahrungen unsere Sicht der Dinge prägen, unsere Interaktion mit anderen, die Art und Weise, wie wir auf negative Gefühle reagieren. Ebenso stimmt es sicherlich, dass nicht alle Menschen die gleichen Chancen auf wirtschaftliches Vorankommen und grundlegende menschliche Würde haben; manche werden in eine signifikante Benachteiligung hineingeboren. Dennoch ist die Art, wie sich unser Dasein auf diesem Planeten gestaltet, nicht in Stein gemeißelt – eher in den Sand geschrieben. Unsere Kindheit ist nicht unser Schicksal. Unser Naturell ist nicht unser Schicksal. Das Viertel, in dem wir aufgewachsen sind, besiegelt ebenso wenig unser Schicksal. Das zeigen Forschungen nur allzu deutlich. Nichts, was im Leben geschehen ist, schließt aus, dass wir uns mit anderen verbinden, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Wir denken häufig, dass das Leben mit dem Erreichen des Erwachsenenalters stagniere, dass sein weiterer Verlauf und unsere Lebensweise damit vorgezeichnet seien. Die Studien zur Entwicklung Erwachsener sagen jedoch, dass das ganz und gar nicht stimmt.15 Entscheidende Veränderungen sind nach wie vor möglich.
Kommen wir noch einmal auf eine Formulierung zurück, die wir eben gebraucht haben: Menschen, die isolierter sind, als sie es sich wünschen. Diese Formulierung haben wir aus einem bestimmten Grund gewählt, denn bei der Einsamkeit geht es nicht nur um die physische Trennung von anderen. Die Anzahl der Menschen, die wir kennen, bestimmt nicht notwendigerweise über unser Gefühl der Verbundenheit oder der Einsamkeit. Ebenso wenig wie wir wohnen oder ob wir Kinder haben. Man kann auch in einer großen Menschenmenge einsam sein oder in einer Ehe.16 Tatsächlich wissen wir, dass sich konfliktreiche Ehen mit wenig Zuneigung schlimmer auf die Gesundheit auswirken können als Scheidungen.
Worauf es ankommt, ist die Qualität der Beziehungen. Vereinfacht ausgedrückt könnte man sagen: Wer inmitten herzlicher Beziehungen lebt, schützt damit Geist, Seele und Körper.
Schutz – ein ausgesprochen wichtiges Konzept. Das Leben ist hart und manchmal greift es frontal von vorn an. Herzliche, enge Beziehungen schützen uns vor den Pfeilen und Schleudern des Lebens und Älterwerdens.
Als wir den Probandinnen und Probanden der Harvard-Studie bis ins hohe Alter hinein, 80 Jahre und älter, gefolgt waren, wollten wir sie uns im mittleren Alter noch einmal ansehen, um herauszufinden, ob man vorhersagen konnte, wer sich zu einem zufriedenen, gesunden 80-Jährigen entwickeln würde und wer nicht. Also sammelten wir alles, was wir über sie als 50-Jährige wussten, und siehe da: Es war nicht der Cholesterinspiegel, der darüber entschied, wie sie alt werden würden, es war ihre Zufriedenheit in Beziehungen. Die Menschen, die mit 50 am zufriedensten in ihren Beziehungen waren, waren mit 80 die sowohl geistig als auch körperlich gesündesten.17
Als wir diesen Zusammenhang näher untersuchten, nahmen die Beweise für die These oben immer mehr zu. Die Männer und Frauen, die in den glücklichsten Partnerschaften lebten, berichteten mit 80, dass sie immer glücklich waren, auch an Tagen, an denen sie vermehrt körperliche Schmerzen hatten.18 Menschen in unglücklichen Beziehungen hingegen beklagten, dass sich mit körperlichen Schmerzen auch ihre Stimmung verschlechterte, sodass zum körperlichen nun auch noch ein emotionaler Schmerz hinzukam. Andere Studien kommen hinsichtlich der großen Rolle, die Beziehungen spielen, zu ähnlichen Schlüssen. Hier dazu einige deutliche Beispiele aus den oben erwähnten Längsschnittstudien:19
Mit einer Kohorte von 3720 schwarzen und weißen Erwachsenen im Alter zwischen 35 und 64 Jahren ergab die Studie Healthy Aging in Neighborhoods of Diversity Across the Life Span (HANDLS), dass Teilnehmende, die eine größere Unterstützung aus dem sozialen Umfeld angaben, auch weniger an Depressionen litten.
Im Rahmen der Chicago Health, Aging, and Social Relations Study (CHASRS), einer repräsentativen Studie mit Einwohnerinnen und Einwohnern von Chicago, gaben die Befragten, die in erfüllenden Beziehungen lebten, an, glücklicher zu sein.
In der Geburtskohortenstudie aus Dunedin, Neuseeland, waren soziale Verbindungen im Jugendalter ein besserer Prädikator für Wohlbefinden im Erwachsenenalter als akademische Leistungen.
Und die Liste setzt sich fort … Doch natürlich ist die Wissenschaft nicht der einzige Bereich menschlicher Erkenntnis, der etwas über das gute Leben aussagen kann. Im Gegenteil – sie ist eher ein Neuling auf diesem Gebiet.
Die Weisheit der Alten
Die Erkenntnis, dass gesunde Beziehungen gut für uns sind, existiert in der Philosophie und in der Religion schon seit Jahrtausenden. Auf gewisse Weise ist es bemerkenswert, dass man im Verlauf der Menschheitsgeschichte hinsichtlich des Lebens immer wieder zu ganz ähnlichen Schlüssen gekommen ist. Andererseits erstaunt uns das auch wieder nicht, denn auch wenn unsere Technologien und Kulturen in stetigem Wandel begriffen sind – schneller als jemals zuvor –, so bleiben fundamentale Aspekte der menschlichen Erfahrung doch bestehen. Als Aristoteles das Konzept der eudaimonia entwickelte, stützte er sich zwar auf seine Beobachtungen der Welt, aber auch auf sein eigenes Empfinden – ein Empfinden, das heute noch dasselbe ist wie damals. Als Laozi vor mehr als 2400 Jahren sagte: »Je mehr du anderen gibst, desto mehr wirst du selbst haben«, formulierte er damit ein Paradoxon, das immer noch Bestand hat. Die Weisheit der alten Philosophen und Religionsstifter ist unser Erbe, und das sollten wir nutzen.
Wir greifen auf die Parallelen mit diesem uralten Wissen zurück, um unsere moderne Wissenschaft in einen größeren Zusammenhang zu stellen und die Bedeutung dieser Fragen und Erkenntnisse hervorzuheben. Von wenigen Ausnahmen abgesehen war Wissenschaft an den Altvorderen oder überlieferten Weisheiten nie besonders interessiert. Wie ein stürmischer junger Held hat sie sich nach der Aufklärung auf die eigene Suche nach Wissen und Wahrheit begeben. Auch wenn es Hunderte von Jahren gedauert hat, so schließt sich auf dem Gebiet des menschlichen Wohlbefindens heute doch allmählich der Kreis. Endlich holen wissenschaftliche Erkenntnisse die Weisheit der Alten ein.
Der holprige Weg des Entdeckens
Wir als Wissenschaftler gehen jeden Tag zur Arbeit, um uns mit der Frage auseinanderzusetzen, was ein gutes Leben ausmacht. Im Laufe der Jahre hat uns das eine oder andere Ergebnis immer wieder überrascht. Dinge, die wir für selbstverständlich gehalten haben, waren es in der Tat nicht. Dinge, von denen wir annahmen, sie seien falsch, haben sich als wahr herausgestellt. In den folgenden Kapiteln werden wir unsere Erkenntnisse mit Ihnen teilen.
In den nächsten fünf Kapiteln erkunden wir die elementare Natur von Beziehungen und erläutern, wie Sie die wichtigsten Lektionen aus diesem Buch auf Ihr eigenes Leben anwenden können. Wir sprechen darüber, wie das Erkennen, wo Sie derzeit in Ihrem Leben stehen, wo sie sich innerhalb der menschlichen Lebensspanne derzeit befinden, Ihnen dabei helfen kann, tagtäglich zu Lebenssinn und Zufriedenheit zu gelangen. Wir stellen Ihnen das ungeheuer wichtige Konzept der sozialen Fitness vor und warum sie ebenso entscheidend ist wie die körperliche Fitness. Wir erkunden, wie Neugier und Aufmerksamkeit Beziehungen verbessern und das Wohlbefinden steigern können, und bieten Ihnen Strategien an, wie Sie mit der Tatsache umgehen können, dass Beziehungen auch einige der größten Herausforderungen in unserem Leben darstellen.
Danach widmen wir uns bestimmten Arten von Beziehungen und gehen dabei verschiedenen Fragen nach: Was ist in langfristigen intimen Beziehungen wichtig? Welche Auswirkungen haben Erlebnisse aus der frühen Kindheit auf unser Wohlergehen? Wie können wir damit umgehen? Welche Möglichkeiten haben wir, am Arbeitsplatz Beziehungen zu knüpfen? Welche überraschenden Vorteile bieten die verschiedenen Arten von Freundschaften? Bei jedem Thema stützen wir unsere Erkenntnisse mit der dahinterstehenden Wissenschaft. Wir lassen Teilnehmende der Harvard-Studie zu Wort kommen und davon berichten, wie sich all das im echten Leben abspielt – und zwar in Echtzeit, über beinahe ein gesamtes Jahrhundert hinweg.
Als Leiter und stellvertretender Leiter der Harvard Study of Adult Development spielen die Studie und das, was sie uns über das Glücklichsein lehren kann, in unserem Leben eine große Rolle. Wir sind mit der Faszination von der Conditio humana gesegnet (und geschlagen). Der Psychiater und Psychoanalytiker Bob verbringt jeden Tag Stunden damit, sich mit Menschen über ihre zutiefst empfundenen Sorgen und Wünsche zu unterhalten. Zusätzlich zur Leitung der Harvard-Studie unterrichtet er angehende Psychiaterinnen und Psychiater in Psychotherapie. Er ist seit 35 Jahren verheiratet, hat zwei erwachsene Söhne und sitzt in seiner Freizeit oft auf einem Meditationskissen und praktiziert und lehrt Zen-Buddhismus.
Marc ist klinischer Psychologe und bildet als Professor seit 30 Jahren immer neue Generationen von Psychologen und Forscherinnen aus. Auch er ist als Therapeut tätig, schon lange verheiratet und Vater zweier Söhne. Als begeisterter Sportler findet man ihn in seiner Freizeit häufig auf dem Tennisplatz (und früher auf dem Basketballfeld).
Unsere gemeinsame Forschung und unsere Freundschaft haben vor fast 30 Jahren begonnen. Erstmals begegnet sind wir uns am Massachusetts Mental Health Center, einer lokalen gemeinnützigen Einrichtung mit Kultstatus, wo wir beide mit sozial und wirtschaftlich extrem benachteiligten Menschen arbeiteten, die zudem noch mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen hatten. Das motivierte uns beide, uns sowohl bei unserer klinischen Arbeit als auch bei unserer Forschung mit Erfahrungen von Menschen zu beschäftigen, die einen ganz anderen Hintergrund hatten als wir.
30 Jahre später sind wir immer noch Freunde, forschen immer noch gemeinsam und tun unser Bestes, um den riesigen Fundus an Lebensgeschichten, auch bekannt als Harvard Study of Adult Development, in ihr zweites Jahrhundert zu führen. Durch die Geschichten der Befragten und ihrer Familien lernen wir auch immer etwas über uns selbst und wie wir unser Leben führen können. Mit diesem Buch versuchen wir, Ihnen diese Lektionen näherzubringen, das unbezahlbare Geschenk, das die Teilnehmenden an der Harvard-Studie der Wissenschaft gemacht haben, auch an Sie weiterzugeben. Schließlich nahmen sie nicht nur uns Forschenden zuliebe an der Studie teil – sie taten es für alle Menschen, überall auf der Welt. Und ihr Leben ist das Herzstück dieses Buchs.