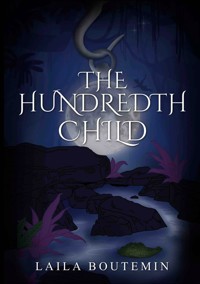
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Hundredth Child
- Sprache: Deutsch
"Ich gebe nicht eher Ruhe, bis ich den Kopf des Jungen oder den Mond selbst an meinem Haken habe." Harlow Lorelei ist allein. Mit fünfzehn und ohne Familie kämpft sie Tag für Tag ums Überleben- bis Peter Pan sie nach Nimmerland entführt. Doch die Insel, die einst wie ein Traum erscheint, entpuppt sich schnell als Albtraum. Düstere Prophezeiungen, der Meerjungfrauen warnen vor Verrat und Untergang. Doch sagen sie die Zukunft voraus-odererschaffen sie sie selbst? Peter ist längst nicht der Held, für den ihn alle halten. Und je tiefer Harlow in das Geheimnis der Insel eintaucht, desto mehr Zweifel wachsen: an Peter, an der Vergangenheit- und an sich selbst. Doch in einer Welt voller Lügen ist die größte Gefahr nicht der nächste Kampf- sondern die Frage, wem man sein Herz anvertrauen kann. Eine düstere Nacherzählung der Geschichte von Peter Pan- mit überraschenden Wendungen, Slow Burn und der Erkenntnis, dass manche Gefühle tödlicher sind als jede Klinge. Jetzt neu inklusive Playlist und Illustration!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 592
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Warnung: In diesem Buch können potenziell unangenehme Inhalte behandelt werden. Hinten im Buch findet ihr eine mit Spoilern enthaltende Liste.
(Nein, ich zahle keine Therapie.)
Für mein früheres Ich, und vielleicht auch für deins.
„Das Nimmerland wird dir dein Herz stehlen, um es zu brechen. Davor kann nicht einmal die unbezwingbare Harlow fliehen, doch sie rennt und ich rannte mit ihr.“
-Elena H. G.
Was du nicht tun solltest, wenn du dieses Buch liest:
Lese es nicht Kindern vor.
Nur weil es mit Feen, fliegenden Jungs und Inseln beginnt, heißt das nicht, dass es mit Gute-Nacht-Küssen endet.
Iss keine Kekse dabei.
Zu viele Krümel an der falschen Stelle und du wirst denken, es ist Feenstaub. Spoiler: Es ist keiner.
Glaub nicht, du weißt, wie die Geschichte endet.
Du weißt nichts, Wendy.
Glaub nicht an Helden.
Nicht jeder, der fliegt, ist ein Engel. Manche fallen nur langsamer.
Trag keine Uhr beim Lesen.
Tick. Tack. Tick. Tack. Du wirst nie wieder eine Uhr auf dieselbe Weise hören.
Zähl nicht die Toten.
Denn du wirst anfangen, sie mit denen zu verwechseln, die noch leben.
Wenn du das Gefühl hast, du bist am Ende angekommen- du bist gerade erst am Anfang.
Und das Wichtigste: Wenn du irgendwann glaubst, du hättest alles verstanden: lies das letzte Kapitel noch mal.
TRIGGERWARNUNG
(Falls du klare Antworten suchst – hier gibt’s nur Fragen.)
Achtung, mutige Abenteurerinnen und Abenteurer! Ihr steht kurz davor, eine Welt zu betreten, in der nichts so ist, wie es scheint. Hier gibt es Blut – nicht à la Hollywood-Splatter, aber auch nicht bloß einen harmlosen Kratzer. Der Tod? Taucht unangekündigt auf und benimmt sich nicht gerade höflich. Messerstechereien? Natürlich. Aber keine Sorge, die Piraten hier führen nicht nur Klingen, sondern auch eine ordentliche Ladung Beleidigungen mit sich.
Und falls ihr glaubt, irgendwem trauen zu können – vergesst es.
Captain Hook? Klingt charmant, aber der Mann ist ein Profi darin, euch mit Worten einzuwickeln, bis ihr nicht mehr wisst, wo oben und unten ist.
Peter Pan? Der Held der Geschichte? Vielleicht. Aber wenn ihm langweilig wird, seid ihr schneller allein, als ihr „zweiter Stern rechts“ sagen könnt. Ihm wird schnell langweilig.
Was ihr wissen müsst:
Für Erwachsene:
Diese Geschichte wird euch auf eine Achterbahnfahrt schicken. Mal fühlt ihr euch wie 12, mal wie 42, als hätte euch jemand mitten ins Spiel „Erwachsenwerden“ geworfen, ohne die Regeln zu erklären. Ihr werdet zwischen den Welten schweben – und wenn ihr das nicht zu ernst nehmt, macht es sogar Spaß. Das ein oder andere Mal werden spezifische Altersgruppen beleidigt. Fühlt euch dementsprechend bitte alle angesprochen.
Für Jugendliche:
Willkommen im Chaos. Mal seid ihr der verlorene Junge, mal der Pirat. Vielleicht auch der eine, der alle nervt, weil er zu viel über das Leben philosophiert (Kein Urteil von mir!). Eure Rolle hier ist so unklar wie alles andere in dieser Welt – und das ist genau richtig so.
Egal, wer ihr seid, es gibt nur eine Regel: Erwartet das Unerwartete. Und wenn ihr fliegen wollt? Dann braucht ihr eine Mischung aus Feenstaub, Wahnsinn und der Bereitschaft, einfach loszuspringen – ohne Plan.
Hiermit heiße ich euch alle willkommen an Board. Wer kalte Füße kriegt nimmt die Planke. Schwimmflügel gibt’s hier keine. (Krokodile schon, lol.)
Inhaltsverzeichnis
Der Junge, der niemals schlief
Aus dem Waisenhaus ins Himmelreich
Über den Wolken, unter den Sternen
Captain Hook und die Kunst der Dramatik
Fliegende Stiefel
Märchenerzählungen und Abenteuer
Wo der Ozean sein Schicksal dichtet
„Immer die Helfende, niemals die, der geholfen wurde“
Verblasste Visionen
Verlorene Schatten
Unbekannte Worte
Ein Spiel mit der Vergänglichkeit
Die Verlorenen
Das Dorf der Stammeskrieger
Hinter der Fassade
Blicke aus Smaragd
Der Sprung ins kalte Wasser
Ein Funken Magie
„Schon immer da“
Das Mädchen inmitten der Welten
Zwischen den Zeilen
Der Sprung ins kalte Wasser
Jenseits des Gewöhnlichen
Wo der Tod die Luft erfüllt
Wenn der Boden zu schwanken beginnt
Ein Herzschlag zu wenig
Nicht jeder, der fliegt, ist frei
Die Hand des Verrats
Ein letzter Hilferuf
Der Junge, der niemals schlief
Die Nacht hatte London mit einer undurchdringlichen Decke aus Finsternis überzogen, und das ferne Geläut einer Kirchenglocke schnitt wie ein langsamer, dumpfer Herzschlag durch die Stille. Es war Mitternacht, die Stunde, in der die Stadt schien, als halte sie den Atem an. Der trübe Mond kämpfte vergeblich gegen die Wolken, die wie schmutzige Watte über den Himmel trieben. Der schwache Schimmer, der hin und wieder durchbrach, reichte kaum aus, die Umgebung zu erhellen, doch er genügte, um den groben, grauen Stein der Wände um mich herum zu erkennen.
Der Schlafsaal war eine kalte, karge Höhle, die kaum mehr Wärme oder Trost bot als die Gassen draußen. Die Betten, schmal und dicht aneinandergereiht, waren nichts weiter als Holzgestelle mit durchgelegenen Matratzen, die von dünnen, fleckigen Decken bedeckt wurden. Der frostige Wind pfiff durch die Ritzen im Mauerwerk und ließ das fahle Licht der Straßenlaternen auf dem Boden tanzen.
Hier lebten wir, die vergessenen Kinder Londons, eingepfercht in ein Waisenhaus, das wie ein dunkler Riese über die schmalen Gassen der Stadt thronte. Seine hohen, steilen Dächer ragten wie Speerspitzen in den Himmel, die Fenster waren schmale Schlitze, die kaum Tageslicht hineinließen. Der Ruß der umliegenden Fabriken hatte die Fassade in ein ewiges Grau gehüllt, das selbst die seltenen Sonnenstrahlen verschluckte.
Ich trug die Uniform, die uns auferlegt worden war – ein dickes, kratziges Kleid aus grobem Stoff, das uns alle gleich erscheinen ließ, ein Heer von blassen, erniedrigten Schatten. Die Farbe war ein düsteres Dunkelgrau, abgenutzt und matt, mit einer verblassten, ehemals weißen Schürze, die nun nur noch an die Vergänglichkeit erinnerte. Das Kleid war schwer und steif, jedes Stück Stoff schien gegen mich zu arbeiten, als würde es meine Bewegungen behindern. Der Saum des langen Rocks reichte bis zu meinen Knöcheln und waberte träge bei jedem Schritt, als wäre auch er müde von all der Schwere, die wir trugen.
Die Stiefel, die ich trug, waren viel zu groß für meine Füße, die Sohlen abgenutzt und schiefgelaufen, was mich ständig in Gefahr brachte, zu stolpern. Doch es war das, womit wir zurechtkommen mussten.
Inmitten all dieser Monotonie war ich ein leuchtender Kontrast. Meine blasse Haut hob sich deutlich von der tristen Umgebung ab, als ob sie den grauen Stoff des Kleides durchbrach, wie das Licht eines schwachen Mondes. Meine dunklen, widerspenstigen Locken fielen in wilden Strähnen über meine Schultern, so ungestüm wie die Gedanken in meinem Kopf, die ebenso unordentlich und wild waren. Die braunen Augen, die mich in den Spiegeln oder in den Augen der anderen betrachteten, schimmerten mit einer Melancholie, die tief in mir lag, doch auch einen Funken Hoffnung bewahrte – ein leises, unaufhörliches Flimmern von etwas, das ich nicht ganz begreifen konnte.
Mit der Sorgfalt eines Diebes schlich ich auf Zehenspitzen durch den Raum, mein Herz hämmerte in meiner Brust, so laut, dass ich fürchtete, es könnte die anderen Kinder wecken. Meine Finger, steif vor Kälte und von Angst erfüllt, tasteten nach dem eisernen Fenstergriff.
Als ich ihn drehte, fühlte sich das Metall an wie das Klauen eines Raubtiers, doch er gab nach, und das Fenster schwang mit einem leisen Knarren auf. Sofort schlug mir die beißende Winterluft ins Gesicht, stach auf meiner Haut wie unzählige Nadeln. Ein Schauder lief mir über den Rücken, aber ich ließ mich nicht aufhalten. Ich war vorbereitet.
Zuerst warf ich den ausgeblichenen Rucksack hinaus, der all meine Habseligkeiten barg. Darin befanden sich nicht viel – eine zerknitterte Landkarte, ein altes Buch mit losen Seiten, und vor allem das Wichtigste: drei Pfund, die ich in einem unbemerkten Augenblick aus dem Schreibtisch von Ms. Winston, der Leiterin des Waisenhauses, gestohlen hatte. Drei Pfund – ein Vermögen für jemanden wie mich. Es war mehr, als ich je auf einmal besessen hatte, und ich hoffte, dass es genug sein würde, um für ein paar Nächte ein Bett und eine warme Mahlzeit zu kaufen.
Danach folgte die löchrige Decke, die ich als zusätzlichen Schutz gegen die Kälte mitgenommen hatte. Schließlich kletterte ich selbst auf den schmalen Fenstersims. Der Wind zerrte an meinem Kleid, und für einen Moment schien es, als wolle er mich zurück ins Zimmer zwingen. Doch ich ließ nicht locker. Ich stieß mich ab und sprang.
Der Aufprall war härter, als ich erwartet hatte. Meine Beine schmerzten, und der kalte Stein der Straße schien mir die Hitze aus dem Körper zu saugen. Doch ich hatte es geschafft. Der Gedanke an meine Freiheit brannte heller als die Kälte. Mein Atem formte kleine Wolken, die im Dunkel der Nacht verschwanden, während ich meinen Rucksack griff.
Doch bevor ich aufbrechen konnte, durchbrach ein Geräusch die unheimliche Stille. Ein Rascheln, kaum hörbar, kam von über mir. Sofort schoss mein Blick nach oben, suchte die schiefergedeckten Dächer ab. Der Schatten des Waisenhauses lag schwer und reglos in der Dunkelheit, doch das Geräusch ließ mich nicht los. Es musste etwas da sein.
„Hallo?“, rief ich, meine Stimme klang unsicher, schwächer, als ich wollte. Die Nacht antwortete mir mit Schweigen, und doch war da ein Gefühl, das mir sagte, ich sei nicht allein. Mein Herz raste, und die Dunkelheit schien mich zu umhüllen, schwerer und dichter als zuvor.
Doch ich durfte nicht verweilen. Der Weg in die Freiheit war schmal, und jede Sekunde hier bedeutete Gefahr. Mit zitternden Händen zog ich den Rucksack enger an mich, warf einen letzten Blick zurück auf das Waisenhaus und verschwand in die Gassen von London.
Die Stunden der Nacht zogen sich wie zäher Nebel dahin, und ich lag wach, während die Kälte der Luft durch jede Faser meines Kleides kroch. Der Schlaf wollte mich nicht finden, und selbst wenn, wäre er ein flüchtiger Trost gewesen. Mein Kopf war erfüllt von Gedanken, von Erinnerungen an all die Dinge, die ich hatte tun müssen – Dinge, die ich hasste, Dinge, die mich kleiner machten, bis ich kaum mehr wusste, wer ich war.
Widerstand zu leisten hatte keinen Sinn gehabt. In den Augen derer, die Macht über mich hatten, war ich nichts, sobald ich mich wehrte. Wertlos, überflüssig. Diese Erkenntnis war ein Schmerz, der tiefer ging als die beißende Kälte.
Ich hatte das Waisenhaus hinter mir gelassen, doch die Freiheit fühlte sich noch ungewohnt an. Die späten Stunden Londons wirkten paradox lebendig. Selbst jetzt, in der tiefsten Dunkelheit, waren die Straßen erfüllt von Bewegung.
Elegante Kutschen rollten vorbei, gezogen von stolzen Pferden, deren Hufe auf dem Kopfsteinpflaster widerhallten. Autos, selten und für mich fast wie ein Wunderwerk, summten und ratterten durch die Hauptstraßen. Männer und Frauen, gut gekleidet, eilten unter den Laternenlichtern entlang, als folgten sie einem Ziel, das nur sie kannten. Ihre Schritte hallten in den engen Gassen wider, doch keiner von ihnen beachtete mich. Ich war unsichtbar, ein Schatten, der in einer Stadt voller Leben keinen Platz hatte.
Eine seltsame Erleichterung durchflutete mich. Niemand sah mich, niemand verlangte etwas von mir. Niemand schrie Befehle, niemand hob die Hand, um mich zurechtzuweisen. Zum ersten Mal seit langer Zeit war ich allein mit mir selbst. Die Lichter der Stadt warfen lange Schatten, die sich an den Gebäudewänden tanzend verflochten. Ich spürte die Freiheit wie einen leichten Wind, der mich umgab, und doch nagte die Unsicherheit an mir.
Ein Zuhause hatte ich nicht mehr, das war klar. Aber ich war nicht allein mit diesem Schicksal. Überall in den Straßen Londons sah ich andere, die ebenfalls entwurzelt waren. Männer, Frauen, Kinder, eingehüllt in zerlumpte Mäntel, zusammengedrängt an wärmenden Feuerstellen, die sie aus Abfällen errichtet hatten.
Einige schliefen zusammengerollt unter Treppen, andere saßen an den Bahnhöfen, die zu einem Zufluchtsort für die Heimatlosen geworden waren. Und dann gab es die Unterkünfte – Orte, von denen ich gehört hatte, wo man sich ein Nachtlager erkaufen konnte, wenn man das Geld dafür hatte.
Ich zog meinen Rucksack enger an mich und suchte in der Dunkelheit nach einem Ort, der mir Schutz bieten könnte. Die Straßen waren beängstigend weit und unpersönlich, doch die engen Gassen, die sich wie Adern durch die Stadt schlängelten, schienen einladender. Jede von ihnen war eine kleine Welt für sich – mit ihren eigenen Geräuschen, Gerüchen und Schatten. Ich entschied mich schließlich für eine schmale, menschenleere Gasse, deren Boden von feuchtem Kopfsteinpflaster bedeckt war. Die Wände waren hoch und eng, und das fahle Licht einer entfernten Straßenlaterne warf einen schwachen Schimmer über die Szene.
Ich ließ mich langsam gegen eine Mauer sinken, spürte den kalten Stein durch das grobe Material meines Kleides. Meine Beine zitterten, sowohl vor Erschöpfung als auch vor Kälte. Der Boden war hart, aber wenigstens war ich hier allein. Ich zog meine Decke aus dem Rucksack, legte sie um meine Schultern und versuchte, mich so klein wie möglich zu machen.
Die Geräusche der Stadt drangen nur gedämpft zu mir, wie aus einer anderen Welt. Das Summen der Autos, das Rufen der Menschen, das gelegentliche Bellen eines Hundes – es wirkte fern, wie ein Lied, das ich nicht verstand. Ich schloss die Augen und lauschte meinem Atem, dem einzigen Geräusch, das ganz mir gehörte.
Vielleicht war dies kein Zuhause, dachte ich. Aber vielleicht konnte ich hier wenigstens einen Moment des Friedens finden, bevor der Morgen anbrach.
Das Rascheln war wieder da. Es schien sich durch die Stille der Nacht zu schneiden wie ein Messer, das mühsam durch zähe Stoffe dringt. Mein Herz setzte einen Schlag aus, bevor es wild zu pochen begann. Ich lag reglos da, die Decke eng um mich geschlungen, während mein Atem in kleinen, unsicheren Wolken vor meinem Gesicht in die Luft stieg. Das Geräusch kam von oben, ganz eindeutig. Es war kein Traum gewesen, kein Hirngespinst, das mein übermüdeter Kopf mir vorgespielt hatte.
Langsam öffnete ich meine Augen, die Lider schwer von der Müdigkeit, die mich doch irgendwie übermannt hatte. Meine Finger tasteten nach meinem Gesicht, rieben über die kalte Haut, als könnte ich so die Benommenheit vertreiben. Die Dunkelheit lag noch immer wie ein schwerer Mantel über der Stadt, und der schwache Schein der Straßenlaterne am Ende der Gasse hatte sich kaum verändert.
Das Rascheln wurde leiser, doch es war noch da, unbeständig, wie das Flüstern eines Geistes, der mir etwas sagen wollte. Ich schluckte schwer und hob den Kopf, spürte, wie die kalte Luft meine Haut streifte und mir die Haare in die Stirn blies. „Hallo?“ Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern, ein vorsichtiges Rufen, das irgendwo zwischen Mut und Angst schwebte.
Ein weiteres Geräusch erklang – ein Zischen, kurz und scharf, wie ein Windstoß, der durch ein schmales Loch pfiff. Die Kälte wurde stärker, als hätte jemand die Tür zu einer eisigen Welt geöffnet, und ich zog die Decke fester um mich, während ich nach oben blickte. Mein Atem stockte.
Dort, nur wenige Meter über mir, direkt an der Wand der Gasse, sah ich sie – Augen. Große, weit aufgerissene Augen, die mich aus der Dunkelheit heraus anstarrten. Es dauerte einen Moment, bis mein Verstand das Gesehene begreifen konnte.
Es war ein Kind. Ein Kind, das sich an die rauen Ziegelsteine klammerte, als wäre es Teil der Mauer selbst. Sein Gesicht war blass und schmutzig, die Augen weit aufgerissen und von einer Intensität erfüllt, die mich frösteln ließ. Ich konnte nicht erkennen, ob es Angst war, die in ihnen lag, oder etwas anderes – Neugier vielleicht, oder Misstrauen.
„Wer bist du?“ Meine Worte hallten schwach in der engen Gasse wider, vermischten sich mit dem leisen Rauschen des Windes. Das Kind antwortete nicht, doch seine Augen blieben auf mir haften, wie die einer Katze, die eine Bewegung im Dunkeln beobachtet.
Der Junge war nicht auf einem Dach, noch spähte er aus einem der Fenster auf mich herab. Nein, was ich sah, widersprach jeglicher Vernunft. Er schwebte. Einfach so, als wäre das Luftige seine natürliche Heimat und der Boden unter uns eine fremde Welt, die ihn nicht zu binden vermochte. Mein Atem stockte, und mein Kopf begann zu pochen, als wäre mein Verstand nicht in der Lage, das Gesehene zu begreifen.
„Wie...?“ Das Wort entglitt mir, kaum mehr als ein Flüstern. Es war nicht einmal eine Frage, sondern eher ein Ausdruck reiner Verwunderung. Meine Stimme zitterte, und ich fühlte, wie mein Körper sich anspannte, bereit entweder zu fliehen oder zu schreien. Doch stattdessen rieb ich mir hektisch die Augen, als könnte ich den Anblick einfach wegwischen. Doch als ich wieder aufsah, war er immer noch da. Schwebend. Still. Unmöglich.
Mein Mund war trocken, und meine Gedanken wirbelten wie Blätter in einem Sturm. „Ich träume,“ murmelte ich schließlich, mehr zu mir selbst als zu ihm. Es war die einzige Erklärung, die mein Verstand in dieser seltsamen, unbegreiflichen Situation zuließ. Ein Traum, das musste es sein. Aber warum fühlte sich alles so real an? Die Kälte, die an meinen Fingern nagte, der raue Stein unter mir, der Geruch von feuchtem Pflaster – Träume waren doch nicht so lebendig.
Der Junge, der eben noch in der Luft gehangen hatte, begann langsam, sanft, wie ein Blatt, das zu Boden segelt, zu mir herabzuschweben. Es war nicht der plumpe Fall eines Menschen, der von der Schwerkraft gepackt wurde, sondern eine Bewegung voller Anmut, beinahe spielerisch. Seine Füße berührten den Boden lautlos, als wäre er selbst leichter als eine Feder.
Er stand nun direkt neben mir. Ich spürte seine Präsenz wie eine seltsame, magnetische Energie. Meine Augen suchten sein Gesicht, suchten nach einer Erklärung, doch alles, was ich fand, war ein Lächeln – nicht arrogant, nicht überheblich, sondern verschmitzt, voller Geheimnisse. Es war ein Lächeln, das etwas verbarg, und genau deshalb war es so fesselnd.
„Wie heißt du?“ fragte er schließlich, seine Stimme klar und ruhig, wie ein Bach, der über glatte Steine fließt.
Ich starrte ihn an, unfähig, sofort zu antworten, denn jetzt, wo er so nah bei mir stand, konnte ich ihn besser erkennen. Sein Haar war ein wilder Schopf aus blonden und fast braunen Wellen, die ihm ungezähmt in die Stirn fielen. Es sah aus, als hätte es nie eine Bürste berührt, und dennoch passte es perfekt zu ihm, als wäre es ein Teil seiner wilden, ungebändigten Natur.
Doch es war seine Kleidung, die mich wirklich verstörte. Kein Hemd, keine Hose, keine Schuhe. Stattdessen trug er eine Art Gewand aus Blättern, die kunstvoll um seinen Körper drapiert waren, als wären sie aus einem uralten Märchen entsprungen. Sie schimmerten leicht im Mondlicht, als hätte der Tau der Wälder sie benetzt.
Manche waren grün und frisch, andere dunkel, fast schwarz, wie Herbstlaub. Es war ein seltsamer Anblick, so fernab von allem, was ich je gesehen hatte, und doch schien es ihm völlig normal.
„Wie heißt du?“ fragte er erneut, und diesmal schwang ein leises Lachen in seiner Stimme mit, als hätte er Spaß daran, mich aus meiner Sprachlosigkeit zu locken.
Ich zögerte, unsicher, ob ich ihm antworten sollte. Wer war er? Und woher kam er? Ganz sicher nicht aus England. Er sah aus, als käme er aus einer anderen Welt – einer, die weder von Fabriken noch von Rauch oder Lärm beherrscht wurde. Vielleicht aus einem dichten, grünen Urwald, einem Ort, an dem die Zeit stillstand und die Regeln der Menschen keine Bedeutung hatten.
„Wer bist du?“ brachte ich schließlich hervor, die Worte brüchig und leise, fast wie ein Windhauch. Doch das Lächeln des Jungen wurde nur breiter, und seine Augen, leuchtend und klar, schienen für einen Moment wie Sterne in der Dunkelheit.
„Ich? Das ist unwichtig,“ sagte er mit einem leichten Schulterzucken. „Du hast noch nicht gesagt, wie du heißt.“
Sein Ton war so selbstverständlich, so unbeschwert, dass ich spürte, wie die Angst, die mich zuvor gelähmt hatte, langsam nachließ. Doch an ihre Stelle trat etwas anderes – ein seltsames, überwältigendes Gefühl von Neugier. Wer war dieser Junge, der keine Schuhe trug, in Blättern gekleidet war und durch die Luft schwebte, als wäre es das Normalste der Welt?
„Ich…“ Meine Stimme brach, und ich spürte, wie meine Kehle brannte. Mit einem leichten Husten versuchte ich, meine Stimme zurückzugewinnen. „Harlow Lorelei,“ brachte ich schließlich hervor, doch es klang brüchig und unsicher. Ich räusperte mich, doch es half kaum. „Nenn mich einfach… Harlow.“
Der Junge nickte, als ob er meinen Namen bereits kannte, oder als ob es für ihn keine Rolle spielte, wie ich mich nannte. Dann sagte er mit einem Lächeln, das sowohl freundlich als auch geheimnisvoll war: „Ich bin Peter.“
Seine Stimme war jung, lebendig, doch in ihr lag eine unbeschreibliche Tiefe, als würde er mehr wissen, als er zuzugeben bereit war. Er streckte mir seine schmutzige Hand entgegen, die mit Kratzern und Schrammen übersät war. „Peter Pan,“ fügte er hinzu, als wäre das alles, was ich wissen müsste.
Einige Sekunden lang starrte ich ihn nur an. Sein Name klang fremd und doch… vertraut. Irgendwo hatte ich ihn vielleicht schon einmal gehört, oder es war die Art, wie er es aussprach – als wäre sein Name Teil einer Legende, die ich zu kennen glaubte.
Schließlich bemerkte ich seine ausgestreckte Hand, zögerte kurz und nahm sie dann vorsichtig in meine eigene. Seine Haut war kalt, rau von der Kälte und dem Schmutz, doch sein Griff war überraschend fest.
„Woher kommst du?“ Meine Stimme war leise, doch die Frage drängte sich auf. Etwas an ihm schien nicht von dieser Welt zu sein, und dennoch stand er jetzt hier, direkt vor mir.
Er zuckte leicht mit den Schultern, als wäre es die einfachste Frage der Welt, und deutete mit einem ausgestreckten Finger in den Nachthimmel. „Von ganz weit weg,“ sagte er schließlich. Sein Blick wanderte zu den Sternen, die über uns funkelten, und ich konnte nicht anders, als ihm zu folgen. Der Himmel wirkte in diesem Moment unendlich, eine leere Leinwand, die er mit seinen Worten ausfüllte.
„Du hast kein Zuhause, oder?“ fragte er plötzlich, und seine Stimme war so ruhig, so direkt, dass es mich aus meinen Gedanken riss.
Seine Worte schnitten tief, denn sie waren wahr. Nein, ich hatte kein Zuhause. Nicht mehr. Mein Zuhause war ein Ort gewesen, an dem ich mich nie willkommen gefühlt hatte, ein Ort, den ich hinter mir gelassen hatte, ohne zurückzublicken. Ich nickte langsam, spürte, wie diese simple Bewegung eine Schwere in mir hervorbrachte, die ich bislang verdrängt hatte.
Er sah mich an, und in seinen Augen lag etwas, das ich nicht deuten konnte. War es Mitgefühl? Verständnis? Oder vielleicht nur eine schlichte Akzeptanz? Er schien nichts weiter dazu sagen zu wollen, und ich fühlte eine seltsame Erleichterung darüber.
„Wie machst du das?“ fragte ich stattdessen und deutete vage in Richtung der Stelle, wo er eben noch geschwebt hatte. Ich wollte nicht länger über mich sprechen, nicht über mein verlorenes Zuhause oder die Leere, die in mir nagte. Peter grinste.
Es war kein spöttisches Grinsen, sondern eines, das voller Freude und Stolz war, als hätte ich gerade den Schlüssel zu einem Geheimnis erfragt, das nur er kannte. Er hob einen Fuß, trat einen Schritt zurück und breitete die Arme aus, als wollte er gleich wieder abheben.
„Das?“ Peter grinste breit, ein Schimmer von verschmitztem Stolz in seinen leuchtenden Augen. „Das ist ganz einfach,“ sagte er und zuckte beiläufig mit den Schultern, als ob er von etwas Alltäglichem sprach, wie dem Binden von Schuhen oder dem Summen eines Liedes. „Du musst nur daran glauben, dass du fliegen kannst.“
Ich runzelte die Stirn und schüttelte leicht den Kopf. „Glauben?“ wiederholte ich skeptisch, meine Stimme ein skeptisches Echo seiner Worte. Glauben allein sollte reichen, um zu fliegen? Es klang so absurd, dass ich nicht wusste, ob ich ihn auslachen oder einfach stehen lassen sollte.
Doch bevor ich die Chance hatte, meinen Unglauben auszusprechen, hob Peter eine Hand, als wolle er mich zum Schweigen bringen. „Aber…“ begann er, und seine Stimme senkte sich zu einem geheimnisvollen Ton, als wollte er die Spannung auf die Spitze treiben. Er ließ eine dramatische Pause verstreichen, genug, um mein Interesse trotz allem zu wecken.
„Es hilft,“ fuhr er fort, sein Lächeln wuchs zu einem verschmitzten Grinsen, „wenn du ein bisschen Staub hast. Feenstaub.“
„Feenstaub?“ Ich konnte nicht anders, als die Worte fast ungläubig zu wiederholen. Meine Stimme klang schärfer, als ich es beabsichtigt hatte, und meine Stirn legte sich noch tiefer in Falten. Alles an dieser Begegnung war wie ein merkwürdiger Traum, doch dieser Teil schien selbst für ein Märchen zu viel.
„Feenstaub,“ bestätigte er mit einem bekräftigenden Nicken. Sein Ton war völlig ernst, als ob er über die grundlegenden Regeln des Universums sprach. „Aber den gibt’s nicht überall,“ fügte er hinzu, während er seine Arme verschränkte und mich mit einem Blick musterte, der so sicher war, dass er mich fast einschüchterte. „Und… du brauchst Übung.“
„Übung?“ Ich lachte kurz auf, eine Mischung aus Unsicherheit und Belustigung. Dieser Junge war verrückt. Ganz sicher. Feenstaub und Übung – als ob er eine geheime Kunst beherrschte, die er mir jetzt großzügig zu erklären gedachte. Doch gleichzeitig – warum fühlte sich seine Überzeugung so... ansteckend an?
Ich schüttelte den Kopf, mehr zu mir selbst als zu ihm. „Das ist doch Unsinn,“ sagte ich schließlich, aber meine Stimme war leiser geworden, weniger sicher.
„Unsinn?“ Peter hob eine Augenbraue, und ein herausforderndes Funkeln trat in seine Augen. „Du denkst, ich spinne, nicht wahr?“ Er neigte leicht den Kopf, seine wachsamen Augen fixierten mich wie die eines Raubvogels, der sein Ziel abschätzte.
Ich wollte widersprechen, doch er kam mir zuvor. „Das denken sie alle,“ sagte er mit einem spielerischen Lachen. „Aber weißt du was?“ Er beugte sich leicht zu mir vor, seine Stimme wurde zu einem Flüstern, das dennoch vor Energie und Überzeugung vibrierte. „Wenn du es selbst siehst, wirst du es verstehen.“
Bevor ich reagieren konnte, sprang er mit einer katzenhaften Eleganz zurück, direkt auf eine nahegelegene Kiste. Er balancierte darauf, als wäre es ein Podium, bereit, eine große Show zu beginnen. Die Nacht schien sich um ihn zu verdichten, das Mondlicht glitzerte auf seiner seltsamen Kleidung aus Blättern.
Dann breitete er die Arme aus, ein Ausdruck von triumphaler Freude auf seinem Gesicht, als sei dies der Moment, auf den er gewartet hatte. Mit einem kräftigen Sprung erhob er sich in die Luft, und mein Atem stockte. Kein Wanken, kein Zögern – er flog.
Peter bewegte sich mit einer Leichtigkeit, die jenseits aller Vernunft lag. Er schwebte höher, drehte sich einmal in der Luft, als wollte er sichergehen, dass ich jede seiner Bewegungen sah. Der Wind spielte mit seinen Haaren, und sein Lachen schallte durch die stille Nacht – ein Klang, der sowohl verspielt als auch voller Geheimnisse war.
Ich konnte nur stehen und starren, mein Herz raste, mein Verstand suchte verzweifelt nach einer Erklärung. Das hier war unmöglich. Und doch… war es echt.
Ich starrte ihn an, die Stirn in tiefe Falten gelegt, meine Augen schmal vor Unglauben und Verwirrung. Sein Lächeln – dieses selbstsichere, freche Grinsen – schien eine Herausforderung zu sein, eine Aufforderung, die Logik über Bord zu werfen. Doch ich konnte nicht anders, als mich gegen seine Worte zu wehren. „Aber… fliegen ist nicht möglich,“ sagte ich schließlich, meine Stimme klang entschlossener, als ich mich fühlte. „Also, physikalisch geht das doch gar nicht.“
Peter schnappte dramatisch nach Luft, als hätte ich ihn mit einer unsagbaren Beleidigung getroffen. Seine Augen weiteten sich, und er legte eine Hand auf seine Brust, als müsse er einen Schock überwinden. „Bist du etwa…“ begann er und hielt inne, sein Gesicht eine Mischung aus Entsetzen und ungläubigem Staunen.
Ich hob eine Augenbraue, verwirrter denn je. „Was?“ fragte ich langsam, meine Stimme vorsichtig, als ob ich eine Zeitbombe entschärfen müsste.
Peter beugte sich vor, seine Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen. „Ich mag es gar nicht aussprechen…“ Er machte eine theatralische Pause, bevor er die Worte wie einen Fluch ausspuckte. „Bist du etwa… erwachsen?“
„Was?“ rief ich abermals, mehr verwirrt als beleidigt. Doch bevor ich mich erklären konnte, machte Peter ein würgendes Geräusch, als wäre meine bloße Anwesenheit eine Zumutung.
„Pirat!“ platzte er heraus, und sein Zeigefinger schoss wie eine Waffe in meine Richtung.
„Pirat?!“ Ich sprang auf, mein Kopf schwirrte vor Verwirrung und Ärger. „Ich bin kein Pirat! Wie kommst du überhaupt darauf?“
Peter musterte mich misstrauisch, als suche er nach einem verräterischen Zeichen. „Du siehst aus wie einer,“ sagte er schließlich, und seine Stimme war voller Verachtung. „So wie du sprichst! Über Physik und sowas. Nur Piraten und Erwachsene reden so.“
Ich hob die Hände, die Handflächen nach oben, als wollte ich mich verteidigen. „Ich bin kein Pirat!“ protestierte ich lautstark. „Ich bin fünfzehn! Ist man mit fünfzehn nicht noch ein Kind?“
Peter schien kurz nachzudenken, bevor er die Schultern zuckte. „Tja,“ sagte er, als wäre das Thema plötzlich nicht mehr wichtig. „Dann glaubst du doch an Magie.“
Seine plötzliche Wendung ließ mich sprachlos. „Magie?“ fragte ich erneut, und das Wort kam nur als ein schwacher Laut über meine Lippen.
„Wenn du kein Pirat bist und kein Erwachsener, dann glaubst du an Magie,“ erklärte Peter mit einer Selbstverständlichkeit, die mich nur noch mehr verwirrte. Er verschränkte die Arme und musterte mich mit einem Blick, der aussagte, dass er das letzte Wort gesprochen hatte.
„Das ergibt doch keinen Sinn!“, rief ich aus und warf die Hände in die Luft. Doch Peter grinste nur breiter, als hätte er gerade einen wichtigen Punkt bewiesen.
„Magie ergibt nie Sinn,“ sagte er schließlich, und seine Stimme hatte einen seltsamen, geheimnisvollen Ton. „Das ist der ganze Spaß daran.“
Ich öffnete den Mund, um zu widersprechen, doch keine Worte kamen heraus. Alles, was ich wusste, alles, was ich für sicher gehalten hatte, schien in dieser seltsamen Begegnung zu verschwimmen. Wer war dieser Junge? Und warum fühlte ich mich, als würde meine Realität unter meinen Füßen zerbröckeln?
„Komm mit mir,“ sprach Peter schließlich, seine Stimme eine Mischung aus Begeisterung und Nachdruck. Seine Worte klangen wie ein Versprechen, wie die Verlockung einer Freiheit, die ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht hätte vorstellen können. Doch obwohl mich seine Worte reizten, zog sich etwas in mir zusammen – ein instinktives, unangenehmes Gefühl tief in meinem Bauch. Es war ein merkwürdiger Zwiespalt.
Dieser Junge, mit seinem seltsamen Lächeln und den noch seltsameren Worten, weckte in mir zugleich Neugier und Misstrauen. Warum war er hier, mitten in der Nacht? Warum suchte er mich aus? Es lag in meiner Natur, das Schlimmste in guten Menschen zu sehen und das Beste in denen, die nicht gut waren. Und doch – was, wenn er wirklich die Rettung war, nach der ich mich so lange gesehnt hatte?
„Mit?“ fragte ich, meine Stimme zögernd. „Wohin?“
Peter lehnte sich vor, als wolle er mir ein großes Geheimnis anvertrauen. „Nach Nimmerland,“ flüsterte er und grinste, als hätte er die magischen Worte gesprochen, die alles erklären würden.
Ich blinzelte. Der Name sagte mir nichts, weder aus meinen flüchtigen Erinnerungen an die Geschichten, die wir uns heimlich im Waisenhaus erzählten, noch aus irgendeinem Buch, das mir je vorgelesen wurde. „Nimmerland?“ wiederholte ich, meine Stimme skeptisch.
„Ja!“ sagte Peter und deutete mit einer weit ausholenden Geste in den Himmel, als sei es die selbstverständlichste Sache der Welt. „Dort oben.“
Ich folgte seinem Finger und runzelte die Stirn. In der Richtung, in die er zeigte, funkelten zwei helle Sterne am samtigen Nachthimmel. Mein Blick wanderte zwischen den Sternen und seinem ernsten Gesicht hin und her. „Dort oben?“ Ich lachte leise, ungläubig. „Das soll ein Witz sein, oder?“
Doch Peter nickte ernsthaft, ohne einen Hauch von Zweifel. „Es ist kein Witz,“ sagte er leise, aber eindringlich. „Komm mit mir. Weg von dieser grausamen Welt.“
Seine Worte trafen mich wie ein Schlag. Weg von dieser Welt? Konnte er wirklich meinen, dass es einen Ort gab, der all das Elend, den Schmerz und die Kälte hinter sich ließ? Einen Ort, wo ich keine Angst mehr haben musste?
„Du wirst alles Böse hinter dir lassen und vergessen,“ fügte er hinzu, seine Stimme jetzt weicher, fast einladend. „Kein Hunger, keine Kälte, keine Einsamkeit mehr. Nur Freiheit.“
Ein Funken Hoffnung loderte in mir auf, doch er wurde schnell von meiner Skepsis erstickt. Weg von hier? Würde dann wirklich alles besser werden? Oder war das nur eine weitere Illusion, die zerbrechen würde wie die vielen vor ihr?
„Wo genau liegt dieses… Nimmerland?“ fragte ich vorsichtig, bemüht, meine Neugier zu verbergen.
„Dort, wo die Sterne hell leuchten und der Himmel niemals endet,“ sagte Peter, seine Augen glitzerten im fahlen Mondlicht.
„Ist es schwer, dorthin zu kommen?“ fragte ich, immer noch skeptisch, doch ein Hauch von Verlangen schlich sich in meine Stimme.
Peter grinste, als hätte er genau diese Frage erwartet. „Es gibt nichts Leichteres als das,“ sagte er und trat einen Schritt näher, als wollte er mir das Geheimnis anvertrauen.
Mein Herz schlug schneller, und ich fühlte, wie die Kälte der Nacht um mich herum beinahe verschwand. Was, wenn er wirklich die Wahrheit sagte? Was, wenn das Nimmerland existierte? Doch der Zweifel nagte immer noch an mir. Wer war dieser seltsame Junge wirklich? Und was würde mich erwarten, wenn ich ihm folgte?
„Hast du keine Eltern, Peter?“ Meine Stimme war leise, fast vorsichtig, als ich die Frage stellte. Ich wusste nicht genau, warum, aber irgendetwas an diesem seltsamen Jungen rief in mir den Wunsch hervor, mehr zu erfahren. Vielleicht lag es daran, dass er so anders war, so unbeeindruckt von den Dingen, die mich täglich bedrückten. Oder vielleicht war es die Art, wie er mit einer Selbstverständlichkeit von Dingen sprach, die unmöglich schienen.
Peter lachte auf, ein helles, fast spöttisches Lachen, das in der kühlen Nachtluft widerhallte. „Eltern?“ wiederholte er, als sei das Wort selbst ein Scherz. „Ich bin Peter Pan! Ich brauche keine Eltern! Ich habe keine erwachsenen Menschen – und ich will auch keine.“
Seine Worte ließen mich stutzen. „Aber…“, setzte ich an, doch er hob die Hand, um mich zum Schweigen zu bringen.
„Die einzige Person, die mich erziehen darf, bin ich selbst,“ erklärte er mit einer Mischung aus Stolz und Trotz, als hätte er diesen Satz schon oft gesagt. Seine grünen Augen funkelten vor Überzeugung, und ich spürte, dass er jedes Wort ernst meinte.
Ich zog die Brauen zusammen, während ich ihn musterte. Er stand da in seinem seltsamen Kostüm aus Blättern, als sei es das Natürlichste der Welt, barfuß, mit Schmutzflecken auf der Haut und einer fast unheimlichen Selbstsicherheit. Wie konnte ein Junge wie er, der höchstens zwölf Jahre alt war, wirklich allein überleben?
„Aber wie…“ Ich hielt inne, unsicher, wie ich die Frage formulieren sollte. „Wie kannst du ohne Erwachsene auskommen? Jemand muss sich doch um dich kümmern. Dich füttern, dir helfen, dich beschützen…“
Peter schnaubte, und sein Lächeln verschwand für einen Moment. „Erwachsene,“ sagte er mit einem Hauch von Verachtung in der Stimme, „sind die, die dir sagen, was du tun sollst. Sie sind die, die dir Grenzen setzen und dich dazu bringen, an Dinge wie Zeit, Regeln und Verantwortung zu glauben. Sie stehlen dir das Leben, bevor du weißt, was es wirklich ist.“
Ich schluckte schwer, während seine Worte in meinem Kopf nachhallten. Es war nicht das, was ich erwartet hatte. Es klang, als hätte er mit einer tiefen, verbitterten Abneigung gegen Erwachsene gesprochen – aber woher kam diese Abneigung?
„Und wer füttert dich?“ platzte ich schließlich heraus, unfähig, meine Neugier länger zurückzuhalten.
Peter grinste wieder, als hätte ich eine besonders dumme Frage gestellt. „Ich brauche niemanden, der mich füttert,“ sagte er. „Ich habe gelernt, alles zu finden, was ich brauche. Ich bin frei, Harlow. Keine Regeln, keine Befehle, kein Warten darauf, dass jemand für mich sorgt. Freiheit.“
Freiheit. Das Wort hatte einen verlockenden Klang, doch ich konnte nicht leugnen, dass es mich beunruhigte. Wie konnte er das alles allein schaffen? War er wirklich so unabhängig, wie er behauptete, oder war er einfach zu stolz, es zuzugeben, wenn er Hilfe brauchte?
„Aber…“ Ich zögerte, unsicher, ob ich die richtigen Worte finden würde, um meinen Gedanken Ausdruck zu verleihen. „Als Kind ist man doch… man ist doch auf jemanden angewiesen, oder nicht? Jemanden, der sich um einen kümmert, jemanden, der einen… liebt?“ Meine Stimme wurde leiser, als das letzte Wort über meine Lippen kam, fast so, als hätte ich Angst, es laut auszusprechen.
Peter hielt inne, sein fröhliches Lächeln erstarrte, und sein Blick wich dem meinen aus. Für einen Moment schien es, als hätte ich ihn an einer Stelle getroffen, die er nicht preisgeben wollte. Sein Kinn senkte sich leicht, die lockeren Strähnen seines wilden Haares warfen Schatten über sein Gesicht. Dann, wie auf ein unsichtbares Stichwort, lachte er – aber es war nicht mehr das helle, sorglose Lachen, das zuvor die Nacht durchdrungen hatte. Dieses Lachen war anders. Es war leiser, gebrochener, fast gezwungen.
„Liebe,“ wiederholte er schließlich, das Wort wie ein bitteres Stück Obst im Mund schmeckend. Er spuckte es regelrecht aus. „Das ist etwas für Erwachsene. Sie reden davon, sie preisen es an, als wäre es der Schlüssel zu allem, was man sich wünschen könnte. Aber weißt du, was es wirklich ist?“ Er sah mich an, sein Blick durchdringend, fast herausfordernd. „Es ist eine Lüge. Ein Trick, um dich zu binden. Sie versprechen dir Liebe, aber wenn du sie wirklich brauchst, ist sie nie da. Wer braucht das schon?“
Die Worte trafen mich wie ein Schlag in die Magengrube. Ich wollte widersprechen, wollte ihm sagen, dass er Unrecht hatte, dass Liebe mehr war, dass sie echt sein konnte. Aber ich fand keine Worte. Seine Stimme, sein Blick, alles an ihm ließ mich glauben, dass er das wirklich so meinte. Dass er es selbst erlebt hatte.
Ich beobachtete, wie er seine Arme verschränkte, als wolle er sich vor einer unsichtbaren Kälte schützen, die ihn von innen heraus fror. Seine Haltung war selbstbewusst, beinahe trotzig, doch in seinen Augen lag etwas anderes. Ein Schatten, tief und dunkel, wie ein Geheimnis, das er mit aller Kraft zu verbergen versuchte.
„Peter…“ begann ich, doch meine Stimme versagte. Was hätte ich sagen sollen? Dass ich ihn verstand? Dass ich es anders sah? Alles, was mir einfiel, erschien mir hohl und bedeutungslos.
Er sah weg, richtete seinen Blick auf den Himmel, als suchte er nach einem Ausweg. „Weißt du, warum ich fliege?“ fragte er plötzlich, seine Stimme leise, fast flüsternd. „Weil ich nie wieder irgendwo festgehalten werden will. Nicht von einem Ort, nicht von Menschen, nicht von irgendetwas, das mich zurückhält. Fliegen ist Freiheit. Es ist besser als Liebe, besser als alles andere.“
Ich schluckte schwer, als seine Worte in mir widerhallten. Sie waren voller Überzeugung, aber auch voller Schmerz. Und obwohl er so fest an seine Freiheit glaubte, konnte ich nicht umhin, das leise Zittern in seiner Stimme zu bemerken, das mir zeigte, dass er sich selbst davon zu überzeugen versuchte.
Für einen Moment schien die Nacht stiller zu werden, die Geräusche der Stadt gedämpfter, als ob sie uns Raum geben wollte. Ich sah Peter an, den Jungen, der behauptete, keine Liebe zu brauchen, keine Erwachsenen, keine Bindungen. Und doch fragte ich mich, ob er tief in seinem Herzen nicht genau danach suchte – oder ob er einfach nur gelernt hatte, ohne es auszukommen.
„Du willst doch mitkommen, oder?“ fragte Peter erneut, doch dieses Mal schwang etwas in seiner Stimme mit, das sich wie echte Sorge anfühlte. Sein Blick ruhte auf mir, und in seinen Augen flackerte etwas, das ich nicht ganz deuten konnte – ein Mix aus Hoffnung, Dringlichkeit und einem leisen Zweifel. Es war, als ob meine Antwort mehr für ihn bedeutete, als ich zunächst vermutet hatte.
Ich zögerte. Hier bleiben? Wofür? Es gab nichts mehr, was mich hielt. Mein Zuhause war längst nicht mehr das, was es hätte sein sollen. Familie? Freunde? Fehlanzeige. Jeder Abschied, der mir in den Sinn kam, fühlte sich so bedeutungslos an, dass es fast schmerzte. Und dennoch…
„Ich… ich glaube schon,“ murmelte ich schließlich, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. Es war, als würde ich mich selbst überreden müssen, diesen Schritt zu wagen.
Peters Gesicht verwandelte sich augenblicklich. Sein Grinsen war so breit, dass es schien, als könnte nichts in der Welt ihm jetzt noch die gute Laune verderben. Er klatschte in die Hände, ein fröhliches Geräusch, das die Dunkelheit um uns herum förmlich zerriss.
„Wunderbar!“ rief er aus, als wäre alles bereits entschieden, als hätte ich meine Seele einem unausgesprochenen Versprechen verschrieben. „Dann komm her!“
Er deutete auf eine leere Stelle des Bodens, die nur schwach vom Mondlicht beleuchtet wurde. Ich zögerte einen Moment, doch sein Eifer war ansteckend, und ehe ich mich versah, hatte ich bereits Schritte in die angezeigte Richtung gemacht.
„Stell dich genau da hin,“ sagte Peter, jetzt mit einer Mischung aus Vorfreude und einer unerwarteten Ernsthaftigkeit in der Stimme. Ich tat, wie er sagte, fühlte mich aber zunehmend unruhig. Er ging einige Schritte zurück, als wolle er sicherstellen, dass nichts und niemand uns stören konnte.
Dann brachte er zwei Finger an die Lippen, und bevor ich auch nur fragen konnte, was er vorhatte, stieß er einen Pfiff aus. Es war kein gewöhnlicher Pfiff – es war, als hätte er einen Befehl gegeben, der von der Luft selbst weitergetragen wurde. Der Klang schien zu vibrieren, sich in die Nacht auszubreiten, bis er irgendwo weit oben in den Himmel verschwand.
Ich wollte gerade fragen, was zum Teufel das sollte, als ein schimmerndes Licht am Horizont erschien. Es war winzig, kaum größer als ein Funke, und bewegte sich so schnell, dass es fast unmöglich war, ihm mit den Augen zu folgen. Das Licht raste auf uns zu, tanzte durch die Luft wie ein Wesen mit eigenem Willen.
„Was ist das?“ Meine Stimme zitterte vor Verwirrung und einem Anflug von Furcht. Ich machte einen Schritt zurück, doch Peter hob beschwichtigend die Hände.
„Keine Angst,“ sagte er und lächelte, als hätte er mit solchen Reaktionen gerechnet. „Das ist Glöckchen, meine Fee. Du kannst sie auch Tink nennen.“
„Eine… Fee?“ Ich blinzelte, unsicher, ob ich ihn richtig verstanden hatte.
„Ja,“ bestätigte er mit Nachdruck, seine Stimme voller Stolz. Doch dann wurde sein Tonfall plötzlich ernster, fast belehrend. „Aber hör gut zu: Du darfst niemals an ihrer Existenz zweifeln. Solltest du das jemals laut aussprechen, stirbt eine Fee. Mit jedem überzeugtem ‚Es gibt keine Feen‘ wird ein von ihnen ausgelöscht. Also pass auf, was du sagst.“
Ein kalter Schauer lief mir über den Rücken. Die Vorstellung, dass ein unbedachter Satz ein Leben beenden könnte, ließ mich schaudern. Ich starrte die kleine Lichtgestalt an, die jetzt nahe genug war, dass ich mehr erkennen konnte.
Das schimmernde Licht hatte eine Form – winzige, zarte Flügel, die wie aus Glas gefertigt wirkten, und einen kleinen Körper, der golden leuchtete. Sie trug ein Kleid, das wie aus Blättern gemacht war, doch jedes Mal, wenn ich mich bemühte, genauer hinzusehen, verschwamm sie vor meinen Augen. Es war, als wolle sie nicht vollständig wahrgenommen werden, als gehöre sie in eine Welt, die nicht mit sterblichen Augen gesehen werden konnte.
Die Fee – Glöckchen, wie Peter sie genannt hatte – flog um mich herum, ihre Bewegungen so schnell und zappelig, dass ich beinahe das Gleichgewicht verlor, während ich ihr folgte. Sie summte leise, ein Geräusch, das wie ein feines Klingeln klang, und ich hatte das Gefühl, dass sie mich neugierig musterte.
„Glöckchen, gib ihr ein bisschen Staub ab,“ sagte Peter plötzlich, und in seiner Stimme lag ein Hauch von Autorität. Die Fee hielt abrupt inne, schwebte einen Moment in der Luft, und begann dann schrill zu quietschen. Es klang wie ein entrüsteter Protest, eine lautstarke Weigerung, Peters Anweisungen zu folgen.
Peter stöhnte genervt und rollte mit den Augen. „Immer dasselbe mit dir,“ murmelte er und griff nach ihr. Er hielt sie zwischen Daumen und Zeigefinger fest, und obwohl sie weiterhin schimpfte und zappelte, wirkte Peter davon völlig unbeeindruckt.
„Hör auf zu jammern,“ sagte er scharf, bevor er mit der anderen Hand an ihre schimmernden Flügel schnippte. Ein glitzernder Staubregen rieselte herab, golden und funkelnd wie flüssiges Licht.
„Ah!“ rief ich erschrocken, als der Staub auf mein Gesicht fiel. Es kitzelte auf meiner Haut, in meinen Haaren, und als ich einatmete, musste ich niesen. Peter lachte leise, doch ich konnte meinen Blick nicht von dem schimmernden Staub abwenden, der jetzt überall um mich herum in der Luft schwebte.
„Das ist Feenstaub,“ erklärte Peter knapp, als wäre das die normalste Sache der Welt. „Damit kannst du fliegen.“
„Fliegen?“ Meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
„Ja,“ sagte Peter, als hätte er noch nie an etwas so Einfaches geglaubt. „Aber der Staub allein reicht nicht.“ Seine Augen funkelten, und er hob einen Finger, wie ein Lehrer, der eine wichtige Lektion erklärte. „Weißt du, was du außerdem brauchst?“
Ich schüttelte langsam den Kopf, meine Gedanken zu verwirrt, um zu antworten.
„Einen wunderbaren Gedanken,“ sagte Peter, seine Stimme wurde leiser, beinahe sanft. „Etwas, das dich glücklich macht. Ein Moment, eine Erinnerung, ein Traum. Irgendetwas, das dich leicht macht, als könntest du alles schaffen.“
Mein Herz begann schneller zu schlagen. Ein wunderbarer Gedanke? Mein Verstand durchsuchte fieberhaft jede Ecke meines Geistes, auf der Suche nach etwas, das diesem magischen Kriterium entsprechen könnte.
„Es ist einfacher, als du denkst,“ sagte Peter und trat einen Schritt zurück, seine Augen voller Erwartung. „Denk einfach nach und probier es aus.“
Ich schloss die Augen und versuchte verzweifelt, an einen glücklichen Moment zu denken. Doch der Kopf fühlte sich leer an, als wäre er von einem dichten Nebel verhüllt. Alles, woran ich denken konnte, waren Bruchstücke von Erinnerungen, die keinen Funken Magie entfachen konnten.
Das Lächeln von einem Lehrer, als er mir in der Schule ein gutes Zeugnis gab – es war nur ein Moment, und er verblasste, sobald er in meinem Gedächtnis auftauchte. Das Geschenk, das ich einmal im Kinderheim erhalten hatte, unerwartet und in seiner Bedeutung klein – aber es hatte mir nie das gegeben, was ich jetzt suchte. Dann das Bild, das ich als Kind gemalt hatte, voller Stolz und kindlicher Freude – auch dieses Bild schien mir in diesem Augenblick nicht genug zu sein. Keiner dieser Momente konnte das Gefühl von „wunderbar“ in mir erwecken, das Peter mir versprochen hatte.
„Dein Ernst?“ Peters Stimme war wie ein kaltes Rauschen in meinem Kopf, das mich aus meinen Gedanken riss. Ich blickte zu ihm auf, seine Augen weit aufgerissen, als hätte ich ihm gerade ein Rätsel gestellt, das er nicht lösen konnte. „Dir fällt wirklich gar nichts ein?“
Ich zuckte hilflos mit den Schultern. Meine Gedanken schienen sich wie wild um einen Punkt zu drehen, aber sie wollten nicht an das festhalten, was ich wirklich brauchte. Die Frustration stieg in mir auf, doch ich konnte nicht viel dagegen tun. Was war mit mir nur los?
Peter schüttelte den Kopf, ein amüsiertes, aber auch mitfühlendes Lächeln auf den Lippen. „Na gut,“ sagte er, und sein Ton wurde plötzlich fest, voller Entschlossenheit, als wolle er mir etwas erklären, was ich noch nicht verstehen konnte. „Dann hör mir mal zu. Dort oben, da ist ein Ort – ein Ort voller Wunder. Ein Ort, den du dir nicht mal im Traum vorstellen kannst. Feen, Meerjungfrauen, Indianer… alles, was dein Herz begehrt, ist dort.“ Er deutete mit einer schwungvollen Handbewegung in den Himmel, als könne er all die Dinge herbeizaubern, die er beschrieb. „Und weißt du was? Es gibt keinen Grund, nicht glücklich zu sein. Wirklich nicht.“
„Indianer?“ wiederholte ich ungläubig, während meine Augen die dunkle Weite des Himmels absuchten. Die Idee, an diesem Ort, von dem Peter sprach, teilzunehmen, schien völlig abwegig. Doch irgendetwas in Peters Stimme ließ mich innehalten und überdenken, was er sagte.
„Piraten!“ rief er plötzlich, und in seinem Gesicht lag eine solche Begeisterung, dass ich nicht anders konnte, als mit ihm mitzufiebern.
„Piraten? Echte Piraten?“ fragte ich, ohne es zu merken, dass ein Lächeln auf meinen Lippen spielte. Es war, als ob Peter etwas in mir ansprach, das tief verborgen war, und ich spürte eine ungewohnte Neugier, eine Lust darauf, mehr zu erfahren.
„Echte Piraten!“ rief Peter, als hätte er das Geheimnis der Welt für mich gelüftet. „Und wir kämpfen gegen sie! Glaub mir, Harlow, da oben erwartet dich ein Abenteuer, das du dir nicht mal in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Meerjungfrauen, Feen, Indianer und Piraten… das ist alles real, und es gehört dir, wenn du es willst!“
Seine Worte hüllten mich ein, wie ein unsichtbares Band, das mich immer tiefer in eine Welt zog, die ich niemals für möglich gehalten hätte. Ich konnte das Kribbeln in meinen Fingerspitzen spüren, ein Gefühl von Freiheit, das durch meine Adern raste. Und dann – ein weiteres Mal – spürte ich es. Es war ein merkwürdiges Gefühl, das mich durchfuhr, als ob der Boden, auf dem ich stand, plötzlich nicht mehr real war.
„Peter!“ rief ich mit erschrockenem Unterton und griff verzweifelt nach seinem Arm. Ein Hauch von Panik stieg in mir auf, als ich bemerkte, dass meine Füße den Boden nicht mehr berührten. „Ich… ich schwebe!“
Peter sah mich mit einem triumphierenden Grinsen an, als ob er bereits gewusst hatte, was als Nächstes geschehen würde. „Natürlich tust du das. Du hast es geschafft!“
Ich blickte nach unten, meine Augen weit aufgerissen, und in diesem Moment konnte ich es kaum fassen. Tatsächlich – der Boden war weit entfernt.
Ein Lachen, laut und ungebremst, brach aus mir heraus, so intensiv, dass ich fast die Luft anhalten musste. „Ich fliege!“ rief ich, während ich die Schwerelosigkeit genoss. „Ich kann wirklich fliegen!“
Peter lachte mit mir, als würde er mit mir die Freude an diesem unglaublichen Erlebnis teilen. „Natürlich kannst du fliegen,“ sagte er ruhig, „du hast es immer gekonnt. Du musstest nur den richtigen Gedanken finden.“
Ich drehte mich in der Luft, zuerst zögerlich, dann immer mutiger, als die Welt unter mir immer kleiner wurde. Es war ein unglaubliches Gefühl von Freiheit – als würde ich alles hinter mir lassen können, als gäbe es keine Grenzen mehr. Ich war nicht mehr an einen festen Ort gebunden, konnte durch den Himmel gleiten, als wäre ich ein Teil von ihm.
„Ab jetzt wird alles gut,“ sagte Peter, seine Stimme ruhig und vertrauensvoll. Es war ein Versprechen, das ich ohne zu zögern glaubte. Dann schwebte er zu mir heran, die Augen voller Wärme, und hielt mir seine Hand hin. Es war mehr als nur eine Einladung – es war ein Schlüssel zu einer neuen Welt, einem völlig neuen Leben.
„Harlow Lorelei,“ sagte er, fast feierlich, „komm mit zum Nimmerland.“
Ich sah einen Moment lang auf seine Hand, die mir wie eine Verheißung der Freiheit erschien. Dann, ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, griff ich nach ihr. Und in diesem Augenblick, als meine Hand seine ergriff, wusste ich, dass sich mein Leben für immer verändern würde. Alles, was ich bis dahin gekannt hatte, war nichts im Vergleich zu dem, was vor mir lag. Ich war bereit für das Nimmerland.
Aus dem Waisenhaus ins Himmelreich
„Zweiter Stern rechts und geradeaus bis zum Morgen,“ antwortete Peter mit einem triumphierenden Funkeln in seinen hellwachen Augen, als ich ihn fragte, wo das Nimmerland lag. Seine Stimme hatte einen Rhythmus, fast wie ein Lied, das nur er kannte. Seine Worte klangen so simpel und gleichzeitig wie ein Rätsel, ein Geheimnis, das nur er entschlüsseln konnte. Zweiter Stern rechts und dann geradeaus bis zum Morgen? Es war eine Wegbeschreibung, die in jeder anderen Situation absurd gewirkt hätte – doch hier, mit der kühlen Nachtluft, die an mir zerrte, und den unendlich funkelnden Sternen um uns, fühlte es sich plötzlich real an.
Die Welt unter uns, die vertraute, graue Stadt mit ihren kalten Mauern und leblosen Straßen, war längst verschwunden. Stattdessen erstreckte sich ein Ozean aus Dunkelheit unter uns, nur hin und wieder von Wolkenfetzen durchbrochen, die wie Geister durch die Nacht schwebten. Der Wind spielte mit meinen Haaren, ließ sie wild um mein Gesicht tanzen. Meine Hände umklammerten Peters, der mich sicher durch diese neue, schwindelerregende Dimension führte.
„Peter,“ begann ich, meine Stimme ein wenig atemlos, während wir weiter flogen. Meine Gedanken rasten schneller als der Wind, der uns trug. „Erzähl mir mehr über diese Welt. Gibt es dort… andere Kinder wie dich und mich? Und wenn ja, was macht ihr? Wie lebt ihr überhaupt?“ Die Fragen sprudelten aus mir heraus, ein unkontrollierbarer Strom aus Neugier und Sehnsucht. Mein Herz pochte vor Aufregung, und meine Stimme zitterte vor der Vorstellung, bald in eine Welt einzutauchen, die ich mir nur vage ausmalen konnte.
Peter lachte, sein Klang war hell und frei, fast so, als hätte er selbst den Wind in seiner Stimme eingefangen. „Das sind aber viele Fragen!“ rief er, drehte sich mitten im Flug zu mir um und grinste mich an – dieses kindliche, unbesorgte Grinsen, das zugleich verspielt und geheimnisvoll war.
„Also,“ begann er schließlich, während er eine kleine Schleife flog und mich mit sich zog. Der Sternenhimmel über uns funkelte so klar, dass er fast lebendig wirkte. „Es gibt andere Kinder, ja. Die verlorenen Jungen.“ Seine Stimme wurde tiefer, voller Stolz und etwas, das wie Beschützerinstinkt klang. „Ich habe sie alle hierhergebracht. Jeden einzelnen. Sie waren… nun ja, verloren, wie ihr Name schon sagt. Niemand wollte sie, niemand hat sie gebraucht – also habe ich sie zu mir geholt.“
Ich spürte einen Stich in meiner Brust. Seine Worte klangen einfach, fast beiläufig, aber die Wahrheit dahinter war schmerzlich offensichtlich. Kinder, die niemand wollte. So, wie ich. Peter sprach mit einer Selbstverständlichkeit, die mich innehalten ließ, obwohl wir beide gerade über den Horizont hinwegflogen.
„Und weißt du was?“ fuhr er fort, während sein Blick sich plötzlich wieder auf mich richtete. Sein Lächeln wurde weicher, ein wenig verschmitzter. „Du bist eine Ausnahme. Du bist ein Mädchen, das ist ungewöhnlich. Aber nicht nur das – du bist hier, weil du kein Zuhause mehr hast.“
Ich hielt die Luft an, als diese Worte mich trafen. Er hatte recht. Es gab nichts, was mich zurückhielt. Kein Zuhause, kein warmes Licht in einem Fenster, das auf mich wartete.
Doch bevor ich in diesen Gedanken versinken konnte, fügte er etwas hinzu, das mich völlig aus dem Konzept brachte. „Und,“ er hielt inne, fast dramatisch, „weil ich denke, dass du Potenzial hast.“
Ich blinzelte ihn an, verwirrt. „Potenzial?“ wiederholte ich, meine Stirn in Falten gelegt. Der Wind trug meine Worte davon, doch Peter hörte sie trotzdem.
Er flog ein Stück zurück und sah mich ernst an, seine Augen glühten wie die Sterne um uns herum. „Ja, Potenzial,“ sagte er, fast feierlich. „Für Abenteuer. Für Freiheit. Für Dinge, die die Erwachsenen dir weggenommen haben, ohne dass du es bemerkt hast.“
Seine Worte ließen etwas in mir aufbrechen, ein Gefühl, das ich lange nicht gespürt hatte. Abenteuer. Freiheit. Hatte ich nicht immer davon geträumt? Von einer Welt, die größer war als alles, was ich bisher kannte?
Peter lächelte wieder, dieses freche, ansteckende Grinsen, das ihn so einzigartig machte. „Aber keine Sorge,“ sagte er und zog mich mit einem spielerischen Schwung ein Stück höher in die Luft, „du wirst alles selbst sehen. Das Nimmerland wartet nicht auf Fragen. Es wartet auf dich.“
Ich spürte, wie mein Herz vor Aufregung schneller schlug, als ich in die unendliche Weite vor uns blickte.
„Zu deiner zweiten Frage,“ begann Peter mit einem wissenden Grinsen, während er mit den Armen eine theatralische Geste machte, „ich habe dir ja schon gesagt, dass es im Nimmerland Wesen gibt, von denen man hier nur in Geschichten hört. Feen, Meerjungfrauen, Piraten – sie sind alle echt. Wirklicher, als du es dir vorstellen kannst.“
Seine Stimme klang so sicher, so überzeugt, dass ich ihn für einen Moment einfach nur anstarren konnte. Doch er fuhr bereits fort, seine Worte sprudelten wie ein Bach, der sich seinen Weg durch unbekanntes Gelände bahnte. „In unserer Freizeit besuchen wir magische Orte, die selbst die wildesten Träume übertreffen. Zum Beispiel der Nimmerwald. Ein Ort voller Magie, wo die Luft glitzert und die Schatten in den Bäumen tanzen. Dort gibt’s Feen, aber welche zu finden, ist nicht so einfach.“
Ich runzelte die Stirn und öffnete den Mund, um etwas zu fragen, doch Peter hob die Hand, als wollte er mich zum Schweigen bringen. „Geduld,“ sagte er mit einem schelmischen Lächeln. „Feen verstecken sich meistens, sie sind scheu. Aber wenn du das Glück hast, eine Fee zu finden, die sich an dich bindet...“
„Bindet?“ fragte ich, meine Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
„Ja, bindet,“ wiederholte Peter mit Nachdruck, seine Augen funkelten geheimnisvoll im Licht der Sterne. „Wenn eine Fee sich entscheidet, dich als ihren Menschen zu akzeptieren, bleibt sie dir bis zu deinem letzten Atemzug treu. Es ist eine Verbindung, die stärker ist als alles, was du je erlebt hast.“ Seine Stimme war sanft, doch es lag ein Hauch von Schwere darin, als ob die Bedeutung seiner Worte selbst ihn berührte.
Er hielt inne, und sein Blick veränderte sich. Die sonst so unbekümmerte Ausstrahlung war einer plötzlichen Ernsthaftigkeit gewichen, fast melancholisch. „Aber... wenn du stirbst, stirbt auch die Fee. Ihre Lebensenergie ist mit deiner verbunden.“
Die Worte hallten in der Stille nach, und ein leises Quietschen durchbrach plötzlich die Luft. Ich drehte mich erschrocken um und sah Glöckchen, Peters kleine Fee, die in einem sanften goldenen Licht leuchtete. Ihre zierlichen Flügel schwirrten aufgeregt, und sie hielt ihre winzigen Hände vor den Mund, als ob sie den Ausbruch ihrer eigenen Reaktion zu unterdrücken versuchte. Es war ein schriller, fast unwilliger Laut gewesen, aber es lag keine Überraschung darin.
Trotzdem schien sie das Thema zu bewegen, und ich bemerkte, wie ihre Bewegungen unruhig wurden, ein nervöses Hin und Her, als ob sie ihre Gefühle nicht ganz einordnen konnte. Peter schenkte ihr einen kurzen, beruhigenden Blick, als wolle er sie daran erinnern, dass sie nicht allein mit diesem Wissen war.
Ein Schauer lief mir über den Rücken, während ich die Tragweite seiner Worte begriff. Es war nicht nur die Verbindung zwischen Mensch und Fee, die mich faszinierte, sondern auch die Tragik, die in diesem Bund lag. Eine Treue, die so tief reichte, dass sie über Leben und Tod hinausging – und doch genau an diesen gebunden war.
Ich stellte mir vor, wie es sein müsste, eine Fee an meiner Seite zu haben. Ein Wesen, das nicht nur Licht und Magie, sondern auch bedingungslose Loyalität ausstrahlte. Jemand, der mich auf all meinen Abenteuern begleitete, ein lebendiger Funke, der für mich leuchtete, egal wie dunkel der Weg vor uns war. Doch der Gedanke, dass dieser Funke eines Tages mit mir verlöschen könnte, war bittersüß.
„Und dann gibt es noch die Meerjungfrauenlagune,“ fuhr Peter fort. Seine Stimme wurde ein wenig dunkler, geheimnisvoller. „Das ist ein Ort, der dich in seinen Bann zieht, aber auch etwas Düsteres an sich hat. Die Lagune ist wunderschön, das Wasser glitzert wie ein Edelstein und spiegelt den Mond wider. Aber es ist auch ein gefährlicher Ort. Die Meerjungfrauen sind keine freundlichen, schüchternen Wesen, wie man es vielleicht erwartet. Sie sind launisch, manchmal sogar grausam. Es ist, als ob die Lagune selbst ihre Launen teilt – dunkel, unberechenbar, aber unbestreitbar magisch.“
Ich konnte nur mit offenem Mund zuhören. Bilder formten sich vor meinem inneren Auge: glitzernde Wasserflächen, schattenhafte Feen, die durch leuchtende Wälder huschten, und gefährlich schöne Meerjungfrauen, die aus der Tiefe starrten.
„Und dann,“ setzte Peter mit einem Funkeln in den Augen hinzu, „kämpfen wir natürlich auch gerne gegen die Piraten. Das ist immer der größte Spaß.“ Er sprach diese Worte mit solcher Leichtigkeit aus, als wäre das Kämpfen gegen gefährliche Seeräuber nichts weiter als ein aufregendes Spiel.
„Piraten? Feen? Meerjungfrauen?“ Ich hörte selbst, wie ungläubig ich klang. „Wie kannst du all das aufzählen, als wäre es das Normalste der Welt?“
Peter grinste breit und flog eine kleine Kurve um mich herum, sein Gesicht vor Stolz glühend. „Weil es meine Welt ist. Und bald auch deine.“
Ich starrte ihn immer noch an, mein Herz pochte wild. „Von solchen Sachen hatte ich immer als Kind geträumt, und jetzt...“
„Jetzt wirst du genau diese Wesen sehen,“ unterbrach Peter mich, seine Stimme vor Begeisterung überschäumend, „und nicht nur sehen. Du wirst mit ihnen Abenteuer erleben – hautnah. Keine Träume mehr, Harlow. Jetzt ist es echt.“
Sein Lächeln war ansteckend, und ich spürte, wie sich die Aufregung in mir ausbreitete. Diese neue Welt, so voller Wunder und Geheimnisse, wartete auf mich. Und ich konnte es kaum erwarten, sie zu betreten.





























