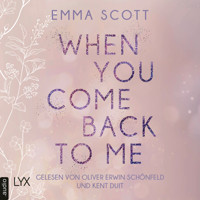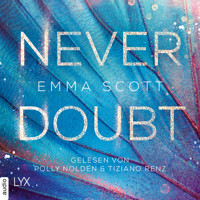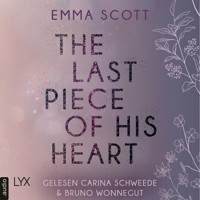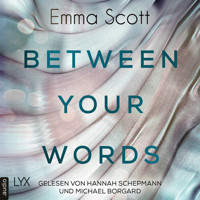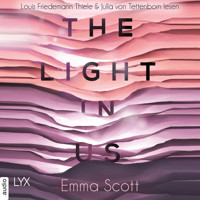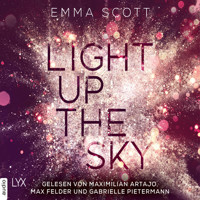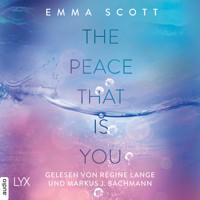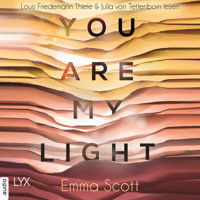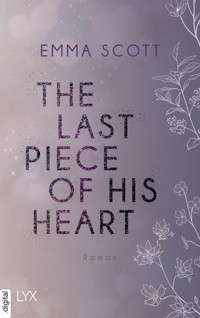
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwei gebrochene Seelen. Eine Liebe, die alte Wunden heilen kann. Wenn sie es zulassen ...
Ronan Wentz hat die Hölle gesehen. Nachts durchstreift er die Straßen, um seinen Albträumen und seiner Wut zu entfliehen. Da trifft er Shiloh, die clever und kreativ ist und scheinbar ihr Leben völlig im Griff hat. Doch alles, was Shiloh tut, hat nur ein Ziel: die Zuneigung ihrer Mutter zu gewinnen, welche ihren Anblick kaum ertragen kann. An Liebe glaubt keiner der beiden, aber die Anziehungskraft und aufkeimenden Gefühle zwischen ihnen ist zu stark, um sie zu ignorieren. Bis eine Nacht alles zum Einsturz bringt und sie sich entscheiden müssen, ob sie zulassen wollen, dass ihre Vergangenheit weiterhin ihre Zukunft bestimmt.
»Dieses Buch ist einfach nur atemberaubend. Ich weiß gar nicht, wie ich weiterleben soll, ohne mehr von den LOST BOYS zu lesen.« SHELF LOVE
Das bewegende Finale der LOST-BOYS-Trilogie
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 637
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Inhalt
Titel
Zu diesem Buch
Leser:innenhinweis
Playlist
Widmung
Prolog
Teil 1
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
Teil 2
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
Teil 3
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Teil 4
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
Teil 5
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
Epilog
Anmerkung der Autorin
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Emma Scott bei LYX
Impressum
Emma Scott
The Last Piece of His Heart
Roman
Ins Deutsche übertragen von Inka Marter
Zu diesem Buch
Ronan Wentz hatte als Achtjähriger schon die Hölle gesehen. Die nächsten zehn Jahr verbrachte er bei gleichgültigen Pflegeeltern. Jetzt hat sein Onkel ihn zu sich geholt, und obwohl dieser sich als schroff und nicht allzu liebenswert entpuppt, ist er doch die einzige Familie, die Ronan noch hat. Seiner Wut und den Albträumen, die ihn stets begleiten, kann er trotzdem nicht entfliehen, und auch die unerwartete Freundschaft mit Miller und Holden, den beiden anderen Misfits der Schule, bringt ihm nur kurze Momente der Ruhe. Nachts durchstreift er die Straßen, ohne viel Hoffnung, irgendwann wahren Frieden zu finden. Aber dann trifft er Shiloh, die clever und kreativ ist und scheinbar ihr Leben völlig im Griff hat. Doch Shiloh zeigt der Welt lediglich eine mühsam errichtete Fassade. Alles, was sie tut, hat nur ein Ziel: die Zuneigung ihrer Mutter zu gewinnen, die ihren Anblick kaum ertragen kann. An Liebe glaubt keiner der beiden, aber die Anziehungskraft und aufkeimenden Gefühle zwischen ihnen ist zu stark, um sie zu ignorieren. Bis eine Nacht alles zum Einsturz bringt und sie sich entscheiden müssen, ob sie zulassen wollen, dass ihre Vergangenheit weiterhin ihre Zukunft bestimmt.
Liebe Leser:innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte.
Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
Playlist
Everybody Knows // Concrete Blonde (Vorspann)
Roots // Imagine Dragons
Young, Gifted, and Black // Nina Simone
The Most Beautiful Girl in the World // Prince
Hunger // Florence + the Machine
Let Me Blow Ya Mind // Eve (feat. Gwen Stefani)
Black Hole Sun // Soundgarden
Liggi // Ritviz
Heathens // Twenty-One Pilots
Physical // Dua Lipa
Umbrella // Rihanna (feat. Jay-Z)
She Will Be Loved // Maroon 5
Skin and Bones // Cage the Elephant
Lightning Crashes // Live
Bright Lights // The Weeknd (Abspann)
Für meine Leser:innen. Mit all meiner Liebe. Ihr habt den Lost Boys die Tür zu euren Herzen geöffnet und sie beschützt.
Prolog
Ronan
»Nennen Sie fürs Protokoll Ihren vollen Namen.«
»Ronan August Wentz.«
»Alter?«
»Neunzehn.«
»Wissen Sie, warum Sie hier sind, Ronan?«
Weil der Weg hier zu Ende ist.
Zwei Detectives warteten auf eine Antwort. Einer war klein und rundlich – auf seiner Marke stand Kowalski. Harris war größer und trug einen Schnurrbart. Ich verschränkte die Arme und tat so, als würde dieser beschissene weiß gestrichene Verhörraum mir nicht die Luft abdrücken. Auf dem Tisch standen Styroporbecher mit schwarzem Kaffee neben einer dicken Akte mit meinem Namen. Eine Kamera in einer Ecke richtete ihr schwarzes Auge auf uns und nahm alles auf.
Die Detectives tauschten Blicke angesichts meines eisernen Schweigens, dann stand Harris auf und ging hinter dem Kleineren, Kowalski, auf und ab.
»Wo waren Sie in der Nacht des dreizehnten Juli um dreiundzwanzig Uhr?«
»Zu Hause.«
»Was haben Sie gemacht?«
»Ferngesehen.«
»War jemand bei Ihnen?«
»Nein.«
Er deutete mit dem Kinn auf meine lädierten Fingerknöchel. »Wie ist das passiert?«
»Weiß ich nicht mehr.«
Es war eine beschissene Antwort, aber die Wahrheit war nicht viel besser.
Kowalski verzog den Mund. »Sie wissen es nicht mehr?«
»Dürfen Sie mich so was überhaupt ohne Anwalt fragen?«
»Glauben Sie, dass Sie einen Anwalt brauchen, Ronan?«
»Wir unterhalten uns nur«, unterbrach ihn Harris. »Ihre Hände sind ziemlich schlimm verletzt.« Er nahm meine Akte vom Tisch. »In Ihrer Umgebung werden viele Leute schlimm verletzt, oder, Mr Wentz? Angefangen mit Ihrer Mutter.«
Ich versteifte mich, wappnete mich.
»Ich will sagen, dass Sie in einem gewalttätigen Umfeld aufgewachsen sind«, fuhr der Detective beiläufig fort und blätterte durch meine Lebensgeschichte: Verhaltensauffälligkeiten, Polizeiberichte wegen eines Aufenthalts im Jugendknast und die Vermerke der Sozialarbeiter aus zehn Jahren in Pflegefamilien. »Hier steht, Ihr Vater hat Ihre Mutter mit einem Baseballschläger totgeprügelt, als Sie acht waren.«
Es fühlte sich an, als hätte er mich in den Magen getreten. Doch ich nickte nur.
»Er ist nach einer Messerstecherei mit einem anderen Insassen im Gefängnis gestorben?«
Ich verschränkte die Arme. »Er hat gekriegt, was er verdiente.«
Falsche Antwort.
Die Cops hoben die Augenbrauen. Wieder tauschten sie einen vielsagenden Blick: Jetzt kommen wir langsam weiter.
»Sie waren Zeuge, nicht wahr? Als Ihr Dad Ihre Mom ermordet hat?«
Ich zuckte zusammen, da sich die blutbefleckten Erinnerungen aus ihrem Grab befreien wollten. Sie blieben nicht tot, egal wie tief ich sie vergrub.
»Kann ein Kind ziemlich fertigmachen, so was mit ansehen zu müssen«, stellte Harris grimmig fest.
»Hat es Sie wütend gemacht, Ronan?«
»Wütend genug, um selbst mal zuzuschlagen?«
»So extreme Gewalt liegt in der Familie, sagt man.«
»In der DNA.«
»Wie der Vater, so der Sohn.«
Die letzten Worte hingen zwischen uns, nahmen mir die Luft zum Atmen. Meine größte Angst, laut ausgesprochen. Ich setzte mich anders hin und schwieg.
»Zurück zu unserem aktuellen Problem«, sagte Kowalski endlich und nahm jetzt selbst die Akte. »Hier steht, Sie haben an Ihrem ersten Tag in der Central High Frankie Dowd die Nase gebrochen.«
»Er hat meinen Freund bedroht.«
»Also haben Sie ihm einfach so ohne Vorwarnung eine verpasst.«
»Miller wär fast gestorben, verdammt.«
»Miller Stratton?« Der Cop las in der Akte. »Zum Zeitpunkt des Angriffs war er nicht Ihr Freund. Sie hatten ihn davor noch nie gesehen, oder etwa doch?«
Er ist jetzt mein Freund, Arschloch.
Ich würde sterben für Miller Stratton. Für Holden Parish.
Für Shiloh …
Schmerz machte sich in meiner Brust breit. Kowalski klopfte auf den Tisch, um mich aus meinen Gedanken zu reißen.
»Anscheinend haben Sie den Ruf, grundlos gewalttätig zu werden. Stimmt das?«
Ich versteifte mich und schwieg.
Ich habe es versucht. Ich habe versucht, mich zu bessern …
»Gehen wir noch einmal in die Vergangenheit zurück, ja?« Harris warf wieder einen Blick in die Akte. »In einem einzigen Schuljahr sind Sie nicht weniger als sechsmal von der Santa Cruz Central High suspendiert worden. Vandalismus, tätlicher Angriff … Vor zwei Monaten hatten Sie eine körperliche Auseinandersetzung mit Miller Strattons Stiefvater. Haben ihn im ersten Stock von einer Brüstung hängen lassen.«
Ich knirschte mit den Zähnen. Ich hatte niemanden irgendwo runterhängen lassen. Ich hatte das Arschloch Chet Hyland über das Geländer gelegt, damit er Millers Mutter in Ruhe ließ. Und es hatte funktioniert. Aber wen kümmerte das schon. Diese Arschlöcher waren nicht an der Wahrheit interessiert – weil die nicht zu der Geschichte passte, die schon über mich geschrieben worden war. Geschrieben mit dem Blut meiner Mutter. Und dem meines Vaters. Seinem Blut, das in meinen Adern floss.
Wie der Vater, so der Sohn.
»Also?«
»Chet war nicht sein Stiefvater«, murmelte ich. »Er war ein Versager, der Millers Mom geschlagen hat. Aber das interessiert Sie wohl nicht.«
Die Cops tauschten Blicke.
»Haben Sie ein Problem mit der Polizei?«
Eine alte Erinnerung kam an die Oberfläche: Meine Mutter schleppt sich verletzt und blutend in eine Ecke, mein Vater steht mit einem Baseballschläger über ihr …
Ihr habt meine Mom im Stich gelassen, und jetzt ist sie tot, dachte ich. Aber war das bloß gegen die Cops gerichtet, oder galt Entsprechendes nicht auch für mich? Sie hatten sie im Stich gelassen, aber ich auch. Ich hatte sie nicht beschützen können.
Und ich hatte auch Shiloh nicht beschützen können.
Schuldgefühle, Zorn und Trauer – die drei Affen auf meinem Rücken – schrien und heulten.
Kowalski sah mich scharf an. »Beantworten Sie die Frage, Junge.«
»Leute brauchen Hilfe«, sagte ich. »Und wenn sie die von Ihnen nicht kriegen, helfe ich.«
»Oh, Mann, was für eine Selbstjustiz-Scheiße.« Kowalski verdrehte die Augen. »Es ist also Hilfe, einem Mann zu drohen, ihn aus dem ersten Stock runterzuwerfen?«
Ich grinste höhnisch. »Danach hat er sie in Ruhe gelassen, oder?«
»Was ist mit Frankie vor zwei Nächten? Haben Sie da auch ›geholfen‹?«
»Ich hab ihn nicht angerührt.«
»Sie haben Franklin Dowd in der Nacht des dreizehnten Juli nicht gesehen?«
Ich rutschte auf dem Stuhl herum. Eine Schweißperle kroch zwischen meinen Schulterblättern hinunter wie ein Insekt. »Ich hab nicht gelogen.«
»Kommen Sie, Wentz«, sagte Harris. »Hören Sie auf, die Sache kompliziert zu machen. Wir wissen alle, was passiert ist.«
Kowalski zählte es an seinen Fingern ab: »Es gibt gut dokumentierte Feindseligkeiten zwischen Ihnen und Frankie Dowd. Sie haben ihm die Nase gebrochen, kurz nachdem Sie ihn zum ersten Mal gesehen hatten. Fünfzig Zeugen können bestätigen, dass Sie ihn auf einer Party am neunten September letzten Jahres im Kampf zu Boden gerissen haben, und vor ein paar Monaten hat man gehört, dass Sie ihm drohten, ihn, Zitat, zu Brei zu schlagen, sollte er je jemandem etwas tun, der Ihnen wichtig ist.«
Harris verschränkte die Arme. »Shiloh Barrera ist Ihnen wichtig, stimmt’s?«
»Ja«, sagte ich. Und das war das Wahrste, was ich an diesem Abend gesagt hatte.
»Und Frankie hat ihr etwas getan«, fuhr Harris fort. »Also haben Sie Ihr Versprechen gehalten und ihn zu Brei geschlagen. Und zwar so richtig. Oder nicht?«
»Ich hab gesagt, ich …«
»Er liegt im Krankenhaus, Ronan«, sagte Kowalski. »Er kämpft um sein Leben.«
Harris nickte. »So was nennt man ein Motiv.«
»Und Sie sitzen hier mit geschwollenen und zerschrammten Fäusten. Aber ausgerechnet diesmal war es jemand anders. Das wollen Sie uns sagen?«
Ich hob das Kinn. »Genau das sag ich, verdammt noch mal.«
Harris seufzte. »Sie machen es nur schlimmer, Wentz. Der Fall liegt auf der Hand. Gestehen Sie, dann bietet man Ihnen vielleicht einen Deal an. Natürlich nur, wenn Ihr Opfer überlebt.«
Ich ballte unter dem Tisch die schmerzenden Hände zu Fäusten. Mir stand ein Anwalt zu. Ein Telefonanruf. Aber was würde das bringen? Ich galt schon als schuldig, bevor sie mich auf diesen Stuhl gesetzt hatten.
Harris legte den Kopf schief. »Wollen Sie wissen, was ich denke, Ronan?«
Ich wusste schon, was er dachte.
Dies war das Ende des Weges.
Wie der Vater, so der Sohn.
Es tut mir leid, Shiloh. Ich hab’s versucht …
Der Detective beugte sich vor, sein Ton war kalt und endgültig. Wie eine Tür, die zuschlug. »Ich denke, Sie wandern für sehr lange Zeit ins Gefängnis.«
Teil 1
1. Kapitel
Shiloh
Ein Jahr zuvor …
»Ich muss los«, sagte ich und zog meinen Rollkoffer in das opulent eingerichtete Wohnzimmer meines Onkels und meiner Tante. »Ich muss mein Flugzeug kriegen.«
Ich hasste es, das Offensichtliche auszusprechen, aber wenn ich nicht laut verkündete, dass ich abreiste, könnte meine Mutter, die in der Küche des Hauses saß, es völlig ignorieren. Sie daran zu erinnern, dass ein ganzes Jahr vergehen würde, bevor sie ihre einzige Tochter wiedersah, könnte ihre kalten Mauern vielleicht niederreißen, damit sie mir gegenüber ein bisschen Wärme zeigte.
Keine Chance.
Draußen vor dem Fenster herrschte in New Orleans rege Betriebsamkeit an diesem schwülen Sommermorgen, während Mama sich über den Tisch am Küchenfenster beugte, ihre Zigarette rauchte und das sonntägliche Kreuzworträtsel machte. Unnahbar und weit weg. Genau wie schon am Anfang dieses Urlaubs, vor sechs Wochen, und bei jedem Sommerbesuch, an den ich mich erinnerte, seit ich vier war und sie mich bei meiner Urgroßmutter Bibi in Kalifornien abgegeben hatte.
Tante Bertie – rundlich und farbenfroh in einer violetten Bluse und passender Hose – gab einen mitfühlenden Laut von sich. Sie saß zwischen meinem Onkel Rudy und ihrer fünfundzwanzigjährigen Tochter Letitia auf der Couch. Ein Vorsaison-Spiel der Saints lief lärmend auf dem Flachbildfernseher.
»Ist es schon wieder so weit?«, fragte Tante Bertie und schnalzte mit der Zunge. »Mir kommt es vor, als seist du gerade erst angekommen.«
Bei meinen Besuchen im Sommer wohnte ich immer in dem viktorianischen Haus meines Onkels und meiner Tante im Garden District. Es war ein wunderschönes altes Haus, das Tante Bertie in warmen Farben und mit Kissen mit Samttroddeln nach ihrem Geschmack dekoriert hatte. Das Buntglasfenster in der Haustür warf einen Regenbogen auf den Teppich.
Ich liebte das Haus und die Menschen darin, aber ich hätte alles gegeben, um bei Mama in ihrem kleinen Shotgun-Haus in der Old Prieur Street im Seventh Ward zu wohnen. Sie sagte, es sei zu klein, aber das war mir egal. Ich hätte auf der Couch geschlafen. Auf dem Fußboden …
»Der Sommer ist wie im Flug vergangen, Schätzchen«, sagte Tante Bertie. »Wenn wir uns das nächste Mal sehen, bist du eine Highschool-Absolventin.« Sie betrachtete mich in meiner weich fließenden Hose und dem engen, weißen bauchfreien T-Shirt. »Ganz wunderhübsch siehst du aus, Shiloh. Und du bist so schnell gewachsen. Nicht wahr, Marie?«
Mama gab einen unverbindlichen Laut von sich und sah nicht von ihrem Kreuzworträtsel auf.
Bleib stark, sagte ich mir und wehrte mich gegen den Schmerz, der sich einen Weg zu meinem Herzen suchte. Du weißt genau, dass du nicht mehr erwarten kannst.
Und trotzdem hörte mein dummes Herz nie auf, zu Mama vordringen zu wollen, egal wie sehr es wehtat.
»Bevor ich fahre, habe ich noch etwas für euch.« Ich stellte meine Tasche auf den Couchtisch und holte vier kleine, mit Seidenpapier gefütterte Geschenktütchen heraus.
»Du Süße. Das war doch nicht nötig.« Ein Lächeln zeigte sich auf Berties Gesicht, als sie den Finger in eins der Tütchen steckte. »Sind da etwa Originalkreationen von Shiloh Barrera drin?«
Ich lächelte. »Vielleicht.«
»Mensch, Mensch«, sagte Onkel Rudy und löste den Blick von seinem Footballspiel. »Weihnachten ist aber früh dieses Jahr.«
Ich verteilte die Tütchen an meine Tante, meinen Onkel und meine Cousine. Eines blieb übrig. Für Mama.
Cousine Letitia legte sich ihres erwartungsvoll auf den Schoß. Selbst an einem Sonntag war sie super gestylt in Markenjeans, gelben High Heels und einem kurzen Oberteil, das ihre trainierten Bauchmuskeln zeigte. Ihre Braids hatte sie gekonnt hochgesteckt, nur ein paar hingen herunter und umschmeichelten die goldenen Ohrhänger.
»Ich liebe es jetzt schon«, sagte sie.
Ich lachte. »Du weißt noch gar nicht, was es ist.«
»Du hast es gemacht, also muss es wundervoll sein.«
Ich schluckte und riskierte noch einen Blick auf Mama, die sich nicht von ihrem Platz in der Küche rührte.
Tante Bertie holte eine Türkis-Brosche aus ihrem Tütchen. Ich hatte die silberne Filigranarbeit geschwärzt, um ihr einen antiken Touch zu verleihen. Tante Bertie legte sich eine Hand auf die Brust. »Oh, wie wunderbar, mein Schatz. Das ist das Schönste, was ich je gesehen habe. Warum wartest du bloß bis zum letzten Moment, um uns diese herrlichen Geschenke zu geben?«
Ich grinste. »Damit ihr nur so lange so tun müsst, als würden sie euch gefallen, bis ich aus der Tür bin!«
»Pfft, diese Brosche ist einfach wundervoll.« Tante Bertie steckte sie sich an die Bluse und breitete die Arme aus. Ich beugte mich über den Tisch, und sie umfing mich, weich und nach Parfüm duftend. »So ein talentiertes Mädchen. Du kriegst diesen Laden, von dem du träumst. Das fühle ich.«
»Danke, Tantchen«, sagte ich und genoss ihren Glauben an mich. Die Liebe, die sie mir einfach so schenkte.
»Das ist ja was.« Onkel Rudy drehte einen Schlüsselanhänger aus Zinn mit dem Fleur-de-Lys-Logo der Saints in den Händen. »Den hast du selbst gemacht? Warte, bis die Jungs das sehen. Danke, Kindchen.«
Er war so stolz, dass ich einen Kloß im Hals bekam. Ich nickte, lächelte schwach und sah weg. Es war so viel leichter, meinen Schmuck im Internet an Fremde zu verkaufen, die keine rührseligen, mir unangenehmen Gefühle an die Oberfläche lockten.
»Wow, unglaublich«, sagte Letitia und zog ein Paar Ohrringe aus ihrem Tütchen: leuchtender Lapislazuli, kunstvoll mit Silberdraht umwunden. Sie nahm die Ohrhänger, die sie trug, sofort raus und tauschte sie gegen meine. »Machst du Witze? Du bist so wahnsinnig begabt, Shi. Meine Mama hat recht. Du wirst etwas daraus machen.«
»Danke, Teesh«, sagte ich und berührte die Henkel des letzten Tütchens.
Während Letitia und Rudy ihre Geschenke verglichen und voreinander damit angaben, lächelte Tante Bertie mich sanft an. Voller Mitgefühl. »Marie«, rief sie in die Küche. »Shiloh hat etwas für dich.«
Das konnte Mama nicht ignorieren.
Sie stand von ihrem Platz am Küchenfenster auf und kam langsam auf mich zu. Es tat weh, das Widerstreben in ihren Bewegungen zu sehen.
Marie Barrera war jung – nur neunzehn Jahre älter als ich – und schön, aber voller Traurigkeit. Alle sagten, ich sei ihr wie aus dem Gesicht geschnitten, aber die Gene meines unbekannten Vaters machten meine Haut heller und minderten unsere Ähnlichkeit.
»Wenigstens das ist kein Geheimnis«, hatte Jalen Jackson – mein Fuckbuddy hier in Louisiana – vorige Nacht im Bett unverblümt festgestellt. »Jemand hat Milch in den Kaffee deiner Mutter getan.«
Aber die offensichtliche Tatsache, dass mein Vater weiß war, füllte nicht das riesige Loch, das sein Fehlen in meinem Leben hinterließ. Er war wie ein Geist, der die Familie durch mich heimsuchte. Niemand erwähnte ihn. Am wenigsten Mama. Nach dem bisschen, was ich in siebzehn Jahren mitgekriegt hatte, war ich das Produkt eines One-Night-Stands. Unerwartet und ungewollt. Mama hatte mit einem vollen Stipendium an der Louisiana State University studiert und eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, bis sie schwanger war. Jetzt arbeitete sie Teilzeit in einer Bank, ihre Träume von einem Job im Marketing waren für immer aufgeschoben. Wer mein Vater auch sein mochte, sie hatte ihn aus ihrem Leben verbannt und weigerte sich, je wieder von ihm zu sprechen.
Es ergab überhaupt keinen Sinn. Warum hatte meine Mutter trotz einer großen Familie, die bereit war zu helfen, das Studium geschmissen? Warum hatte sie mich nicht zur Adoption freigegeben?
Warum hatte sie mich überhaupt bekommen?
Niemand sagte es mir. Aber trotz all der Geheimnisse, die meinen Vater umgaben, war eins absolut klar: Mama sah ihn, wenn sie mich ansah, und ihr gefiel nicht, was sie sah.
Ihr Lächeln flackerte wie eine altersschwache Glühbirne, als ich ihr das Geschenktütchen gab. Sie nahm es langsam in Empfang, blickte zögernd hinein. »Was ist das?«
»Es ist nichts. Nur … eine Kleinigkeit.«
Mama zog einen gehämmerten Kupferarmreif mit grünlicher Patina heraus und hielt ihn ans Licht.
»Es sollte wie etwas aussehen, was aus einem gesunkenen Schiff geborgen wurde«, sagte ich, und meine sonst kräftige Stimme zitterte leicht. »Ich weiß, dass du die immer faszinierend fandst.«
Ich sah mit angehaltenem Atem, wie sie den Armreif in den Händen drehte. Tränen füllten ihre braunen Augen – Augen wie meine –, und zum ersten Mal in diesem Sommer sah sie mich richtig an. Dann ließ sie den Armreif wieder in die Tüte fallen, als hätte sie sich daran verbrannt.
»Er ist sehr schön. Danke.«
Sie blinzelte die Tränen weg und umarmte mich kurz und steif. Ich wollte in ihre Arme sinken, in den Geruch nach Zigaretten und Jasminparfüm. Aber kaum, dass ich ihre Arme um mich spürte, waren sie auch schon wieder weg.
»Sei brav. Arbeite hart. Grüß Bibi von uns.«
Und was ist mit mir?
Ich atmete scharf ein, als könnte ich den Gedanken auf die Weise zurücknehmen. Schwach zu sein und um das zu betteln, was ich nicht bekam, würde mich nirgendwohin bringen. Ich war klug genug, nicht einmal daran zu denken. Ich war stärker als das.
»Auf Wiedersehen, Mama«, sagte ich.
Aber sie hatte sich schon wieder an den Tisch zurückgezogen, zu ihrem Kreuzworträtsel und dem Zigarettenrauch. Das Tütchen stellte sie zu ihren Füßen auf den Boden, und es sah klein und schon vergessen aus.
»Komm, ich fahre dich, Liebes«, sagte Onkel Rudolph sanft in die gefühllose Stille, die Mama hinterlassen hatte.
»Danke, Onkel Rudy«, sagte ich und grinste ironisch. »Aber ich kann dich unmöglich von diesem sehr wichtigen und doch bedeutungslosen Vorsaison-Spiel der Saints wegholen. Ich nehme ein Uber.«
Onkel Rudy grinste zurück. »Du kleiner Naseweis.«
Tante Bertie schnaubte. »Ein Uber? Du willst zu einem Fremden ins Auto steigen? Ein hübsches Mädchen wie du?«
In der Küche zuckte meine Mutter zusammen. Oder vielleicht fröstelte sie nur wegen der Klimaanlage.
»Danke, Tante B, aber ich krieg das schon hin.«
»Unsinn. Rudy fährt dich, und damit basta.«
Mein Onkel zwinkerte mir zu, seine weißen Zähne strahlten in seinem dunkelbraunen Gesicht. »Du hast den Boss gehört.«
»Von dem Klappergestell will doch sowieso keiner was.« Letitia lachte und rollte meinen Koffer zur Tür. »Von Jalen hast du dich schon verabschiedet?«, fragte sie mit hochgezogenen Augenbrauen und einem wissenden Grinsen.
Ich warnte sie mit einem wütenden Blick, leise zu reden. »Gestern Nacht.«
Sie verzog die Miene. »Du wirst dem Jungen noch das Herz brechen.«
»Geht nicht. Wir haben eine Abmachung«, sagte ich leise, und meine Wangen wurden heiß. Ich hasste alles, was Klatsch auch nur im Entferntesten ähnelte, während meine Cousine davon lebte. »Keine Bindung, keine Verpflichtungen.«
»Dein Motto.«
Ich sah zu meiner Mama. Ich hab von den Besten gelernt.
»Ich werd dich vermissen.« Letitia strich mit dem Finger über Hunderte Mikro-Braids, die mir weich über die Schultern fielen. »Gibt es in Kalifornien jemanden, der kann, was ich kann?«
Letitia war noch nicht mal dreißig und bereits Inhaberin eines Schönheitssalons in der Canal Street mit dem Namen »Das Studio«. Sie war mir Vorbild und Inspiration für meine eigenen Pläne.
»Keine Chance.«
»Cool, dann wirst du wiederkommen müssen und mich aufsuchen. Und Jalen.«
»Ach, halt den Mund.«
Letitia lachte und umarmte mich ein letztes Mal.
Onkel Rudy kam zur Tür und nahm meinen Rollkoffer. »Fahren wir, Liebes.«
Bertie und Letitia winkten, wünschten mir eine gute Reise und alles Gute und hüllten mich darin ein.
Und in der Küche saß Mama wie ein kalter Luftzug in der feuchten, stickigen Augusthitze von New Orleans.
Ich erschauderte und ging hinaus.
Das Flugzeug landete um ein Uhr mittags in Kalifornien. Nach einer Uber-Fahrt zog ich meinen Rollkoffer den Weg zu unserem gemütlichen Bungalow hoch. Die Luft in Santa Cruz war kühler, mit einem Hauch von Salz, und die Bäume reichten von den Bergen herunter bis in unsere ruhige Straße. Eine Seite unseres Vorgartens wurde von einer riesigen Zypresse überschattet, auf der anderen prangten in allen Farben Bibis Blumenbeete.
»Zu Hause«, murmelte ich. Ich stieg die drei Stufen zur vorderen Veranda hoch und schloss die Tür auf. »Bibi, ich bin’s.«
»Da ist sie ja«, sagte meine achtzigjährige Urgroßmutter, die auf unserer unförmigen, mit Kissen übersäten Couch saß. Ihre dunkelbraune Haut war faltig – fast alles Lachfalten –, und ihr kurzes Haar inzwischen vollkommen silbern. Trotz der sommerlichen Wärme hatte sie sich in ein grün-weißes Umhängetuch gehüllt, das sie selbst gemacht hatte. Ein gelbes Wollknäuel lag neben ihren in Hausschuhen steckenden Füßen, und sie klapperte mit den Nadeln, da sie ein weiteres strickte. Unsere trägen grauen Katzen Lucy und Ethel hatten sich auf der Rückenlehne der Couch ausgestreckt.
Ich ließ den Rollkoffer an der Tür stehen und durchquerte das Wohnzimmer mit den antiken Möbeln, die eigentlich viel zu groß waren für unser kleines Haus. Jede verfügbare Oberfläche war mit irgendwelchem Kitsch vollgestellt, neben Stapeln alter Bücher, die Bibi nicht mehr lesen konnte, weil sie zu schlecht sah. Familienfotos bedeckten fast jeden Zentimeter der Blümchentapete, und aus der alten Stereoanlage erklang Nina Simone.
»Wie war es?«, fragte Bibi. »Ich hoffe, besser als letztes Jahr.«
Ich ließ mich neben ihr auf die Couch fallen und meinen Kopf auf ihrer Schulter ruhen. »Besser? Ich weiß nicht. Bertie und Rudy waren wie immer wundervoll. Letitia ist wie die Schwester, die ich nie hatte.«
»Aber …?« Bibis Nadeln klapperten.
»Aber Mama ist immer noch Mama.«
Meine Urgroßmutter tätschelte mir mit ihrer warmen trockenen Hand die Wange und seufzte. »Ach, mein Mädchen. Ich wünschte, es wäre besser zwischen euch.«
»Ich weiß nicht, warum ich überhaupt noch hinfahre.« Plötzlich brannten mir Tränen in den Augen, und ich blinzelte sie schnell weg. Ethel sprang mir auf den Schoß, und ich konzentrierte mich darauf, ihr die Ohren zu kraulen. »Sie will mich nicht um sich haben, und das sage ich nicht aus Selbstmitleid. Das ist eben so.«
»Aber sie will dich dahaben, Liebes«, sagte Bibi. »Sie zeigt es dir auf die einzige Art, zu der sie fähig ist.«
»Indem sie mich ignoriert?«
»Indem sie dich bittet zu kommen. Für eine Zeit dort zu sein.«
»Nicht gerade eine schöne Zeit. Es ist, als würde es ihr körperliche Schmerzen bereiten, mich anzusehen. Ich meine, ich kann’s verstehen. Ich hab ihre Zukunft ruiniert. Aber warum macht sie sich überhaupt die Mühe? Warum mach ich sie mir?«
»Weil da Liebe ist, auch wenn es schwer ist, sie zu sehen.«
Sie hätte mich nicht behalten müssen.
Mir schauderte, als ich das dachte, denn zweifellos musste meine Mutter denselben Gedanken gehabt haben. Manchmal, wenn ich sie ansah, empfand ich ein merkwürdiges erinnertes Schwindelgefühl, als hätte ich irgendwann mal wankend auf dem schmalen Grat zwischen hier und dem Nichts gestanden.
»Denk das nicht, Shiloh.«
Bibi war vielleicht offiziell blind, aber sie sah alles.
»Ich kann nichts dagegen tun«, sagte ich leise. »Warum hat sie mich bekommen, wenn es so hart für sie werden würde?«
Bibi dachte einen Moment nach. »Das Herz einer Frau ist kein Raum, in dem sich ihre Gefühle und Entscheidungen klar umrissen von weißen Wänden abheben wie Ausstellungsstücke. Es gleicht tiefen Katakomben, die wir unser ganzes Leben lang ergründen. Deine Mama sucht sich einen Weg durch die ihren, aber sie kommt nur langsam voran. Weil sie sich verlaufen hat.«
Ich sah meine Urgroßmutter an, die Frau, die mich großgezogen hatte, der ich vertraute und die ich mehr liebte als irgendjemanden sonst. »Was ist passiert, Bibi?«
Sie seufzte, ihr Busen hob sich unter dem Hauskleid. »Ich wünschte, ich könnte es dir sagen, Herzchen. Aber Marie hat sich verschlossen, um sich zu schützen.« Sie sah mich bedeutungsvoll an. »Genau wie du.«
Nach siebzehn Jahren war ich an Bibis sanfte Ermahnungen gewöhnt, mein Herz für andere Erfahrungen zu öffnen. Aber obwohl sie so weise war, verstand sie es nicht. Ich musste hart arbeiten, um etwas aus mir zu machen und zu beweisen, dass ich die Entscheidung wert war, die Mama getroffen hatte.
Wenn man sein Herz öffnet, kommt nur Schmerz hinein.
»Hast du deinen Liebsten wiedergesehen?«, fragte Bibi nach einer Minute.
»Jalen ist nicht mein Liebster. Wir haben eine Abmachung.«
»Eine Abmachung. Wie romantisch.« Sie runzelte über ihrem Strickzeug die Stirn. »Ich würde mich besser fühlen, wenn du heulend nach Hause kämst, weil du den Jungen so vermisst und nicht weißt, wie du überleben sollst, bis du ihn das nächste Mal siehst.«
»Uh, nein danke. Ich werd sicher nicht gefühlsduselig wegen eines Jungen.«
Die Ablehnung meiner Mutter war schon schwer genug zu ertragen, besten Dank. Bibi hatte das Herz einer Frau mit Katakomben verglichen. Meins war eher wie ein heruntergekommenes Hotelzimmer, das ich lieber abschloss, so gut es ging. Auf keinen Fall würde ich irgendeinen Typen da reinlassen, damit er noch mehr kaputt machte.
Bibi gab einen missbilligenden Laut von sich. »Ihr zwei passt auf, nehme ich an.«
»Natürlich.«
Wir verhüteten, und ich passte auf, dass Jalen nicht auf die Idee kam, ich würde mehr wollen. Aber ich musste mir keine Sorgen machen. Wir kannten uns seit Jahren, und unsere Freundschaft hatte sich, als wir vierzehn wurden, auf experimentelles Rumknutschen ausgeweitet. Er war der ideale Fuckbuddy: sexy, schlau und nicht daran interessiert, sich mit Gefühlen anzustecken. Genau, was ich brauchte.
»Immer vorsichtig, meine Shiloh«, sagte Bibi zu ihrem Strickzeug. »Vorsichtig, getrieben, ehrgeizig.«
»Du sagst das, als wäre das etwas Schlechtes. Und apropos, wenn ich nichts für dich tun kann, muss ich in die Garage.«
»Jetzt schon? Du bist gerade erst nach Hause gekommen.«
»Ich muss einen Haufen Online-Bestellungen abarbeiten.«
Sie seufzte. »Und Tag und Nacht fleißig. Meine eigene kleine Tiana.«
Ich grinste. Küss den Frosch war auch so ein Lieblingsthema von Bibi. Der süße Disney-Film war irgendwie zu einer Metapher für mein Leben geworden.
»Sie hat ihr Restaurant gekriegt, oder?«, sagte ich.
»Sie hat auch gelernt, auf dem Weg dahin der Liebe Platz einzuräumen.«
»Darf ich dich daran erinnern, dass Tiana auch – für kurze Zeit – ein Frosch war? Es ist ein Märchen. Das hier ist die reale Welt.«
Bibi rümpfte die Nase, die Nadeln arbeiteten. »Mag sein, aber mir gefällt es nicht, dass du immer den ganzen Tag in dieser Garage hockst. Es ist nicht gesund und muss aufhören.«
»Aufhören?« Ethel spürte meine Anspannung und sprang von meinem Schoß. »Aber … ich brauche die Garage. Ich arbeite da. Sie ist …«
»Nicht gut genug für dich«, sagte Bibi und lächelte vor sich hin. »Weshalb ich eine Anzeige aufgegeben habe. Ich werde einen Handwerker beauftragen, dir eine Werkstatt zu bauen.«
»Eine Werkstatt. Wo?«
»Hinten im Garten.«
Ich blinzelte. Abgesehen von dem Gemüsebeet und der kleinen Terrasse, sah unser Garten aus wie die nordkalifornische Version eines tropischen Dschungels.
Bibi las meine Gedanken wie so oft. »Der Mann kann das Gestrüpp beseitigen und dir einen kleinen Schuppen bauen für die Werkzeuge und die chemischen Poliermittel und was du noch so hast. Ich werde keine Minute länger zulassen, dass du diese Dämpfe einatmest.«
Ich lehnte mich zurück und sah es schon vor mir: meine eigene kleine Werkstatt mit einem richtigen Tisch, an dem ich eine Schraubzwinge befestigen könnte, statt dem klapprigen alten Ding, das in der Garage stand. Ich könnte die Etsy-Bestellungen abarbeiten und nebenbei noch Stücke fertigen, die ich irgendwann in einem richtigen Laden im Zentrum von Santa Cruz verkaufen würde. Das war immer mein Traum gewesen. Eines Tages. Jetzt, dank dieser unglaublichen Frau, war eines Tages ein Stück näher gerückt.
Dann löste sich die Vision auf wie eine Fata Morgana.
»Das können wir uns nicht leisten, Bibi.«
»Mach dir um das Geld mal keine Sorgen. Ich habe mir meine Ersparnisse angesehen, und es ist genug da. Und was sollte ich sonst damit anstellen? Um die Welt reisen? Ich fühl mich hier pudelwohl.« Sie lächelte. »Es wird kein Schloss werden, also mach dir nicht zu große Hoffnungen. Aber du brauchst eine Werkstatt, Shiloh. Du hast so großes Talent – das ist schon lange klar. Und ich ziehe dich zwar auf, dass du für andere Dinge Platz schaffen sollst in deinem Leben, aber ich weiß auch, wie wichtig dir die Arbeit ist. Das ist nicht irgendein Hobby.«
»Nein«, sagte ich leise. »Es ist mein Leben.«
Sie berührte meine Wange. »Ich will tun, was ich kann – so gering es auch ist –, um dich deinen Träumen näher zu bringen. Auch wenn das heißt, dass ich dann noch weniger von dir sehe.«
Ich legte die Arme um Bibi. »Ich kann dir nicht genug danken. Aber ich kann auch etwas zahlen. Den Handwerker oder das Material …«
»Das verbiete ich. Du brauchst jeden Dollar für deinen Laden. Ich schenke es dir und will nichts mehr davon hören.«
Ich umarmte sie fester. »Danke, Bibi.«
»Gern geschehen, Kind. Jetzt geh. Ich weiß, du willst an die Arbeit gehen. Ich spüre es in deinen Knochen.«
Ich lachte und küsste sie auf die Wange. »Ich hab dich lieb.«
»Ich dich auch, mein Schatz.« Sie warf mir eine Kusshand zu, dann strickte sie weiter, Nina Simones »Young, Gifted and Black« mitsummend, ein wissendes, zufriedenes Lächeln auf dem wettergegerbten Gesicht.
Ich eilte in die Garage, wo meine in Plastikbehälter gestopften Materialien an einer Wand lagerten. Ein kleiner Tisch stand vor Bibis altem Buick, der jetzt mir gehörte. Die einzelne Glühbirne war nicht hell genug, aber ich hasste es, bei offener Garagentür zu arbeiten. Ich fühlte mich dann ungeschützt. Jeder, der mit seinem Hund spazieren ging oder den Müll rausbrachte, könnte sehen, was ich tat. Ungestört hinten im Garten zu arbeiten wäre ein Traum. Das nächste Level.
Und das Level danach ist mein eigener Laden.
Ich steckte mir die Ohrhörer ins Ohr und hörte Rihanna, als ich mich an mein letztes Projekt setzte. Kurz bevor ich nach Louisiana gefahren war, hatte ich Messing- und Kupferdraht geflochten, um vielleicht ein Armband daraus zu machen. Ich fühlte mich sofort wohl auf meinem Hocker, schob das unbearbeitete Armband über ein Mandrel und nahm einen Kunststoffhammer zur Hand. Vorsichtig hämmerte ich das geflochtene Metall auf dem zylinderförmigen Werkzeug in Form, bis es vollkommen rund war und die gewünschte Größe hatte.
In wenigen Minuten hatte ich das Stück fertig, für eine Frau namens Christine in Texas, die es über meine Etsy-Seite bestellt hatte. Diese Webseite war genau, was ich brauchte, um meine Arbeit bekannt zu machen und ein bisschen was für meinen späteren Laden einzunehmen. Vielleicht schon nächsten Sommer.
Dank Bibi.
Mich erfüllte Liebe zu dieser Frau, wärmte mich und löschte die Erinnerung an Mamas kalte Schulter. Bibi war die einzige Person, die ich vorbehaltlos liebte.
Ich dachte über ihre Worte nach, während ich das neue Armband im Licht drehte – über ihre Warnung, dass ich so verschlossen werden würde wie meine Mutter. Gefangen hinter einer selbst errichteten Mauer und gleichzeitig verloren. Aber was sollte ich sonst tun? Jeden Stein aus Mamas Mauer verbaute ich zwangsläufig auch in meiner eigenen.
Nur so konnte ich überleben, dass meine eigene Mutter mich hasste.
2. Kapitel
Ronan
»Ronan?«
Ich drehte mich um, als ich meinen Namen hörte, sah mich in der Menge um, die am Gepäckband stand, und da war er – Nelson Wentz. Mein einziger lebender Verwandter.
Das Herz hämmerte mir in der Brust angesichts der Ähnlichkeit.
Onkel Nelson war wie ein Ausblick darauf, wie mein Dad ausgesehen hätte, wenn er es bis ins mittlere Alter geschafft hätte – Mitte fünfzig, in einer alten Jeans und mit einem Bauch, über dem die Windjacke spannte. Der Großteil von Nelsons dunklem Haar war weg, und seine Augen waren grau, stumpf und leer. Wie die eines Hais, der sich zum Töten bereit macht. Wie Dads Augen.
Wie meine.
»Hey, Onkel Nelson.«
»Nur Nelson«, sagte er. »Da bist du also, was?« Er beäugte mich von oben bis unten, registrierte die zerrissene Jeans, das schwarze T-Shirt und die Tattoos, als wäre ich ein Stück Vieh auf einer Auktion. »Sieht aus, als hätten sie dich auf dieser Farm ordentlich schuften lassen. Gut. Mein Rücken ist nicht mehr, was er mal war. Du wirst den größten Teil der schweren Sachen tragen müssen.«
Ich schob den alten Rucksack die Schulter hoch. »Wofür?«
»Das besprechen wir auf der Fahrt.« Er deutete mit dem schwabbeligen Kinn auf das Gepäckband. »Hast du Gepäck?«
Ich nickte und versuchte, meine Enttäuschung zu ignorieren.
Er schmeißt also keine Willkommensparty für dich. Komm drüber weg.
Wir warteten in angespanntem Schweigen, bis meine abgewetzte übergroße Sporttasche herum kam. Ich nahm sie vom Band und wuchtete sie mir auf die Schulter, dann gingen wir durch die elektrische Schiebetür zum Parkplatz des Flughafens San Jose.
Als ich im März achtzehn geworden war, war ich aus dem staatlichen Pflegesystem rausgefallen und seither auf mich allein gestellt gewesen. Ich hatte gejobbt, um zu überleben, zuletzt in einem Milchviehbetrieb in Manitowoc. Der Job war nur für den Sommer, und ich wäre danach obdachlos gewesen, aber meine Sozialarbeiterin rief mich an, dass sich nach zehn Jahren endlich ein Onkel gemeldet hatte. Der Bruder meines Dads hatte sich bereit erklärt, mich aufzunehmen. Ich würde nach Santa Cruz ziehen und bei einem Blutsverwandten wohnen statt bei Fremden. Vielleicht die Schule zu Ende machen. Ich würde wieder eine Familie haben.
Ich sah Nelson an.
Ich habe wieder Familie.
Meine Instinkte, geschärft in den Jahren, die ich allein gewesen war und exakt niemandem vertraut hatte, warnten mich, nichts zu überstürzen. Ich musste in der Lage sein, jederzeit wieder abzuhauen. Mein Überleben hing davon ab. Aber dann, während wir warteten, dass die Ampel grün wurde, atmete ich kurz durch. Andere Luft. Irgendwie ’ne andere Sonne. Alles andere lag an meiner abgefuckten Kindheit, und die Hitze in Wisconsin war erdrückend gewesen. Die Winter herzlos. Jetzt war ich in Kalifornien. Ich konnte neu anfangen. Vielleicht die verdammten Gespenster meiner Vergangenheit hinter mir lassen.
Nelson hustete und spuckte auf den Gehweg. Unter seiner Körpermasse hatte er Dads Statur. Groß, mit Muskeln, die unter dem Fett lauerten, enorme Hände mit schwieligen Knöcheln, die sich zu riesigen Fäusten ballen konnten …
So viel dazu, die Geister zurückzulassen. Ich werd gleich mit einem ins Auto steigen.
Er führte uns aus der goldenen kalifornischen Sonne in ein kaltes Parkhaus zu einem alten Dodge-Pick-up in verblasstem Rot. Ich warf meine Tasche auf die Ladefläche, die voller Gerümpel war – ein Haufen muffiger Mäntel, Klappstühle und ein Karton mit einem Tennisschläger, einer Kaffeemaschine und angeschlagenen Bechern.
»Wohnungsräumung«, sagte Nelson und zeigte auf den Karton. »Du glaubst nicht, was für einen Scheiß die Leute liegen lassen. Wirst du ja sehen.«
Ich fegte zusammengeknüllte Taschentücher und Fast-Food-Verpackungen vom Sitz und setzte mich hin, den Rucksack auf dem Schoß. Noch mehr Verpackungen lagen auf dem Armaturenbrett, zu meinen Füßen rollten Plastikflaschen herum.
Nelson quetschte sich hinters Steuer, und bald wurde der Flughafen San Jose im Rückspiegel kleiner. Die gewundene Straße – ein Schild sagte, es sei die 17 – brachte uns südwärts durch grüne Wälder nach Santa Cruz. Berge erhoben sich zu allen Seiten und sahen nach dem platten Land in Manitowoc aus wie ein Wunder.
»Du redest nicht viel, was?«, fragte Nelson nach ein paar Minuten.
»Nicht viel.«
»Stört mich nicht. Ich kann’s nicht ab, wenn mir einer das Ohr abkaut.« Sein Haiblick landete auf mir, dann wieder auf der Straße. »Du siehst aus wie er. Russell. Weniger wie deine Mom.«
»Ich weiß«, sagte ich und biss die Zähne zusammen.
»Eine Schande, was passiert ist«, fuhr Nelson fort. »Was für ein Verlust. Es lief so gut bei Russ. Bis er sie getroffen hat.«
Ein roter Dunst trübte meine Sicht, und ich packte den rauen Stoff meines Rucksacks und ballte die Fäuste.
»Eine Schande.« Nelson schüttelte den Kopf, blickte auf die Straße. »Das machen Frauen mit einem anständigen Mann. Drehn ihn durch die Mangel. Machen ihn verrückt, und wenn’s dann hart auf hart kommt, hat er den Kürzeren gezogen.«
»Er hat sie mit einem Baseballschläger erschlagen«, stieß ich hervor, meine Stimme hart wie Stein.
»Russ war kein Engel, aber womit hat Norah ihn auf die Palme gebracht? Sie hat ihn mürbe gemacht. Er wollte ja nicht von Anfang an jemandem wehtun. Über so was redet heute keiner mehr. Gehören immer zwei dazu, oder?«
Ein Bild loderte grell vor mir auf: fliegende Fäuste, da ich Nelson den Namen meiner Mutter aus dem dämlichen Mund schlug. Ich kämpfte gegen die Wut an – die Wut meines Vaters, die in mir kochte, und wandte mich ab. Die kalifornische Landschaft, die draußen vor dem Fenster vorbeiflog, war völlig verschwommen. Aber ich konnte meine Mutter in der Scheibe gespiegelt sehen. Wie sie weinte und sich in unserer abgeranzten Küche mit den gesprungenen Fliesen in eine Ecke kauerte, das Abendessen, das ihm nicht geschmeckt hatte, überall auf dem Boden verteilt. Kein besonderer Abend. Hätte jeder Abend sein können.
»Du bist nicht wie er, Ronan«, flüsterte Mom, und ihre Tränen vermischten sich mit dem Blut auf ihrer Wange. »Du bist besser als er. Vergiss das nicht.«
Ich holte scharf Luft, zwang meine Fäuste, sich zu öffnen, und versuchte, ihr zu glauben.
»Wir müssen über die Modalitäten unserer Abmachung reden«, sagte Nelson.
»Okay.«
Ich hatte nicht gewusst, dass es eine Abmachung gab. Ich dachte, ich hätte einen Onkel, der mich wollte. Die Chance auf eine Familie. Ein normales Leben.
Ich hätte es besser wissen müssen.
»Ich besitze zwei Häuser mit je zehn Wohnungen«, sagte Nelson. »Ich wohne in dem Gebäude in der Bluffs Avenue. Du wirst in dem bei den Klippen unterkommen.«
Ich sah zu ihm. »Ich wohne nicht bei dir?«
Er runzelte die Stirn. »Du bist achtzehn, oder? Ich hab schon mit vierzehn gearbeitet und allein gewohnt.«
»Aber …«
»Nichts aber. Du bist grade in Kalifornien angekommen und träumst schon davon, den ganzen Tag am Strand abzuhängen? Typisch.«
Ich knirschte mit den Zähnen. Ich hatte gearbeitet, seit ich acht war – entweder in Arbeitsprogrammen im Jugendknast, oder ich machte mich in den Pflegefamilien nützlich, die mich für ein paar Monate aufnahmen. Der Job in Manitowoc hieß, dreizehn Stunden täglich unter der knallheißen Sonne und mit beschissener Bezahlung zu arbeiten.
Komm mir nicht damit, dass ich faul sei, Arschloch.
»Worin besteht der Job?«, fragte ich.
»Hausverwaltung. Instandhaltung. Ein bisschen Mädchen für alles. Hast du je getischlert?«
»Mit sechzehn war ich bei einer Familie, die eine Baufirma hatte. Ein paar Sachen hab ich gelernt.«
»Gut. Was ist mit Klempnern? Gas und Wasser?«
»Nicht viel.«
»Gibt auch nicht viel zu wissen«, sagte er. »Ich zeig’s dir. Ich mach die Reparaturen gern selbst. Hält die Kosten niedrig. Und ich werd nicht abgezogen von überteuerten sogenannten Profis, die ’n Viertel-Zoll-Rohr nicht von ’nem Loch im Boden unterscheiden können.«
Ich rutschte auf meinem Sitz herum. Mein Onkel war nicht an Familie interessiert. Es würde keine Mahlzeiten am selben Tisch geben. Wir würden keinen Sport zusammen gucken. Ich war zum Arbeiten da. Nichts weiter.
Mein Magen fühlte sich leer an, als hätte ich seit Jahren nichts gegessen und würde auch so schnell nichts kriegen.
»Was ist mit Schule?«
Nelson runzelte die Stirn. »Welche Schule?«
»Mir fehlt noch ein Jahr.«
Er schnaubte. »Wirklich?«
»Ich hab ein Jahr verpasst, als … die ganze Scheiße passiert ist. Ich will den Abschluss machen.«
»Mach den Test, wenn’s dir so wichtig ist. Du wirst keine Zeit für die Schule haben. Es ist viel zu tun. Wenn jemand auszieht – oder rausgeworfen wird –, müssen wir deren Dreck wegputzen und die Wohnung für die neuen Mieter fertig machen. Wir müssen eine Anzeige schalten, die Bewerbungen durchsehen. Dann muss man die Miete einsammeln, und das ist ’ne ganz andere Schinderei. Man könnte glauben, ich hab einen Wohltätigkeitsverein, bei den Ausreden, die ich zu hören krieg.«
Mein Onkel redete weiter, während eine Erinnerung in mir aufstieg. An das letzte Mal, dass ich wirklich mit meiner Mom geredet hatte, nur drei Tage vor ihrem Tod.
»Mach die Schule fertig, Ronan«, sagte sie und gab mir einen frisch abgewaschenen Teller zum Abtrocknen. »Egal, was passiert. Mach es nicht wie ich. Ich bin abgegangen, und seitdem wurde mir ständig die Tür vor der Nase zugeknallt. Der Weg war zu Ende.« Ihre klaren blauen Augen verdunkelten sich, dann strahlte sie mich an. »Du bist schlau. Lass dir nie von jemandem was anderes weismachen, und lass dir das von niemandem nehmen.«
»Was denn nehmen?«, fragte ich und stellte den Teller auf die Arbeitsplatte.
»Deine Zukunft.«
Ich wandte mich Nelson zu. »Ich will die Schule fertig machen.«
»Das ist nicht der Deal.«
»Und was ist der Deal? Ich soll für dich arbeiten.«
»Für ein Dach über deinem dämlichen Kopf.« Er hob die Augenbrauen, als ich grimmig schwieg. »Hast du ’ne andere Option? Diese Farm da? Kuhscheiße schaufeln und in der Scheune schlafen? Wenn du zurückgehen willst, gern, sag, dass ich anhalten soll, und ich lass dich hier raus.«
Als würde man einen Hund auf der Straße aussetzen, dachte ich, während alle meine Hoffnungen schwanden, eine nach der anderen. Ich war wieder auf mich gestellt. Okay, scheiß drauf.
»Fahr rechts ran.«
Nelson runzelte die Stirn. »Hä?«
»Du hast mich gehört. Ich hab gesagt, fahr ran.«
»Jetzt warte mal …«
»Halt den Scheißwagen an.«
Nelson verzog das Gesicht, verdrehte die Hände auf dem Steuer. Er bremste und hielt am Straßenrand. Bäume standen zu beiden Seiten der kurvigen Straße. »Wir sind mitten im Nirgendwo. Hör zu, Ronan, vielleicht war ich zu voreilig …«
»Danke für’s Mitnehmen.« Ich stieg aus und knallte die Tür hinter mir zu.
Nelson ließ das Beifahrerfenster runter und fuhr im Schritttempo neben mir her, Verzweiflung in der Stimme. Anscheinend brauchte er mich dringender, als er hatte durchblicken lassen.
»Du willst deinen ganzen Scheiß hinten drauf lassen?«
»Jepp.«
»Sei nicht blöd, Ronan. Du hast hier niemanden.«
Ich hatte nie jemanden gehabt. Ich ging weiter.
Er beugte sich über den Beifahrersitz, sein Ton wurde etwas weicher. »Hör zu. Ich wär kein guter Vater gewesen für ein kleines Kind. Aber jetzt bin ich hier, und wir sind eine Familie. Das ist gut für uns beide. Oder?«
Familie. Wieder dieses beschissene Wort. Ich blieb stehen.
»Na also«, sagte Nelson. »Jetzt steig ein und …«
»Sie wollte ihn verlassen.«
Er blinzelte dumm. »Hä?«
»Du wolltest wissen, was Mom gemacht hat, dass Dad so durchgedreht ist«, sagte ich und starrte ihn gefühllos und unerbittlich an. »Er kam nach Hause, nach einer Nacht im Gefängnis, weil er sie verprügelt hatte. Die haben ihn nie lange genug eingesperrt. Haben sie nie beschützt.«
Ich hab sie nicht beschützt …
Meine Stimme war belegt, und ich räusperte mich. »Sie hat gesagt, sie würde ihn verlassen und mich mitnehmen. Und dann hat er sie umgebracht, verdammt.«
Nelson zog die Schultern hoch, sah überallhin, nur nicht zu mir. »Ja, okay, okay.«
»Rede nie wieder über sie. Sag nicht ihren Namen. Gar nichts.«
»Alles, was du willst.«
»Und ich werd die Schule fertig machen.«
Nelson riss die Augen auf. »Sonst noch was? Pass bloß auf, Junge.«
Ich rührte mich nicht.
Er fluchte wieder. »Das wird nicht laufen. Du wirst schon sehen. Das wird schwer für dich, und für mich wird es schwerer mit den Mietern.«
Ich setzte mich wieder in Bewegung.
»Okay, okay, wenn du darauf bestehst, Einstein. Steigst du jetzt endlich in das beschissene Auto?«
Ich stieg wieder ein, legte mir den Rucksack auf den Schoß und knallte die Tür zu.
»Gott«, murmelte Nelson, als er wieder auf die Straße fuhr. »Wann war je mal was leicht? Nie, echt nie.«
Wenigstens waren wir darin einer Meinung.
Meine Sozialarbeiterin, Alicia, hatte mir gesagt, dass Santa Cruz eine eher kleine Stadt sei, aber verglichen mit Manitowoc war sie riesig. Straßen über Straßen mit Häusern, Geschäften, einer großen Universität und dem Boardwalk mit Fahrgeschäften, Buden und einem Riesenrad, das sich langsam vor dem Pazifik drehte. Der Michigansee war nichts gegen das endlose Blaugrün des Ozeans, das sich jenseits der Küste erstreckte. Und wenn man sich umdrehte, waren da grün bewachsene Berge. Es war wie eine Fata Morgana, nachdem ich achtzehn Jahre lang dieselbe trostlose Landschaft angestarrt hatte.
Ich sah Nelson an und fragte mich, wie zum Teufel er hier gelandet war.
»Deine Großmutter hat mir und Russell alles vererbt«, sagte er und beantwortete damit meine unausgesprochene Frage. »Ich hab die Häuser gekriegt, in die sie und Pawpaw vor einer Million Jahren investiert hatten, und dein Dad hat das Geld genommen.« Er schnaubte. »Da hab ich mal Glück gehabt.«
Ich nickte grimmig und erinnerte mich, wie Mom sich abgemüht hatte, um mit dem, was sie in zwei Jobs verdiente, die Rechnungen zu zahlen und Essen auf den Tisch zu stellen, während Russ die Erbschaft versoff und in Fantasy-Sport-Ligen und beim Pokerspielen verzockte.
»Hier wohnst du.«
Nelson lenkte den Wagen auf einen Parkplatz mit rissigem Asphalt, direkt vor einem Betonklotz von Mehrfamilienhaus in einem Viertel, das voll davon war. Die unteren Fenster waren mit Eisenstäben vergittert. Die Farbe blätterte ab. Eine Außentreppe führte in den ersten Stock.
Er zeigte auf die obere Eckwohnung. »Da kannst du fürs Erste wohnen. Hol deine Sachen, ich zeig dir alles.«
Ich folgte ihm die Stufen hoch zu der Eckwohnung. An der Tür klebte ein schwarz-goldener Aufkleber, auf dem BÜRO stand.
»Eigentlich wohnen die Verwalter im Erdgeschoss«, sagte Nelson. »Aber da wohnt eine Frau mit zwei Kindern, die mich angefleht hat, dass sie nicht nach oben umziehen muss.« Er verdrehte die Augen, während er einen Schlüsselbund herausholte und die Tür aufschloss.
»Warum will sie nicht umziehen?«
»Na, weil die Erdgeschosswohnung größer ist! Ich hab ihr gesagt, dass das deine Entscheidung ist. Wenn du die vorlaute Zicke rauswerfen willst, immer gern.«
Meine Schultern spannten sich an. »Werd ich nicht.«
»Lass dich erst mal rumführen, und sag das dann noch mal.«
Er drückte die Tür auf, und ich trat in ein dunkles schäbiges Wohnklo. Eine alte Couch, ein Tisch und zwei Stühle waren die einzigen Möbel in dem Wohnzimmer mit Küchenecke. Das Schlafzimmer mit Futon war winzig und hatte ein kleines Fenster mit Blick auf die Straße. Im Bad gab’s Waschbecken und Klo und eine Dusche. Auf dem gelb angelaufenen verkratzten Porzellan lagen ein paar tote Kakerlaken. Ich versuchte, mir eine Mutter mit zwei Kindern hier drin vorzustellen, und mir wurde schlecht.
»Ich hab’s dir ja gesagt«, sagte Nelson, der meine angeekelte Miene missverstand. »Die untere Wohnung ist besser.«
»Für mich ist es okay hier.«
»Sei nicht blöd. Wenn ich du wäre …«
»Ich hab gesagt, es ist okay.«
Er seufzte. »Mach, was du willst. Und jetzt an die Arbeit.«
In den nächsten zwei Wochen stellte Nelson mir die Mieter der Cliffside Apartments vor. Die »vorlaute Zicke« aus der Erdgeschosswohnung unter mir war Maryann Greer – eine müde aussehende Frau Mitte dreißig. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, aber das Feuer in ihnen war noch nicht erloschen.
Sie erinnerte mich an Mom.
Ihre Zwillinge, Camille und Lillian, sahen aus, als wären sie etwa sechs. Sobald Nelson mich als den neuen Verwalter vorstellte, hatten mich alle mit demselben Misstrauen angesehen. Ich sagte Maryann, dass sie in ihrer Wohnung bleiben könne. Trotzdem machten sie schnell die Tür zu.
»Du warst zu nett zu ihr«, hatte Nelson gesagt, als wir zur nächsten schäbigen Tür in dem schäbigen Gebäude kamen. »Gewöhn dich nicht dran. Du musst aufpassen mit diesen Mietern. Gib ihnen den kleinen Finger, und die nehmen die ganze Hand.«
Soweit ich sehen konnte, kriegten die Mieter kaum irgendwas. Fast alle hatten Probleme mit Heizung und Sanitäranlagen, und die Wohnungen waren genauso abgeranzt wie meine. Oder schlimmer. Das ganze Haus brauchte einen neuen Anstrich und neue Leitungen, und man musste den rissigen Parkplatz erneuern.
Während der ersten Wochen gab ich mein Bestes, um zu reparieren, was kaputt war – verstopfte Abflüsse, undichte Rohre … Auf meinem iPhone – ein Geschenk von meiner Sozialarbeiterin, als ich Wisconsin verließ – googelte ich, wie man Heizdrähte ersetzte. Ich streckte die Materialkosten aus eigener Tasche vor, weil Nelson zu lange brauchte, und er brauchte noch länger, um mir das Geld zurückzuzahlen.
Die Arbeit hielt mich auf Trab. Die ersten Schultage an der Santa Cruz Central High verstrichen, aber am Donnerstag hatte ich weit genug aufgeholt, um hingehen zu können. Die Schule war glücklicherweise so nah, dass ich zu Fuß hin konnte, da ich kein Auto hatte.
Und kein Einkommen.
»Du wohnst mietfrei«, hatte Nelson zu mir gesagt. »Soll ich dich obendrein bezahlen?«
»Wie soll ich …?«
»Du musst dir einen Job suchen«, hatte er gesagt, als wäre ich blöd. »Und neben der Arbeit und dem Verwaltungsjob hast du keine Zeit für Schule. Ich hab’s dir ja gesagt.«
»Ich gehe hin.«
Er seufzte. »Fürs Erste. Aber wenn’s im Haus nicht läuft, nehm ich dich raus.«
Versuch’s nur.
Die Central High war wie im Film. Ein offenes Schulgelände mit Pavillons und Bäumen und Klassenräumen, die sauberer und besser beleuchtet waren als meine Wohnung. Ich kam mir vor wie ein Hochstapler. Ich war zu alt; ich hatte zu viel gesehen. Ich gehörte nicht zu diesen Schülern, ihren lächelnden Gesichtern und ihren beschissenen Schulveranstaltungen. Ich spürte, wie sie mich und meine Tattoos anstarrten, und hörte sie flüstern, dass ich ein entflohener Strafgefangener sei. Ein Krimineller.
Nelson hatte recht.
Aber ich dachte an meine Mom und machte weiter.
In der Mathestunde sagte Ms Sutter, eine mürrisch aussehende Frau mit dunklem Haar und verkniffenem Gesicht, dass wir unsere Collegeblöcke und Stifte rausholen sollten, während sie Gleichungen auf einen uralten Overhead-Projektor schrieb.
Ich klopfte mit einem Bleistift auf das Pult. Ich hatte vergessen, Schulutensilien zu kaufen.
»Mr Wentz, nicht wahr?«, fragte Ms Sutter. »Wo ist Ihr Block?«
»Vergessen«, murmelte ich.
Sie schürzte die faltigen Lippen. »Da liegt Schmierpapier am Fenster. Das können Sie nehmen. Ausnahmsweise.«
Alle Blicke lagen auf mir, als ich aufstand und ein paar Blätter von dem schiefen Stapel nahm. Mir war scheißegal, was die über mich dachten, aber die Mathegleichungen auf dem Projektor ergaben keinen Sinn. Es ergab keinen Sinn, dass ich hier war. Ich hatte zu viel vom normalen Leben verpasst und würde das nie aufholen.
Sorry, Mom. Es ist zu spät für mich. Zu spät …
Ich schnappte mir meinen Rucksack und ging. Ms Sutter rief mir hinterher. Ich ignorierte sie und ging auf einem der Wege in Richtung Ausgang. Aber die Schule war riesig. Als der Footballplatz in Sicht kam, wusste ich, dass ich den falschen Weg genommen hatte.
»Fuck.«
Ich wollte gerade kehrtmachen, als ich Stimmen hörte und eine Art Wecker, der losging.
»Du siehst gar nicht gut aus, Stratton. Pisst du dir wieder in die Hose?«
Ich spähte um die Ecke. Drei Typen hatten sich vor einem vierten in zerrissenen Jeans, Jacke und Beanie aufgebaut. Seine Uhr piepte, und er wankte, als wäre er betrunken.
»Geh mir aus dem Weg, verdammte Scheiße«, sagte er schwach zu einem schlaksigen rothaarigen Typen, der Board-Shorts trug und ein krankes Grinsen im Gesicht hatte.
»Ich steh hier gut«, sagte der Rothaarige, verschränkte die Arme und versperrte ihm den Weg. »Bin irgendwie neugierig, was als Nächstes passiert.«
Seine beiden Freunde traten nervös von einem Fuß auf den anderen.
»Hey, Frankie, er sieht wirklich nicht gut aus«, sagte einer zu dem Rothaarigen.
»Ja, und dieser Alarm …«
»Ach was, bei dem ist alles klar, was, Stratton?«
Der Typ, Stratton, sah total scheiße aus – blass, schweißnass, konnte kaum stehen.
Frankie packte ihn am Nacken. »Hast du immer noch dieses kleine Ding im Bauch? Was wohl passiert, wenn das einer rausholt? Nur, um es sich besser ansehen zu können?«
Was für ’ne Scheiße …?
Als ich mitten in die kleine Gruppe latschte, traf Stratton Frankie gerade mit einem schwachen Haken unter dem Kinn. Frankies Mund schloss sich mit einem Klacken und einem Blutspritzer.
»Du Mifferl!«, heulte er. »Hamir auffie Ffunge gebiffm.«
Frankie holte mit geballter Faust aus. Stratton stand mir im Weg. Ich schob ihn zur Seite und rammte meine Faust in Frankies Gesicht. Knochen und Knorpel gaben nach, und er stolperte heulend und fluchend rückwärts.
Ich konnte fühlen, wie die anderen mich anstarrten, konzentrierte mich aber auf Frankie. Jeder Muskel in meinem Körper war bereit für mehr, wenn er mehr wollte.
Und ich hoffte, er wollte mehr.
Der stellvertretende Direktor, ein glattes Arschloch namens Chouder, tauchte hinter uns auf. »Was ist hier los?«
»Mifferl hat mir die Nase gebrochen«, jammerte Frankie hinter seiner Hand.
»Melden Sie sich bei der Krankenschwester, Dowd«, sagte Chouder, dann richtete er seinen durchdringenden Blick auf mich. »Mr Wentz. In mein Büro. Der Rest von Ihnen geht in den Unterricht zurück.«
Strattons piepende Armbanduhr erregte seine Aufmerksamkeit und kühlte das Blut in meinen Adern. Er sah krass aus. Brauchte vielleicht einen Notarzt.
»Alles in Ordnung mit Ihnen?«, fragte Chouder genervt.
»Klar doch«, sagte Stratton und verzog den Mund. »Ging mir nie besser.«
Absolut stoisch und müde wankte er zu einer Reihe von Schließfächern. Er verpetzte Frankie und seine Freunde nicht. Jammerte nicht.
»Geht’s dem auch gut?«, fragte ich Chouder, als wir zum Verwaltungsgebäude gingen.
»Sie haben ihm die Nase gebrochen. Ein bisschen spät, um sich Sorgen zu machen.«
»Nicht das Arschloch. Der andere.«
»Miller schafft das schon«, sagte Chouder und führte mich durch die Büros des Verwaltungsgebäudes, wo Betreuer und Lehrkräfte sich unterhielten oder an ihren Schreibtischen saßen.
»Warum sind die Arschlöcher ihm blöd gekommen?«
»Achten Sie auf Ihre Ausdrucksweise, Mr Wentz.« Er deutete auf einen Stuhl vor seinem Schreibtisch. »Ich nehme an, sie haben Miller damit aufgezogen, dass er vor ein paar Jahren für kurze Zeit obdachlos war und mit seiner Mutter in einem Auto gewohnt hat.« Er beugte sich vor, um eine Akte aus einer Schublade zu holen, knallte sie auf den Schreibtisch und runzelte dann die Stirn angesichts meines finsteren Blicks. »Das ist nichts, was Sie bis morgen Mittag nicht ohnehin erfahren hätten. Lassen Sie’s, Wentz.« Er tippte auf die Akte. »Sie haben größere Probleme. Ihre kleine Einlage war ein tätlicher Angriff.«
»Der beschissene Mobber hat es verdient.«
»Hm.« Chouder zog die Augenbrauen hoch und blätterte meine Akte durch. »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm bei den Wentz’, nicht wahr?«
Ich knirschte mit den Zähnen.
»Es gibt neben Gewalt auch andere Wege, um seine Ziele zu erreichen.« Chouder verschränkte die Finger. »Wie wäre es mit drei Tagen Suspendierung, um darüber nachzudenken?«
Als ich aus Chouders Büro kam, wartete Miller Stratton auf mich.
»Du musstest das nicht für mich tun«, sagte er und lief neben mir her, während ich vom Schulgelände ging.
»Ich hab’s nicht für dich getan«, sagte ich und sah ihn nicht an.
»Warum dann?«
Weil er sie umgebracht hat und ich ihn nicht aufgehalten hab.
Aber wer wollte so abgefuckte Scheiße hören? Stattdessen zuckte ich die Achseln und ging weiter. Miller lief weiter neben mir her. Es ging ihm jetzt besser. Er hatte nicht mehr so glasige Augen, sah nicht mehr aus, als würde er gleich umkippen. Aber er hatte immer noch diesen stoischen Gleichmut an sich. Trug ihn wie die schäbige Jacke, die so abgerissen war wie meine eigene.
»Stimmt es, dass du in einem Auto gewohnt hast?«, fragte ich.
In Millers Augen blitzte Wut auf. »Du hast dich gerade mal zehn Minuten auf dem Schulgelände aufgehalten und hast das schon gehört? Ein neuer Rekord. Ja. Ist lange her. Anscheinend kann es niemand vergessen.«
»Dann sorg dafür.«
»Wie?«
Ich dehnte die Finger, die ein bisschen wehtaten, nachdem ich Frankie eine verpasst hatte. Nicht so wie ich. Sei nicht wie ich. Wie er.
Miller sah mich an. Er war ein paar Zentimeter kleiner als ich mit meinen eins neunzig. »Der Dad von dem Typen, dem du eine reingehauen hast, ist ein Cop.«
Ein höhnisches Grinsen verzerrte meine Lippen. »Scheiß auf beide.«
»Was hast du gegen Cops?«
Ich dachte an die vielen nächtlichen Besuche der Polizei, die damit geendet hatten, dass mein Dad sich in einer Gefängniszelle »beruhigte«, nur um am nächsten Tag wütender als je zuvor zurückzukommen. An gesetzliche Verfügungen, mit denen er sich den Arsch abwischte wie mit Klopapier.
Solche Sachen konnte man einem völlig Fremden nicht erzählen, aber mit jedem Schritt auf unserem Weg kam Miller mir weniger fremd vor.
Wir schwiegen entspannt, bis ich zu der Ecke des Gebäudes kam, das ich verwaltete. Ich hatte den Fernseher angelassen, als ich am Morgen aus dem Haus gegangen war. Wir hörten ihn plärren.
»Wohnst du da?«
Ich nickte.
»Ich wohn eine Querstraße weiter.« Miller schob die Hände in die Jackentaschen. »Musst du nach Hause?«
»Nach Hause.« Ich schnaubte. Ich wusste nicht mal mehr, was das Wort bedeutete. »Nein.«
Miller nickte. Seine dunkelblauen Augen sahen aus, als hätte er auch schon ziemlich viel Scheiße gesehen.
»Komm mit.«
Miller führte uns über einen Pfad, der hinter einem Parkplatz mit einem verlassenen Werkzeugschuppen losging. Er führte zum Strand, weg vom Boardwalk mit den Lichtern und Achterbahnen und lachenden Touristen, hin zu den Klippen, die dem Viertel seinen Namen gaben.
Der Weg war steinig und nicht leicht. Wir kletterten über Felsen, wo die Klippen bröckelten und Teile ins Meer gestürzt waren. Gerade als ich dachte, dass wir umkehren müssten, wurde es leichter. Das Wasser wich zurück, und Miller führte uns um einen großen Felsen herum, der uns den Weg versperrte. Auf der anderen Seite war eine kleine Hütte, verwittert und alt, aber sie stand noch.
»Ich hab die vor vier Tagen entdeckt«, sagte Miller. »Seitdem war ich jede Nacht hier. Nach der Arbeit.«
»Okay.« Ich sah mich in dem kleinen Raum um, in dem es einen Holztisch und eine Bank gab. Ein Fenster war einfach in eine Wand reingesägt. »Wo arbeitest du?«
»In der Spielhalle unten im Boardwalk.«
Ich nickte und setzte mich auf die Bank. »Man kann das Meer sehen.«
Miller rammte wieder die Hände in die Taschen. »Ja, es ist schön. Ein guter Ort, um …«
»Einfach mal abzuhauen von allem?«
»Ganz genau.«
»Du sahst krank aus vorhin«, sagte ich. »Was ist das für ’ne Uhr? Hat die was damit zu tun?«
»Es ist ein Alarm. Mein Blutzucker war niedrig.« Miller hob sein T-Shirt an und zeigte mir ein kleines weißes Ding, das an seinem Bauch befestigt war. »Ich hab Diabetes.«
Ich nickte, und dann kam mir eine Kindheitserinnerung – eine der wenigen schönen. Ich hielt mir die Hand vors Gesicht, damit Miller nicht dachte, ich würde mich über ihn lustig machen.
Zu spät.
»Ist irgendwas komisch?«, fragte er mit verdächtig scharfer Stimme.
»Ich kannte mal ein Mädchen, als ich klein war … so fünf«, sagte ich, und plötzlich wurde ich von diesem Lachen völlig überrumpelt. »Ihre Tante hatte Diabetes. Sie hat immer Di-ba-titten gesagt.«
Miller runzelte die Stirn, dann steckte das Lachen ihn an.
»Und keiner hat sie verbessert?«
Ich schüttelte den Kopf. »Würdest du?«
»Gott, nein.«
Wir lachten uns kaputt über dieses dämliche Wort, als wäre es das komischste, das wir je gehört hatten. Aber ich hatte seit Ewigkeiten nicht gelacht, und ich wette, Miller auch nicht.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: