
The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt (Epische Romantasy von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau) E-Book
Jennifer Benkau
15,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Lost Crown
- Sprache: Deutsch
Sie malt Magie auf seine Haut. Nachtschwarz ist der Wald, in dem die junge Schmiedin Kaya von Räubern entführt wird. Totenbleich ist der verwundete Anführer Mirulay, der Kayas Hilfe braucht. Blutrot ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefühlen spielt, sondern auch ihr größtes Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mirulay verfügt jedoch über eine ganz andere Magie, die Kayas Sinne betört und die Macht hat, Königreiche zu stürzen Episch. Sinnlich. Herzzerreißend. Band 1 der atemberaubenden neuen Romantasy-Reihe von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau Jennifer Benkaus Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet New-Adult-Romance von Jennifer Benkau: A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 601
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2022 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag © 2022 Ravensburger Verlag Copyright © 2022 by Jennifer Benkau Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de) Covergestaltung und Vorsatzkarte: Carolin Liepins Verwendete Bilder von © AboutLife, © John D Sirlin, © suns07butterfly, © lenaer, © Marylia, © Ensuper, © nereia und © And-One, alle von Shutterstock Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-51151-8
ravensburger.com
KAPITEL 1
MIRULAY
DER TAG, AN DEM DIE SCHRECKEN KAMEN
18 JAHRE ZUVOR, AM HOF VON ESHRIAN
Wenn dies einer der Tage ist, dachte Mirulay, über die man auch in Jahren noch spricht, dann wird man sich erzählen, dass es nie ein langweiligeres Fest gegeben hat. Und das hier im Aquamarinschloss, dem Palast von Eshrian! Mirulay mochte erst acht Jahre alt sein und wenig erfahren in gesellschaftlichen Belangen. Aber er war absolut überzeugt davon, dass sein Vater und seine ganze Familie sich lächerlich machten mit solch einer einschläfernden Feierlichkeit.
Die Menschen standen in kleinen Gruppen zusammen, und kaum jemand erhob auch nur für ein Lachen die Stimme über die schwermütigeMusikdesStreichertrios.NiehatteMirulaywenigerFarben indenKleidernundRöckenderAdligenundMächtigendiesesLandes gesehen. Normalerweise übertrumpften sich Frauen und Männer Eshrians in der Nacht der Lichtblüten damit, die Modefarben leuchtender als die anderen erstrahlen zu lassen. Selbst Haar und Haut färbten sich manche ein, immerhin war es für lange Wochen die letzte Gelegenheit zum Feiern. Heute aber trugen sie allesamt kummervolles, leeres Weiß. Es verdunkelte den Abend, dieses Weiß, hob die Finsternis, die um den Palast herumstrich, auf einen Sockel, als wäre sie die Königin der Nacht. Schatten fingen sich in den Deckenreliefs wie Wolken als Vorboten eines Unwetters.
Sein Vater, der Sarev von Eshrian, hatte ihn liebevoll umarmt und vollZärtlichkeitverspottet,alsMirulayihmvonseinenEindrückenerzählte. »Du hast doch nur Angst, dass die Mutter schimpft, wenn die Flecken auf deinem weißen Rock verraten, was du getrieben hast, mein Junge. Was ist das da schon wieder an deinem Knie? Gras? Beim Schrecken, der aus dem Wald kommt, um dich zu holen! Wie gelangst du inmitten des Palastes an Grasflecken auf deiner Hose? Ach, sag nichts, ich nehme an, ich will es gar nicht wissen.«
MirulayhattegrinsendmitdenSchulterngezuckt.SeinVaterhatterecht,erwollteesganzgewissnichtwissen.EswarnämlichkeinGras,dasseinKniegrünlichverfärbthatte,sondernMoosvondenDachschindeln.ErhattenachKazmingesucht,undnachdemdiePalastgardeihnnichtindenGästeflügelgelassenhatte,warergezwungengewesen,einenanderenWegzunehmen.LeiderwaresihmamEndeaberbloßgelungen,demnurwenigjüngerenCousindurcheinFensterzuzuwinken.
NunhieltensiesichzwarimselbenSaalauf,aberbeideKinderwarenstrengangewiesen,anderSeiteihrerVäterzustehen,respektvoll zu schweigen, bis sie angesprochen wurden, und nicht aufzufallen, ja bestenfalls unsichtbar zu werden. Leider hatte man Miru verboten, dazuseineMagiezunutzen.AllesSchmollenhattenichtgeholfen:Seine Mutter hatte ihm zwar sein Cercerys ausgehändigt – das magische Amulett, in dessen mit Sternenlicht gefülltem Inneren genug Zauber steckte, dass Miru seine Gestalt verändern konnte. Er sollte es, wie es für den Sohn des Sarevs angemessen war, an diesem Abend um den Hals tragen. Zuvor aber hatte sie einen kleinen Zauber um das goldene Medaillon gewirkt: Mirulay vermochte einfach nicht, es zu öffnen. »Deine Zeit kommt noch, Miru«, hatte Mutter ihn zu trösten versucht. »Womöglich sogar früher, als du jetzt denkst.«
Nun, heute schien die Zeit gar nicht zu vergehen. Vielleicht wurde es besser, wenn sich die Lichtblüten später öffneten und ihre Magie alle Erwachsenen in einen berauschenden Bann zog?
Mirulay blickte ein weiteres Mal zu Kazmin, der die Augen verdrehte, woraufhin Miru sich eine gequälte Grimasse nicht länger verkneifen konnte. Ein Fehler. Wie auch immer sein Vater es angestellt haben mochte, Mirulays Respektlosigkeit war ihm nicht entgangen.
»Mirulay.« Sein Vater drehte ihn zu sich und kniete sich vor ihm hin, um sehr leise sprechen zu können, sodass nur sie beide seine Worte vernahmen. »Ich weiß, dass du dich auf die Nacht der Lichtblüten gefreut hast und nun alles anders ist. Aber unser guter Herzog ist erst wenige Wochen tot.«
Miru schluckte. Dies war nicht der richtige Ort für Widerworte, das wusste er. Aber es war so schwer, den Mund zu halten! »Herzog Basco hätte nie zugelassen, dass ein Fest so traurig gefeiert wird, Vater. Und musst du als Sarev nicht dafür sorgen, dass alles so gemacht wird, wie der Herzog es gewollt hätte?«
»Gibt es denn Grund zum Feiern?«, wollte sein Vater wissen. »Nach all dem, was unserem Volk in den letzten Jahren passiert ist, Miru, haben wir da Grund zu feiern?«
Er hätte Nein sagen müssen. Der Krieg mit Keppoch hatte Eshrian schwer getroffen und viele Menschen das Leben gekostet. Doch das war nicht der Grund für die verhaltene Stimmung. Seine Eltern blickten immer mit einem Kopfschütteln auf die Reichen und Mächtigen des Landes, die unter dem Krieg nur wenig gelitten hatten. Natürlich hatten auch sie Verluste hinnehmen müssen, doch nicht annähernd in dem Umfang wie das normale Volk.
»Herzog Basco hat selbst im Krieg gefeiert«, sagte Miru, ohne die Frage zu beantworten.
Sein Vater schmunzelte. »Normalerweise gäbe ich dir recht, und wir würden es ebenfalls tun. Doch normalerweise gäbe es einen Prinzen oder eine Princessa, und der Sarev würde das Land nur regieren, bis diese alt genug sind, um ihr Erbe anzutreten. Herzog Basco aber starb kinderlos und beerbte dadurch uns. Unsere Familie, Mirulay, muss sich nun das Vertrauen des Volkes erarbeiten. Und wenn wir jetzt feiern, tanzen und lachen – wie, glaubst du, sähe das aus?«
Der ernste Blick in seines Vaters nebelgrauen Augen ließ Miru wieder daran denken, wie der Herzog umgekommen war: bei einem Jagdunfall. Ein Sturz vom Pferd, als er nach Wildsauen schoss. Dabei war er ein so guter Reiter gewesen. »Du meinst, jemand könnte denken, wir würden uns freuen, dass er tot ist?«
»Scht, Mirulay. Niemand denktdas. Aber nicht alle kannten Herzog Basco so gut, wiedu und ich ihn kannten. Manchen könnte es unziemlicherscheinen,würdenwirfeiern,wieeresgewollthätte.«Erblicktezu seinem jüngeren Bruder. Mirulay kannte Onkel Azjan nur vonden Festen, zu denen er stets im Palast erschien. SeinVater und sein Onkel sahen einander selten. Azjan war geradeerst richtig erwachsen geworden, dabeiaberschoneinselbstsichererMann,dersichoftzumgern gesehenen Mittelpunkt des Geschehens machte, indemer Geschichten von seinen Reisen in andere Länder erzählte. Heuteaber war er still, und seine klugen Augen wirkten angespannt.
»Wir wollen die Trauer respektieren, die vielen Menschen im Palast die Herzen schwer macht. Schau doch nur!« Der Sarev schob Miru ein Stück zur Seite. Von diesem Platz aus hatte er einen besseren Blick auf die Saalmitte, wo nun die Tänzerinnen Aufstellung nahmen. Es war eine Tanzgruppe, die zur Hälfte aus Eshrianerinnen bestand – den besten Tänzerinnen des Landes. Die anderen Frauen waren Gäste aus dem benachbarten Amisa, die schon so viele Monate im Palast weilten, dass Miru sie allesamt beim Namen kannte. Heute allerdings sahen sie anders aus als sonst, denn ihre Körper steckten Herzog Basco zu Ehren in Kostümen, die nichts mit ihrer eigenen Kultur zu tun hatten, sondern typisch für den beliebtesten Tanz Eshrians waren. Statt ihrer üblichen im Wind wallenden Tuchgewänder trugen sie wie die Eshrianerinnen kurze, enge Stoffstücke aus weißem Leinen, die ihre Arme, Beine und manchmal auch die Bäuche frei ließen. Ihre dunkelbraune Haut war stellenweisemitTrauerweißübermalt.IhreBewegungenjedochwaren die, mit denen die gesamte Gruppe immer tanzte: Die Grenzen des menschlichen Körpers schienen für sie nicht zu existieren. Sie ließen sich von der Musik tragen, lieferten sich ihr ganz und gar aus. Wenn die Musik wollte, dass sie sich verbogen, wie kaum jemand dazu imstande war, dann taten sie es. Manchmal schien es, als würden sie bei den Sprüngen in der Luft schweben. Ja, als könnten sie fliegen, wenn die Musik es von ihnen verlangte. Sie waren nicht umsonst die besten Tänzerinnen beider Länder.
Von der Tänzerin Ilara konnte Mirulay kaum den Blick abwenden. Das lange, krause Haar floss wie ein schwarzer Mantel ihren Rücken hinab, und über ihre Wangen zogen sich zwei Tränenspuren durch die Schminke. Ilara war fülliger als die anderen Tänzerinnen, was Miru aber erst heute auffiel, wo sie die Tracht Eshrians trug.
Währendersiebeobachtete,begrifferlangsam,wasseinVatermeinte. Die Amisanerin tanzte puren Kummer und offenbarte mit ihrem Körper jedem im Saal ihr gebrochenes Herz. Alle, die ihr zusahen, wurden still und lächelten auf diese Art, wie Erwachsene lächeln, wenn sie sich an etwas Schönes erinnern, das unwiederbringlich vorüber ist.
»Die Geliebte des Herzogs«, flüsterte eine Frau einer anderen zu. »Manche sagen, dass er sie zur Frau nehmen wollte.«
»Und andere, dass sie ihn verhext hat«, raunte die zweite Frau und fing sich dafür einen strafenden Blick der ersten ein.
»Istdochwahr,vielesagenes.ErsollihrdiewertvollstenStücke aus der Schatzkammer Eshrians geschenkt haben.MagischeStücke«, beharrte die Erste.
Am liebsten wäre Mirulay zu Ilara gegangen, hätte sie an der Hand gefasst, das Trauerweiß aus ihrem Gesicht gewischt und ihr gesagt, dass alles gut werden würde. Er wusste genau, dass sie niemanden verhext hatte. Wenn Herzog Basco sie hatte heiraten wollen und ihr Geschenke gemacht hatte, dann, weil sie sich lieb gehabt hatten.
Die Musik endete, und Ilara verließ den Saal mit gesenktem Kopf, als würde nichts jemals wieder gut werden.
Mirulay blickte sich nach Kazmin um. Stattdessen machte er seine Mutter umringt von einer Gruppe wohlhabender Kaufleute aus. Selbst sie hatte ihr Gesicht heute weiß geschminkt, auch wenn sie das als verheiratete Frau nicht musste. Sie warf Miru ein liebevolles Lächeln zu und deutete in die Mitte des Saales, wo sein Vater sich nun mit der Stirka in der Hand aufstellte. Im Friedenssaal war es verboten, Waffen zu tragen. Die einzige Ausnahme stand dem Oberhaupt der Regierung zu. Heute war dies der Sarev.
Vater hatte Stunden damit verbracht, die richtigen Worte für die Rede zu finden, und dabei einen ganzen Stapel Papier Blatt für Blatt zerknüllt.
NungaltalleAufmerksamkeitihm.Stimmenverstummten,Gespräche wurden mitten im Satz unterbrochen, und kaum jemand wagte es, auch nur mit der Stiefelsohle über das Parkett zu schaben.
»Meine Gäste«, begann sein Vater mit ruhiger Stimme, die mühelos den Saal ausfüllte. »Viele Jahre habe ich mich auf das Amt des Sarevs vorbereitet, und nun halte ich es in einer Weise inne, die sich wohl niemandvon uns je hätte vorstellen können: ohne einen Thronerben, den ich unterrichten und anleiten darf. Stattdessen sitze jetzt ich selbst auf diesemThron.VieleJahrewollteichSarevwerden,undnunwünschteich nichts mehr, als das Amt zurückgeben zu dürfen, an jemanden, der …«
Plötzliche Wortlosigkeit schwebte im Raum.
Warumsprachernichtweiter?Mirulaybeobachteteirritiert,wiesich die Augen seines Vaters weiteten. Wie sein Mund sich öffnete, ohne dass ein Ton folgte.
Miru verstand nicht. Hatte Vater seinen Text ver…?
In diesem Moment brach sein Vater in die Knie, und irgendwo schrie eine Frau auf, die wie Mirus Mutter klang und doch ganz anders. Onkel Azjan stand dicht hinter seinem Vater, und Mirus erster Gedanke war zu rufen: Hilf ihm, Onkel! Tu etwas!
Doch dann sah er die Stirka in Azjans Hand. Das Blut auf der Klinge und seinem Handschuh. Und die rote Blüte, die sich auf Vaters weißem Wams öffnete, größer und größer wurde, bevor er nach vorn kippte und mit der Stirn auf den Boden schlug.
Plötzlich peitschte Geschrei wie eine Sturmfront durch die Menge. Auch Mirulay schrie, aber er hörte sich nicht. Er hörte bloß das Entsetzen, das Grauen, die Todesangst der Menschen. Und begriff nichts.
Die verzweifelte Bitte, sein Onkel möge Vater doch helfen, war noch in seinem Kopf, als er zusah, wie Azjan den Kopf seines Vaters am Haar hochzerrte und seine Stirka über dessen Kehle zog.
Und dann war da nichts mehr als Blut, so unendlich viel Blut.
KAPITEL 2
KAYA
HEUTE, IN EINEM DORF IN DER REGION BELLANEY IM WESTEN VON AMISA
Um mich herum stiebt ein Funkenmeer auf, als ich das glühende Hufeisen mit dem Hammer in die richtige Form schlage.
Der Kunde springt mit einem Aufschrei zurück und starrt mich wütend an. »Kannst du nicht aufpassen, du Tölpel? Soll ich mir die guten Kleider versengen?«
Ich halte kurz inne und wiege den Hammer in der Hand. »Gerade sollte ich mich noch beeilen. Und jetzt möchten Sie, dass ich ein Päuschen mache? Sie stehen in einer Schmiede, guter Herr, also … wird hier wohl geschmiedet.«
Der ältere Mann klopft sich die imaginären Glutflocken von seiner Weste.»Werdnichtfrech!Schlimmgenug,dassichaufmeinPferd warten muss. Und starr mich ja nicht so an. Ich weiß, dass du was ausheckst!«
Statt einer Antwort werfe ich unserem Schmiedehelfer Samu einen knappen Blick zu. Er verkneift sich jede Reaktion, aber ich sehe trotzdem den Ärger in ihm schwelen. Der Kunde wollte sein Pferd am Abendabholen.NunistesNachmittag,underbeschwertsichnichtnur, dass wir noch arbeiten, sondern verlangsamt unsere Arbeit noch, indem er im Weg herumsteht. Und natürlich wirft er mir vor, etwas Böses im Schilde zu führen.
Kaya aus Bellaney. Die kann ja nur Hinterlistiges im Kopf haben. Das behauptet schließlich jeder.
Ich habe ihnen nie Grund für ihr Misstrauen gegeben, aber irgendeine Stimme flüstert ihnen zu, dass mit mir etwas nicht stimmt. Und sie erzählen es lautstark weiter.
Bei den letzten Schlägen auf das Eisen lasse ich besonders viele Funken fliegen. Ich liebe diesen Teil meiner Arbeit, da kann meinetwegen eineganzeHordeKundenummichherumstehenundsichbeschweren. Mit meinen Händen, meinem selbst geschmiedeten Werkzeug und der Glut aus der Esse das harte, unnachgiebige Eisen in jede beliebige Form zu bringen, macht mich stolz und zufrieden wie sonst nur die Dinge, die mir verboten sind. Ich mag die Hitze, die sich unter der hölzernen Überdachung staut, ich mag den Anblick, wie sich das Eisen langsam nach meinen Wünschen formt, und ich mag den Geruch von Pferden, Feuer und Metall.
Als ich fertig bin, deute ich für Samu auf das Pferd, und er hebt den Hinterhuf an.
»Vielleicht treten Sie einen wenig zurück«, sage ich betont freundlich zudemPferdebesitzer,bevorichdasglühendeEisenmitderZange auf die Hufunterseite drücke und Samu, das Pferd und ich für einen Moment in einer beißenden Rauchwolke von verbranntem Horn verschwinden.
»Werdensiesichjeandichgewöhnen,Kaya?«,murmeltSamumirzu.
Ich muss lächeln. »Hast du doch auch.« Aber es hat gedauert, und obwohl wir gut zusammenarbeiten, merke ich Samu nach wie vor an, dass ihm irgendetwas an mir nicht ganz geheuer ist.
Der Wallach schnaubt, und ich klopfe ihm für das geduldige Stillstehen die Kruppe, während ich das Eisen zischend im Wasserbad versenke, damit es abkühlt.
»Ich hoffe, beim nächsten Mal ist der Meister wieder selbst zugegen«,meintderKunde,währendichdieBrandformdesEisenskontrolliere und sie – ohne mich selbst loben zu wollen – für nichts anderes als perfekt erachten kann.
Mit dem Unterarm wische ich mir den Schweiß von der Stirn. »Da wünsch ich Ihnen Glück. Mein Vater wird morgen für mehrere Wochen nach Eshrian reisen. Aber bis der nächste Beschlag nötig wird, ist er sicher zurück.«
»Sind Sie denn nicht zufrieden mit dem Ergebnis?«, erkundigt sich Samu, während ich mit Nägeln zwischen den Lippen das Hufeisen auf den Huf anbringe. Ich bin sehr stolz auf ihn, weil er sein genervtes Unverständnis diesmal nicht offen vor sich herträgt, sondernmit etwas tarnt, das recht überzeugend an Höflichkeit erinnert.
DieAntwortisteinunwirschesKnurren.NatürlichistderMannzufrieden. Meine Arbeit ist ebenso gut wie die meines Vaters, denn bei ihm habe ich das Handwerk drei Jahre lang erlernt, bevor ich im Frühjahr vor drei weiteren Gildenmeistern meine Prüfung abgelegt habe. Aber ich bin eben Kaya, und das ist Grund genug, mir zu misstrauen. Nicht wenige Leute bringen ihre Pferde nur unter der Voraussetzung, dass Vater sie beschlägt. Nun, die werden sich in den nächsten Wochen wohl noch umschauen, wenn Vater weg ist.
Ich knipse die überstehenden Nägel ab, biege sie um und feile die Oberfläche glatt. Im Anschluss bekommt der brave Wallach einen Kanten hartes Brot. Sein Besitzer zählt derweil die Münzen ab und reicht sie Samu.
»Entschuldigen Sie«, sagt der, »aber da fehlen zwei Schilling.«
Nicht auch noch das!
»Dem Meister zahle ich gern wieder den vollen Preis«, erwidert der Kunde, nimmt sein Pferd und wendet sich ab. Samu ballt die Fäuste und blickt sich Hilfe suchend zu mir um. Seine schmächtige Statur ist ihm trotz der harten Arbeit geblieben, dennoch sieht man, dass er über eine zähe Kraft verfügt. Da ist dieser stete Hauch von Angriffslust in seinen dunklen Augen. Samu hat ein großes Talent für Pferde, daher hat mein Vater ihn als Schmiedehelfer eingestellt. Den Umgang mit Menschen allerdings muss er jeden Tag üben.
»Der haut uns ab«, murmelt Samu.
»Ich wette die fehlenden zwei Schilling«, flüstere ich, »dass er sie gleich zahlt.«
Samu verschränkt die Arme. »Das will ich sehen.«
»Das passt schon!«, rufe ich dem Kunden nach, befreie meine schweißnassen Hände von den Lederhandschuhen und binde die schwere Schürze ab. »Für den letzten Beschlag in dieser Schmiede gibt es schließlich einen Abschiedsrabatt.«
Der Mann bleibt stehen und dreht sich langsam zu mir um. »Was soll das heißen,letzterBeschlag?«
»Dass Sie sich für Ihre Pferde nach dem Abschiedsrabatt wohl eine neue Schmiede suchen müssen. Eine Regel meines Vaters, ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Alles Gute, Sie werden schon eine neue Schmiede finden.«
Samu grinst überlegen. Er weiß so gut wie ich, wie weit der Weg zur nächsten ist. Der Kunde ahnt es vermutlich ebenfalls, wenn ich seinen Gesichtsausdruck richtig deute.
Ein Lächeln fliegt über meine Lippen, noch bevor der Mann in seinen Geldbeutel greift.
Na also, es geht doch.
Wenig später hat sich Samu verabschiedet. Ich fege ein letztes Mal durch, schlüpfe aus den schweren Stiefeln, die ich nur bei der Arbeit trage, und nehme das Leinentuch von meinem Kopf, das meine langen Haare vor den fliegenden Funken schützt. Dann sperre ich die Schmiede von außen ab und mache mich auf den Heimweg. Zähe Gräser, Sand und Steinchen kitzeln meine nackten Sohlen.
Als ich unser Haus nach wenigen Minuten erreiche, rufe ich nach meinem Bruder Kito. Oft sitzt er in der Krone der Akazie, aber heute ist zwischen den feinen Blättern nichts von ihm zu sehen.
Dafür vernehme ich Hufschlag. Ich schirme meine Augen mit der Hand gegen die tief stehende Sonne ab und erkenne das schiefergraue Pferd meines Vaters. Warum kommt er denn so früh schon heim? Oder habe ich mich in der Zeit verschätzt? Ich fahre zusammen, als ich ans Abendessen denke, denn plötzlich nehme ich den Geruch wahr, der aus dem Haus dringt. Der Weizenbrei köchelt seit Mittag vor sich hin. Kito hat bestimmt vergessen, ihn umzurühren.
Eilig laufe ich ins Haus, vorbei an meiner Staffelei, die vor der Tür steht, weil ich am Morgen gemalt habe. In meiner Eile verzichte ich darauf, mir die Füße an der Schwelle zu waschen, und flitze zur Kochstelle. Glück gehabt: Etwas Weizen hat am Grund des Kessels angesetzt, aber zumindest scheint der Brei noch nicht verbrannt.
Vater wäre nicht sauer. Jedem brennt hin und wieder das Essen an, auch ihm. Aber er soll nicht denken, dass Kito und ich überfordert sind, den Haushalt in den kommenden Wochen allein zu führen.
Rasch klopfe ich die Matte aus, auf der noch Krumen vom Frühstück liegen, arrangiere die Schalen, Tassen, Löffel und Messer besonders ordentlich und verteile Kerzen dazwischen. Nebenbei brate ich Zwiebeln in Zucker und Fett, schneide Feigen und reibe scharfe Kräuter drüber. Süßwürzige Düfte erfüllen unsere Küche.
Ab morgen sind Kito und ich auf uns gestellt. Es gibt keinen Grund, deshalb aufgeregt zu sein. Immerhin bin ich siebzehn, und die ersten Mädchen und Jungen aus meiner Schule beginnen bereits, ihre eigenen Häuser zu bauen oder Familien zu gründen. Da werde ich ja wohl eine Weile auf meinen Bruder aufpassen und die Arbeit in der Schmiede allein verrichten können.
Oder? Was, wenn Kito krank wird? Was, wenn er in der Schule frech wird und seine Lehrerin verlangt, dass ich ihn bestrafe? Was, wenn es dann über mich kommt, und ich der Lehrerin endlich mal sage, was ich von ihr und ihrer Auffassung von guter Erziehung so halte?
Ich hacke eine Feige so energisch mit dem Messer durch, dass die beiden Hälften vom Brett fliegen.
Ruhig bleiben. Es wird gut gehen. Es geht immer gut. Meine Eltern sind ja nicht aus der Welt – sie reisen nur beruflich, und ich gönne es ihnen, mehr zu erleben als unser Dorf, in dem sich seit meiner Geburt nicht einmal die Kiesel verändert haben, die auf der Straße liegen. Geschweige denn die Menschen oder ihre Ansichten. Ich kann es ja selbst kaum erwarten, bis sich mir die erste Gelegenheit zu einer Reise bietet.
Vater scheint noch das Pferd zu versorgen, sodass ich schließlich, als das Essen fertig ist, wieder nach draußen gehe. Ich finde ihn vor der Tür neben meiner Staffelei.
»Hallo, Papa. Du bist früh dran,was …« Mein Blick fällt auf seine rechte Hand, um die er ein Tuch geschlagen hat. Dann auf sein aschfahlesGesicht.MeineWorteverschwindenundweichenanderen.»Hast du dich verletzt?«
»Das war die verdammte Mulistute vom Krämer.« Er seufzt. »Die hat sich wieder einmal angestellt, als wollte ich ihr die Hufe abschneiden, statt ihr zu helfen. Umgeworfen hat sie mich und ist in ihrem Hin und Her auf meine Hand getrampelt. Blödes Biest.«
Ich verkneife mir die Bemerkung, dass die Stute es sicher nicht mit Absicht getan hat. Das weiß er selbst. »Ist es schlimm? Soll ich mal sehen?«
FrustriertschüttelterdenKopf.»IchwarschonbeiJaconndeshalb.«
ObgleichwirklichnichtslustigistaneinerverletztenHand,muss icheinGrinsenunterdrücken.EsisttypischvonVater,zumPferdeheiler unseres Dorfes zu gehen statt zu dem der Menschen. Er vertraut niemandem so sehr wie dem alten Jaconn. Gerüchten zufolge soll der sogar anstelle einer Hebamme bei meiner Geburt geholfen haben, aber Jaconn und meine Mutter schütteln immer nur lachend den Kopf, als wäre das Ganze eine lange, amüsante Geschichte, die ich nicht erfahren soll.
»Und was sagt der große Heilmeister?«, erkundige ich mich.
»Gebrochen.«
»Was? So schlimm? Papa, das tut mir leid! Tut es sehr weh?«
Er grummelt, und mir wird klar, dass sein Arbeitsausfall für ihn ein viel größeres Problem darstellt als die Schmerzen.
In nicht einmal anderthalb Kilometern Entfernung rastet ein Tross ausEl’Yellamiz,derHauptstadtAmisas.DieTriaga,bestehendausunserendreiHohepriesterinnen,hatdieReisendenhöchstpersönlicherwähltundausgesandt –einegroßeEhre,wennmanmeinenbestenFreundNevanfragt,deralsMitgliedseinerHeilergildefürdenTrossausgesuchtwurde,umverletztePferdezuversorgen.KnapphundertKriegerinnenundKrieger,ebensovieleHandelsleute,zweiDutzendKutschenundfastvierhundertPferdebefindensichmitunterschiedlichenGüternaufdemWegnachEshrian.EinewertvolleReliquie,dieunseremNachbarlandvorlangerZeitgestohlenwurde,sollalsZeichendesRespektesandenHerzogvonEshrianzurückgegebenwerden,weshalbmandemTrossnichtnurEhre,sondernauchgroßediplomatischeWichtigkeitbeimisst.GeradefürDörferwieunseres,dieandenGrenzenzuEshrianliegen,sinddieverbessertenBeziehungenvonenormerBedeutung,dennimmerwiederkommtesandiesenGrenzenzuReibereien,ScharmützelnundmanchmalauchzuernsthaftenKämpfenzwischendenEshrianernunduns.DieReisesollAmisainsicherenFriedenführen.
Vater wurde als Schmied ausgewählt. Mit einer gebrochenen Hand allerdings …?
»Du kannst den Tross nicht begleiten. Wie willst du so den Schmiedehammer führen?«
»Und was soll ich sonst tun?« Vater stößt einen unwirschen Laut aus. »Ich habe der Triaga zugesagt.«
»Aber da war deine Hand heil, und nun ist sie gebrochen.«
»Was, denkst du, kostet es an Zeit, einen anderen Schmiedemeister aufzutreiben?«
Das wird Tage dauern. Unsere Region verfügt nur über wenige Schmieden. Und auch sonst nicht über viel. Allein zum nächsten Dorf reitet man fast einen Tag, und der dortige Schmied ist alt und tatterig. Zumindest war er das imletzten Sommer. Ob er überhaupt noch lebt?
»Aber mit der Hand kannst du unmöglich arbeiten! Die Hohepriesterinnen werden dafür Verständnis haben.«
»Und die Dörfler?« Die Art, wie Vater mich ansieht, tut mir beinah weh. Als wäre ich naiv und ahnungslos. Dabei weiß ich natürlich, was er meint: Den Tross zu verpflegen, ist Aufgabe der Dorfgemeinschaft, undsiewirdalleinmiteinemDankentlohnt.IneinemDorfwieunserem reißt der Bedarf an Nahrung für so viele Menschen und Tiere schonbeieinemTageingroßesLochindieVorräte.WennderTrossnun länger bei uns gastieren muss, ehe sich ein neuer Schmied auftut, bedeutet das für uns spätestens im Winter Hunger.
»DasVertrauenindeineMutteristbereitsjetztnichtmehrdasbeste«, sagt Vater leise.
Ich muss schlucken, denn das liegt allein an mir. An meiner Andersartigkeit.
»Wenn die Kolonne nun meinetwegen länger bleiben muss, Kaya, versagen sie ihr endgültig die Loyalität und werden eine neue Dorfmeisterin wählen.«
Das würde Mamma das Herz brechen. Sie hat so hart gearbeitet, um die damals zerstrittenen Familien zu versöhnen. Unser Dorf ist nicht wohlhabend, aber alle haben, was sie brauchen. Jedes Kind kann zur Schule gehen, niemand muss hungern, jedes Dach ist dicht und jede Feuerstelle heiß. Wir leben in Sicherheit vor räuberischen Banden aus Eshrians Wäldern, was in Bellaney beileibe keine Selbstverständlichkeit ist. Wer Mamma sein Vertrauen abspricht, erinnert sich vermutlich nicht mehr an die Zeiten, bevor sie Dorfmeisterin war. Doch leider vergessen Menschen sehr schnell. Vor allem vergessen sie Gefahren, die jemand anders für sie abwenden konnte.
Vater betrachtet mein Gemälde auf der Staffelei, als würden sich die blauen und weißen Tupfen, mit denen ich die Wolken gemalt habe, über das Leinen bewegen. Aber dieses Bild ist tatsächlich nur das: ein Bild aus Farben. Etwas, das mehr ist als das, würde ich niemals für jeden ersichtlich herumstehen lassen.
»Was also«, sagt Vater, »bleibt mir übrig, als zu hoffen, dass meine Hand heilt?« Er zuckt mit den Schultern und hält mitten in der Bewegung mit schmerzverzerrtem Gesicht inne.
Ichmustereihn.DieweißenSträhneninseinemehemalsschwarzen Haar. Die grauen Bartstoppeln auf seiner tiefbraunen Haut. Wie lange braucht ein Knochen eines Mannes Ende vierzig, um zusammenzuwachsen? Sicher länger, als die Reise dauert. »Sei doch vernünftig, Papa.«
Er sieht mich an, als wollte er mir den Mund verbieten. Aber das tut er nicht. »Und wie, mein Mädchen?«
»Indem ich für dich auf diese Reise gehe.«
»Kaya! Auf keinen Fall!«
»Denkst du, ich könnte es nicht? Ich bin eine gute Schmiedin!«
Mein Vater schüttelt fassungslos den Kopf. »Natürlich bist du gut. Darum geht es nicht.«
»Worum dann? Du hast selbst gesagt, dass es ungefährlich ist.Inmitten all der Kriegerinnen und Krieger wird mir kaum etwas zustoßen.DaswarendeineWorte.UndNevanistschließlichauchdabei.Wirarbeiten großartig zusammen, das hast du auch gesagt.«
»Natürlich habe ich das gesagt, aber das bedeutet doch nicht …«
»Du gehst weg?«
Ich fahre herum und sehe in die weit geöffneten braunen Augen meines Bruders. Kito steht hinter mir im Haus. Ob er die ganze Zeit in unserem Zimmer war und gelauscht hat?
»Wo kommst du denn bitte her? Das Essen brennt fast an, und du schimmelst in deinem Bett herum wie ein Sack fauler Rüben?«
Er reagiert nicht auf meinen Versuch, ihn zu necken, sondern kommt auf bloßen Füßen einen Schritt näher. »Du gehst nicht wirklich weg, oder, Kaya?«
»Nein, das tut sie nicht«, sagt unser Vater tonlos, doch ich höre seiner Stimme an, dass bei dieser Entscheidung das letzte Wort noch nicht gesprochen ist.
KAPITEL 3
KAYA
Selten gab es in unserem Haus ein Abendessen, bei dem nicht geredet und gelacht wurde.
Heute jedoch essen wir schweigend, verfangen in unseren Gedanken. Ich bin nicht mehr sicher, die Zwiebeln und Feigen gewürzt zu haben, irgendwie schmeckt alles nach fadem Weizenbrei.
Vater müht sich mit der linken Hand ab, nicht zu kleckern. Kitos Blick ruht wie ein Vorwurf auf mir.
Schließlich schiebe ich meine halb volle Schale zurück. »Es geht nicht anders. Ich muss auf diese Reise gehen, wenn wir nicht wollen, dass das DorfdieKolonnemehrereTagedurchfütternmuss.Ihrwisstdasbeide.«
Kito wirft seinen Löffel auf die Matte, springt auf und rennt aus der Küche. Ich höre die Haustür klappern und will ihm nach, aber mein Vater schüttelt den Kopf.
»Lass ihn, Kaya. Du hast recht, und er wird sich damit abfinden.«
»Und du, Papa?«
»Bleibt mir eine Wahl? Aber du musst mir etwas schwören, bei allem, was dir lieb und teuer ist!«
»Dass ich kein gefährliches Abenteuer und keinen möglichen Streit auf der Reise auslassen werde?« Ich biete ihm ein Lächeln an, und er braucht beunruhigend lange, bis er es erwidert. »Ach, Papa. Ich werde gut auf mich aufpassen, jedem Ärger aus dem Weg gehen und mich die ganze Zeit an Nevan halten. Ich schwöre es. Besser so?«
»Ein wenig. Ich wünschte, ich müsste dich gar nicht schicken.«
Undichwünschte,eswürdeihmleichterfallen,michgehenzulassen. Denn die Wahrheit ist: Als sich vorhin dieser Weg vor mir auftat, so unverhofft und plötzlich, da erwachte ein Vibrieren zwischen meinem Herzen und meiner Magengegend. Ich spürte eine stärker flatternde Vorfreude darauf, etwas Neues zu sehen. Unbekannte Menschen. Ein fremdes Land. Womöglich … irgendetwas Großes.
Ich will auf diese Reise gehen!
Papa seufzt schwer. »Wie soll ich das nur deiner Mutter erklären?«
Ich lege meine Hand auf seine unverletzte. »Sie wird es verstehen. IchschreibeihrnachdenGesängeneinenBrief,damitsiedirkeineVorwürfe macht.« Mamma hat meine Sehnsüchte immer besser verstandenalsPapa.DasbegannschonmitmeinemDrangzumalen, auch wenn meine Bilder zuweilen … einige Eigenheiten entwickelten, die uns alle in Erklärungsnöte brachten. Und es endete mit meinem Wunsch, Vaters Schmiedehandwerk zu erlernen, obgleich meine Lehrerin zeterte, man dürfe doch ein stockdürres Mädchen, wie ich es damals war, nicht das Schmieden lehren. Ich würde ja nie eine frauliche Figur und einen feinen Geist bekommen, wenn ich so hart arbeite! Und das als Tochter der Dorfmeisterin!
Nun. Drei Jahre sind vergangen, und ich bin immer noch die Tochter der Dorfmeisterin und eine Frau ziemlich eindeutig ebenfalls. Aber ebenso bin ich eine Schmiedin mit kräftigen Schultern, sehnigen Armen und dem einen oder anderen bleibenden Beweis auf der Haut, dass die Esse verflucht heiß ist.
Mit überkreuzten Füßen stemme mich hoch. »Ich schau mal nach Kito.«
Papa blickt zu mir hoch. »Dann singen wir nicht gemeinsam heute Abend? Dieses letzte Mal?«
Ich grinse. »Ich bin doch nur ein paar Wochen fort. Für Kito werden sie sich länger anfühlen als für dich.«
Er nickt. »Du hast sicher recht, Kaya. Das hast du auffallend oft. Ich bin stolz auf dich.«
Ach herrje, er wird sentimental. Besser, ich verschwinde schnell, bevor es schlimmer wird. »Klopf dir auf die Schulter, Papa, ihr habt mich gut hinbekommen. Ich räume sogar das Geschirr ab, wenn ich zurückkomme. Lass es einfach stehen und ruh die Hand aus. Dein Buch wartet bestimmt auf dich.«
Ich werfe ihm noch einen Luftkuss zu und flitze nach draußen, barfuß über das Steppengras hinweg und weiter in Richtung der staubbedeckten Felshügel im Süden, um meinen Bruder zu suchen. Zähe Ambrosiasträucher und goldgelbe Creosoten blühen und erfüllen die Luft mit ihrem Duft, der ein wenig an Tabak und Feuerrauch erinnert.
Als wenig später die Sonne wie eine gewaltige Blutorange am westlichen Horizont versinkt – genau dort, wo sich ganz weit weg und doch recht nah Eshrian befinden muss –, und die Zeit der Gesänge zu Ehren Amisas, der Triaga und der Mutter Lyaskye gekommen ist, habe ich Kito noch nicht gefunden. Er war weder bei den Dünen, wo die Naras wachsen und er sich zwischen den giftgrünen Dornen gern eine der süßen runden Früchte ergattert, noch auf den knorrigen Eichkatzenbäumen. Nicht am Wasserreservoir und nicht unter der Sandflussbrücke. Und auch hier, bei den rostroten Felsen nah des Feigenhains, kann ich ihn nicht finden.
Und nun bleibt mir keine Zeit mehr, ihn zu suchen, denn von der Ebene, wo der Tross lagert, dringen bereits die Lieder zu mir herüber; ein fernes, tiefes Summen, das entsteht, wenn sich Hunderte von Stimmen mischen.
Seit ich denken kann, habe ich nie einen Abendgesang ausgelassen, und heute sollte ich nicht damit anfangen. Ich sinke auf die Knie, setze michaufmeineFersenundberühredentrockenenBodenmitdenFingerspitzen, bis der Staub sich in die Rillen meiner Haut schmiegt, sodass wir fast verbunden sind: der Erdboden von Amisa und ich.
Der Abendgesang bedeutet für Amisa das, was den Keppochanern der Blick ins Feuer ist oder den Menschen aus Lyaskye das Gebet. Wir singen den Tag in den Schlaf, damit er alles Schlechte loslässt und eine friedliche Nacht heranlockt, der ein guter neuer Morgen folgen soll.
Ich schließe die Augen und singe ein Lied meiner Heimat, das niemandaußermirkenntundjehörenwird.EinLiedderErwartung, ein Lied der Vorfreude und Aufregung, ein Lied der Neugier auf die Fremde. Aber gleichzeitig ist es auch ein Lied des Trostes und der Bitte umVergebung,weilmeinkleinerBruderzurückbleibenmussundmein Vater die Reise nicht antreten kann.
Es wird ein langes, helles und für meine Verhältnisse lautes Lied, denn jeder Stein und jeder Busch, jedes Tier und jede der zähen Pflanzen will es hören. Für Augenblicke gelingt mir das, was das hehre Ziel der Gesänge ist und nur selten erreicht wird. Ich scheine mich aufzulösen im Gesang und der Dämmerung. Jeder bewusste Gedanke verschwindet, ich bin nirgends mehr und gleichzeitig überall. Es ist, als würde mein Geist einschlafen, während mein Körper weitersingt, und der Schlaf schenkt mir einen Traum, klar und wirklich wie der Wind auf meinen nackten Armen und der Erdboden unter meinen Knien. Im Traum verreibe ich mit den Händen eine Farbe in leuchtendem Türkis auf goldbraunem Untergrund. Sie riecht nach zerriebenem Stein und Salz, aber in meinem Mund entsteht der Geschmack von klarem Wasser nach einer langen Durststrecke. Ich glaube zu spüren, wie verdorrt und wund sich meine Kehle anfühlt. Als wäre ich zwei Tage lang durch die Wüste geirrt. Und dann rinnt dieses kalte Wasser über das Brennen des Durstes hinweg, löscht es aus und hinterlässt Wohlgefühl. Jetzt weiß ich, welche Magie in diesem Farbton liegt.
»Kaya?«
Ich schrecke aus meiner Trance auf, fahre herum und sehe Nevan zwischen den struppigen Büschen stehen. Das Licht der Dämmerung wirft einen goldenen Schimmer auf seine braune Haut, ein paar Partikel des Wüstenstaubes glitzern darin auf. Dass er sich seine Locken vor der Reise raspelkurz geschnitten hat, kann ich nur als bedauernswert bezeichnen. Nicht, dass er nicht gut aussähe. Aber nun erinnert er an dieKrieger,kaummehranmeinenbestenFreund,dersichnichtsdaraus macht, wie Männer den Traditionen zufolge auszusehen haben.
»Entschuldige.« Seine Zähne leuchten weiß auf, als er mich breit anlächelt. »Ich wollte dich nicht erschrecken.«
Ich muss lachen. »Lügner, natürlich wolltest du. Wart einen Moment, bin gleich bei dir!«
Die Bilder der Trance verrinnen in meiner Erinnerung, aber mir bleibt das Wissen, dass sich etwas Besonderes in der Nähe befindet. Etwas Besonderes in Türkis, in dem die Magie des Wassers verborgen ist. Ich sehe unter den Büschen nach, fege mit den Händen Sand und Staub von ein paar Steinen, aber letztlich zieht es mich zu den rostroten Felsen zurück. Nevan und ich haben hier schon oft in zwanzig Metern Höhe gesessen, um mit baumelnden Füßen über das gesamte Dorf zu blicken. Heute fesselt ein Loch meine Aufmerksamkeit, gerade groß genug, damit ich meine Hand hineinstecken kann.
»Kaya, lass das.« Nevan tritt näher, als ich behutsam in die Dunkelheit taste, bis mein Arm bis zum Ellbogen in der Scharte verschwunden ist. »Wenn da Skorpione drin hocken!«
Doch meine Fingerspitzen fahren bereits über etwas anderes, und das kurze Aufleuchten in meiner Brust verrät mir, dass ich gefunden habe, wonach ich suchte. »Keine Sorge. Ich kann schon mal versprechen, dass keine Skorpione in dem Loch sitzen.«
Nevans Gesicht verdüstert sich, während er die Arme verschränkt, und ich muss lachen. Er spielt sich ständig auf, als wäre er mein großer Bruder, der daheim gescholten wird, wenn mir etwas zustößt. Dabei binichsogareinpaarMondläufeälteralser,undwirsindnichtmiteinander verwandt, nicht einmal über ganz viele Ecken, was in Bellaney ziemlich selten ist. Aber wir sind zusammen aufgewachsen, seit Nevans Eltern ihn mit fünf Jahren zu Jaconn in die Lehre gaben, damit ein Pferdeheilerausihmwird.InderSchulehatmanunssofortnebeneinandergesetzt, weil keiner sonst mit mir an einem Tisch sitzen wollte. Ich war das Mädchen mit den seltsamen Aussetzern, das blicklos ins Leere starrte und selbst dann nicht reagierte, wenn die Lehrerin schon zornesrot im Gesicht war. Nevan war der Junge, der nicht sprach, mit niemandem, egal, was man ihm androhte. Lange Zeit dachten alle, er könnte gar nicht reden. Nur ich kannte die Wahrheit, denn ich hatte mit angehört, was er den kranken Pferden zuflüsterte.
»Keine Skorpione«, wiederhole ich, während ich meinen Fund hervorhole. »Bloß eine Schlange.«
»Kaya!« Nevan ist schwer zu ärgern. Aber Schlangen sind sein wunder Punkt. Seine Kehle macht ein klickendes Geräusch, so schwer muss er schlucken.
Grinsend öffne ich meine Hand. »Zumindest steckte mal eine drin. Aber es scheint, als wäre sie ausgezogen.« Wir betrachten die leuchtend türkisfarbene Schlangenhaut auf meiner staubbedeckten Handfläche; Nevan mit leichter Abscheu im Gesicht, ich fasziniert. Es ist schon fast dunkel, trotzdem leuchtet die Haut, als fiele Licht darauf. Ich werde sie mörsern und in Öl verreiben. Es wird eine wundervolle Farbe werden, um tiefes, kaltes Wasser zu malen.
»Es ist übrigens prima, dass wir uns treffen, denn ich muss dir sehr dringend etwas erzählen!« Ich schiebe die Schlangenhaut in die Tasche meinerärmellosenTunikaundschmiegemeinenArmumseineschlanke Taille.
Nevan legt seinen um meine Schulter.
Eine Weile waren Vertrautheiten wie diese schwierig für mich. Vor wenigenJahrenpassierteesungewollt,dassichNevanmitanderenAugen sah. Vielleicht lag es daran, dass er sich verändert hatte. Seine Schultern waren breiter geworden, seine Arme muskulöser, und an seinem Schlüsselbein sowie den Schläfen formten die Knochen praktisch über Nacht Linien, die ich ständig hatte anstarren müssen. Aber eigentlichwogendieÄnderungeninmeinemGeistschwereralsdie von Nevans Körper. Denn plötzlich hatte ich diese Fantasien, er würde mich küssen. Mich auf eine gänzlich neue Art berühren. Irgendwann gestand ich ihm, dass ich mich in ihn verliebt hatte.
Es war die viel besungene erste, wahre und einzige große Liebe. Und sie dauerte genau so lange, wie Nevan brauchte, um mir äußerst liebevoll, aber ebenso deutlich zu erklären, dass er mich liebe und immer lieben werde. Aber nicht auf die Art, zu der Küsse gehörten.
Ich warf ihm an den Kopf, dass es zwischen uns nie wieder so sein würde wie vorher. Aber man versteht nicht viel von der Zukunft, wenn man vierzehn Jahre alt ist. Will sagen: Ich irrte mich.
»Wollen wir wetten«, sagt Nevan, »dass ich es schon weiß?«
Wir beide lieben es zu wetten, wenn auch nie um einen Einsatz.
»Was soll das heißen?«
»Ich bin vorhin über Kito gestolpert«, sagt Nevan. »Der sucht dich überall.«
»Dieser kleine Lump!«, schimpfe ich und muss grinsen. »Erist doch abgehauen. Er war wütend, weil ich …«
Nevanziehtmicheinwenigzusichheran.»WeilduihnnichtnachEshrianmitnimmstunderstattdessenweiterzurSchulegehenmuss,obwohlerdaallesschonkann?Dashatermirzumindesterzählt.«
Nun. Nevan hat die Wette gewonnen. »Und dann hast du nach mir gesucht?«
»Nein. Ich bin bloß deiner Stimme gefolgt. Die klang, als würde eine arme Katze ganz dringend Hilfe brauchen.«
Dafür zwicke ich ihn in die Seite, wo man ihn mit Leichtigkeit kitzeln kann.Ichknuffeallerdingssehrunkitzeligundfest,dennderKommentar war gemein.
»Aua, was soll das denn? Du weißt, dass ich dich bewundere. Vielleicht nicht für deine liebliche Gesangsstimme. Aber für deinen Mut, trotzdem zu singen.«
Dafür hat er sich eigentlich mehr als nur einen Knuff verdient, denn so schlecht singe ich sicher nicht. Aber mir ist gerade überhaupt nicht nach einer Rauferei.
»Denkst du, Kito verzeiht mir?«, frage ich Nevan leise. Die Vorstellung, morgen früh loszuziehen, während mein Bruder noch wütend ist, macht mein Herz schwer. Kito ist stolz und stur und würde es über sich bringen, sich nicht einmal zu verabschieden.
»Das hat er längst.«
»Da bin ich mir nicht so sicher.«
»Kaya.« Nevan verkneift sich das Lachen, aber es schwingt in seiner Stimme mit. »Ich kenne Kito ebenso lange wie du. Er bedeutet mir nicht weniger als dir.«
Das stimmt ganz sicher nicht. Zwar ist Kito nicht mein leiblicher Bruder; nicht in dem Sinne, dass er wie ich im Bauch unserer Mutter zum Menschen herangewachsen ist. Aber ich könnte ihn nicht stärker lieben,wennessowäre.KitowurdevoneinersehrjungenFraugeboren, die in unser Dorf kam, bei der Hebamme klopfte und um eine Anstellung bat. Niemand wusste, woher sie kam oder von wem das Kind unter ihrem Herzen war. Sie erzählte jedem im Dorf eine andere abenteuerliche Geschichte. Einige Wochen arbeitete sie tüchtig bei der Hebamme, gebar in ihrem Haus das Kind und verschwand ohne den Säugling nur wenige Tage nach der Geburt. Einen wilden, sturmgetrieben Geist – so hatten meine Eltern sie damals genannt. Sie wurde nie wieder gesehen. Die Hebamme hatte meiner Mutter den kleinen Jungen gebracht, weil sie wusste, dass sich meine Eltern so sehnlich wie vergebens ein zweites Kind gewünscht hatten. Doch der Säugling war schwach gewesen und hatte die Ziegenmilch nicht vertragen, mit der Mamma ihn fütterte.
»Stutenmilch«, hatte die Hebamme damals geraten. »Stutenmilch ist der Muttermilch ähnlicher als die Milch der Kühe und Ziegen. Vielleicht verträgt er die.«
Nevan und ich hatten die Pferde gesattelt und waren im Mondschein wie die Derwische ins Nachbardorf geritten, wo eine Familie eine Stute besaß, die gerade ein Fohlen geboren hatte. Wir beknieten sie, das Pferdausleihenzudürfen,undtatsächlich:MitderMilchderStuteerholte sich Kito. Das Fohlen, Kitos Milchbruder, hat meine Mutter später für ihn gekauft.
Während ich nun zurückblicke, kommt mir der Gedanke, dass Nevan Kitos Leben damals ebenso gerettet hat wie ich. Vielleicht sind die beiden also doch nicht weniger verbunden.
»Ich hoffe, dass du recht hast«, murmle ich. In einiger Entfernung kann ich bereits die Konturen unseres Hauses ausmachen. Das warme Licht der Feuerstelle dringt durch die Vorhänge und verspricht sichere Heimeligkeit, die ich außerhalb unserer Wände noch nirgendwo im Dorf gefunden habe.
Und plötzlich ist da ein wenig Furcht vor dem Aufbruch morgen.
Ich weiß doch gar nicht, was mich erwartet.
KAPITEL 4
MIRULAY
DER TAG, AN DEM DIE SCHRECKEN KAMEN
18 JAHRE ZUVOR, AM HOF VON ESHRIAN
»Mirulay, komm!«
Miru wimmerte vor Dankbarkeit auf, als er die Stimme seiner Mutter erkannte. Sie packte ihn so fest am Arm, dass es wehtat, aber er fühlte nur Erleichterung, als sie ihn mit sich durch das Chaos riss.
Panisch rannten die Leute umher, flüchteten in Richtung der Ausgänge und wurden wieder zurückgetrieben. Schläge prasselten auf Köpfe ein, Schreie gingen in gurgelnde Laute über.
Miru wusste nicht, wie ihm geschah. Eben noch war doch alles gut gewesen, und plötzlich spielten die Gäste verrückt und droschen wie wild geworden auf jene ein, mit denen sie zuvor noch ein Glas gehoben hatten. Klingen blitzten auf, Dolche und die längeren, kantigen Stirkas. Wie kamen all die Waffen so plötzlich in den Friedenssaal?
Eilig zerrte die Mutter ihn in eine Ecke und stieß ihn hinter einen schweren Vorhang aus azurblauem Samt.
»Mirulay, hör mir zu!« In ihrem Blick war so viel Trost. Auch ihr Gesicht war von Schrecken gezeichnet, aber ihre grünen Augen waren immer noch so zuversichtlich wie eh und je. Sie übertrug all ihre Kraft und ihren Mut auf ihn. So wie immer wenn er zu verzagen drohte.
»Was passiert hier, Mutter?«
»Das ist nicht wichtig. Nur eins ist wichtig, also hör gut zu.« Sie sprach so schnell und so leise, dass er Angst bekam, sich nicht merken zu können, was sie sagte. »Du musst dich verstecken. Versteck dich, Miru, und dann flieh nach draußen, sobald es sicher ist. Raus aus dem Palast.«
»Treffen wir uns draußen? Du, Vater und ich?«
Ihr entglitt ein kleiner Laut. »Vater ist fort, Schatz. Du bist jetzt Sarev.«
»Nein!« Er war doch … bloß Miru. Ein Junge, der … der so fürchterliche Angst hatte!
»Du bist nun der Sarev, Mirulay, und als solcher hast du nur eine einzige Aufgabe.«
Irritiert sah er zu, wie seine Mutter mit flinken Fingern eine Naht amVorhangöffneteundeineStirkaherauszog.Erwusstenicht,ob es ihn verstören sollte, dass seine Mutter eine Klinge im Friedenssaal versteckt hielt, oder obes ihn beruhigte. Was immer auch geschah: Sie hatte einen Plan. So wie stets.
»Sie dürfen dich nicht in die Hände bekommen, verstehst du mich?« Fest drückte sie ihm das Heft der Stichwaffe in die schweißnasse Hand. Zwei wasserblaue Steine zierten die Schenkel der Parierstange. Aquamarine. Die Aquamarine der Masqueradner. »Versteck dich vor jedem, verlass den Palast und flieh. Das ist deine Aufgabe.«
»Und du, Mutter?«
Statt einer Antwort berührte sie erst seine Wange, dann sein Cercerys. Ein Kribbeln fuhr ihm von dem Medaillon ausgehend durch die Brust. »Ich gebe alles, damit du sie erfüllen kannst, das schwöre ich dir. Aber auch du musst alles geben, hörst du mich? Gib niemals auf. Lauf in die Wälder!«
»Mutter! In den Wäldern lauern die Schrecken!«
Eine Träne rann über ihr Gesicht, dann eine zweite. Sie küsste seine Stirn.
»Nein, Mirulay. Die wahren Schrecken sind jetzt hier.«
Im nächsten Moment war er allein.
KAPITEL 5
KAYA
IM OSTEN VON ESHRIAN
Die Abendsonne scheint in Eshrian nicht weniger golden als bei uns zu Hause. Es ist nicht kälter und nicht wärmer. Doch das Licht, der Wind aufmeinerHautundalldaswinzigkleineLebeninderLuftfühlen sich hier ganz anders an. Es prickelt auf meinem Körper, dieses Andere, immer wieder richten sich vor erwartungsvoller Spannung die feinen Härchen auf meinen Armen auf.
Vier Tage sind wir nun in Eshrian, und ich möchte permanent tanzen und Menschen anlächeln. Sie am liebsten umarmen, und das schon, seit wir die Grenze passierten.
Doch auch hier wenden sie sich von mir ab.
Was ist los mit mir, dass diese aufgekratzte Freude trotzdem immer wieder aus dem Nichts neu entsteht?
Nevan lässt sich neben mir nieder, reißt seinen kleinen Laib Maisbrot in zwei Teile und reicht mir eine Hälfte. »Du grübelst so laut, dass es das Zirpen der Grillen übertönt, Kaya. Was ist los?
Ich deute auf eine Gruppe Soldaten, die mit zwei Pferden abseits von demWagenstehen,dermeineprovisorischeSchmiededarstellt.Sie sehen immer mal wieder her und machen keinen Hehl daraus, dass sie über mich reden. Aber keiner kommt zu mir. Man brachte mir bislang nicht mehr als ein Wagenrad und eine beschädigte Schaufel zur Reparatur. Niemand hat mir sein Pferd anvertraut. »Ich hatte es mir einfacher vorgestellt.«
Auch Nevan haben sie nicht gleich in ihren Kreis aufgenommen, aber immerhin vertrauen sie seiner Heilkunst. Sein Gildezeichen am Aufschlag der Tunika, der goldene Bogen, der Kopf, Hals- und RückenlinieeinesPferdesskizziert,istihnenBeweisgenugfürseinKönnen.Ich bin sicher, dass sie ihn an ihre Feuer einladen und ihren Wein mit ihm teilen würden, wenn er nicht ständig mit mir zusammen wäre.
»Es liegt an mir, oder? Ich bin … seltsam.«
Nevan will widersprechen, aber ich lasse ihn nicht.
»Nein, warte. Meine Familie und du, ihr habt immer Erklärungen dafür, dass die Leute in unserem Dorf mich nicht mögen. Sie sind in ihrenTraditionenverhaftet,undesistschwierigfürsie,jemandengernzuhaben,derso …andersist.Aberhierkenntmichniemand.Niemand hier weiß, dass ich anders bin. Und trotzdem meiden sie mich.«
Nevankönntemireinreden,dasssiemirihreTierebloßnichtanvertrauen, weil ich eine Frau bin. Weil sie mich – Gildezeichen hin oder her –fürunerfahrenhalten.AberNevanistkeinLügner.Alsozieht er mich einfach nur an sich. Doch nur kurz. Dann verliert sein Gesicht plötzlich alle Wärme und wird wieder undurchschaubar und vertraut zugleich. So ist Nevan, der nichts an sich heranlässt, nur Pferde und Seltsamkeiten wie mich und den alten Jaconn.
Er nickt unauffällig in eine Richtung, und ich folge der Geste mit dem Blick. Ein Krieger kommt zu uns, einen großen, wunderschönen KohlfuchsamZügel.DerHengstbestehtfastnurausperfektdefinierten Muskeln, aber seine Bewegungen sind verhalten, seinem Schritt fehlt der Schwung, er will kaum auftreten. Ich ahne sofort, woran es liegt, sein Gangbild ist typisch.
»Du bist die Schmiedin?«, ruft der Mann mir zu. »Mein Hengst muss beschlagen werden. Kriegst du das hin?«
»Nein.«Ichstemmemichhoch,willmirdieFingeranderHoseabwischen, habe aber noch das Brot in den Händen. »Ich meine, ja, natürlich bekäme ich das hin. Aber ich glaube nicht, dass das nötig ist. Er ist bisher immer ohne Eisen gegangen, oder?«
»Jetzt läuft er schlecht«, erwidert der Mann und hält mir die Zügel hin. »Ich denke, er braucht Hufeisen.«
AufeinemSteinbildeicheinHäufchenausmeinenBrotstücken, um nichts zu verschwenden, und greife nach dem Zügel. Ich mache keine hastige Bewegung, der Hengst weicht trotzdem ruckartig vor mir zurück und reißt mich aus dem Gleichgewicht. Um ein Haar hätte ich ihn losgelassen.
In einiger Entfernung lachen ein paar Frauen und Männer, und auch der Krieger, der mir das Pferd gebracht hat, hat ein Grinsen im Gesicht. Das Pferd tänzelt aufgeregt um mich herum, zieht am Zügel und bleckt die Zähne in meine Richtung. Offenbar ist es Fremden gegenüber nicht bloß misstrauisch eingestellt, sondern schwer entschlossen ablehnend.
»Das Problem ist die Zehe.« Ich spreche mit dem Reiter des Pferdes, aber ich rede tief und ruhig, als würde ich es dem Tier erklären. »Sie ist zu lang geworden, das schmerzt ihn. Stimmt’s, Schöner?«
Der Mann verschränkt die Arme und amüsiert sich darüber, dass ich sein Pferd nur halten kann, indem ich es kleine Kreise um mich herumlaufen lasse.
»Er braucht keine Eisen, nur eine Hufbearbeitung«, erkläre ich.
»Das kann ja nicht lang dauern«, sagt der Krieger, dreht sich um und schlendert davon. Dabei pfeift er betont harmlos ein Lied, während seine Kameradinnen und Kameraden ausgelassen lachen. Über mich.
»Nettes Pferd«, murmelt Nevan ironisch, während ich mich abmühe, um nicht gebissen zu werden. »Ich würde dir ja helfen, Kaya, aber …«
»Schon gut, ich weiß.« Ich werde auf die Probe gestellt. Sie haben mir mit Absicht dieses schwierige Pferd gebracht und mich allein damit stehen lassen. Man will mich scheitern sehen. Ich brauche gar nicht hinsehen, um zu wissen, dass sie drüben bei den Zelten sitzen, eine PfeifeodereineFlascheWeinherumgehenlassenundmichbeobachten.
Womöglich entscheidet sich in den folgenden Momenten, ob ich auf dieser Reise noch etwas zu tun bekomme oder ob sie verlorene Nägel weiterhin selbst wieder schief und krumm in die wackelnden Eisen schlagen oder ihre Pferde zu lange unbearbeitet laufen lassen. Ich muss das unbedingt schaffen. Und es gut machen. Anderenfalls wäre ich besser gar nicht erst mitgeritten.
Ich sehe den Kohlfuchs nicht direkt an, wodurch es sich ziemlich schwierig gestaltet, seinen Zähnen auszuweichen, wenn er nach mir schnappt.WährendichihnSchrittfürSchrittüberzeuge,näheranmeinen Schmiedewagen heranzutreten, versuche ich, ihm ein Gefühl der Ruhe zu vermitteln. Jeden Moment, in dem er nicht am Zügel zerrt oder nach mir beißt, lobe ich ihn mit leiser Stimme. Er ist kein böses Pferd. In diesem Fall hätte er mir längst mit den Hufen den Schädel eingeschlagen. Er hat bloß Angst, und ich frage mich unweigerlich, was er erlebt hat. Doch alle möglichen Antworten stören meinen inneren Frieden, daher verdränge ich die Gedanken wieder. Für den Moment ist egal, was früher war. Wir können es nicht mehr ändern.
Die Sonne geht langsam unter, ich höre Nevan bereits leisevor sich hin summen. Es tut gut, ihn in meiner Nähe zu wissen. Dass er einfach vorgibt, alles wäre normal, verleiht mir Sicherheit. Ich stimme selbst meinen Abendgesang an. Die Töne, die sich in meiner Kehle bilden, sind sehnsuchtsvoll und melancholisch. Sie würden einsam klingen, aber irgendetwas verhindert das. Vielleicht Nevans tiefe Melodie.
Es wäre schön, würde der Gesang das Pferd beruhigen, aber es macht sich offenbar nichts aus Liedern.
EndlichhabeichmeinenWagenerreichtundkanndieZügelum dieAnbindestangeschlingenundmirleisesingenddieHaaremiteinem gelben Tuch zusammenbinden. Ich lege meine Lederschürze an und hole meine Werkzeugtasche mit den Messern, Wetzstäben und Feilen.
Und die Farbe. Ich vergewissere mich, dass niemand nah genug ist, um zu sehen, was ich tue, und greife intuitiv zu einem warmen Rot – Karmesin. Den Farbton habe ich aus uraltem Stein aus der Wüste gewonnen, der sich tagsüber aufwärmt und die Wärme die ganze Nacht lang hält, vermischt mit einem duftenden Öl aus Nüssen meiner Heimat.DieFarbeistwarm,alsichmeineFingerhineintauche.Sieerinnert mich an zu Hause, an meine Familie, an die Gewissheit, weder Kälte noch Hunger oder wilde Tiere fürchten zu müssen. Genau das braucht dieser schöne, ängstliche Hengst. Geborgenheit.
DasPferdsteigtaufdieHinterhand,alsichnahherantreteund seine Schulter berühre. Um ein Haar erwischt mich sein herumwirbelnder Huf. Es ist schwierig, die Rune – das Symbol für Sicherheit – auf sein Bein zu zeichnen, wenn das Pferd sich nicht von mir berühren lassen will. Aber es auf die klassische Weise zu beruhigen, würde Stunden, wenn nicht Tage dauern. Ich will nicht von den Hufen getroffen werdenundmussdochganznahanseineBeine.MeinAbendliedist zu Ende, aber ich vergesse einfach, aufzuhören, und singe es ein zweites Mal. Schließlich habe ich es geschafft: eine karmesinrote Spirale auf der Schulter des Pferdes, die außen in einem Kreis endet, der eine sichere Begrenzung symbolisiert.
Es wirkt sofort. Das Pferd beruhigt sich, senkt den Kopf, sieht mich verwirrt und erleichtert zugleich an und schnaubt.
Ich habe so etwas schon oft erlebt, denn ich wurde mit dieser Fähigkeit geboren. Und trotzdem schaudert mir jedes Mal, wenn ich es sehe. Weniger weil es gefährlich ist, weil ich dabei erwischt werden könnte oder weil meine Eltern mir zeit meines Lebens einbläuen, dass niemand davon wissen darf. Sondern weil es so faszinierend ist. Eben noch war da Angst, nackte Panik. Nun fühlt der Hengst eine tiefe Sicherheit, allein durch die richtige Wahl von Farbe und Rune. Und das, womit ich beides auf seinem Fell verbinde: Magie.
»Kaya.« Nevan steht direkt hinter mir, während ich meine Handschuhe überstreife. Niemand ist nah genug, um uns zu belauschen, dennoch flüstert er. »Du kannst dochhiernicht …«
Ich streiche am Vorderbein des Hengstes nach unten, und er hebt denHufvomBoden.»Ichbinvorsichtig,dieFarbelässtsichleichtabbürsten.«
»Und wenn jemand fragt, wie du das Pferd beruhigt hast?« Ohne aufzublicken, höre ich ihm an, dass er sich umsieht.
Gleichzeitig erkenne ich am Huf des Pferdes, dass ich recht hatte. Eine halbe Stunde Arbeit, und dieses wunderschöne Pferd wird wieder unbeschwert traben und galoppieren. »Dann sagen wir, dass das Pferd wohl gemerkt hat, dass ich ihm nur helfe.« Ich greife zum Messer und beginne zu arbeiten.
»Du nimmst das zu leicht«, murmelt Nevan. »Wir sind hier nicht zu Hause.«
»Es ist nicht gerade so, als könnte ich dort zeigen, wer ich wirklich bin.« Auch in unserem Dorf verheimliche ich mein Talent. Verstecke es. Ich würde sogar lügen, sollte mich jemand danach fragen.
»Man würde dir dort aber nichts antun«, erwidert Nevan tonlos. »Oder dich in Ketten nach Lyaskye zur Königin bringen. Das Gesetz besagtnochimmer,dassjeder,derderMagiemächtigist,fürsiearbeiten muss.«
»Ich weiß«, zische ich. Es gab eine Zeit, da spielte ich mit dem Gedanken,freiwilligzudieserKöniginzugehen,nurumnichtmehrjeden Tag daran erinnert zu werden, dass Nevan mich nicht liebte und fast jeder andere im Dorf mich hasste. Aber niemand konnte mir sagen, wasmichdorterwartethätte.EineverantwortungsvolleAufgabeinLyaskyes Hauptstadt Rubia? Oder ein Sklavendasein an magischen Ketten? »Ich weiß. Und wenn es dir lieber ist, lasse ich mir vom nächsten verstörten Pferd den Schädel eintreten.«
Nevan ist klug genug, darauf nicht mehr als ein unwirsches Brummen zu erwidern, mich arbeiten zu lassen und die Krieger im Blick zu behalten.DassihreStimmenleisergewordensind,habeichbereitsbemerkt, ohne aufzusehen.
»Woher weißt du eigentlich, welche Farben du verwenden musst, um eine bestimmte Wirkung zu erzielen?«, fragt Nevan, als ich beinah fertig bin und die Hufe bloß noch auf Kanten kontrolliere. »Und welche Muster? Das hier ist kein Symbol der Beruhigung, oder? Ich habe es noch nie gesehen.«
Ich richte mich auf und streiche über die Rune. Seltsam, dass Nevan mich danach fragt. Wir reden selten darüber. Ich glaube, dass Jaconn ihm eingetrichtert hat, wie gefährlich meine Fähigkeit ist. Aber ich lasse Nevan normalerweise auch nicht zuschauen, wenn ich sie nutze. »Sie bedeutet Heimat«, flüstere ich. »Schutz, Sicherheit … aber auch Begrenzung. Ich hatte das Gefühl, der Hengst könnte das brauchen. Woher ich das weiß, kann ich nicht sagen. Die Antworten kommen mir oft bei den Abendgesängen. Oder im Moment des Einschlafens oder Aufwachens. Sie kommen einfach zu mir, weil sie wissen, dass ich sie hören kann. Ich weiß nur nie, zu welchen Fragen sie gehören.«
KAPITEL 6
KAYA
ESHRIAN, ÖSTLICH DER FLUSSGABELUNG DES IIRA
In den folgenden Tagen reisen wir durch Wälder, über Feldwege und Hügelketten hinweg. Nevan und ich teilen uns Vaters Wagen, in dem wir meine Esse, Amboss und Werkzeuge sowie seine Heil- und Hilfsmittel transportieren. Wir wechseln uns auf dem Kutschbock ab, der jeweils andere nimmt meine Stute Shami. Am späten Nachmittag schlägt die Kolonne gemeinsam das große Lager auf. Die Krieger steckendenPferdenkleineWeidestückeab,anderebauendieMarschzelte auf oder heben Feuergruben aus, sodass kurz darauf der Duft nach frischem Brot, gegrilltem Fleisch und Gemüse oder Eintöpfen durch unser Lager schwebt.
Ich binde mir gleich nach dem Abspannen unserer treuen beiden MuliseinTuchumdieHaareundfeueredieEssean.Seitdemnervösen Hengst bringt man mir endlich die Pferde, die meine Arbeit nötig haben. Zwischendurch schmiede ich neue Nägel, repariere Werkzeuge oder schärfe das eine oder andere Schwert. Manchmal habe ich so viel zu tun, dass ich mir selbst zu den Abendgesängen keine Pause erlaube und mir erst etwas zu essen hole, wenn es längst dunkel ist und die anderen sich um die knisternden Lagerfeuer versammelt haben.
Nevan und ich sitzen meist abseits in der Nacht und lassen ihr ihr Wesen aus stiller Dunkelheit. Ich bin nach der anstrengenden Arbeit oft zu müde, um noch lange zu reden, aber es ist eine gute, wohltuende und zufriedene Art der Erschöpfung. Ich schlafe wie ein Stein und weiß am Morgen kaum mehr, wie ich in unser kleines Zelt gelangt bin. Oft raufen wir kichernd um den Platz, der viel zu gering für uns beide ist, sodass Nevans Füße unter der Plane hinausragen.
»DubrauchstdasganzeZelt,weilduschläfstwieeinSeestern«,spottet er gern, dabei hat er noch nie einen Seestern gesehen und weiß garantiert nicht, wie die schlafen.
Sosehr ich Kito und auch meine Eltern vermisse, inzwischen ist diese Reise besser, als ich es mir vorgestellt habe. Es gibt so viel zu sehen. So viele Tiere, die ich bislang nur aus Büchern kannte, so viele Pflanzen, deren Dasein ich für unmöglich gehalten hätte. Alles ist dicht verwoben in Eshrian, jeder Baum ein Lebensraum, jedes Gewächs mit anderen gemeinsam in der Erde verwurzelt. Alles reagiert aufeinander –dasWetter,dasLand,dieLebensweisen.Allesbefindetsichineinem Zustand der Symbiose und scheint sogar zu kommunizieren. Eshrian wird dasLandderWurzelnundWäldergenannt,undichbeginnezubegreifen, dass dies nicht nur Worte sind. Ich bilde mir ein, es selbst zu fühlen.
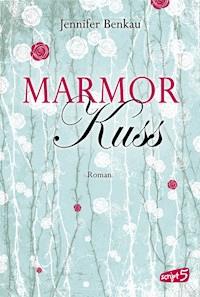











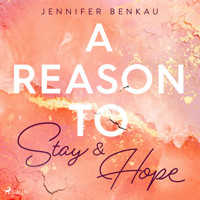
![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)


![Die Seelenpferde von Ventusia. Sturmmädchen [Band 3 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5301e0aef492f4b62003660f83fe52a5/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)











