
The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet (Epische Romantasy von SPIEGEL-Bestsellerautorin Jennifer Benkau) E-Book
Jennifer Benkau
15,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ravensburger Verlag GmbH
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Lost Crown
- Sprache: Deutsch
Welche Farbe hat Verrat? Gegen ihren Willen musste Kaya das Leben ihres Entführers Mirulay mit ihrer Runenmagie retten. Inzwischen schlägt ihr Herz für den Anführer der Rebellen. Doch Mirulay riskiert zu viel im Kampf gegen den grausamen Herzog. Als Kaya auf einem Maskenball die legendäre Krone von Eshrian stehlen soll, gerät sie in größte Gefahr. Während ihr Leben, ihre Liebe und das ganze Reich am seidenen Fäden hängen, erkennt Kaya zu spät, dass es etwas gibt, wovor keine Magie der Welt sie schützen kann: Verrat. Band 2 der epischen Fantasy-Dilogie Jennifer Benkaus Romantasy-Reihen "One True Queen", "Das Reich der Schatten" und "The Lost Crown" spielen in derselben Fantasy-Welt, können aber unabhängig voneinander gelesen werden. Sie sind in dieser Reihenfolge erschienen: One True Queen, Band 1: Von Sternen gekrönt One True Queen, Band 2: Aus Schatten geschmiedet Das Reich der Schatten, Band 1: Her Wish So Dark Das Reich der Schatten, Band 2: His Curse So Wild The Lost Crown, Band 1: Wer die Nacht malt The Lost Crown, Band 2: Wer das Schicksal zeichnet New-Adult-Romance von Jennifer Benkau: A Reason To Stay (Liverpool-Reihe 1) A Reason To Hope (Liverpool-Reihe 2)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 621
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Als Ravensburger E-Book erschienen 2022 Die Print-Ausgabe erscheint im Ravensburger Verlag © 2023 Ravensburger Verlag Copyright © 2023 by Jennifer Benkau Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover. Lektorat: Sarah Heidelberger (www.sarah-heidelberger.de) Covergestaltung und Vorsatzkarte: Carolin Liepins Verwendete Bilder von © AboutLife, © John D Sirlin, © suns07butterfly, © lenaer, © Marylia, © Ensuper, © nereia und © And-One, alle von Shutterstock Alle Rechte dieses E-Books vorbehalten durch Ravensburger Verlag GmbH, Postfach 2460, D-88194 Ravensburg.
ISBN 978-3-473-51152-5
ravensburger.com
GEWIDMET DEN FRAUEN, DIE IM KAMPF UM FREIHEIT UND GERECHTIGKEIT IMMER WIEDER WAHRE GESCHICHTE SCHREIBEN. WOMEN. LIFE. FREEDOM.
KAPITEL 1
KAYA
IN DER RODNAYA
Tiefblau, schwer und melancholisch versinkt der Tag im See.
Ein bisschen noch, ein bisschen mehr, und nichts bleibt von ihm übrig. Dann ist er fort. Untergegangen im tiefen Wasser der Rodnaya.
Ich schüttle den Kopf, um die seltsamen Gedanken loszuwerden, und strecke die Füße aus, bis meine Zehenspitzen ins kalte Nass eintauchen. Prompt rieselt mir ein Schauder die Beine entlang. Dieser Ort macht den Kopf ein wenig wirr. Nur wenigen Menschen ist es möglich, sich in der Rodnaya aufzuhalten, der tief in Magie versteckten Zuflucht der Masqueradner. Die meisten normalen Menschen werden erst wunderlich, dann immer verwirrter, und schließlich vergessen sie, wer sie sind. Mir aber konnte die Wirkung bislang nichts anhaben, was für Mirulay mehr als genug Beweis ist, dass meine Magie zwar anderer Natur ist als die seine, aber eng mit der seines Clans verbunden sein muss.
Sind meine seltsam schwermütigen Gedanken nun der Beweis, dass ich für diesen Ort doch eine Fremde bin? Dass die Rodnaya mich loswerden will?
Oder – und ich muss gestehen, es liegt näher – sind es meine Sorgen, die mir den Kopf schwer machen?
Mit der Hand beschatte ich die Augen und sehe zu Miru, der in ruhigen, gleichmäßigen Zügen auf mich zuschwimmt. Immer wieder kommt sein Gesicht für einen Atemzug hervor, während er durchs Wasser pflügt, sein dunkles Haar glänzt nass in der Sonne. Im nächsten Moment taucht er wieder knapp unter die Oberfläche, und das Letzte, was ich von ihm sehe, sind ein paar glitzernde Lichtreflexe auf seinem muskulösen Rücken, bevor er in die Tiefe taucht.
Das Schwimmen war Nevans Rat. Die Bewegung im Wasser soll Mirus Muskeln trainieren, ohne sein Bein zu überlasten, weil es nach seiner schweren Verletzung noch geschwächt ist. Eine Verletzung, die er nicht hätte überleben dürfen, was er mit meiner Hilfe aber doch getan hat. Ich allerdings hätte ihm nie helfen können, wäre Nevan nicht gewesen.
Ach, Nevan. Ich bin seit zwei Wochen hier und habe ebenso lange nichts von ihm gehört. Alles, was ich weiß, ist, dass mein bester Freund seit Kindertagen mich all die Jahre lang belogen hat. Er ist nie mein Freund gewesen. Im besten Fall war er mein Leibwächter. Im schlechtesten hat er mich bewacht und ausspioniert, um mich irgendwann an Herzog Azjan auszuliefern.
Herzog! Ich unterdrücke den Impuls, bei dem Wort verächtlich auszuspucken. Azjan hat den Titel gestohlen, nachdem er erst den wahren Herzog und danach Mirulays Eltern bestialisch hat abschlachten lassen. Sie sollten nicht seine letzten Opfer bleiben. Doch Azjan tötet nicht allein durch das Schwert und längst nicht ausschließlich jene, die ihm seine Macht streitig machen könnten. In ganz Eshrian hungert das Volk, weil seine exorbitanten Steuern den Menschen nicht genug zum Leben lassen.
Er ist kein Herzog, er ist ein Tyrann.
Wie konnte Nevan das nicht erkennen?
In jedem Fall sollte ich froh sein, dass er weg ist, wieder bei Azjans Schergen, wo er hingehört, und mich nicht länger täuschen kann.
Leider bin ich es nicht – froh.
Stattdessen fehlt er mir mehr, als ich in Worte fassen kann. Und ich will keineswegs bloß, dass er meine Fragen nach dem Warum beantwortet.
Ich will mehr. Will wieder mit ihm scherzen, lachen, arbeiten und mit ihm die Abendlieder singen. Und reden. Vor allem reden. Ich will, dass es wieder wie früher wird. Dass ich ihm vertrauen kann und er mir.
Doch vermutlich würde er alles, was ich ihm anvertraue, Azjan weitererzählen, und das wäre weitaus schlimmer als mein verletzter Stolz oder mein gebrochenes Herz. Es würde Eshrian gefährden und die letzte Möglichkeit, die das Land noch hat, sich von Azjans Joch zu befreien. Denn womöglich bin ich die Einzige, die noch zwischen Azjan und seiner völligen Macht über Eshrian steht.
Das zumindest denkt Mirulay, der nicht nur herausgefunden hat, dass ich die Tochter des letzten rechtmäßigen Herzoges und damit die Princessa Eshrians bin, sondern darüber hinaus die Erbin der Krone, die Eshrian seit Hunderten von Jahren niemandem mehr aufs Haupt gesetzt hat.
Die Erbin der Krone … womit nichts anderes als eine Königin gemeint ist.
Innerlich lache ich über den Gedanken. Ich – Kaya, eine Schmiedin aus Bellaney – kann wohl kaum eine Königin sein.
Aber Mirulay glaubt aus tiefstem Herzen daran, und für mich sind seine Gedanken pure Hoffnung. Denn sollte es wahr sein, können wir dieses wundervolle Land, das mir in so kurzer Zeit so viel gegeben hat, zum Besseren verändern.
Sirrend fliegen zwei Libellen über den See hinweg, haschen sich in wildem Zickzack. Ihre Spiegelungen malen schillernd grüne Zeichen ins Blau der Wasseroberfläche, wie Runen, die für Hoffnung stehen. Der Duft von Sumpfkresse und Wasserminze liegt in der Luft.
Mirulay taucht ganz in meiner Nähe auf und krault das letzte Stück zum Ufer, wo ich auf den warmen Felsen sitze. Direkt vor mir verschränkt er die Arme auf den Steinen und legt das Kinn auf seinen Handrücken.
»Nevan?«, fragt er mich leise. »Ist er das, der deine Gedanken verdunkelt?«
Miru hat mich erstaunlich gut kennengelernt in der kurzen Zeit. Vielleicht bin ich aber auch nur durchschaubar geworden. Ich komme mir vor wie aus Glas. Und das ist in Ordnung so. Soll er ruhig alles von mir sehen. Er würde nichts davon gegen mich verwenden.
Und worüber sollte ich auch sonst grübeln, wenn nicht über Nevan? Erst gestern erreichte mich eine Nachricht von meinem Bruder. Kito geht es gut. Wenn ich seinen Worten Glauben schenken kann, erlebt er nur ein großes, aufregendes Abenteuer. Es hat ihn immer in die Ferne gezogen. In unserer kleinen Hütte in unserem Dorf in Bellaney träumte mein Bruder von Städten, Schlössern und Burgen.
Ich seufze leise. »Er verdunkelt meine Gedanken? Das kannst du sehen?«
Miru nickt ganz ernst. »Mit etwas Abstand sieht man ein kleines Gewitterwölkchen, das sich über deinem Kopf zusammengebraut hat.«
»Wirklich, ja?«
»Du solltest dein Kleid ausziehen und reinkommen. Das Wasser wäscht so was fort.«
Sein Lächeln ist verführerisch. Aber kein Lächeln der Welt bekommt mich in derart kaltes Wasser. »Nicht nach tausend heißen Wüstenstürmen. Ich würde in eine Starre fallen wie ein Sandrochen im Winter. Und dann würde ich zum Grund sinken und … blubb, blubb.«
Miru schnippt mit dem Finger ein paar Tropfen Wasser in meine Richtung. »Wenn du untergehst, rette ich dich. Das würde ich immer tun. Versprochen.«
»Vorsicht mit deinen Worten, Sarev von Eshrian«, murmle ich, während er sich aus dem Wasser hochstemmt, mir näher kommt und mich, nass, wie er ist, langsam zurückdrängt. »Du hast keine Ahnung, was du da versprichst.«
Miru umfasst meinen Nacken und drückt mich auf den Rücken; sanft und langsam, damit ich mich an den Steinen nicht stoße. Er lehnt sich über mich. Wasser rinnt ihm aus den Haaren, zieht glänzende Linien über seine Schultern und tropft dann auf mich herab. Eine Gänsehaut überzieht meinen gesamten Körper, die nur wenig mit dem kalten Nass auf meiner sonnenwarmen Haut zu tun hat. Mehr mit seinen Lippen, die meinen näher und näher kommen. »Ach, nein? Und was, wenn ich dir alles versprechen würde?«
Ich kann nur noch flüstern. »Du weißt nicht, was die Sandrochen von Amisa vermögen. Im Vergleich verursachen eure Gierschluchten nichts weiter als Schlaglöcher in der Straße.«
»Schon in Ordnung, Kaya. Wenn du auf den Grund sinkst – was soll ich dann noch an der Oberfläche? Dann leben wir halt auf dem Grund.«
Seine Lippen treffen auf meine. Sein Kuss ist vom Wasser noch kühl wie der See im Schatten der Felswand und ebenso tief. Ich fühle mich geborgen in seinen Armen und der Sicherheit der Rodnaya und belebt von der uralten Magie, die er und dieser Ort in sich tragen. Und in der ich zu Hause bin.
Mit jeder Faser meines Seins kann ich es spüren: Auch wenn Kummer auf unseren Herzen lastet und Gefahren unsere Zukunft trüben, auch wenn die dunklen Wolken, von denen Mirulay gesprochen hat, real sind – die Sonne, die durch das Finstere hindurchbricht, ist es ebenso. Ihre Strahlen fangen sich in den glitzernden Tropfen, die über seinen Körper rinnen, herabfallen und auf meiner warmen Haut zu Vergänglichkeit zerspringen. Wir sind jetzt und hier, und Licht und samtige Wärme umfließen uns beide.
Heute sind wir perfekt, so wie wir sind. Zusammen. Glücklich. Und unendlich verliebt.
KAPITEL 2
AN EINEM UNBEKANNTEN ORT
Es tropft Blut vom Gemäuer.
Plitsch. Plitsch. Plitsch.
»Und dir fällt immer noch nichts ein?«
Vielleicht ist es Kondenswasser. Kein Blut. Sein Mund ist wund, seine Lippen sind aufgesprungen vor Durst. Könnte er doch an das gelangen, was da tropft. Egal, was es ist.
In der gemauerten Zelle steht die Luft vergessen und schwer wie ein altersschwacher Soldat. Womöglich scheint die Feuchtigkeit im Licht der schwachen Funzel nur rot.
Plitsch. Plitsch.
Nein, es ist zu dick für Wasser. Zu zäh.
Blut. Oder Schweiß. Sein eigener. Vor Angst.
Fremdartige Formen blitzen vor seinen geschlossenen Lidern auf.
»Rede endlich, verdammter Pisser!«
Selbst wenn er wollte, bliebe keine Zeit, um auch nur ein Wort zu antworten. Der Griff der kurzen Stichwaffe trifft auf seinen Kiefer, und Schmerz explodiert in seinem Kopf. Schon wieder. Immer noch.
Er taumelt zurück. Kann das Gleichgewicht nicht halten, weil man ihm die Hände hinter dem Rücken gefesselt hat. Er stößt gegen das Mauerwerk und rutscht daran zu Boden. Wie viele Tage hat er versucht, aufrecht zu bleiben? Er kann sie nicht mehr zählen.
Die Zeichen erscheinen, sobald er die Augen schließt. Sie leuchten in grellen Farben, als wollten sie ihm etwas zeigen. Doch er hat ihre Bedeutung vergessen. Sie vielleicht auch nie gekannt.
Blut tropft vor seinen Knien auf den Boden und rinnt in die Ritzen zwischen den Steinen.
Blut. Sicher, diesmal.
Es gibt eine Möglichkeit, der Folter zu entkommen. Sie haben ihm das gelassen, was einem Zauber noch am nächsten kommt. Das kleine, unauffällige Schmuckstück, das sie für nichts weiter halten als ein Symbol seiner Gilde. Doch es ist mehr. Es ist sein Weg aus dieser Zelle. Ein gefährlicher Weg, der ihn in den Tod führen könnte. Oder in die Freiheit. Wenn er es nur endlich wagt, ihn zu gehen.
»Gemach, mein Freund«, sagt der zweite Mann und klopft dem, der die Waffe trägt, auf die Schulter. »Wenn du ihm den Schädel zertrümmerst, wird er uns gar nichts mehr verraten.«
»Ich rate dir, dass du deinen Kopf beisammenhältst«, knurrt der erste und spuckt vor ihm auf den Boden. »Wenn ich wiederkomme, will ich dich singen hören, Vögelchen.«
Singen. Was gibt es noch zu singen?
Seine Erinnerungen verschwimmen wie Bilder, die sich wandeln, auflösen und zu etwas Neuem werden, während er sie noch ansieht. Ein Blumenmeer in einem Moment – ein tosender Ozean nur kurz darauf. Und überall die Zeichen.
Wer hat diese Bilder gemalt?
Wann hat er sie gesehen?
Er verbietet sich die Erinnerungen, weil sie dicht an dicht mit dem wandeln, was die Männer von ihm wissen wollen.
Wann kommt der unweigerliche Moment, in dem er vergisst, warum er nicht aussprechen darf, was sie hören wollen?
Er wischt sich den Mund an der Schulter ab, zieht die Knie an den Körper und legt die Stirn darauf. Seitdem man ihn gefesselt hat, ist das die einzige Position, in der er etwas Schlaf findet. Er kann in den unmöglichsten Haltungen ausruhen. Das hat er schon als Kind gelernt.
Wenn nicht die Träume wären, die sich anschleichen, kaum dass sein Kopf schwer wird.
Es ist Blut, das vom Gemäuer tropft. Doch noch ist es nur sein Blut, und dies reicht ihm als Trost.
Plitsch. Plitsch.
KAPITEL 3
KAYA
IN DER RODNAYA
Das Licht eines jungen Morgens spielt im Raum, und wir planen einen Krieg.
Es ist surreal. Verwirrend klar und unabdingbar. Aber nicht richtig.
Ein paar Sonnenstrahlen funkeln über Geschirr und Gläser auf dem Tisch hinweg, fangen sich im tintenschwarzen Kaffee in den Tassen oder in den polierten Bilderrahmen an den Wänden. Das Licht spielt, während die Zeit doch stillstehen müsste und wir uns schweigend anstarren.
»Nein.« Es ist Mirulay, der die Stille bricht. »Völlig ausgeschlossen.«
Cisca, die stolze Kommandantin all seiner Kämpfenden, sinkt auf ihrem Stuhl in sich zusammen. »Du nimmst uns damit unsere einzige Chance. Ich hatte befürchtet, dass das nicht gut geht.«
Mit das meint sie uns. Miru und mich. Unsere Liebe. Und es schmerzt mich, dass ich sie verstehe, ihr sogar beinah recht geben muss. Denn Miru lehnt den Vorschlag, den ich soeben gemacht habe, nur aus einem einzigen Grund ab.
Er hat Angst um mich. Angst, dass mir etwas zustößt.
»Es ist so falsch.« Ich stehe auf und trete ans Fenster. Voller Hoffnung und Licht breitet sich der neue Tag draußen aus. Die Rodnaya liegt mit ihren goldenen Getreidefeldern und sattgrünen Wiesenhügeln vor uns wie die Illusion einer besseren Welt. Ein Gemälde in der warmen Stube, wenn draußen ein Schneesturm tobt. Denn außerhalb ihrer magischen Grenzen tobt das Land Eshrian vor Schmerzen, weil Azjan es gewaltsam zu beherrschen versucht. Seine Städte, seine Menschen, aber auch seine Natur. »Es ist so falsch, in eine Schlacht zu ziehen, wenn man den Krieg doch verhindern will.« Ich rede mehr zu mir selbst als zu Mirulay und Cisca. »Wie kann Kampf je zu Frieden führen? Das ist, als risse man Wunden auf, um jemanden gesund zu machen. Völlig absurd. Aber wenn wir es nicht tun, wird Azjan eine Welle der Gewalt auslösen, die niemand mehr stoppen kann.«
Eshrian wehrt sich mit Erdbeben, Stürmen und Überschwemmungen gegen den Versuch, von Azjan unterjocht zu werden. Das Land ist uralt. Eine stille, wortlose Königin, der die Sterblichkeit nichts anhaben kann. Die notfalls jeden Menschen, jedes Tier und jede Pflanze zerstören wird, um dann geduldig abzuwarten, bis neues Leben Asche, Erde und Stein bewohnt. Ab und zu kommt mir der Gedanke, ob sie nicht recht hat. Ob wir Menschen es nicht verdient haben, für unsere Fehler und unsere Gier bestraft zu werden. Aber spätestens dann denke ich an meinen kleinen Bruder und an die anderen Kinder Eshrians. Sie haben es verdient, zu leben. Sie haben ihre Heimat verdient. Und sie haben sich nach den Jahren unter Azjans Herkunft endlich Sicherheit verdient.
Ich balle beide Fäuste. »Wir haben keine andere Wahl, ist es nicht so?«
»Nein, haben wir nicht.« Cisca stützt den Kopf in die Hände und vergräbt die Finger in ihrem blonden Haar.
Mirulay blickt mich schweigend an. Unbeweglich wie ein Felsen. Mehr Zustimmung werde ich von ihm nicht bekommen.
»Wenn wir es also tun müssen«, fahre ich fort, »wenn sowohl das Nichtstun als auch das Scheitern absolut keine Optionen sind … stehen wir dann nicht in der Pflicht, den besten Plan umzusetzen, den wir haben?«
An Mirulays Kiefer zuckt ein Muskel, weil er die Zähne so fest aufeinanderbeißt. Ich habe einen frei liegenden Nerv getroffen, und das tut mir leid. Ich weiß, wie zwingend er die Verantwortung für dieses Land und seine Menschen fühlt. Es ist nicht fair, den Druck, den er sich selbst macht, gegen ihn einzusetzen. Aber wenn ich wirklich die bin, für die er mich hält – die Erbin der seit Jahrhunderten verlorenen Krone aus Runen und Magie –, dann wiegt meine Verantwortung ebenso schwer wie seine.
»Cisca hat ganz recht«, sage ich, während besagte Cisca aussieht, als wäre sie gerade lieber am anderen Ende des Landes, ganz egal, wie viele Stürme dort toben. »Unsere Gefühle dürfen nicht dazu führen, dass wir unsere stärksten Waffen nicht einsetzen. Niemand von uns will einen Krieg, ich am wenigsten. Aber gerade darum sollten wir alles tun, um ihn sehr schnell zu entscheiden.«
Mirus graue Augen werden schmal, während er mich fixiert. »Du bist aber keine Waffe, die wir benutzen können, Kaya.« Sein Tonfall klingt so kalt und entschlossen, dass es mir eisig über die Schultern rieselt. Dabei will er mich nur beschützen. Vor dem, was ich bin, kann mich allerdings niemand beschützen.
»Ich bin der beste Plan, den wir haben.«
Mirulay mag als Clanmagier der Masqueradner eine sehr viel mächtigere Magie besitzen als ich. Er kann das Antlitz von Menschen, Tieren und Dingen beinah beliebig verändern und ihnen eine neue Erscheinung geben. Seine Magie vermag es, ein eingeschüchtertes Mädchen in den Augen seiner Feinde wie einen gewaltigen Raubvogel wirken zu lassen, der ihnen das Gedärm aus den Bäuchen reißen kann. Oder ein ganzes Gehöft samt Ländereien, Wald und einem See hinter den herabhängenden Zweigen einer Trauerweide zu verbergen, wo es unsichtbar für andere wird. Doch Azjan ist ebenfalls vom Clan der Masqueradner. Er wirkt dieselbe Magie und durchschaut Mirus dadurch mit Leichtigkeit.
Meine Magie ist kaum mehr als eine Begabung für Farben und Formen. Mit der Wahl der passenden Farbe und der richtigen Rune kann ich einem Menschen Kraft verleihen oder rauben, ein Pferd beruhigen oder ängstigen oder eine Wunde dazu bringen, etwas schneller zu heilen. Oder nie. Meine Macht ist begrenzt. Aber sie hat einen enormen Vorteil, und ich werde alles dafür tun, dass wir ihn ausspielen: Azjan kennt meine Magie nicht. Er kann sie weder durchschauen noch mit seiner eigenen auflösen.
»Du willst mit mir in dieses Schloss gehen.« Mirus Stimme ist ruhig. Beherrscht. Als tiefdunkelblau würde ich sie beschreiben, müsste ich eine Farbe wählen. Ohne das Spiel aufgewühlter Wellen darin. Ein stilles, tiefes Meer, in dessen Innerem jederzeit eisige Kälte freibrechen kann.
Langsam erhebt er sich und tritt auf mich zu, Schritt für Schritt, bis er direkt vor mir steht. »In das Schloss, in dem er meine Eltern getötet hat.« Er geht einfach weiter, drängt mich zurück. Ich kann nicht ausweichen und muss rückwärtsgehen. »Wo ich war, während er meine Verlobte tötete und sie dabei in meine Augen sehen ließ.«
Die Erinnerung reißt mich in eine dunkle Tiefe. Es tut mir so unsagbar leid, was ihm und Anait angetan wurde. Aber er will mein Mitgefühl nicht, es prallt einfach an ihm ab und flattert vor seiner Brust herum wie ein hilfloser Vogel, der sein Nest nicht erreichen kann.
Ich stoße mit dem Rücken gegen die Wand zwischen den Fenstern. Die Hilflosigkeit ist das Schlimmste. Wenn ich könnte, würde ich sie aus mir herausreißen.
»Mirulay«, sagt Cisca. »Es wird im Aquamarinschloss entschieden.« Ihre Stimme ist so kontrolliert wie ihr Körper, wenn sie in den Kampf zieht. Sie kann das gut: sämtliche Emotionen für einen Moment wegsperren. Dann ist sie niemandem eine Freundin und hat auch selbst keine Freunde mehr. Es spricht ausschließlich die Soldatin aus ihr. Mirulays Kommandantin. »Es muss dort enden.«
»In dem Schloss, in dem Azjan mich vernichten will.« Miru klingt, als wäre sein Onkel seinem Ziel schon nahe.
»Darum werde ich mitkommen«, flüstere ich. »Um genau das zu verhindern.«
Miru stößt sich dicht neben meinem Gesicht am Mauerwerk ab, als wollte er es mit seinem Handballen zum Einsturz bringen. Mit zwei Schritten ist er am Tisch. Was er aufgebracht durch die Zähne knurrt, verstehe ich nicht, weil im selben Moment Gläser und eine Kanne durch den Raum fliegen und an der Wand zerschellen.
Ich wünschte, ich wäre mutig genug, um nicht zu erschrecken bis ins Mark. Aber all mein Mut und meine Zuversicht sind bloß Maskerade. Und ein klein wenig von Mirus verzweifeltem Zorn reicht schon aus, um ihn das durchschauen zu lassen. Da ist ein feines Lächeln in seinen Augenwinkeln, während er mich nun quer durch den Raum mustert. Meine gesamte Zuversicht rutscht mir wie ein loser Umhang über die Schultern und fällt zu Boden.
Mirulay nickt wissend. »Sag mir, dass du keine Angst hast, Kaya.«
Unwillkürlich balle ich die Fäuste. »Ich lüge dich nicht an! Ich habe Angst. Ich habe nie etwas anderes behauptet.«
Ich wünschte, Cisca würde mich unterstützen. Aber sie trinkt nur einen Schluck aus ihrer Tasse und starrt dabei auf die Tischplatte, wo sich eine Lache aus blutrotem Saft verteilt. Cisca stimmt mir zu. Das hat sie vorhin klar geäußert. Doch der Entschluss ihres Capitans wiegt für sie schwerer als ihre Überzeugung. Diesen Teil an ihr – sie nennt ihn Vertrauen, ich Gehorsam – werde ich nie verstehen.
»Du bist meine Schwachstelle«, sagt Mirulay. »Daher kannst du nicht mitkommen.«
»Dein Herz ist deine Schwachstelle.«
Widerwillig muss er lächeln. »Ja. Das stimmt.«
»Und doch nimmst du es mit. Weil es Schwachstelle und Stärke ist. Beides zugleich.«
Er schluckt, und im selben Moment weiß ich, dass ich gewonnen habe, auch wenn ich mit dem Rücken zur Wand stehe und vor Angst zittere. »Kaya …«
»Und darüber hinaus brauchst du dein Herz. Genauso ist es auch mit mir. Ich bin deine Schwachstelle und deine Stärke. Und du wirst mich dort brauchen, Mirulay Jachan, Sarev von Eshrian. So wie ich dich brauchen werde.«
»Du? Mich?«
»Ja.« Etwas in mir, dieser tief vertraute Teil von mir, der alles Bedrohliche gern in Humor verpackt, möchte ihn schelmisch angrinsen. Aber ich verkneife es mir. Es ist ernst. »Ich werde dich brauchen, denn während du auf dem Maskenball mit Azjans Hofdamen tanzt, um deinen Mut unter Beweis zu stellen und neue Verbündete unter seinen hochedlen Gästen zu gewinnen, wirst du noch etwas anderes tun.«
»Und das wäre?«
»Du wirst ihn ablenken. Weil ich zu dieser Zeit den Turm aufsuchen werde, wo sich das Wasserbecken befindet, in dem die Krone Eshrians versteckt ist.«
»Kaya!« Er starrt mich an, als hätte ich ihm soeben aus dem Nichts den Krieg erklärt. »Hast du den Verstand verloren?«
Ach,Miru … Da sind so viele Gefühle zwischen uns. Meine erreichen deine und kehren tausendfach zu mir zurück. So viel Glück und Zuneigung. Doch ausgerechnet jene deiner Gefühle, die dadurch entstehen, dass du mich auch so lieb hast, die hasse ich. Deine Sorge um mich. Dein Bedürfnis, mich zu beschützen. Gleichzeitig verstehe ich all das so gut, denn es geht mir ganz ähnlich.
Doch wenn wir dieses Land retten wollen, und mit ihm die Welt, in der wir leben, dann werden wir der Gefahr beide entgegentreten müssen. Selbst in den entscheidenden Kampf zu gehen, ist nicht schwer. Jedenfalls nicht halb so schwer wie zuzulassen, dass ein geliebter Mensch ebenfalls seinem Gegner entgegentritt. Kein Abgrund fühlt sich so schrecklich an wie der, an dem jemand steht, den man liebt.
»Keineswegs«, sage ich. »Es ist meine Krone, die ich verloren habe. Ich werde sie mir auf diesem Ball zurückholen! Und du wirst mich nicht davon abhalten. Denn du musst mir helfen.«
KAPITEL 4
KAYA
Die Zeit ist ein seltsames Konstrukt.
Sie kann sich ewig anfühlen. Widerhaken ausfahren, an denen sich die Nerven aufreiben. Sie kann uns aber auch durch die Finger rinnen wie Wasser. Davonjagen, sodass man ihr nur hilflos hinterherstarren kann. Man hat ständig zu viel oder zu wenig Zeit.
Und dann gibt es diese Tage, an denen beides passiert. Die Zeit rast und zieht sich gleichermaßen in die Länge. Man kann kaum abwarten, dass sie vergeht, und gleichzeitig passiert alles viel zu schnell.
Die Wochen vor dem Maskenball verlaufen so.
Außerhalb unserer kleinen Blase in der Rodnaya leiden die Menschen unter der sich aufbäumenden Gewalt des Landes. An einem Ort bebt die Erde, Risse und Krater reißen Häuser und Straßen in die Tiefe. An einem anderen springt ein Fluss über seine Ufer, überschwemmt Täler, nur um im weiteren Verlauf auszutrocknen, sodass die Fische im Staub ersticken.
Und mittendrin in all dem Chaos sind wir, versteckt in einem magisch geschützten Tal, in dem die Sonne über goldenen Feldern aufgeht und beim Untergehen das Fell der weidenden Pferde rötlich schimmern lässt. Wo der Wind Blüten aus den Baumkronen schneien lässt und Fluss und See so klares Wasser führen, dass man sogar die Krebse am Grund beobachten kann.
Ich schäme mich angesichts der Friedlichkeit. Es ist, als wären Mirulay und ich mit ein paar wenigen Vertrauten zusammen die einzigen Menschen, die in einer sicheren Oase leben, während alle anderen in einer grausamen Wüste überleben müssen.
Kito ist dort draußen, und die Sorgen um ihn rauben mir in manchen Augenblicken den Verstand. Am liebsten würde ich wie ein Derwisch nach Zamouka reiten, um ihn zu retten und ihn endlich wieder bei mir zu haben.
Aber ich muss vernünftig sein. Cisca hat es mir mit der Geduld einer Kaktusfeige erklärt: Wir haben nur einen Versuch, Kito zu retten. Wenn Azjans Leute mitbekommen, dass Kito irgendeine Bedeutung für Mirulay hat, ist unsere Chance verwirkt. Wir müssen ihn holen, wenn Azjans ganze Aufmerksamkeit sich auf einen anderen Ort fokussiert und er nicht mitbekommt, wie wir still und leise wie die Nachtkatzen an seinen Hof kommen und den Jungen holen.
Ebenso still und leise verspreche ich dem falschen Herzog von Eshrian die böseste Überraschung seines Lebens. Bald.
»Kaya?« Mirus Stimme dringt samtig durch die Dunkelheit. Ihr folgt seine Hand, die mir über die Wange streicht, und mein Herz fragt sich derweil, wie es sich in diesem Moment so leicht anfühlen kann, wenn es doch mit so vielen Sorgen belastet ist.
»Warum bist du denn schon wieder wach?«, frage ich leise. Es sind noch drei oder vier Stunden, bis die Sonne aufgeht, und wenigstens einer von uns sollte morgen früh ausgeschlafen sein. Dann beginnt unsere Reise nach Zamouka und mit ihr das, was ich einen Plan nenne und Mirulay blanken Wahnsinn. Aber er geht mit mir in diesen Wahnsinn, und gemeinsam werden wir es schaffen.
»Das Rauschen hat mich geweckt.«
»Das Rauschen?« Ich höre kein Rauschen. Nur ganz leise das Zirpen einer Grille draußen vor dem Fenster.
»Ja. Da dringt dieses Rauschen aus dem großen schwarzen Loch heraus, das du in die Luft gestarrt hast.«
Glucksend stupse ich ihn an. »Das ist allenfalls ganz klein, dieses Loch.«
»Und was hast du damit vor?«
»Mit dem Loch?«
»Ja. Du gibst dir doch nicht umsonst so viel Mühe, ein Loch in die Luft zu starren.«
Seine Ernsthaftigkeit rührt mich. Jeder andere würde fragen, was mir Kummer macht. Miru aber weiß es selbst, und er kennt mich gut genug, um zu erkennen, dass es mit Ablenkung oder einem Denk-nicht-drüber-nach bei mir nicht getan ist.
»Mal überlegen. Ich könnte es in das Wasserbecken im Turm werfen. Dann fließt alles Wasser ab, und ich hole mir die Krone von Eshrian heraus, ohne nasse Füße zu bekommen.«
Mirulay lacht leise. »Ich liebe dich«, sagt er dann, und mir bleibt kurz das Herz stehen, nur um dann umso lauter weiterzuschlagen.
Bevor ich etwas erwidern kann, fährt er schon fort: »Ich liebe dich für dieses überschwängliche Maß an Hoffnung, das du so freigebig an alle verteilst. Wir hatten so lange keine Hoffnung mehr. Und dann kamst du, und plötzlich baden wir darin.«
Seine Worte berühren etwas in mir. Es ist, als entzündeten sie einen winzigen Funken in meiner Brust. Eine Art … Inspiration. Als wäre ich einem Bild, das ich malen möchte, plötzlich ganz nah. Als erschiene es fast schon sichtbar vor meinen Augen.
Doch ich will gar kein Bild malen. Und die Rune, die ich am frühen Morgen zeichnen werde, ist mir schon seit Langem bekannt. Mit ihr steht und fällt unser gesamter Plan. Der Zauber, der gerade in mir auffunkt, flämmchenweise zu einem Feuer anwächst und dann zu einem glühenden Inferno wird, hat nichts mit der magischen Rune zu tun und gleichzeitig alles.
»Kaya? Ist alles in Ordnung? Ich höre dein Herz schlagen, so laut ist es.«
»Alles … bestens.« Ich wispere nur. Bin mir selbst nicht sicher. »Ich glaube, ich weiß es jetzt.«
»Was meinst du?«
»Ich weiß jetzt, mit welcher Farbe ich dir die Rune zeichnen werde.« Die Rune, die vielleicht die wichtigste und mächtigste ist, die ich je gemalt habe. Die Rune, die den Clan der Masqueradner zur Verzweiflung bringen könnte und gleichzeitig von ihm inspiriert ist.
Die Rune der maskierten Magie.
Sie wird Mirulays Clanmagie der Masqueradner maskieren. Welche Illusion Miru auch erzeugen wird, wie auch immer er sein Antlitz oder das unserer Freunde verändern wird – niemand hat eine Möglichkeit, seinen Zauber als solchen zu erkennen. Nicht einmal Azjan, der vom selben Clan ist.
Da Azjan nicht die geringste Vorstellung davon hat, dass mein Zauber existiert, wird er keinen Verdacht hegen. Wir werden ihm ein Theater bieten, das er erst vergessen wird, wenn er seine Augen endgültig zum letzten Mal schließt.
Schade eigentlich, dass wir schon fort sein werden, wenn er merkt, dass wir ihn getäuscht haben.
Mirulay setzt sich auf. Licht flammt auf, und Schwefelgeruch zieht an mir vorbei, als er eine Kerze entzündet. Ihre sanfte Helligkeit malt Umrisse um seine Silhouette. Er lehnt sich zu mir hinunter. »Mit welcher?«
»Mit welcher was?« Während ich so in seine grauen Augen blicke, die so steinern und unnachgiebig scheinen können und nun so liebevoll, vergesse ich beinah, worüber wir gerade gesprochen haben. Die Vorstellung, ihn an mich zu ziehen, seinen Mund auf meinem und seine Hände auf meiner Haut, ist so süß. Wir könnten alle Sorgen und Gefahren vergessen. Selbst die Verantwortung, die wir tragen. Wenigstens ein paar Minuten lang. Nur bis die Kerze ein messerrückendickes Stück herabgebrannt ist …
Aber das muss warten. »Du meinst, mit welcher Farbe? Nun, du wirst überrascht sein. Um ehrlich zu sein, du wirst dir Sorgen machen. Daher verrate ich es dir besser nicht.«
Wieder lacht Miru. »Weil ich den Rest der Nacht sicher gut schlafen werde, jetzt, wo ich weiß, dass du mir morgen eine Farbe unter die Haut stichst, über die du nur verrätst, dass sie mir Sorgen machen wird.«
»Vertraust du mir etwa nicht?« Ich ziehe einen Schmollmund.
»Doch, natürlich. Selbst wenn deine Farbe aus Beeren vom Strauch des Schwarzen Todes besteht oder aus pulverisiertem Blutrotem Skorpion … nicht einmal dann werde ich zurückzucken. Weil du weißt, was du tust.«
»Danke«, flüstere ich und bin dann lange, lange still, bis ich doch noch etwas sage. »Miru? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was ich tue.«
»Dann ist es der Schwarze Tod?« Wird er ein wenig blass, oder bilde ich mir das im Kerzenlicht nur ein?
»Kein Giftgewächs, nein.«
»Uff. Gut zu hören.«
»Nein, nicht gut. Gar nicht gut. Ich fürchte, es ist schlimmer. Und ich weiß nicht, ob es funktioniert.«
»Das werden wir sehen. Aber jetzt bin ich wirklich neugierig. Was ist das für eine Farbe?«
»Ich habe nie zuvor mit ihr gemalt. Jeder andere würde sagen, dass es keine Farbe ist. Dass Malen damit nicht möglich ist. Aber ich glaube, es ist doch möglich.« Ich atme tief durch und hoffe, dass er mich versteht. »Ich werde diese Rune mit Hoffnung malen, Mirulay.«
KAPITEL 5
KAYA
Die Gefahren der letzten Jahre haben ihre Spuren auf Mirulays Körper hinterlassen. Vor ein paar Wochen sagte er einmal im Scherz, ihn würden nur noch seine Narben zusammenhalten. Er fragte mich, ob mich das nicht erschrecke. Ich hatte keine Antwort darauf.
Nun da ich auf der Suche nach der perfekten Stelle für meine Rune den Blick von seinem Bauch über den schlanken Oberkörper bis hin zu seiner Kehle wandern lasse, fällt sie mir endlich ein. Es erschreckt mich nicht, was er bisher durchgemacht hat. Es bestätigt mich in dem, was wir tun.
»So viele Menschen«, murmle ich, »die unter der aktuellen Situation leiden. Sie alle haben diese Narben, diese Hämatome, diese gebrochenen Knochen. Und Herzen.« Ich streiche über eine Stelle, die die Vergangenheit besonders übel zugerichtet hat. »Wir ändern das. Es ist unsere Aufgabe.«
»Ist es das?« Eine kleine Herausforderung liegt in seiner Stimme, während er die Augen schließt. Und ich weiß, was er meint. Dass es seine Aufgabe ist, steht nicht zur Diskussion. Er ist der Sohn des letzten regulären Sarevs. Es ist sein Erbe, das Land zu beschützen.
Doch ich bin, wessen Nachfahrin ich auch sein mag, in der Ferne aufgewachsen. In der Fremde – aus Sicht der Eshrianer.
Fremd aber bin ich nicht. War es vielleicht nie.
Ich erinnere mich an das vertraute Gefühl und mein erleichtertes Durchatmen, als ich zum ersten Mal einen Fuß auf den Boden dieses Landes setzte.
»Ja, das ist es. Wer wären wir denn, wenn wir nicht täten, was wir können, um die Welt besser zu machen?«
Mirulay lächelt, aber es wirkt bekümmert, als erinnerten ihn meine Worte an die einer anderen Person. Einer, die er verloren hat, vermute ich. Vielleicht Anait, seine Mutter oder sein Vater. Azjan hat sie alle getötet. »Der Preis kann hoch sein, Kaya.«
Ja. Das kann er. Zu widersprechen würde bedeuten zu lügen. »Hier.« Ich lege meine Hand auf seinen Bauch, auf die Stelle zwischen Nabel, Leiste und seiner linken Flanke. »Hier muss die Rune hin.«
Miru atmet einen Hauch tiefer ein, als ich zu der winzigen Klinge greife. Sie ist leicht gebogen, schmal und scharf und erinnert an die Kralle eines Perryn.
»Musst du auch gerade daran denken, welche Erscheinung ich dir gegeben habe, als wir aus Ser Brockens Anwesen geflohen sind?«
Ich nicke. Ich sah aus wie eine albtraumhafte Chimäre aus Frau und riesigem Raubvogel. Ich besaß Flügel mit einer gewaltigen Spannweite, und sie wirkten so echt, dass ich bis heute manchmal träume, mich mit ihnen in die Lüfte zu schwingen und mich vom Wind über Eshrian hinwegtragen zu lassen. Kein einziges Mal kehre ich im Traum nach Amisa zurück, dabei denke ich am Tag sehr oft an das Land, in dem ich groß geworden bin. An mein Dorf und die Lieder, die wir Abend für Abend dem Tag singen. An … meine Eltern.
Mit einem kleinen Kopfschütteln verbiete ich mir die Schwermut und konzentriere mich auf Miru. »Bist du bereit?«
Sag doch Nein. Sag einfach Nein.
Er sagt kein Wort, nur sein Blick macht deutlich, dass ich beginnen soll.
Ich habe ihm bereits eine Rune unter die Haut gestochen. Seit einigen Wochen trägt er jene, die für Schmerz steht, an der Innenseite seines vernarbten Oberschenkels. Sie hat das Gegenteil ihrer Bedeutung bewirkt, und ich hoffe inbrünstig, dass ich auch heute die richtige Farbe wählen und den passenden Zauber für Mirulay wirken kann. Wenn nicht, sind wir alle verloren.
»Ich hoffe nur«, hauche ich, »dass es funktioniert.«
»Wir wissen es, wenn wir es versuchen.«
Ich muss lächeln, denn ich erkenne die Worte. Es sind meine eigenen. »So viel Weisheit kann nur ein Sarev aussprechen.«
»Die Weisheit stammt von einer Königin, Kaya.«
»Ach ja? Welcher denn?« Meine scharfe, dünne Klinge zerteilt seine Haut. Ein Tropfen Blut rinnt über seinen Bauch, und ich erschrecke nicht zum ersten Mal darüber, wie bedrohlich Blut auf so heller Haut wie seiner erscheint. Dabei fließt doch dasselbe Blut in unseren Adern.
»Einer künftigen.« Seine Stimme bleibt ganz ruhig, während ich vier Bogen als Schutz von allen Seiten ziehe. Er zuckt nur dann zusammen, wenn die Linien sich kreuzen. »Einer Königin der Zukunft.«
Die Rune ist fertig, nun kommt das Entscheidende. Die Farbe und die Magie. Selbst das Werkzeug war mir wichtig. Während meines Abendgesanges habe ich vor wenigen Tagen einem der in der Rodnaya weidenden Pferde ein paar Mähnenhaare abgeschnitten und mir daraus einen Pinsel gefertigt. Erst später hat mir jemand erzählt, dass das Pferd ein ganz besonderes ist, das nicht jeden an sich heranlässt. Es gehörte Anait.
Es wundert mich wenig, dass sie mir ihre Hilfe hat zukommen lassen. Seit wir an ihrem Grab miteinander gesprochen haben, sehe ich ihren Geist nicht mehr. Aber ich fühle, dass sie noch nah ist.
Mit geschlossenen Augen befeuchte ich den Pinsel mit der Zunge und sammle ich mich. Konzentriere all meine Hoffnung, bis ich glaube, sie im Mund zu schmecken. Sie schmeckt bitter – sie wird einen Preis kosten. Aber gleichzeitig sind da auch Süße und ein Geschmack von Wind, der über fruchtbare Erde und durch blühende Wälder streift.
Das Gefühl ist richtig.
Ich puste es sanft in meine hohle linke Hand und tauche mit der rechten den Pinsel hinein. Dann öffne ich die Augen und ziehe die Wunden, die ich Mirulay verursacht habe, mit dem Pinsel nach.
Wir halten beide die Luft an.
Miru, weil der Schmerz so unerwartet kommt. Der Pinsel ist weich, dennoch stöhnt er auf und verkrampft die Fäuste.
Ich, weil ich nicht damit gerechnet habe, was nun passiert. Das Blut verschwindet einfach; verdunstet wie ein Tropfen Wasser in der Wüste. Die Hoffnung füllt die Schnitte in seiner Haut, schimmert auf in Tönen zwischen Blau, Violett und Grün, wie das Gefieder der Waldelstern. Dann wird sie plötzlich schwarz. Genauso wie die feinen bläulichen Adern über seinen Sehnen und Muskeln. Es ist, als wechselte sein Blut die Farbe.
Miru keucht auf, und kurz bin ich nicht sicher, was ich sehe. Ist es noch Miru, der vor mir auf dem Bett liegt und die Fäuste in die Laken gegraben hat, so fest, dass der Stoff reißt?
Das Wesen vor mir hat Augen wie aus schwarzem Glas und starrt mich an wie ein in die Enge getriebenes Raubtier. Ich habe ihn schon einmal so erlebt: an dem Abend, als der Nachtschein blühte. Damals hat er mich in einen Albtraum mitgerissen. Und auch jetzt formiert sich die Umgebung neu um mich herum. Lichter schweben in der Luft wie fliegende Kerzenflammen. Sie bewegen sich zu schweren, getragenen Klängen von Bratschen, Celli und Violinen …
»Nein!« Heute lasse ich es nicht zu. Ich gehe nicht mit ihm in die Schrecken, die zweifellos auf uns lauern.
Ich weiß nun, was er fürchtet und was er aushalten musste. Es ist die Vergangenheit, die kommt, um ihn zu holen. Und die Angst vor der Zukunft. Mehr von beidem will ich nicht sehen. Ich fürchte selbst zu sehr, was er mir zeigen könnte, jetzt, da er keine Kontrolle mehr hat.
»Nein!«, wiederhole ich und verankere mich in Gedanken mit tiefen Wurzeln im Hier und Jetzt. »Ich bleibe hier. Bleib du auch bei mir.«
Seine Magie bäumt sich auf, als versuchte sie, vor meiner zu entkommen. Die dunkle Färbung seiner Adern zieht sich um die Rune zusammen, es scheint, als söge das Zeichen die Schwärze ein.
Mirulay blinzelt und ist wieder der Alte. Er wischt sich winzige Schweißperlen von der Oberlippe und sieht ratlos von der Rune zu mir. »Es hat nicht funktioniert, oder?«
Die Rune ist da, aber ihre Linien sind pechschwarz. Hoffnung hatte ich mir als Farbe doch ein wenig anders vorgestellt. Ob das etwas zu bedeuten hat?
Seine Haut wirkt beinah unversehrt, als wäre diese Tätowierung nicht wenige Augenblicke alt, sondern Jahre.
Ich muss schlucken. »Doch, das hat es.«
»Aber? Da ist ein Aber in deinen Gedanken, Kaya, ich kann es hören.«
»Kein Aber.« Es hat funktioniert, ohne jeden Zweifel. »Deine Magie ist … fort. Nein, nicht fort. Aber ich kann sie nicht mehr wahrnehmen. Selbst ich nicht, Miru. Sie ist maskiert.« Das Gefühl ist seltsam. Es ist, als fehlte mir einer meiner Sinne, wenn ich mich ihm zuwende. Einer, der vorher so selbstverständlich zu mir gehörte, dass ich ihn nie infrage gestellt habe. Einer, den ich nicht auszublenden imstande war. Man kann die Augen schließen und nicht mehr sehen. Man kann sich die Ohren zuhalten und nicht mehr hören.
Mirus Magie war immer da. Sie wurde von meiner Magie empfangen und brachte etwas in mir zum Klingen. Nun fehlt dieses Gefühl. Es ist unsichtbar geworden, gut versteckt von meiner magischen Rune.
»Es hat funktioniert«, wiederhole ich. Allerdings habe ich plötzlich das drängende Gefühl, einen Fehler gemacht zu haben. Was, wenn ich die Kontrolle über etwas aus der Hand gegeben habe, das nur ich kontrollieren kann?
»Kaya?« Miru streckt die Hand aus, legt sie in meinen Nacken und zieht mich an sich, bis meine Stirn an seiner lehnt. Ich schließe die Augen und genieße den winzigen Moment der Ruhe. Wir haben viel gemeinsam durchgestanden, Miru und ich, und daher ist ein jeder Augenblick kostbar. »Danke dir. Ich weiß nicht, ob deine Rune wirklich halten wird, was du dir davon versprichst. Aber etwas hat sie jetzt schon bewirkt.«
»Was denn? Spürst du einen Unterschied?«
Er nickt. »Hoffnung. Die spüre ich.«
Und er hat sie dringend gebraucht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Eilig küsse ich seine Lippen und stemme mich hoch, bevor mir ein paar Tränen in die Augen steigen und meine Unsicherheit verraten.
Ich darf seine Hoffnung nicht mit meinen Zweifeln besudeln.
KAPITEL 6
KAYA
Mit wirren Gedanken laufe ich die Treppen herab und Richtung Haustür, als ich im Gemeinschaftsraum Ciscas Stimme höre. Ich will nicht lauschen, aber etwas in ihrer Stimme lässt mich innehalten und nahe der Tür verharren.
»Es ist mir völlig egal, ob du Mitleid hast, Talka.« Cisca spricht ernst, aber leise.
Obgleich ich Talka vermisst habe und erleichtert bin, dass er hier ist, kommt keine echte Freude in mir auf.
»Das Ganze ist nicht ohne Grund geschehen«, sagt er in diesem Moment zu seiner Kommandantin. »Und vergiss bitte nicht, dass Azjan und seine Leute ebenfalls gute Motive für ihre schlechten Taten nennen können. Du kannst Menschen verurteilen, weil sie ihm Glauben schenken. Aber doch nicht mit derartiger Härte!«
»Und ob ich das kann«, zischt Cisca. Sie scheint über den Umstand, dass Talka ihr widerspricht, ebenso überrascht wie ich. Meist sagt er genau das, was sie hören möchte, und genießt es, wenn sie sich über ihre Einigkeit freut. Ich bin nicht sicher, ob sie es weiß, aber Talka ist bis über beide Ohren in sie verliebt.
»Wer uns verrät«, sagt Cisca kalt, »hat Gnade weder verdient noch wird er sie als Geschenk bekommen.«
»Hast du dir je die Frage gestellt, wem du glauben würdest, wenn dein Vater dich nicht zu Mirulay gebracht hätte?«, fragt Talka.
Irre ich mich, oder höre ich Cisca empört die Luft einziehen? Doch sie schweigt. Ich weiß nicht, worauf Talka anspielt, aber seine Worte scheinen sie zu treffen.
»Vielleicht würdest du in Azjan die Rettung Eshrians sehen und in Mirulay eine Gefahr für das Land, wenn dein Vater damals den Preis gezahlt hätte, den Azjan für seinen Zauber forderte.«
Ich weiß nicht, worüber sie genau reden. Aber ich begreife plötzlich einen anderen Zusammenhang. Nämlich woher Cisca und Mirulay sich kennen.
Ciscas Oberlippe ist gespalten. Die Eshrianer gelten als ein Volk, dem makelloses Aussehen wichtig ist. Oberflächlich und eitel sind die Worte, die meine Mutter wählte, aber ich denke, dass mehr dahintersteckt. Die Magie, die Azjan und Mirulay beherrschen, kann das Äußere wandeln. Cisca wurde zu Miru gebracht, damit er die Besonderheit ihrer Lippe durch einen Zauber maskiert. Ich habe sie nicht anders kennengelernt als in ihrer wahren Gestalt, denn als ich sie zum ersten Mal sah, war Miru viel zu schwer verwundet, um die Magie noch aufrechtzuerhalten. Aber mir ist damals schon aufgefallen, wie irritiert sie war, dass man ihr wahres Gesicht sehen konnte.
Ich muss an Xenia denken, die man als Leibwache für mich abbestellt hatte. Miru hatte das Feuermal in ihrem Gesicht verschwinden lassen.
Wie mag es Xenia gehen? Ich kann nicht behaupten, das launische Mädchen zu vermissen. Aber ich mache mir Sorgen, was mit ihr passiert ist, nachdem wir das Anwesen verloren haben. Dass sie für Mirulay gearbeitet hat, könnte sie in massive Schwierigkeiten gebracht haben.
Es wundert mich kein bisschen, zu hören, dass Azjan einen Preis für seinen Zauber verlangt. Scharf und spitz erwischt mich dagegen die Frage, ob dies auch für Mirulay gilt. Ich werde ihn fragen, wenn …
»Es ist mir egal!«, ruft Cisca und unterbricht mich damit in meinen Gedanken. »Wir reden hier auch nicht davon, dass jemand nicht ahnen konnte, wer Azjan ist und was er tut. Wir reden von Verrat, Talka! Von jemandem, der wusste, wofür wir kämpfen und aus welchen Gründen. Und dieser Verrat hat zwei Dutzend unserer Leute das Leben gekostet.«
»Cisca, ich verstehe deine Wut. Aber du kannst deshalb niemanden zum Tode …«
»Ich«, schreit Cisca, »kann Menschen zu Schlimmerem als zum Tode verurteilen. Und du …« Sie setzt eine Pause und atmet hörbar durch. »Du bist nicht in der Position, mich zu kritisieren. Ich warne dich dieses eine Mal. Kommt es wieder vor, dass du mich um Gnade für Verräter anbettelst?«
Talka schweigt, und mir wird der Mund trocken.
Wer ist dieser Verräter?
Statt einer Antwort höre ich Schritte, und plötzlich tritt Talka in den Türbogen. Einen winzigen Moment lang blickt er mich erschrocken an, als hätte ich ihn bei etwas Verbotenem ertappt. Dann ist der Eindruck verschwunden, und ich bin nicht sicher, ob ich ihn mir eingebildet habe.
Talka dreht sich noch einmal zu Cisca um. »Ich werde nie wieder etwas von dir fordern, Kommandantin.«
Damit tritt er an mir vorbei, lässt mir bloß ein knappes Nicken da und geht zur Tür hinaus auf den Hof.
Cisca erscheint im Türbogen, ihre Hand streift das Holz, als sie Talka nachsieht.
»Ich … ich habe noch nie mit ihm gestritten«, sagt sie leise zu mir. »Ich wusste nicht … ich dachte immer …«
»Dass er gar nicht anderer Meinung sein kann als du?«
Sie nickt mit schuldbewusster Miene. »Ich dachte, wir wären uns immer einig. Aber das stimmt nicht, oder?«
»Ich glaube, er ist gern mit dir einer Meinung.« Weilerdichliebt,Cisca. Aber das sage ich ihr natürlich nicht. »Aber diesmal war ihm sein Standpunkt wichtiger als der Wunsch, dir zu gefallen.«
Als ich den Blick hebe, sind ihre klugen blauen Augen direkt auf mich gerichtet. »Was ist denn sein Standpunkt?«
Sie fragt damit eigentlich etwas anderes: Wie viel hast du mitgehört?
Und ich beschließe, ehrlich zu ihr zu sein, weil ich den Versuch nicht wage, Cisca hinters Licht zu führen. »Dass es einen Verräter gibt, der von deiner Gnade abhängig ist.«
In meinem Kopf tobt ein wilder Gedanke herum. Was, wenn Nevan dieser Verräter ist? Was, wenn Talka hier um Nevans Leben feilscht?
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Nevans Lügen haben mich verletzt. Aber das bedeutet nicht, dass ich denke, er hätte Mirulay verraten.
Ist das naiv? Er hatte nicht den geringsten Grund, Mirulay nicht zu verraten. Er hat ihn nicht kennengelernt und seine Geschichte nicht gehört. Ist es meine Schuld, weil ich ihm nicht alles erzählt habe? Ich wollte gar keine Geheimnisse vor ihm haben, aber ich wollte auch nicht Mirus Vergangenheit ohne dessen Erlaubnis vor Nevan ausbreiten.
Wenn ich alles anders gemacht hätte … wäre es vielleicht nie zu dem Angriff auf Ser Brockens Anwesen in Vitira gekommen?
Ich reibe mir die Stirn, um diese nutzlosen Was-wäre-Wenns zu vertreiben. Eigentlich will ich den Gedanken, Nevan könnte den entscheidenden Verrat begangen haben, weiterhin ausschließen. Denn Nevan – welche Funktion er auch innegehabt haben mochte in unser beider Leben – ist eine herzensgute Seele. Er hätte nichts getan, was so viele unschuldige Menschen in so große Gefahr gebracht hatte. Das passt nicht zu ihm.
Cisca wirkt nachdenklich. »Du weißt, was in Vitira geschehen ist, Kaya. Du weißt es besser als ich, denn du warst dort und ich … nicht. Du hast gesehen, wie barmherzig die Soldaten waren.« Zynismus färbt ihre Stimme. »Wie viel Gnade sie für Ser Brocken übrig hatten.«
Ich presse die Lippen zusammen und atme gegen den Drang an, mich zu übergeben. Sie haben ihn nicht im Kampf getötet. Sie haben ihn qualvoll gefoltert, es jedoch nicht zu Ende gebracht. Ich war es, die Ser Brocken schließlich erschoss. Und mit ihm all seine Peiniger.
Niemand außer Mirulay weiß davon.
»Talka«, sagt Cisca leise, »wäre bei diesem Angriff beinah ebenfalls getötet worden.«
Ich bin ein wenig erleichtert, dass sie mir mein Entsetzen offenbar nicht angemerkt hat. Stattdessen ist sie mit ihrem eigenen beschäftigt. »Und doch will er nicht, dass du etwas tust, das sich nicht mehr rückgängig machen lässt. Vielleicht hast du noch nicht alle Informationen?«
Bei allen Wüstenstürmen! Was, wenn Nevan der Verräter ist? Es würde bedeuten, dass er gefunden wurde. Dass sie ihn vielleicht sogar festgenommen haben und irgendwo einsperren.
Ich kenne mich. Nach wenigen Sätzen und ein paar Erklärungen wäre ich auf seiner Seite, und zwar völlig egal, was er wirklich getan hat. Selbst wenn er das Dach über unseren Köpfen in Brand gesetzt hat – ich würde trotzdem nicht wollen, dass ihm etwas zustößt. Man kann so viele gemeinsame Jahre, all die Freundschaft und so viel gelebtes Vertrauen nicht einfach wegwischen wie Worte, die man in den Sand geschrieben hat. »Wer ist es?«
Cisca legt mir eine Hand auf den Arm. »Das muss dich nicht kümmern. Ich diskutiere meine Entscheidungen mit niemandem. Es reicht mir schon, mich mit Talka herumschlagen zu müssen. Ich vermute, die Rodnaya macht seinen Verstand trübe. Normalerweise weiß er, wer die Befehle gibt.«
»Ich frage dich bloß, wer dieser Verräter ist.«
»Um mich dann ebenfalls anzubetteln, gnädiger zu sein?«
»Ich bettle nicht!«, entfährt es mir ungewollt scharf. Ich muss mich räuspern und wiederhole mich ruhiger. »Ich bettle nicht. Mag sein, dass ich eine Meinung habe, aber …«
»Siehst du«, unterbricht mich Cisca. »Sie ist irrelevant, diese Meinung. Ebenso wie Talkas Meinung. Oder Mirulays. Es gibt Entscheidungen, die obliegen mir allein.«
»Wer?«, wiederhole ich schlicht.
Cisca reibt sich über die Oberlippe. »Es ist im Augenblick nur eine Ahnung, wo wir die Person finden können. Es gab noch keine Festnahme. Und du hast eine Entscheidung getroffen.« Sie deutet auf die Truhe mit meinen Sachen, die bereits neben der Tür steht und nur noch in die Kutsche geladen werden muss. »Du hast mehr als genug mit dieser Aufgabe zu tun, Kaya. Ich erledige derweil meine.«
»Warte ab, bevor du etwas tust, was sich nicht rückgängig machen lässt«, sage ich. Dann trete ich zur Seite, um Cisca Platz zu machen. »Ich bettle nicht. Ich bitte dich darum, weil du meine Freundin bist. Aber wenn du meine Bitte nicht anhörst, schrecke ich nicht vor einem Befehl zurück. Und glaube mir, ich bin in der Lage, dir einen Befehl zu erteilen, wenn ich muss. Ich will es nur nicht.«
Daraufhin nickt sie bloß knapp. Eine Geste an eine Ranghöhere, eine Geste ohne jegliches Gefühl der Zuneigung oder des Verständnisses. Da ist nur eins: Gehorsam.
Ich hasse es.
Cisca verlässt das Haus, und ich habe das Gefühl, eine Freundin geht.
Weil ich sie fortgeschickt habe.
Vielleicht für immer.
KAPITEL 7
KAYA
AUF DEM WEG RICHTUNG ZAMOUKA
Früh am nächsten Morgen beginnt unsere Reise. Mirulay, Talka, Cisca und ich reiten, und hinter uns rumpelt die Kutsche mit drei Bediensteten. Sie hält uns auf, wir wären ohne sie viel schneller in Zamouka, weil sie uns zwingt, die breiten Straßen zu nehmen. Allerdings ist sie mit ihren ziselierten Eisenbeschlägen ein Vermögen wert, und die höhere Gesellschaft von Eshrian würde jeden Hinweis darauf, dass Mirulay Jachan nicht mehr wohlhabend ist, als große Schwäche auslegen. Erlauben will er sich nicht die kleinste. Denn er muss genau diese Leute von sich überzeugen.
In Zamouka muss Mirulay der Sohn des letzten Sarevs sein. Eine leibhaftige Legende. Und er muss vorgeben, zu ihnen zu gehören: den Reichen und Mächtigen. Es mag eine Sache sein, Azjan die Macht über das Reich wegzunehmen – aber nur mit der Unterstützung der Menschen werden wir sie auch halten können. Wie gut, dass Miru nichts so gut kann, wie sich zu maskieren. Darüber hinaus wüsste ich nicht, wie ich mein aufwendiges Ballkostüm ohne Kutsche hätte transportieren sollen. Es ist groß wie ein Sarg und ebenso sperrig.
Einige von Mirus Leuten begleiten uns, halten sich aber meist weiträumig um uns verteilt und sichern uns in alle Richtungen ab. Wovor, ist schwer zu sagen. Die größten Gefahren dieser Tage sind Erdbeben, Überschwemmungen und plötzliche Wetter weit jenseits der Normalität.
Wir umschiffen sie, wie ein Schiff Stürmen ausweicht, wobei die Rolle des Kapitäns zwischen Miru und Cisca aufgeteilt zu sein scheint, während Talka als Steuermann fungiert, der ihre Anweisungen umsetzt, und ich als eine Art lebendiger Seismograf, Kompass und Sextant diene. Zwar fälle ich keine einzige Entscheidung – das würde ich mir nicht anmaßen –, doch scheint keine getroffen zu werden, ohne dass zuvor mein Rat eingeholt wird, besteht dieser auch stets nur aus einem Gefühl.
Einmal habe ich nichts mehr sagen wollen. Gierschluchten jagten in der Nähe, und am Himmel vor uns türmten sich Wolkenungeheuer in Schwarz und Dunkelrot auf, zerrissen und formierten sich neu. Und ich sollte vermuten, ob es besser war, auszuweichen oder in das Unwetter hineinzusteuern. Mit nichts als meiner Ahnung und dem Wissen, dass sich alle hier auf mich verließen?
»Was verlangt ihr da von mir?«, herrschte ich Miru an. »Der Sturm kann in alle Richtungen ausschwenken. Wenn ich dir nun sage, dass wir südlich vorbeireiten, und dann …«
»Wenn du es sagst, entscheide ich so«, bestätigte er. »Weil es niemand besser weiß als du.«
»Und wenn ich mich irre?«
Er schluckt. »Dann war meine Entscheidung falsch.«
»Und meine. Ich kann das nicht. Das ist viel zu schwerwiegend, um es für uns alle zu entscheiden.«
»Denkst du das wirklich?«
Ich wollte nicken, aber aus irgendeinem Grund drückte mir meine Beklommenheit den Hals zu, sodass ich nicht mal mehr das schaffte.
»Wenn ja, Kaya, dann musst du umkehren und in die Rodnaya zurückreiten. Wenn du aber weiter nach Zamouka reisen willst, dann bleibt dir nichts anderes übrig, als dich mit dem Gedanken abzufinden, eine große Menge an Entscheidungen zu treffen, von denen jetzt schon klar ist, dass du dir einige nie verzeihen wirst. Das hier ist nur der Anfang.«
Ich beiße mir auf die Unterlippe. »Das ist Verantwortung, richtig? Entscheidungen treffen zu müssen – und zu können –, von denen man weiß, dass sie falsch sind.«
Und mit diesem Wissen entschied ich über unsere Richtung. Diesmal lag ich richtig. Das würde nicht immer so bleiben.
Je weiter wir in besiedeltes Gebiet vordringen, desto verständlicher wird mir unsere große Leibwache, denn in den Dörfern liegt Hunger in den Blicken aller Menschen. Hunger und die Überzeugung, dass wir mehr haben als sie. Mehr als einmal bin ich überzeugt davon, dass nur unsere Anzahl dafür sorgt, dass wir nicht angegriffen werden.
Wir queren Felder, auf denen die Rüben klein und hart wie Steine sind, dabei müssten sie längst dick und reif sein.
»Das passiert, wenn ein Feld dreimal im Jahr Ertrag bringen muss«, erklärt Talka mit leerem Blick, während er sein Pferd am Zügel neben meinem herführt. Seit seinem Streit mit Cisca ist er wortkarg und hält sich abseits. »Man muss dem Boden auch mal Zeit geben, sich zu erholen. Aber die Leute sind zur Produktion gezwungen, und die Erde hat keine Nährstoffe mehr. Das hier«, er zieht eine Rübe aus dem Acker, wiegt sie in der Hand und schleudert sie dann aufs Feld, »enthält nichts mehr. Es füllt bloß den Bauch, aber stillt nicht den Hunger.«
Ich wünschte, ich hätte ein Wort des Trostes. Talka ist in Mirus Gefolge, weil er in einem Dorf aufwuchs, das Azjan ausbeutete. Ursprünglich hatte er gelebt wie jene, die nun unserer Kutsche nachschleichen und denen er mit der Stirka drohen muss, damit sie uns nicht überfallen.
Das Leid hat sie zusammengeführt, und ihre Freundschaft baut darauf auf. Ob sie Bestand haben kann, wenn es kein solches Leid mehr in Eshrian gibt? Wenn jeder eine wahre Chance auf ein solides und gutes Leben und einen angemessenen Anteil vom Glück hat, egal, wem er sich anschließt?
Ich sehe Miru hinterher, der voranreitet, und stelle mir diese Frage: Wenn er nicht mehr für diese Menschen sorgen muss – wird er noch ihre Nähe suchen?
Manchmal denke ich, in ihm ist zu viel zerstört worden, um anderen noch etwas zu geben. Und ich weiß, wie absurd der Gedanke ist, gibt er mir doch so unsagbar viel.
Aber trotzdem … Er wirkt oft, als wäre er all dessen müde. Allem außer mir vielleicht.
KAPITEL 8
KAYA
»Wir werden uns ein paar Stunden lang absetzen«, sagt Miru zu mir, wendet sein Pferd und reitet zu Talka, um ihm Bescheid zu geben.
Als er zurückkommt, frage ich ihn, was er gesehen hat. »Mir ist dein Blick nach Osten aufgefallen. Da ist etwas, oder?«
Mirus Blick wird weich und liebevoll. »Dir entgeht nichts. Tatsächlich habe ich aber nichts gesehen, sondern etwas nicht gesehen.«
»Etwas Bedeutsames?«
»Alles ist bedeutsam in Eshrian.«
Eine gute Stunde später scheinen wir gefunden zu haben, was Mirulay gesucht hat, denn er steigt vom Pferd, schiebt Laub beiseite und hebt etwas auf, das ich in der Dämmerung erst beim Näherkommen erkennen kann. Es ist eine Feder, platt gedrückt und schmutzig und an ihrer Außenseite verkohlt. »Wir müssen hier richtig sein.«
»Ich würde dir suchen helfen, wenn du mir sagst, wonach.«
Doch in diesem Moment scheint er den Hinweis entdeckt zu haben, nach dem er sich umschaut, denn plötzlich eilt er, sein Pferd am Zügel, zwischen den Bäumen her. Er muss über dorniges Unterholz steigen, und ich, die ihm nachreitet, bin ein paarmal gezwungen, mich auf den Pferdehals zu ducken, weil mir Äste im Weg hängen. Doch schließlich erreichen wir eine kreisrunde Lichtung, und in ihrer Mitte …
»Er ist nicht verschwunden«, murmelt Mirulay, und kurz erweckt er den Eindruck, als würde er sich gleich auf die Knie fallen zu lassen, weil er sich nicht mehr aufrecht halten kann. »Er ist zerstört.«
Vor uns ragen die Überreste eines Baumstammes aus dem Boden. Auf der Höhe von etwa einem Meter ist er abgebrochen und zur Seite gestürzt. Die Baumkrone muss abgebrannt sein, denn sie besteht nur noch aus wenigen dicken Ästen, die schwarz wie Kohlen geworden sind. Überall liegt verbranntes Laub, vermischt mit Asche.
Es ist nur ein zerstörter Baum. Aber ein Gefühl sagt mir, dass eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes vor uns liegt.
Ich springe vom Pferd, als sich vor seinen Hufen etwas bewegt, und beuge mich zum Boden. Vorsichtig hebe ich einen grauen Vogel aus der Asche. Zuerst denke ich, seine Flügel würden zwischen meinen Fingern zerfallen wie verbranntes Papier. Doch es sind nur verkohlte Blätter, in denen er sich versteckt hat. Der Vogel – es ist eine zarte, kleine Taube – scheint unversehrt, aber schwach. Panisch rast ihr Herz in der zerbrechlichen Brust.
»Es ist der Essebaum«, sagt Miru, der die Taube noch nicht bemerkt hat, da er mir den Rücken zuwendet. Er umrundet den Baumstumpf und tastet vorsichtig über die schwertspitzen Bruchkanten. »Seine Blüten glühen auf, wenn sie sich öffnen, und werden zu tausend kleinen Flammen. Kein Brand hätte diesen Baum zerstören können. Er hätte nicht verbrennen dürfen. Ich begreife das nicht.«
Dafür glaube ich zu verstehen. »Sieh mal, das Muster, das am Stamm entlang nach unten führt.« Es sind feine Zickzacklinien, wie von einer Feder aus Glut gekritzelt. »Ich denke, dass ein Blitz in den Baum einschlug. Seine Kraft hat ihn abbrechen lassen.«
Erstaunt sieht Miru mich an. »Du könntest recht haben. Trotzdem ist es ungewöhnlich und … Warte. Was hast du da?«
Die Taube schmiegt sich in meine Hände, als würde sie meine Wärme genießen. Ich streichle ihren kleinen runden Kopf, das scheint sie zu beruhigen.
»Sieht aus, als hätte ich jetzt wirklich einen Vogel«, scherze ich lahm. »Weißt du zufällig, was diese Tauben fressen? Sie hat kaum noch Kraft.«
Auf dem Weg zu mir streift Miru mit der Hand über die verkohlten Äste der Baumkrone. Sein Blick verheißt nichts Gutes. »Es ist eine Feuertaube. Sie frisst die Kerne des Essebaumes.«
Eine Feuertaube. Auch das noch. Ich betrachte sie zweifelnd. Sie entfachen kleine Feuer, die sich schnell ausweiten und Katastrophen verursachen können. Diese allerdings erscheint mir vollkommen hilflos. Und verloren, wenn ich sie liegen lasse.
»Das hier ist furchtbar«, sagte Mirulay betroffen und schluckt schwer. »Feuertauben brüten im Essebaum – und nur in diesem. Dass er nun verloren ist …«
»Sind Feuertauben denn so wichtig? In Amisa sind sie als Plage verschrien.«
»Hier nicht weniger. Aber als ich ein Kind war, da erzählte meine Mutter mir anhand ihres Beispieles immer, dass jedes Tier seine wichtige Aufgabe im großen Gefüge hat. Dass ein jedes gebraucht wird. Und bei den Waldleuten habe ich gelernt, dass immer ein Grund zur Sorge besteht, wenn sich im Wald etwas ändert, das lange Bestand hatte.«
Ich wiege den kleinen Körper in meinen Händen. Die Taube ist kaum mehr als Knochen und Federn. »Und was frisst eine Feuertaube?«
»Nichts«, sagt Miru. »Nur die Essebaum-Kerne.«
Oh. Der Baum ist mitsamt Blüten und all seinen Kernen verbrannt. »Steht denn nicht irgendwo ein zweiter?«
»Ich weiß von einem in der Rodnaya und einem an den Grenzen zu Amisa. Aber …«
Wir wären Tage unterwegs. Zeit, die wir nicht haben.
Mein Herz zieht bei der Vorstellung, dass ich meiner Taube vielleicht nicht helfen kann. Dass sie womöglich in meinen Händen verhungern muss.
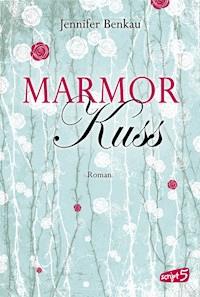











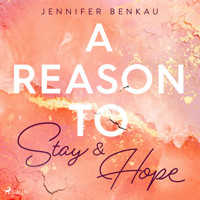
![Die Seelenpferde von Ventusia. Wüstentochter [Band 2 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/951159023fcc1fbce23b219e5bb9ea3d/w200_u90.jpg)


![Die Seelenpferde von Ventusia. Sturmmädchen [Band 3 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/5301e0aef492f4b62003660f83fe52a5/w200_u90.jpg)
![Die Seelenpferde von Ventusia. Windprinzessin [Band 1 (Ungekürzt)] - Jennifer Benkau - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/25fb250af2dc0456b6868226a45dcce5/w200_u90.jpg)











