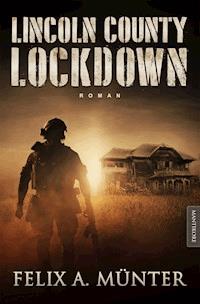Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Mantikore-Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: The Rising
- Sprache: Deutsch
THE RISING - NEUE FRONTEN DRITTER TEIL DER POSTAPOKALYPTISCHEN ROMANSERIE VON FELIX A. MÜNTER Der Kampf um die Zukunft der Menschheit geht weiter! Es ist das Jahr 7 der neuen Welt. Der Neubeginn für die Menschheit ist zum Greifen nah. Die Zeiten, in denen um das nackte Überleben gekämpft wurde, scheinen vorüber. Die "Union" verspricht bald freie Wahlen abzuhalten. Doch die Hoffnung auf Frieden und Freiheit wird auf die Probe gestellt, als der Sohn des Machthabers auf mysteriöse Weise verschwindet. Schnell werden die Kontrahenten beschuldigt, das Kind entführt zu haben, um den jungen Staat zu erpressen. Die Welt droht erneut in Krieg und Chaos zu versinken. Als sich eine Gruppe auf die Suche macht, kommen sie der unvorstellbaren Wahrheit auf die Spur….
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 579
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Felix M. Münter
THE RISING 3NEUE FRONTEN
Deutsche Erstauflage
1. AuflageVeröffentlicht durch denMANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYKFrankfurt am Main 2015www.mantikore-verlag.de
Copyright © der deutschsprachigen AusgabeMANTIKORE-VERLAG NICOLAI BONCZYKText © Felix A. Münter
Lektorat: Nora-Marie BorruschTitelbild: Ignacio Bazán LazcanoSatz: Karl-Heinz Zapf
VP: 113-95-01-06-0416
ISBN 978-3-945493-39-7
Felix A. Münter
THERISING 3NEUE FRONTEN
Roman
Für KatharinaDanke, dass du mich und meine nächtlichen Schreiborgien erträgst.Ich liebe dich.
Ein besonderer Dank gebührt Oliver: Ohne dich wäre diese Welt niemals zu dem geworden, was sie ist.
Prolog
Sieben Jahre waren seit der Schlacht um Yard vergangen. Anders als die zahlreichen Skeptiker angenommen hatten, zerfiel die brüchige Allianz zwischen den Bewohnern der Stadt nicht mit dem Sieg über General Banner und seiner Armee. Die Einheit, die damals im Zeichen der Bedrohung geschmiedet worden war, hielt.
Aus dem Bündnis entstand die Union, eine Art Stadtstaat mit Yard im Zentrum. Das Gefecht zwischen Banners Truppen und den Menschen in Yard war die Initialzündung für ein allzu menschliches Bedürfnis gewesen. Die Überlebenden aus der Welt DANACH strebten nach etwas, das sie nur aus Erzählungen kannten: die Sicherheit der Zivilisation. Der Gedanke, das Leid und die Unsicherheit, die Bedrohungen und Sorgen der Welt DANACH hinter sich zu lassen und einzutauschen gegen etwas Besseres, beflügelte die Menschen. Sie ließen sich vom Gedanken der Union antreiben.
Architekt des neuen Bundes war Marcus. Vom Anführer einer der Fraktionen in Yard hatte er sich zum Präsidenten des jungen Staats aufgeschwungen. Ihm war es zu verdanken, dass das einmalige Bündnis zwischen den Bewohnern von Yard nicht auseinanderbrach. Eisern hatte er an seinem Traum festgehalten und für ihn gekämpft. Der Triumph über General Banner war für ihn der Beweis, dass er den rechten Pfad eingeschlagen hatte, und gleichzeitig Legitimation, damit weiterzumachen.
Kaum war der Schlachtenlärm verklungen, tat er alles, was notwendig war, um das fragile Bündnis zu stärken und zu erhalten. Er verhandelte mit Geschick, er überzeugte, er drohte. Und manchmal setzte er Gewalt ein, um den Fortbestand der Union zu sichern.
Denn Widerstände gefährdeten das Überleben – und das konnte er nicht zulassen.
Die Union entsprang seinem Geist. Wie bei einem Kind konnte er Jahr für Jahr beobachten, wie der einfache Gedanke wuchs und immer ausgeprägtere Formen annahm. Wie die Menschen Teil der Union wurden, wie die Union wuchs und mächtiger wurde. Gleich einem Vater begutachtete er das, was er erschaffen hatte, und war stolz auf sein Werk. Doch bekanntlich kommt im Leben eines jeden Kindes irgendwann der Zeitpunkt, da es groß genug geworden ist, um auf eigenen Beinen zu stehen.
Sie hatten ihn zum ersten Präsidenten der Union gemacht. Und nach dem Willen des Rats, den Marcus selbst ins Leben gerufen hatte, sollte es kein Posten auf Lebenszeit sein. Ein Staat brauchte Bewegung, frisches Blut, um wachsen zu können, und so wurde die Amtszeit eines Präsidenten der Union schon früh begrenzt. Bei Marcus gab es keine Ausnahme. Auch wenn er der Geburtshelfer des jungen Stadtstaats war und sein Verdienst gar nicht groß genug herausgestellt werden konnte, warteten im achten Jahr nach seiner Amtseinführung die Wahlen auf ihn. Die ersten Wahlen in der Geschichte der Union.
Es war 2063. Noch gut ein Jahr bis zur Präsidentschaftswahl.
Kapitel 1
Faustpfand
„Kann Arleen mit uns kommen?“
Der kleine Junge blickte fragend zu dem Mann auf. Seine Kleidung war unordentlich und ein Büschel des blonden Haarschopfs stand ungebändigt an seinem Hinterkopf ab. Die roten Wangen des Jungen waren der letzte Hinweis darauf, dass er bis vor wenigen Minuten wild im Garten gespielt hatte.
Der Angesprochene blickte an dem Sechsjährigen vorbei in den Garten. Halb im Türrahmen versteckt stand das Mädchen. Als sich ihre Blicke trafen, zog sie sich schüchtern zurück. Er lächelte.
„Darf sie denn?“
Der Junge nickte eifrig. „Jaja! Sie ist doch heute zum Spielen hier hergekommen. Den ganzen Tag!“
Der Mann verzog kurz nachdenklich das Gesicht. „Joshua, glaubst du nicht, dass wir ihrer Mutter Bescheid sagen müssen? Die wird doch sicher wissen wollen, wo Arleen ist.“
Joshua verknotete verschüchtert die Arme hinter dem Rücken und blickte zu Boden, während er nervös mit den Füßen scharrte.
„Aber die holt Arleen doch erst heute Abend ab! Bis dahin sind wir doch längst wieder zurück! Sie merkt das bestimmt nicht …“
Der Erwachsene lachte laut und herzhaft über die kindliche Logik. Er legte seine Hand auf den Kopf des Jungen und versuchte damit, die abstehende Haarsträhne zu bändigen.
„Macht euch erst einmal fertig. Ich kümmere mich um alles andere.“
Joshua kicherte und gluckste zufrieden auf. „Danke, Will!“
Und damit drehte er sich auf dem Absatz herum und stürmte in den Garten hinaus, noch bevor Will etwas sagen konnte. Für einen Moment blieb der Mann in seinem Korbsessel sitzen und beobachtete die beiden Kinder, lächelte zufrieden.
Doch so sehr er der einfachen Logik Joshuas auch folgen wollte, war ihm doch klar, dass er das nicht tun konnte. Er schüttelte den Kopf, um seine Gedanken zu ordnen, griff nach seiner Tasse und stürzte den lauwarmen Kaffee herunter. Er stand auf, streckte sich einmal und machte sich auf die Suche nach Clara.
Er fand sie in der Küche, wo sie damit beschäftigt war, das Mittagessen zuzubereiten. Will lehnte sich an den Türrahmen und lächelte keck. Sie hätte selbst keinen Finger rühren müssen. Als Frau von Marcus, dem mächtigsten Mann in Yard und der gesamten Union, wäre es ein Leichtes gewesen, fähiges Haushaltspersonal zu bekommen. Doch Clara hatte abgelehnt, ja, sich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt. Der Gedanke, nicht mehr selbst anpacken zu können und sich von anderen Menschen bedienen zu lassen, mochte für einige vielleicht verlockend sein, doch widersprach ihrem Charakter.
„Suchst du etwas?“, fragte sie, ohne aufzublicken.
„Ich hab’ es schon gefunden.“
„Ach?“ Sie blickte auf, streifte sich ihre Hände an der Schürze ab und strich eine Haarsträhne zurück hinters Ohr. „Und was kann ich für dich tun, William?“
„Es geht um Joshua.“
Für einen ganz kurzen Moment konnte er erkennen, wie allein der Name ausreichte, um sie die Küchenarbeit vergessen zu lassen und sofort bei der Sache zu sein. Clara richtete sich auf und warf einen Blick in den Garten, wo sie ihr Kind beim Spielen entdeckte.
Sie schmunzelte schief.
„Was hat er angestellt?“
„Du nimmst immer gleich das Schlimmste an, was? Nein, gar nichts hat er gemacht. Aber er hat mich was gefragt.“
Spöttisch zuckte ihre Augenbraue nach oben, während sie schmunzelte. „Jetzt bin ich aber gespannt, wenn du es ihm nicht beantworten konntest.“
Will winkte ab. „Nein, nein, anders. Er hat gefragt, ob das Mädchen gleich mitkommen kann.“
Clara verschränkte die Arme vor der Brust und blickte nachdenklich nach draußen.
„Arleen? Fiona ist den ganzen Tag unterwegs und hat sie deshalb bei uns gelassen. Ich weiß nicht, ob ihr das gefallen würde.“
Will schüttelte den Kopf. „Weißt du, was er gesagt hat? Dass wir doch wieder zurück sind, bevor Arleen abgeholt wird. Dass ihre Mutter das gar nicht bemerken wird. Ich kann mir nicht helfen, ich finde, das kleine Schlitzohr hat Recht.“
Ihre Blicke trafen sich für einen langen Moment, dann nickte sie. „Das könnte sogar stimmen. Meinetwegen. Aber pass gut auf sie auf.“
„Keine Sorge, dein Mann bezahlt mich ganz gut dafür, weißt du? Und was soll schon passieren? Dein Mann ist Präsident der Union. Das hier ist sein real gewordener Traum. Die Menschen lieben ihn“, lächelte er.
„Will, ich habe dich in all den Jahren niemals als leichtsinnigen Narren kennengelernt. Du weißt genau, dass es hinter dieser Fassade anders aussieht. Er hat sich mit einigen Entscheidungen Feinde gemacht. Und letztlich hat er dich doch genau aus diesem Grund eingestellt: Du sollst uns schützen, während er im Unionsrat sitzt. Wozu bräuchten wir einen Leibwächter, wenn es keine Gefahr gäbe?“
„Weil Marcus ein vorsichtiger Mann ist. War er schon immer. Diese Vorsicht hat ihn lange vor der Union an die Spitze gebracht. Aber wenn du schon so fragst … Wie viele Angriffe auf euch hat es denn in den vergangenen Jahren gegeben?“
„Keine“, gab sie knirschend zu.
„Da hast du es. Müssen wir wirklich noch länger darüber reden?“
Clara sog hörbar die Luft ein. „Nein. Aber pass trotzdem auf.“
„Dafür bin ich hier.“
Seine Worte schafften es nicht, ihre Zweifel zu beseitigen. Sie verzog das Gesicht nachdenklich und blickte zu den spielenden Kindern. Ein Seufzen verließ ihre Lippen.
„Mach dir nicht so viele Gedanken“, meinte Will aufmunternd und berührte sie sanft und liebevoll an der Wange. Ihre Blicke trafen sich und für einen Moment huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Dann zog er die Hand schnell wieder zurück, aus Angst, dass sie irgendjemand sehen konnte.
„Er ist bei dir gut aufgehoben, ja“, sagte sie und legte ihre Hand in seine.
„Das ist er“, nickte der Leibwächter und drückte ihre Hand noch einmal, bevor er ging.
Selbst auf den belebten Straßen von Yard fiel das sonderbare Trio auf. Der blonde Junge saß strahlend auf den Schultern des breitschultrigen Mannes und ließ sich durch die Stadt tragen. William hielt mit der linken Hand den Oberschenkel von Joshua, während er mit seiner rechten Hand Arleen führte. Das Mädchen war kaum ein Jahr älter als Joshua und hatte nicht die beste Laune. Die beiden Kinder hatten sich darum gestritten, wem von ihnen das Privileg zuteilwerden sollte, auf Williams Schultern zu sitzen. Will hatte einschreiten müssen und den Kindern nach einigen Minuten einen Kompromiss schmackhaft machen können: Auf dem Hinweg würde er das eine Kind auf den Schultern tragen, auf dem Rückweg das andere. Er hatte sie Hölzer ziehen lassen, und Arleen hatte Pech gehabt. Jetzt reagierte sie bockig, zog und zerrte immer wieder an seiner Hand, teils aus Trotz, teils, weil sie in eine andere Richtung wollte.
William ertrug das alles mit einer stoischen Ruhe. Wäre es sein eigenes Kind gewesen, hätte er anders reagiert – so aber war Gelassenheit wahrscheinlich der beste Weg.
Es war einer der prächtigen, letzten Sommertage. Kaum eine Wolke bedeckte den Himmel, überall war strahlendes Blau. Die Sonne schickte ihre wärmenden Strahlen zu Boden, eine sanfte Brise sorgte für erträgliche Temperaturen. Von der grünen Ebene her trieb der kräftige Duft des Sommers in die Stadt und vermischte sich mit den vielfältigen Gerüchen von Yard zu einem einzigartigen Potpourri. Entgegen der Vorschriften, die Marcus ihm eingeschärft hatte, trug der Leibwächter seine Schutzweste nicht.
Der Präsident pochte immer wieder darauf, doch William war Pragmatiker. Seit er für Marcus arbeitete, hatte es nicht den kleinsten Zwischenfall gegeben, bei dem er die klobige Weste wirklich gebraucht hätte. Gerade im Sommer war die Panzerung aus der Zeit DAVOR unangenehm und wirkte wie eine Hitzefalle. Er kannte genug Geschichten über Soldaten und Söldner, die die Sonne unterschätzt und mitten im Dienst wegen Überhitzung kollabiert waren. Will hatte daher für sich entschieden, dass er seiner Arbeit viel besser nachkommen konnte, wenn er die Weste nicht trug. Stattdessen trug er ein bequemes T-Shirt und eine ausgewaschene Hose, nichts an seiner Kleidung deutete auf seinen Arbeitgeber hin – und das hielt er immer noch für den besten Schutz. Daneben war seine Versicherung gegen Ärger eine großkalibrige Pistole, die lässig aus dem Schulterholster unter seiner Achsel hervorstach. Selbst mit den beiden Kindern fiel er so auf den Straßen von Yard nicht sonderlich auf. Marcus hatte in den letzten Jahren tunlichst darauf geachtet, sich nicht zu oft mit seinem Sohn zu zeigen, so dass der Wiedererkennungseffekt auf offener Straße bestenfalls gering war.
Vielleicht bildete William es sich nur ein, doch vom ersten Moment an kam es ihm so vor, als würden sie beobachtet. Tatsächlich hatte er dieses Gefühl immer, wenn er mit dem Jungen unterwegs war. Er selbst nannte es gesunde Vorsicht und schrieb es seiner Aufgabe zu. Meistens waren es nur kurze Blicke, die sie streiften, und im nächsten Moment gingen die Beobachter wieder ihrem normalen Tagwerk nach.
Die drei erreichten das Tor ins Zentrum der Stadt. In den wenigen Jahren, die seit dem Sieg über Banners Truppen vergangen waren, hatte sich das Antlitz der Stadt grundlegend verändert. In riesigen Kraftanstrengungen waren vor den Toren Wohnquartiere entstanden, zuerst westlich der Mauer, danach im Osten und zuletzt im Süden. Die Bewohner von Yard, die oftmals Jahrzehnte auf den Gleisen des alten Rangierbahnhofs gelebt hatten, siedelten um. Die hohen Mauern aus Schrott wurden abgetragen, als man Baumaterial brauchte, der alte Zaun, der das Gelände in der Zeit DAVOR umgab, wieder instandgesetzt. Im geräumten Zentrum von Yard entstand das Regierungsviertel, Nervenzentrum der Union. Einige der Gleise wurden samt den Werkstätten instandgesetzt und bildeten nun den Bahnhof.
An den Bahnhof grenzte das Depot. Riesige Lagerhallen, viele davon aus der Zeit DAVOR, reihten sich dicht an dicht. In ihrem Inneren stapelten sich schier endlose Mengen allerlei Güter. Angrenzend an den Bahnhof und das Depot befand sich der Markt. Es war ein riesiges Gelände voller Verkaufsstände und Geschäfte. Dazwischen Ausschänke, Kneipen und Garküchen. Der Markt nahm fast die Hälfte des alten Güterbahnhofs ein. Yard lebte vor allem vom Handel, und dieser Platz, auf dem man angeblich alles bekommen konnte, was man wollte, war das eindrückliche Zeichen dafür. Der Handel kam dort niemals zum Erliegen.
„Hey, Ashton! Haben sie dich zum Kindermädchen gemacht?“, lachte eine uniformierte Frau am Tor.
Will lächelte schief und ging zu ihr hinüber.
„Mara! Du weißt doch, ich hab’ die Armee verlassen, weil ich was anderes machen wollte, als Tag für Tag an irgendeinem Tor zu stehen.“
„Sieh mal an. Und jetzt bist du Mädchen für alles, was? Wo hast du denn deinen Rock gelassen?“
„Zuhause. Ich habe so viel Marmelade eingekocht, dass ich keine Zeit mehr hatte, mir die Beine zu rasieren, und das hätte zu den Stöckelschuhen albern ausgesehen.“
Beide brachen in lautes Gelächter aus und begrüßten sich herzlich. Die Uniformierte lächelte die beiden Kinder freundlich an. „Hey, Josh! Wer ist denn deine Freundin?“
Der Junge lachte die Frau an. „Das ist Arleen, sie kommt heute mit uns!“
Mara nickte und sah Will skeptisch an. „Warte mal. Arleen?“ Sie musterte das Mädchen und nickte bestätigend. Die wilden roten Locken waren unverkennbar. „Die Tochter des Generals?“ Lapidar zuckte Will mit den Schultern. „Ja, Moodys Kind. Der alte Haudegen ist gerade zur Truppeninspektion unterwegs und seine Frau wohl schwer beschäftigt. Keine Ahnung, geht mich auch nichts an. Sie ist heute zu Besuch bei Joshua und wollte mitkommen. Na ja, und jetzt sind wir hier.“
Mara kicherte verhalten und grinste breit. „Wenn ich mir ansehe, was für ein Gesicht die Kleine gerade macht, besteht überhaupt kein Zweifel mehr, wer der Vater ist.“
Das Mädchen mochte nicht ganz begriffen haben, was sich die Erwachsenen dort erzählten, quittierte den Ausspruch der Soldatin aber mit einer Grimasse und einer herausgestreckten Zunge.
„Siehst du, was habe ich gesagt?“
„Ganz wie der Vater, stimmt schon“, pflichtete Will ihr bei. „Muss ich mich auf irgendwelche Besonderheiten auf dem Markt einstellen?“
„Nein. Alles ruhig bisher.“ Sie machte eine wegwerfende Geste. „Das gleiche Chaos wie an jedem anderen Tag.“
„Gut. Dann wollen wir mal.“
„Soll ich euch eine Eskorte mitgeben?“
„Ach, lass gut sein. Mit Arleen hier werde ich schon fertig.“
„Na dann. Gute Jagd euch dreien!“
Kurz bevor sie den Markt erreichten, hielt William in einer kleinen Gasse. Von hier aus hatte man einen guten Blick auf das Gedränge. Es herrschte ein reges Treiben, eine unüberschaubare Menschenmenge drängte sich zwischen den Verkaufsständen hin und her. Es wurde gelacht, geflucht, gefeilscht. Lautstark brüllten Händler gegen die Unterhaltungen an und boten ihre Waren feil, versuchten, so viele Kunden wie nur möglich in ihren Bann zu ziehen. Von den Garküchen stiegen dichte Dampfschwaden auf und die Gerüche der unterschiedlichsten Speisen hingen schwer in der Luft. Über die Köpfe der Menschenmenge hinweg dröhnte aus der einen Richtung schwer zu identifizierende Musik, während aus der entgegengesetzten Richtung schrille Klänge kamen. Ein Tag wie jeder andere auf dem Markt von Yard.
Es war ein Leichtes, sich in diesem Wirrwarr zu verlieren.
Kurzerhand nahm Will Joshua und setzte ihn auf seine linke Schulter, hob Arleen zu seiner rechten Schulter empor. Will stöhnte hörbar auf und verteilte das Gewicht der Kinder bestmöglich auf seinen Schultern.
„Also gut, ihr beiden! Ich will, dass ihr euch richtig festhaltet, ja?“
Die Kinder gehorchten und er legte ihnen die Hände auf die Oberschenkel, machte ein paar vorsichtige Schritte. Zufrieden nickte er. So würde es gehen. Zwar hatte er es nun schwer, nach links oder rechts zu schauen, konnte auch nicht mehr alles hören, aber das war eine bessere Lösung, als Arleen im Gewirr der Menge zu verlieren.
Mit großen Schritten stapfte er nun auf die ersten Marktstände zu, während die beiden Kinder vergnügt glucksten und kicherten. Arleens schlechte Laune war schlagartig verflogen und zusammen mit Joshua bewunderte sie das rege Treiben.
Er tauchte in die hin und her wogende Menschenmasse ein, schwamm wie ein Fisch mit dem Strom. Während er lediglich auf eine Wand aus vielen Gesichtern und Hinterköpfen blickte, überragten die Kinder auf seinen Schultern die Menge und schienen den besonderen Ausblick zu genießen. William war in diesem Moment froh, dass er schon hunderte Male hier gewesen war und wusste, wohin er musste. Zielsicher steuerte er durch die Massen. Es war kurz nach Mittag und an den Ständen herrschte gerade Hochbetrieb. An einigen Stellen drängten sich die Marktgänger so eng, dass es kein Durchkommen gab.
Fast jeden Tag nahm Will die gleiche Route. Es gab einige Händler, bei denen er Stammkunde war und den Großteil der täglichen Bestellungen aufgab. Sicher – das hätte er einfacher haben können. Bei einem Kunden wie dem Präsidenten wäre wahrscheinlich jeder Händler bereit gewesen, bis zur Haustür zu liefern. Für William aber waren die täglichen Einkäufe eine willkommene Ablenkung von der ermüdenden Routine. So hatte er die Chance, sich aus den immer gleichen Abläufen zu lösen, und wurde das Gefühl los, dass die Monotonie ihn erstickte. Ohne Frage, er war dankbar, dass Marcus ihm diese Anstellung verschafft hatte. Es war ein Privileg und der Dank für Wills jahrelange Treue. Auch wenn es der Union im Allgemeinen gut ging, konnte man es wirklich schlechter treffen, als Leibwächter der Präsidentenfamilie zu sein. Vier Jahre war es her, seit Marcus ihm die Stelle angeboten hatte. William war damals gerade zum Offizier in der neuen Unionsarmee aufgestiegen, hatte sein erstes Kommando. Eine vielversprechende Laufbahn stand ihm bevor und dennoch hatte er sich dagegen entschieden und das Angebot angenommen. Yard war seine Heimat. Hier war er geboren, hier war er groß geworden. In seinem ganzen Leben war er nie mehr als nur ein paar Kilometer von der Stadt entfernt gewesen. Er hatte die Höhen und die Tiefen der Stadt erlebt, hatte in der Schlacht um Yard gegen Banners Armee gekämpft und sah nun, wie sein Geburtsort sich veränderte. Das alles aber hinter sich lassen wollte und konnte er nicht. Auf eine seltsame Art und Weise fühlte er sich mit diesem Ort verbunden und allein der Gedanke, die Stadt zu verlassen, bereitete ihm Magenschmerzen. Genau das aber war es, was ihn als Offizier erwartet hätte. Dienst in irgendeiner kleinen Siedlung irgendwo in der Union. William war froh, dass Marcus ihm mit seinem Angebot die schwere Entscheidung abgenommen hatte.
Es dauerte etwa eine Stunde, bis sie ihre Bestellungen zusammen hatten. An den Ständen waren er und die Kinder herzlich begrüßt worden. Ein paar freundliche Sätze ohne Tiefgang. William lachte und scherzte mit den Händlern, gab seine Bestellungen auf. Bei den Gängen auf den Markt wurden im Großen und Ganzen die täglichen Bedürfnisse gedeckt: Er bestellte Rindfleisch bei einem der Händler, Mehl und Mais beim nächsten. An einem der Stände konnte er eine Ladung frischer Kürbisse ergattern, an anderer Stelle ein paar Äpfel. Und bei einem Händler fand er sogar die wahrscheinlich letzten Melonen dieses Sommers. Obwohl wenn sie recht klein waren und neben den anderen Waren auf dem Tresen kümmerlich wirkten, schlug er zu, denn er wusste, wie sehr Clara dieses Obst mochte.
Wie bei jedem Besuch auf dem Markt hielt er bei Crowley’s. Eine Garküche am Rande des Markts, untergebracht in einem großen Container aus der Zeit DAVOR. Die grüne Lackierung war an vielen Stellen abgeplatzt und Rost sprenkelte die Wände. Eine der Seitenwände des Containers war auf halber Höhe entfernt worden, wobei ein großer Tresen entstanden war. Der Laden gehörte Marv, einem Veteranen aus der Schlacht um Yard, der damals bei der Belagerung drei Finger der linken Hand verloren hatte, trotzdem aber ein ausgezeichneter Koch war. Seine Gäste nannten ihn zumeist Crowley, was nicht etwa ein obskurer Spitzname war, denn in verblichenen Lettern stand genau das auf dem Container. Marv hatte einfach die Not zur Tugend gemacht und den Namen beibehalten. Die Gerichte, die er Tag für Tag anbot, waren einfach, aber wohlschmeckend. Der Veteran hatte den Bereich vor seinem Tresen mit gestapelten Autoreifen vom Trubel der Marktstände abgegrenzt. Das schaffte Intimität. Das Crowley’s war eine kleine Oase inmitten des hektischen Treibens und gerade deshalb so beliebt. Vor dem Container lagen ein paar verwitterte Kabeltrommeln, die den Gästen als Tische dienten und an denen sie wiederum auf alten Reifen Platz nehmen konnten.
William bahnte sich seinen Weg zu einem der Tische, während er das stumme, aber freundliche Winken des Veteranen hinter dem Tresen erwiderte. Behutsam setzte er die beiden Kinder ab und streckte sich einmal, lockerte die Schultern. Eine kleine Pause war jetzt genau das, was er brauchte.
„Wartet hier einen Moment, ich bin gleich wieder da!“, meinte er mit erhobenem Zeigefinger in Richtung der Kinder und schlenderte, sich seine Schultern massierend, hinüber zum Tresen.
„Haben sie dir heute gleich zwei Bälger aufs Auge gedrückt, Ashton?“, grinste der untersetze Mann hinter dem Tresen. Seine Zähne waren gelb und schief.
„Warum spricht mich heute eigentlich jeder darauf an, Marv?“ William schüttelte den Kopf und stützte sich auf den Tresen.
„William Ashton! Schau dich doch einfach an! Du bist groß und kräftig, in deinen besten Jahren. Du siehst so aus, als würdest du mit den Leuten, die dich schief ansehen, den Boden wischen. Da passen Kinder einfach nicht ins Bild, weißt du?“
„Womit habe ich denn diese Komplimente verdient?“
„Ich habe ’nen guten Tag. Freu dich einfach drüber. Was kann ich dir bringen?“
Gekünstelt rümpfte William die Nase und lächelte spöttisch. Mit einem Kopfnicken deutete er auf den großen Topf über der Feuerstelle.
„Was auch immer da drin ist und so stinkt, alter Freund. Was ist es heute? Warte! Lass mich raten: Bohnen und Mais mit ein bisschen Fleisch dazwischen?“
„Ganz falsch, Will! Heute biete ich die Spezialität des Hauses an: Mais mit Speck und Bohnen!“
Die Männer lachten auf.
„Siehst du, Marv, deshalb komme ich so gerne hierher. Die Abwechslung, die du bietest, kann ich ansonsten nirgendwo in dieser Stadt finden.“
Marv schnitt eine Grimasse und murmelte tonlos eine derbe Verwünschung, dann war er schon dabei, drei Portionen zu bereiten. Er meinte es gut mit seinem Stammgast, jeder der Näpfe war bis zum Rand gefüllt, ohne die kleinen Mägen der Kinder zu beachten.
„Danke“, meinte Will und schob dem Veteranen drei Patronen über den Tresen.
„Stimmt so, William“, sagte Marv, nahm zwei Patronen und schob eine zurück. „Macht es euch bequem und lasst es euch schmecken.“ Marv warf einen Blick nach links und rechts, nickte zufrieden und wischte sich seine Hände an der speckigen Schürze ab.
„Getränke gehen auf mich. Setz dich schon mal, ich bin gleich bei euch.“
Will stellte die dampfenden Schüsseln vor die Kinder, die zuerst etwas argwöhnisch darin stocherten, dann aber mit kleinen Bissen zu essen begannen. Er selbst hatte gerade einige Löffel gegessen, als Marv mit einer alten Kanne und ein paar Plastikbechern zu ihrem Tisch herüberkam.
„Und, wie läuft das Geschäft, Marv?“
Der Veteran kratzte sich mit den verbliebenen Fingern der linken Hand die Bartstoppeln und wiegte den Kopf hin und her: „Wie immer. Eine alte Weisheit hat heute noch Bestand. Es gibt zwei Dinge, die die Menschheit immer tun wird, egal was kommen mag: essen und sterben. Insofern habe ich ein gutes Auskommen. Und vor allem kein schlechtes Gewissen, weil ich den Leuten Holzkisten verkaufe.“
„An dir ist ein Poet verloren gegangen“, stelle William fest und nahm einen Schluck aus dem Plastikbecher.
„Und an dir offensichtlich ein Kindermädchen.“
„Du wirst nicht müde, diesen Witz zu wiederholen, was?“
„Nein. Sag mal, irre ich mich oder ist das …“, begann der Veteran und deutete ungeniert auf Arleen, die dem Koch einen fragenden Blick zuwarf.
„Ja. Das ist die Tochter des Generals. Wenn ich vorstellen darf: Arleen!“
Marv legte ein freundliches Lächeln auf und tätschelte dem Mädchen den Kopf: „Ich bin erfreut über diesen hohen Besuch.“ Er schnitt eine Grimasse in Joshuas Richtung, die der Junge mit einem fröhlichen Glucksen quittierte. „Und über den Sohn des Präsidenten freue ich mich natürlich auch.“
Während Will sich bemühte, seine Schüssel zu leeren, unterhielt der Koch die beiden Kinder mit einigen Grimassen und Witzen. Arleen und Joshua hatten es irgendwann aufgegeben, die viel zu großen Portionen essen zu wollen, und genossen das Schauspiel des gutmütigen Veteranen.
Mit einem deutlich hörbaren Rülpsen beendete William seine Mahlzeit, klopfte sich mit der Faust gegen die Brust, wischte sich den Mund ab und schob die Schüssel von sich weg. Die Kinder kicherten über die Zurschaustellung seiner schlechten Manieren.
„Offenbar hat es geschmeckt“, bemerkte Marv.
„Immer. Ansonsten wäre ich nicht so oft hier.“
„Sag mal, siehst du unseren Präsidenten heute noch?“, fragte Marv, während er das Geschirr zusammenschob.
„Ich habe gewusst, dass du dich nicht aus reiner Nettigkeit einfach zu uns setzen wirst, du alter Gauner!“ William verdrehte gespielt die Augen. „Schon möglich. Was liegt dir denn auf dem Herzen, womit ich ihn belästigen soll?“
„Nein, nein!“, der Veteran hob abwehrend seine Arme. „Es liegt ja nicht direkt mir auf dem Herzen. Es gibt da nur was, das er vielleicht wissen sollte.“
„Mach es nicht so spannend, alter Mann …“
„Also, es gibt doch die Planungen, den Tauschhandel im nächsten Jahr abzuschaffen.“
„Ja. Das ist sein letztes Glanzstück vor der Wahl, wenn du so willst. Was ist damit?“
„Es gibt ein paar Händler, die damit nicht zufrieden sind.“
„Das ist nichts Neues. Die Händler sind allesamt nur auf ihren Profit aus und sehen, wie der geschmälert wird, wenn es eine Währung gibt. Vor allem die, die von außerhalb der Union kommen, oder die, die seltenes Zeug verkaufen, haben wohl Angst, nicht mehr so schnell wie früher reich zu werden. Seitdem sein Vorschlag im Unionsrat debattiert wird, gibt es diese Bedenken.“ William zuckte mit den Schultern.
„Und was glaubst du?“
„Ich?“, fragte Will ehrlich erstaunt. „Ich bin weder Politiker noch Händler und kann das nur schwer bewerten. So wie ich es bisher verstanden habe, ist eine gemeinsame Währung für die Bürger der Union ein Vorteil. Für einige Händler wahrscheinlich auch – vor allem für die, die sich nur in der Union bewegen. Ich meine, Geld mich sich herumzutragen ist viel einfacher als Tonnen von Tauschwaren. Es macht Geschäfte verlässlicher. Du weißt doch, wie es jetzt ist. Ein Händler hat was im Angebot, das du gerne kaufen willst. Du bietest ihm etwas zum Tausch an. Wenn der Kerl das, was du tauschen willst, aber schon im Überfluss hat und weiß, dass er dafür keine Kunden bekommen wird, gehst du leer aus. Geld ist da viel einfacher einzusetzen.“
„Hm“, murmelte Marv nachdenklich. „Aber hier in Yard tauschen wir doch eigentlich schon immer nur gegen Medikamente und Munition. Ist das nicht genau das Gleiche?“
„Ich glaube, Geld kannst du weder verschießen noch gegen Krankheiten schlucken. Verstehst du? Die Dinger funktionieren bisher ja gut, aber es sind Verbrauchsgüter. Was ist denn, wenn alle Medikamente aus der Zeit DAVOR aufgebraucht sind?“
Der Koch schien nicht überzeugt, verkniff sich aber weitere Kommentare. Mit unverständlichem Gemurmel räumte er das Geschirr ab und stellte es auf den Tresen. Er stützte sich mit beiden Armen auf den Tisch, als er zurückkam, und sprach leise weiter: „Ich wollte es doch nur anmerken, Ashton. Es gibt genügend Leute in der Union, denen der Vorschlag nicht schmecken könnte.“
William zog die Augenbraue hoch. „Was soll das sein? Eine Warnung?“
„Pass einfach auf dich auf“, sagte Marv und klopfte seinem Freund zum Abschied auf die Schulter. Er drehte sich um und ließ den Leibwächter mit einem mulmigen Gefühl im Magen sitzen.
In den nächsten zwei Stunden ging es um die Bestellungen, die nicht alltäglich waren. William marschierte mit den Kindern zu den unterschiedlichsten Händlern, um zu finden, was ihm aufgetragen worden war. Da ging es um eine Uhr, die Clara ihrem Mann zum Geschenk machen wollte, um neues Spielzeug für Joshua und um neues Essbesteck. Bei diesen Dingen lohnte es sich, die Händler immer wieder abzugehen. Bestellungen, wie bei den Lebensmitteln, waren in solchen Fällen schwer möglich, man musste einfach im richtigen Moment an der Auslage stehen. Nachdem sie zumindest beim Essbesteck fündig geworden waren, beschloss Will, die anderen Bestellungen bei den nächsten Besuchen abzuhandeln, und schlug den Heimweg ein.
Ein Poltern in der Menschenmasse vor ihnen riss William aus seinen Gedanken und ließ ihn zusammenzucken. Angestrengt versuchte er zu erkennen, was geschehen war, konnte aber kaum mehr als die Hinterköpfe seiner Vordermänner entdecken. Der langsam voranschreitende Menschenstrom war zum Erliegen gekommen und über die bunte Geräuschkulisse des Marktes legte sich ein vielstimmiges Gemurmel, das laute Flüche begleiteten. Erfolglos versuchte der Leibwächter, sich auf die Zehenspitzen zu stellen und ein besseres Bild zu bekommen.
„Kinder, was ist da los?“, fragte er Joshua und Arleen, die auf seinen Schultern hockten.
Die beiden reckten ihre Hälse und blickten angestrengt über die Köpfe hinweg.
„Da ist ein Karren umgestürzt!“, stelle Joshua fest.
„Ja! Und die Leute streiten miteinander!“, präzisierte Arleen.
William stöhne missmutig. „Sieht es so aus, als kämen wir durch?“
Die Kinder schienen sich einen Moment uneinig, dann schüttelten sie den Kopf. „Nein, der ganze Weg ist blockiert.“
„Toll!“, murrte Will und wandte sich in eine andere Richtung.
Der Menschenstrom war jetzt wieder in Bewegung gekommen und suchte sich seinen Weg an dem verunfallten Gespann vorbei. Der Leibwächter hatte kaum eine andere Wahl, als sich mit den Kindern auf seinen Schultern mit dem Strom treiben zu lassen, selbst wenn es einen Umweg bedeutete. Eingezwängt zwischen keifenden Marktbesuchern tat er sein Bestes, einen Weg vom Gelände zu finden.
Unvermittelt spürte William etwas Hartes in seinem Rücken, dann knallte es laut. Schmerz explodierte und mit einem abgerissenen Schrei ging der stämmige Leibwächter in die Knie. Noch bevor er den Boden berührt hatte, spürte er einen Fuß im Rücken, der ihm endgültig das Gleichgewicht nahm und der Länge nach hinschlagen ließ. Über die nervösen Aufschreie der Marktgänger hörte er die gellenden, ängstlichen Stimmen der Kinder, die vor ihm in die Menge stürzten. Will landete mit dem Gesicht im Dreck, während Menschen um ihn herum auseinanderstoben. Er versuchte, in die Höhe zu kommen, und realisierte den pochenden Schmerz in Seite und Rücken und sogleich den Geschmack von Eisen im Mund. Sein rechter Arm versagte ihm kraftlos den Dienst und stöhnend rollte er sich auf die Seite, stemmte sich mit aller Kraft in eine sitzende Position. Seine Umgebung nahm er nur verschwommen wahr, alle Geräusche verzerrt, wie in einem schlechten Traum. Nur war das hier die Realität, aus der er nicht im letzten Moment aufwachen konnte. Mühevoll kam er auf die Beine und zerrte ungelenk seine Pistole aus dem Holster. Mittlerweile waren die Menschen vollends zurückgewichen. Er stand allein, doch von den Kindern keine Spur. Während sein Blick sich trübte und die Umgebung zu tanzen begann, wandte er sich taumelnd von der einen zur anderen Seite, suchte ein Zeichen der beiden Kinder. Von rechts donnerte ein zweiter Schuss und riss ihn mit aller Macht von den Beinen. William registrierte lediglich den Treffer, nicht aber den Schmerz. Erneut schlug er hart auf, verlor seine Pistole. Rauschen breitete sich in seinen Ohren aus und Dunkelheit tanzte an seinem Sichtfeld. Verschwommen konnte er einen Schatten entdecken, der sich über ihm aufbaute.
Ein Blitz.
Ein Knall.
Schwärze.
+++
Stille war im Saal des Unionsrats eingekehrt, als Marcus sich erhob und zum Rednerpult humpelte. Wie an jedem anderen Tag trug er eine nahezu makellose Uniform, deren silberne Knöpfe im Licht schimmerten. Sein linker Arm hing schlaff herab, während er sich mit der rechten Hand auf einen schmucklosen Gehstock stütze. Die linke Hälfte seins Gesichts war von wulstigen Narben übersät und eine schwarze Augenklappe bedeckte sein Auge auf dieser Seite. Trotz der alten Narben machte er keinen mitleidserregenden Eindruck. Marcus hatte schon früh gelernt, sich von seinen Verletzungen nicht behindern zu lassen. Er hielt den Rücken gerade und strahlte Würde aus.
Es dauerte einige Momente, bis er das Rednerpult erreicht hatte. Ohne sich aus der Ruhe bringen zu lassen, nahm er einen letzten Zug von der Zigarre und legte sie in den bereitgestellten Aschenbecher. Seine Hand prüfte noch einmal den Sitz der Uniform und strich die halblangen, graumelierten Haare glatt. Er sog hörbar die Luft ein.
Die anwesenden Ratsmitglieder betrachteten ihren Präsidenten erwartungsvoll. Einige von ihnen waren schon lange Teil dieses Gremiums und hatten sich zu waschechten Bürokraten entwickelt, andere hatten erst seit einigen Monaten einen Sitz im Unionsrat. Das Prozedere war einfach: Wenn eine Gemeinde sich der Union anschloss, erhielt sie das Recht, einen Posten im Unionsrat zu besetzen. Damit sollte sichergestellt werden, dass alle Interessen des Staatengebildes bestmöglich vertreten wurden. Das Problem war nur: Je größer die Union wurde, umso mehr Bürokratie war nötig. Der Unionsrat schwoll immer weiter an und plötzlich mussten Gremien geschaffen werden, die sich mit vielfältigen Fragen auseinandersetzten. Es war die schwierige Geburt einer Demokratie.
In der Welt DANACH hatte es Ähnliches über Jahrzehnte nicht gegeben, zumindest nicht in diesem Ausmaß. In ihrer Entwicklung war die Union einzigartig – und das machte es so kompliziert. Nirgends gab es ein Vorbild, ein Modell, an dem man sich hätte orientieren können. Je größer die Union wurde, umso vielfältiger wurden die Ansprüche und Forderungen der einzelnen Mitglieder. Manchmal war es ein schwerer Kampf, alles unter einen Hut zu bekommen. Und eines war klar: Allen konnte man es nie Recht machen.
„Verehrte Ratsmitglieder!“, hob er über die Stille an. „Ich möchte heute zu Ihnen über ein Thema sprechen, das in den letzten Wochen und Monaten für Aufregung gesorgt hat. Wie Sie wissen, habe ich die Einführung einer allgemeingültigen Währung für die Union angeregt. Der Gedanke dazu war niemals aus der Not geboren oder nicht bis in die letzte Konsequenz bedacht – es ist schlichtweg der nächste logische Schritt in der Weiterentwicklung der Union.“
Marcus ließ seinen Blick über die Zuhörer schweifen und einige Augenblicke vergehen, bevor er weitersprach.
„Hier in Yard hat die Union, wie wir sie heute kennen, ihren Ursprung genommen. Wir haben damals begonnen mit einer Idee, mit einer Vision, einem Trümmerhaufen und einigen tausend Menschen, die durch einen gemeinsamen Feind nach Jahrzehnten des Blutvergießens zusammengeschweißt wurden. Die Parole damals wie heute lautete ‚Einigkeit‘! Diese Einigkeit hat uns stark gemacht und das Wachstum der vergangenen sieben Jahre begründet. Jetzt stehen wir vor dem nächsten Schritt, unsere Einigkeit zu stärken, und Zweifel kommen auf. Ist diese Entscheidung die richtige? Gibt es vielleicht mehr Nach- als Vorteile bei einer gemeinsamen Währung? Jeder von Ihnen wird sich diese Fragen gestellt haben. Unabhängig von der Fragestellung kann ich Ihnen eine Gewissheit schon jetzt geben: Diejenigen, die gezweifelt haben, haben es in der Welt DAVOR nicht weit gebracht und werden es auch in der Welt DANACH nicht weit bringen!“
Der Präsident hatte beschwörend die rechte Faust gehoben und verharrte einen Sekundenbruchteil in dieser Pose.
„Der komplette Handel der Union basiert im Moment auf dem Prinzip des Tauschens. Das hat erhebliche Nachteile. Niemandem kann vor einem Geschäft klar sein, ob es wirklich zum Abschluss kommt. Hat der Händler schon genug von dem, was ich ihm anbiete, wird er nicht mit mir tauschen wollen. Mein Nachbar aber, der vielleicht genau das besitzt, was den Händler interessiert, der bekommt den Zuschlag. Das ist völlig irrsinnig! Und es geht dabei nicht einmal nur um die Bürger der Union, sondern auch um die Händler. Es ist umständlich, mit unzähligen Tauschwaren von A nach B zu reisen, noch dazu, wenn das alles rein spekulativ ist. Vielleicht sind einem Händler in der einen Siedlung Felle als Tauschwaren angeboten worden. Nun hat er davon eine ganze Ladung und zieht in die nächste Siedlung. Dort gibt es aber schon genug davon und er bleibt auf seinen Waren sitzen. Den zusätzlichen Aufwand, die zusätzlichen Wachen, die er anheuern muss, und das Lasttier, das vielleicht nötig ist, die kann er als Verlust abschreiben. Das kann doch nicht im Interesse des Händlers sein!“
Einige der Zuhörer reagierten mit Kopfschütteln und Gemurmel, aber Marcus war noch lange nicht fertig mit seiner Ansprache. Und er war nicht gewillt, sich das Rederecht untergraben zu lassen.
„Und wenn wir ehrlich sind, gibt es das Prinzip einer Währung doch schon längst. Seit Jahrzehnten scheint es üblich zu sein, Medikamente oder Munition als Zahlungsmittel zu nutzen. Der Grund liegt doch auf der Hand: Jeder kann damit etwas anfangen – aber nicht jeder hat in gleichem Maße die Möglichkeit, an diese Güter zu kommen! Darin liegt wieder einmal die Ungerechtigkeit. Was ist denn mit all den kleinen Siedlungen, die nicht über genügend Vorräte gewisser Waren verfügen? Sie werden von den Händlern ausgespart und nicht beliefert! Lehnen wir also die Einführung einer gemeinsamen und verbindlichen Währung für alle Mitglieder der Union ab, schnüren wir diesen Gemeinden langsam, aber sicher die Luft zum Atmen ab. Und dazu haben wir kein Recht! Und damit nicht genug: Munition und Medikamente sind Verbrauchsgüter. Was ist denn, wenn irgendwann nicht mehr genügend Tabletten aus der Zeit DAVOR vorhanden sind? Oder wenn sie so alt sind, dass sie nichts mehr nützen? Dann werden wir uns zwangsläufig Gedanken darum machen müssen, wie es weitergehen soll. Wir haben aber schon jetzt die Möglichkeit, die Weichen für die Zukunft zu stellen, so dass uns das Problem nicht betrifft. Warum also warten?“
Zufrieden bemerkte Marcus, dass vor allem jene Ratsmitglieder, die aus kleinen Ortschaften kamen, ihm zustimmend zunickten. Sie kannten die Probleme, die er beschrieben hatte, nur zu gut. Er nahm einen Schluck Wasser und fuhr fort: „Und ich kenne all Ihre Einwände! Sie werden sich fragen, wie sich eine Währung reguliert. Wie werden Preise festgelegt, wie wird sichergestellt, dass die Menschen nicht ein Vermögen für etwas ausgeben, was viel weniger Wert ist? Die Antwort darauf ist einfach: Der Markt wird sich selbst regulieren. Angebot und Nachfrage werden die Preise bestimmen und jeder Händler, der im Geschäft bleiben will, muss seine Angebote so gestalten, dass sie auch gekauft werden. Macht er es nicht, kann er seinen Laden schließen! Und es gibt Skeptiker unter Ihnen, die die Idee vielleicht gut finden, aber mit Recht fragen, wie sicher die Währung ist. Ob es nicht für irgendjemanden leicht wäre, unsere Zahlungsmittel zu fälschen. Ich kann dazu sagen: Dank der Mithilfe des Instituts bin ich der Überzeugung, Zahlungsmittel geschaffen zu haben, die sehr sicher sind. Von einer absoluten Sicherheit kann natürlich niemand sprechen, denn das ist unmöglich. Aber ganz ehrlich: Falsche Patronen oder Medikamente sind schon immer verwendet worden, um Händler und Kunden zu täuschen. Das kann also kein Argument gegen eine Währung sein.“
Der Präsident gab seinen Zuhörern Zeit, das Gesagte sacken zu lassen, und nahm unterdessen einen langen Zug von der Stumpenzigarre.
„Ich bitte Sie daher, heute genau abzuwägen, wie Sie Ihre Stimme einsetzen werden. Ich bin der festen Überzeugung, dass Sie alle in Ihrem Innersten wissen, welche Wahl die richtige ist. Nicht nur für sich oder Ihre Heimat allein – sondern für die Union, unser aller Heimat! Ich bitte sie, meinen Antrag zu unterstützen, denn er bedeutet Gerechtigkeit, Sicherheit und Stabilität für das Jetzt und die Zukunft. Danke.“
Damit deutete Marcus eine knappe Verbeugung an, griff nach seinem Gehstock und humpelte zu seinem Platz zurück. Unter den Ratsmitgliedern erscholl währenddessen der erste Applaus. Der Präsident registrierte das Klatschen und die ermunternden Zurufe und reagierte mit einem knappen Lächeln. Es war nicht seine Art, sich im Erfolg zu baden, während das Ziel noch nicht erreicht war. Aus dem Augenwinkel konnte er entdecken, wie seine Worte einige der Unentschlossenen mitgerissen und auf seine Seite gebracht hatten. Dennoch, es würde ein zähes Ringen werden. Während er sich in den Ledersessel sinken ließ, wurde der nächste Redner aufgerufen.
„Es gibt eine Gegenrede zu Präsident Tailors Ausführungen. Es spricht nun: Nigel Sumter, Repräsentant der freien Händler in der Union.“
Marcus lehnte sich zurück und beobachtete, wie der Genannte unter dem Beifall seiner Unterstützer aufstand und zum Rednerpult schritt. Sumter war ein hochgewachsener und dürrer Mann in den Vierzigern. Er entsprach so gar nicht dem Klischee des wohlgenäherten Händlers, sondern hinterließ viel mehr den Eindruck, schon bei der ersten Windböe Gefahr zu laufen, Knochenbrüche zu erleiden. Dieser erste Eindruck konnte trügen, denn tatsächlich hatte Sumter sich in den vergangenen Jahren einen Ruf als zäher politischer Gegner und besonnener Taktiker erarbeitet. In der Welt DAVOR wäre er wahrscheinlich der Prototyp eines Politikers gewesen. Seine Kleidung war immer eine Idee zu ordentlich, wirkte aber einschüchternd auf Beobachter. Allein das trug dazu bei, dass man sich in der Nähe des Händlers deplatziert und unwohl fühlen konnte. Sumter hatte einen scharfen, alles durchdringenden Blick, der in den meisten Fällen ausreichte, um den politischen Gegner zum Schweigen zu bringen. Er hatte das Pult erreicht und legte seine Notizen akribisch vor sich ab, rieb sich einmal seine feingliedrigen Hände, als wäre ihm kalt, und begann mit deutlicher Stimme: „Ich danke Präsident Tailor für seine Ausführungen. Sie waren erhellend. Aber: Ich bitte Sie, verehrte Ratsmitglieder, sich nicht gleich von seinen Worten mitreißen zu lassen! Das, was unser Präsident da plant, ist weit diffiziler, als seine einfachen Worte es auszudrücken vermögen. Die Zusammenhänge sind nicht so einfach, wie er uns glauben lassen will.“
Von der Seite kam eine Offizierin schnell an Marcus heran. Allein ihre Schrittgeschwindigkeit war ihm ein Hinweis auf die Dringlichkeit dieser Unterbrechung. Trotzdem, wenn er eines nicht gutheißen konnte, waren es Unterbrechungen, gerade bei so wichtigen Debatten wie im Moment. Sein Kopf fuhr herum und mit seinem verbliebenen, gesunden Auge musterte er die Frau scharf. Sie bemühte sich nicht einmal, Haltung anzunehmen, sondern beugte sich in einer raschen Bewegung hinunter zu ihm und flüsterte ihm etwas zu. Als sie fertig war, blinzelte Marcus sie ungläubig an, doch sie nickte nur. Marcus rang mit seiner Fassung, ließ er seine flache Hand auf den Tisch klatschen. Das laute Geräusch ließ den Redner unterbrechen und zahlreiche Augenpaare wanderten fragend in Richtung des Präsidenten. Hastig stemmte der sich hoch, atmete unkontrolliert. Sein Gesicht war aschfahl.
„Entschuldigung. Die Sitzung und die heutige Abstimmung sind bis auf Weiteres unterbrochen.“
Ohne ein Wort der Erklärung wandte Marcus sich um und humpelte aus dem Sitzungssaal, ließ die Anwesenden ratlos zurück. Als die massiven Flügeltüren sich hinter ihm schlossen, schwoll ein vielstimmiges Murmeln unter den Ratsmitgliedern an.
+++
„Eine Entführung? Das ist ein direkter Angriff auf ihn.“
Sal sah nachdenklich aus dem großen Fenster in Richtung der großen Ratshalle in der Ferne. Eris nickte bestätigend. Er trug die Haare mittlerweile kurz und sein stoppeliger Bart war seit einigen Jahren glattrasierter Haut gewichen.
„Absolut. Und es geht ja nicht nur um Marcus. Sie haben auch Arleen.“
„Aber warum?“ Sal wandte sich zu ihrem Mann. In ihrem Gesicht war eine Mischung aus Angst, Stress und Nervosität zu entdecken. Als Mutter konnte sie erahnen, was es für Eltern bedeutete, wenn ihre Kinder entführt wurden. Eris legte die Stirn in Falten und sch nachdenklich sein Kinn nach vorne.
„Sie wollen Druck auf ihn ausüben.“
„Sie? Wer sind denn ‚die‘, Eris? Du redest so, als wüsstest du genau, wer dafür verantwortlich ist.“
Er blickte sie an und schüttelte den Kopf. „Ich habe keine Ahnung. Es sind nur Vermutungen, mehr nicht. Marcus wollte heute seinen Antrag auf die Einführung einer gemeinsamen Währung durchbringen. ’ne knappe Geschichte, aber ich glaube, er hätte das Rennen gemacht. Er hat sich mit dieser Idee nicht unbedingt Freunde gemacht, weißt du?“
„Und wer soll dahinter stecken?“
Eris zuckte mit den Schultern. „Die freien Händler haben bisher am meisten Widerstand geleistet. Sie haben durch die Einführung am meisten zu verlieren. Es gibt ein paar Gemeinden in der Union, die strikt gegen die Einführung sind. Ich kann mir vorstellen, dass sie bereit wären, zu einer Entführung zu greifen.“
Sal war nicht überzeugt. Sie schüttelte den Kopf und ging einige Schritte zur Zimmertür, hielt inne. Durch das Holz konnte sie hören, wie ihre beiden Söhne auf der anderen Seite spielten. Erleichterung durchströmte sie.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!