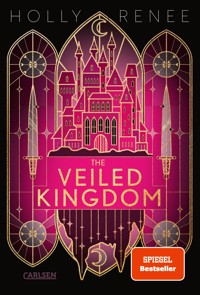
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Sie kann niemandem vertrauen – weder ihrem König, noch ihrem Herzen Nyra lebt in ständiger Angst. Als Tochter eines brutalen Königs ist ihr ganzes Leben geprägt von ständigem Machtstreben und sinnloser Gewalt. Und weil Nyra nie die magischen Kräfte entwickeln konnte, die für ihre Rolle als Erbin unabdingbar sind, muss sie mit dem Schlimmsten rechnen. Während eines Überfalls auf den Königspalast, ergreift sie ihre Chance und flieht in die dunklen Slums von Marmoris. Jetzt muss sie sich den Menschen anschließen, die alles bekämpfen, wofür ihr Vater steht. Verzweifelt versucht Nyra, ihre wahre Identität zu verschleiern, doch der charismatische und gefährliche Rebellenanführer Dacre durchschaut sie – und nutzt ihre Abhängigkeit für seine Zwecke. Gefangen in einem gefährlichen Geflecht aus Leidenschaft, Verrat, Gewalt und magischer Energie, wird Nyras Loyalität auf eine harte Probe gestellt. Wird sie kämpfen – oder alles opfern, was sie beschützen will? Intensiv, morally grey und voller Leidenschaft: The Veiled Kingdom entführt in eine Welt, in der Liebe tödlich, Magie unberechenbar und Loyalität eine Illusion ist. Der Auftakt einer knisternden Romantasy-Trilogie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Holly Renee
The Veiled Kingdom
Aus dem Englischen von Dorothee Witzemann
Gefangen zwischen einer Rebellion und der Herrschaft eines Tyrannen
Nyra ist auf der Flucht vor dem grausamen König von Marmoris – ihrem Vater! Dass sie dabei in ständiger Gefahr schwebt, nimmt sie in Kauf. Allerdings darf niemand erfahren, wer sie in Wahrheit ist. Vor allem nicht die Rebellen, die sie unterwegs aufgreifen und zwingen, sich ihrer Sache anzuschließen. Doch je besser sie die Gruppe und ihre Ziele versteht, desto größer wird Nyras innere Zerrissenheit: zwischen der Loyalität zu ihrem Königreich und ihrem neuen Verständnis für den Aufstand gegen die tyrannische Herrschaft ihres Vaters – und da ist dann noch das, was Dacre, der Sohn des Rebellenführers, in ihr auslöst. Er zeigt ihr, dass Liebe und Hass zwei Seiten derselben Klinge sind.
Wohin soll es gehen?
Vorbemerkung
Karte
Buch lesen
Content Note
Danksagungen
Über die Autorin
Für Amber Palmer –
Danke für deine unendliche Unterstützung und Freundschaft.
VORBEMERKUNG
Liebe Leserin, lieber Leser,
dieser Roman enthält potenziell triggernde Inhalte. Aus diesem Grund befindet sich hier ein Hinweis darauf. Am Romanende findest du eine Themenübersicht, die Spoiler enthält.
Entscheide bitte für dich selbst, ob du diese Warnung liest. Gehe während des Lesens achtsam mit dir um. Falls du auf Probleme stößt und/oder betroffen bist, bleibe damit nicht allein. Wende dich an deine Familie und an Freunde oder suche dir professionelle Hilfe.
Wir wünschen dir alles Gute und das bestmögliche Erlebnis beim Lesen dieser besonderen Geschichte.
KAPITEL 1
NYRA
Unter meinem dünnen Umhang rann mir der Schweiß an der Wirbelsäule herunter.
In der Luft lag noch eine leichte Kühle, doch der Anblick des Wächters, der mit seiner Pranke am Schwertgriff am Ende der Brücke stand, brachte mein Herz zum Rasen, wenn ich an mein Vorhaben dachte.
Ich holte tief Luft und ließ das geschäftige Treiben in der Marktgasse auf mich wirken. Der Geruch nach Rauch und salzigem Fisch stach mir in die Nase, aber er konnte weder den Gestank der Slums noch der schwitzenden Körper überdecken, die sich an mir vorbeidrängten.
Meine dunklen Haare warf ich über meine Schulter, während ich mich durch die Menge schob, um so weit wie möglich von dem Wächter wegzukommen.
Ganz kurz sah ich zu dem Palast und dem Eisentor, das ihn von der belebten Brücke trennte.
Die große Brücke des Königreichs Marmoris war ein legendärer Ort.
Zumindest wollte das der König gern alle anderen glauben machen.
Mein verräterischer Blick wanderte am Palast hinauf zu meinem ehemaligen Zimmer. Das Fenster befand sich so weit oben, dass ich direkt darüber eine der Fahnen meines Vaters im Wind flattern sehen konnte.
Und es lag so hoch, dass niemand hineinschauen konnte, sodass ich dort jederzeit sicher war.
Dachte ich.
In Wahrheit war es gerade hoch genug, dass niemand die machtlose Erbin sehen konnte, die Schande des Königs.
Viel zu lange hatte ich seine Scham irrtümlich für Wachsamkeit gehalten. Als ich zehn Jahre alt wurde und immer noch kein Funke Magie zu erkennen war, gaben meine Eltern die Hoffnung auf, dass ihre Thronerbin die gleichen Mächte besitzen würde. Auch heute konnte ich mich noch gut an die Furcht und Sorge in ihren Gesichtern erinnern, als sie mir erklärten, dass wir dieses Geheimnis für uns behalten müssten. Aber diese Sorge starb lange vor meiner Mutter. Mein Vater hatte das Interesse an mir verloren, zurück blieb nur Feindseligkeit.
Der riesige Wasserfall unter der Brücke rauschte so laut, dass ich die gedämpften Gespräche um mich herum kaum hören konnte. Ich versuchte, angestrengt zu horchen, aber mehr als den Austausch von Münzen und Geschäfte im Flüsterton, die nicht für fremde Ohren bestimmt waren, konnte ich nicht verstehen.
Eine Brise vom Meer her ließ mir die Haare um die Schultern wehen, und ich atmete tief ein. Jedes Mal, wenn der Wind einen vertrauten Geruch herantrug, wurde ich von bittersüßen Erinnerungen überschwemmt – hin- und hergerissen zwischen Nostalgie und Verbitterung.
Ich schaute über das Wasser zu dem Dutzend Schiffe hinaus, die gerade beladen wurden. Wenn ich daran dachte, wie ich sie früher beobachtet und davon geträumt hatte, selber die Segel zu setzen und mich vom Wind davontragen zu lassen, weg von diesem Ort, dann schmerzte mein Magen vor Sehnsucht.
Jedoch schmerzte mein Magen in letzter Zeit immer.
Ich gab mir einen Ruck und schlängelte mich zwischen den abgenutzten Wagen durch, bis ich an dem Händler vorbeikam, der mich immer anstarrte, und lächelte ihn an, als er lüstern grinste.
Mehr brauchte ich nicht.
Er schaute auf die Rundung meiner Brüste, und ich nahm die Hände hinter den Rücken.
Wenn er meine Kurven angaffte, hatte er keine Zeit, meine Hände zu beobachten.
»Guten Tag, du«, sagte er, bevor er sich über die Unterlippe leckte, die durch seinen wuchernden, ergrauenden Bart kaum sichtbar war.
»Tag«, rief ich freundlich zurück und zog den Kopf ein, damit er sah, wie schüchtern ich war, wie sehr mir seine Aufmerksamkeit schmeichelte. Währenddessen legte ich meine Hände um einen Apfel und ein altes Stück Brot.
Unter meinem dünnen Umhang steckte ich das Brot hinten in meinen Hosenbund.
Mit einem geübten Lächeln klimperte ich mit den Wimpern, während mich der Mann angaffte. Der abgeschabte Ring an seinem Finger war ihm offenbar egal.
»Heute Abend soll es kalt werden.« Seine Aufmerksamkeit lag weiterhin auf meinem Körper, und ich konzentrierte mich darauf, ruhig zu atmen, um mir nicht anmerken zu lassen, wie sehr mein Herz hämmerte.
Ich nickte und hob demonstrativ den Blick zum Himmel, um die Wolken zu mustern. »Danke für den Hinweis.«
Als wären wir, die wir auf der Straße schliefen, uns der Wetteränderungen nicht mehr als bewusst.
»Du weißt ja, wo du mich findest, wenn dir dein Umhang nicht genug Wärme bietet.«
Ich biss mir auf die Zunge. Den Apfel hielt ich immer noch fest in der Hand, sein Gewicht verlieh mir eine Illusion von Sicherheit, während mir der Saft über die Finger lief, weil ich die Nägel in sein Fruchtfleisch bohrte.
»Danke.« Ich nickte knapp, dann verschwand ich in der Menge der Einkaufenden, bevor er das Interesse an meinem Körper verlieren und woanders hinschauen würde.
Und das konnte ich mir nicht leisten.
Beinahe ein Jahr lebte ich auf diesen Straßen, seit dem Überfall, und ich achtete sorgfältig darauf, dass mich niemand zu genau ansah.
Ich hatte nicht genug Geld, um mir die Überfahrt auf einem der Schiffe leisten zu können, wie ich es mir erträumt hatte. Außerdem hielten mich die Gerüchte über die Gefahren jenseits der Küste hier fest.
Die Rebellen waren schonungsloser geworden, und ich konnte es nicht riskieren, nach Süden weiterzuziehen, bevor die Abgabe für den König fällig war. Dadurch waren die Rebellen so sehr auf meinen Vater und den Palast konzentriert, dass sie mich nicht bemerken würden.
Ich schlängelte mich zwischen den Leuten auf der Brücke durch und bemerkte, wie ein Mann in feinstem Zwirn auf einen Händler zuging, dessen Augen aufleuchteten, als er ihn näher kommen sah. Der Mann trug keinen Umhang, sein Hemd war mehr als dick genug, um die Kälte abzuhalten. Das bedeutete aber auch, dass der Beutel, den er vorn an den Gürtel geknotet trug, deutlich sichtbar war.
Und ausgehend davon, wie er den Hosenbund bis knapp unter die Hüfte des Mannes herunterzog, hätte ich gewettet, dass sich darin mindestens zehn Münzen befanden.
Ohne den Mann aus den Augen zu lassen, beschleunigte ich meine Schritte. Die Verzweiflung schlug ihre Krallen in mein Inneres, drängte mich weiter. Doch mit Gier riskierte ich nur mein Leben oder schlimmer noch: geschnappt zu werden.
Zudem hatte ich genügend Essen, um für zwei Tage den allerschlimmsten Hunger zu stillen.
Doch die Abgabe war bald fällig, bis dahin musste ich weg sein. Denn es wurde von jedem im Königreich erwartet, sich dem König vorzustellen und die Abgabe zu entrichten, die man mit seiner jeweiligen Macht schuldig war.
Und das konnte ich nicht.
Selbst wenn ich die Macht hätte, irgendwie zu bezahlen, was mein Vater für angemessen hielt: Die Palastbewohner kannten mich, sie würden mich auf den ersten Blick erkennen. Dagegen besaßen die Soldaten, die auf der Brücke, in den Straßen der Stadt und den Kerkern patrouillierten, dieses Privileg nicht, die Leibwache meines Vaters schon. Und sie würden ohne Zweifel anwesend sein, um ihren König zu beschützen, wenn er seinen Untertanen das bisschen abnahm, was er ihnen zugestand.
Wenn man die Abgabe nicht entrichtete, ermordeten sie unser Volk, ohne mit der Wimper zu zucken, und die Angst davor, was sie mir antun würden, überwog die Angst vor den Rebellen.
Ich zwang mich, näher an den Mann heranzugehen, während er unaufmerksam mit den Händen über sein frisch gebügeltes Hemd strich.
Auf dieser Brücke war das sehr dumm. Hier war der beste Ort für Diebstähle, jedoch wurde man auch am ehesten erwischt. Und wäre da nicht das Schreckgespenst des Hungers gewesen, wäre ich wahrscheinlich abgebogen.
Doch das konnte ich mir nicht leisten.
Nicht so kurz vor der Abgabe für den König.
Der Mann sprach nur ein paar Sätze mit dem Händler, dann übergab er ihm zwei Goldmünzen.
Zwei Münzen, die ich ihm nicht mehr würde abnehmen können.
Ich schluckte die lähmende Angst hinunter und folgte dem Mann wie ein Schatten, als er weiterging.
Sein Gang war selbstbewusst, seine Schritte zielstrebig, während er die Brücke überquerte, ohne mich zu bemerken.
Mein Umhang verschmolz mühelos mit dem Meer aus Kleidung auf dem Markt und bot mir ein klein wenig Anonymität.
Ich bewegte mich, so schnell ich konnte, versuchte, den Mann zu erwischen, bevor er näher an den Palast herankam. Mein Herz schlug im Takt mit meinen Schritten, als sich der Abstand zwischen uns verringerte.
Er blieb stehen, um einen kleinen Händlerkarren vorbeizulassen, dessen klapprige Holzräder laut auf den Steinplatten ratterten, und ich wusste, das war meine einzige Chance.
Der Karren steuerte auf mich zu, verfehlte mich nur knapp, und ich schoss vor, um mich haltsuchend an den Mann zu klammern. Mit rudernden Armen stolperte ich in ihn hinein, vergrub die Finger haltsuchend in sein Hemd, und brachte ihn damit aus dem Gleichgewicht.
Er stieß mit dem Mann hinter ihm zusammen, und wir schafften es in dem Gedränge alle drei kaum, uns auf den Beinen zu halten.
Ich verlor keine Zeit, zog an den Lederbändern, die seinen Beutel am Gürtel hielten, und schon hatte ich ihn in der Hand. »Es tut mir so leid«, stammelte ich mit zitternder Stimme. »Ich habe nicht aufgepasst, wohin ich gehe.«
Er musterte mich von oben bis unten. Ich konnte seinen prüfenden Blick förmlich spüren, und jeder Nerv in meinem Körper schrie mich an wegzulaufen.
Die rechte Hand hatte ich in sein Hemd verkrallt, mit der linken hielt ich seinen Münzbeutel umklammert, als hinge mein Leben davon ab.
Die Verwirrung des Mannes verwandelte sich in Sorge, und er streckte die Hand nach mir aus. »Geht es dir gut?«
Ich zwang mich zu einem leichten Lächeln, bemühte mich nach Kräften, verletzlich zu wirken. »Ja. Ich bin nur … Ich habe den Halt verloren. Mir ist nichts passiert.« Ich betete, dass er das fehlende Gewicht an seiner Hüfte noch nicht bemerkt hatte.
Er hielt mich an den Oberarmen, zögerte einen Moment, dann nickte er. »Sei vorsichtig da draußen. Die Brücke kann ein gefährlicher Ort sein für ein Mädchen wie dich.«
Ein Mädchen wie ich.
Er hatte keine Ahnung, dass diese Brücke für ein Mädchen wie mich gefährlicher war als für alle anderen. Das ganze Königreich war gefährlicher.
Ich erwiderte sein Nicken und packte den Beutel fester, bevor ich einen kleinen Schritt nach hinten machte. Ich neigte den Kopf. »Danke, Sir. Das werde ich.« Damit drehte ich mich um und verschmolz mit der Menge. Mein Herz klopfte vor Nervosität und Schuldgefühlen.
Doch keines von beidem war stark genug, dass ich meine Tat bereut hätte.
Als ich mich durch den belebten Markt schob, konnte ich mir einen Blick in die Börse nicht verkneifen, die ich fest umklammert hielt. Es war mehr als genug, um ein paar Wochen zu überleben, vielleicht sogar Monate, wenn ich klug wirtschaftete. Das Gewicht der Münzen nahm etwas von dem Druck in mir, als ich sie in meine Tasche steckte.
Die Wächter standen immer noch am Eingang der Brücke, und ich zwang mich, an ihnen vorbeizugehen, obwohl meine Muskeln mit jedem Tritt, den ich näher kam, protestierten. Nachdem ich über die Schwelle von den feinen Steinplatten auf das staubige Kopfsteinpflaster der Straßen trat, erlaubte ich mir, kurz über meine Schulter zu schauen, um sicherzugehen, dass mich niemand beobachtet hatte.
Dass der Mann meinen Diebstahl nicht bemerkt hatte.
Da die Wächter mich keines Blickes würdigten, ging ich schneller durch die schmalen Straßen. Je weiter ich mich von der Brücke entfernte, desto weniger prächtig wurden die Häuser und Geschäfte.
Auch die Bewohner dieser Häuser wurden immer unbedeutender.
Man durfte dem König nur nahe sein, wenn man ihm etwas zu bieten hatte. Wenn man Magie besaß, die ihm vielleicht von Nutzen sein konnte.
Der Gestank nach Müll und Verwesung mischte sich mit dem Duft nach Gewürzen, der von den heruntergekommenen Essensständen überall an den Straßen heranwehte. Es war ein harter Kontrast zu der Opulenz des Palastes und seiner Brücke, doch je weiter ich mich von beiden entfernte, desto mehr hatte ich das Gefühl, wieder atmen zu können.
Auf meinem Weg durch die verfallenen Straßen sah ich in die Gesichter der Bewohner, die mir begegneten. Viele sahen müde und resigniert aus, gebrochen von täglichen Anstrengungen. Die Welt außerhalb des Palastes war hart, sie erinnerte mich unablässig daran, was ich zurückgelassen hatte.
Ich trauerte um Teile des Lebens, das ich einst geführt hatte, während ich gleichzeitig zu den Göttern betete, dass ich nie zurückkehren würde.
Ich hielt den Kopf gesenkt, verschmolz mit meiner Umgebung aus Armut und Verzweiflung. Der zerschlissene Umhang, der meine Identität verschleierte, machte seine Sache gut und schenkte mir in diesen vergessenen Straßen die Illusion, unbeobachtet zu sein. Überleben zu müssen hatte mich gelehrt, mich unsichtbar zu machen. Ein Geist zu sein, der durch die Schatten wehte.
Und das leistete mir gute Dienste.
Ich bog nach rechts in eine vergessene Gasse ab und ging an dem verwitterten Haus vorbei, an dessen bröckelnden roten Ziegeln der Efeu emporrankte. Die alte Frau, die dort wohnte, ging selten aus und bekam kaum Besuch, und noch seltener schaute sie in die kleine Nische am Ende ihres Gartens.
Dort setzte ich mich hin, an den Ort, der zu meinem Zuhause geworden war, und zog das Brot und den Apfel unter meinem Umhang hervor. In Momenten wie diesem wünschte ich mir, ich hätte ein Messer, aber Micah würde schon bald hier sein.
Als ich den ersten Bissen gestohlenes Brot kostete, hörte ich jemanden vom Ende der Gasse herannahen. Zur Sicherheit steckte ich das Essen weg und blieb still, während die Schritte langsamer wurden. Aus den Schatten tauchte Micah auf, seine schmale Gestalt verschmolz nahtlos mit der Dunkelheit um ihn herum.
»Glück gehabt heute?«, fragte er leise und sah sich nach möglichen Gefahren um, bevor er sich mit einem Ächzen neben mich setzte.
»Ich habe mich ganz gut geschlagen«, erwiderte ich, zog das Brot heraus und brach es in zwei Hälften. Gierig nahm er sein Stück, der Hunger in seinem Blick war unmöglich zu übersehen. »Und du?«
Er nickte und händigte mir einen kleinen Beutel aus, der sich viel zu leicht anfühlte, um Münzen enthalten zu können. »Ich konnte mir das hier in der Nähe des Palastes aus der Kutsche eines Edelmannes schnappen.«
Vorsichtig zog ich den Beutel auf und sah mehrere gefaltete Stücke Pergament, alle mit dem königlichen Siegel verschlossen.
»Das ist Post für den König.«
Mit zitternden Fingern griff ich in den Lederbeutel, doch seine Worte ließen mich erstarren. Angst schnürte mir die Kehle zu und ich ließ das Säckchen fallen.
»Die können wir nicht behalten«, sagte ich entschieden, meine Stimme kaum mehr als ein Flüstern. »Wenn sie uns mit diesen Briefen erwischen, steht nicht nur unser Leben auf dem Spiel.«
Ich schüttelte den Kopf, meine Gedanken rasten. Das waren wichtige Dokumente, womöglich enthielten sie Informationen, die als Druckmittel gegen die Mächtigen eingesetzt werden konnten. Wir konnten es uns nicht leisten, dieses Risiko auf die leichte Schulter zu nehmen.
Ein Risiko, das mich in viel größere Gefahr brachte als die Münzen, die ich gerade gestohlen hatte.
Falls der König und seine Wachen nicht schon nach mir suchten, würden sie hiernach trachten.
Und das beunruhigte mich am meisten. Falls er mich je finden wollte, wusste niemand davon.
Ich war die verlorene Prinzessin, von der alle immer noch glaubten, sie sei in ihrem Turm weggesperrt.
Ich war die Schwachstelle der makellosen Regentschaft des Königs, und er versteckte mich immer noch genauso, wie ich mich vor ihm versteckte.
Besorgt sah mich Micah an. »Du hast recht«, gab er angespannt zu. »Ich hätte sie nie gestohlen, wenn du nicht weggehen würdest.« Er strich sich mit seinen schwieligen Händen durch die hellen Haare, die im Sonnenlicht schimmerten.
Micah war der Einzige, dem ich mich anvertraut hatte, seit ich den Palast verlassen hatte. Jedoch wusste er auch nur, was ich zuließ. Er war mir mit Freundlichkeit begegnet, wo es sonst niemand getan hatte, und ich dankte es ihm, indem ich meine Identität vor ihm geheim hielt. Aber mein Vater würde ihn umbringen, wenn er je herausfände, dass er mir half, mich zu verstecken.
Für Micah war ich ein Mädchen mit Vergangenheit, das auf der Flucht war, aber für meinen Vater war ich eine Last. Und jeder, der von mir und meiner mangelnden Macht wusste, fiel in dieselbe Kategorie.
»Aber schau.« Er faltete eines der Pergamente auseinander, dessen Siegel schon gebrochen war, und überflog den Inhalt. Er deutete auf den unteren Rand der Seite, und ich spähte über die Kante, um zu sehen, was er meinte. »Wir haben das Zeichen der Rebellen nicht ganz richtig hinbekommen.« Er nahm meine linke Hand und schob den Ärmel hoch, sodass das einfache schwarze Symbol sichtbar wurde. Mit dem Daumen strich er über die empfindliche Haut meines Handgelenks, wo er das Zeichen mithilfe seiner Magie sorgfältig eingeritzt hatte, und mich überlief ein Schauder.
Es bestand aus zwei einfachen, gekreuzten Pfeilen. Wir hatten beide schon so oft davon gehört, aber Micah hatte recht, es unterschied sich ein wenig von dem in dem Brief. Die Befiederung war nicht dieselbe, und jeder, der bereits zu den Rebellen gehörte, konnte leicht den Unterschied erkennen. Außerdem würden sie dann wissen, dass ich nichts weiter war als eine Verräterin, die versuchte, sich als eine von ihnen auszugeben. Sie würden mich genauso schnell töten wie der König.
Doch Unterstützer des Königs verließen die royale Küste nicht, es sei denn, sie schlossen sich der Rebellion an. Zumindest nicht mehr seit dem Angriff. Andernfalls war es zu gefährlich. Falls sie mich erwischten, wenn ich von hier floh, konnte ich nur überleben, wenn ich sie überzeugen konnte, dass ich auf ihrer Seite stand.
Sie durften nie erfahren, wer ich wirklich war.
Niemand durfte das.
»Wir müssen das in Ordnung bringen.« Seine Finger strichen sanft über mein Zeichen und mein Magen zog sich zusammen. »Wenn sie das sehen, wissen sie sofort, dass du eine Schwindlerin bist.«
Eine Schwindlerin.
Bei den Göttern, mir fiel kein besseres Wort ein, um mich zu beschreiben.
»Tu es.« Ich nickte in Richtung des Pergaments und schluckte. Noch immer erinnerte ich mich gut daran, wie sich seine Magie beim letzten Mal in meine Haut gebrannt hatte, weshalb ich wusste, dass es auch diesmal nicht weniger schmerzhaft werden würde. Doch Schmerz war ein vergleichsweise geringer Preis. Mein Schicksal hing davon ab.
Konzentriert verzog Micah das Gesicht, als er seine Magie in die Fingerspitzen lenkte. Die Luft knisterte vor Energie, eine greifbare Vorahnung, welche die Nische erfüllte. Ich holte tief Luft und wappnete mich für das Kommende.
Sanft drückte Micah den Daumen auf das Zeichen an meinem Handgelenk, ganz vorsichtig, um die vorhandenen Linien nicht zu unterbrechen. Seine Magie floss von ihm in mich, vermischte sich mit meinem Fleisch. Hitze strahlte von ihm aus, versengte meine Haut und ritzte neue Details in das Zeichen.
Ich biss mir auf die Lippe, erduldete das Brennen, während er sorgfältig die Federn korrigierte. Jedes Streicheln seines Daumens fühlte sich an wie Feuer, während er mir meine neue Identität einbrannte. Es war eine aus der Notwendigkeit geborene Neuerfindung, ein verzweifelter Versuch, in einer Welt zu überleben, die Loyalität und Gefolgschaft verlangte.
Als der Schmerz stärker wurde, ballte ich die Fäuste, meine Nägel gruben sich in meine Handflächen. Micahs Berührung wurde leichter, sein angestrengter Blick blieb jedoch unverwandt auf das Pergament gerichtet.
Endlich ließ er mich los, und eine Welle der Erleichterung überspülte mich. Ich betrachtete das veränderte Symbol an meinem Handgelenk, die klaren Linien, umrandet von meiner roten, gereizten Haut. Die Befiederung war perfekt abgestimmt, jedes zarte Detail in meine Haut eingeritzt als bleibender Beleg dafür, zu wem ich werden musste.
»Du musst vorsichtig damit sein«, warnte Micah, und in seiner Stimme lagen Sorge und dieselbe Missbilligung wie beim ersten Mal, als ich ihn gebeten hatte, mir das Zeichen einzubrennen. »Die Rebellion treibt ein gefährliches Spiel.«
Ich nickte ernst, ich war mir der Risiken vollauf bewusst. Es gab Gerüchte, die Rebellion gewänne im Geheimen an Stärke, befeuert von den Ungerechtigkeiten des Königs und der Mächtigen. Sie kämpften für die Freiheit, für eine Welt, in der alle dieselben Chancen im Leben hatten, unabhängig von ihrer Magie. Doch sie agierten auch im Verborgenen, ihre Taktiken waren ebenso gnadenlos wie die ihrer Gegner.
Und ich hatte den Beweis dafür gesehen, als sie den Palast überfielen, der bis dahin als uneinnehmbar gegolten hatte.
»Das weiß ich«, erwiderte ich mit fester Stimme. »Aber hoffentlich muss ich es nicht einsetzen.«
Uns war beiden klar, dass ich mir niemals die Überfahrt auf einem der Schiffe im Hafen des Königreiches würde leisten können, aber wenn ich es weit genug in den Süden schaffte, hatte ich vielleicht eine Chance.
Es war eine lange Reise bis an die südliche Küste, vor allem für ein Mädchen, das sich nie weiter als eine Meile vom Palast entfernt hatte. Aber es gab keine anderen Möglichkeiten für mich.
»Ich will nicht, dass dir etwas passiert.« Micah legte mir die Hand an die Wange, und Schuldgefühle durchströmten mich.
Seine Sorge und die Gründe, warum er Angst um mich hatte, wogen zu schwer. Micah war zu meinem Anker geworden, seit ich den Palast verlassen hatte, mein Vertrauter und engster Freund.
Doch wie er mich jetzt ansah, das war … mehr.
In der Ferne war ein lauter, durchdringender Schrei zu hören. Micahs Hand verharrte kurz vor meinem Gesicht. Wir erstarrten beide, horchten angespannt, und plötzlich war das Geräusch von Stiefeln auf Kopfsteinpflaster viel zu nah. Wir waren nicht mehr sicher.
Erschrocken riss Micah die Augen auf und drehte den Kopf in Richtung der näher kommenden Schritte. Seine Hand sank herab und seine Finger streiften den Griff eines versteckten Dolches an seinem Gürtel. Die Verzweiflung in seiner Stimme war deutlich hörbar, als er eindringlich flüsterte: »Wir müssen sofort weg.«
Mein Herz raste, mein ganzer Körper war in Panik. Mit eisernem Griff packte ich Micahs Arm. »Hier«, sagte ich, sowohl ängstlich, aber auch entschlossen, als ich die Hälfte der Münzen aus der Börse in meiner Tasche zog.
»Woher zum Teufel hast du die denn?« Er packte meine Hand und schloss meine Finger um die Münzen, während er sich über die Schulter umsah.
»Ich hab sie gestohlen«, flüsterte ich eindringlich. »Nimm sie und geh. Such dir ein sicheres Versteck, irgendwo, wo sie dich nicht finden können. Wir treffen uns heute Abend wieder hier.«
»Die brauchst du.«
»Wir brauchen sie beide«, drängte ich, und wir wussten, dass es stimmte.
Micah zögerte kurz, war hin- und hergerissen zwischen seiner Sorge um mich und dem Bedürfnis zu fliehen. Doch allein waren wir viel schwerer zu erwischen als gemeinsam. Ich ließ die Münzen in seine Hand fallen, er nickte und schloss die Finger darum, dann drückte er ein letztes Mal meine Hand.
»Pass auf dich auf«, murmelte er. Und dann war er fort, verschwand in den Schatten, als wäre er nie hier gewesen.
Allein in der spärlich beleuchteten Gasse, hämmerte mein Herz in meiner Brust wie eine Kriegstrommel. Die Schritte wurden lauter, kamen immer näher. Angst und Adrenalin jagten durch meine Adern, befeuerten meine Instinkte, als ich mich umdrehte und in die entgegengesetzte Richtung rannte.
Ich schoss durch die schmale Gasse, sprang über eine ausrangierte Kiste und wich einem Mann aus, der mir entgegenkam. Meine Lunge brannte bei jedem Atemzug, aber ich rannte weiter.
Meine Gedanken rasten. Ich musste ein Versteck finden, in der Menge verschwinden, aus den Augen derer, die da näher kamen. Es war egal, hinter wem sie her waren, die Königsgarde machte keine Unterschiede, wenn man ihr in die Quere kam.
In den Straßen wimmelte es von Leuten, und alle waren nervös. Hektisch schaute ich mich um, genau wie alle anderen, während sich Dutzende von Wachen durch die Menge bewegten.
Ich wurde langsamer, schob mich mit gesenktem Kopf zwischen den Leibern durch.
»Da!«, hörte ich einen Mann hinter mir rufen, wagte es aber nicht, mich umzudrehen, um zu sehen, wer es war. »Das ist sie.«
Mein Herz setzte einen Schlag aus. Entsetzen stieg in mir auf, drängte mich zu laufen, aber ich zwang mich, ruhig zu bleiben. Ich schlängelte mich mühelos zwischen Leibern hindurch, versuchte, mich in der Menge aufzulösen.
Doch das Schicksal meinte es nicht gut mit mir.
Bevor ich reagieren konnte, schlossen sich starke Hände um meinen Arm, rissen mich mit einer Kraft nach hinten, dass der Schmerz durch meine Schulter schoss. Stolpernd versuchte ich, das Gleichgewicht zu halten.
Eine vierschrötige Gestalt ragte über mir auf, gekleidet in die dunkelblaue Uniform der Königsgarde. Er starrte mir in die Augen, und in mir rangen Furcht und Trotz miteinander, als ich mich überwand, den Blick zu senken und so zu tun, als wäre ich jemand, der ich nicht war.
Jemand, der den König und seine Männer respektierte.
»Ich hab sie«, rief er über die Schulter, und ich zuckte innerlich zusammen, als ich weitere laute Schritte näher kommen hörte. Er streckte die Hand aus, hob mit einem schwieligen Finger mein Kinn an und musterte mich.
»Ist sie es?«, fragte ein weiterer Wächter hinter ihm, und ich schluckte mühsam.
Nein. Bitte, bitte, bitte.
Wenn sie mich in den Palast zurückbrachten, würde ich nicht überleben. Mein Vater würde es nicht zulassen. Ich hatte ihn und sein Königreich verraten, weil ich während des Überfalls davonlief, und das würde er mich nicht vergessen lassen.
»Sie ist es.« Er hielt mein Handgelenk in die Höhe, zog mich dichter an sich, während die Leute auseinanderstoben, so weit weg von uns, wie sie konnten.
Ich bedeutete ihnen nichts, ich war ein Niemand, für das sie ihr eigenes Leben nicht riskiert hätten, und Micah war verschwunden, wie ich es ihm befohlen hatte.
Die Prinzessin.
Ich war auf die Worte aus seinem Mund vorbereitet, auf ein allgemeines Luftschnappen, wenn die Umstehenden es hörten, aber ich erschrak, als er mit dem Daumen über mein immer noch schmerzendes Rebellenzeichen strich.
»Und es sieht aus, als wäre die kleine Diebin auch noch eine Verräterin.«
KAPITEL 2
DACRE
Zähneknirschend hörte ich mir die Schelte meines Vaters an.
Als wäre es meine Schuld, dass meine Schwester erwischt wurde.
Als wäre ich nicht schon dabei, mir das Hirn zu zermartern, wie wir sie rausholen könnten.
Das war nichts Neues.
Fast täglich wurden Rebellen von der Palastwache gefangen genommen.
Manche brachten sie auf der Stelle für ihren Verrat um, während andere zum Schicksalsgott beten mussten, damit der Tod sie holen kam. Gefangene des Königs wurden gefoltert, und die Rebellen hatten viele Geheimnisse, die es wert waren, verraten zu werden.
Außerdem war meine Schwester viel zu jung und viel zu hübsch, sie würden sie nicht so schnell töten. Die Wachen hatten sicherlich weit schlimmere Pläne für sie, als ihr Geheimnisse zu entlocken.
Doch ich würde bis zum letzten Atemzug bluten und kämpfen, um sie herauszuholen.
Wir kauerten am Waldrand, warteten darauf, dass sich die letzten Sonnenstrahlen hinter die Küste zurückzogen.
Die Abgabe war schon in zwei Tagen fällig, bis dahin musste ich sie befreit haben.
Hinter der Baumgrenze suchte ich unsere Umgebung ab, während mein Vater weiterfaselte.
Ich hatte keine Energie für ihn übrig.
Er mochte der Anführer der Rebellion sein, aber er war auch für den Tod meiner Mutter verantwortlich.
Er war für eine Vielzahl von Toten verantwortlich, als er einen Überfall plante, auf den wir nicht vorbereitet waren.
Ein Überfall, der unser Leben veränderte, der dafür sorgte, dass ich den Respekt vor ihm verlor.
»Hast du mir zugehört?«, knurrte er mit seiner tiefen Stimme, und ich erwiderte endlich seinen Blick.
»Was?«
»Du hörst mir nicht einmal zu, Dacre, verdammt noch mal.« Auf seiner Stirn bildeten sich zwei tiefe Furchen, als er enttäuscht die Brauen zusammenzog, und seine grünen Augen funkelten mich an.
Seine Haare waren tiefschwarz wie die unendliche Weite des Nachthimmels. In weichen Wellen fielen sie herab, umrahmten sein Gesicht und bildeten einen Kontrast zu seinem kantigen Kiefer, an dem noch eine Narbe vom Überfall zu sehen war.
Hätte ich nicht die dunklen Augen meiner Mutter, wäre ich sein Ebenbild.
»Wir wissen, wo sie die Gefangenen einsperren.« Ich fuhr mir mit der Hand durch die Haare, schaute am Palast hoch und zu der Brücke mit dem Markt, die wir um jeden Preis zu meiden versuchten. »Kai und ich gehen allein rein. Wenn wir sie nicht innerhalb einer halben Stunde finden, ziehen wir uns zurück.«
Nur über meine verdammte Leiche.
»Eine halbe Stunde«, bekräftigte er den Zeitrahmen. »Wenn ihr sie in der Zeit nicht finden könnt, verschwindet ihr. Du bist zu wichtig.«
Ich schnaubte höhnisch, aber er achtete nicht darauf.
»Wir sollten Kai und Mal reinschicken.«
»Ich gehe rein, ob du einverstanden bist oder nicht«, erwiderte ich entschieden und sah meinen Vater fest an. »Sie ist meine Schwester, und ich werde sie bestimmt nicht ihrem Schicksal überlassen.«
Er entspannte seine Kiefermuskeln, legte einen kurzen Moment den Kopf schief, während er mich betrachtete. Er hätte darauf bestehen sollen, selbst hineinzugehen, um seine Tochter zu retten. »Ihr habt dreißig Minuten.«
Es war nicht von Bedeutung, was er sagte, denn ich hatte mich bereits entschieden. Ich hatte nicht vor, mich zurückzuziehen, wenn ich sie nicht innerhalb einer halben Stunde fand. Egal, was das für Folgen hatte.
Ohne auf weitere Befehle meines Vaters zu warten, drehte ich mich zu den dunkler werdenden Schatten der Hauptstadt um.
Kai und ich hatten jeden Zentimeter des Palastes studiert, sämtliche Routinen der Wachen und jeden möglichen Eingang. Wir beschäftigten uns schon seit Jahren damit. Doch jetzt, als wir uns bereit machten, zum ersten Mal seit dem Überfall das Palastgelände zu betreten, pulsierten die Adern an meinem Hals. Ich atmete schwer und mein Herz raste.
»Bist du bereit?«, fragte Kai kaum hörbar trotz der Stille.
»So bereit ich nur sein kann.« Meine Hände waren schweißnass und meine Stimme unsicher.
Wir bewegten uns durch die Schatten, unsere Schritte waren auf dem moosbedeckten Boden kaum zu hören, als wir meinen Vater und die anderen hinter uns ließen. Wir steuerten nicht direkt auf die Brücke zu, sondern nach rechts, wo die wenigen Straßenhändler zu hören waren, die noch unterwegs waren.
»Jetzt fängt der Spaß an«, flüsterte Kai verängstigt.
Ich nickte. Von derselben Beklommenheit erfüllt schaute ich mich um. Wir bewegten uns im Einklang miteinander, wie zwei Windungen derselben Schlange, einen Schritt nach dem anderen machend steuerten wir durch das Gewirr aus Personen und Waren.
Vom Markt aus waren immer noch Feilschen und Gelächter zu hören. Vor uns ragte der Palast über der Stadt auf, seine Macht und Herrlichkeit ein starker Kontrast zu der Misere der königlichen Untertanen.
Kai nickte nach rechts und ich folgte ihm in eine schmale Gasse, die zwischen zwei hohen Gebäuden durchführte. Bei einem Blick über die Schulter sah ich das vertraute Haus, das so von Efeu bewachsen war, dass es beinahe nicht zu erkennen war. Dann richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder nach vorn.
Ich durfte nicht über dieses Haus nachdenken. Nicht jetzt.
Mir standen die Härchen im Nacken zu Berge, und ich ballte die Fäuste, versuchte, meine Nervosität zu unterdrücken.
Kai führte uns durch die nächste schmale Straße, tiefer zwischen die Häuser der Stadt und weiter weg von der Menge. Hier war der Geruch des Meeres unverkennbar, und ich konnte beinahe das Salz auf meiner Zunge schmecken.
In der Ferne hörte man das Geräusch der Wellen, wenn sie sich an den Felsen brachen, und ich nahm mir einen Moment, um durchzuatmen.
Am Ende der Gasse kamen wir abseits der geschäftigen Massen in den ruhigeren Teil der Altstadt. Der Palast war immer noch weit weg, sein schattenhafter Umriss zog uns an wie ein Leuchtturm in der Dunkelheit.
»Hier entlang.« Kai deutete nach vorn und ich folgte ihm.
Wir bewegten uns zügig, unsere Schritte hallten von dem feuchten Kopfsteinpflaster wider. Wir überquerten verlassene Straßen, mieden vereinzelte Fußgänger und streunende Katzen auf der Suche nach Futter.
Als wir uns den Palastmauern näherten, sahen wir zwei Wachen, die vor dem Haupttor auf und ab gingen und unentwegt die Umgebung absuchten. Kai und ich tauschten einen stummen Blick, dann teilten wir uns auf.
Ich schlich an der Mauer entlang, weg vom Tor, und wurde das Gefühl nicht los, dass hier etwas nicht stimmte. In meinem Nacken kribbelte es, ich zögerte einen Moment und sah mich misstrauisch um.
Doch da war nichts.
Also schlich ich weiter an der Mauer entlang, bis ich zu der Stelle kam, über die Kai und ich gesprochen hatten. Ich begann zu klettern. Als ich mich auf der anderen Seite lautlos aufs Palastgelände fallen ließ, hörte ich links von mir ein Rascheln.
Ich erstarrte, versuchte, kein Geräusch zu machen, das Herz schlug mir bis zum Hals.
Eine plötzliche Bewegung war zu erahnen, und ich zog meinen Dolch aus seiner Scheide an meiner Brust. Gerade wollte ich ihn werfen, da merkte ich, dass es Kai war, das Gesicht eine Maske der Besorgnis.
»Wir haben ein Problem.«
Ich schaute über die Schulter zum Tor, und da hörte ich es: die leisen Bewegungen von Wachen, die wussten, dass etwas nicht stimmte.
Früher glaubten wir, es sei unmöglich, in den Palast einzudringen, aber hineinzukommen war nie das Problem gewesen. Das Problem war, wieder herauszukommen.
Doch jetzt gab es kein Zurück mehr.
Keine Bedrohung auf dieser Welt brachte mich dazu, meine Schwester zurückzulassen.
»Rebellen!«, rief eine der Wachen, und Kai und ich sahen uns an.
»Wir müssen sie finden.« Meine Stimme war kaum mehr als ein Wispern. »Schnell.«
Kai suchte mit zusammengekniffenen Augen die Tore ab. »Meine Magie?«
»Benutz sie.« Ich nickte zu den Wachen hinüber. »Sie wissen sowieso schon, dass wir hier sind.«
Kai warf einen kurzen Blick auf den Palast. »Wir müssen schnell sein«, sagte er, schloss die Lider und ich spürte ein Beben in der Luft. Er grub die Finger in die lose Erde, griff einen Moment lang fest zu und lockerte sie dann wieder. Dichte schwarze Rauchfäden sickerten aus seinen Fingerspitzen und schlängelten sich über den Boden, bevor sie darin verschwanden.
Die Erde bebte, und die erschrockenen Stimmen der Wachen wurden lauter.
»Wir müssen los.« Mein Herz hämmerte, als Kai die Augen wieder aufriss. Sie waren fast vollkommen schwarz, sogar noch dunkler als normalerweise.
»Auf der Hinterseite des Palastes. Der Kerker.«
Wir standen auf, bewegten uns, so schnell wir konnten, und versuchten dabei, im Schatten zu bleiben. Als wir an der Palastrückseite ankamen, standen dort zwei Wachen, beide mit gezogenen Schwertern.
Rauch schoss aus Kais Fingern, krachte dem einen gegen die Brust, meinen Dolch versenkte ich in den anderen.
An meinen Schläfen rann der Schweiß herunter, und ich wischte ihn eilig weg, während der Druck auf meiner Brust zunahm. Ein Leben zu nehmen war eine schwerwiegende Angelegenheit, das war mir bewusst, und doch durfte ich jetzt nicht darüber nachdenken.
Für meine Schwester hätte ich sie alle getötet.
Schuld und Reue konnten mich später zerfressen.
Wir stiegen über sie weg, einer von ihnen zitterte noch, als das letzte bisschen Leben mit dem Blut aus seinem Körper floss, das jetzt in den makellosen Palastboden sickerte.
Ich legte die Hand an den Türgriff, da erklang über uns das Läuten der Turmuhr. Ich wagte es nicht, mich umzuschauen, aber ich hörte Kai leise vor sich hinbrummen.
»Sieht aus, als hätten wir die Frist deines Vaters verpasst.«
Ich schnaubte höhnisch und hätte gelächelt, hätte nicht im Palast meine Schwester auf uns gewartet. Kai respektierte die Befehle meines Vaters fast noch weniger als ich.
»Rein und raus«, erinnerte ich uns beide an das, was wir schon wussten. »Wir holen Wren und hauen ab.«
Im Palast herrschte das Grauen. Das Königreich Marmoris war groß, und es wurde von einem König verunreinigt, der mehr Blutdurst als Sorge um sein Volk empfand, dem er eigentlich dienen sollte.





























