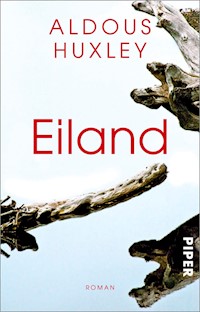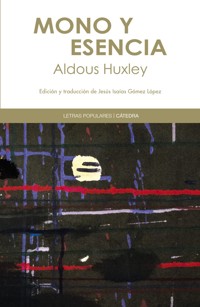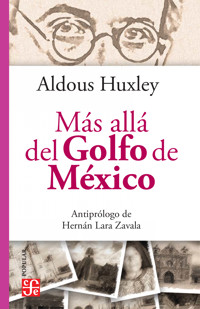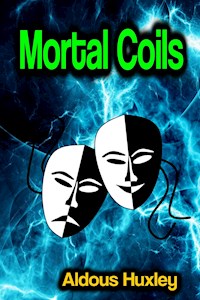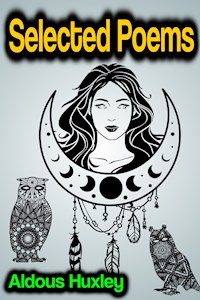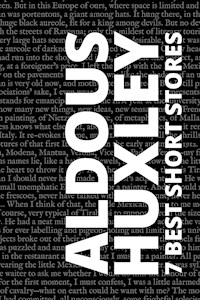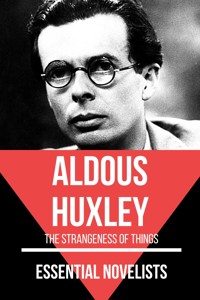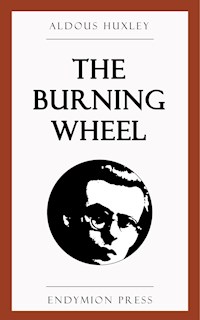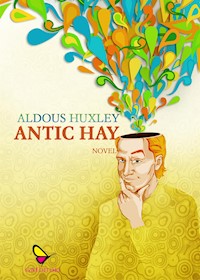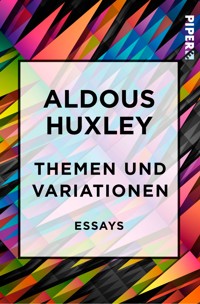
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Hält die Kunst ihrem Zeitalter den Spiegel vor? Oder jedes Zeitalter seiner Kunst?« Seine Analysen basieren auf einem bemerkenswerten, fast übernatürlichen Verständnis der menschlichen Natur und sind auch heute erschreckend aktuell. Aldous Huxley ist zu Recht ein prophetisches Genie und eine der wichtigsten literarischen und philosophischen Stimmen des 20. Jahrhunderts. Im vorliegenden Essayband beschäftigt er sich mit dem Verhältnis von Kunst und Religion und porträtiert die spanischen Meisterzeichner El Greco und Goya.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.piper.de
Neuauflage einer früheren Ausgabe
Übersetzt aus dem Englischen von Herberth E. Herlitschka
ISBN 978-3-492-97666-4
© Piper Verlag GmbH, München 2017
© Mrs. Laura Huxley
Die englische Originalausgabe erschien unter dem Titel »Themes and Variations«, Chatto & Windus, London 1950
© der deutschsprachigen Ausgabe Piper Verlag GmbH, München 1952
Covergestaltung: zero-media.net, München
Covermotiv: FinePic®, München
Datenkonvertierung: abavo GmbH, Buchloe
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.
KUNST UND RELIGION
Hält die Kunst ihrem Zeitalter den Spiegel vor? Oder jedes Zeitalter seiner Kunst?
Folgt der Künstler oder führt er? Oder geht er seinen Weg ganz allein und gehorcht nur den kategorischen Imperativen seiner Begabung und der immanenten Logik der Tradition, innerhalb deren er schafft?
Ist er der Repräsentant seiner Epoche? Oder vertritt er bloß einen Wahlkreis, der nicht größer ist als die besondere Gruppe begabter Menschen – seiner Vorläufer,Zeitgenossen und Nachfolger – der er, durch seine Erbmasse bestimmt, eben angehört?
Alle diese Fragen können, und zwar richtig, bald mit Ja, bald mit Nein, bald mit Ja und Nein beantwortet werden. Es gibt da keine allgemeinen Regeln, sondern nur besondere Fälle; und die meisten sind für uns in einen dichten Nebel des Nichtwissens gehüllt.
Nehmen wir zum Beispiel den Fall, der sich jedem nach Rom Kommenden darbietet – den fesselnd rätselhaften Fall des Barocks und des Katholizismus im 17. Jahrhundert. Auf welche Weise standen die beiden in Beziehung zueinander? Von welcher Art war der Zusammenhang zwischen den Kunstformen jener Zeit und den religiösen Erlebnissen derer, die in ihr lebten?
Dreihundert Jahre nachher ist das Einzige, was wir mit Sicherheit wissen, dass sich die von der religiösen Kunst des Barocks Dargestellten fast ausnahmslos in einem Zustand chronischer Gemütserregung befinden. Sie schwenken die Arme, rollen die Augen, drücken die Hände auf wogende Busen, und manchmal schwinden ihnen in einem Übermaß des Gefühls die Sinne bis zur Bewusstlosigkeit. Wir betrachten sie mit einer Mischung aus ästhetischer Bewunderung und ethischem Missfallen und beginnen dann Vermutungen über die Menschen anzustellen, welche ihre Zeitgenossen waren. War deren religiöses Leben so wild bewegt wie das Leben dieser Geschöpfe aus der Fantasie der Maler und Bildhauer? Und wenn das stimmt, hatte sich die Kunst solch ungestüme Bewegtheit zum Vorbild genommen oder war diese bedingt durch die Vertrautheit mit einer Kunst, die aus rein ästhetischen Gründen so wild bewegt geworden war? Oder war am Ende in der wirklichen Welt, die der gemalten und gemeißelten entsprach, gar keine solche aufgeregte Bewegtheit vorhanden? Die Künstler des Barocks waren dessen überdrüssig, dasselbe zu tun, was ihre Vorläufer getan hatten, und waren durch die ihrer Tradition innewohnende Logik dazu verhalten, das Ungewöhnliche und Übermäßige zu erforschen; daher mussten die Figuren über den Altären in einer ausgedachten Verzückung gestikulieren. Jedoch das religiöse Leben der Menschen, die vor diesen Altären ihre Andacht verrichteten – war das etwa kennzeichnend anders geworden als das religiöse Leben der Menschen früherer Zeiten? Oder gab es nicht damals wie zu jeder Zeit nur einige wenige eifrige Kontemplative und Aktive, die den großen Teigklumpen der Buchstabengetreuen und der Überschwänglichen, der Heuchler und der Lauen durchsäuerten?
Ich selbst neige eher zu der zweiten Ansicht. Die Umwelt ist nie das einzig Bestimmende, und die Vererbung ist stets am Werk und bringt in jeder Periode der Geschichte jede mögliche Art und Abart des Körperbaus und Temperaments hervor. Alle Anlagen der menschlichen Natur sind zu allen Zeiten vorhanden, und zu allen Zeiten werden (trotz einer Umwelt, die einigen von ihnen ungünstig sein mag) so gut wie alle diese Möglichkeiten in einigem Ausmaß verwirklicht.
Man braucht nur Salimbenes Chronik und William Laws Ernste Mahnung zu lesen, um zu begreifen, dass es in den Zeiten der Gläubigkeit ebenso viele irreligiöse Menschen gab, wie Pietisten in Zeiten des Rationalismus und der Aufklärung. Die Byzantiner, die sich über die Trinitätslehre bis zum Wahnsinn ereifern konnten, waren dieselben Byzantiner, die bei den Wagenrennen in Raserei gerieten. Und unser eigenes Zeitalter der Atomphysik ist zugleich ein bemerkenswertes Zeitalter der Sterndeuterei und des Zahlenglaubens. In keiner Epoche gibt es eine Synthese, sondern nur ein bloßes rohes Nebeneinander von Gegensätzen und Unvereinbarem. Und doch gibt es in jeder Epoche nur einen einzigen vorherrschenden, Kunststil, in dessen Ausdrucksformen Maler und Bildhauer eine streng begrenzte Zahl von Vorwürfen behandeln. Die Kunst lässt sich in diesem Zusammenhang als einen Vorgang des Auswählens und Umwandelns definieren, durch den eine nicht zu bewältigende Vielheit auf zumindest einen Anschein von Einheit reduziert wird. Daher dürfen wir niemals erwarten, in der Kunst eine Spiegelung der gleichzeitigen Wirklichkeit zu finden, wie sie von den Menschen in allen ihren angeborenen und erworbenen Verschiedenheiten erlebt wird. Wie könnte jemand sonst aus einem Studium der verhaltenen und formalisierenden Kunst des italienischen Trecento auf das Vorhandensein der ungezügelten religiösen Wiedererweckungen schließen, welche ein so charakteristischer Zug jener Zeit waren? Und, umgekehrt, aus den Verzückungen des Barocks auf die Tatsache der Mystik im 16. und 17. Jahrhundert? Wer vermöchte bei der Betrachtung von Carlo Dolcis Magdalena zu ahnen, was der hl. Johannes vom Kreuze über wahre Barmherzigkeit gesagt hat – dass sie nicht eine Sache des Gefühls, sondern des Willens sei? Oder wer könnte, Berninis hl. Teresa vor Augen, vermuten, dass Berninis Zeitgenosse Charles de Condren die Schwäche beklagte, welche Ekstatiker dahin bringe, Gott so animalement zu empfangen? Die Wahrheit scheint zu sein, dass es, während die große Masse des Volks, wie stets, gleichgültig und dann und wann abergläubisch blieb und während die Meister des geistlichen Lebens eine Verehrung des Geistes im Geiste predigten, den Künstlern der Zeit beliebte und gefiel, ein Christentum des Nervenkitzels und der eingeweidlichen Sehnsüchte bald heftig leidenschaftlich, bald übersättigend sentimental zu verherrlichen. Und sie wählten diese Darstellungsweise nicht aus Gründen, welche mit den Problemen des Lebens zu tun hatten, sondern mit denen der Kunst. Ihre Bilder und Skulpturen spiegelten nicht das vielfältige religiöse Erleben ihrer Zeit, ja konnten das gar nicht; und ebenso wenig spiegelte das religiöse Erleben der meisten ihrer Zeitgenossen die vorherrschende Kunst. Kunst und Religion gingen ihre getrennten Wege, wobei die Künstler die Religion als erwünschte Gelegenheit benützten, einen barocken Expressionismus zu entwickeln, und die Religiösen sich dieser Kunst als Mittel bedienten, um zu den verschiedenen Arten religiösen Erlebens zu gelangen, für die ihre Temperamente sie geeignet machten. Und genau dieselben Beziehungen zwischen Religion und Kunst waren vorhanden gewesen, als die »Primitiven« einen vielgestaltigen Katholizismus als Gelegenheit benützten, eine besondere Art statischer Komposition zu schaffen, und die Religiösen diese Werke als Hilfsmittel, sei es bei der Glaubenserweckung, bei der Kontemplation oder beim Praktizieren von Magie.
Von Rom und dem Barock wollen wir uns für einen Augenblick Toskana und dem Rokoko zuwenden. Ein paar Kilometer von Siena steht inmitten der Weinberge ein großes Kartäuserkloster, Pontignano genannt, das heute von einem Dutzend oder mehr Bauernfamilien bewohnt wird. In den alten Zeiten hatte jeder Mönch eine Wohnung von drei Räumen – eine Küche, eine Schlafzelle und eine winzige Gebetzelle. Die Türen zu diesen Appartements gingen auf den Kreuzgang, und nach hinten hinaus lagen kleine ummauerte Gärtchen, wo ein Mann Gemüse ziehen und sein eigenes Grab graben konnte. Jeder Klosterbruder lebte unabhängig von allen übrigen, ein Einsiedler in einer Gemeinschaft von Einsiedlern, ein Schweigender unter Schweigenden. Die meisten Baulichkeiten in Pontignano stammen aus dem 14. Jahrhundert, wurden aber von einem Innendekorateur des 18. aufgefrischt. Unter seiner Leitung wurde die Kirche mit einem riesigen Hochaltar aus Holz geschmückt, so bemalt, dass es wie Marmor aussah, und die kleinen Oratorien, in denen die Mönche ihre privaten Andachten verrichteten, wurden mit Rokokoschnörkeln in Stuckarbeit ausgekleidet, bis sie den Boudoirs ebenso vieler Provinz-Pompadours ähnelten. Uns, mit unserem unverbesserlichen Geschichtssinn, erscheint diese Verbindung des hl. Bruno mit Ludwig XV. irrsinnig ungereimt. Aber welchen Eindruck machte sie auf die Mönche, die tatsächlich in diesen Räumen beteten? Begannen sie etwa plötzlich zu denken, zu fühlen und sich zu gehaben wie jene libertinösen Abbés, die wir uns in diese Art von Dekoration hineinzudenken pflegen? Gewiss nicht. »Nie reformiert, weil nie deformiert«, blieb der Kartäuserorden auf seinem Weg, ungeachtet der veränderten ästhetischen Mode. In ihren neu stuckierten Oratorien meditierten die Brüder über den Tod genauso, wie ihre Vorgänger das getan hatten, als die Ausschmückung einen Barock- oder Renaissance-, einen gotischen oder romanischen Stil aufwies. Stilarten ändern sich, Weltreiche entstehen und gehen zugrunde: der Tod aber bleibt sich gleich, eine früher oder später in der Erfahrung eines jeden Menschen auftretende nackte Tatsache – eine Tatsache, die keine Geschichte hat und für die daher alle geschichtlichen Veränderungen, ob politischer oder wirtschaftlicher, wissenschaftlicher oder künstlerischer Art, völlig unwesentlich sind. Die pompadourische Kunst in den Oratorien von Pontignano sagt uns gar nichts über die zeitgenössische Kartäuserreligiosität, die wie stets ihren Mittelpunkt in der Betrachtung des Todes hatte. Wir lernen nichts weiter aus ihr, als dass die Mönche des 18. Jahrhunderts es für nötig hielten, die alten Gebäude renovieren zu lassen, und dass die Einzigen, die das in einem Zeitalter, das noch nichts von Stilimitation und Antiquitätenfälschung wusste, zu tun verstanden, Männer waren, welche in der zeit- und landläufigen Kunsttradition erzogen waren.
Heutzutage sind die Religiösen übler daran als damals die Mönche von Pontignano. Nicht lebendiges Rokoko, sondern das schwindelhaft Mittelalterliche oder irgendein abscheuliches Stück massenerzeugter bondieuserie ist alles, was sie für ihre Zwecke finden können. Dennoch, trotz der Unwesentlichkeit der meisten modernen religiösen Kunst, blüht Religion in allen ihren Aspekten, vom fetischistischen bis zum kontemplativen, auch weiterhin und bringt ihre guten oder bösen Früchte hervor. Der Mensch ist ein Ganzes, und das ist vielleicht auch die menschliche Gesellschaft; aber sie sind Ganzheiten, welche wie Schiffe durch wasserdichte Zwischenwände abgeteilt sind. Auf der einen Seite eines Schotts ist die Kunst, auf der anderen die Religion. Es mag guter Wein in der einen und Spülicht in der anderen Abteilung sein. Die Verbindung zwischen den zweien besteht nicht in einer Röhre oder durch Osmose, sondern nur von oben her, nur im Verstand, der hinabblickt und beide gleichzeitig sehen und erkennen kann, dass sie (mehr in Gegenüberstellung als in Verschmelzung) demselben individuellen oder sozialen Ganzen angehören.
VARIATIONEN ÜBER EIN BAROCKGRABMAL
»Unsichtbar war«, wie wir alle wissen, »in den glücklichen Tagen heidnischer Kunst das Gerippe.« Und unsichtbar blieb es trotz Christentum während der meisten folgenden Jahrhunderte. Im Mittelalter liegen die gepanzerten Ritter, die Bischöfe mit Krummstab und Mitra, die Damen, die ihre Füße an den Rücken kleiner Hunde wärmen, alle beruhigend im Fleische und in voller Leiblichkeit da. Keine Totenschädel zieren ihre Grabmäler, keine gekreuzten Knochen, keine grausigen Schnitter. Künstler des Worts mögen rufen: »Mein Herz, es bricht entzwei, ach weh, Terribilis mors conturbat me«, aber Künstler des Steins begnügen sich damit, das Bildnis eines Schläfers auf einem Bett zu meißeln. Die Renaissance kommt, und noch immer dauert der Schlaf inmitten der skulptierten Träume von einem halb irdischen, halb himmlischen Paradies geruhsam fort.
Bacchanten, wie ihr solche kennt, vielleicht
Ein Dreifuß, Thyrsus oder eine Vase,
Der Heiland bei der Predigt auf dem Berg,
Sankt Praxedis im Strahlenkranz, und Pan,
Bereit, der Nymphe letzt' Gewand zu lüpfen,
Und Moses mit den Tafeln.
Um die Mitte des 16. Jahrhunderts aber ist bereits eine Veränderung erfolgt. Das Bildnis schläft nicht mehr; es hat die Augen geöffnet und sich aufgesetzt – idealisiert, veredelt wie auf den Mediceergräbern, oder ein nüchternes Porträt wie irgendeine dieser bewundernswerten Büsten in ihren runden Nischen zwischen den Pilastern eines klassischen Aufrisses. Und auf dem Sockel, unterhalb der lateinischen Inschrift, da gemahnt nicht selten (jedenfalls in Rom und nach 1550) ein kleiner Totenschädel aus knochenweißem Marmor den Beschauer daran, was er selbst bald sein wird, was das Urbild des Porträts bereits geworden ist.
Warum ist der Totenkopf gerade in diesem bestimmten Augenblick der Geschichte Mode geworden? Religiös Gesinnte könnten vermuten, dass er etwas mit der Gegenreformation zu tun hatte; medizinisch Gesinnte, dass ein Zusammenhang mit der im 16. Jahrhundert pandemischen Syphilis bestand, deren nasenlose Opfer eine dauernde Mahnung an das Ende des Menschen waren; künstlerisch Gesinnte, dass irgendein Grabsteinbildhauer der Zeit Geschmack an Knochen fand und eine glückliche Hand für sie besaß. Ich wage es nicht, unter den möglichen Alternativen zu wählen, sondern bin es zufrieden, die von jedermann, der in Rom gewesen ist, beobachtbare Tatsache zu verzeichnen, dass dort nach der Mitte des Jahrhunderts die Totenschädel unbezweifelbar vorhanden sind.
Mit den Jahren gewinnen dann diese Mahnungen ans Sterblichsein immer größere Wichtigkeit. Von Miniaturen des Dings hinter dem Gesicht wachsen sie in kurzer Zeit zu vollerblühten Nachbildungen in Todesgröße heran. Und plötzlich lassen sie sich, in Nachahmung jener körperlosen Seraphim auf mittelalterlichen und Renaissancegemälden, ein Paar Flügel wachsen und lernen fliegen. Und mittlerweile ist die Kunst der Spätrenaissance zum Barock geworden. Einer ästhetischen Notwendigkeit wegen, weil es nämlich einem selbstbewussten Künstler einfach unmöglich ist, weiterhin zu tun, was aufs vortrefflichste von seinen Vorgängern getan wurde, weicht das Symmetrische dem aus dem Gleichgewicht Gebrachten, das Statische dem Dynamischen, das Formalistische dem Realistischen. Gestalten werden plastisch dabei erfasst, wie sie ihre Stellung ändern; malerische Kompositionen versuchen aus ihrem Rahmen auszubrechen. Wo früher Unterbetonung war, herrscht nun emphatischer Nachdruck; wo sich Maß und Menschlichkeit fand, gibt es nun das Enorme, das Erstaunliche, den Halbgott und den epileptischen Untermenschen.
Man betrachte zum Beispiel diese Totenköpfe auf den Grabmonumenten. Sie haben an Größe zugenommen; ihre Todestreue ist überwältigend, und um die Ähnlichkeitswirkung zu erhöhn, hat der Bildhauer sie von ihrem alten Platz in der Mittelachse wegverlegt und zeigt sie nun nebenhin und unposiert im Profil oder Dreiviertelprofil, zum Himmel aufblickend oder ins Grab hinabsehend. Und ihre Flügel! Riesenhaft, wild schlagend, vom Wind geschwellt – die Flügel von Geiern in einem Orkan. Der Appetit aufs Unmäßige wächst mit dem, wovon er sich nährt, und zugleich mit ihm wächst die Virtuosität der Künstler und die Bereitwilligkeit ihrer Auftraggeber, für immer erstaunlichere Monumente zu zahlen. Um 1630 genügt der Totenkopf nicht mehr als memento mori; es ist notwendig geworden, das ganze Gerippe darzustellen.
Die grandiosesten dieser Mahnungen an unsere Sterblichkeit sind die mächtigen Gerippe, die Bernini für die Grabmäler Urbans VIII. und Alexanders VII. in St. Peter verfertigte. Majestätisch in seinen Gewändern und intensiv lebendig sitzt jeder der beiden Päpste dort oben und segnet sein Volk. Einige Spannen unter ihm befinden sich zu beiden Seiten seine besonderen Tugenden – Glaube, Mäßigkeit, Standhaftigkeit, wer mag es wissen? In der Mitte, unterhalb des Pontifex maximus, steht das gigantische Emblem des Todes. Auf Urbans Grabmal hält das Gerippe (ein wenig schief, denn es wäre unerträglich altmodisch und unrealistisch, wenn das Ding völlig horizontal wäre) eine schwarze Marmorrolle, beschrieben mit dem Namen und Titel des Papstes; auf Alexanders Grabmal ist das Ungeheuer, wie die Fotografen sagen, »erwischt worden«, gerade als es aus der in das Grabgewölbe führenden Tür geschossen kommt. Und es kommt wie eine Rakete herauf, in einem Winkel von sechzig oder siebzig Grad, und im Emporschießen hebt es mühelos sechs oder sieben Tonnen rotmarmorner Draperien hoch, welche die Starrheit des Architektonischen mildern und statisch Geometrisches in etwas Bewegliches und Unbestimmtes verwandeln.
Der Nachdruck liegt bei diesen beiden außerordentlichen Werken nicht auf Himmel, Hölle oder Fegefeuer, sondern auf körperlicher Auflösung und dem Grab. Der Schrecken, der solche Werke wie das Dies irae inspirierte, war der des zweiten Todes, des Todes, den ein zorniger Richter über die Seele des Sünders verhängt. Hier dagegen ist das Thema der erste Tod, der jähe Übergang von Belebtheit zu Fühllosigkeit und von weltlichem Ruhm zum Abendmahl mit dem Reichstag staatskluger Würmer.
Chi un tempo, carco d'amorose prede,
ebbe l'ostro alle guance e l'oro al crine,
deforme, arido teschio, ecco, si vede.[1]
Berninis Grabmäler sind keineswegs einzigartig. Die römischen Kirchen sind voll von mahnenden Gerippen. In Santa Maria sopra Minerva, zum Beispiel, ist ein kleines Monument an einer der Säulen auf der Nordseite der Kirche befestigt. Es bewahrt das Angedenken an einen gewissen Vizzani, wenn ich mich recht erinnere, einen Rechtsgelehrten, der einige Zeit vor der Mitte des 17. Jahrhunderts starb. Hier, wie bei den Wandmonumenten der Hochrenaissance, blickt eine Büste aus einer Rundnische hervor, die über dem langen lateinischen Katalog angebracht ist, welcher die Ansprüche des Toten auf die Aufmerksamkeit der Nachwelt aufzählt. Es ist die in ihrer intensiven Lebensähnlichkeit fast zur Karikatur gewordene Büste eines blühenden Mannes Mitte vierzig, der offenbar kein Narr ist, aber eine Miene abgeklärter und zweifelfreier Selbstgefälligkeit zur Schau trägt. Welch ein gewaltiger Erfolg ist – gesellschaftlich, beruflich, geschäftlich – sein Leben gewesen! Und wie stark fühlt er mit Milton: »Nichts frommt mehr als Selbsthochschätzung, die auf Recht und rechtes Maß sich gründet.« Aber plötzlich gewahren wir, dass die Büste samt ihrem runden Rahmen in einer fast verliebten Umarmung gehalten wird von einem Totengerippe in Hochrelief, das diagonal von links nach rechts über das Monument flitzt. Der gelehrte Jurist und alles, was er erreichte, alle seine Selbstzufriedenheit werden dahingerafft in Finsternis und Vergessen.
Von derselben Art, aber noch erstaunlicher sind die Grabmäler der Familie Pallavicini in San Francesco a Ripa. Von Mazzuoli zu Beginn des 18. Jahrhunderts ausgeführt, gehören diese Monumente zu den letzten und dabei extravagantesten Nachblüten aus dem Geist des Barocks. Bewundernswert gemeißelt, stehen die üblichen Tugenden am Sockel eines jeden der riesigen pyramidenförmigen Gebilde Wache. Über ihnen, mit gewaltigen Flügeln schlagend, hält ein drei Meter hohes Gerippe aus Bronze uns ein Paar ovaler Rahmen zur Besichtigung entgegen, welche die Büsten dahingeschiedener Pallavicini enthalten. Auf der einen Seite der Familienkapelle sehen wir die Bildnisse zweier fürstlicher Kleriker. Der Tod hält sie mit einer gewollten Nachlässigkeit, kippt ihre Rahmen ein wenig, den einen zur Linken, den anderen zur Rechten, sodass die ernsten, asketischen Gesichter wie durch die Bullaugen eines rollenden Schiffs hervorblicken. Ihnen gegenüber, in den Händen eines anderen und wenn möglich noch grausigern Gerippes zeigen sich zwei andere Angehörige der Familie – eine ältliche Prinzessin diesmal und ihr Gatte. Und was für ein Gatte! Unterhalb der majestätischen Perücke ist das Gesicht derb, vielkinnig, selbstgefällig, schwachsinnig. Hoher Blutdruck bläst den ganzen untersetzten Kerl fast bis zum Bersten auf; stolz hält er die Schweinsschnauze dauernd zum Himmel emporgerichtet. Und nun ist, was ihn emporhält, der Tod; Verwesung ist es, was mit triumphierendem Spott ihn zur Schau stellt, für immer in Marmor am Pranger, ein groteskes und jämmerliches Beispiel menschlichen Dünkels.
Zu dem kleinen Dicken dort oben in den Klauen des Gerippes hinaufblickend, überlegt man mit einer gewissen Verwunderung, dass irgendein Pallavicini dieses seltsame Monument für einen verstorbenen Verwandten in Auftrag gegeben und, wie anzunehmen, dafür bezahlt haben muss. Mit welcher Absicht? Um die Absurdität der Ansprüche des alten Herrn auf Großartigkeit bloßzustellen? Um alles, wofür er gelebt hatte, zum Spott werden zu lassen? Die Antwort auf diese Fragen ist zumindest teilweise bejahend. Alle diese Barockgrabmäler waren doktringemäß einwandfrei. Die Erben von Päpsten und Prinzen legten gewaltige Summen aus, um den Ruhm ihrer hervorragenden Vorfahren zu feiern – aber für Monumente, deren emphatisch christliches Thema die Vergänglichkeit irdischer Größe und die Eitelkeit menschlicher Wünsche ist. Worauf sie sich mit verdoppelter Tatkraft wieder der Aufgabe zuwandten, ihre eigene Gier nach Geld, Rang und Macht zu befriedigen. Ein Glaube an die Hölle und ein Wissen, dass jeder Ehrgeiz zur Vereitelung durch die Hand eines Gerippes verurteilt ist, haben die wenigsten Menschen je daran gehindert, sich so zu benehmen, als wäre der Tod nicht mehr als ein grundloses Gerücht und ein Überleben etwas jenseits der Grenzen des Möglichen. Die Menschen des Barocks unterschieden sich von denen anderer Epochen nicht durch das, was sie wirklich taten, nicht einmal durch das, was sie über ihr Tun dachten, sondern durch das, was von ihren Gedanken auszudrücken sie bereit waren. Ihnen gefiel eine Kunst, die sich immerzu mit Tod und Verwesung beschäftigte, und sie waren nicht besser und nicht schlechter als wir, die wir in solchen Dingen verschwiegener sind.
Der fantastische Totentanz in San Francesco a Ripa ist fast der letzte seiner Art. Dreißig Jahre nachdem diese Skulpturen gemeißelt wurden, konnte Robert Blair eine bescheidene Popularität durch das Schreiben solcher Verse wie dieser erreichen:
Mich deucht, ich seh ins Grab dich hingestreckt
Und übersatt auf deiner Rosenwange
Den wohlgenährten Wurm in trägen Ringeln
Sich rekeln ohne Scheu.
Die Bildhauer aber des 18. Jahrhunderts machten keinen Versuch, diese gruseligen Vorstellungen zu gestalten. Auf den Grabsteinen und Grabmälern dieser Zeit kommentiert der Tod nicht mehr die wahnsinnigen Prätentionen seiner Opfer. Abgebrochene Säulen, gelöschte Fackeln, weinende Engel und Musen – dies die Sinnbilder, die nun im Schwang sind. Der Künstler und sein Auftraggeber sind bestrebt, minder peinliche Gefühle als das Grauen vor Verwesung hervorzurufen. Mit dem 19. Jahrhundert betreten wir ein Zeitalter stilistischer Wiederbelebungen; aber niemals findet sich da eine Rückkehr zu den Grabmalmoden des Barocks. Seit der Zeit Mazzuolis bis zum heutigen Tag ist kein irgendeinem bedeutenden Europäer errichtetes Monument mit Totenköpfen oder Gerippen verziert worden.
Wir leben gewohnheitsmäßig auf mindestens drei Ebenen – der Ebene des ausschließlich individuellen Daseins, der Ebene intellektueller Abstraktion und der Ebene geschichtlicher Notwendigkeit und gesellschaftlicher Konvention. Auf der erstgenannten ist unser Leben völlig privat; auf den anderen ist es, zumindest teilweise, ein gemeinsames und öffentliches Leben. So befinde ich mich, wenn ich über den Tod schreibe, auf der Ebene verstandesmäßiger verallgemeinernder Begriffsbildung; als Teilhaber am Leben einer Generation, welche die Grabmalkunst des Barocks als wunderlich und fremd empfindet, auf der Ebene der Geschichte. Geht es aber tatsächlich einmal mit mir ans Sterben, werde ich auf der ersten Ebene sein, der Ebene ausschließlich individuellen Erlebens. Was im menschlichen Dasein gemeinsam und öffentlich ist, wurde stets für achtbarer gehalten als alles Private. Könige haben ihre Hofastronomen, Kaiser ihre amtlichen Historiografen; aber es gibt keine Leibgastronomen, keine päpstlichen oder kaiserlichen Pornografen. Unter allen Verbrechen werden die sozialen und geschichtlichen als unbeträchtliche Schwächen edler Gemüter verziehen, und die sie begehen, werden ganz allgemein bewundert. Die Wüstlinge und Völlerer hingegen werden von jedermann verurteilt – sogar von sich selbst (und darum waren sie Jesus so viel lieber als die achtbaren Pharisäer). Wir haben keinen Gott der Puffs, aber unser Gott des Piff-paff-puffs ist leider immer noch sehr rüstig.
Dieser Konflikt zwischen dem öffentlichen und Privaten, zwischen dem Sozialen und dem Individuellen, zwischen dem Historischen und dem Existenziellen, zumindest an dieser einen, wichtigen Front, ist der fundamentale Gegenstand barocker Kunst. Der Fürst mit seiner Allongeperücke, der Papst im Pallium und Fanone, der Rechtsgelehrte mit seinem lateinischen Lobspruch und selbstzufriedenen Lächeln – sie alle sind Stützen der Gesellschaft, Vertreter großer geschichtlicher Kräfte und sogar Geschichtemacher. Aber unter dem Schmunzeln und der Perücke und der Tiara befindet sich der Leib mit seinen physiologischen Vorgängen, welche mit niemand geteilt werden können; befindet sich die Seele mit ihren Einsichten und jähen Begnadungen, ihren abgründigen Albernheiten und ihren uneingestehbaren Begierden. Jede Gestalt der Öffentlichkeit – und in gewissem Maß sind wir alle öffentliche Gestalten – ist auch ein Inseluniversum privaten Erlebens; und das privateste aller dieser Erlebnisse ist das Herausfallen aus dem geschichtlichen Ablauf, das Getrenntwerden von der Gesellschaft – mit einem Wort, das Erlebnis des Todes.
Stets auf Unwissenheit beruhend – bald unüberwindlicher, bald willentlicher und selektiver – können geschichtliche Verallgemeinerungen nie mehr als teilweise wahr sein. Dennoch, auf die Gefahr hin, die Tatsachen zu entstellen, damit sie in eine Theorie passen, möchte ich behaupten, dass in irgendeiner gegebenen Epoche die Beschäftigung mit dem Tod in umgekehrtem Verhältnis steht zum Vorherrschen eines Glaubens an die Möglichkeit der Vervollkommnung des Menschen innerhalb einer richtigen Gesellschaftsordnung und mittels einer solchen. In der Kunst und Literatur des Zeitalters eines Condorcet, des Zeitalters eines Herbert Spencer und Karl Marx, des Zeitalters eines Lenin und der Geschwister Webb gibt es wenige Totengerippe. Warum? Weil im Lauf des 18. und 19. Jahrhunderts die Menschen zu dem Glauben an den Fortschritt kamen, an den Fortgang der Geschichte zu einer immer großartigen und besseren Zukunft, an das Heil, nicht für den einzelnen Menschen, sondern für die Gesellschaft. Der Nachdruck lag dabei auf Geschichte und Umwelt, welche beide für das primär Bestimmende des individuellen Schicksals gehalten wurden. Tatsächlich werden sie unter orthodoxen Marxisten nun (seit der Kanonisierung Lysenkos und dem gegen »reaktionären Morganismus« geschleuderten Anathema) für die einzigen Determinanten gehalten. Vorbestimmung, ob augustinische oder mendelische, ob karmische oder genetische, ist ausgeschlossen, und wir sind wieder zurück bei Helvetius und seinen Hirtenknaben, die alle in Newtons umgewandelt werden können; zurück bei John B. Watson und seinen unbegrenzt auf Reflexe drillbaren Kleinkindern. Mittlerweile bleibt es Tatsache, dass in dieser noch immer ünregenerierten Welt ein jeder von uns eine physische Konstitution und ein Temperament erbt. Überdies ist die Laufbahn eines jeden einzelnen Menschen wesentlich nichtfortschrittlich. Auf dem Höhepunkt der Reife beginnt auch schon der Abstieg bis zum Verfall und Tod des Körpers. Kann etwas schmerzlicher offenkundig sein? Und doch, wie selten ist in den letzten zweihundertfünfzig Jahren der Tod zum Gegenstand irgendeines beträchtlichen Kunstwerks gemacht worden! Unter den großen Malern hat nur Goya sich den Tod zum Vorwurf gewählt, und auch er nur den gewaltsamen Tod, den Tod im Krieg. Die Bildhauer von Grabmälern spielen, wie wir gesehen haben, stets auf der Skala der den Tod umgebenden Gefühle – einer Skala, die vom Edeln und Erhabnen bis zum Zärtlichen und sogar Wollüstigen reicht. (Die köstlichsten Hinterbäckchen im ganzen Repertoire der Kunst sind auf Canovas Grabmonument für die letzten Stuarts zu finden.)
In der Literatur desselben Zeitalters ist der Tod häufiger behandelt worden als in der Malerei oder der Bildhauerei. Aber (zumindest meiner Kenntnis nach) nur ein einziges Mal mit völliger Zulänglichkeit. Tolstojs Der Tod des Iwan Ilyitsch ist eins der künstlerisch vollendetsten und zugleich eins der erschrecklichsten Bücher, die je geschrieben wurden. Es ist die Geschichte eines durchaus alltäglichen Menschen, der gezwungen ist, Schritt für qualvollen Schritt zu entdecken, dass die öffentliche Persönlichkeit, mit der er sich sein Leben lang identifizierte, kaum mehr als ein Gebilde der kollektiven Fantasie und sein wesentliches Selbst das einsame, von der Umwelt abgeschnittene Geschöpf ist, das krank wird und leidet, die Welt zurückweist und von ihr zurückgewiesen wird, sich zuletzt (denn die Geschichte hat einen glücklichen Ausgang) in sein Schicksal findet und sich in dem Akt der Ergebung, gerade im Augenblick des Todes, allein und nackt angesichts des Nichts wiederfindet. Die Bildhauer des Barocks befassen sich mit demselben Thema; aber sie »beteuern zu viel«, und ihr bewusstes Streben nach Erhabenheit neigt dazu, die eigene Absicht zu vereiteln. Tolstoj wird nie emphatisch, leistet sich keine rhetorischen Schnörkel, spricht ganz schlicht von den schwierigsten Dingen und tonlos und sachlich von den fürchterlichsten. Darum hat seine Erzählung eine solche Gewalt und wirkt so tief verstörend auf unsere gewohnte Selbstzufriedenheit. Wir sind durch sie auf fast ganz dieselbe Weise schockiert, auf die wir durch Pornografien schockiert werden, und aus demselben Grund. Das Geschlechtliche ist etwas fast ebenso völlig Privates wie der Tod, und ein Kunstwerk, das machtvoll die Wahrheit über jenes oder diesen ausdrückt, ist der achtbaren öffentlichen Gestalt, die zu sein wir uns einbilden, sehr peinlich. Niemand kann die Tröstungen der Religion oder Philosophie erlangen, wenn er nicht zuvor ihre Desolationen, ihre Trostlosigkeiten, erlebt hat. Und nichts ist trostloser als eine gründliche Erkenntnis des privaten Ich. Daher die Nützlichkeit solcher Bücher wie Iwan Ilyitsch und, so möchte man hinzuzufügen wagen, solcher Bücher wie Henry Millers Wendekreis des Krebses.
Und hier gestatte man mir eine Nebenbemerkung über die Pornografie des Zeitalters, das den Aufstieg der Ideen des Fortschritts und des sozialen Heils sah. Das meiste von ihr ist bloß unbeträchtliche Verspieltheit, bloß Erfüllung von Wunschträumen – Boucher bis zum logischen Schluss getrieben. Der gefeiertste Pornograf jener Zeit, der Marquis de Sade, ist eine Mischung aus wirklichkeitfliehendem Maniak und philosophe. Er lebt in einer Welt, wo wahnsinniges Fantasieren mit nach-voltairischem Vernunftdenken abwechselt; wo unmögliche Orgien unterbrochen werden, damit die Teilnehmer manchmal klug, öfter aber auf die seichteste Weise des 18. Jahrhunderts über Moral, Politik und Metaphysik reden können. Hier, zum Beispiel, ein typisches Stückchen Sadescher Soziologie. »Ist Inzest gefährlich? Gewiss nicht. Er erweitert die Familienbande und macht daher die Vaterlandsliebe des Staatsbürgers tatkräftiger.« An dieser Stelle, wie im ganzen Werk dieses wunderlichsten Produkts der Aufklärung, unsere wir die öffentliche Gestalt ihr Dümmstbestes tun, um die ihrem Wesen nach unrationalisierbaren Tatsachen des privaten Daseins zu rationalisieren. Aber was wir brauchen, wenn wir uns selbst kennen sollen, ist der wahrheitsgemäße und eindringliche künstlerische Ausdruck gerade dieser unrationalisierbaren Tatsachen – der Tatsachen des Todes, wie in Iwan Ilyitsch, der Tatsachen des Sexus, wie im Wendekreis des Krebses, der Tatsachen des Schmerzes und der Grausamkeit, wie in Goyas Desastres, der Tatsachen der Furcht und des Ekels und der Erschöpfung, wie in diesem ganz entsetzlich wahrhaften der vielen Kriegsbücher, Die Nackten und die Toten. Unkenntnis ist eine Seligkeit, die wir uns nie leisten können; aber nur uns selbst zu kennen, ist nicht genug. Wenn sie eine fruchtbringende Desolation sein soll, muss Selbsterkenntnis der Weg zu einer Erkenntnis des anderen werden. Sonst ist sie nur eine andere Form der Unkenntnis und kann nur zu Verzweiflung und selbstgefälligem Zynismus führen. Herumtappend zwischen Zeit und Ewigkeit, sind wir Amphibien und müssen diese Tatsache hinnehmen. Noverim me, noverim, Te – dieses Gebet drückt eine wesentlich realistische Haltung gegenüber dem Weltall aus, in welchem wir, ob wir wollen oder nicht, leben und sterben müssen.
Der Tod ist nicht das einzige private Erlebnis, mit dem sich die Barockkunst beschäftigt. Ein paar Schritte von den Pallavicinigräbern entfernt liegt Berninis Statue der sel. Ludovica Albertoni in Ekstase rücklings hingestreckt. Hier wie bei desselben Künstlers hl. Teresa besitzt das festgehaltene Erlebnis etwas so besonders Privates, dass der Beschauer auf den ersten Blick einen Schock der Verlegenheit empfindet. Wenn man diese reich geschmückten Kapellen in San Francesco und Santa Maria della Vittoria betritt, hat man den Eindruck, eine Schlafzimmertür im unschicklichsten Augenblick geöffnet zu haben, fast als hätte man den Wendekreis des Krebses bei einer seiner verblüffendsten Seiten aufgeschlagen. Die Haltung dieser Ekstatiker, ihre Miene und der Überschwang des kuttelnartigen Faltenwurfs, der sie umgibt und bei der Albertoni in einer Art peritonalen Katarakts auf den Altar hinunter überfließt – das alles zusammen bewirkt eine Betonung der Tatsache, dass Heilige zwar bedeutende historische Gestalten sein mögen, ihre Physiologie aber etwas so beunruhigend Privates ist wie die irgendeines anderen Menschen.
Durch die innere Logik der Tradition, innerhalb welcher sie schufen, waren die Künstler des Barocks zu einer systematischen Ausbeutung des Übermäßigen verpflichtet. Daher das epileptische Benehmen ihrer gestikulierenden oder einer Ohnmacht nahen Gestalten und daher auch ihr Misserfolg beim Suchen eines angemessenen künstlerischen Ausdrucks für das mystische Erlebnis. Dieser Misserfolg erscheint einem noch erstaunlicher, wenn man sich erinnert, dass ihre Zeit eine große Blüte mystischer Religion sah. Sie war das Zeitalter des hl. Johannes vom Kreuze und Benet von Canfields, der Mme Acarie und Pater Lallemants und Charles de Condrens, eines Augustine Baker, eines Surin und eines Olier. Diese alle hatten gelehrt, dass das Ziel des spirituellen Lebens die vereinende Erkenntnis Gottes ist, sein unmittelbares Erleben jenseits des diskursiven Verstands, jenseits des Vorstellungsvermögens, jenseits aller Gemütsbewegung. Und alle hatten sie ausdrücklich betont, dass Visionen, Verzückungen und Wunder nicht »die echte Ware« seien, sondern bloße Nebenprodukte, die, zu ernst genommen, verhängnisvolle Hindernisse des spirituellen Fortschritts werden können. Aber Visionen, Verzückungen und Wunder sind erstaunliche und pittoreske Ereignisse, und erstaunliche und pittoreske Ereignisse waren die vorbestimmten Vorwürfe von Künstlern, welche sich mit dem Übermäßigen zu befassen hatten. In der barocken Kunst wird der Mystiker entweder als ein mit übernormalen Kräften begabtes Medium oder als ein Ekstatiker dargestellt, der aus der Geschichte ausscheidet, um allein zu sein, aber nicht mit Gott, sondern, in einem von Geschlechtsgenuss kaum unterscheidbaren Zustand, mit seiner (oder ihrer) Körperlichkeit. Und dies trotz allem, was die zeitgenössischen Meister des spirituellen Lebens damals über das Gefährliche gerade dieser Dinge sagten.