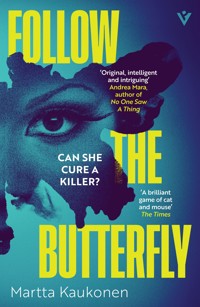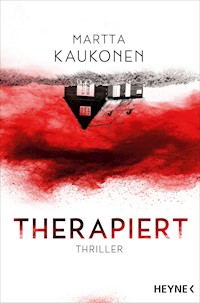
12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Ira-Reihe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Auf der Shortlist für den Viktor Crime Award 2024
Wer zu tief in der Seele schürft, entfesselt das Böse
Star-Therapeutin Clarissa Virtanen hat schon viele schwierige Fälle behandelt. Als die traumatisierte junge Ira vor ihr sitzt, die kaum ein Wort herausbringt, läuten bei ihr sofort die Alarmglocken. Ira scheint kurz davor, sich etwas anzutun. Das will Clarissa um jeden Preis verhindern. Schließlich darf sie nicht noch einen ihrer Schützlinge verlieren. Denn das würde auch ihr Leben zerstören, das längst nicht so perfekt ist, wie es nach außen scheint. Aber Clarissa ahnt nicht, dass Ira sie aus einem ganz bestimmten Grund als Therapeutin ausgewählt hat …
Ein Psychothriller der Extraklasse: Immer wenn du denkst, du hast die Geschichte durchschaut, wendet sich das Blatt erneut.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Ähnliche
Das Buch
»An jenem Abend hörte ich Iras Stimme zum ersten Mal. Ein leises Flüstern, als hätte sie aus dem Jenseits angerufen. Und so fing es an. Das Spiel, dessen Regeln sie mir nicht genannt hatte. Was das Schlimmste ist? Die schlaflosen Nächte, die Scham, die Gewissensbisse? Die Tatsache, dass ich alles verloren habe? Nein, das Schlimmste ist, dass ich mich Tag und Nacht nach ihr sehne.«
»Ich bildete mir ein, die richtige Person gefunden zu haben, musste aber die bittere Erfahrung machen, dass ich mich geirrt hatte. Clarissa Virtanen. Mir unterlief eine Fehleinschätzung, die ich mir nie verzeihen werde. Ich dachte, sie würde mir nur zuhören und nicht in den Ablauf der Ereignisse eingreifen. Ich weiß, dass sie darauf brennt, ihre eigene Version zu erzählen. Und sie schreckt vor keinem Mittel zurück, um mich zum Schweigen zu bringen.«
Die Autorin
Martta Kaukonen wurde 1976 geboren und lebt in Helsinki, wo sie als Filmkritikerin arbeitet. Mit ihrem Debüt Therapiert hat sie Presse und Leser in ihrer Heimat gleichermaßen begeistert. Die Faszination des Bösen begleitet sie auch im Alltag. Sie liebt Psychothriller, Film noir und verlassene Häuser.
Martta
Kaukonen
Therapiert
Thriller
Aus dem Finnischen
von Gabriele Schrey-Vasara
WILHELMHEYNEVERLAG
MÜNCHEN
Die Originalausgabe Terapiassa erschien erstmals 2021
bei Werner Söderström Ltd. (WSOY), Helsinki.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Diese Übersetzung wurde gefördert von
Deutsche Erstausgabe 12/2022
Copyright © 2021 by Martta Kaukonen
German edition published
by agreement with Martta Kaukonen and Elina
Ahlbäck Literary Agency, Helsinki, Finland.
Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Frauke Meier
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung von Adobe Stock (Oliverstockphoto)
und Shutterstock.com (kitsana1980)
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN: 978-3-641-29257-7V002
www.heyne.de
Vor allem sei die Heldin deines eigenen Lebens, nicht das Opfer.
NORAEPHRON
1. TEIL
DER RORSCHACHTEST
Ira
Im Zimmer war zu viel Blut. Nein, ich hatte nicht mit dem Blut meines Opfers Songtexte der Beatles an die Wand geschrieben, wie es die Manson Family zu tun pflegte. Aber auf dem Boden war ein riesiger Fleck. Kein herzförmiger, sondern so einer, den die Menschen beim Tintenflecktest als Schmetterling bezeichnen, weil sie sich schämen zu sagen, dass sie eigentlich Schamlippen sehen.
Ich begann, den Blutfleck genauer zu untersuchen, doch dann fielen mir meine Strümpfe auf. Sie waren so klebrig, dass sie an meinen Fußsohlen hafteten. Als ich näher an den Fleck herantrat, kam es mir vor, als würde ich über einen regennassen Rasen gehen. Die blutigen Fußabdrücke folgten mir von der Leiche zum Teppich. Ich erschauderte. Wieso hatte der Fleck eine solche Ähnlichkeit mit dem Bild auf der ersten Karte des Rorschachtests?
Was hätte Freud dazu gesagt? Kann der Blutfleck eines Menschen, den du getötet hast, dein Unbewusstes abbilden? Oder sollte man ihn deuten wie das erkaltete Blei zu Neujahr? Ein Schmetterling: Du fliegst bald auf? Mord verleiht Flügel? Die psychoanalytische Theorie wäre wesentlich anders ausgefallen, wenn ich im Wien des 19. Jahrhunderts auf der Couch des misogynen Kokainisten gelegen hätte.
Jetzt bekommt ihr womöglich ein falsches Bild von mir. In Wahrheit bin ich sehr penibel. Ich habe nicht die Angewohnheit, meine Umgebung zu verschmutzen. Ich foltere. Ich morde. Ohne Spuren zu hinterlassen. Das ist Ehrensache für mich. Meinetwegen brauchen die Angehörigen des Opfers ihr Geld nicht für eine kostspielige Tatortreinigung auszugeben. Es war mir unbegreiflich, wieso mir die Karten diesmal aus der Hand geglitten waren.
Ich hatte den Mord sorgfältig vorbereitet und jede Einzelheit gründlich durchdacht. Allein schon über die Tatwaffe hatte ich mir tagelang den Kopf zerbrochen. Ich möchte, dass die jeweilige Waffe erzählt, warum ich gerade diesen Anzugträger ermorde.
Diesmal hatte ich mich für ein Filetiermesser entschieden.
Muss ich euch denn wirklich alles erklären? Das Messer ist eins der klassischsten Phallussymbole. Was hätte besser in die Brust eines Schürzenjägers gepasst, der sich jahrzehntelang von seinem Schwanz hat leiten lassen?
Alles hätte also ganz und gar in Ordnung sein sollen, aber plötzlich hatte das Chaos die Macht übernommen. Ich benahm mich wie eine jämmerliche Amateurin. Nun würde ich erheblich länger am Tatort bleiben müssen als geplant. Woher sollte ich jetzt noch die Zeit nehmen, die Leiche verschwinden zu lassen?
Ich hatte lange gesucht, bevor ich zufällig die perfekte letzte Ruhestätte für mein Opfer fand. Als ich einmal mit dem Nahverkehrszug von Helsinki nach Kerava fuhr und durch das staubige Fenster die bedrückende Gegend betrachtete, bemerkte ich in der Nähe des Bahnhofs von Savio einen kleinen Teich.
Das Internet wusste zu berichten, dass der Teich sich auf dem Grundstück einer alten Gummifabrik befand. Die Fabrik hatte ihre Produktion bereits 1985 eingestellt. Der Teich war voller Algen, sodass bestimmt niemand mehr darin schwimmen wollte. Wenn ich die Leiche in den Teich warf, würde ich mir obendrein die Mühe ersparen, ein Grab auszuheben.
Ich würde die Leiche meines Opfers im Kofferraum seines eigenen Wagens zum Teich bringen, die Plane, die ich in eine Sporttasche gepackt hatte, am Ufer ausbreiten, die Leiche auf die Plane legen und zersägen, die Plane, die Säge und die Leichenteile im Teich versenken, den Wagen auf dem Parkplatz am Bahnhof von Savio abstellen und mit dem letzten Zug nach Helsinki zurückfahren.
Die Leiche verschwinden zu lassen war für mich der schwierigste Teil beim Morden. Zum Glück verleiht das Adrenalin dem Menschen Superkräfte. Dank ihm war es mir immer wieder gelungen, Männer, die größer waren als ich, in den Kofferraum eines Autos und ins Grab zu schleppen.
Jetzt musste ich gegen die Zeit kämpfen, wenn ich meinen Plan durchziehen wollte, bevor irgendwer mein Opfer vermisste. Zum ersten Mal bei einem Mordtrip hatte ich das Gefühl, mich nicht auf mich selbst verlassen zu können. Mein Herz schlug heftiger. Eine Panikattacke fehlte mir gerade noch. Ich musste mich irgendwie beruhigen. Doch die Angst hatte mich schon gepackt. Eine derartige Sudelei konnte nur eine Folge haben: Ich würde erwischt werden.
Das Zuhause meines Opfers hatte meinen Erwartungen entsprochen. Es war die Sorte Wohnung, die man aus Inneneinrichtungssendungen kennt. Selbst wenn man sich die ganze Folge angesehen hätte, wäre man hinterher bestimmt nicht fähig, die Wohnung zu beschreiben. Man würde sich nur an die weiße Farbe erinnern, von der die enthusiastischen Moderatoren der Sendung behaupteten, sie habe mindestens zehn verschiedene Nuancen. Weißer Teppich, weiße Vorhänge, weißes Bett und als kühnes Detail ein ins Graue spielendes – aber trotzdem weißes – Bücherregal. Bin ich die Einzige, bei der die weiße Farbe Assoziationen an die geschlossene Abteilung einer psychiatrischen Anstalt weckt? Jetzt erinnerte das klinische Schlafzimmer des Opfers allerdings eher an einen OP-Saal in der Chirurgie. Ich verfluchte meine Stümperei.
Plötzlich fiel mein Blick auf ein Dekobild an der Wand. Live Love Laugh. Zu solchen Teebeutelaphorismen greifen nur Menschen, die ihre Gefühle nicht auszudrücken wissen, sondern darauf angewiesen sind, dass irgendwer sie für sie in Worte fasst. Ich kann meine Gefühle selbst ausdrücken: durch Töten.
Das Bild ließ mich an die Zettel denken, die Angehörige von Demenzkranken überall anheften, um die Patienten daran zu erinnern, wie man welchen Gegenstand nennt. Ich war mir sicher, dass das Opfer das trendige Bild nicht selbst ausgewählt, sondern von seiner Jahrzehnte jüngeren Freundin geschenkt bekommen hatte.
Ich starrte lange auf das Bild, dann zuckte ich plötzlich zusammen. Mein Herz setzte einen Schlag aus.
In der Mitte des o im Wort Love war ein roter Punkt.
Hastig ging ich näher heran. Tatsächlich, es war Blut. Wie hatte es so weit spritzen können?
Anfangs war alles so gut gelaufen, und jetzt: eine totale Katastrophe!
Es war leicht gewesen, in die Wohnung zu gelangen. Ich hatte mein Opfer so lange beobachtet, dass ich seine haarsträubende Gutgläubigkeit erkannt hatte. Ich hatte herausgefunden, dass der Mann in seinem Garten einen Reserveschlüssel aufbewahrte. Er versteckte ihn beim Weggehen immer zwischen den Sonnenblumenkernen im Vogelhäuschen. Seine Naivität war geradezu rührend.
Mein Opfer verbrachte seine Nächte auf den Wellen eines Statussymbols der Achtzigerjahre. Sein Bett dürfte eins der letzten seiner Art sein. Ich konnte von Glück sagen, dass ich mich mit dem Ellbogen auf dem Bett abstützte, als ich mein Filetiermesser zu schwingen begann, denn so merkte ich, dass es ein Wasserbett war. Wenn ich mein Messer versehentlich ganz durch den Körper des Opfers gestoßen hätte und es bis in die Wassermatratze gedrungen wäre, hätten die Nachbarn unter ihm Hunderte Liter Wasser auf den Kopf bekommen und wütend an die Tür gehämmert.
Mein Opfer schlief so fest, dass ich minutenlang dastehen und es betrachten konnte. Warum soll man sich unnötig beeilen? Ich will sicher sein, dass ich mein Opfer töten muss. Ich will nichts bereuen, wenn es zu spät ist.
Allerdings muss ich zugeben, dass ich meine Meinung auch bei keinem anderen meiner Opfer geändert habe. Selbst bei denen nicht, die mich angefleht haben, sie zu verschonen. Bei denen am allerwenigsten. Darauf muss ich einfach stolz sein. Ich unterziehe meine Opfer immer einer so genauen Vorauswahl, dass alle, die ins Finale kommen, es auch über die Ziellinie schaffen.
Ich habe gedämpftes Wimmern zu hören bekommen, tierisches Gebrüll und wirres Geschwätz, aus dem ich nicht schlau geworden bin. Man hat mir das Vaterunser vorgebetet und die Zehn Gebote, vor allem das fünfte. Aber ich habe mich nicht beirren lassen.
Also das Messer ziehen, in die Brust stoßen und so weiter. Ich glaube nicht, dass ihr so pervers seid wie ich, und darum wollt ihr sicher nicht mehr wissen. Nur das Allerwichtigste: Was empfinde ich beim Töten?
Nichts.
Auch diesmal nicht.
Alles wiederholt sich, es bleibt immer gleich. Jedes Mal hoffe ich, dass es diesmal anders wäre. Dass ich zum Leben erwache. Dass ich Energie aus meinem Opfer saugen könnte. Dass ich einen Grund bekäme zu leben. Dass ich das Gefühl hätte, Macht zu haben. Dass sich alle meine Probleme in Wohlgefallen auflösten. Dass sich endlich alles ändern würde. Dass meine Tat irgendeine Bedeutung hätte, ganz egal welche. Dass ich etwas begreifen würde. Dass ich das letzte Wort hätte. Vielleicht irgendeine Katharsis. Aber da ist nichts.
Nichts.
Und trotzdem versuche ich es wieder und wieder. Diesmal würde es anders sein, weil ich ihn am Morgen ermorde. Weil ich ihn mit einer Axt ermorde. Weil ich ihn schnell ermorde. Weil ich ihn ermorde, um mich zu rächen. Weil ich ihn ermorde, ohne ihn zu foltern. Weil ich ihn geräuschvoll ermorde. Weil ich lache, während ich ihn töte. Weil er den Tod verdient. Weil er sterben wollte. Weil er sowieso sterben würde.
Aber nichts änderte sich.
Das Gefühl war immer das gleiche: Es war nicht vorhanden.
Vielleicht kam ich deshalb auf die Idee, mit dem Töten aufzuhören. Oder ich hatte es einfach satt.
Dies würde das letzte Mal sein. Er sollte mein letztes Opfer sein. Eine große Ehre, nur würde er die Fanfaren leider nicht hören können.
Ich hatte den Gedanken kaum zu Ende gedacht, als ich schon lachen musste. Ich würde aufhören. Aber sicher! Was blieb mir dann? Töten war das Einzige, was ich noch hatte. Ohne das war ich leer.
Jeder Mensch hat eine Identität. Ich hatte nichts, woraus ich mein Ich konstruieren konnte. Ich war eine leere Leinwand, eine Ansammlung von Nichtigkeiten. Ich musste selbst ein Bild von mir erschaffen.
Serienmörderin, das war meine Identität.
Nomen est omen. Meine Eltern haben meinen Beruf gewählt. Warum hätten sie mich sonst Ira genannt? Mein Name bedeutet nämlich im Lateinischen Zorn.
Und wenn ich noch so sehr aufhören wollte, wie sollte ich das schaffen?
Der blutige Schmetterling zu meinen Füßen beantwortete meine Frage.
Ich würde eine Therapie beginnen.
Helsinkier Nachrichten
Ehemaliger Minister in Kerava verschwunden
Der pensionierte Finanzminister Uolevi Mäkisarja (Konservative Partei) verschwand gestern im Stadtteil Kilta in Kerava.
Mäkisarja wurde als Finanzminister während der Rezession in den Neunzigerjahren als strenger Kassenwart bekannt, der für »Nichtstuer«, wie er die Arbeitslosen nannte, keine Sympathien hegte.
Die Vermisstenmeldung erstattete Mäkisarjas Freundin, die Schauspielerin Mirri Kuuramo. Sie war wie verabredet zu Besuch gekommen, traf Mäkisarja aber nicht zu Hause an und setzte sich mit der Polizei in Verbindung.
Mäkisarjas Auto wurde am Sonntagabend auf dem Parkplatz am Bahnhof von Savio gefunden.
Der achtzigjährige Mäkisarja ist 170 cm groß und wiegt 70 Kilo. Er hat braune Augen, dunkelbraune Haare und einen Schnurrbart. Als er zuletzt gesehen wurde, trug er einen dunklen Anzug und eine graue Krawatte.
»Wir nehmen das Verschwinden alter Menschen äußerst ernst. Die Polizei beginnt schnellstmöglich mit der Suche nach dem alten Mann«, sagt Kommissarin Reija Jalkanen von der Polizei von Ost-Uusimaa.
Eventuelle sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei von Ost-Uusimaa telefonisch entgegen.
Clarissa
Alles begann mit einem Anruf. An dem Abend hörte ich Iras Stimme zum ersten Mal. Ein leises Flüstern, als hätte sie aus dem Jenseits angerufen.
Es war ein Mittwochabend – der zweite Januar 2019 – und schon beinahe elf Uhr. Ich saß im Wohnzimmer auf dem Sofa und sah mir die neueste Folge Studio A an, die ich aufgezeichnet hatte. Ich war am Vortag Gast im Studio gewesen und fragte mich gespannt, wie mein Auftritt gelungen war.
Ich hatte so viel zu tun gehabt, dass ich noch nicht dazu gekommen war, mir die Aufzeichnung anzusehen, aber nun hatte ich es mir endlich vor dem Fernseher bequem gemacht und die Beine salopp auf den Couchtisch gelegt. Nachdem ich die erste Viertelstunde der Sendung gesehen hatte, atmete ich erleichtert auf: Alles war perfekt gelaufen.
Auf dem Sofa im Fernsehstudio machte ich einen sachkundigen Eindruck.
Wir Frauen müssen unsere Kompetenz immer wieder beweisen, während bei Männern Sachverstand und Befähigung als gegeben betrachtet werden. Es war mir auf Anhieb gelungen, den Moderator der Sendung von meiner Autorität auf meinem Gebiet zu überzeugen. Er nickte hingerissen zu allem, was ich sagte.
Aber für eine Frau ist Sachkenntnis ein zweischneidiges Schwert. Männer fürchten sich vor intelligenten Frauen. Ich hatte schon vor langer Zeit begriffen, dass ich in jeder Hinsicht zu viel war.
Zu klug, zu begabt, zu verdient, zu kompetent.
Zu bedrohlich.
Aber zum Glück hatte ich einen Weg gefunden, die Männer dafür zu entschädigen, dass mein Verstand ihr zerbrechliches Selbstbewusstsein in Bedrängnis brachte. Ich machte mich klein wie Däumelinchen, indem ich mich möglichst sexy kleidete.
Meine aufreizende Erscheinung beruhigte jeden Mann. Sie erinnerte die Männer daran, dass auch ich – wie alle Frauen – letzten Endes nur ein Stück Fleisch war, auch wenn sie mir geistig nicht gewachsen waren.
Als ich also auf der Couch von Studio A saß, hatte ich, meiner Gewohnheit treu, meinen femininen Panzer angelegt. Ich trug einen pinkfarbenen Minirock von Versace, der so kurz war, dass es fast dreist wirkte, und eine enge rosa Bluse von Chanel, deren obere Knöpfe ich offen gelassen hatte und die eben deshalb kaum etwas der Fantasie überließ.
Zufrieden lächelnd betrachtete ich mein Ebenbild im Fernsehen. Ich nahm die Schüssel, die ich auf den Wohnzimmertisch gestellt hatte, wählte einen möglichst großen Kartoffelchip und steckte ihn mir in den Mund.
Als das Handy klingelte, schrak ich auf.
Verärgert drückte ich die Pause-Taste der Fernbedienung und schnappte mir das Handy vom Tisch. Unbekannter Anrufer. Ein Telefonverkäufer. Aber Telefonverkäufer rufen nicht so spät an. Vielleicht ein neuer Patient.
Hastig zerkaute ich den Chip und schluckte die Stücke hinunter.
»Clarissa Virtanen.«
Stille. Vielleicht war die Verbindung schlecht, und der Anrufer hatte mich nicht gehört. Ich versuchte es noch einmal.
»Clarissa Virtanen.«
Die Stille hielt an. Ich wollte gerade auflegen, als ich ein leises Flüstern hörte.
»Ira hier, hallo.«
Die Stimme kam aus weiter Ferne.
Ich kannte keine Ira.
»Hallo«, antwortete ich.
»Ich suche eine Therapeutin. Hätten Sie freie Termine?«
»Danke für Ihren Anruf. Mein erster freier Termin ist morgen früh um neun Uhr.«
Stille.
»Hallo! Sind Sie noch dran?«
»Ja. Morgen um neun Uhr passt mir.«
Ich nannte Ira die Adresse meiner Praxis und verabschiedete mich.
Und so fing es an.
Das Spiel, dessen Regeln sie mir nicht genannt hatte.
Was das Schlimmste ist?
Die schlaflosen Nächte, die Scham, die Gewissensbisse? Die Selbstvorwürfe, deren Chor ich nicht einmal nachts zum Schweigen bringe? Die Gedanken, die sich endlos im Kreis drehen? Die bodenlose Reue, die an meiner Seele nagt? Die höhnische Stimme in meinem Kopf? Die Angst, dass all das ewig weitergeht und ich nie mehr zur Ruhe komme? Die Tatsache, dass ich alles verloren habe?
Nein, das Schlimmste ist, dass ich mich Tag und Nacht nach ihr sehne.
Arto
Ich habe mir den Kopf darüber zerbrochen, ob ich den Namen Clarissa Virtanen vorher schon einmal gehört hatte. Höchstwahrscheinlich ja, denn sie suhlte sich in der Öffentlichkeit wie eine Sau im Dreck und ließ keine noch so kleine Gelegenheit aus. Aber ich lebte in meiner eigenen, schnapsgeschwängerten Blase und hatte ihr keinerlei Aufmerksamkeit geschenkt, obwohl ich als Reporter Prominente und Trends hätte beobachten müssen. Man kann also durchaus behaupten, dass ich erst durch Irmeli Lahjametsä, die Chefredakteurin der Helsinkier Nachrichten, zum ersten Mal von ihr hörte.
Ich bin mir sicher, dass es am 3. Januar 2019 war. Ihr fragt euch bestimmt, wieso mir das Datum in Erinnerung geblieben ist. An dem Tag waren genau sechs Jahre vergangen, seit meine geliebte Frau Marja starb.
Ich saß in der Helsinkier Innenstadt in der Schreibfeder, der Stammkneipe meiner Redaktion, und wartete darauf, dass der Tag in die Nacht überging.
Ich glaube so wenig an Geister wie an Gespenster. Dennoch war mir, als ob Marja versuchte, aus ihrem Grab heraus Verbindung zu mir aufzunehmen und mir etwas zu erzählen. Es war kein angenehmes Gefühl, eher ein Unheil verkündendes.
Vielleicht hatte Marja ein Geheimnis mit ins Grab genommen, das sie gern mit mir geteilt hätte, von dem ich aber nichts wissen wollte?
In meinen Gedanken war noch ein zweiter Mensch anwesend. Ein Mensch, den ich immer lieben werde, auch wenn wir uns nie wiedersehen. Der Sinn meines Lebens.
Das Stakkato hochhackiger Schuhe riss mich aus meiner nostalgischen Melancholie. Meine Augen öffneten sich und begannen, nach einem Fluchtweg zu suchen. Zu spät. Jemand tauchte vor mir auf und umarmte mich.
Es war eine herzliche Geste. Nach der ersten Verblüffung sah ich, dass es Irmeli war, die da vor mir stand; sie hatte bloß ihre lange blonde Perücke gegen einen schwarzen Lockenschopf ausgetauscht.
Durch die aggressive Krebsbehandlung hatte Irmeli ihre Haare verloren, aber die schwere Krankheit hatte ihr glühendes Engagement für ihre Arbeit nicht beeinträchtigt. Der neue Look stand ihr besser als die blonde Mähne. Ihre veilchenblauen Augen kamen in dem schwarzen Rahmen erst richtig zur Geltung.
Irmelis Blick wanderte über die leeren Biergläser, die sich vor mir auf dem Tresen angesammelt hatten. Es war nicht schwer, ihre Gedanken zu erraten.
Ich versuchte, unauffällig einen Blick in den Spiegel hinter der Theke zu erhaschen. Es war kaum zu glauben, dass man mich in jüngeren Jahren als attraktiv bezeichnet hatte. Die hohen Wangenknochen waren nur noch eine Erinnerung. Stattdessen hing dort schlaffes Fleisch. Meine imposante Nase war bei einem besoffenen Zusammenstoß mit der Kühlschranktür gebrochen, eine Narbe am linken Nasenrand erinnerte an das Unglück. Meine Haare waren früher dick wie Rosshaar gewesen, inzwischen aber so dünn geworden, dass die Strähnen, die ich zum Pferdeschwanz gebunden hatte, nicht mehr an eine Löwenmähne erinnerten, sondern an ein Mäuseschwänzchen. Meine grünen Augen, die in meiner Jugend hell geleuchtet hatten, waren trüb wie Teiche, die von Blaualgen erobert worden waren.
Im Sommer stand mein fünfzigster Geburtstag an, aber mein Spiegelbild verriet, dass ich keinen Grund zum Feiern hatte.
Irmeli blickte von den Biergläsern zu mir auf. Sie sah mir in die Augen, und ihr Ärger verwandelte sich in Mitleid. Die Predigt blieb mir erspart – diesmal.
Bald nach Marjas Tod war ich wegen meines Alkoholismus bei den Helsinkier Nachrichten gefeuert worden. Seitdem hatte ich als Freelancer gearbeitet, und Irmeli bestellte immer noch Reportagen bei mir.
»Artsi, gut, dass ich dich treffe. Ich hab einen Auftrag für dich. Gleich muss ich hier ein Interview führen, aber vorher kann ich dich kurz briefen.«
Eigentlich hatte ich keine Lust, mich mit beruflichen Dingen zu befassen. Aber ich musste mich lieb Kind machen, denn Irmeli hatte mir schon ziemlich viel verziehen. Sicher zu viel.
Also bemühte ich mich, interessiert zu wirken.
»Es ist genau dein Ding.«
Mit diesem Mantra jubelte Irmeli ihren leidenden Opfern jeden Auftrag unter.
»Ein persönliches Interview mit einem wirklich interessanten Menschen. Preisverdächtig.«
Was auch sonst. Ich hasste persönliche Interviews. Ja, ich hasste meine Arbeit. Und ich hasste mein Leben. Außerdem war ich nicht auf den großen Journalistenpreis aus.
»Die Titelstory für die neue Lifestyle-Beilage ist noch frei.«
Irmeli war reichlich früh zugange. Die Beilage sollte erst im Sommer erscheinen. Sicher hatte sie eine Person im Sinn, deren Interview auch für die Innenseite der Zeitung taugte, falls man im Sommer doch etwas anderes für die Titelseite wollte. Jedenfalls bliebe mir genügend Zeit, um das Interview zu führen.
»Du darfst die Therapeutin Clarissa Virtanen interviewen.«
Warum schob Irmeli das Interview mit der Therapeutin ausgerechnet mir zu?
Sie drückte mir einen Zettel in die Hand, auf dem eine Telefonnummer stand.
Wenn ich mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen könnte, würde ich das Feuerzeug aus der Tasche meiner Lederjacke nehmen, den Zettel zerknüllen und an Ort und Stelle zu einem Häufchen Asche verbrennen.
Ira
Ich hätte euch gleich warnen müssen. Ich lüge nämlich. Chronisch und pathologisch. Selbst wenn es um irgendetwas völlig Belangloses geht.
Fragt mich, ob ich Katzen oder Hunde lieber mag, dann sage ich Hunde, obwohl ich Katzen liebe und Hunde nicht ausstehen kann: Sie stinken, ihr Fell wird nass, sie tragen an ihren Pfoten Dreck ins Haus und kläffen nervtötend. Trotzdem antworte ich, dass ich Hunde liebe. Warum? Ich habe so lange gelogen, dass ich nicht mehr anders kann.
Und wenn man lange genug lügt, beginnen Wahrheit und Lüge sich zu gleichen. Die meisten Menschen dürften der Meinung sein, dass es gut wäre, sie auseinanderzuhalten. Edel und moralisch richtig. Ich bin mir da nicht so sicher. Die Lüge ist meine Wahrheit.
Außerdem glaube ich nicht an Ehrlichkeit. Die meisten haben sich selbst so oft belogen, dass sie auch anderen gegenüber nicht mehr die Wahrheit sagen können. An der Scheidung ist der Partner schuld, die Probleme im Beruf verursacht der unerträgliche Chef, und wenn deine Tochter eine selbstzerstörerische Magersüchtige wird, wer trägt die Schuld? Du jedenfalls nicht.
Und wenn man viel lügt, wird man gut darin.
Wenn ich wollte, könnte ich auch euch alles Mögliche glauben lassen.
Alles Mögliche.
Aber jetzt kennt ihr meine Neigung, also seid auf der Hut.
Ich habe behauptet, dass ich mit dem Töten aufhöre. Pah! Das habe ich durchaus nicht vor.
Der Mensch ist ein faules Geschöpf. Fragt irgendwen, der euch begegnet, ob er gut in seinem Beruf ist, und ihr bekommt garantiert eine bejahende Antwort. Warum würde irgendwer weiterhin etwas tun, das ihn anstrengt? Die Menschen möchten es sich möglichst leicht machen. Es gibt nur zwei Dinge, in denen ich gut bin, aber in denen bin ich wirklich verdammt gut: Foltern und Töten. Warum sollte ich also aufhören?
Mein Wunsch, eine Therapie zu beginnen, hatte einen ganz anderen Grund.
Ich hatte Angst, geschnappt zu werden.
Männliche Serienmörder haben eins gemeinsam. Sie wollen mit der Polizei Katz und Maus spielen. Sie verteilen Hinweise an den Tatorten. Der Mord ist für sie kaum die Hälfte des Genusses. Sie geilen sich an dem Gedanken auf, dass sie intelligenter sind als die Bullen. Die Opfer sind bloß Schachfiguren. Der wahre Willenskampf wird zwischen dem Mörder und der Polizei geführt.
Mir waren die Polypen und ihre Theorien scheißegal. Sie konnten mir dankbar sein, denn immerhin hatte ich ihnen schon seit Jahren interessante Morde geliefert, an denen sie herumknobeln durften.
Wahrscheinlich widmete irgendein Bulle irgendwo in Finnland sein Leben dem Versuch, die Morde, die ich begangen hatte, aufzuklären. Womöglich zog er Gummihandschuhe über und befummelte die Indizien, die an den Tatorten gesammelt worden waren. Vielleicht starrte er finster auf Fotos von Verdächtigen an der Pinnwand und versuchte abzuschätzen, welcher von ihnen kaltblütig genug war, um sich als Serienmörder zu betätigen. Oder hatte er vielleicht schon kapituliert, sich krankschreiben lassen und seinen Nachfolger eingearbeitet?
Aber was spielte das für eine Rolle? Er tat nur seine Arbeit. Ich würde ihm nie begegnen, und das war gut so. Für mich war er ein Fantasieprodukt, ein Gespenst in Uniform. Aber als ich den blutigen Schmetterling betrachtete, der auf dem Schlafzimmerteppich meines Opfers die Flügel spreizte, begann ich die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass ich erwischt wurde. Der Gedanke klebte in meinem Gehirn wie Kaugummi.
Ich malte mir schon aus, wie ich in der Isolierzelle hockte – ja, dorthin würde man mich immer wieder stecken, denn ich würde bestimmt nicht mit den anderen Gefangenen auskommen, und das würde ich auch deutlich machen, mit Fäusten, Klauen und Zähnen.
Ich würde alles tun, um diesem furchtbaren Schicksal zu entgehen.
Finnland ist zu klein für Serienmörder. Es gibt hier auch nicht viele von uns. Wenn jemand gerade Geschmack am Töten gefunden hat, wird er auch schon gefasst. Ich hatte längst Rekorde gebrochen, aber damit will ich nicht prahlen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis irgendwer bei der Zentralkripo das Gesamtbild erkennen würde. Dann würden die nachlässig zusammengeschusterten Alibis mir nicht helfen. Ich wäre geliefert.
Zum Glück gibt es in unserem Land die aus dem Monopoly-Spiel bekannte Karte »Du kommst aus dem Gefängnis frei«.
Ich würde vor Gericht eine Untersuchung meines Geisteszustandes fordern. Irgendein Psychiater würde mit dem Schaufelbagger meine Psyche durchwühlen. Bei der Untersuchung würde festgestellt werden, dass ich bei der Verübung der Verbrechen nicht zurechnungsfähig gewesen war, also eingeschränkt schuldfähig. Im Volksmund: viertelverrückt. Unzurechnungsfähige werden nicht ins Gefängnis eingeliefert, sondern in eine psychiatrische Anstalt für Gefangene. Dann eine wundersame Genesung, Entlassung, und schon kann ich mich wieder meiner Lieblingsbeschäftigung zuwenden.
Ich wollte auf Nummer sicher gehen. Ich würde mir einen an Empathiefähigkeit leidenden, gutgläubigen Idioten aussuchen, und sollte ich geschnappt werden, würde dieser Therapeut ein so herzzerreißendes Gutachten über mich schreiben, dass man mich als unzurechnungsfähig betrachten musste.
Ein genialer Plan, oder?
Er hatte nur eine Lücke. Wie sollte ich die Therapie durchhalten?
Therapeuten werden gern dem Heiland gleichgestellt. Als würden Therapeuten sich selbstlos für ihre Patienten aufopfern, dabei ist es ja nur ihr Job. Man nennt sie schließlich nicht umsonst »Seelenklempner«.
Der Therapeut sitzt dir nur aus einem Grund gegenüber. Versucht mal, Hilfe von ihm zu bekommen, wenn ihr ihm dafür nicht 90 Euro oder den positiven Bescheid der Krankenversicherung über die Kostenübernahme für eine Rehabilitationspsychotherapie präsentieren könnt. Das weiche Sofa, das verständnisvolle Lächeln, die empathischen Worte – all das bleibt euch verwehrt, wenn ihr keine gängige Entschädigung zu bieten habt.
Ich machte mir also keine Illusionen darüber, dass mein Therapeut sich für meine Angelegenheiten interessieren würde. Hauptsache, er war manipulierbar. Er musste so fest an meine Unschuld glauben, dass er notfalls bereit war, vor Gericht für mich auszusagen, sollte es so weit kommen.
Na gut. Ich gebe zu, dass ich hoffte, im Gesicht meines Therapeuten wenigstens irgendeine echte Reaktion auf meine Erzählung zu sehen. Einen Hauch von egal was. Ich erwartete kein bestimmtes Gefühl. Ob Abscheu oder Bewunderung, war mir völlig egal.
Beim Morden faszinieren mich die Reaktionen meiner Opfer. Die Gefühle eines Menschen brennen nur dann auf voller Flamme, wenn er um sein Leben kämpfen muss. Es gibt also vielleicht doch noch etwas Menschliches in mir. Ich möchte die Gefühle anderer Menschen erleben.
Außerdem: Wenn meine Geschichte meinen Therapeuten berührte, könnte ich sicher sein, dass er alles für mich tun würde.
Im Nachhinein kann ich mir nur selbst die Schuld geben. Ich bildete mir ein, die richtige Person gefunden zu haben, musste aber die bittere Erfahrung machen, dass ich mich geirrt hatte.
Clarissa Virtanen.
Ich entdeckte die eifrig hechelnde Zicke bei Studio A. Sie schlängelte sich halb nackt auf dem Sofa im Fernsehstudio wie eine Kobra, die zum Flötenspiel eines Schlangenbeschwörers tanzt.
Die Witze, die der Moderator riss, mochten noch so blöd sein, Clarissa gackerte und gackerte und gackerte dermaßen, dass ich befürchtete, sie würde sich in die Hose machen.
Tussi. Wolkenkopf. Barbie. Spatzenhirn. Windkanal.
Gerade so eine Therapeutin wollte ich.
Aber mir unterlief eine Fehleinschätzung, die ich mir nie verzeihen werde.
Ich dachte, sie würde mir nur zuhören und nicht in den Ablauf der Ereignisse eingreifen.
Ich weiß, dass sie darauf brennt, ihre eigene Version zu erzählen.
Und sie schreckt vor keinem Mittel zurück, um mich zum Schweigen zu bringen.
Clarissa
Ohne meinen Mann Pekka wäre ich nicht fähig gewesen, nach der Arbeit in den Freizeitmodus zu schalten. Er bestand darauf, dass ich die beruflichen Dinge hinter mir ließ, wenn ich am Ende des Tages die Tür zu meiner Praxis schloss. Undenkbar, dass ich nach Feierabend in meinen Unterlagen geblättert hätte.
Pekkas Anweisung war mir nur recht. Ohne ihn hätte ich pausenlos über die Probleme meiner Patientinnen gegrübelt.
Wenn ihr in der Beziehung zwischen Pekka und mir irgendeine tiefere Bedeutung sehen wollt, die es nicht gab, nur zu! Aber nein, ich habe nie versucht, Pekka zu therapieren.
Pekka wusste nicht, dass ich oft ganze Nächte durchwachte und bei einem Glas Rotwein die Schwierigkeiten meiner Patientinnen wiederkäute. Dann saß ich in meinem seidenen Morgenmantel und meinen Leinenpantoffeln in der Küche und trank bis in die frühen Morgenstunden.
Königin leistete mir Gesellschaft. Ich hatte die Mischlingskatze im Winter vor dem Frost gerettet. Sie schmiegte sich an meine Beine, als ich im Schneetreiben an der Haltestelle auf den Bus wartete. Am Kopf hatte sie einen blutenden Kratzer, als hätte ihr gerade eine andere Katze mit den Krallen zugesetzt. Als ich das Tier auf den Arm nahm, begann es sofort zu schnurren. Da war es um mich geschehen.
Königin liebte es, in den Stunden nach Mitternacht Zeit mit mir allein zu verbringen. Sie strich mir um die Beine und schnurrte.
Ich genoss die Entspannung, die mir der Wein bescherte, bis es Zeit wurde, den nächsten Tag zu beginnen und den Problemen zu begegnen, zu denen ich in der Nacht so viel Distanz gewonnen hatte, wie der Alkohol mir gewährte.
Ich weiß, dass es nichts bringt, sich zu sehr auf die Probleme der Patientinnen zu fixieren. Das ist ein Zeichen für mangelnde Professionalität. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass meine Kollegen mitten in der Nacht darüber grübelten, wie sie die Scheidung eines Patienten verhindern oder ihm aus seiner Depression heraushelfen könnten. Ein Profi muss unbedingt fähig sein, sein privates und sein berufliches Ich voneinander abzugrenzen.
Ich bin zu empathisch für den Beruf der Therapeutin.
Pekka
Ich bewunderte Clarissa, weil sie ihr ganzes Leben der Aufgabe widmete, Schiffbrüchigen zu helfen. Als hätte sie sich schuldig gefühlt, weil sie es nach oben geschafft hatte, während ihre Patientinnen noch im trüben Wasser strampelten.
Mein Mut hätte nicht ausgereicht, um Tag für Tag der Finsternis ins Auge zu blicken.
Ich bin sicher, dass die meisten von Clarissas Patientinnen durch die Therapie geheilt wurden oder dass sich zumindest ihre Lebensqualität verbesserte.
Wie viele unter uns können von sich sagen, dass ihre Arbeit eine so große Bedeutung hat?
Clarissa hatte die Angewohnheit, jedes Mal eine Flasche Champagner zu entkorken, wenn ihre Therapiebeziehung zu einer Patientin ein erfolgreiches Ende nahm. Dazu ging sie auf unsere Terrasse und ließ den Champagner in die Luft spritzen wie ein Formel-1-Fahrer auf dem Siegerpodest. Den Rest des Getränks goss sie in eine Kristallschale und trank genießerisch einen Schluck daraus.
Clarissa bewahrte die Champagnerkorken in einem riesigen Weidenkorb auf. Zu Beginn ihrer Laufbahn fiel es meiner Frau schwer, nach der Arbeit abzuschalten, sie grübelte ständig über berufliche Angelegenheiten. Um das Problem zu lösen, probierte sie verschiedene entspannende Hobbys aus, bis sie feststellte, dass weder Häkeln noch Origami ihr Seelenruhe brachten.
Als Erinnerung an diese Experimente blieb in unserer Wohnzimmerecke der wütend dorthin geworfene, falsch geknotete Rohling eines Makramee-Wandbehangs zurück. Die einzige gelungene Handarbeit ist der für die Korken bestimmte Weidenkorb, was dem Umstand zu verdanken ist, dass ich ihn fertig geflochten habe. Der Korb ist schon randvoll.
Am nächsten Morgen war die Party vorbei, und auf Clarissas Couch saß bereits eine neue, um Hilfe flehende Patientin. Was sagt es über unseren Wohlfahrtsstaat aus, dass die Patientinnen Schlange standen? Clarissa konnte nicht alle Hilfesuchenden annehmen, obwohl sie ständig selbstlos Überstunden machte.
Die allermeisten Menschen im Sozialwesen müssen für einen miserablen Lohn schuften, ohne jemals Dank zu bekommen. Auch Clarissa wurde von ihrer Arbeit nicht reich, aber sie wurde umso höher geschätzt.
Clarissa war die Expertin für sexuellen Missbrauch und Gewalt in Finnland. Sie hatte als Sachverständige Einschätzungen für zahlreiche Zeitungsartikel geschrieben, aber die MeToo-Kampagne sprengte jeden Rahmen. Seit dem Beginn der Kampagne erkundigte sich mindestens einmal wöchentlich irgendein Medienvertreter nach Clarissas Auffassung.
Clarissa kümmerte sich wirklich um ihre Patientinnen, vielleicht sogar ein bisschen zu sehr. Bei uns zu Hause wurde nicht über die Angelegenheiten der Patientinnen gesprochen. Clarissa unterliegt ja der Schweigepflicht, hätte also ohnehin nicht über Einzelheiten reden können. Aber mir war es wichtig, dass sie in ihrer Freizeit die Kümmernisse ihrer Patientinnen vergaß und sich auf ihr eigenes Leben konzentrierte.
Es kam mir nicht in den Sinn, eifersüchtig auf Clarissas Patientinnen zu sein.
Ich glaubte an unsere Ehe.
Ich vertraute meiner Frau.
Berühmte letzte Worte …
Arto
Die Frau, die Irmeli interviewen sollte – irgendeine junge bildende Künstlerin, die gerade eine Einzelausstellung im Kiasma-Museum bekommen hatte –, flatterte theatralisch an die Bar der Schreibfeder und umarmte Irmeli.
Irmeli verabschiedete sich hastig von mir und beeilte sich, Drinks für sich und die Künstlerin zu bestellen.
Ich beschloss, sofort mit der Hintergrundrecherche für das Interview mit Clarissa Virtanen zu beginnen. Da ich immer entweder verkatert oder betrunken war, würde ich später auch nicht arbeitsfähiger sein als hier und jetzt auf dem Barhocker.
Also holte ich den Laptop aus der Aktentasche und googelte nach Informationen über Clarissa.
Eine Dreiviertelstunde später hatte ich alles Mögliche über sie gelesen. Meine Schlussfolgerung war, dass sie bereitwillig Interviews gab, aber nie über ihr Privatleben sprach. Der Albtraum jedes Reporters.
Clarissa Cristal Virtanen, 50, war seit einundzwanzig Jahren als Therapeutin tätig. Neben ihren Spezialgebieten kommentierte sie in den Medien gern auch andere fachliche Fragen, ob es nun um Mobbing am Arbeitsplatz, Narzissmus oder Scheidungen ging.
Wenn Clarissa als Expertin interviewt wurde, war sie präzise und analytisch. Ihre Gedanken waren klar und scharfsinnig. Unermüdlich verteidigte sie die Rechte von Mädchen und Frauen, und sie schien sich nicht darum zu kümmern, wie andere auf ihre Ansichten reagierten.
Clarissa traf den Kern der Sache und scheute nicht davor zurück, kühne Meinungen zu äußern. Anders als die meisten Experten redete sie nicht um den heißen Brei herum, sondern sagte unumwunden, mitunter sogar provozierend, was sie dachte. Zum Beispiel hatte sie kürzlich in einem Essay für die Wissenschaftsnachrichten proklamiert, dass die Behörden nicht willens waren, gegen Sexualverbrechen an Kindern vorzugehen.
»Der finnische Staat müsste sich offiziell bei allen Opfern von Pädophilen entschuldigen, so wie er sich 2016 bei denjenigen entschuldigt hat, die in den Pflegeheimen des Kinderschutzes vernachlässigt wurden«, argumentierte sie.
»Das finnische Gesetz schützt die Pädophilen, nicht ihre Opfer. Finnland kann nicht behaupten, ein Wohlfahrtsstaat oder ein zivilisiertes Land zu sein, solange es nicht für jede an Kindern begangene sexuelle Gewalttat Verantwortung übernimmt.
Das Gesetz müsste dahin gehend geändert werden, dass Erwachsene, die von pädophilen Delikten wissen, sie aber nicht bei der Polizei anzeigen, wegen Beihilfe bestraft werden.«
Ich erinnerte mich, dass der Essay eine rege Diskussion ausgelöst hatte, aber mir war entfallen, dass Clarissa ihn geschrieben hatte.
Meine Erinnerungslücke verwunderte mich nicht. Der Alkohol hatte schon viel wichtigere Dinge aus meinem Gedächtnis gespült.
Clarissas Ansichten waren so unmissverständlich und plakativ, dass es leicht war, Überschriften und sogar Schlagzeilen daraus zu fabrizieren. Kein Wunder, dass die Reporter allem Anschein nach ihrem Bann erlegen waren.
Clarissa war zwar nicht bereit, öffentlich über ihr Privatleben zu sprechen, ließ sich aber bei allen möglichen Events blicken. Wenn man den Klatschblättern glauben durfte, war sie mit vielen Promis befreundet. Sie war ein bekanntes Gesicht bei Filmpremieren für geladene Gäste und bei Präsentationen neu erschienener Bücher. Man konnte sie auf den Gesellschaftsseiten von Frauenzeitschriften entdecken, wo sie hinter dem riesigen Sonnenhut irgendeiner Benimmtrainerin hervorspähte oder um ein aus dem Fernsehen bekanntes Pärchen herumschwirrte, das gerade seine Hochzeitstorte anschnitt.
Clarissas Geheimnistuerei in Hinblick auf ihre Privatangelegenheiten überraschte mich nicht. Sie war eine typische Expertin. Diese Leute sind nicht bereit, irgendetwas über ihr persönliches Leben auszuplaudern. Stattdessen sollen die Interviews sich um ihre Verdienste und Theorien drehen, und der Reporter soll in seinem Artikel alle Preise, Ehrungen und Anerkennungen erwähnen, die sie je erhalten hatten.
Aber ich war ein schlauer Fuchs, es würde mir bestimmt gelingen, Clarissa ein Bein zu stellen.
Manche Reporter fürchten sich davor, Psychologen, Psychiater und Therapeuten zu interviewen. Sie haben wohl Angst, sich auf das Sofa des Interviewpartners legen zu müssen und in ihre Kindheit zurückgeworfen zu werden. Ich finde solche Ängste lächerlich.
Ich überlegte, ob Clarissa als Therapeutin so kompetent war, dass sie meine Probleme lösen könnte. Wie würde sie reagieren, wenn ich ihr erzählen würde, dass ich die wichtigste zwischenmenschliche Beziehung in meinem Leben verkorkst hatte?
Die Sehnsucht nagte an meinen Knochen.
Sie war so nah, aber ich hatte keine Möglichkeit, sie zu erreichen. Und sie konnte nicht ahnen, dass ich immer noch an sie dachte.
Ira
Eins habe ich noch vergessen zu erzählen. Clarissa war nämlich nicht meine erste Therapeutin. Ich hatte auf schäbigen Sofas, hölzernen Hockern und weichen Polstersesseln gehockt, seit ich zehn war.
Eines Tages hatte sich mein Verhalten einfach verändert, und meine Eltern haben nie herausgefunden, warum.
Als Zehnjährige wurde ich zur städtischen Kinderpsychologin geschickt. Sie lehnte jede weitere Sitzung ab.
Ich war angeblich normal.
Meine Eltern waren erleichtert, dass die Behandlung endete, bevor sie überhaupt begonnen hatte. Worüber man nicht sprach, das existierte nicht.
Meine Heimatstadt war so klein, dass alle alles voneinander wussten. Meine Eltern hatten Angst, jemand würde darüber tratschen, dass ihr kleiner Liebling in Behandlung musste.
Ich habe wohl schon erzählt, dass ich beim Anblick weißer Farbe an eine psychiatrische Klinik denken muss? Mit vierzehn kam ich in die jugendpsychiatrische Abteilung einer psychiatrischen Klinik. Ich hatte schon seit Jahren unter Magersucht gelitten.
Meine klapperdürre Erscheinung weckte überall mit Entsetzen vermischte Bewunderung. »Wäre ich doch auch so schlank, aber nicht krank«, seufzte eine Mitschülerin neidisch. Alle Mädchen und Frauen wollen ja schlank sein – aber wir Magersüchtigen rechnen nicht nach, wie viele Kilos uns noch von der Bikinifigur trennen, sondern wie viele noch zwischen uns und dem Tod liegen.
Ratet mal, was komisch ist.
Der Mensch glaubt immer, dass er eine normale Kindheit gehabt hat. Immer. Unabhängig davon, wie sie in Wirklichkeit war.
Auch ich habe meine Eltern gegenüber der Psychiaterin in der Klinik verteidigt. Sie taten doch ihr Bestes. Jeder hätte so gehandelt wie sie!
Dass ich in so schlechter Verfassung war, hatte nichts mit meiner Kindheit oder meinen Eltern zu tun, sondern lag nur an mir selbst.
Als ich bereits volljährig war, brachte mein Vater mich gegen meinen Willen zu einer Psychiaterin in einem privaten Ärztezentrum. Sie empfahl mir eine Psychoanalyse. Also das traditionelle Muster: auf dem Sofa liegen.
Solche archäologischen Ausgrabungen interessierten mich nicht.
Die Psychiaterin gab bereitwillig zu, dass ihre Kompetenz nicht ausreichte, um meine Probleme zu lösen. Sie drückte sich sehr vorsichtig aus, aber ich las zwischen den Zeilen, worum es ihr ging.
Sie wollte nicht riskieren, für meinen Selbstmord zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Clarissa
Ich suche in den Tiefen meines Gehirns nach der Erinnerung an unsere erste Begegnung. Wäre alles, was geschehen ist, zu verhindern gewesen? Es klingt verrückt, aber ich bin davon überzeugt: Sobald Ira meine Praxis betrat, versuchte mein Unbewusstes, mir zu sagen, womit ich es zu tun hatte.
Aber ich hörte nicht zu.
Ich habe die Angewohnheit, Beobachtungen im Zuge der Behandlung meiner Patienten aufzuzeichnen und die Unterlagen zu jedem einzelnen in einem separaten Ordner im Archivschrank meines Arbeitszimmers aufzubewahren.
Iras Ordner enthält nur einige DIN-A4-Bögen. Zum Teil sind sie voll beschrieben, auf anderen stehen nur einige Sätze. Zu manchen Sitzungen habe ich gar keine Notizen.
Die Dokumente bieten also keine nennenswerte Hilfe. Versucht einfach selbst mal, euch an die wichtigsten Ereignisse eures Lebens zu erinnern!
Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie Ira über mich lachen würde, wenn sie von meiner Bedrängnis wüsste.
Ich hatte ja nicht ahnen können, dass aus einer normalen Patientenakte wertvolles Beweismaterial werden würde, mit dessen Hilfe ich versuchen könnte zu beweisen … ja, was eigentlich?
Jedenfalls nicht meine Unschuld, denn jeder Versuch, meine Schuld abzustreiten, wäre sinnlos.
Vielleicht versuche ich auch gar nicht, irgendetwas zu beweisen. Eher zu erklären. Ich kann euch ja nur bitten, dass ihr versucht, mich zu verstehen. Allerdings fürchte ich, dass auch das unmöglich ist.
Ich werde mich immer an diesen Blick erinnern. Ira gab mir die Hand und sah mir in die Augen. Ihre Augen waren dunkelblau, so dunkel, dass sie in der schwachen Beleuchtung meiner Praxis fast schwarz wirkten. Poetisch ausgedrückt: Sie erinnerten an ein finsteres Meer, auf dessen Grund Rätsel verborgen waren, von denen ich nichts ahnte.
Der Blick war trotzig. Es war, als hätte sie mich zu einem Spiel aufgefordert, das Kinder lieben: das Spiel, bei dem man sich in die Augen sieht und derjenige verliert, der als Erster den Blick abwendet.
Ira durchschaute mich. Für meine anderen Patientinnen war ich vor allem ein Spiegel. In diesem Spiegel sahen sie, was sie wollten. Für manche war ich die Mutter, die sie nie geliebt, sondern mit jeder Geste ihre Verachtung ausgedrückt hatte, für andere der Vater, der sie gerade dann im Stich gelassen hatte, als sie den väterlichen Schutz am dringendsten gebraucht hätten. Bei Ira konnte ich mich nicht auf meine berufliche Rolle stützen.
Als wir uns zum ersten Mal die Hand gaben, hatte ich das Gefühl, dass in diesem einen flüchtigen Moment unermesslich viel passierte. Man sagt, dass unmittelbar vor dem Tod das ganze Leben vor den Augen des Sterbenden vorbeizieht. Ich hatte ein ähnliches Gefühl.
Ich war bereit, alles zu opfern.
Wie absurd!
All das erscheint euch sicher noch verworren. Ich habe pausenlos darüber nachgedacht, was falsch gelaufen ist. Jetzt habe ich die Antwort gefunden. Es ging bei allem nur um ein Missverständnis. Darum, dass die Dinge nicht so lagen, wie ich glaubte.
Ich verstand alles falsch, von Anfang an. Nichts war das, wonach es aussah. Nicht dieser erste Blick, und auch nichts anderes.
Ira hatte die ganze Zeit die Oberhand, obwohl ich glaubte, alles zu beherrschen. Sie ließ mich tanzen wie eine Marionette.
Ich glaubte, dass für uns dieselben Regeln galten wie in all meinen anderen Beziehungen zu Patientinnen.
Therapie beruht auf einer Illusion. Man muss den Patienten glauben lassen, er wäre am Ball, obwohl die Therapeutin die Richtung bestimmt.
Ira drehte die Konstellation um. Ich konnte mich nicht aus ihrem Griff lösen.
Mir war ja nicht einmal bewusst, dass ich ihre Gefangene war.
Arto
Als ich meiner Ansicht nach genug Hintergrundrecherchen über Clarissa angestellt hatte, konzentrierte ich mich wieder auf das Saufen. Ich bestellte ein Bier und widmete mich ihm an derselben Stelle am Tresen, an der ich schon hockte, seit der Pub am Morgen aufgemacht hatte. Den ganzen Tag über hatte ich versucht, die Trauer fernzuhalten, aber nun drängte sie sich so heftig in mein Bewusstsein, dass ich sie nicht mehr abwehren konnte.
Ich beschloss, die Gedenkfeier für Marja zu Hause fortzusetzen.
Auf dem Heimweg ging ich noch im Laden vorbei und holte mir einen Zwölferpack Bier. Er leistete mir auf dem Sofa Gesellschaft. Ich versuchte, mir einzureden, dass ich nicht zu betrunken war, schließlich war es ein Abend unter der Woche, und um es mir zu beweisen, beschloss ich, mir Studio A anzusehen, wie es sich für einen anständigen Journalisten gehört. Es war eine Wiederholung der Sendung vom Neujahrstag.
Auf dem Bildschirm erschien Clarissas Gesicht. Sofern ich den Verlauf des Gesprächs richtig verstand, ging es in der Sendung um Feminismus. Clarissas Expertise reichte aus, um auch dieses Thema zu kommentieren.
»Gleichberechtigung entsteht nicht ohne Quoten. Das ist ein Fakt«, sagte sie nachdrücklich.
Clarissa fühlte sich im Fernsehstudio wie zu Hause. Sie saß kerzengerade und mit ruhiger Miene auf dem Sofa. Allem Anschein nach machte es sie keine Spur nervös, vor der Kamera aufzutreten.
Sie sprach mit klarer und fester Stimme, war präzise in ihrer Wortwahl und brachte ihre Theorie allgemeinverständlich vor. Sie ließ sich nicht dazu hinreißen, ihre Kompetenz durch Fachjargon zu unterstreichen, sondern sorgte dafür, dass auch weniger Gebildete verstanden, was sie meinte.
Ich hatte den Fernseher zu spät eingeschaltet. Das Interview war zu Ende. Der Moderator schien von Clarissa ebenso gebannt zu sein wie ich. Er stotterte und wurschtelte hilflos herum, bis die Sendung mit Russland und Putins Jagdleidenschaft weiterging.