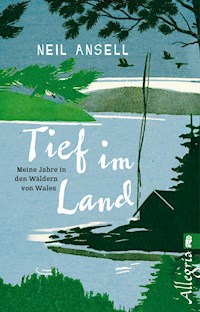
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Konzentriert, bildhaft, melodisch erzählt, hat der Text meditativen Charakter. Er vermittelt, was es heißt, ganz im Hier und Jetzt zu sein. "Tief im Land" entführt uns in die Ruhe eines archaischen, asketischen Lebens. Neil Ansell verbrachte fünf Jahre zurückgezogen in den Hügeln von Wales. In exzellenter Prosa erzählt er von seinem Alltag in einem alten, halb verfallenen Cottage ohne Strom und Gas. Im Laufe der Zeit verschmilzt er immer mehr mit seiner Umgebung. In bemerkenswerter Selbstvergessenheit beschreibt er Landschaft, Tier- und speziell die Vogelwelt. Auf wunderbare Weise gelingt es ihm, uns in die Stille des Landes hineinzuziehen. Begeisterte Stimmen "Dieses Buch ist ein Kleinod." BBC "Außergewöhnlich. Tief im Land ist so kraftvoll. Ansell zeigt uns, was wir sehen können, wenn wir allein sind." Independent "Das Besondere ist die Langsamkeit. Man taucht ein in einen Ort und eine Zeit, die anders ist." Guardian "Eine wunderschöne, zarte/klare Darstellung von Wales" Jay Griffiths "Berührend. Ansell erzählt mit Charme und Liebe zum Detail Geschichten im Rhythmus des Lebens in der Britischen Wildnis." Financial Times "Bemerkenswert, Faszinierend" Time Out "Ein Juwel von einem Buch, ein außergewöhnliches Märchen. Lehne dich in deinen tiefsten, bequemsten Sessel zurück und fliehe in eine andere Welt." Countryfile
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Das Buch
»Stellen Sie sich vor, Sie hätten die Gelegenheit, sich ganze fünf Jahre Zeit zu nehmen, frei von gesellschaftlichen und beruflichen Verpflichtungen. Jede Erkenntnis, die ich gewann, war das Ergebnis späterer Reflexion. Das Alleinsein führte mich nicht zur Innenschau, ganz im Gegenteil.«
Neil Ansell verbrachte fünf Jahre zurückgezogen in den Hügeln von Wales. In exzellenter Prosa erzählt er von seinem Alltag in einem alten, halb verfallenen Cottage ohne Strom und Gas.
Im Laufe der Zeit verschmilzt er immer mehr mit seiner Umgebung. In bemerkenswerter Selbstvergessenheit beschreibt er Landschaft und Tierwelt. Vor allem Vogelliebhaber werden begeistert sein.
Mit seinen Naturbeschreibungen gelingt es Ansell, uns in die Stille des Landes hineinzuziehen und in die Ruhe eines archaischen Lebens zu entführen.
Konzentriert, bildhaft und melodisch verfasst, hat der Text meditativen Charakter. Er vermittelt uns ein Leben ganz im Hier und Jetzt. Tief im Land ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, was es heißt, allein in der Natur zu leben.
Der Autor
Neil Ansell ist ein mit Preisen ausgezeichneter britischer Fernsehjournalist der BBC und schreibt für verschiedene Zeitungen wie Guardian und New Statesman. Er hat über 50 Länder bereist, bevor er sich für fünf Jahre in ein abgelegenes Cottage in Wales zurückzog. In England wurde sein Buch Tief im Land zweifach für literarische Auszeichnungen nominiert. Er lebt heute mit seiner Familie in Brighton, England.
NEIL ANSELL
Tief im Land
Meine Jahre in den Wäldern von Wales
Aus dem Englischen von Ulrike Kretschmer
Die Originalausgabe erschien 2011 unter dem Titel Deep Country – Five Years in the Welsh Hillsim Verlag Penguin Books, London, UK.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.
Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.
ISBN 978-3-8437-1448-8
© 2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin
© der Originalausgabe 2011 by Neil Ansell
Übersetzung: Ulrike Kretschmer
Lektorat: Vera Baschlakow
Umschlaggestaltung: ZERO GmbH, München
Umschlagmotiv: Getty Images, ©CSA Images
Illustrierte Karte im Kapitel Prolog © Andrew Farmer
E-Book: LVD GmbH, Berlin
Alle Rechte vorbehalten.
Prolog
Diejenigen, die so nett sind, mich mit dem Auto mitzunehmen, scheinen immer verwirrt zu sein, wenn ich ihnen sage, wo sie mich absetzen können. Die von eng geschlossenen Kiefernreihen flankierte Straße macht an der Stelle, an der ein Pfad in den Wald abzweigt, einen langen, schwungvollen Bogen. Allerdings ist der Pfad für den, der nicht genau weiß, wonach er suchen soll, unsichtbar. Gewissermaßen ein Hauch von einem Pfad – ich bezweifle stark, dass ihn irgendjemand außer mir in den letzten Jahren benutzt hat. Ich betrete die kühle Stille des Kiefernwaldes und gehe zur Talsohle hinunter. Durch die Baumstämme kann ich den Lichtschimmer auf dem Wasser weit dort unten sehen. Hoch über mir vollführt ein Sperberweibchen kunstvolle Kreise im Balzflug.
Über den Fluss führt ein Steg, eine alte Hängebrücke, auf der ich stehen bleibe. Ich lehne mich ans Geländer und sehe flussabwärts aufs Wasser hinab, das über untergetauchte Felsen schießt und hier und da kleine, moosbedeckte Inseln freigibt. Die Stunden, die ich damit verbracht habe, diesem Fluss zuzusehen, ziehen vorbei, manchmal im Schneckentempo und manchmal als reißender brauner Sturzbach. Dann sehe ich auf: Der Tag schreitet voran, und ich muss noch einen Berghang hinaufklettern. Das steilste aller steilen Felder – streckt man die Arme nach vorn aus, während man es hinaufgeht, kann man beinahe den Boden vor sich berühren. Es ist Mai, über dem Feld liegt ein blauer Schleier, die Luft ist schwer von Duft. Eigentlich wachsen die violetten Hasenglöckchen im Wald, nicht auf Wiesen, doch vor langer, langer Zeit war dieses Feld hier bewaldet, und so ist die Erde immer noch von den größten Zwiebeln, die selbst ein Traktor nicht herausziehen kann, durchsetzt. In Erinnerung an alte Zeiten zeigen sich hier jedes Frühjahr Tausende von Hasenglöckchenblüten; die Ableger des Geistes eines Waldes.
Jenseits eines morschen Gatters befindet sich die Heide. Die fest eingerollten Blätter des Farnkrauts entfalten sich, und der ganze Abhang explodiert geradezu vor neuem Leben. Bald wird der Farn Kopfhöhe erreicht haben, während der Pfad sich wie ein grüner Tunnel durch ihn hindurchschlängelt. Ein Rotmilanpaar kreist gemächlich über dem Tal, ein einzelner Rabe überfliegt, gerade und entschlossen, die Felder unter mir und krächzt, als er mich sieht. Ich folge ihm, ich weiß genau, wohin er will. Der helle, trillernde Ruf eines Brachvogels rinnt die Talflanke hinunter. Die Hügel rufen; immer rufen sie mich zurück.
Für den Uneingeweihten ist das Cottage außerordentlich schwer zu finden, und genau das gefällt mir. Ich komme knapp vor Einbruch der Nacht dort an und trete die Hintertür auf – anders kann man sie nicht öffnen. Die Dunkelheit bricht bald herein, und ich muss noch eine Menge erledigen, solange ich etwas sehen kann: Wasser holen, Holzscheite aus dem Schuppen ins Haus bringen, die Lampen befüllen. Feuer anzünden, ein Bett herrichten, einen Kessel Wasser fürs Abendessen aufsetzen. Danach werde ich es mir mit einer Tasse Tee vor dem Haus bequem machen, den Sonnenuntergang ansehen und die Fledermäuse vom Speicher zählen. Es tut gut, wieder hier zu sein.
An manchen Tagen fühlt es sich hier wie auf einer Insel an. Nachts füllt sich das Tal mit Nebel; in der Dunkelheit kann ich nur einen schmalen Streifen davon ausmachen, der sich im Talgrund niederlässt und an den Kurven und Windungen des Flusses entlangmäandert. Doch wenn ich aufwache, strömt das Sonnenlicht durch die geschlossenen Vorhänge herein; ich werfe sie zurück und blicke auf ein schäumendes Meer. Bis hier oben, auf dreihundert Meter Höhe, dringt der Nebel fast nie. Die Kronen der nächststehenden Bäume tauchen wie Mangroven aus dem Nebelmeer auf; dahinter wird erst wieder in über dreißig Kilometer Entfernung Festland sichtbar, die angedeuteten Walrücken der Black Mountains und die kirchturmartigen Spitzen der Brecon Beacons. Manchmal allerdings ist der Nebel so dicht, dass er in Wellen gegen meine Füße brandet, wenn ich vor die Tür trete, und ich kaum die Hand vor Augen sehe, wenn ich ein paar Schritte den Hügel hinuntergehe. Doch dann brennt die immer höher steigende Sonne den Nebel weg: Die Gezeiten wechseln, der Nebel zieht sich, einen tauglitzernden Abhang hinter sich lassend, ins Tal zurück.
Der Morgen dämmert, und ich bin allein und auch wieder nicht allein. Auf einer Überlandleitung sitzt ein Gartenrotschwanz, auf dem Dach hüpft eine Bachstelze herum. Im Schuppen nisten Amseln. Sie haben ihr Nest auf einer umgekehrten Hacke, die an einem Nagel an der Wand hängt, gebaut. Die Gartenrotschwänze wiederum nisten offenbar im Giebel, sie scheinen das neue Dach zu mögen. Ihren alten Nistkasten haben sie den Kohlmeisen überlassen. Als ich den Deckel anhebe, blicke ich auf acht hungrige, weit geöffnete Schnäbel. Nach einigen Sekunden sinken vier der Küken ins Nest zurück, doch die anderen, hungrigeren, drängen weiter nach oben und weigern sich zu akzeptieren, dass ich nichts für sie habe. Auch das Baumloch in der Esche vor dem Cottage wird jedes Jahr von einem Vogel bezogen, und nun ist endlich ein Paar scheuer Hohltauben an der Reihe. Im frühmorgendlichen Licht der Sonne genießen sie das Balzen, fliegen aus ihrem Nistbaum auf und drehen gemeinsam einen engen Kreis in der Luft – so nah beieinander, dass sie sich fast berühren. Der voranfliegende Vogel trägt einen kleinen Zweig im Schnabel, als ob er zur Arche zurückkehren wollte.
Ich setze mich vor das Cottage, sehe über das Tal bis zu den Hügeln in der Ferne und schärfe meine Säge. Einundzwanzig Striche nach rechts und dann einundzwanzig Striche nach links. Nach der Dürreperiode in letzter Zeit ist es sinnvoll, während meines Aufenthalts hier so viel Holz wie möglich zu zersägen, es in Scheite zu spalten und im Schuppen zu lagern, bevor es nass werden kann. Das Wetter in dieser Gegend ist so unberechenbar, dass es beruhigend ist, einen Holzvorrat für mehrere Wochen als Reserve im Schuppen zu wissen. Während ich meine Kettensäge dafür bereit mache, fällt mir auf, dass die Schwalben ein Nest unter dem Eingang des Hauses gebaut haben. Vorsichtig greife ich hinein und fahre mit dem Finger über die glatte Lehmauskleidung. Ein einziges Ei liegt darin, das Schwalbenweibchen hat heute ihr erstes Ei gelegt. Es wird jeden Tag ein weiteres legen, bis das Gelege vollständig ist und bebrütet werden kann. Dann wird es Zeit, meine »Veranda« an die Schwalben abzutreten und nur noch die Hintertür zu benutzen.
Als ich hier das ganze Jahr über lebte, war ich schon erstaunt gewesen, wie viele Vögel in unmittelbarer Nähe zum Cottage nisteten. Und nun, da der Ort noch ungestörter ist, gibt es mehr Vögel denn je. Zum allerersten Mal nistet ein Distelfinkpaar im Garten. Es dauert eine Weile, bis ich das Nest in den Schlehen vor dem Gatter an der Stelle gefunden habe, an der es sich auch die Buchfinken hin und wieder gern gemütlich machen. Die Distelfinken, auch als Stieglitze bekannt, sind entzückende, kleine Vögel mit kirschroten Gesichtern und leuchtend gelben Streifen auf den Flügeln. Sie bauen ihre Nester üblicherweise weit vom Stamm entfernt, wo sie dem Wind als Spielball dienen; allerdings sind die kleinen, mit Moos ausgepolsterten Körbchen so stabil konstruiert, dass noch nicht einmal ein Sturm sie umstürzen kann. Dieses Nest hier befindet sich in etwa zwei Meter Höhe, zu hoch, um hineinzusehen. Also halte ich einen Spiegel darüber, um die vier winzigen, dicht beieinanderliegenden Eier in seinem Inneren zu inspizieren.
Ich habe mir einen wunderbaren Zeitpunkt für meinen Besuch ausgesucht. Der Frühlingsabend ist so mild, milder könnte auch ein Sommerabend nicht sein. Morgen werde ich mich zu den Hügeln aufmachen, vorausgesetzt, das Wetter hält.
Während sich die Dunkelheit über das Land breitet, taucht plötzlich ein Falke über dem Feld vor dem Cottage auf. In der Regel kann man Greifvögel im Flug nur schwer auseinanderhalten, doch diesen erkenne ich an seinem Flugbogen, an seinem Temperament sofort als Baumfalken. Er ist weit von seinem üblichen Revier entfernt; selbst nach all den Jahren hält der Ort hier immer noch Überraschungen für mich bereit. Auf der Jagd scheint der Baumfalke nicht zu sein – er scheint sich einfach nur seines Lebens zu freuen. Und während sich die Nacht herabsenkt, beobachte ich verzaubert, wie er auf seinen sichelförmigen Schwingen dahingleitet, herabstößt, eindreht und abschwenkt, bis ich ihn nicht mehr sehen kann. Noch nie zuvor habe ich einen solchen Vogel gesehen, einen Vogel, der wirkt, als tanze er in der Luft.
In den Monaten, die seit meinem letzten Besuch vergangen sind, ist das Gras im Garten, vor den Schafen durch einen Zaun geschützt, hoch und üppig gewachsen. Ich kann kaum noch die Umrisse meiner ehemaligen Gemüsebeete erkennen. Ich würde das Gras ja schneiden, wären da nicht die Feldhasen. Hasen gehören zu den widerstandsfähigsten Tieren überhaupt: Sie leben das ganze Jahr über auf den Feldern und können jederzeit Junge bekommen. Dieses Jahr haben sie sich dafür das Frühjahr und meinen Garten ausgesucht. Nur ein paar Schritte von mir entfernt knabbern zwei Hasenjunge an dem saftigen Gras auf dem fruchtbaren Boden, der früher mein Gemüse genährt hat. Sie sind schon fast so groß wie Kaninchen und müssen bereits entwöhnt sein, sonst würde die Häsin sie noch nicht größtenteils sich selbst überlassen. Das Hasenweibchen habe ich erst einmal gesehen. Die beiden Jungen beobachten mich dabei, wie ich sie beobachte, scheinen sich jedoch nicht an mir zu stören, solange ich den Blick auf sie gerichtet halte. Schweifen meine Augen auch nur einen Moment lang ab, verschmelzen sie augenblicklich mit dem langen Gras.
Ich habe fünf Jahre lang allein in diesem Cottage gelebt, sommers wie winters, ohne Transportmittel, ohne Telefon. Dies ist die Geschichte dieser fünf Jahre. Sie erzählt, wo und wie ich gelebt habe. Sie handelt davon, was es bedeutet, an einem Ort zu leben, der so abgelegen ist, dass man wochenlang keiner anderen Menschenseele begegnet. Es ist auch die Geschichte der verborgenen Orte, die ich in mir fand, und der Geschöpfe, die mir Gesellschaft leisteten.
1
Das Leere Viertel
Das erste Mal traf ich an einem Herbstabend im Jahr meines dreißigsten Geburtstages an dem Cottage ein. Ich hatte mich direkt nach einer Doppelschicht um vier Uhr nachmittags von London aus auf den Weg gemacht. Da ich nicht damit gerechnet hatte, es an diesem Abend noch zu schaffen, hatte ich eigentlich bei Freunden in Swindon übernachten und meine Reise am nächsten Tag fortsetzen wollen. Aber der erste Lkw, der zu Beginn der Autobahn M4 angehalten hatte, nahm mich bis zur Raststätte Leigh Delamere Services mit, und so beschloss ich weiterzufahren. Danach zog sich meine Fahrt hin, denn die Straßen waren immer weniger befahren. Der letzte Lastwagenfahrer des Tages setzte mich um Mitternacht im Dorf ab. Ich dankte ihm und zückte meine selbst gezeichnete Karte. Ich nahm die Brücke über den Fluss und folgte den kleinen Wegen. Das Cottage liegt knapp fünf Kilometer vom Dorf entfernt; die Wege dorthin werden immer schmaler und steiler und gehen schließlich in einen Feldweg über. Ich vernahm den Ruf des Waldkauzes: das »Kuwitt« des Weibchens und das »Huh-Huhuhu-Huuh« des Männchens. Insgesamt fünf Reviere konnte ich zählen, es fühlte sich an, als ob ich vom einen zum nächsten weitergereicht würde, wie der Stab in einem Staffellauf. Der Mond schien nicht, doch die Milchstraße zog sich als heller, verwischter Streifen über den Himmel. Ab dem letzten Bauernhof muss man bis zum Cottage sieben Gatter öffnen und wieder schließen; dabei folgte ich dem Pfad, statt die Abkürzung über die Felder zu nehmen. An dieser Stelle war es aber so steil, dass es mir vorkam, als würde der Pfad wie ein Betrunkener hin und her torkeln.
Später sollte ich meine nächtlichen Streifzüge nur bei Sternenlicht unternehmen; jetzt war alles noch so neu, dass ich es vorzog, die Taschenlampe einzuschalten. Wohin ich auch leuchtete, überall warfen reflektierende Augen das Licht zurück – Kaninchen, die die Ränder der Felder säumten. Ich wusste damals nicht, dass ihre Population einen Höchststand erreicht hatte. Bald würde die Myxomatose wieder zuschlagen und sie praktisch auslöschen, bevor sie sich danach langsam wieder erholte. Wenn man weiß, wo man hinschauen muss, kann man das Cottage am Hang wie einen Leuchtturm von der Hauptstraße fünfzehn bis fünfundzwanzig Kilometer weiter südlich aus sehen. Doch hat man das Dorf erst verlassen, macht die Beschaffenheit des Geländes das Cottage unsichtbar, zumindest so lange, bis man das letzte Gatter geschlossen hat, um die Ecke gebogen ist und der Pfad schließlich ausläuft. Da stand ich nun und warf meinen ersten Blick auf Penlan Cottage, das sich an den Hang schmiegte und ringförmig von Eschen umgeben war. Nach dem Marsch in die Dunkelheit der Hügel war es ein willkommener Anblick. Wie ein Zuhause.
Auf der Nordseite wirkte das Cottage wie die Kinderzeichnung eines Hauses: vier rechteckige Fenster, in der Mitte eine Tür, ein Steildach, ein hoch aufragender, rauchender Schornstein und zu jeder Seite ein Baum. Auf der Südseite sah es eher wie ein Schuppen aus: mit einer Wellblechverkleidung wetterdicht gemacht und cremefarben gestrichen. Das war nicht besonders schön, aber wahrscheinlich notwendig, da das Cottage auf dieser Seite unbarmherzig den Elementen ausgesetzt war. Ein Freund von mir hatte es einmal als den einzigen ihm bekannten Ort beschrieben, an dem es hügelaufwärts regnete. Die »Veranda« bestand lediglich aus einer Steinplatte und einem Holzrahmen, der wiederum mit Wellblech verkleidet war. Doch ich saß gern dort und ließ meinen Blick über das Tal schweifen, und an nassen Tagen trommelte der Regen wie Gewehrschüsse auf das Metalldach. Neben meiner Veranda stand eine ausladende Zwergmispel, außerdem wollte ich ein wildes Geißblatt aus dem Wald hierher verpflanzen, das die gesamte Veranda überdachen sollte. Sein Nektar sollte Schwärmer anlocken, vielleicht sogar den Mittleren Weinschwärmer, der mit seiner pastellrosa und moosgrünen Färbung in meinen Augen schöner ist als jeder andere Schmetterling in ganz Großbritannien. Auf der Südseite hatte das Cottage zwei Fenster, das Wohnzimmerfenster und das des Schlafzimmers darüber. Die Steinwände waren dick genug für Fensterbänke, in denen ich sitzen konnte, sollte das Wetter mich doch einmal von der Veranda vertreiben. An der Aussicht konnte ich mich einfach nicht sattsehen. An der Ost- und Westseite gab es je ein schmales, schlitzförmiges Fenster. Einst hatte das Cottage einem viktorianischen Wildhüter gehört – durch die schmalen Fenster hatte er die Fasanengehege beidseits des Hauses im Auge behalten können. Vom Fenster auf der Westseite blickte man über die Heide. Nur zwei Felder weiter, und man befand sich im offenen Heideland. Überhaupt konnte man mehr als dreißig Kilometer nach Westen gehen, ohne auf ein anderes Haus, eine Straße oder einen Zaun zu treffen. Deshalb nennt man die unbewohnten Gebirgszüge der Cambrian Mountains im tiefsten Herzen des Landes auch die grüne Wüste von Wales, das walisische »Leere Viertel«.
Wenn man direkt hügelabwärts geht, kann man jenseits des Pfades einen überwucherten Steinhügel sehen, der in etwa die Form eines großen Gebäudes hat. An dieser Stelle stand einst ein Bauernhof, vermutlich Penlan Farm. Jetzt sprießen aus dem Steinhügel ausgewachsene Eschen – er ist weniger eine Ruine als vielmehr der Geist einer anderen Zeit. Die Landschaft hier ist heute viel wilder, viel ursprünglicher, als sie früher war. Das fast fünfzig Hektar große, hügelige und fruchtbare Gebiet um mich herum bot mittlerweile gerade einmal einem einzigen älteren Pächter ein knappes Auskommen, während zwischen den Feldern doch die verstreuten Überreste von fünf Bauernhöfen oder Bauerncottages sowie eine Mühle zu finden waren. Mechanisierung und Maschinisierung entvölkerten das Land: Zuerst zogen die Menschen nach Süden zu den Bergwerken und viel später dann in die Städte an der Küste des südlichen Wales und weiter. Die Welt mag sich mit Menschen füllen, doch gibt es immer noch einige wenige Orte, die sich dem Trend widersetzen und zurückgelassen, von den Menschenmassen aufgegeben werden.
Mein Cottage war aus Steinen von den Überresten des Bauernhofs errichtet worden, an dem Hang, von dem man ihn ursprünglich abgetragen hatte. Penlan schmiegte sich eng an diesen Hang, die Felswand hinter dem Cottage war so hoch wie die Regenrinne am Dach. Was die Erbauer dazu veranlasst hatte, das Cottage oberhalb des Grundwasserspiegels zu errichten, kann ich nicht sagen. Die Quelle trat knapp unterhalb meines Pfades aus dem Boden hervor; das Wasser wurde zu einem Brunnen fünfundvierzig Meter das vordere Feld hinabgeleitet, sein Überlauf wurde wiederum weitergeleitet und versorgte den Bauernhof mit Wasser, der sich am Fuß des Hügels außer Sichtweite befand. Neben dem Cottage standen zwei Regentonnen, die insgesamt hundertneunzig Liter fassten. Das Wasser eignete sich bestens für den Garten oder zum Waschen, zum Trinken musste man es erst abkochen. Allerdings schmeckte das Wasser aus der Quelle ohnehin besser als jedes Leitungs- oder Regenwasser.
Orte wie diesen findet man nur noch selten. Das Cottage ist Teil eines großen Landbesitzes, aber als man die anderen Gebäude, die ebenfalls dazugehören, modernisierte, beschloss man, Penlan sei einfach zu abgelegen, als dass sich das Modernisieren lohnen würde. Also ließ man das Cottage, wie es war: ohne Strom, ohne Gas, ohne fließendes Wasser, ohne Rohrleitungen. Seit fast fünfzig Jahren hatte niemand mehr hier gewohnt, es war ein Relikt einer längst vergangenen Lebensweise, die die Welt nicht mehr wollte. Penlan war das höchstgelegene und abgelegenste Cottage des gesamten Besitzes, galt aber auch als der Ort mit der schönsten Aussicht. Die Berge am südlichen Horizont waren vierzig Kilometer entfernt. Von vielen anderen Häusern in der Gegend konnte man einen flüchtigen Blick auf diese fernen Gebirgszüge erhaschen; allerdings waren die meisten in kleinen Tälern oder zwischen Bergfältelungen versteckt oder von einer Einrichtung zum Schutz vor den Elementen umgeben. Penlan war ohne Rücksicht auf den Komfort seiner Bewohner auf einem so hohen und exponierten Hügelkamm errichtet worden, dass sich der Horizont wie eine Panoramaansicht über achtzig Kilometer oder mehr von Osten nach Westen erstreckte. Es thronte über der Welt.
Freunde von mir hatten das Cottage etwas früher im Jahr gemietet, waren aber nur ein einziges Mal hier gewesen. Sie hatten versucht, Feuer zu machen, und dabei die Dohlennester im Kaminschacht angezündet, die Generationen dieser Vögel dort gebaut hatten. Nach meinem ersten Besuch zog es mich wieder und wieder zum Cottage. Ich verbrachte Weihnachten dort und begrüßte das neue Jahr vom Gipfel meines kleinen Berges aus. Es dauert länger, ihn zu erklimmen, als man vermuten würde: Es folgt Scheingipfel auf Scheingipfel, und man sieht den Steinhaufen auf der Bergkuppe eigentlich erst, wenn man schon darauf steht. Lässt man sich an diesem Steinhaufen nieder, kann man die unmittelbare Umgebung nur in einem Umkreis von etwa fünfundvierzig Metern sehen, dann fällt der Hang steil ab. Es war eine sternenklare Nacht; auf dem Hügel wuchs kaum Gras, nur ein Miniaturwald silbriger Flechten, die im Mondlicht beinahe zu fluoreszieren schienen. Die benachbarten Bergkuppen waren schneeverschmiert, und ringsum herrschte gefrorene Stille.
Eigentlich hatte ich an Neujahr einen ausgedehnten Spaziergang unternehmen wollen, doch da es schüttete, verbrachte ich den Großteil des Tages auf der Veranda und sah auf die Landschaft hinaus. Auf die Steinruine von Penlan Farm war vor langer Zeit ein großer Eschenast gefallen – vor zu langer Zeit, als dass man ihn noch als Brennholz hätte benutzen können. Aus den Bäumen flog ein Buntspecht heran, das Gefieder ein scharfer Kontrast von Schwarz und Weiß. Einen roten Genickfleck hatte er nicht, also war es ein Weibchen, dafür aber wunderschöne kirschrote Unterschwanzdecken. Energisch hämmerte das Spechtweibchen auf das verrottende Holz ein und spritzte Holzspäne in alle Richtungen. Im Laufe einer Stunde hatte sie*, so vertieft in die Arbeit, dass sie den heftigen Regen kaum wahrzunehmen schien, ein respektables Loch gezimmert. Sie hielt nur inne, um hin und wieder eine Raupe hinunterzuschlucken. Nach einiger Zeit steckte ein Wiesel, das es sich unter dem Eschenstamm gemütlich gemacht hatte, die Nase aus dem Bau. Ich hätte schwören können, im Gesichtsausdruck des Wiesels Missmut zu erkennen – Verärgerung darüber, vom unaufhörlichen Hämmern direkt über sich geweckt worden zu sein. Es blickte auf den prasselnden Regen und wagte sich schließlich aus seinem Versteck, um im ruhigeren, hohlen Stamm einer nahe gelegenen Eiche Schutz zu suchen. Wiesel sind normalerweise sehr lebhaft, sie bewegen sich springend, hüpfend, schlängelnd und vor allem sehr flink fort, doch dieses hier schlich geradezu und zog den Schwanz mit der schwarzen Spitze hinter sich her.
* Anmerkung der Übersetzerin: Die in diesem Buch verwendeten Personalpronomen beziehen sich auf das biologische Geschlecht des Vogelweibchens bzw. -männchens, nicht auf das grammatikalische.
Im Frühjahr des neuen Jahres übernahm ich die Pacht für das Cottage, die mich nur hundert Pfund im Jahr kostete – ein eher symbolischer Mietpreis. Ein Haus, das bewohnt wird, verkommt viel langsamer als ein unbewohntes, und meine Freunde hatten beschlossen, dass das Cottage nicht das Richtige für sie war, auch nicht als Feriendomizil. Dafür hatte man ihnen ein anderes Cottage angeboten, das ebenfalls Teil des Besitzes, doch weitaus komfortabler ausgestattet war. Die Inhaber lebten in einem großen Haus jenseits des Flusses; da sie aber den Großteil ihres Besitzes unter ihren Kindern aufgeteilt hatten, waren ihr ältester Sohn und seine Frau meine Vermieter. Beide kannte ich schon seit Jahren. Anfang April zog ich ganz in das Cottage ein. Die wenigen Brücken, die es in meinem Leben noch gab, hatte ich abgerissen. Ich schloss die Türen auf und hängte die Schlüssel an den eigens dafür vorgesehenen Haken gleich hinter der Eingangstür. Und seitdem habe ich sie, glaube ich, nicht mehr angefasst.
Als Erstes musste ich meine neue Heimat bewohnbar machen – zumindest für meine Verhältnisse, wenn auch nicht für die anderer Menschen. Ich reparierte die Gatter und den Zaun, um die Schafe aus dem kleinen Garten fernzuhalten, damit ich ihn bewirtschaften konnte. Zahlreiche Dachziegel hatten sich gelockert und waren verrutscht; ich schob sie wieder an Ort und Stelle und fixierte sie mit diesen kleinen Bleistreifen, die sicherlich einen Namen haben, den ich allerdings nicht weiß. Die Decke des großen Schlafzimmers war eingestürzt, also nagelte ich einige Rigips-Platten daran und füllte provisorisch die Lücken. Ich bin handwerklich nicht besonders begabt, und so sah die Decke anschließend auch aus. Doch immerhin hielt das Provisorium und hält noch heute. Das Fallrohr, das von der Regenrinne am Dach zu einer der Regentonnen führte, war oben abgerissen. Ich reparierte es mit einem Plastiktrichter, einem kurzen Stück Schlauch und etwas Gaffa-Tape – und das Problem war für die nächsten fünf Jahre erledigt. Der schmale Spalt zwischen der hinteren Wand des Cottages und der Bruchsteinwand drohte, vom regelmäßig überlaufenden Wasser aus den Regentonnen und dem an der Felswand herabrinnenden Regen überschwemmt zu werden. Dieses Problem löste ich, indem ich einen Graben aushob und mit Kieselsteinen sowie einem Stück altem Landentwässerungsrohr füllte, das ich am Rand eines Feldes gefunden hatte. Kontraproduktiv war auch, dass Regen durch den Schornstein ins Kaminfeuer fiel; ich kletterte aufs Dach und zementierte zwei übrig gebliebene Dachziegel in einem umgekehrten V auf die Einfassung des Schornsteins. Aus einer Aluminiumplatte, ein Fundstück im Schuppen, bastelte ich einen Feuerrost für den Kamin, damit nicht mehr so viel Rauch ins Innere des Cottages drang. Danach war das Haus fertig für mich.
Vor hundert Jahren, als das Cottage noch einer Familie als Zuhause diente, war es besser an Wohnbedürfnisse angepasst gewesen. In der Küche im hinteren Teil des Hauses stand ein alter Kupferkessel, in dem man früher hatte Wasser kochen können; jetzt allerdings war er jenseits aller Reparaturkünste verrostet, und die Feuerstelle darunter sowie die Backöfen daneben hatte man zugemauert. Sogar den Kamin hatte man abgeriegelt. Ich sage Küche, doch vielleicht ist Vorratskammer ein besseres Wort für einen Raum ohne fließendes Wasser und ohne Kocheinrichtungen. Dort bewahrte ich meine Wasserkannen für den täglichen Bedarf auf, ebenso wie meine Töpfe und Pfannen. Es gab ein Spülbecken aus Stein und die eigentliche, begehbare Vorratskammer, in die sich hier, auf der Nordseite des Hauses, nie ein Sonnenstrahl hineinverirrte und in der man deshalb Dinge das ganze Jahr über verhältnismäßig kühl lagern konnte. Im Schuppen stand ein weiterer Kupferkessel, in dem man einst Wäsche gewaschen hatte, doch auch dieser war nicht mehr benutzbar.
Es war Frühling, und um mich herum erwachte alles zu neuem Leben, während ich arbeitete. Ein Paar Stare nistete in der Ecke des Dachgiebels; den ganzen Tag über saßen sie ganz oben in der Krone der Esche direkt vor dem Haus und imitierten alles, was sie hörten, sodass ich mehr als einmal nach draußen lief, um nach etwas zu sehen, das gar nicht da war. Ganz ausgezeichnet ahmten sie zum Beispiel einen Brachvogel nach. Die Dohlen hatten den nun wieder rauchenden Schornstein geräumt und ihr Nest in einen Hohlraum im Stamm der Esche hinter dem Cottage verlegt. Diese Esche wuchs kerzengerade aus dem Felsen der Bruchsteinwand heraus; sie wirkte immer irgendwie kahl und drohte, jederzeit umzustürzen. Getan hat sie das allerdings nie. In der Bruchsteinmauer, die meinen Garten vom Pfad davor trennte, hatten sich Trauer-Bachstelzen versteckt. Die Nester dieser Vögel sind dafür berüchtigt, schwer auffindbar zu sein; die fütternden Altvögel landeten zunächst auf einem Felsen in einiger Entfernung – mit wippenden Schwänzen, die Schnäbel vollgestopft mit Insekten – und huschten dann im Windschatten der Mauer den Pfad entlang, um potenzielle Fressfeinde von ihrer Spur abzulenken. Bis ich den genauen Ort des Nestes in einer kleinen Steinnische kaum dreißig Zentimeter über dem Boden entdeckt hatte, dauerte es mehrere Tage, an denen ich die Vögel beinahe ununterbrochen beobachtete. Die Elternvögel blieben immer in Sichtweite, Futter fanden sie auf den Feldern im Umkreis von fünfundvierzig Metern genug. Ich fühlte mich irgendwie verantwortlich für diese Vögel. Als Willkommenskomitee meines neuen Zuhauses waren sie meine Schutzbefohlenen, und in der Tradition der Zigeuner gelten sie als gutes Omen. Zwei der Küken verließen das Nest, lange bevor sie so weit waren, im Alter von nur neun Tagen; zwei winzige Unschuldsbündel, zusammengedrängt auf einem nahe gelegenen Felsen, die mit piepsenden Lauten nach ihren Eltern riefen. Viele Jungvögel verlassen das Nest, Tage bevor sie fliegen können, und ich frage mich immer wieder, ob es nicht eine sehr riskante Überlebensstrategie ist, so schutzlos Beutegreifern ausgeliefert zu sein. Doch ich nehme an, dass im Konkurrenzkampf der Jungen um das begrenzte Nahrungsangebot derjenige Jungvogel als Erstes gefüttert wird, der zuerst das Nest verlässt. Als ich die Warnrufe der Elternvögel hörte und sah, wie sie verzweifelt umherflatterten, lief ich nach draußen und verscheuchte das Eichhörnchen, das den Jungen auf dem Stein zu nahe gekommen war und interessiert herumschnupperte. Ich hob die beiden Flaumbällchen auf und setzte sie ins Nest zurück. Dort blieben sie auch den ganzen Tag, doch als es dunkel wurde, waren sie schon wieder verschwunden. Ich war sehr erleichtert, sie am nächsten Morgen lebend wiederzufinden, und letzten Endes wurde die ganze Brut erfolgreich flügge. Sich allzu sehr um das Schicksal einzelner Vögel zu sorgen ist allerdings nicht ratsam: Das Leben auf den Feldern und in den Wäldern da draußen ist brutal. Kleine Vögel wie beispielsweise Blaumeisen legen dreizehn oder vierzehn Eier und versuchen es sogar mit einem zweiten Gelege, wenn alles gut läuft – was einen annähernden Eindruck davon vermittelt, wie es um ihre Überlebenschancen steht. Wäre die Sterblichkeit nicht so hoch, würde es von Blaumeisen überall nur so wimmeln, wie bei einer Heuschreckenplage.
An einem unerwartet warmen Frühlingstag öffnete ich die Türen des Cottages weit, um das Haus zu lüften. Eine Schwalbe kam durch die Vordertür hereingeflogen, umkreiste mich, der ich in der Mitte des Wohnzimmers stand, drei Mal und verschwand wieder durch die Hintertür, so plötzlich, wie sie gekommen war. Einen Augenblick lang war innen zu draußen geworden und mein Cottage zu einem Teil der Landschaft, nicht mehr die abgeschlossene Einheit, die mich von der Natur vor dem Fenster trennte.
Auf dem Dachboden gab es eine kleine Brutkolonie von Fledermäusen; es bereitete mir besonderes Vergnügen, an einem milden Abend zur Zeit der Dämmerung draußen im Garten zu sitzen und zu versuchen, die Tiere zu zählen. Sie schossen aus unsichtbaren Spalten unter dem Dachvorsprung hervor und flogen direkt auf die Bäume zu. Die Langohrfledermäuse haben sich darauf spezialisiert, Insekten von Blättern zu picken, anstatt sie in der Luft zu fangen. Hin und wieder erspähte ich auch eine oder zwei Fransenfledermäuse, die in die Dunkelheit verschwanden; sie sind etwas größer und seltener. Es ist schon nicht einfach, eine Fledermausart zu identifizieren, wenn man ein Exemplar in der Hand hält – schießen sie in einer irren Geschwindigkeit im Halbdunkel umher, ist es praktisch unmöglich. Erst vor etwa zehn Jahren haben Experten herausgefunden, dass es sich bei der Zwergfledermaus, die häufigste bei uns heimische Art, eigentlich um zwei verschiedene Spezies handelt. An ihrer Art zu fliegen konnte ich in der Regel am besten erkennen, dass die meisten meiner Mitbewohner Langohrfledermäuse waren. Manchmal jedoch sah ich aus den Augenwinkeln die Silhouette von Ohren, die halb so lang waren wie das ganze Tier, das deshalb wie ein winziges, fliegendes Kaninchen wirkte. Zur Brutzeit hielt ich mich vom Dachboden fern; Fledermauskolonien sind so anfällig für Störungen, dass man in freier Wildbahn eine Genehmigung braucht, um sie zu besuchen. Normalerweise zählte ich etwa zwanzig bis dreißig Tiere. Im Sommer stieg diese Zahl an, als die Jungtiere die Kolonie verließen und selbstständige Flüge unternahmen. Fledermäuse – darauf lässt schon der Name schließen – mögen für unsere Augen wie Mäuse mit Flügeln aussehen, ihre Lebenszyklen unterscheiden sich von denen der Mäuse jedoch erheblich: Während die durchschnittliche Maus nur etwa ein Jahr Zeit hat, um eine neue Generation ins Leben zu rufen, können Fledermäuse bis zu dreißig Jahre alt werden und ihr Leben lang immer dieselben Sommer- und Winterschlafplätze aufsuchen. Deshalb ist es so wichtig, die von ihnen auserkorenen Orte zu schützen – insbesondere Langohrfledermäuse reagieren Standortwechseln gegenüber ausgesprochen empfindlich. Es war nicht nur so, dass sie das Cottage in der Abenddämmerung verließen und in der Morgendämmerung zurückkehrten, sie kamen und gingen die ganze Nacht hindurch. Wenn ich in der Dunkelheit vor das Haus trat, jagten sie einander oft um das Cottage herum. Flogen sie dann ganz nah an mir vorbei, konnte ich den Lufthauch ihres Flügelschlages auf meiner Haut spüren. Ihre Reflexe waren allerdings so schnell, dass sie mich nie berührten. Manchmal konnte ich nachts ein schwaches Rascheln hören, wenn sie sich auf dem Dachboden bewegten. Ich empfand es als Privileg, dass sie da waren und ihr unergründliches Leben direkt über mir verbrachten.
Weniger willkommen als Hausgäste waren die Mäuse, die im Frühjahr über das Cottage herfielen. Nur ein einziges Mal stieß ich auf Hausmäuse, die in dieser Gegend eher selten sind. Nein, das hier waren Landmäuse, keine Stadtmäuse, genau genommen Waldmäuse und ihre größeren und weniger häufigen Verwandten, die Gelbhalsmäuse, die aus den angrenzenden Feldern kamen und das Cottage regelrecht überschwemmten. Zugegeben: Es waren süße Viecher mit großen schwarzen Augen, aber sie richteten ein Riesendurcheinander an und fraßen einfach alles. In die Wohnzimmerdecke waren fünf robuste Fleischerhaken gedübelt, an die ich die von den Mäusen besonders geschätzten Lebensmittel in Einkaufstaschen hängte, doch verfügten die schlauen Tiere über eine atemberaubende Fähigkeit, Dinge – alle möglichen Dinge – zu finden, die ich übersehen hatte. Unermüdlich nagten sie sich ihren Weg durch Plastikbehälter und Plastikflaschen sowie Korken und hatten sogar eine Schwäche für Seife. Da ich sie nicht töten wollte, besorgte ich mir einige Lebendfallen, fing sie und brachte sie nach draußen. Aber selbst aus einer erstaunlich großen Entfernung kamen sie schnurstracks zum Cottage zurück, und so ging ich auf Nummer sicher und setzte sie fortan jenseits des Flusses aus.
Tagsüber verbrachte ich den Großteil meiner Zeit damit, meine Umgebung zu erkunden. Obwohl ich bei meinen Streifzügen gelegentlich auch etwas weiter vordrang, war das, was ich mein Heim nannte, im Grunde die Strecke, die ich zu Fuß vom Cottage und wieder zurück an einem Tag bewältigen konnte. Deshalb war mein Heim, mein Heimatgebiet, logischerweise im Sommer größer und im Winter kleiner und bestand grob gerechnet aus einem Umkreis von acht Kilometern um das Cottage herum. Ganz rund war der Umkreis allerdings nicht, denn ich verbrachte viel weniger Zeit auf der Ostseite des Flusses. Nicht weil sie nicht zugänglich gewesen wäre: In nördlicher oder südlicher Richtung waren die nächsten Straßenbrücken Kilometer entfernt, doch an der Stelle, an der der Fluss dem Cottage am nächsten war, konnte man ihn auf einer wunderschönen alten, nicht befahrbaren Hängebrücke überqueren, die dabei hin und her schwankte. Ich stand gern dort und beobachtete für eine Weile die Wasseramseln und Gebirgsstelzen, außerdem bot die Brücke eine praktische Abkürzung zur Straße dahinter. Doch wurden die Hügel östlich des Flusses kontinuierlich kleiner und immer bewohnter, während man sich den Welsh Marches an der Grenze zu England näherte. Und mich zog es unerbittlich in die Wildnis, nach Westen.
Die mit Schafen beweideten Felder unmittelbar um das Cottage wirkten trotz der weiten Aussicht, die sie boten, abgelegen und lauschig. Im Westen wurden sie von Penlan Wood flankiert, einer ausgewachsenen Pflanzung Gemeiner Fichten, und im Osten von einem kleinen Eichenwald, den man vor langer Zeit als Deckung für Fasane angelegt hatte. Im Frühling bedeckten zahllose Hasenglöckchen den Waldboden, über dem Eichenwald ragten die Felswände des Berghangs jenseits des Tals auf. Das obere Feld hinter dem Haus war von einem lang gezogenen Dickicht Gemeiner Kiefern begrenzt, und knapp hundert Meter den Hügel hinab, wo der Hang steil abfiel, standen verstreut einige massive Eichen, viele Hunderte Jahre alt und im Laufe der Zeit ausgehöhlt. Der obere Rand von Penlan Wood verlief beinahe auf gleicher Höhe mit dem Cottage, und abgesehen von dem ungestörten Blick, den man in direkt westlicher Richtung auf die Heide hatte, war das Haus von Bäumen umzingelt, als ob es in einer großen Lichtung erbaut worden wäre. Der einzige andere Mensch, der zum Cottage kam, war der Bauer, der sich um seine Schafe kümmerte; ansonsten war ich gewissermaßen der Herrscher über diese Gegend. Manchmal hatte ich das Gefühl, nirgendwo anders hingehen zu müssen – wenn ich nur lange genug geduldig hier wartete, würde jede wild lebende Kreatur, die es im Herzen von Wales zu sehen gab, früher oder später zu mir kommen.
So nah bei Penlan Wood fühlte ich mich geborgen; der Wald schützte das Cottage zumindest etwas vor dem vorherrschenden Südwestwind. Nadelbaumpflanzungen dieser Art sind viel gescholten, weil sie andere, natürliche Lebensräume verdrängen; zudem gelten sie als generell artenarm, als leblos. Das dachte ich anfangs von Penlan Wood auch. Es war schwierig, überhaupt in den Wald hineinzukommen, da der Zaun, der ihn umgab, von Rhododendrongestrüpp überwuchert war. Und gelang es einem doch, in den Wald einzudringen, war es darin dunkel und düster und still. Kein Vogelgesang war zu hören, nur eine dicke Schicht Fichtennadeln bedeckte den Waldboden. Hier wuchs absolut gar nichts, außer im Herbst, wenn strahlend weiße Hexeneier auf dem Boden erschienen, die zu den fremdartig wirkenden, phallusförmigen, von Fliegenlarven befallenen Stielen und Hüten der Gemeinen Stinkmorchel zerbarsten. Der Wald war nie ausgedünnt worden, vermutlich weil er eben klein und dunkel, ungünstig gelegen und leicht vergessen war. Die Bäume waren ausgewachsen, vielleicht vierzig Jahre alt, und standen Schulter an Schulter, weshalb auch so wenig Licht das dichte Baumkronendach durchdringen und auf den Waldboden gelangen konnte. Die Pflanzung war klein, nur wenige Hektar groß, und nicht besonders vielversprechend – aber sie stand ganz in meiner Nähe und fühlte sich wie meine an. Es dauerte geraume Zeit, bis der Wald mir seine Geheimnisse offenbarte, doch seine anscheinende Leblosigkeit war eine Täuschung.
Vom Rand des Waldes drangen jede Nacht Eulenrufe zu mir. An der Ecke, die dem Cottage am nächsten war, stand eine einzelne, uralte Eiche. Es heißt, Eichen brauchen zweihundert Jahre zum Wachsen, zweihundert Jahre zum Leben und zweihundert Jahre zum Sterben. Dieser Baum starb bereits, die obersten Zweige waren blattlos und zeichneten sich wie ein Geweih gegen den Himmel ab. Ich fragte mich, ob dieser Baum wohl das Zuhause der Eulen war, doch als ich ihn inspizierte, fand ich keinerlei Löcher, die sich als Nisthöhle geeignet hätten. Dann jedoch ging ich an einem sonnigen Tag auf dem Feld hinter dem Baum spazieren, und die Eiche warf im strahlenden Sonnenlicht einen absolut perfekten Schatten auf das Gras zu meinen Füßen. Plötzlich sah ich auch den Schatten einer Eule auf dem Boden vor mir, und bevor ich noch aufblicken konnte, verschwand die Geistereule ins Herz der Finsternis. Danach behielt ich den Baum konstant im Auge; ich setzte mich abends auf einem Baumstumpf in der Nähe und beobachtete das Kommen und Gehen der Eulen. Es waren Waldkäuze, und es schien ihnen nichts auszumachen, dass ich sie beobachtete – das Weibchen stattete mir eines Nachmittags sogar einen Gegenbesuch ab. Ich jätete gerade Unkraut im Garten, als sie über mich hinwegflog, um sich das Ganze ein wenig näher anzusehen, und dabei leise rief. Männchen und Weibchen unterschieden sich auffällig voneinander: Das Männchen war hellgrau gefärbt, das Weibchen dunkel rötlichbraun. Als ich sicher wusste, dass beide Vögel auf der Jagd waren, kletterte ich den Eichenstamm hinauf bis zu der Stelle, an der sich die unteren Äste ausbreiteten, und navigierte mich um ein Stück Brombeergestrüpp herum, das aus einer Astgabel herauswuchs.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.





























