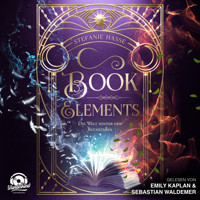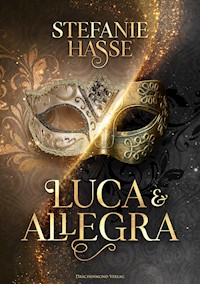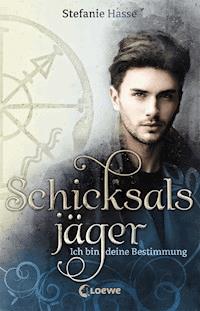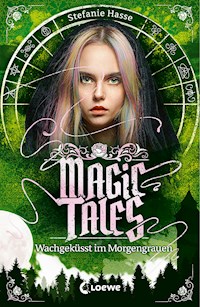11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Oetinger
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Die Zeitreise beginnt: Geh mit Max auf die Time Travel Academy! Kein Handy, kein Tablet. Stattdessen Heute-basteln-wir-mit-Klopapierrollen. Wie gern würde der zwölfjährige Max sein Leben gegen das eines anderen eintauschen. Seins ist nämlich verdammt langweilig. Bis er eines Tages die goldschimmernde Einladung zur Time Travel Academy erhält – und mit ihr die Nachricht, dass er dort seine spurlos verschwundene Schwester wiederfinden kann. Time Travel, also Zeitreisen – wie cool ist das denn?! Und in einem Internat leben! Für Max zählt nur noch eins: Er muss unbedingt auf die TTA. Und schon steckt er mitten in einem rasanten Abenteuer auf der wohl coolsten Academy aller Zeiten, voller Technik-Nerds und witziger neuer Freund*innen. Da willst du doch garantiert dabei sein. Wer weiß, vielleicht hast du ja auch das Zeitreise-Gen in dir. Leg los mit Band 1 der Time Travel Academy: Noch nie war Zeitreisen cooler. - Die Lieblingsthemen Internat und Zeitreise in einer rasanten Action-Reihe für Jungs und Mädchen ab 10. - Start der lässigen Fantasy Kinderbücher in lustig lockerem Erzählton – Fortsetzung folgt. - Witziges und zugleich spannendes Abenteuer durch Raum und Zeit. - Max, ein 12-jähriger, typisch schusseliger, herrlich unperfekter Held. - Computerfreaks und Chaosclub – eine Superheld*innen-Academy für auserwählte Kids.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über dieses Buch
Kein Handy, kein Tablet – stattdessen Heute-basteln-wir-mit-Klopapierrollen! Wie gern würde der zwölfjährige Max sein Leben gegen das eines anderen eintauschen. Seins ist nämlich verdammt langweilig. Bis er plötzlich die goldschimmernde Einladung zur Time Travel Academy erhält – und mit ihr die Nachricht, dass er dort seine spurlos verschwundene Schwester wiederfinden kann. Für Max zählt nur noch eins: Er muss unbedingt auf die TTA! Und schon steckt er mitten in einem rasanten Abenteuer auf der wohl coolsten Academy aller Zeiten!
Band 1 der Time Travel Academy:
Noch nie war Zeitreisen aufregender!
Für Nico und Jojo
Intro
Niemand glaubt an Zeitreisen. Nicht die Wissenschaft, nicht meine Lehrerinnen und Lehrer und ich schon gar nicht. Es gibt da dieses tolle französische Wort Déjà-vu, das alle als Ausrede benutzen. Vor allem meine Eltern. Déjà-vu bedeutet so viel wie »schon gesehen« und beschreibt einen Moment, der sich anfühlt, als wäre er schon einmal passiert. Genau damit habe ich mir erklärt, warum ich meine Schwester Stella immer wieder in einer Menschenmenge entdecke, obwohl sie seit drei Jahren nicht mehr bei uns ist.
Die Zeit ist ein seltsames Phänomen. Das klingt jetzt philosophischer als beabsichtigt, verzeiht mir. Aber ihr kennt das garantiert, dass die Zeit nicht immer gleich schnell vergeht, obwohl ganz wichtige Menschen schon vor Ewigkeiten festgelegt haben, wie lang genau eine Sekunde dauert. Nur fühlen sich fünf Minuten ungeduldiges Warten (auf das Ende des Unterrichts) unendlich viel länger an als eine Stunde an der Spielekonsole. Manchmal dehnt sich die Zeit so zäh wie ein zu lang gekauter Kaugummi, und in manchen Momenten rast sie dahin wie eine Rakete. Das hat etwas mit einem Phänomen zu tun, das man Zeitempfinden nennt (ich habe inzwischen so einiges darüber gelernt).
Doch eine Sache habe ich immer für eine unumstößliche Wahrheit gehalten:
Zeitreisen gibt es nur in Büchern und Filmen. Punkt. Das ist eine Tatsache. Wie die Tatsache, dass Wasser nass ist und der Himmel blau. Aber habt ihr schon einmal Pfeffer in eine Schüssel mit Wasser gestreut und dann den Finger hineingetaucht? Der bleibt nämlich trocken. Und was passiert mit dem Blau des Himmels bei Sonnenuntergang oder bei einem Regenbogen?
Genauso ist es nämlich auch mit Zeitreisen. Es ist nicht immer alles richtig, was behauptet wird.
Wenn ihr mir nicht glauben wollt, überzeugen euch vielleicht meine Erlebnisse vom 25. Juli eurer Zeitrechnung. Von dem Tag, an dem sich mein Leben innerhalb kürzester Zeit (ha! Wortspiel! Ich weiß, dass ihr das jetzt noch nicht versteht, keine Sorge, das wird noch) verändert hat.
1
Der 25. Juli verlief genauso langweilig wie viele andere Tage auch, was vielleicht noch schlimmer war, weil an diesem Tag mein zwölfter Geburtstag war. Ich rannte gerade vom »Camp Kreativ« (wie unkreativ kann man bei der Namensvergabe eigentlich sein?), meiner persönlichen Ferienhölle, nach Hause. Meine Eltern hatte ich morgens kaum zu Gesicht bekommen, weil sie schon so früh zur Arbeit aufgebrochen waren. Früher hätte ich die ganze Strecke zurück nach Hause locker geschafft, ohne aus der Puste zu kommen. Aber seit ich nicht mehr dreimal in der Woche Fußballtraining hatte, war meine Kondition ziemlich mies geworden, und ich musste deshalb nach den ersten vierhundert Metern keuchend ins Schritttempo wechseln.
Die warme Spätnachmittagssonne schien auf die Häuser, die in dieser Gegend alle zweistöckig waren. Sie hatten jeweils eine kleine angebaute Garage, ähnliche Gartenzäune und abgesehen von den unterschiedlichen Farbanstrichen sahen sie nahezu gleich aus. Zurzeit wollten sich scheinbar alle Nachbarn mit dem am prachtvollsten blühenden Rosenbusch im Vorgarten übertreffen. Inzwischen roch schon die ganze Straße süßlich nach Rosen.
Vor mir hopste mein zwergenkleiner Schatten über den geteerten Gehweg – ich war zwar nicht sehr groß, aber zum Glück etwas größer als der dunkle Winzling vor mir. Ich erwartete – nein, hoffte! – wie jedes Mal, dass sich meine Schattenarme gleich verdoppeln würden, ehe meine Schwester Stella zur Seite trat. Wir hatten solche Schattenspiele geliebt, hatten etliche Stunden damit verbracht, die coolsten Monster aus unseren Schatten zu formen. Ich wünschte sie mir so sehr zurück, dass ich mir manchmal sogar einbildete, sie zu sehen. Das behaupteten zumindest meine Eltern, als ich ihnen anfangs noch aufgeregt erzählt hatte, wie ich Stella vor der Schule hatte stehen sehen oder in einer Menschenmenge auf der Kirmes.
Ich sah sie immer noch hin und wieder – oder glaubte, sie zu sehen. Wisst ihr, wie schrecklich es ist, jemanden so richtig doll zu vermissen? Ich ließ meine angestaute Trauer, die sich gerade mehr nach Wut anfühlte, an einem kleinen Stein aus, den ich den Rest des Weges vor mir her kickte.
Ich war so darauf konzentriert, dass mir die Stimmen, die aus unserem Haus durch ein Fenster nach außen drangen, erst spät auffielen. Ich wollte nicht lauschen (okay, jedenfalls nicht die ersten zwei Sekunden), aber die Stimmen meiner Eltern waren so angespannt und verändert, dass sie mich magnetisch anzogen.
Wäre ja auch komisch, wenn es mir egal gewesen wäre, was sie gerade so aufgeregt besprachen, sie sind ja schließlich meine Eltern. Ich ließ den kleinen Stein auf dem Gehweg liegen und schlich mich zum gekippten Küchenfenster.
»Meinst du, sie ist echt?«, fragte Mama gerade. Sie und Papa standen hinter der Kochinsel, ihre Köpfe waren von einer Bratpfanne verdeckt, die an einem Haken an der Dunstabzugshaube baumelte. Meine Mutter hatte etwas Funkelndes in der Hand, das aussah wie eine Postkarte aus Gold. Mama trug ein dunkelblaues Jackett mit passendem Rock, mein Vater hatten noch seinen Cordanzug an und die karierte Krawatte, als wären beide gerade von der Arbeit gekommen.
»Hast du gesehen, wer die Einladung gebracht hat, Robert?« Jetzt sprach Mama so leise, dass ich sie kaum verstehen konnte, weshalb ich vorsichtig noch etwas näher an die Hauswand rückte. In den Büschen unter dem Fenster hatten sich Spinnen eingenistet, deren Netze mir jetzt vermutlich irgendwo am Körper hingen. Doch das war nicht das Beunruhigendste in diesem Moment.
Als Mama zur Seite trat, gab die baumelnde Bratpfanne den Blick auf ihr Gesicht frei, und fast hätte ich einen verräterischen Laut von mir gegeben: Ich hatte meine Mutter selten derart … verängstigt gesehen. Ihre Hand zitterte. Die Sonnenstrahlen, die dabei immer wieder von der Karte eingefangen und reflektiert wurden, blendeten mich. Aber wirklich schockiert war ich von dem, was sie dann tat.
Schwungvoll drehte sie den Zündungsknopf am Gasherd nach rechts, sodass sofort eine Stichflamme emporschoss. Ohne zu zögern, hielt sie die schimmernde Karte mitten in die Flamme. Ein kalter Schauer durchlief mich, instinktiv wollte ich Nein rufen, hielt mir dann aber schnell die Hand vor den Mund, um den Laut zu ersticken.
Papa war dicht zu meiner Mutter getreten und hielt ihre Hand mit der Karte, an der nun die Gasflamme gierig leckte. Die Strähnen, die sich aus Mamas dunklem Haarknoten gelöst hatten, flatterten ein wenig, doch nichts weiter geschah. Die Karte fing kein Feuer, verkohlte nicht, sie bewegte sich nur ganz sanft, als wäre die Flamme nicht mehr als ein Luftzug.
Immer mehr Spinnweben blieben an mir kleben, als ich mich noch näher zum Fenster schob und die Nase gegen das kühle Glas presste. Dabei betete ich, dass meine Eltern zu abgelenkt waren, um mich zu entdecken. Irgendwie spürte ich – keine Ahnung, wieso eigentlich –, dass sie nicht beobachtet werden wollten. Das ist wahrscheinlich diese sogenannte Intuition, von der immer alle reden. Die Scheibe beschlug von meinen hektischen Atemzügen, und mein Herz pochte schneller als beim Fünfzig-Meter-Lauf in der Schule.
Aus welchem Material bestand diese Karte, dass sie nicht kaputtging? Und was genau war so gefährlich an ihr, dass meine Eltern versuchten, sie zu verbrennen?
Dann drehte mein Vater den Gasherd aus, und die Flamme verschwand. Meine Mutter trat mit entschlossener Miene zum Waschbecken neben dem Herd, drehte den Hahn auf und hielt die Karte so lange unter den heißen Strahl, bis Dampf aus dem Becken aufstieg. Ungeduldig schüttelte sie die Karte, nachdem sie das Wasser abgestellt hatte – aber nichts passierte. Danach knüllte sie das Ding zusammen, scheinbar ohne sich zu verbrennen, und legte es auf die Abtropffläche. Feindselig starrten meine Eltern auf den unförmigen goldenen Klumpen, wobei die blauen Augen meines Vaters hinter den Brillengläsern doppelt so groß wirkten wie sonst.
Auch ich war wie versteinert und wagte kaum, auch nur zu atmen. Ich wusste zwar nicht, warum sie den Klumpen für einen Feind hielten, aber das seltsame Verhalten meiner Eltern machte mir mindestens genauso viel Angst wie ihnen diese goldene Karte. Selbst die Vögel in der Hecke zu den Nachbarn waren verstummt. Dann allerdings begann der Papierklumpen sich von allein zu bewegen, und ich schrie auf, bevor ich mir auf die Zunge beißen konnte.
Mama schlug sich die Hände vors Gesicht, als wollte sie nicht mitansehen, wie sich das Papier selbstständig auseinanderfaltete und Sekunden später wieder funkelnd und glänzend das Küchenlicht reflektierte, als wäre es nie zusammengeknüllt worden.
In diesem Moment wünschte ich mir, alles, was die anderen über mich behaupteten, wäre wahr und ich hätte einfach nur eine ausgeprägte Fantasie, würde Dinge sehen, die nicht da waren. Das wäre weit weniger besorgniserregend – und unheimlich! – als das, was ich eben gesehen hatte. Ich schaute von der nun wieder tadellosen Karte hoch zu meinen Eltern und begegnete dem Blick meines Vaters, in dessen Augen dasselbe Erschrecken lag wie in dem Laut, den Mama nun von sich gab. Die Tatsache, dass ich das Ganze beobachtet hatte, machte es nicht besser.
Am liebsten wäre ich direkt durchs Fenster ins Haus gesprungen. Weil es aber nur gekippt war, musste ich zur Haustür rennen, Sturm klingeln und gegen die Tür hämmern, sodass mich vermutlich sogar Frau Hausner nebenan hörte. Trotzdem öffnete mir niemand. Obwohl mein Vater mich doch gesehen hatte! Er hatte mir direkt in die Augen geschaut!
Mit rasendem Puls fischte ich nach meinem Schlüssel an dem Band um meinen Hals und schloss mit zitternden Fingern die Tür auf. Die Stimmen meiner Eltern drangen aus der Küche. Sie schienen sich zu streiten, dabei aber leise sein zu wollen, was durch die Tür wie ein bedrohliches Grollen und Zischen klang. Diesen Tonfall kannte ich nur zu gut. Genauso hatten sie nach Stellas Verschwinden miteinander gesprochen. Immer wieder. Und herausgekommen war trotzdem nichts. Stella, meine vier Jahre ältere Schwester, war seit drei Jahren wie vom Erdboden verschluckt.
Dann wurde es plötzlich still, und die Silhouette meines Vaters erschien im Durchgang, der vom Flur zur Küche führte. »Max, da bist du ja«, sagte er und lächelte, als wäre alles in bester Ordnung. Offensichtlich war das Heben seiner Mundwinkel sehr anstrengend. Schweißperlen standen ihm auf der Stirn. Er hatte sein Cordjackett abgelegt, und sein grünes Hemd klebte an seinem Körper.
Hinter ihm tauchte mit aufgesetzt fröhlichem Ausdruck meine Mutter auf.
»Kann mir mal jemand erklären, was hier los ist?«, wollte ich wissen.
»Was meinst du?«, fragte mein Vater betont ahnungslos und steckte seine Hände in die Taschen. Auch das schien anstrengend zu sein, so gequält wie er schaute. Ich war fassungslos und fühlte mich, als hätte ich einen Topf Kleister verschluckt. Mein ganzer Hals fühlte sich verklebt an.
»Mama?«, brachte ich mühsam hervor.
Meine Mutter hatte sich abgewandt und fummelte konzentriert mit dem Wasserkocher herum, der auf einmal das Interessanteste war, was sie jemals gesehen hatte. Das war nie im Leben der Fall. Sie ist Astrophysikerin, sie sieht tausendmal interessantere Dinge, wenn sie durch ihre Teleskope schaut.
»Das Ding ist irgendwie kaputt«, murmelte sie, ehe sie den Küchenschrank öffnete und die lange Reihe an Teesorten anstarrte. Erwartete sie, dass der Tee von allein herauskam? Drehten meine Eltern jetzt völlig durch?
»Und was war das gerade für ein goldenes Ding, das ihr da in der Hand hattet?«
»Was meinst du?«, fragte meine Mutter und wandte sich langsam zu mir um, als wäre das eine völlig abwegige Frage. Ich kannte dieses Lächeln. So verkrampft sah ich aus, wenn der Schulfotograf versuchte, uns mit dämlichen Witzen zum Lachen zu bringen, und mir eher zum Heulen zumute war.
»Mama, diese goldene Karte, die ihr gerade hattet? Ihr habt vor einer Minute versucht, sie anzuzünden. Du erinnerst dich?« Das war doch keine Fata Morgana gewesen. Mir war zwar heiß, aber nicht heiß genug für Halluzinationen.
»Ach diiiiiiie«, sagte meine Mutter und zog dabei das »i« in die Länge, um Zeit zu schinden. »Das war … das war nichts.« Sie starrte wieder auf die Teesorten. Wie lange wollte sie noch darüber nachdenken, ob sie grünen Tee mit Zitronen-, Granatapfel-, Matcha- oder meinetwegen Getragene-Socken-Geschmack wollte?
»Kann ich sie mal sehen?«
»Ach, die ist kaputt«, murmelte sie. »War nur Müll.« Etwas Glänzendes lugte unter der Butterbrotdose aus recyclebarem Plastik hervor. Mit wenigen Schritten war ich bei ihr und zog die Karte unter der Dose hervor, bevor meine Mutter reagieren konnte. Fast hätte ich sie sofort wieder fallen gelassen, denn sie fühlte sich total merkwürdig an: kühl und weich wie Watte, dabei vibrierte sie zwischen meinen Fingern. Auf dem golden schimmernden Hintergrund war etwas geschrieben wie auf einer sehr, sehr vornehmen Einladung. So stellte ich mir jedenfalls vornehme Einladungen vor, zu irgendwelchen blöden Fußball-Geburtstagen gab es eher kopierte, zerknitterte Zettel. Als ich den ersten Satz überflogen hatte, hörte ich auf zu atmen.
Persönliche Einladung der TT Academy für MAXKASTELL
Mein Name war größer geschrieben als der Rest des Textes und schimmerte besonders stark. Ich fuhr mit dem Finger darüber und konnte die erhabenen Buchstaben sogar spüren und … in dem Moment riss meine Mutter mir die Karte so hektisch aus der Hand, als würde sie gleich explodieren.
Ich fing wieder an zu atmen. Ich kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber es muss passiert sein, sonst wäre ich ja nicht mehr hier.
»Die ist nicht für dich«, sagte meine Mutter unglaublicherweise und versteckte die Karte hinter ihrem Rücken – so ähnlich wie ich mich früher verhalten hatte, wenn ich die XXL-Tüte Gummibärchen nicht abgeben wollte, die Oma mir geschenkt hatte, um mir eine Auszeit vom Öko-Essen meiner Eltern zu gönnen. (Meine Oma streut auch Zucker auf den Salat, sie hat definitiv andere Ansichten über Ernährung als meine Eltern.)
»Aber da steht doch mein Name drauf!« Mir gehören viele Dinge, auf denen nicht mein Name steht, aber diese Karte war eindeutig für mich. Und diese Einladung war definitiv vornehmer als jede andere, die ich je in meinem Leben erhalten hatte. Ich wollte sie auf jeden Fall haben!
Doch meine Mutter schüttelte mit zusammengepressten Lippen den Kopf und blickte mich streng an, als würde ich ihr etwas vorenthalten, was ihr gehörte, und nicht umgekehrt. Ich blickte also genauso streng zurück. Sie würde mich doch nicht ernsthaft anlügen, nachdem ich meinen Namen auf der Karte gelesen hatte! Sie hatte mich noch nie angelogen, oder jedenfalls hatte ich das bisher noch nie bemerkt. Vielleicht waren meine Eltern ganz anders, als ich bisher geglaubt hatte? Im nächsten Moment änderte sich der Gesichtsausdruck meiner Mutter, sie riss die Augen auf, machte wieder einen Schritt auf mich zu und umarmte mich so fest, dass es mir die Luft abschnürte.
»Wir haben noch eine Geburtstagsüberraschung für dich, Maxi-Liebling!«, rief sie so nah an meinem Ohr, dass es weh tat. Ihre Haare kitzelten an meiner Nase. Sollte das jetzt die Erklärung für ihr Verhalten sein?
»Mama, wenn du mich weiter fast zerquetschst, ist das hier eh mein letzter Geburtstag«, röchelte ich und war für einen Moment mehr um mein Leben besorgt als um die Karte. Zögernd ließ sie von mir ab. Jetzt übernahm mein Vater und drückte mich nochmals. Etwas weniger fest, dafür wuschelte er mir durch die Haare – was hatten Erwachsene eigentlich immer mit dieser Haarwuschelei? –, was ich ganz ausnahmsweise durchgehen ließ, weil mein Geburtstag war.
»Wir wollen in deine Lieblingspizzeria gehen. Und dann können wir auch schon eine Liste machen, wen du zu deiner Geburtstagsfeier einlädst und was wir Schönes planen können«, sagte er, als hätte es nie eine Karte gegeben und ich hätte mir das alles nur eingebildet. Mein Magen zog sich bei der Erwähnung einer Geburtstagsparty zusammen. Seit Stellas Verschwinden hatte ich keine Freunde mehr. In der Schule wurde über mich (und meine Familie) getuschelt, und alle mieden mich, als wäre das Verschwinden von Geschwistern ansteckend. Selbst Fußball hatte ich deshalb aufgegeben, obwohl ich es so sehr geliebt hatte. Aber wenn man allein auf dem Platz steht und vom Rest des Teams ignoriert wird, macht es keinen Spaß.
»Lasst uns jetzt endlich losgehen«, mischte sich Mama in unser Blickduell ein. »Ich habe Hunger.«
Mein Vater nickte übereifrig und schob mich schnell in Richtung Flur. Okay, vielleicht würden sie mir dann bei meiner Lieblingspizza erzählen, was es mit dieser goldenen Karte auf sich hatte. Aber ich glaubte nicht so recht daran. Selbst für ihre Verhältnisse verhielten sie sich supermerkwürdig. Eins war allerdings sicher: Ich musste auf jeden Fall irgendwie herausfinden, was los war.
2
Bis wir aufbrachen, hatte ich ständig nach der goldenen Karte Ausschau gehalten. Ich war mir fast sicher, dass meine Mutter sie beim Verlassen des Hauses in ihre Handtasche gesteckt hatte, aber die erinnerte mich manchmal an die Tasche von Hermine aus »Harry Potter«. Mich würde nicht wundern, wenn Mama darin ebenfalls ein Zelt hätte. Ohne Zauberspruch wäre die Einladung für immer in den Untiefen dieser gigantischen Tasche verschollen.
Die Salami-Pizza mit dünner Kruste und der perfekten Menge Käse in der besten Pizzeria der Stadt (gut, sie war auch die einzige) war noch leckerer als sonst, sodass es beim Abendessen nicht mehr anstrengend war zu lachen, zu quatschen und sich über schwarze Löcher und alte Reliquien zu unterhalten. Meine Eltern schenkten mir – statt des erhofften Handys – einen Kino-Gutschein und den Original-Fußball der letzten WM. Eigentlich hatte ich so viel Spaß wie lange nicht mehr, und irgendwie wurde dieser zwölfte Geburtstag doch noch der beste Geburtstag seit Stellas Verschwinden. Jedenfalls, wenn ich verdrängte, was vorher in unserer Küche geschehen war, und übersah, dass meine Mutter hin und wieder abwesend lächelte und ziemlich oft zur Toilette verschwand – natürlich mit ihrer Handtasche! Und wenn ich ignorierte, dass meine Eltern keinerlei Versuch machten, irgendetwas zu erklären, und meine vorsichtigen Fragen direkt abwürgten.
Und wenn ich nicht daran dachte, wie mein Name auf der Karte im Licht geschillert hatte.
Ja, das waren wahnsinnig viele Dinge, die ich nicht tun sollte. Weshalb es mir später im Bett auch nicht mehr gelang. Unten wurden die Stimmen meiner Eltern immer lauter, und ich schaffte es nicht mehr, ihr seltsames Verhalten auszublenden. Daher öffnete ich die Augen, starrte auf die aufgeklebten Leuchtsterne an der Decke und konzentrierte mich auf die Stimmen meiner Eltern. Sie diskutierten schon wieder.
So leise wie möglich stieg ich aus meinem Bett und tappte auf den glatten Holzdielen in den Flur. Während ich die Treppe runterschlich, achtete ich darauf, nur die Treppenstufen zu betreten, von denen ich wusste, dass sie nicht knarrten. Natürlich wohnten wir im ältesten Haus in der Gegend, was meine Eltern als Glücksfall ansahen, weil es besonders viel »Atmosphäre« hatte, die vor allem darin bestand, dass es überall knirschte und knackte.
Endlich konnte ich durch die Tür etwas verstehen.
»Wer hat die Einladung gebracht? Wir …« Dann sprachen sie wieder leiser. Ich musste näher zur Tür, aber die untersten acht Stufen waren so laut, dass ich es niemals ungehört nach unten schaffen konnte. Ich legte mich vorsichtig aufs Geländer und ließ mich auf dem Bauch langsam nach unten gleiten. Dabei musste ich sorgfältig darauf achten, dass mein Schlafanzugoberteil sich nicht hochschob, weil man auf dem nackten Bauch nur schwer rutschte. Fast unten angekommen hörte ich die Stimme meines Vaters.
»Vielleicht wäre es für Max das Richtige.« Es klang unsicher, eher nach einer Frage.
»Damit dasselbe passiert wie mit Stella?«
Stella! Ich vergaß für einen Augenblick, mich festzuhalten, und mit einem lauten Poltern landete mein Hintern auf dem alten Parkett. Es tat höllisch weh. Vielleicht war mein Hinterteil auch empfindlicher geworden, seit ich nicht mehr zum Fußballtraining ging und ständig über den Rasen schlitterte. Innerhalb einer Nanosekunde riss mein Vater die Tür zum Wohnzimmer auf, stürmte heraus und stolperte fast über meine Beine. Meine Mutter erschien hinter ihm, ihre Finger umfassten etwas Goldenes. Beide sagten nichts, nachdem sie mich erkannt hatten, sondern waren vor Schreck kurz gelähmt wie die Tiere, die nachts vor die Scheinwerfer eines Autos gerieten.
Okay, jetzt nicht überlegen, sondern handeln.
Mit drei langen Schritten erreichte ich meine Mutter, riss ihr die goldene Karte aus der Hand, drehte mich um und sprang die Stufen hinauf, immer mehrere auf einmal, rannte in mein Zimmer und warf mich von innen gegen die Tür. Ich hörte das Knarren der ersten Stufen, als sie mir nachkamen. Wieso hatte ich keinen Schlüssel für mein Zimmer?
In Filmen klappte es immer, wenn man eine Stuhllehne unter die Klinke schob und sie damit blockierte. Ich stemmte mich gegen den schweren Ohrensessel, der in meiner Leseecke stand. Nichts. Dann warf ich mich mit dem ganzen Oberkörper gegen die Lehne. Langsam gab er nach, und ich rückte ihn stoßweise gegen die Tür. Vielleicht waren das die Superkräfte, mit denen Menschen angeblich in Panik unter Adrenalin ganze Autos hochheben konnten. Der Sessel stieß gerade gegen die Tür, schon presste sich die Klinke in das Polster der Rückenlehne. Mein Herz klopfte so laut, dass meine Eltern es wahrscheinlich durch das Holz hören konnten. Doch die Klinke ließ sich tatsächlich nicht vollständig herunterdrücken. Auch nicht beim zweiten oder beim dritten Versuch. Diese Filme waren ausnahmsweise mal realistisch.
»Max, mach bitte die Tür auf.« Ein lautes Hämmern und die verärgerte Stimme meines Vaters drangen dumpf durch die Tür. Alles in mir drängte danach, der Aufforderung meiner Eltern zu folgen, wie ich es sonst tat. Aber dann spürte ich wieder das watteweiche Ding in meiner Hand. Meine Eltern hatten gelogen. Sie wussten offenbar etwas über Stella, das sie vor mir verheimlichten. Und es hatte etwas mit dieser Einladung zu tun. Keuchend ließ ich mich in den Ohrensessel fallen und las erneut die erste Zeile:
Persönliche Einladung der TT Academy für Max Kastell
Mein Puls beschleunigte sich. Meine Hände kribbelten, als würden Ameisen darauf herumlaufen.
Sehr geehrter Herr Kastell,
wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie zur Aufnahmeprüfung der Time Travel Academy für Zeitreisende zugelassen wurden. Die Einschreibung ist zu nachfolgendem Datum ganztägig möglich.
Wir erwarten Pünktlichkeit.
Ort: Weihergasse 108
Zeitstempel: 202207250000UTC
Wie bitte? Time Travel Academy? Zeitreisende? Ernsthaft jetzt? War es das, wonach es sich anhörte? Und was sollten bitte diese komischen Zahlen bedeuten? Wie konnte man pünktlich sein, wenn man nicht verstand, welche Uhrzeit sie meinten? Es klopfte erneut.
»Max, öffne die Tür. Wir können dir alles erklären!«
Das Klopfen schwoll zu einem Donnern an. Wenn ich so fest gegen die Tür schlagen würde, würde es ziemlichen Ärger geben.
»Mach auf, Max. Jetzt!«, hörte ich die ungewohnt bedrohliche Stimme meines Vaters. Mein Blick glitt zum Fenster. Wenn ich schnell war, könnte ich aus dem Fenster springen, mein Fahrrad holen und zu der auf der Einladung angegebenen Adresse düsen. Aber das wäre verrückt. Dies war schließlich kein Actionfilm. Außerdem würden meine Eltern mich vermutlich sowieso einholen, sobald sie verstanden hatten, dass ich aus dem Fenster geklettert war.
»Es reicht. Du öffnest jetzt sofort die Tür!«, rief meine Mutter in ihrer strengsten Stimme.
»Okay. Aber ihr sagt mir wirklich, was los ist«, gab ich zögernd nach. Vielleicht hatten sie ja tatsächlich eine Erklärung. Ich warf einen letzten Blick auf die Einladung und versuchte, sie mir einzuprägen, als könnte ich ein Foto davon machen, falls meine Eltern sie mir gleich wieder wegnahmen. Hätte ich wie alle anderen ein Handy, hätte ich ein echtes Foto machen können. Jetzt musste mal wieder mein Kopf reichen.
Ich schob den Ohrensessel, der ziemlich von der Türklinke geärgert worden war, zur Seite, und polternd fielen meine Eltern ins Zimmer. Es hätte lustig sein können, wie sie sich in letzter Sekunde gegenseitig auffingen, aber nach Lachen war mir nicht zumute. Vor allem nicht, nachdem meine Mutter mir eine weitere halbe Sekunde später die Karte aus der Hand gerissen hatte und dabei erleichtert aufatmete, als hätte sie mich vor einer geladenen Pistole gerettet. Ich stemmte die Hände in die Hüften, machte mich extra groß und stellte mich breitbeinig vor die beiden hin.
»Könnt ihr mir jetzt endlich erklären, was es mit diesem goldenen Ding auf sich hat? Ihr benehmt euch total schräg.«
Mein Vater setzte zum Sprechen an, aber Mama kam ihm zuvor.
»Ach, es ist wirklich nichts«, sagte sie, während sie versuchte, meinen Vater mit Blicken zu hypnotisieren oder zu lähmen. Das wurde ja immer absurder. »Also«, fügte sie zögernd hinzu und strich sich mehrere Haarsträhnen aus dem Gesicht. Von ihrem Dutt, den sie morgens vor der Arbeit fest zusammengesteckt hatte, war wirklich nicht viel übriggeblieben. Ihre Wangen waren gerötet, und wenn ich mich nicht täuschte, zitterten ihre Finger wieder ein wenig. Dann schüttelte sie sich kurz. »Es ist natürlich schon etwas«, schnaubte sie nervös. »Wir machen das alles nur, um dich zu beschützen. Das ist ein ganz schlechter Scherz, der hier gespielt wird. Das sind … Gangster.«
Ernsthaft jetzt? Für wie alt hielten sie mich? Ich schnappte kurz nach Luft. »Gangster? Mama, hast du zu viele Filme gesehen? Was sollen das denn für Gangster sein, die vornehme Karten in Schönschrift verschicken?«
»Sie … sie versuchen Kinder anzulocken. Deshalb versuchen wir, dich davor zu beschützen«, stammelte sie.
»Und woher wisst ihr davon?«, fragte ich. Ich glaubte ihnen kein Wort.
»Das … das wissen alle Eltern«, sagte meine Mutter wenig überzeugend. Dann lächelte sie, schaute dabei aber so verstört, dass man ihr Lächeln keinesfalls ernst nehmen konnte.
In dem Moment wurde mir klar, dass ich von ihnen keine vernünftige Antwort bekommen würde, egal wie viel ich fragte. Und umso sicherer war ich mir, dass ich auf jeden Fall herausfinden musste, was los war.
Zeit, die Taktik zu ändern. Ich sah zu meiner Mutter, dann zu meinem Vater. Beide blickten ängstlich erwartungsvoll zurück.
»Okay«, sagte ich und war sehr darum bemüht, einen Rest Ärger und Zweifel in meine Stimme zu legen – was gar nicht so einfach war, wie es vielleicht klingt. »Ihr meint also, die Karte hat ein Gangster geschrieben, der versucht, Kinder anzulocken – um sie dann zu … berauben?«
Meine Eltern nickten ungefähr gleichzeitig und wirkten ziemlich erleichtert. Wenn nicht alles so merkwürdig gewesen wäre, hätte ich über ihren schlechten Schauspielauftritt lachen müssen. Was sollten mir Gangster denn rauben? Mein Taschengeld?
»Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen?« Trotz wildem Pochen in meiner Brust, versuchte ich, ruhig zu klingen.
Das war ihre letzte Chance. Eine Sekunde lang dachte ich, dass mein Vater noch etwas erklären würde, aber dann zuckte er nur hilflos mit den Schultern. Doch seine Augen sahen irgendwie danach aus, als hätte er ein schlechtes Gewissen. Irgendetwas stimmte hier ganz und gar nicht, und ich hasste es wieder einmal, ein Kind zu sein. Erwachsene dachten immer, sie müssten Kindern Dinge verheimlichen, dabei waren sie doch selbst einmal Kind gewesen! Konnten sie sich nicht mehr daran erinnern, wie es war, ständig etwas vorgeschwindelt zu bekommen?
»Gut«, sagte ich bemüht gelangweilt und zuckte mit den Schultern. Ich konnte zusehen, wie die Anspannung von meinen Eltern abfiel. Offenbar hatte ich mein Schauspieltalent nicht von ihnen geerbt.
»Ich bin so froh, dass du das verstehst. Es ist so schwer zu erklären und …«, fing Mama an.
»Schon gut«, sagte ich, um uns beiden die weitere Vorführung zu ersparen, und setzte ein Lächeln auf. Hoffentlich sah es echter aus als das von meiner Mutter. Dann streckte ich die Arme nach oben und gähnte demonstrativ. »So eine Aufregung und völlig umsonst. Ich bin hundemüde«, murmelte ich und hielt mir die Hand vor den Mund, um ein weiteres Gähnen vorzutäuschen. Als hätte das Adrenalin in meinen Adern nicht jeden Gedanken an Müdigkeit ausgelöscht.
»Das kann ich verstehen«, sagte Mama und sah mich liebevoll an. Und unglaublich erleichtert. Verdächtig erleichtert.
3
Zwanzig Minuten später hatte ich geduscht, meinen Schlafanzug aus weichem Nicki angezogen, meinen Eltern Gute Nacht gesagt und war in mein Zimmer gegangen. Und ungefähr dreißig Minuten später hatte ich wieder meine Lieblingsjeans, ein blaues T-Shirt und meine Sneaker angezogen und war aus dem Fenster gestiegen. Nicht ohne vorher aus ein paar Anziehsachen und den Stofftieren, die ich noch hinten im Kleiderschrank lagerte, eine Schlafender-Max-Puppe zu bauen. So würden meine Eltern, wenn sie noch mal kurz ins Zimmer schauten, nicht direkt kapieren, dass ich gar nicht da war.
Glücklicherweise hatte sich alles, was ich auf der goldenen Karte gelesen hatte, tatsächlich in mein Gehirn gebrannt. Ich konnte jeden Buchstaben genau vor mir sehen.
Als ich zur Garage huschte, ohne den verräterischen Kiesweg zu betreten, war es noch einigermaßen hell. Ich schnappte mir mein Fahrrad und schob es leise und dabei so schnell wie möglich auf dem Gras entlang durchs Tor auf die Straße. Hinter der Hecke schwang ich mich auf den Sattel und begann zu treten. Der kühle Abendwind ließ eine Gänsehaut auf meinen Armen entstehen – ich hatte in der Eile ganz vergessen, einen Pullover über mein T-Shirt zu ziehen. Ich richtete mich auf und trat mit vollem Körpergewicht in die Pedale. So wurde mir immerhin warm, und außerdem wollte ich zurück sein, bevor meine Eltern doch noch etwas bemerkten. Immer wieder überfiel mich aber dieses unangenehme Gefühl, dass sie mit ihrer Warnung vielleicht recht hatten. So ganz wohl war mir nicht bei der Sache, schließlich logen sie mir normalerweise nicht so krass ins Gesicht, erzählten nur die üblichen Standardlügen aller Erwachsenen: Zu viel Fernsehen macht viereckige Augen – konnte bei uns ja mangels Fernseher nicht passieren –, Handy-Apps machen Kinder zu aufgedrehten Flummis – deshalb besaß ich kein Handy. Heute jedoch war es anders gewesen. Die Angst in ihren Augen hatte auf mich echt gewirkt. Der Anblick hatte sich wie die Karte in mein Hirn gebrannt und ließ mich frösteln. Und doch musste ich herausfinden, was los war – das könnt ihr sicher alle verstehen.
Ich begegnete zum Glück niemandem, den ich kannte. Viele der Nachbarinnen und Nachbarn waren in den Sommerferien sowieso im Urlaub, und die anderen saßen, der nach Würstchen duftenden Luft zufolge, beim Grillen im Garten hinter den Häusern. Nach fünfzehn Minuten quer durch die Stadt erreichte ich die Weihergasse. Ich bog ab und radelte an den unauffälligen Einfamilienhäusern entlang, welche die Straße säumten. Sie war wie leergefegt, und einige Häuser hier sahen noch nicht mal bewohnt aus. Was mir vielleicht nicht ganz so gruselig vorgekommen wäre, wenn Stella mich nicht verbotenerweise zu diesem Horrorfilm überredet hätte. Das hatte dazu geführt, dass wir die nächsten Wochen nur noch in einem Zimmer mit drei Nachtlichtern gleichzeitig schlafen konnten. Moment. Streicht das bitte. So etwas zuzugeben, ist irgendwie uncool. Aber beim Anblick der Straße musste ich leider sofort wieder daran denken. Nirgendwo ein Mensch, nur vereinzelt kleine Pfützen auf dem oft geflickten Asphalt, über denen Mückenschwärme tanzten. In den Fenstern der Häuser hingen von der Sonne verblichene Gardinen, gelegentlich sah ich das Flimmern eines Fernsehbildschirms, aber nirgendwo hörte ich Stimmen oder roch den Duft von Grillwürstchen. Es gab niemanden, der im Garten saß oder die Straße entlangging. So weit war ich die Weihergasse noch nie heruntergefahren. Immer wieder prüfte ich die Hausnummern an den verwitterten Fassaden: 20, 50, die Weihergasse war ziemlich lang. Je näher ich ihrem Ende kam, umso mehr kribbelten meine Fingerspitzen, die sich wie Schraubzwingen um den Lenker geschlossen hatten. Ich konnte schon die letzten Häuser sehen, als mich die Straße fast aus dem Sattel warf. Vorher war der Asphalt uneben wie ein grober Flickenteppich gewesen, hier war die an einigen Stellen aufgeplatzte Straße gar nicht mehr repariert worden.
Es fehlte nur noch die Horrorfilmmusik, um die Kulisse perfekt zu machen. Ich hielt vor dem letzten Haus auf der rechten Seite. 106 stand am Briefkasten. Gegenüber auf einem Schild mit abgeblätterter Farbe an einem grauen, halb verfallenen Haus stand die Nummer 107 und dann … war die Weihergasse zu Ende.
Aber ich gab nicht auf, sondern fuhr weiter. Der zuletzt rissige Asphalt wurde erst zu einer Schotterpiste, dann, kurz bevor er eine Biegung hinter einer Wiese mit Obstbäumen machte, zu zwei plattgefahrenen Spuren, zwischen denen Gras wucherte. Gegenüber der Obstwiese begannen die Felder, die sich, soweit ich wusste, bis zum Nachbarort zogen.