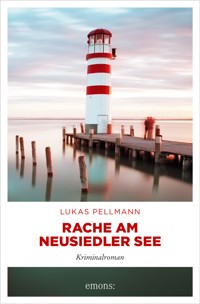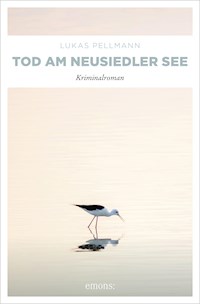
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Nikolaus Lauda
- Sprache: Deutsch
Spannende Krimilektüre mit Witz und Wein. Auf der Flucht vor einem deutschen Mafiaclan versteckt sich der ehemalige Polizist Nikolaus Lauda in Rust am Neusiedler See. Doch statt eines sicheren Rückzugsorts warten dort neue Probleme auf ihn. In einem nahe gelegenen Steinbruch wird die Leiche einer Journalistin gefunden, und für die örtliche Polizei steht fest: Lauda ist in den Fall verwickelt. Um seine Unschuld zu beweisen, stellt er eigene Ermittlungen an. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn auch die Mafia kommt ihm wieder auf die Spur ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 443
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Lukas Pellmann wurde 1979 in Essen/BRD geboren und lebt seit 1990 in Wien. Er studierte Geschichte und Politikwissenschaft an der Uni Wien und arbeitete jahrelang als Journalist. Seit 2015 hat er mehrere Kriminalromane sowie einen Roman veröffentlicht. Daneben schreibt Lukas Pellmann u. a. Kurzgeschichten mit Usern von derstandard.at, bloggt auf www.booksinvienna.at und organisiert Ausstellungen mit der Instagram-Community.
www.lukaspellmann.at
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2022 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Sven Herdt
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-985-3
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Für Papa Pellmann und Jürgen Ritter. Lasst es krachen dort oben!
Freitag
Endstation
»Verabschiede dich von ihr!«
Hätte es eine Neuverfilmung des Films »Der Pate« gegeben, mit Vito Violino in der Hauptrolle, er wäre eine ziemliche Fehlbesetzung gewesen. Der Pate des Ruhrgebiets hatte so rein gar nichts von Glanz und Aura eines Marlon Brando oder Al Pacino. Hätte ich nicht gewusst, dass er der Boss einer Mafiaorganisation ist, die fast ein ganzes deutsches Bundesland unter ihrer Kontrolle hat, man hätte ihn auch für einen Pizzabäcker oder einen Sachbearbeiter des Wiener Magistrats halten können. Er war ein ziemlicher Durchschnittskerl. Ein Durchschnittskerl, der meiner Frau eine Waffe an die Stirn hielt.
Zwanzig Minuten zuvor hatte ich gerade die Wohnungstür hinter mir ins Schloss fallen lassen, als ich den Funkspruch der Kollegen mitbekommen hatte. Geiselnahme bei Bäcker Peter in der Rüttenscheider Straße. Das war gleich ums Eck. Mein Partner Ralf war bereits auf dem Weg. Kurz darauf trafen zeitgleich er, die uniformierten Kollegen und ich bei der Bäckerei ein. Die orangefarbenen Plastiksessel, die unter der gleichfarbigen Markise standen, waren verwaist. Einer der Sessel lag auf dem Boden, umgeworfen von der Dramatik der Ereignisse. Von der gegenüber gelegenen Straßenseite konnten wir erkennen, dass im Inneren der Filiale ein Mann stand, der mit einer Waffe herumfuchtelte. Die Beine einer Frau waren durch die Eingangstür zu sehen. Sie lag am Boden. Wir hatten keine Ahnung, ob sie noch am Leben war. Es war jedenfalls keine Regung zu sehen.
»Ich gehe rein«, sagte ich zu Ralf. Seine Bedenken, die er mir hinterhergerufen hatte, wurden vom Wind durch die Rüttenscheider Straße hinfortgefegt, bis hin zur Brücke über den Kanal der A 52, wo sie vom Lärm der Autokolonnen vollständig absorbiert worden waren. Natürlich war auch das Sondereinsatzkommando im Anmarsch, da hatte Ralf schon recht. Aber eine innere Stimme sagte mir, dass es bei der Geiselnahme um etwas Persönliches ging. Dass das mit mir zu tun hatte. Mit mir ganz persönlich. Und nicht mit Ralf, dem SEK oder sonst wem. Kurz darauf stand ich in der Filiale. Es roch nach Backwaren. Mein Hirn schaltete sofort in den Topfengolatschen-und-Nussbeugel-Modus, obwohl ich in den vergangenen sieben Jahren nichts davon in der Vitrine eines deutschen Bäckers gesehen hatte. Mein Verstand negierte einfach die Realität. Wie gern hätte ich das in diesem Moment auch getan.
»Pack deine Wumme weg«, schrie Vito mich an. Doch ich reagierte gar nicht, sah nur auf den Boden, auf die dort mit dem Gesicht nach unten liegende Frau, und alle meine Befürchtungen wurden mit einem Schlag bestätigt.
»Ganz ruhig, Luise«, sagte ich, »ich bin bei dir. Alles wird gut!«
Meine Frau trug ihren neuen grauen Trenchcoat, in den sie sich ein paar Tage zuvor verliebt hatte. Sie rührte sich nicht, aber ich hörte ein leises Schluchzen. Sie war am Leben.
»Hör auf zu labern«, erklärte Vito, »und pack endlich die Wumme weg!«
»Ich habe keine Waffe dabei«, sagte ich. Zum Beweis hob ich meinen Pullover hoch, damit er sich davon überzeugen konnte, dass ich kein Holster trug.
»Bist ’n kluger Bulle«, lobte er mich. Erst jetzt bemerkte ich an einem Wimmern hinter der Theke, dass wohl auch dort mindestens ein weiterer Mensch kauerte.
»Gib auf, Vito, das macht doch keinen Sinn«, erklärte ich. Ich versuchte, so ruhig und abgeklärt wie möglich zu klingen, und war selbst überrascht, wie gut mir das gelang. Immerhin lag keine fünf Meter von mir entfernt meine Frau auf dem Boden. Da griffen wohl die jahrelang einstudierten Mechanismen, die man als Polizist in der Ausbildung eingebläut bekommt. Ich hätte nicht gedacht, dass das auch dann funktioniert, wenn man auf einer so unmittelbar persönlichen Ebene betroffen ist. »Das SEK wird jeden Moment hier sein, und dann nehmen die den Laden auseinander«, sagte ich abgebrüht.
»Sollen sie doch«, erklärte Vito, leider ebenso abgebrüht. Es entbehrte nicht einer gewissen Ironie, dass er das Leben der Frau eines Polizisten ausgerechnet mit einer HK P10 bedrohte, einer auch von der Polizei verwendeten Pistole. »Bis die da sind, bin ich längst fertig.«
»Man kann doch über alles reden.« Solange man mit Gewalttätern im Gespräch blieb, hatte man die Möglichkeit, die Kontrolle über die Situation zu behalten. Endete das Gespräch, verebbte die Kommunikation, nahm die Tragödie ihren Lauf. Ausnahmslos. Immer.
»Ich bin aber nicht zum Reden hier«, fuhr Vito fort. »Du hast mir meinen Bruder genommen. Ich nehme dir deine Frau. Das ist ganz einfach. Ich wollte nur warten, bis du kommst, damit du es erste Reihe fußfrei mitverfolgen kannst.«
»Vito!«, rief ich. »Mach keinen Scheiß.«
Luises Wimmern wurde lauter. »Niko, tu doch was!«, schrie sie.
»Halt’s Maul, Schlampe!«, brüllte Vito sie an. »Schau genau hin«, sagte er anschließend zu mir. »Endstation!«
»Vito, nein!«
»Endstation!«
»Nein!«
»Doch, Wien Hauptbahnhof, der Zug endet hier.«
Ich öffnete die Augen.
»Gut, dass Sie endlich aufg’wacht sind, sonst hätt ich Ihnen unterm Popscherl einen Schweizer Kracher zünden müssen. Aber dann hätt ich wieder Probleme mit’m Fahrdienstleiter bekommen.« Der ÖBB-Zugbegleiter wusste offenbar, wovon er da sprach.
Willkommen in Ungarn
»Depperter Beidl«, hatte ich dem Zugbegleiter hinterhergeschimpft, nachdem er mich recht unsanft aus dem ICE befördert hatte. Weniger, um ihn damit persönlich zu treffen. Dafür hätte ich mir wesentlich Schlimmeres ausdenken müssen, Kontrolleure und Zugbegleiter mussten sich während der Ausübung ihrer Dienstleistung wohl genug unerfreuliche Dinge anhören. Nein, vielmehr wollte ich mich meiner sprachlichen Skills vergewissern. Sieben Jahre in Deutschland hatten ihre Spuren hinterlassen, auch hinsichtlich meiner verbalen Umgangsformen. Das Meidlinger L kam mir tatsächlich nicht mehr so räudig über die Lippen, wie es sich eigentlich gehörte. Ich übte weiter, während ich mich von der Rolltreppe hinunter in die Bahnhofshalle chauffieren ließ und mich von dort auf den Weg zum Anschlusszug machte. Dreimal, viermal. »Du depperter Beidl, du Hundsbeidl.« Doch meine Aussprache wurde nicht authentischer. Dafür erntete ich verstörte Blicke der Leute, die auf der Rolltreppe an mir vorbeihuschten und die mich – im besten Fall – für einen Patienten mit Tourettesyndrom hielten.
Kein See in Sicht. Die Fahrt mit dem Regionalexpress gestaltete sich seit der Abfahrt am Wiener Hauptbahnhof eintönig. Namenlose Orte mit ihren Fertigteilhauserweiterungen wechselten sich mit Lagerhäusern von landwirtschaftlichen Genossenschaften und riesigen Bahnhofsparkplätzen für Pendler ab. Die Felder standen noch ziemlich im Saft, das überraschte einen in landwirtschaftlichen Dingen gänzlich Minderbemittelten wie mich. Ich hätte erwartet, dass die Landschaft Mitte November in einem grauen Einheitsbrei versinkt. Doch weit gefehlt. Neben abgeernteten Feldern gab es auch reichlich Grün und dazwischen riesige Streifen mit gelbblütigen Pflanzen, die ich für Raps hielt. Hie und da reckte ein Hase seine Ohren aus dem Feld, Rebhühner hüpften vergnügt über die Wiesenstreifen. Die Hochstände der Jägerschaft rundeten das Bild ab. Das am Horizont thronende schneebedeckte Bergmassiv – von der Sonne kitschig in Szene gesetzt – verschwand leider genauso unverhofft, wie es kurz zuvor aus der grauen Wolkendecke emporgekrochen war. Dafür tauchte kurz vor Parndorf, nachdem der REX auf einer Brücke über die A4 gedonnert war, plötzlich ein in der Pampa stehendes Hochhaus auf, das wie diese riesigen Kreuzfahrtschiffe im norddeutschen Emden darauf zu warten schien, endlich zum Meer gezogen zu werden. Doch weit und breit waren keine Schlepper zu sehen, die das mindestens zehn Stockwerke hohe Monstrum zum nicht vorhandenen Meer hätten bugsieren können. Hätte das Hochhaus einen riesigen Balkon im vorletzten Stockwerk gehabt, dann hätte das Ding auch als Avengers Tower aus der Marvel-Superheldenserie durchgehen können.
Als der REX den Bahnhof in Neusiedl am See verließ, war weit und breit immer noch nichts von einem der größten Steppenseen Europas zu sehen. Natürlich hatte meinen Mitschülern und mir schon Frau Spitznagl in der Volksschule in der Kleinen Sperlgasse das Vorhandensein des Neusiedler Sees glaubwürdig dokumentiert. Und wenn ich mich richtig erinnere, haben meine Eltern mit mir auch mal einen Ausflug zum See gemacht. Aber Seen konnten austrocknen, insbesondere Steppenseen wie der Neusiedler See. Von einer Burg war bis jetzt übrigens auch weit und breit nichts zu sehen, was mich ebenso an der Sinnhaftigkeit der Namensgebung für das dazugehörige Bundesland zweifeln ließ. Aber gut, ich hatte ja gerade erst mal ein paar Kilometer auf burgenländischem Terrain zurückgelegt.
Der REX setzte seine Reise am westlichen Ufer des Sees in Richtung Süden in aller Gemütlichkeit fort. Sein hündischer Namensvetter, der in den 1990ern als Polizeihund die österreichischen Fernsehbildschirme erobert hatte, hatte beim Schnappen nach einer Extrawurstsemmel definitiv mehr Elan an den Tag gelegt. Wir zuckelten weiter durch die Landschaft, ließen die ein oder andere Bedarfshaltestelle aus, ebenso wie ein kleines Häuschen mit dem Schriftzug »Leos Ranch«. Es folgten orange-gelb-golden eingefärbte Weingärten an den Hängen des Leithagebirges auf der rechten sowie unendlich weit wirkende Ackerflächen auf der linken Seite. Und, ganz in der Ferne: Schilf. Und schmale Stangen, die man mit einigem Goodwill Segelbooten zurechnen konnte. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass mich Google Maps und die ÖBB nicht an der Nase herumführten. Dort hinten musste er tatsächlich irgendwo sein, der Neusiedler See.
Rund eine Stunde nachdem ich in Wien in den REX eingestiegen war, kündigte die metallene Stimme der ehemaligen Fernsehansagerin Chris Lohner die Ankunft in Eisenstadt an. Und siehe da, am Horizont war auch hier jenes imposante Massiv des Schneebergs zu sehen, das ich bereits kurz hinter Wien ausgemacht hatte. Ich wurde das Gefühl nicht los, dass der REX nicht gerade den direktesten Weg nach Eisenstadt gewählt hatte.
Als sich die roten Schlussleuchten des REX in Richtung Wulkaprodersdorf verabschiedet hatten, kehrte auf den drei Gleisen des Bahnhofs der burgenländischen Hauptstadt Ruhe ein. Der Bahnhof in Eisenstadt gehörte zu jenen grundehrlichen Orten auf der Welt, die einem gar nicht erst vorgaukelten, ein Erlebnisort von Weltformat zu sein. Hier sprang den Ankömmling keine unnötige Shoppingmall und auch keine einzigartige Erlebnisgastronomie an, was ich als sehr wohltuend empfand. Der Eisenstädter Bahnhof erledigte einfach unaufgeregt seinen Job und behelligte die Ankommenden und Abreisenden nicht mit unnötigem Kommerz und Trallala.
Ich schlüpfte zwischen Bahnhofshäuschen und einem von Jugendlichen mit ihren hochgetunten Autos frequentierten Parkplatz hindurch. Auf der anderen Seite warteten bereits Martin, Fanny, Georg und Vitus auf mich. Doch die niedlich benamsten Eisenstädter Stadtbusse ließ ich genauso links liegen wie den 285er, der mich direkt zu meinem Ruster Domizil hätte bringen können. Denn ich teilte eine ungute Eigenschaft mit illustren Herren wie dem Schriftsteller Gorch Fock oder dem Evolutionsforscher Charles Darwin. Steuerte ich Fahrzeuge mit mehr als einem PS nicht selbst, wurde mir gern mal nach wenigen Minuten schlecht. Zug war okay. Beifahrersitz in einem Auto meistens auch. Alles andere konnte sehr übel enden. Goethe, ebenso von Übelkeit auf Reisen betroffen, soll empfohlen haben, mit Brot und Wein stets in der Horizontalen zu reisen. Nun denn, bei mir sollte hoffentlich der Beifahrersitz eines Uber reichen. Eines Uber, auf das ich jedoch lange hätte warten können. Denn ein Blick in die dazugehörige App auf meinem am Wiener Hauptbahnhof erstandenen Wertkartenhandy verriet mir, dass es den praktischen Fahrservice in Österreich lediglich in drei Städten gab. Eisenstadt gehörte, wie ich nun wusste, nicht dazu.
Ich machte mich also auf dem Bahnhofsvorplatz auf die Suche nach einem Taxistand. Leider auch das umsonst. Alles, was ich fand, war das Werbeschild eines Taxiunternehmens in einem Haltestellenaushang. Taxi Pruckner. Ich wählte die angegebene Nummer. Zwanzig Minuten später hielt vor meinen Füßen eine eierschalenfarbene Familienkutsche mit notdürftig auf dem Dach montiertem gelb-schwarzen Taxischild.
»Sie haben ang’rufen, gell?«, fragte die Frau durch das geöffnete Fenster der Beifahrertür. Ich nickte, während Vitus und Georg sich im Hintergrund beleidigt aus dem Staub machten.
»Wo soll’s denn hingehen?«, fragte sie, nachdem ich meinen großen dunkelblauen Koffer und den Rucksack im Kofferraum des Minivans verstaut und auf dem Beifahrersitz Platz genommen hatte. Unter meinem Schuh klebten die roten Reste eines Chupa-Chups-Lollis. Ich hätte schwören können, dass die im Zug noch nicht dort gewesen waren. Kirschgeschmack, tippte ich, nachdem ich den Mist abgekratzt und unter die Lupe genommen hatte.
»Geben S’ her, tut mir leid«, sagte die Taxifahrerin und entriss mir den blauen Stängel mit der roten Viertelkugel, um beides in der Zwischenablage des Autos verschwinden zu lassen. »Meine Tochter vergisst hin und wieder, dass das Auto kein Mistkübel ist.«
Kein »Mistkübel«. Es gab nicht viele österreichische Eigenheiten, die ich während meiner Zeit in Deutschland vermisst hatte. Das Wörtchen »Mistkübel« begeisterte nun aber meine Ohren wie Beethovens Sechste die Ohren eines Klassik-Fans. Und das war noch dazu ein Wort, das mir nach wie vor problemlos und authentisch über die Lippen kam.
»Wo wollen Sie hin?«, fragte sie, nachdem sie den Motor gestartet hatte und losgefahren war.
»Hätten Sie das nicht fragen sollen, bevor Sie sich gerade eben für eine Richtung entschieden haben?«, fragte ich zurück.
Sie war vielleicht ein paar Jahre jünger als ich, Mitte oder Ende dreißig. Dunkle ausufernde Locken, die von einem Zopf gebändigt wurden. Ein beigefarbener Rollkragenpullover und eine Jacke schützten sie vor der Kälte, die in das Innere des Autos gekrochen war. Die warme Luft, die mit dem typischen Gebläseton aus den Öffnungen der Lüftung kam, kämpfte einen vorerst aussichtslosen Kampf. Lange konnte die Frau zuvor noch nicht im Taxi unterwegs gewesen sein, denn im Innenraum hatte es nicht viel mehr Grad Celsius als draußen. Die schmalen Furchen in ihren Gesichtszügen ließen darauf schließen, dass das Leben nicht immer gut zu ihr gewesen war. Trotzdem – oder vielleicht gerade deswegen – war sie eine schöne Frau. Nicht von jener Sorte, die man im Fernsehen oder auf der Straße auf den ersten Blick hübsch findet. Sondern ein Hübsch, dass von innen nach außen strahlt.
»In Eisenstadt kann man sich nicht wirklich verfahren«, antwortete sie. »Selbst wenn Sie in die andere Richtung gewollt hätten, hätten wir nicht viel Zeit verloren.«
Ich nannte ihr die Adresse, und ohne umzudrehen, ging es weiter. Nachdem wir einen verwaisten Kreisverkehr, in dessen Mitte ein halbes Dutzend weißer Kreuze die Vorbeifahrenden still und inhaltsarm ermahnte, passiert hatten, fuhren wir nur noch geradeaus. Wir überquerten die Bahnlinie, über die der REX kurz zuvor in Richtung Wulkaprodersdorf gezuckelt war, und kurvten durch eine Gegend, die sich nicht entscheiden konnte, ob sie nun Wohn- oder Gewerbegebiet sein wollte. Kurz nachdem Diskonter und Baumärkte das Match für sich entschieden hatten, war es auch schon vorbei mit Eisenstadt, und wir befanden uns mitten am Land. Also so richtig am Land.
»Was wollen Sie denn in Rust?«, fragte sie, als wir durch Trausdorf fuhren. Ein Schild wies Interessierte auf Deutsch und Kroatisch in Richtung eines Papstkreuzes beziehungsweise eines Papin križ. »Besuchen Sie jemanden bei uns?«
Bei uns.
»So in etwa«, antwortete ich. Von Luise wusste ich, dass im Garten ihres Elternhauses der geliebte Schäferhund ihrer Kindheit, Kery, begraben worden war. Insofern konnte man durchaus davon sprechen, dass ich jemanden besuchte.
»Und wie lange bleiben Sie?«, fuhr sie mit ihrem Interview fort. Hier draußen tat sich wahrscheinlich nicht so viel. Fremde, unrasierte Kerle mit halblangen fettigen Haaren und einer abgewetzten schwarzen Jeansjacke saßen wahrscheinlich nicht allzu häufig in ihrem Taxi. Insofern sah ich ihr die Neugierde nach, die in Taxifahrerkreisen überall auf der Welt eine Art Berufskrankheit zu sein schien.
»Ich weiß noch nicht so genau«, erklärte ich. Ich wusste es wirklich nicht. Gestern war ich in meiner Wohnung in Essen-Rüttenscheid aufgewacht, und der einzige Tagesordnungspunkt war der abendliche Gang zur Frittenbude von Matze gewesen. Dass Vito und seine Jungs wenige Minuten später plötzlich in meinem Schlafzimmer gestanden waren und mir an die Gurgel wollten, hatte zu einer leicht überstürzten Planänderung geführt, die mich schließlich hierher ins östlichste Eck meines Geburtslandes geführt hatte. Kein Mensch wusste, wie lange mein Aufenthalt hier nötig sein würde, um ausreichend Gras über gewisse Dinge wachsen zu lassen. Falls es das jemals täte.
Zur Vorbereitung auf einen Einsatz gehört in der Regel eine detaillierte Aufklärung des Einsatzortes. Das ist das kleine Einmaleins, das man in der Polizeischule lernt. In Rust erwartete mich zwar kein Einsatz, eine entsprechende Vorbereitung hielt ich aber trotzdem für angemessen. Und Wikipedia war eine wahre Fundgrube, wenn es darum ging, sich über seine neue Umgebung zu informieren. In Österreichs kleinster Statutarstadt, die sich seit Jahrhunderten obendrein Freistadt nennen durfte, lebten laut Onlinelexikon exakt zweitausend Menschen. Rust wurde von der B 52 durchquert, auf der wir gerade an einem Vierundzwanzig-Stunden-Weinautomaten vorbeifuhren. Im Osten grenzte Rust an den Neusiedler See, für dessen tatsächliche Existenz mir nach wie vor ein Beweis fehlte. Fuhr man auf der B 52 weiter in Richtung Süden, war man innerhalb kürzester Zeit in Mörbisch und bald darauf in Ungarn. Nicht mit dem Auto, aber zu Fuß. Denn die B 52 endete kurz hinter Mörbisch mitten im Wald. Vielleicht ein Relikt des Kalten Krieges. Nach Norden führte eine Straße entlang des Schilfgürtels des Sees bis nach Neusiedl und weiter am Ostufer entlang, wo Google Maps so liebliche Orts- und Flurbezeichnungen wie die Hölle oder den Unteren Stinkersee verzeichnete. Und wer vermutete, dass es neben einem Unteren auch einen Oberen Stinkersee gab, wurde nicht enttäuscht. Einen Bahnhof gab es in Rust nicht, einzig weiteres nennenswertes Verkehrsmittel war der Schiffsliniendienst der Reederei Plünder, der die Stadt – zumindest in den touristisch interessanten Monaten des Jahres – mit den anderen Gemeinden des Sees verband.
So weit zu den Hard Facts. Doch nicht die schlechte öffentliche Anbindung und die Nähe zu Ungarn waren es, die die Freistadt Rust berühmt gemacht hatten, sondern der ausgezeichnete Wein, der dank des sonnigen pannonischen Klimas in dieser Gegend gedieh. Nicht, dass mir Welschriesling und Co etwas sagten, als passionierter Freund des Gerstensafts war ich im Ruhrgebiet und zuvor in Wien nahe der Ottakringer Brauerei durchaus richtig aufgehoben. Aber Weinliebhaber und solche, die es werden wollten, schienen hier auf ihre Kosten zu kommen. Zusätzlich war Rust für die Störche bekannt, die sich jedes Frühjahr auf den Hausdächern der Stadt einfanden und offensichtlich ein beliebtes Motiv für Touristen abgaben. Viel mehr als dieses Wissen, das sich auch in einer Werbebroschüre befunden haben konnte, wusste ich nicht über Rust. Luise hatte sich früher nicht gerade ausufernd über ihren Heimatort geäußert. Das mochte seine Gründe gehabt haben, denn neben Kery hatte es wohl nicht viel gegeben, das sie hier zu schätzen gewusst hatte. Sonst wäre sie nicht im frühesten Erwachsenenalter nach Deutschland gegangen.
»Sie können froh sein, dass Sie nicht im August hier angekommen sind«, sagte die Taxiprucknerin, als wir auf einer Anhöhe hinter St. Margarethen einen mächtigen Steinbruch passiert hatten. Sie erwartete sich wohl eine neugierige Nachfrage meinerseits, warum eine Ankunft im Hochsommer nicht empfehlenswert gewesen wäre. Doch ich schwieg.
Dann hatten wir auf unserer Fahrt die Spitze des kleinen Hügels erreicht. Vor uns lag eine graue Nebelsuppe. Irgendwo dort hinten versteckte sich der Neusiedler See vor mir. Zwischen uns und dem grauen Nichts lagen unzählige im Winterschlaf befindliche Weinreben sowie ein kleines Städtchen, dessen Skyline von zweieinhalb Kirchtürmen geprägt wurde. Das musste dann wohl Rust sein. Kurz darauf löste die Taxiprucknerin ihre selbst gestellte Rätselfrage auf. Bei schön Wetter im Sommer gleiche die Fahrt auf der B 52 nämlich einem Schneckenrennen, weil sich halb Ostösterreich zu einem Vergnügungspark namens Familypark aufmachte. Aha.
Wenig später erregte vor der Ortseinfahrt von Rust ein Banner meine Aufmerksamkeit. »Gegen Plünders Hotelwahnsinn«, stand dort in wütenden Buchstaben zu lesen. Darunter hing ein weiteres Plakat, auf dem eine Leopoldsnacht angekündigt wurde. Bevor ich das dazugehörige Datum lesen konnte, waren wir schon vorbeigefahren.
»Kennen Sie hier jemanden?«, fragte sie. »Also in Rust?«
»Ich kannte mal jemanden«, behielt ich meinen unverbindlichen Politikerstil bei.
»Ich wohne nämlich auch in Rust, deshalb frage ich«, reagierte sie erstmals mit einer Antwort anstelle einer neuerlichen Frage.
»Aha«, sagte ich.
Die Fahrt von Eisenstadt nach Rust dauerte keine fünfzehn Minuten. Als wir das Ortsschild passiert hatten, bog sie links ab, und schon waren wir da.
»Im Bahnhofsheiserl wohnen Sie also?«, fragte sie, als sie den Motor abgestellt hatte.
»Ähm, kann sein«, erklärte ich.
»Das Haus hätte mal der Bahnhof von Rust sein sollen. Doch die Bahnlinie ist nie gebaut worden. Nachdem die Neubauers drin g’wohnt haben, steht es jetzt schon ziemlich lang leer. Kannten Sie die Neubauers?«
»Kann man so sagen, ja.«
»Ach, dann kennen Sie sicher die Luise! Die ist ja damals nach Deutschland gegangen. Und so, wie Sie sich anhören …«
»Wie höre ich mich denn an?«
»Na, wie schon? Wie ein Deutscher halt.« Sieben Jahre im Ruhrgebiet machten also aus einem Wiener einen Piefke. »Wie geht’s ihr denn? Ich hab sie nimma g’sehn oder g’hört, seit sie damals weg ist. So schad. In der Schule hamma uns so gut verstanden, damals.«
Luise war tot. Zwei Jahre zuvor von Vito und seinem verdammten Clan ermordet, um einen Beamten der Essener Sondereinheit für organisierte Kriminalität von weiteren Ermittlungen abzuhalten. Das hätte ich der Taxifrau sagen können. »Ich habe sie auch schon länger nicht mehr gesehen«, erklärte ich stattdessen. »Was bekommen Sie?«
Ich zahlte und war dankbar dafür, dass die Frau keine weiteren Fragen stellte. »Dann sehen wir uns in der nächsten Zeit wohl noch das ein oder andere Mal. Vielleicht kommen Sie ja auch mal beim Spritzenhaus vorbei«, sagte sie zur Verabschiedung.
Gut möglich, aber nicht nötig, dachte ich für mich und winkte ihr freundlich zu.
»Ach, entschuldigen Sie!«, hörte ich sie hinter mir herrufen, gerade als ich dachte, ich hätte endlich meine Ruhe. Ich drehte mich nochmals zu ihr.
»Kann es sein, dass Sie deshalb in Rust sind?« Sie strahlte mich an, als ob sie das Rätsel um die Errichtung von Stonehenge oder wenigstens das Geheimnis um das verschollene Bernsteinzimmer gelöst hätte, und zeigte mit ihrem Arm zur Bundesstraße. Ein paar Meter weiter in Richtung Stadtmitte, zwischen Straße und Friedhofsmauer, befand sich ein großes Werbeschild. Die früh einsetzende Dämmerung machte es einem nicht leicht, die Buchstaben in großer Entfernung zu entziffern. Es war jedenfalls ein Gruppenfoto zu sehen, über dem das Logo eines österreichischen Fernsehsenders prangte.
»In der Stadt gehen Gerüchte um, wonach die Serie endlich mit einem neuen Hauptdarsteller fortgesetzt werden soll«, sagte die Prucknerin, immer noch mit Atomium um die Wette strahlend.
Offensichtlich gab ich keinen guten Schauspieler ab, denn meiner Entgegnung schien die Taxifrau keinen Glauben zu schenken. Sie stieg ins Auto, hupte einmal fröhlich und fuhr davon.
Das Bahnhofsheiserl, in dem Luise aufgewachsen war, war das erste Haus vor beziehungsweise nach der Stadtgrenze, je nachdem, aus welcher Richtung man kam. Das L-förmige Ensemble war frei stehend, verfügte also über keine direkten Nachbarn. Weit und breit waren keine Bahngleise zu sehen. Und in seiner Größe entsprach das Gebäude definitiv mehr einem Bahnhofsanwesen als einem kleinen Bahnhofsheiserl.
Neben dem kleinen Einfahrtstor aus Metall wurde die Mauer auf der Seite der Baumgartengasse durch die schwarze Holzfassade einer Scheune unterbrochen. Danach folgte ein in die Jahre gekommener Holzzaun, über den an einer Stelle die Äste eines Apfelbaumes auf Gehweg und Straße ragten. Es waren Winteräpfel, die kleinen sauren, die da zuhauf an dem Baum hingen und wohl immer wieder als unerwartete Geschosse auf Windschutzscheiben landeten. Nadelbäume und eine Hecke begrenzten das Grundstück nach Süden, also dort, wo die B 52 sich auf den Weg nach St. Margarethen machte. Was sich im Inneren des Wohnhauses und des Grundstückes abspielte, war von außen nicht einsehbar. Wie gemacht für mich.
Ich öffnete das Einfahrtstor mit dem Schlüssel, den ich in einer der Kisten, in denen ich Luises Sachen eingelagert hatte, gefunden hatte. Als ich das Tor geschlossen hatte, hörte das unbestimmte Gefühl, beobachtet zu werden, das mich seit dem Aussteigen aus dem Taxi der Prucknerin verfolgt hatte, schlagartig auf. Wenn ein Fremder seine Zelte in einem verlassenen Haus aufschlug, sorgte das schließlich nicht nur bei einer Taxifahrerin für Interesse.
Ich fand mich in einem kleinen Hof wieder. Rechts neben mir ein länglich geducktes Wohnhaus, ihm gegenüber der große Schuppen aus schwarzem Holz. Es herrschte totale Stille. Das kannte ich ja schon vom Bahnhof in Eisenstadt. Aber hier, durch Gebäude, Mauern und dicht stehende Bäume und Sträucher von der Umwelt abgeschirmt, erreichte die Stille nochmals eine neue Dimension.
Derselbe Schlüssel, der auch die Hofeinfahrt gesperrt hatte, öffnete die massive Tür des Wohnhauses. Es brauchte einen kleinen Ruck, damit sie mich einließ. Es war schon fast dunkel draußen, durch die geschlossenen Fensterläden drang dementsprechend auch nichts vom düsteren Winterlicht ins Innere des Gebäudes. Es roch muffig. Ich tastete nach einem Lichtschalter und wartete vergeblich darauf, dass der Raum erhellt würde. Dass die Elektrik nach all den Jahren, in denen das Haus leer gestanden hatte, nicht auf Anhieb funktionierte, war nicht weiter verwunderlich. Also zückte ich das Handy und aktivierte dessen Taschenlampenfunktion. So wie es aussah, stand ich mitten in der Küche, vor mir ein kleiner quadratischer Tisch. Die dicke Staubschicht auf der bescheidenen Küchenzeile, bestehend aus Abwasch, altertümlichem Gasherd und mehreren kleinen Schränken, ließ darauf schließen, dass hier schon sehr lange keine Apfelnockerln mehr zubereitet worden waren. Das war eine der Süßspeisen, deren Zubereitung mir Luise beigebracht hatte, damit nicht immer sie in der Küche stehen musste. Direkt angrenzend lag das Badezimmer. Auf der anderen Seite führte eine Tür ins Esszimmer, von dort ging es weiter ins Wohn- und Schlafzimmer. Alle Möbel waren mit Decken und Planen vor Staub und Moder geschützt. Luise hatte mir erzählt, dass Verwandte nach dem Tod ihrer Eltern tagelang hier geschuftet hatten, um das Haus, für das keiner von ihnen eine Verwendung gehabt hatte, zumindest notdürftig einzuwintern. Irgendwann sollte es dann verkauft werden, doch es schien sich niemand um die Einleitung dieses Verkaufsprozesses kümmern zu wollen. Vielleicht lagen, abgesehen von Kery, doch noch zu viele Emotionen in diesem Haus und auf diesem Grundstück begraben. Ich wusste es nicht und ging auch nicht davon aus, das jemals zu erfahren. Von wem auch? Von den Neubauers lebte niemand mehr hier.
Nachdem ich den Sicherungskasten gefunden hatte, war das Licht zumindest in Küche und Schlafzimmer wiederhergestellt. Für die anderen Lampen würde ich neue Glühbirnen oder, was einen wesentlich größeren Aufwand bedeuten würde, neue Leitungen organisieren müssen. Das war aber ohnehin nicht die einzige Investition, die nötig war, um das Haus zumindest temporär bewohnbar und winterfit zu machen. Aber das hatte Zeit bis zum nächsten Tag. Oder bis zur nächsten Woche. Oder bis irgendwann später.
Die Plastikplane machte ihre plastikplanigen Geräusche, als ich mich auf die Couch setzte. Ich öffnete eine der Bierdosen, die ich zusammen mit einer Flasche Milch am Hauptbahnhof in Wien erstanden hatte. Die Dose war blau und trug einen weißen »Wieselburger«-Schriftzug. Ich hatte gehofft, dass die kalten Außentemperaturen dafür sorgen würden, dass das Bier seine trinkbare Temperatur beibehalten würde. Doch meine Hoffnungen wurden enttäuscht. Und ich ahnte, dass es nicht die einzigen Wünsche waren, die in nächster Zeit jäh zerplatzen würden. Ich öffnete das Bier, nahm einen kräftigen Schluck und streckte meine Beine auf dem ebenfalls mit einer Plane abgedeckten Couchtisch aus.
Mein Handy vibrierte. Obwohl eigentlich niemand die Nummer meines neuen Wertkartenhandys kannte. Es war eine Kurznachricht meines Mobilfunkbetreibers.
Lieber Kunde, willkommen in Ungarn. Hier nutzen Sie Ihre österreichweiten Einheiten ohne Zusatzkosten wie daheim.
Samstag
Gehört der zu Ihnen?
Die Vorhänge ließen nicht viel Licht ins Schlafzimmer. Als ich meine Augenlider endlich auseinandergezogen hatte, wusste ich nicht wirklich, wie spät es war. Oder ob der nächste Tag überhaupt schon angebrochen war. Ich zog den verstaubten Vorhang zur Seite und unterdrückte den durch den aufgewirbelten Staub ausgelösten Hustenreiz. Das mit dem Vorhang hätte ich mir sparen können, denn um etwas aus dem Fenster sehen zu können, hätte ich am Vorabend die Fensterläden öffnen und die Scheiben putzen müssen. Ich torkelte aus dem Schlafzimmer, stets dem Schein der Handytaschenlampe folgend, durch die anderen Zimmer bis zur Küche, wo ich, begleitet vom bereits bekannten Knarzen des Holzfußbodens, die Milch aus dem zum Glück funktionierenden Kühlschrank holte. Ich platzierte sie auf dem Tisch, fein säuberlich, wie sich das gehörte.
Ich öffnete die Haustür und war nicht wesentlich schlauer als zuvor, was den Stand der Sonne anging. Es war dunkel. Eher grau als schwarz. Aber, und das kam jetzt wirklich überraschend, ich war nicht alleine in dieser grauen Dunkelheit. Denn vor der Tür, im Hof des Bahnhofsheiserls, hockte ein brauner Hund. Die Toreinfahrt war nach wie vor geschlossen. Der Hund sah mich mit seinen schwarzen Murmelaugen erwartungsfroh an. Wo war der denn hergekommen?
»Hallo«, sagte ich. Ich ging ein paar Schritte zu der hochgewachsenen Hecke, die den Hof von der Straße nach St. Margarethen abschirmte, und ließ dem Bier vom Abend zuvor freien Lauf. Der Hund stellte sich neben mich und tat es mir gleich. Das reichte, um unsere Freundschaft zu besiegeln. Und um mir zu zeigen, dass es sich gar nicht um einen Hund handelte. Sondern um eine Hündin.
Kurz darauf hatten wir das Tor des Bahnhofsheiserls verschlossen und befanden uns direkt an der B 52. Wir marschierten, als ob wir uns schon seit Jahren kennen würden, an der Friedhofsmauer vorbei, und schon hier zeigte sich, dass man nicht in einer nüchternen Großstadt gelandet war, sondern in einem pittoresken Städtchen. Denn die Mauer war nicht einfach nur hoch und in die Jahre gekommen, so wie die meisten Friedhofsmauern in den meisten Städten dieser Welt. Nein, es handelte sich um eine niedrige Mauer, die aus einzelnen Steinelementen bestand, die einen anständigen Blick auf den Friedhof freigaben. Ein Blick, der meine Gefährtin und mich jedoch nicht weiter kümmerte, denn unsere Aufmerksamkeit richtete sich auf die überdimensionale Werbetafel, mit der die Freistadt Rust sich als Drehort des »Weinkaisers« outete. Das war jenes Schild, auf das meine Chauffeurin am Abend zuvor gedeutet hatte. Wir hielten bedächtig inne. »Willkommen in der Freistadt Rust, der Stadt des ›Weinkaisers‹«, war dort zu lesen. Stadt der Störche, Stadt des Weines, Stadt am See – all diese Zuschreibungen hätte ich und jeder zweitklassige Marketinglehrling der Stadt mit gutem Gewissen verpasst. Auf die Stadt des »Weinkaisers« wäre ich wohl nicht gekommen.
Wir brauchten keine zehn Minuten, bis wir – vorbei an Einfamilienhäusern, Versicherungsmaklern und Gasthäusern sowie einem Park – an einer Kreuzung ankamen, die so was wie den verkehrsplanerischen Mittelpunkt der Freistadt Rust zu bilden schien. Von hier aus führten die Wege zwar nicht nach Rom, dafür jedoch in alle vier Himmelsrichtungen: nach St. Margarethen, ins Zentrum von Rust, nach Mörbisch sowie nach Oggau und weiter in Richtung Neusiedl, jene Bezirkshauptstadt am Nordufer, der der See seinen Namen zu verdanken hat. An der Kreuzung stand unter anderem ein niedliches Ensemble aus zwei Gebäuden. Neben einem kleinen Knusperhäuschen eine offenbar zu einem Gasthaus umfunktionierte ehemalige Feuerwehrstation, in deren Garage vielleicht gerade mal eine alte Puch 175 Platz hatte. Mit ein bisschen gutem Willen ging sich vielleicht auch noch ein Beiwagen aus. Über der aus einer Glasfront bestehenden Vorderseite verriet ein Schild, dass es sich um ein Lokal namens Spritzenhaus handelte. Das war dann wohl jenes Etablissement, das die Taxiprucknerin erwähnt hatte. Das an den Schriftzug angrenzende beleuchtete Logo einer Großbrauerei aus den Niederlanden machte mir Hoffnung, dass ich in der Stadt des »Weinkaisers« auch ein gepflegtes Bier finden würde. Wenngleich die Sorten des Biermultis für mich eher nicht in diese Kategorie fielen. Das niedliche Türmchen auf dem Dach des Spritzenhauses überragte zwar gerade noch so jene angrenzende Kastanie, deren Blätter den Boden des Gastgartens bedeckten. Einen wirklichen Rundumblick, um eine Feuersbrunst zu entdecken, hatte man von dort oben aber wahrscheinlich nicht mehr.
Das Ziel unseres Fußmarsches, der auf Google Maps eingezeichnete Supermarkt, lag direkt hinter dem Spritzenhaus. Doch wir hatten Pech. Denn Supermarkt und Mitarbeiter waren an diesem Samstag, wie ein handgeschriebener Zettel an der Eingangstür verriet, ausnahmsweise bereits zu Mittag in das verdiente Wochenende gestartet.
Meine Gefährtin und ich machten uns also auf den Weg zurück zum Bahnhofsheiserl. Als wir gerade das dezente Willkommensschild der »Weinkaiser«-Stadt Rust erreicht hatten, hielt neben uns eine zu einem Taxi umgebaute Familienkutsche.
»Soll ich Sie mitnehmen?«, fragte die Taxiprucknerin.
»Gerne, wir müssen ein bisserl was einkaufen«, antwortete ich. »Und der Laden im Zentrum hat schon zu.«
Sie nickte wissend, als ob das eh klar wäre, dass der Supermarkt in Downtown Rust an diesem Samstagmittag früher schließt.
»Gehört der zu Ihnen?«, fragte sie und deutete auf die Hündin.
»Ist eine Sie«, machte ich die Taxlerin auf die korrekte Geschlechtsform aufmerksam. Ordnung muss sein.
»Sie kann leider nicht mitfahren«, erklärte sie. »Meine Tochter hat eine Hundeallergie, und deshalb kann ich keine Haustiere im Taxi transportieren.«
Ich blickte in die schwarzen Murmelaugen und wieder retour zum Taxi. Es war kalt. Murmelaugen. Und ich war faul. Murmelaugen. »Da kann man nichts machen«, erklärte ich.
Die Taxiprucknerin winkte, hupte zur Verabschiedung und verschwand in Richtung St. Margarethen. Die Hündin und ich sahen ihr hinterher und setzten unseren Fußmarsch fort.
Im Bahnhofsheiserl legte ich einen Zwischenstopp ein, um mir einen zusätzlichen Pullover zu holen. Ich hatte gerade wieder die noch auf dem Tisch stehende Milch in den Kühlschrank verfrachtet und die Tür zum Wohnhaus geschlossen, als ich – im Hof stehend – ein Geräusch vernahm, dessen Herkunft ich irgendwo zwischen Buntspecht mit verformtem Schnabel und einer ungestimmten Pausenglocke verortete. Die Hündin bellte für den Fall, dass ich das Geräusch nicht mitbekommen hatte, was, unter uns gesagt, ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre. Aber das musste meine neue Freundin ja nicht wissen, weshalb ich mich artig bei ihr bedankte. Ich öffnete das Einfahrtstor und blickte in das Gesicht eines schlanken und hochgewachsenen Mannes mit Segelohren, der mir einen Ausweis vom Landeskriminalamt unter die Nase hielt. Er versuchte, seriös dreinzuschauen, allein, gelingen wollte es ihm nicht so recht. Sein staatsmännisches Gehabe wirkte in seinem etwas zu engen Slimfit-Anzug reichlich aufgesetzt. Einer der beiden uniformierten Kollegen, die hinter ihm Aufstellung genommen hatten, hatte dafür einen ziemlich eindringlichen Blick drauf. Er sah mich an wie eine Bulldogge, die mit ihren kleinen Stummelbeinchen jeden Moment zum Sprung auf ein schönes Stückerl Wurst ansetzen würde. Der andere Polizist sah wesentlich entspannter aus. Ob das nur an seinem breiten Körperumfang und dem gemütlichen Gesichtsausdruck lag, konnte ich nicht abschätzen. Das Auto der drei Gestalten stand in der Einfahrt, direkt unter dem Apfelbaum.
»Es ist niemand da«, sagte ich.
Die drei unerwarteten Besucher tauschten einige Blicke aus. Damit hatte ich sie offensichtlich auf dem falschen Fuß erwischt.
»Dann würden wir uns gerne mit ›niemand‹ unterhalten.«
Hmm, schade. Da hatte ich mir einen größeren Effekt meines blöden Spruchs erhofft.
»Wie kann ich Ihnen helfen?«, gab ich mich ein bisschen kooperativer.
Die Hündin wiederholte die Frage in bellender Hundesprache, nur zur Sicherheit, man wusste ja nie, mit wem man es zu tun hatte. Bella wäre ein passender Name für sie, dachte ich in diesem Moment. Das hätte dem irgendwo weiter hinten in der Wiese verbuddelten Kery sicherlich gut gefallen.
»Halten Sie den Kampfhund zurück!«, bekam es der Segelohrmann mit der Angst zu tun. Der Kerl erinnerte mich an Martin Schoiswohl, dem ich meinen unrühmlichen Abgang vom Wiener LKA vor acht Jahren zu verdanken hatte. Kein Wunder, dass mir der Kerl hier so unsympathisch war. Hinter den dreien bog ein Kleinlastwagen von der Hauptstraße in die Baumgartengasse ein. »Der Moser Wein ist Dein!«, stand auf der Abdeckplane des Wagens. Als der Fahrer das Geschehen am Eingangstor des Bahnhofsheiserls realisierte, hielt er an. »Heast, Poidl du Beidl, sehn ma uns eh übermorgen Abend im Spritzenhaus?« Eines war sofort klar. Der Kerl im Auto musste sich keine Sorgen um seine Aussprache des Meidlinger Ls machen. Der dickere der beiden uniformierten Polizisten drehte sich um, winkte und rief: »Sowieso!«
»Das ist kein Kampfhund«, erklärte ich, als sich die gesamte Aufmerksamkeit wieder auf Bella und mich konzentriert hatte. Um kurz darauf meine Frage zu wiederholen, wie ich denn nun behilflich sein könnte.
»Können Sie sich ausweisen?«, fragte der Zivilkieberer.
Konnte ich. Ich entschuldigte mich für einen Moment, um meinen Ausweis aus dem Wohnhaus zu holen. Meine Kampfhündin nahm ich zur Sicherheit mit. Nicht, dass einer der Polizisten auf blöde Gedanken kommen würde.
»Nikolaus Lauda aus Wien also?«, fragte der Zivilbeamte mit den Segelohren, als ob die auf dem zwanzig Jahre alten Personalausweis abgebildete Person mit meiner aktuellen Erscheinung nichts zu tun hätte.
»Zu Diensten«, sagte ich.
»À la bonne heure«, sagte er. Dann blickte er auf meinen Kopf. Ihm schien dort etwas abzugehen.
»Suchen Sie etwas?«, fragte ich ihn.
»Nein«, antwortete er irritiert. »Ich dachte nur … Ihr Name hat mich … egal, mitkommen!«, fuhr er im Befehlston fort und steckte sich meinen Personalausweis gleich mal in die Tasche.
»Warum?«, fragte ich.
»Hat dir wer ins Hirn g’schissen? Wenn der Herr Chefinspektor etwas anordnet, dann spurst gefälligst!«, platzte es aus dem grimmigen Polizisten mit dem Oberlippenbart heraus.
»Mal ganz entspannt hier. Und per Du sind wir noch lange nicht«, platzte ich zurück.
Der Zivilbulle brachte seinen aufmüpfigen Kollegen mit einer beschwichtigenden Handbewegung zur Räson.
»Es gab einen Vorfall im Steinbruch, zu dem wir Sie befragen wollen«, antwortete er schmallippig.
»Und Ihre Fragen können Sie nicht hier stellen?«
»Ich glaube, wir haben ein längeres Gespräch vor uns. Und das würde ich ungern hier draußen in der Kälte führen. Und, so wie ich den Zustand des Gebäudes einschätze, haben wir es im Stadtpolizeikommando ein bisserl gemütlicher«, fuhr er mit süffisantem Grinsen fort.
In genau diesem Augenblick fiel ein ziemlich wuchtiger Winterapfel auf das darunter geparkte Polizeiauto. Alarmanlage und Sirene sprangen gleichermaßen an, meine Hündin fing an zu bellen, und ein Nachbarshund in der Umgebung stimmte in den Chor mit ein. Der schlecht gelaunte Polizist beeilte sich, das Gejammer des Autos abzustellen. Ich sorgte meinerseits für ein Verstummen des Bellens.
»Bringen Sie mich dann auch wieder mit dem Auto zurück?«, fragte ich. Wenn ich schon mal in Eisenstadt war und die drei Vögel mich anschließend wieder in Rust absetzen würden, konnte ich dort ja schließlich auch gleich die Einkäufe erledigen.
»Das hängt ganz vom Verlauf und von den Ergebnissen des Gesprächs ab«, erklärte der Zivilpolizist.
Ich verabschiedete mich von Bella und schloss das Tor. Auf nach Eisenstadt.
Schön haben Sie es hier
Noch nicht mal vierundzwanzig Stunden war ich zurück in Österreich, und schon hatte mich die örtliche Polizei einkassiert. Das roch nach einem neuen Rekord.
Um zum Stadtpolizeikommando Eisenstadt zu gelangen, fuhren wir fast den ganzen Weg wieder retour, den mich die Taxiprucknerin tags zuvor in Richtung Rust chauffiert hatte. Vor dem wunderschönen Gewerbegebiet bog der Bulldoggenpolizist jedoch auf die S 31 ab. Vom Rücksitz aus, den gemütlichen Beidl-Poidl neben mir, sah ich Wiesen und Äcker an uns vorbeiziehen, gefolgt von den bis zum Himmel reichenden Masten eines Elektrizitätswerks und der Zentrale eines regionalen Fernsehsenders, auf deren Dach sich eine Handvoll Satellitenschüsseln aneinanderkuschelte. Wir kreuzten Bahngleise, von denen ich annahm, dass ich auf diesen am Tag zuvor mit dem REX unterwegs gewesen war. Und nach einer weiteren Abzweigung waren wir dann auch schon da.
Für die Inneneinrichtung hatte das Stadtpolizeikommando wohl keinen Design-Award verliehen bekommen. Ein durch und durch funktional wie langweilig eingerichtetes Dienstzimmer in der zweiten Etage war für unsere Unterhaltung auserwählt worden. Ich nahm auf einem mit rotem Plüschstoff bezogenen Sessel Platz. Auf der anderen Seite des Tisches hockte Stefan Krammer, seines Zeichens besagter Chefinspektor des Landeskriminalamts. Der Kerl saß da in seinem Slimfit-Anzug und seiner Sonnenbrille, als ob er im Anschluss an unser Gespräch zur Sommerausgabe des Opernballs im Park von Schloss Schönbrunn gehen würde. Auf dem quadratischen Tisch, der mich von dem Kerl trennte, standen ein gefüllter Wasserkrug und zwei leere Plastikbecher sowie ein aus vielen Schaumstoffeinzelteilen zusammengesetzter Polizeihund aus Kunststoff, dessen Äußeres auf eine Abstammung einer bei Kindern beliebten Welpenretter-Fernsehserie hindeutete. Wo war ich da nur hineingeraten? Der wenig anspruchsvolle Klangteppich bestand aus dem leisen Surren der Klimaanlage. Durch die drei kleinen Fenster war die wie ein Monolith aus dem All in die Landschaft gepflanzte Filiale einer großen Supermarktkette auf der anderen Seite der Straße zu erkennen. Mein Entschluss, der Einladung von Krammer zu folgen, hatte sich wenigstens mit Blick auf die Befüllung meines Kühlschranks als goldrichtig erwiesen. Immerhin etwas.
»Schön haben Sie es hier«, erklärte ich.
Krammer wirkte wie einer dieser ambitionierten Kerle, denen eine Stadt wie Eisenstadt schnell zu klein geworden war. Er fühlte sich für Höheres bestimmt, war dann aber doch schon zu alt gewesen, um es tatsächlich noch mal irgendwo hinzuschaffen. »Und was führt Sie in unsere schöne Gegend?«, antwortete er und klappte allen Ernstes die Fassung seiner Sonnenbrille nach oben. Das war also eine Kombination aus Brille und Sonnenbrille. Die nach oben gerichtete Sonnenbrillenfassung schützte ihn zwar jetzt gegen das Licht der Deckenlampe, aber zum Preis, dass er sich da gerade ziemlich zum Affen machte.
»Ich will ein bisschen runterkommen und entspannen. Das soll man hier ganz gut tun können, habe ich gehört.«
»Ja, das stimmt. Hat Ihnen wohl die Luise erzählt?«
»Mhmm«, machte ich. »Um welchen Vorfall geht es denn nun?«
Ich wollte das Gespräch rasch hinter mich bringen. Immerhin würden auch in Eisenstadt irgendwann die Geschäfte schließen. Und Small Talk konnte ich ebenso gut mit Bella oder der Taxiprucknerin führen.
»Im Steinbruch, nicht weit vom Bahnhofsheiserl, in dem Sie die Nacht verbracht haben, wurde heute Vormittag die Leiche einer Frau gefunden, die ganz offensichtlich nicht eines natürlichen Todes gestorben ist.«
Jetzt machte er jene kunstvoll verlängerte Pause, die Polizisten gern machen, um die Reaktionen des Gegenübers zu deuten. Was machte meine Mimik? Begann ich, nervös mit den Händen herumzuspielen? Richtete ich meinen Rücken auf, oder machte ich mich klein? Da konnte er bei mir lange warten.
»Wir haben nicht oft Mordfälle hier«, fuhr er schließlich fort, nachdem ich ihm eine Zeit lang regungslos gegenüber verharrt und seinem Blick standgehalten hatte. »Wie Sie schon sagen, bei uns kann man entspannen. Und das soll auch so bleiben.«
»Natürlich«, antwortete ich. »Aber was hat eine tote Frau in einem Steinbruch mit mir zu tun?«
Ohne anzuklopfen und ohne irgendwelche Höflichkeitsfloskeln wurde die Tür geöffnet, und der grimmige junge Beamte kam zackigen Schrittes herein. Er legte Krammer eine braune Dokumentenmappe vor die Nase und verschwand ebenso schnell, wie er gekommen war. Krammer warf einen Blick in die Mappe, machte dabei mehrere interessierte »Ahas« und »Sosos« und klappte das Ding wieder zu.
»Wenn am Freitagabend ein Fremder nach Rust kommt und am nächsten Tag eine Leiche gefunden wird, könnte man schon auf die Idee kommen, dass das was mit besagtem Fremden zu tun hat. Noch dazu, wenn dieser Fremde erst vor wenigen Tagen in der Bundesrepublik den Polizeidienst quittieren musste, weil er einen Mann mit einer Gartenkralle getötet hat. Tatsächlich mit einer Gartenkralle? Echt jetzt?«, fragte er nach, als ob er seinen eigenen Ohren nicht trauen würde.
Eigentlich hatte ich Vitos Bruder den Schädel zertrümmern wollen. Er hatte sich nur zu schnell gedreht und war meiner Bewegung ausgewichen. Ich hatte mich nicht sehr geschickt angestellt. Hatte einfach zu wenig Übung darin, anderen Menschen mit einer Gartenkralle den Kopf einzuschlagen. Gibt ja auch keine Volkshochschulkurse, in denen ausgebildetes Personal einem diese Fähigkeiten näherbrachte. Und ja, mit einer Gartenkralle. Wenn man ungeplanterweise einem Mitglied des örtlichen Mafiaclans in einem Geldwäschebetrieb über den Weg läuft, hat man halt nicht gerade ein ganzes Arsenal an geeigneten Waffen zur Verfügung. Da muss man mit dem vorliebnehmen, was gerade neben einem auf dem Tisch liegt. Dass der Kerl dann aufgrund der dreckigen Gartenkralle an einer Blutvergiftung stirbt, konnte man mir nun wirklich nicht anhängen. Aber irgendwie beschlich mich das Gefühl, dass ich all diese Details besser für mich behalten sollte.
»Ein tragischer Unfall«, antwortete ich.
»Was haben Sie denn gestern Abend und heute in der Früh gemacht?«
Schien so, als ob die Kollegen von der Pathologie dem Slimfit-Sheriff noch keine Details zur genauen Todeszeit der Frau gegeben hatten.
»Das, weswegen ich hergekommen bin«, erklärte ich. »Geschlafen und mich ausgeruht. Die Reise war anstrengend.«
»Kennen Sie eine Carlotta Woods?«
»Ist das die Tote?«, fragte ich.
Er nickte. »Die Dame erlitt einen Bruch der oberen Halswirbelsäule, herbeigeführt durch einen noch nicht näher bekannten Gegenstand.«
Aua.
»Nein, ich kenne sie nicht. Ich kenne hier generell fast niemanden.«
»Das kann ich mir nicht vorstellen. Haben Sie mit der Luise nie die Schwiegereltern besucht?«
»Das Verhältnis zwischen Luise und ihrer Familie war nicht das beste«, antwortete ich wahrheitsgemäß.
»Und trotzdem sind Sie jetzt, Jahre nachdem die Neubauers gestorben sind, ohne Luise hergekommen. Warum?«
»Das sagte ich bereits. Ruhe und Erholung. Die vergangenen Wochen waren, nun ja, recht anstrengend.«
»Gibt es Probleme in Ihrer Ehe mit Luise?«
Offensichtlich hatte die vor ihm liegende braune Mappe nicht alle Details über mich und mein Dasein als Witwer verraten. Ich hatte nicht vor, das zu ändern.
»Das, so würde ich meinen, ist meine Privatangelegenheit.«
»Es gibt nichts Privates, wenn ein Mensch ermordet wird.«
Öha. Mir kam es so vor, als ob das Surren der Klimaanlage plötzlich lauter wurde. Oder bildete ich mir das nur ein?
»Hat der feine Herr aus der Bundesrepublik die vergangene Nacht mit jemandem verbracht? Vielleicht mit Carlotta Woods?«
Warum betonte er immerzu die »Bundesrepublik«? Konnte er, wenn er das schon immer so herausstreichen musste, nicht einfach Deutschland sagen?
»Ich bin erst gestern Abend angekommen. Danach habe ich das Haus bis heute Mittag nicht mehr verlassen.«
»Kann jemand bezeugen, dass Sie in der vergangenen Nacht und während des Vormittages daheim waren?«
»Selbstverständlich«, sagte ich.
Meine Wortmeldung überraschte sowohl ihn als irgendwie auch mich. Er hatte sich wohl schon einen Vortrag zurechtgelegt, wonach meine Geschichte sehr unglaubwürdig klinge und ich mir besser einen Anwalt organisieren sollte. Einen Anwalt, hier in der Pampa. Wahrscheinlich war der einzige Anwalt der Bruder vom Slimfit-Sheriff. Oder sein Cousin. Oder sein Vater. Oder sein Haberer, der ihn in der Schule immer abschreiben hat lassen. Aber seinen Vortrag musste er sich noch ein bisschen aufsparen.
»Ein Hund saß plötzlich vor meiner Tür. Seitdem begleitet er mich.«
Ich verriet ihm nicht, dass Bella erst heute Mittag, als ich meine Nase ins graue Nichts gesteckt hatte, vor der Tür gesessen war. Und ich war mir ziemlich sicher, dass sie mich nicht verraten würde.
»Ich glaube, Sie verkennen den Ernst der Lage«, erwiderte er trocken.
Ich verneinte. »Schauen Sie, ich sehe mich für diese Situation weder zuständig noch verantwortlich. Ich habe mit Ihrer Toten aus diesem Steinbruch nichts zu tun. Ich kannte die Frau nicht, und ich wusste nicht einmal, dass es hier einen Steinbruch gibt. Wenn es weiter nichts zu besprechen gibt, und angesichts Ihrer nicht vorhandenen Beweise sieht das für mich ganz so aus, würde ich jetzt gerne gehen. Ich muss nämlich noch einkaufen, bevor Sie mich zurück nach Rust fahren.«
»Sie wollen mir weismachen, dass Sie den weltbekannten Steinbruch von St. Margarethen nicht kennen?«
Bis hierhin hatte er meine Ausflüchte und Erklärungen wohl noch halbwegs für bare Münze genommen. Mein Unwissen hinsichtlich des »weltbekannten« Steinbruchs ließ mich und das von mir Gesagte jedoch nun in einem äußerst unglaubwürdigen Licht erstrahlen. Dabei hatte ich natürlich schon mal vom Margarethener Steinbruch gehört, schon in der Schule in der Kleinen Sperlgasse hatte ich gelernt, dass der dort gewonnene Sandkalkstein unter anderem für den Bau des Stephansdoms verwendet worden war. Und ja, jetzt fiel mir auch ein, dass in einem Teil des Steinbruches Opern und andere Kulturevents aufgeführt werden. Große Sommerspektakel, die Abend für Abend die Massen anlocken. Aber woher sollte ich denn wissen, dass das Mordopfer ausgerechnet in diesem Steinbruch ums Leben gekommen war?
Widerstand!
Der Hupfer über die Straße vom Stadtpolizeikommando zum Supermarkt kostete mich keine sechzig Sekunden.
Ich konnte mir ausrechnen, dass Krammer mich nicht so schnell von der Leine lassen würde. Ein Fremder kommt in ein kleines Städtchen wie Rust, und am nächsten Tag wird gleich nebenan im weltberühmten Steinbruch eine Leiche gefunden. Für jeden Polizisten der Welt ist das einfach eine zu verlockende Konstellation, und ich selbst hätte die Gelegenheit bis vor wenigen Tagen wahrscheinlich ebenso am Schopfe zu packen versucht. Auch wenn, und das war so ein bisserl der Schwachpunkt seiner Theorie, auch noch andere Orte in der näheren Umgebung des Steinbruchs von St. Margarethen lagen, in denen man nach potenziellen Täterinnen oder Tätern fahnden hätte können. Zum Beispiel St. Margarethen. Aber wie es aussah, würde er sich so lange in seine Nikolaus-Lauda-Tätertheorie verbeißen, bis er genug halbseidene Indizien beisammenhatte. Auch das wusste ich aus eigener Erfahrung nur zu genau. Also musste ich hoffen, dass der tatsächliche Täter bald auftauchen würde.
»Nehmen Sie es ihm nicht übel, er steht ein bisserl unter Druck«, sagte der Poidl, der freundlichere der beiden uniformierten Polizisten, als er mich zur Tür begleitete. »Wir haben die Tatwaffe noch nicht gefunden«, erklärte er. »Das macht ihn ziemlich unrund. Grüßen Sie bitte die Luise von mir, ich würde mich freuen, wenn sie auch mal wieder vorbeischauen würd.«
»Mach ich«, sagte ich geistesabwesend. »Fahren Sie mich dann gleich wieder zurück nach Rust?«
»Würd ich gern«, antwortete Leopold Rainprecht, und schon nach diesen drei Worten war klar, dass aus meinem Taxishuttle zurück nach Rust wohl nichts werden würde. »Aber der Herr Chefinspektor hat’s untersagt.«
Ich klaubte die dringlichsten Einkäufe im Supermarkt zusammen und trat mit zwei vollen Papiersackerln wieder in die nassgraue Eisenstädter Vorstadt hinaus. Ich studierte den Fahrplan der direkt neben dem Supermarkt gelegenen Busstation. In meinem Rücken konnte ich spüren, wie mich Krammer und Konsorten von der gegenüber gelegenen Stadtpolizeidirektion beobachteten. Der 280er verkehrte zwischen Neusiedl und Eisenstadt, und ich hatte gute Lust, mich mit seiner Hilfe auf direktem Wege wieder aus diesem Landstrich wegzubewegen. Aber wohin hätte ich fahren sollen? Rust war wohl jener Ort in der Welt, der mich aktuell am willkommensten hieß. Im Ruhrgebiet drehte Vitos Clan auf der Suche nach mir jeden kohlegeschwärzten Stein einzeln um. Natürlich war es gut möglich, dass sie mich auch in Rust aufstöbern würden. Aber zum einen wollte ich hier ja nicht ewig bleiben, sondern in Ruhe einen Plan schmieden und dann weiterziehen. Und zum anderen hatte ich in dieser überschaubaren Gegend wenigstens den Vorteil, dass ich sie schon von Weitem anrollen sehen würde.
Kurz darauf hörte ich ein mir vertrautes Hupen.
»Sie spazieren ja dauernd durch die Gegend«, sagte die Taxiprucknerin.
Auf der Rückbank saß ein kleines Mädchen, das an einem Lolli rumlutschte. Wohl die Tochter, kombinierte ich mit der mir eigenen phantastischen Kombinationsgabe.
»Wer rastet, der rostet«, erklärte ich philosophisch.
»Steigen Sie ein, ich nehme Sie mit. Wir sind auf dem Weg zur Demo, da kann ich Sie beim Bahnhofsheiserl rauslassen. Und Ihren Hund haben Sie ja nicht dabei.«
»Meine Hündin«, grummelte ich.
Angesichts der zwei schweren Papiersackerln und der vor mir liegenden Wartezeit bis zum nächsten Bus nahm ich das Angebot gern an. »Was denn für eine Demonstration?«, fragte ich neugierig, nachdem ich auf der Rückbank Platz genommen und »Hallo« zur Tochter gesagt hatte.
Ich schätzte sie auf acht oder neun Jahre. Sie hatte mich keines Blickes gewürdigt, sondern weiter auf ihrem Lolli rumgekaut.
»Der Plünder hat große Kalksteinmengen aus dem Steinbruch für das neue Hotel in Ungarn zugesagt. Das lassen wir uns nicht gefallen«, sagte die Taxiprucknerin mit resoluter Stimme.
»Der Steinbruch also«, murmelte ich vor mich hin.
»Ja. Auch wenn das jetzt ein total g’schissener Zeitpunkt ist wegen der Carlotta. Aber die Demo ist schon so lang für heute geplant, weil heute der erste Transport nach Ungarn gehen soll.«
»Und was ist so schlimm daran, wenn Kalkstein nach Ungarn geht?«
»Das ist ja in Fertőrákos nicht nur ein Hotel, sondern ein Parkhaus mit fast neunhundert Stellplätzen, ein Yachthafen und wer weiß was noch alles. Auf einer Fläche von achtzig Fußballfeldern, mitten im Nationalpark- und Naturschutzgebiet.«
»Aber was drüben irgendwo in Ungarn passiert, kann den Rustern doch egal sein«, erklärte ich.
»Eben nicht. Das ist nicht ›irgendwo‹ in Ungarn, sondern gleich hinter der Grenze. Und ein solches Monsterprojekt wirkt sich auf das sensible Gleichgewicht von Flora und Fauna in der ganzen Region aus, um das es ohnehin nicht gut bestellt ist.«
Die Taxiprucknerin war on fire. Also Themenwechsel.
»Haben Sie die Carlotta gekannt?«, fragte ich.
»Natürlich. Sie war zwar keine von uns, aber mit dem Alfred verheiratet. Der wohnt am Rathausplatz.«
Keine von uns.
»Waren Sie befreundet?«
»Nicht wirklich. Die Carlotta hat sehr genau g’wusst, was sie will. Und dass ihr Rust zu klein war, hat man sehr schnell g’merkt. Sie wollte über die Schönen und Reichen berichten und Karriere als Journalistin machen.«
»Arbeitete sie für eine Zeitung hier aus der Region?«, hakte ich mit möglichst gleichgültigem Tonfall nach.
»Ja, für den Eisenstädter Express.«
»Ist die Demo im Steinbruch?«
»Na, der ist noch als Tatort gesperrt. Wir versammeln uns vor der Einfahrt. Schauen Sie auch vorbei? Ist nicht weit von Ihnen, immer der B 52 entlang. Der Christian Braunschmidt vom Express hat sich auch angesagt, das wird richtig viel Aufmerksamkeit geben.«
Warum eigentlich nicht? Das war eine gute Gelegenheit, um sich dem Tatort unverdächtig nähern zu können. Die hiesige Polizei machte in puncto Aufklärung des Mordes schließlich keinen sehr hoffnungsvollen Eindruck. Und wenn ich nicht mangels anderer Verdächtiger irgendwann so richtig ins Fadenkreuz vom Krammer geraten wollte, konnte es nicht schaden, vielleicht selbst ein bisschen zum Erfolg der Ermittlungen beizutragen. Zudem war so eine Demonstration eine gute Möglichkeit, Anschluss an die Ruster zu finden. Ich hatte das unbestimmte Gefühl, dass ich in der nächsten Zeit ein paar Verbündete gebrauchen könnte.