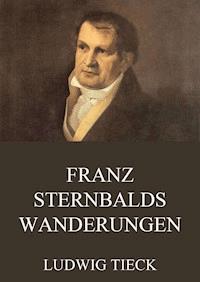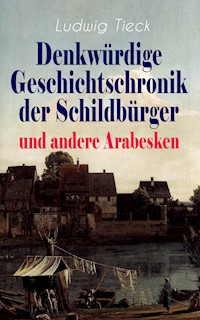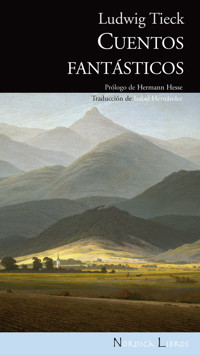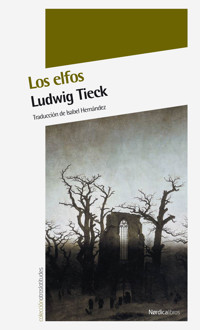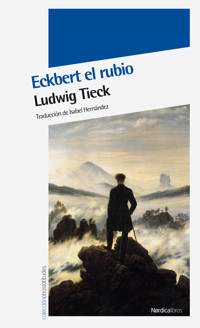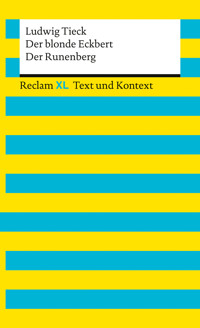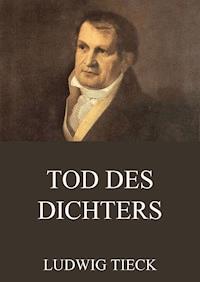
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jazzybee Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Tiecks historisch-romantische Novelle erzählt die Geschichte der fatalen Liebesbeziehung zwischen dem portugiesischen Dichter de Camoes und der jungen Catarina.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 408
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tod des Dichters
Ludwig Tieck
Inhalt:
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Tod des Dichters
Tod des Dichters, L. Tieck
Jazzybee Verlag Jürgen Beck
86450 Altenmünster, Loschberg 9
Deutschland
ISBN:9783849637743
www.jazzybee-verlag.de
www.facebook.com/jazzybeeverlag
Ludwig Tieck – Biografie und Bibliografie
Dichter der romantischen Schule, geb. 31. Mai 1773 in Berlin, gest. daselbst 28. April 1853, Sohn eines Seilermeisters, besuchte seit 1782 das damals unter Gedikes Leitung stehende Friedrichswerdersche Gymnasium, wo er sich eng an Wackenroder anschloß, und studierte darauf in Halle, Göttingen und kurze Zeit in Erlangen Geschichte, Philologie, alte und neue Literatur. Nach Berlin zurückgekehrt, lebte er von dem Ertrag seiner schriftstellerischen Arbeiten, die er größtenteils im Verlag des Aufklärers Nicolai veröffentlichte. So erschienen in rascher Reihenfolge die Erzählungen und Romane: »Peter Lebrecht, eine Geschichte ohne Abenteuerlichkeiten« (Berl. 1795, 2 Bde.), »William Lovell« (das. 1795–96, 3 Bde.; vgl. Haßler, L. Tiecks Jugendroman »William Lovell« und der »Paysan perverti« des Rétif de la Bretonne, Dissertation, Greifsw. 1903) und »Abdallah« (das. 1796), ferner Novellen meist satirischen Inhalts in der Sammlung »Straußfedern« (1795–98), worauf er, seinen Übergang zur eigentlichen Romantik vollziehend, die bald dramatisch-satirische, bald schlicht erzählende Bearbeitung alter Volkssagen und Märchen unternahm und unter dem Titel: »Volksmärchen von Peter Lebrecht« (das. 1797, 3 Bde.) veröffentlichte. Den größten Erfolg errangen unter diesen Dichtungen die unheimlich düstere Erzählung »Der blonde Eckert« und das phantastisch-satirische Drama »Der gestiefelte Kater«. Die Richtung, die in seinen Schriften immer deutlicher hervortrat, mußte ihn in schroffen Gegensatz zu Nicolai sowie zu Iffland, dem Leiter des Berliner Theaters, bringen, während die Romantiker ihn begeistert anpriesen als ein Genie, das Goethe ebenbürtig sei. Nachdem er sich 1798 in Hamburg mit einer Tochter des Predigers Alberti verheiratet hatte, verweilte er 1799–1800 in Jena, wo er zu den beiden Schlegel, Hardenberg (Novalis), Brentano, Fichte und Schelling in freundschaftliche Beziehungen trat, auch Goethe und Schiller kennen lernte, nahm 1801 mit Fr. v. Schlegel seinen Wohnsitz in Dresden und lebte seit 1802 meist auf dem Gute Ziebingen bei Frankfurt a. O., mit dessen Besitzern (erst v. Burgsdorff, dann Graf Finkenstein) er eng befreundet war. Doch unterbrach er diesen Aufenthalt durch längere Reisen nach Italien, wo er die deutschen Handschriften der vatikanischen Bibliothek studierte (1805), sowie nach Dresden, Wien und München (1808–10). Während dieses Zeitraums waren erschienen: »Franz Sternbalds Wanderungen« (Berl. 1798), ein die altdeutsche Kunst verherrlichender Roman, an dem auch sein Freund Wackenroder Anteil hatte, »Prinz Zerbino, oder die Reise nach dem guten Geschmack« (Jena 1799), und »Romantische Dichtungen« (das. 1799–1800, 2 Bde.) mit dem Trauerspiel »Leben und Tod der heil. Genoveva« (separat, Berl. 1820) sowie das nach einem alten Volksbuch gearbeitete Lustspiel »Kaiser Octavianus« (Jena 1804), weitschweifige Dichtungen, in denen das erzählende und namentlich das lyrische Element überwiegt, aber aus einem Gewirr mannigfaltigster metrischer Ausdrucksformen gelegentlich doch echte Schönheit hervorleuchtet (vgl. Ranftl, L. Tiecks »Genoveva« als romantische Dichtung betrachtet, Graz 1899). Von den zahlreichen Übersetzungen und Bearbeitungen fremder Werke, die T. damals veröffentlichte, seien erwähnt: die fehlerhaften »Minnelieder aus der schwäbischen Vorzeit« (Berl. 1803), die gelungene Verdeutschung des »Don Quichotte« von Cervantes (das. 1799–1804, 4 Bde.), die wertvolle Übersetzung einer Anzahl Shakespeare zugeschriebener, aber zweifelhafter Stücke u. d. T.: »Altenglisches Theater« (das. 1811, 2 Bde.) u. a. Auch gab er u. d. T.: »Phantasus« (Berl. 1812–17, 3 Bde.; 2. Ausg., das. 1844–45, 3 Bde.) eine Sammlung früherer Märchen und Schauspiele, vermehrt mit neuen Erzählungen und dem Märchenschauspiel »Fortunat«, heraus, welche die deutsche Lesewelt lebhaft für T. interessierte. Das Kriegsjahr 1813 sah den Dichter in Prag; nach dem Frieden unternahm er größere Reisen nach London und Paris, hauptsächlich im Interesse eines großen Hauptwerks über Shakespeare, das er leider nie vollendete. 1819 verließ er dauernd seine ländliche Einsamkeit und nahm seinen Wohnsitz in Dresden, wo nun die produktivste und wirkungsreichste Periode seines Dichterlebens begann. Trotz des Gegensatzes, in dem sich Tiecks geistige Vornehmheit zur Trivialität der Dresdener Belletristik befand, gelang es ihm, hauptsächlich durch seine fast allabendlich stattfindenden dramatischen Vorlesungen, in denen er sich als Meister in der Kunst des Vortrags bewährte, einen Kreis um sich zu sammeln, der seine Anschauungen von der Kunst als maßgebend anerkannte. Als Dramaturg des Hoftheaters (seit 1825) gewann er eine bedeutende Wirksamkeit, die ihm freilich durch Angriffe der Gegenpartei mannigfach verleidet wurde. In der Novellendichtung, der sich T. in dieser Dresdener Zeit vor allem widmete, leistete er zum Teil Vortreffliches; aber er bahnte auch jener bedenklichen Gesprächsnovellistik den Weg, in der das epische Element fast ganz hinter dem reflektierenden zurücktritt. Zu den bedeutendsten zählen: »Die Gemälde«, »Die Reisenden«, »Der Alte vom Berge«, »Die Gesellschaft auf dem Lande«, »Die Verlobung«, »Musikalische Leiden und Freuden«, »Des Lebens Überfluß« u. a. Unter den historischen haben »Der griechische Kaiser«, »Dichterleben«, »Der Tod des Dichters« und vor allen der großartig angelegte, leider unvollendete »Aufruhr in den Cevennen« Anspruch auf bleibende Bedeutung. In allen diesen Novellen befriedigt nicht nur meist die einfache Anmut der Darstellungsweise, sondern auch die Mannigfaltigkeit lebendiger und typischer Charaktere und der Tiefsinn der poetischen Idee. Sein letztes größeres Werk: »Vittoria Accorombona« (Bresl. 1840), entstand unter den Einwirkungen der neufranzösischen Romantik und hinterließ trotz der Farbenpracht einen überwiegend peinlichen Eindruck.
T. übernahm in Dresden auch die Herausgabe und Vollendung der von A. W. v. Schlegel begonnenen Shakespeare-Übertragung (Berl. 1825–33, 9 Bde.), doch hat er selber nur die Anmerkungen beigesteuert. Die Übersetzungen A. W. v. Schlegels (s. d.) wurden zum Teil mit eigenmächtigen Änderungen wieder abgedruckt, die übrigen Stücke übersetzten Tiecks Tochter Dorothea (geb. 1799) und Wolf Graf von Baudissin (s. d.). Diese beiden verdeutschten auch noch sechs weitere Stücke des alten englischen Theaters, die T. als »Shakespeares Vorschule« (Leipz. 1823–29, 2 Bde.) mit ausführlicher literarhistorischer Einleitung herausgab. Ebenso stammen aus dieser Zeit mehrere mit Einleitungen versehene Ausgaben von Werken deutscher Dichter, auf die er die Aufmerksamkeit von neuem hinlenken wollte. So hatte er schon 1817 eine Sammlung älterer Bühnenstücke u. d. T.: »Deutsches Theater« veröffentlicht (Berl., 2 Bde.). Dann gab er die hinterlassenen Schriften Heinrichs v. Kleist (Berl. 1821) heraus, denen die »Gesammelten Werke« desselben Dichters (das. 1826, 3 Bde.) folgten, ferner Schnabels Roman »Die Insel Felsenburg« (Bresl. 1827) und die »Gesammelten Schriften« von J. M. R. Lenz (Berl. 1828, 3 Bde.). Aus seiner dramaturgisch-kritischen Tätigkeit erwuchsen die wertvollen »Dramaturgischen Blätter« (Bresl. 1825–26, 2 Bde.; Bd. 3, Leipz. 1852; vollständige Ausg., das. 1852, 2 Tle.). 1837 verlor T. seine Frau, seine Tochter Dorothea starb 21. Febr. 1841. In demselben Jahre wurde er vom König Friedrich Wilhelm IV. nach Berlin berufen, wo er, durch Kränklichkeit zumeist an das Haus gefesselt, ein zwar ehrenvolles und sorgenfreies, aber im ganzen sehr resigniertes Alter verlebte. Sein Bildnis s. Tafel »Deutsche Romantiker« (Bd. 17). Seine »Schriften« erschienen in 20 Bänden (Berl. 1828–46), seine »Kritischen Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1848), »Gesammelte Novellen« in 12 Bänden (Berl. 1852–54), »Nachgelassene Schriften« in 2 Bänden (Leipz. 1855). »Ausgewählte Werke« Tiecks gaben Welti (Stuttg. 1886–1888, 8 Bde.), Klee (mit Biographie, Einleitungen und Anmerkungen, Leipz. 1892, 3 Bde.) und Witkowski (mit Einleitung, das. 1903, 4 Bde.) heraus. Aus Tiecks Nachlaß, der sich in der Berliner Bibliothek befindet, veröffentlichte Bolte mehrere Übersetzungen englischer Dramen, unter andern »Mucedorus« (Berl. 1893). Die Ungleichheit von Tiecks Leistungen ist z. T. auf sein improvisatorisches Arbeiten zurückzuführen, das ihn selten zu reiner Ausgestaltung seiner geist-, phantasie- und lebensvollen Entwürfe gelangen ließ; die Gesamtheit seiner Schriften verrät deutlich die Weite und Größe seines Talents. R. Köpke, der T. in den letzten Berliner Jahren nahe stand, veröffentlichte eine ausführliche Biographie u. d. T.: »Ludwig T., Erinnerungen aus dem Leben etc.« (Leipz. 1855, 2 Bde.). Vgl. außerdem H. v. Friesen, Ludwig T., Erinnerungen (hauptsächlich aus der Dresdener Zeit, Wien 1871, 2 Bde.); »Briefe an Ludwig T.« (hrsg. von K. v. Holtei, Bresl. 1864, 4 Bde.); Ad. Stern, Ludwig T. in Dresden (in dem Werk »Zur Literatur der Gegenwart«, Leipz. 1880); Steiner, Ludwig T. und die Volksbücher (Berl. 1893); Garnier, Zur Entwicklungsgeschichte der Novellendichtung Tiecks (Gieß. 1899); Mießner, L. Tiecks Lyrik (Berl. 1902); Ederheimer, Jak. Böhmes Einfluß auf T. und Novalis (Heidelb. 1904); Koldewey, Wackenroder und sein Einfluß auf T. (Leipz. 1904); Günther, Romantische Kritik und Satire bei Ludwig T. (das. 1907). – Tiecks Schwester Sophie T., geb. 1775 in Berlin, verheiratete sich 1799 mit Aug. Ferd. Bernhardi (s. d.), von dem sie 1805 wieder geschieden wurde, lebte dann in Süddeutschland und mit ihren Brüdern, dem Dichter und dem Bildhauer, längere Zeit in Rom, später in Wien, München und Dresden. 1810 schloß sie eine zweite Ehe mit einem Esthländer, v. Knorring, dem sie in dessen Heimat folgte, und starb dort 1836. Sie hat außer Gedichten, z. B. dem Epos »Flore und Blanchefleur« (hrsg. von A. W. v. Schlegel, Berl. 1822), auch Schauspiele und einige Romane, wie »Evremont« (hrsg. von Ludw. T., das. 1836), geschrieben.
Tod des Dichters
I.
Es war ein heller, freundlicher Morgen, als die edle Gräfin Catharina nachsinnend im Gartensaale saß, indem ihr großes Auge auf den blühenden Granaten ruhte, die neben dem Springbrunnen leuchteten, in dessen Bassin sich die Goldfischchen funkelnd bewegten. Ihre Enkelin, Donna Maria, ordnete Rosen und Nelken in den schön gearbeiteten Gefäßen, welche die Ecken des weiten, kühlen Saales schmückten.
Die Matrone wurde aus ihrem Sinnen durch den Ausruf des zwölfjährigen Kindes geweckt: »Da ist er wieder!«
»Was hast du?« fragte Donna Catharina, indem sich die große Gestalt aus dem Armsessel erhob.
»Immer wieder«, sagte das Fräulein, »wandelt der einäugige Mann hier auf der Landstraße und schaut dann durch das Gitter in unsern Garten. Ich habe ihn nun schon drei Tage hintereinander hier stehen sehn. Er betrachtet sich, wie ich glaube, den Springbrunnen so genau und die Blumenbeete. Er ist ein hübscher alter Mann.«
Catharina ging langsam an das Fenster, sah nach dem bezeichneten Wandrer hin und sagte: »Ein Armer, wie so viele. Dieses Erspähen und Lauschen gefällt mir nicht. Man hört so viel von Räubereien und Gewalttaten, und unser kleines Schloß liegt hier ziemlich einsam.«
»O Großmutter«, rief die Kleine, »du bist immer so mißtrauisch! Die Menschen sind nicht so schlimm, als du sie schilderst. Man hat ja nur Not über Not, wenn man keinem mehr trauen will.«
»Glückliches Kind!« sagte Catharina, indem sie dem schönen Mädchen die weiße Stirn küßte. »Traurig genug, daß diese Unbefangenheit dem Mißtrauen entgegenwächst. So quillt die Blüte im Frühling aus dem Apfelbaum, sie prangt und duftet im frischen Morgenhauch, sie fällt ermüdet und farblos auf den Boden, die Frucht gewinnt Kraft, der Apfel rötet sich und reift der Verwesung zu. – So vergeht alles Schöne und Liebliche.«
»Es kommt aber auch wieder«, sagte die Kleine. »Gott wird es nicht müde, die Blumen wieder aufzuwecken, wenn sie gestorben sind. Freilich sind es eigentlich andre als die verwelkten, aber doch auch lieblich. Die Lämmer und kleinen Ziegen im Gebirge dort, wo wir erst wohnten, waren auch alle Jahre neu. Man muß sich mit den frischen Spielkätzchen nun auch wieder bekannt machen. Das ist denn auch bald zustande gebracht.«
Wechsel freilich, sagte Catharina für sich, wer sich diesem hingeben kann, ist auf seine Art glücklich.
Jetzt sah Catharina selbst neugierig auf die Landstraße hinaus, welche man von diesem Seitenfenster übersehen konnte. Ein lahmer Neger hinkte schnell herbei und begrüßte freundlich, wie es schien, den einäugigen Mann. Sie sprachen lebhaft miteinander, und der schwarze Sklave händigte dem Fremden Geld und ein Paket ein. Der Fremde legte dann dem Sklaven seine Hand vertraulich auf die Schulter, sah ihm in die starren Augen und sagte einige Worte, zu welchen der Neger den krausen Kopf schüttelte. Sie besprachen sich dann heimlich und gingen fort, indem der Fremde, wie ermattet, sich auf den Schwarzen stützte.
Catharina sagte: »Der Unbekannte, welcher mein Haus so genau betrachtet, gefällt mir immer weniger. Welche Verabredungen, welche Verbindungen kann er mit diesem unglücklichen Sklaven haben? Soll ich denn immer sorgen? Fast gereut es mich, mein schönes Gebirgstal verlassen zu haben. Der Unmut und die Furcht vor den Menschen folgen mir nach.«
»Siehst du, Mütterchen«, rief die Kleine, indem sie recht schalkhaft dazu aussehn wollte, »das habe ich dir wohl vorher gesagt, daß es so kommen würde! Da draußen hast du dich auch vor jedem unschuldigen Schäfersmann gefürchtet. Da hieß es, die Einsamkeit bekäme dir nicht, die große Stadt hier, das herrliche Lissabon, würde alles gutmachen. Nun sind wir seit etlichen Tagen hier – ja, aber worin ist es nun besser? Das Lärmen der Stadt und des Hafens ist dir zuwider; da gehn wir hieher, in dein schönes Gartenhaus, hier ist es still, und dich ängstet jeder Wandersmann. Der Mann, der nur ein Auge hat, sieht so gut aus, hübsch in seiner Art, ich könnte mich gut mit ihm vertragen, wenn er mit mir redete. Der schwarze Mensch gefiel mir auch, er war ja wie ein Spielkamerad von dem Alten, und ich dachte an meinen guten Pudel, der mit dem Zottenkopf so schüttelte, wenn er springen wollte. Der Pudelhund wird bei unsern Gärtnersleuten auch noch oft an mich denken, denn er war gern in Gesellschaft.«
So schwatzte das lebhafte Kind, und Catharina schien sich an den unschuldigen Reden des muntern Wesens zu erfreuen.
Reiter sprengten vor das Schloß, und bald darauf erschien der alte Marques de Castro, welchen der junge Graf Ferdinand, der Neffe Catharinens, begleitet hatte. Der anmeldende Diener nahm dann die Begleitenden der Herrschaft in Empfang, um sie und ihre Rosse zu versorgen.
Der Greis sowohl wie der Jüngling begegneten der hohen Matrone mit einer scheuen Ehrerbietung. »Ist Euch nun besser, teure Gräfin, begann der Alte, »als gestern und vorgestern? Seid Ihr des Hauses, dieses Gartens und der schönen heitern Aussicht schon mehr gewohnt? Hat sich der Schmerz des Hauptes vermindert, der Euch so sichtlich quälte?«
»Mir ist recht wohl, Marques«, sagte Catharina mit freundlicher Stimme, »so wohl, wie ich es nur erwarten kann. Das wahre Glück des Menschen ist, nur wenig zu fordern. Der Billige findet nur wenige Ursach zu klagen.«
»So klagt Ihr«, antwortete der Alte, »ohne es zu wollen. Sind wir so sehr resigniert wie Ihr, edle Frau, so gibt es freilich sowenig Trauer wie Freude. Ich hoffe aber, Eure Geburtsstadt, die Ihr so lange nicht gesehn, die Bewegung der Welt, der Anblick des Meeres mit seinen Schiffen, diese weite Aussicht von hier in den Himmel und das Gebirge Cintra hinein sowie die Granaten, Orangen und Zitronen hier im Garten werden Euer schönes Gemüt wieder poetisch stimmen.«
»Poetisch?« rief Catharina mit einem Tone, welcher fast zürnend klang. »Ich bin zufrieden«, sagte sie dann milder, »und erkenne, was Gottes Güte, ohngeachtet mancher Leiden, für mich getan hat.«
Der Greis war einen Augenblick wie verlegen gewesen und faßte die feine weiße Hand der Redenden, indem er ihr lächelnd in das Auge sah. »Ihr könnt mich und mein reines Wohlwollen nicht mißverstehn«, sagte er im weichen Ton.
»Gewiß nicht«, antwortete sie, indem sie seine Hand drückte. »Das Vergangene ist vergangen; wir wissen ja, daß wir uns selbst unser Schicksal machen. Ihr wart immer mein edler Freund und seid es geblieben. Wie undankbar wäre ich, wenn ich das jemals vergessen könnte.«
Jetzt wendete sich der alte Marques zum muntern Kinde, indem er sagte: »Nun, Maria, bist du zufrieden, mit deiner lieben Mutter hier zu wohnen?«
»Gewiß, sehr«, antwortete Marie, »nur wollen mich meine Duennen zu sehr und zu oft putzen, weil sie sagen, Ihr oder der junge Graf könnten plötzlich angeritten kommen. Und wenn man sich anzieht und umzieht, so kann man unterdessen nichts andres denken und betrachten.«
»Und du denkst so gern«, sagte der Marques lachend.
»Gewiß«, antwortete das Kind sehr ernsthaft, »denn wenn man nicht darüber denkt, so kann man ja auch an den Dingen gar nichts haben: voraus an denen, über welche man sich freut. Das geht und stirbt ja denn so hin, als wenn wir es nicht gehabt, ja nicht einmal gesehn hätten. So habe ich morgens meine Stunde, wo ich an das Bergtal denke, wo wir lebten: an die Weinstöcke, den Gärtner und seine hübsche junge Frau, an das Kindchen an ihrer Brust, an mein Zickelchen, das jetzt groß ist, an den Wasserfall dort und den jungen Hirten, der die Schalmei so hübsch blies, und an alles, alles.«
»Du hast es freilich noch nicht nötig«, sagte Catharina, »die Kunst des Vergessens einzuüben. Was sammelt der Mensch nicht alles ein, in dem gutmütigen Wahn, daß alles Glänzende ein Schatz sei: Nachher sehnt sich und strebt die Seele, alle diese Gedanken und Erinnerungen wieder loszuwerden. Nur ein Ringen ist uns vergönnt, einen Besitz finden wir nicht.«
»Wenn das wahr ist«, sagte der Neffe, der indes Mariens kleine Hand gefaßt hatte, »so können wir nicht früh genug darauf hinarbeiten, daß uns der Verlust kein Verlieren sei. Gibt es keinen Besitz, so ist die Kraft zu entsagen auch keine Seelenstärke.«
»Lassen wir diese trübseligen Grübeleien«, rief der Alte mit etwas errungener Heiterkeit, indem er den mitleidigen Blick, mit welchem er Catharinen betrachtet hatte, auf das lächelnde Kind wendete. »Es ist unsre Aufgabe, das Leben frei und kräftig fortzuleben und in diesem für ein andres Dasein die Fähigkeit zu erwerben. Dazu gibt es gewiß, so viele Anlagen und Neigungen sich finden, sehr verschiedene Wege, und wir wollen keine Bestrebung, kein rüstiges Ankämpfen oder keine Freude verwerfen. Wenn es von so vielen Alten heißt, sie starben alt und lebenssatt, so glaube ich doch, daß diese Sattheit kein Überdruß des Lebens werden soll. Diese starken Männer fühlten wohl nur, sie hätten nun alles genossen, gefühlt, verstanden und verdaut, was ihnen Natur und Geist in ihrem dermaligen Zustande anbieten konnten. Das Gastmahl war mit frischen Sinnen und geistiger Heiterkeit durchgenossen; und auch trübe Erfahrung und Schmerz stehen dann auf der Schicksalstafel als notwendige Ingredienzen des Mahles.«
Man ward unterbrochen, indem eine Duenna Marien abholte, um sie zur Mittagstafel anzukleiden. Der Marques sah die Störung gern, indem er sich sogleich mit einem andern Gespräch zur Herrin des Hauses wendete: »Wie wohl wird einem hier in dieser schönen Einsamkeit! Die ganze Stadt ist ein verwirrtes Getöse, und man spricht nur von der Einschiffung und dem Ritterzuge unsers Königs. Hier Freude und Jubel, dort Mißbilligung und Furcht, Prophezeiungen durchkreuzen sich, Handel aller Art werden geschlossen, man rennt, man fragt, man wuchert und macht Schulden, und die jungen Edelleute verkaufen, was sie besitzen, um drüben in der afrikanischen Wüste glänzend aufziehen zu können. Wie viele Hoffnungen knüpfen sich an diesen Feldzug! Krönt er vielleicht dort, was früher die portugiesischen Fürsten und Helden taten, oder vernichtet er durch ein entsetzliches Unglück unsern Ruhm und Staat?«
Catharina stand mit der größten Lebhaftigkeit auf und sah den Marques mit den hellen, großen Augen durchdringend an. »Kann diese Lästerung über Eure Lippen kommen?« rief sie aus. »Wir müssen siegen; der Himmel wird seine Streiter nicht verlassen! Unser junger heldenmütiger König wird unser Volk erheben, neue Staaten dort gründen, wie seine Vorfahren den Namen Portugiese in Brasilien, Afrika und den östlichen Indien mit großen, wundervollen Taten unsterblich machten.«
»Der Himmel möge es so fügen«, erwiderte der Alte. »Abenteuerlicher als die früheren Unternehmungen, wenn auch nicht heroischer, ist dieser Zug. Der alte Kriegesfürst Alba hat ihn dringend widerraten, die ergrauten Soldaten schütteln den Kopf über die Hitze der unerfahrnen Jugend, und einige Schadenfrohe weissagen mit leichtem und kaltem Sinn den Untergang unsers Vaterlandes, weil sie schon auf Philipp und Spanien hinblicken, dessen Herrschaft sie für die bessere halten, und meinen, unser kleines Reich hätte immer so, von der Natur bestimmt, eine Provinz Spaniens sein müssen.«
Catharina ging mit heftigen Schritten durch den Saal, ihre Wange glühte, ihr Auge sprühte Licht. »Solche Verräter dürfen sich an den Tag wagen?« rief sie, als müsse sie die Tränen des Zornes zurückzwängen. »Sind ihrer mehr, sind ihrer viele, so ist freilich das Vaterland schon verloren. Wenn wir um die Sklavenketten buhlen, so mag man uns nur das Brandmal der Verworfenheit aufdrücken. Wenn aber die Geister der großen Ahnen herniederwehen und mit ihrem Feuermut jene kühnen Streiter beseelen und anfachen, so werden diese siegen und dann jene kalten Herzen weit weg von sich verstoßen, welche unmündig sind, dieselbe Luft mit ihnen zu atmen.«
Der Marques umarmte wie mit jugendlichem Feuer seine Verwandte, indem er sagte: »Ihr seid, edle Frau, eine Debora, eine Heldin in der Liebe zum Vaterlande. So jugendlich Euer Herz aufflammt bei allem Großen und Schönen, so fühlt und lindert es alle Not, wohin Eure Arme nur reichen können. Wie liebreich nehmt Ihr Euch der Waise einer armen Freundin an und erzieht sie als eine Enkelin und gönnt ihr den Namen des Kindes.«
Catharina ließ sich wieder in den Sessel fallen und sagte mit matter Stimme: »Schmeichelt mir nicht, da Ihr ein Lehrer und Vormund sein sollt, Rater und Helfer. Nehmt Ihr Euch des Kindes an, wenn ich nicht mehr bin.«
»Wunderliche Muhme«, rief der Greis, »Ihr seid stark, gesund und zwanzig Jahr jünger als ich! Das wird der Himmel nicht zulassen, daß ich Euch überleben sollte. Ich wollte Euch auch melden, daß der Aufbau Eures Palastes in der Stadt, den vor zwei Jahren die Flammen zerstörten, ziemlich vorgeschritten ist. In einem Jahre werdet Ihr ihn bewohnen können, und er wird bequemer und prächtiger, als er war.«
»Ach«, seufzte Catharina, »alles dies geschieht für die Verwandten meines verstorbenen Gemahls. Was soll ich in der großen verwirrten Stadt? Hier werde ich wohnen bleiben, wenn ich nicht zu meinem kleinen Hause im einsamen Gebirge zurückkehre.«
»Nein«, rief der Marques, »hier in unserm Lisbon müßt Ihr wenigstens bleiben, und wir, denen Ihr es erlaubt, Euch zu sehn, wir Beglückten wollen Euch ja auf den Händen tragen. Ihr dürft uns nicht wieder entschlüpfen. Auch sollt Ihr, wenn Ihr es durchaus befehlt, von den Verwandten Eures Gemahls nicht gestört werden.«
»Ich werde sie zuweilen sehn, die Habgierigen«, antwortete Catharina, »aber immer nur in Eurer und meines Neffen Ferdinand Gesellschaft. Sie sollen nicht glauben, daß ich sie fürchte, daß ich wohl gar nötig hätte, mich vor ihnen zu verbergen. Wenn ich die Einsamkeit liebe und suche, so ist es, weil sie mir eine liebe Gespielin, meine Freundin ist. Nicht alle Menschen verstehn es, mit ihr zu leben: die Unwürdigen am wenigsten.«
Der Alte küßte ihr mit Zärtlichkeit die weiße Hand, die man noch schön nennen konnte, und entfernte sich, indem er ihr noch in der Tür einen freundlichen, tröstenden Blick zuwarf.
Der Neffe Ferdinand setzte sich hierauf zu ihr an den Tisch, indem er ihr Rechnungen und Quittungen vorwies, denn er war es, welcher mit dem Marques die Oberaufsicht über den Bau des Palastes führte. Sie war mit allem zufrieden, was geschah, und versank wieder in ihre trübe Stimmung.
»Ich rettete aus dem Brande damals«, sagte der Neffe, »was ich nur erreichen konnte. Die wichtigen Dokumente, die Euer Vermögen betreffen, werde ich Euch, verehrte Tante, in diesen Tagen überbringen, auch den Schmuck, den das Feuer verschonte. Einige Bücher, die Euch vielleicht lieb sind, konnte ich ebenfalls in Sicherheit bringen, doch die alten spanischen und italienischen Rittergeschichten vergönnt Ihr mir wohl zu meiner Erquickung noch auf einige Zeit. Unter Rechnungen, Haushaltbüchern haben sich auch ganz unnütze Schriften und Papiere gefunden, mit denen ich Eure Schränke nicht belästigen will. Sie wurden damals gerettet, weil wir etwas Besseres zu finden glaubten. So geht es oft bei solchen Unglücksfällen: Das Unschätzbare läßt man in der Verwirrung vom Element zerstören und bewahrt sorgfältig Spreu und Fetzen.«
»Ein Bild unsers Lebens«, antwortete sie, »ich habe Euch alles unbedingt anvertraut, und Ihr mögt ganz nach Eurem Wohlgefallen handeln.«
Auch der Neffe verabschiedete sich, und sie entließ ihn mit großer Freundlichkeit. Als sie allein war, ging sie wieder an das große Fenster, welches auf die Landstraße und den Weg zur Stadt hinausschaute, und blickte hinunter, als wenn sie jemand ängstlich erwartete. Sie ging zurück und näherte sich wieder. »Endlich!« rief sie plötzlich, und ihr schönes, bleiches Antlitz erglühte.
Man hörte jemand langsam und mühselig die Stiegen heraufschreiten. Als die Tür sich öffnete, trat ein uralter, greiser Diener herein, der auf den Wink seiner Gebieterin die Tür hinter sich sogleich verriegelte. Sie tat dasselbe mit jener, die zu den innern Gemächern führte.
»Setze dich, Domingo, ruhe, alter Mann«, sagte sie freundlich und gerührt, »der Tag ist heiß; erhole dich erst, bevor du sprichst.«
Der ergraute Diener setzte sich zitternd in den Sessel, und sie blieb vor ihm stehn. Er sah zu ihr empor und wollte lächeln, als sie ihm die weiße Locke von der Stirne strich, aber eine Träne stahl sich aus dem Auge des Greises.
»Gute, liebe, herrliche Frau«, sagte er endlich, »ach, die ich kannte und liebte und wartete, als sie noch ein kleines Kind war – ach, warum kann ich Euch nicht glücklich machen!«
»So hast du nichts erfahren?« fragte sie.
»Genug«, erwiderte der Greis, »wäre es nur etwas Besseres: Vor zehn Jahren ist er krank aus Indien zurückgekommen, damals, wie das große Sterben hier im Lande war.«
»Das weiß ich«, erwiderte sie lebhaft, »weiter!«
»Dann haben sich manche um ihn bekümmert«, sagte der Alte, »aber unser König war noch zu jung, beinah noch kindisch. Und viele Feinde hatte er auch, das wißt Ihr ja selbst am besten. Vier Jahre später kam sein Buch heraus, das so sehr schön sein soll, wie sie alle sagen. Nun hatten sie unserm regierenden Kinde, denn der Herr war ja erst sechzehn Jahr alt, schon seinen Wirrwarr und das wilde Afrika und die Märtyrergeschichten in seinen hitzigen Kopf gesetzt ...«
»Sprich nicht so!« rief Catharina.
»Ich sage nur«, fuhr der Alte mit Rührung fort, »daß man doch lieber vorher erst Mensch sein soll, ehe man sich zum Helden und Erretter von Tausenden erklärt und Religion und die Kreuzesfahne in die heißen Steppen einpflanzen will, die da doch verdorren werden.«
»Und was von ihm?« fragte Catharina.
»Ja, wie mir viele Menschen und der Buchhändler, der das schöne Buch von ihm hat drucken lassen, gesagt haben, so war denn dieser große heroische Mut die Ursach, daß man einen so begabten Untertan, einen so herrlichen Mann hat verschmachten lassen. Er ist schon vor zwei Jahren im Hospital gestorben.«
Catharina wich zurück. Er entfernte sich auf einen stummen Wink.
»Voriges Jahr«, sagte sie, als sie allein war, »hätte ich also wohl auch, wie Rodrigo, mein Gemahl, sterben können.«
Sie eröffnete mit einem goldenen Schlüssel einen kleinen, zierlichen Schrank. Ein Buch, schön in Gold gebunden und verziert, nahm sie heraus, öffnete es und küßte es inbrünstig. Dann setzte sie sich nieder und weinte von Herzen.
In der Vorstadt, welche auf der entgegengesetzten Seite von Lissabon sich erstreckt, hatte sich nach der Siesta eine Gesellschaft von Bürgern versammelt. Im Garten einer Schenke saßen sie unter einer dicht schattenden Weinlaube an einem langen steinernen Tische, der Blick umfaßte von dort eine weite Aussicht über Hügel, Weinberge und einen Teil der Stadt, welche amphitheatralisch emporstieg. In diese einsame und kühle Gartengrotte kamen zuweilen gegen Abend einige befreundete Menschen, um sich bei einem Kruge leichten Weines zu unterhalten, und den Vorsitz führte fast immer Herr Matthias, der sich dem geistlichen Stande gewidmet, aber noch keine Stelle eines Kapellans hatte erhalten können, weil es ihm an einem vornehmen Beschützer fehlte. Ihm zunächst nahm Enrique seinen Platz ein, ein Mann, der sich gern Künstler und Bildhauer nennen hörte, weil er nicht ohne Geschicklichkeit Zierat und selbst zuweilen kleine Figuren in Holz schnitzte. Die übrigen Gäste waren Handwerker oder Männer, die von geringen Renten kümmerlich und eingezogen lebten. Sie vereinigten sich gern in diesem wohlfeilen und still abgelegenen Garten, weil sie hier keine Veranlassung fanden, Geld auszugeben oder von heftigen und schreienden Gesellen gestört zu werden. So hatte der Besitzer, ein Weingärtner, gewissermaßen eine feinere, halbgelehrte Gesellschaft bei sich vereinigen können, der er sich selber, obgleich er der Wirt war, zuweilen gern anschloß, es auch deshalb mit der Bezahlung des Weines, den er selbst baute, nicht immer genau nahm, wenn er sich in freien und anmutigen Gesprächen unterhalten hatte.
»Wie ich sage«, fuhr Matthias fort, »wozu hilft es nun, gelehrt zu sein, wenn keiner unserer müßigen Großen meine Talente anerkennen mag? Wenn man mich nicht unterstützt und befördert, um meinem Vaterlande noch mehr Ehre zu machen? Die Übersetzung meiner Eklogen des großen Virgilius ist gut, die Anmerkungen dazu sind vortrefflich: Alle, die eine Stimme haben, kommen darin überein, das ist es aber auch alles. Da lobe ich mir Italien, da findet der große Mann seinen Mäzen. Was haben die erlauchten Medicäer für Künste und Wissenschaften getan, die Päpste Julius, Leo und Clemens, die Kardinäle, Bembo und andere Fürsten der Kirche und weltliche Herrscher. Seit die Herren Jesuiten hier im Lande so vielen Einfluß haben, ist alles, was ihnen nicht dient, vernachlässiget. Darum hinken wir, wenn der Italiener geht und läuft, darum ist, so manchen großen Regenten wir auch besaßen, Portugal immer noch verfinstert und trübe.«
»Wohl, wohl!« rief der Bildhauer. »Glaubt mir nur, es fehlt unsern Landesgenossen noch an Auge und Sinn: Wir sind allzumal noch Barbaren. Was könnte auch bei uns geschehn, da es uns gewiß nicht an Kunsttalenten fehlt, wenn der jetzige unglückliche Feldzug, den Gott zum Heil lenken möge, nicht alle unsere Kräfte verschlänge? Man hört nur von Waffen, Kanonen, Harnischen, Schwertern, Rossen und Pulverwagen, Gewehren und Feldschlangen. Der junge Adel ist wie berauscht, und Kinder wollen mit in die brennenden Steppen hinüberziehn, um mitzukämpfen, und Weiber und Mütter folgen, weil sie sich einbilden, dort Wohnungen zu finden, große Städte zu erobern und Kolonien zu gründen. Aber es muß zum Elend ausschlagen. Und hier zu Hause wird unterdessen alles versäumt, und alle verarmen, weil der letzte Crusado nur für Schiffe und Mannschaft verwendet wird.«
»Laßt Don Luis nur kommen«, rief Ernesto, ein alter Bürgersmann, »der wird uns die Sache anders auslegen!«
»Anders, aber nicht besser, Don Ernesto!« rief Matthias, der Geistliche. »Dieser Luis meint alles zu wissen und zu verstehn; und, erinnert Ihr Euch nicht, wie ich ihn neulich zuschanden machte, als er meine Anmerkung zum sechsten Vers der dritten Virgilischen Ekloge nicht billigen wollte?«
»Laßt es gut sein, einsichtsvoller Mann«, erwiderte Ernesto, »gebt nicht dem Sprichwort recht, daß die Gelehrten immerdar aufeinander neidisch sind.«
»Ich neidisch?« antwortete Matthias mit einigem Unwillen. »Schon mein Stand verpflichtet mich zur Demut; und wie könnte ich einen Laien, der Soldat war und sich niemals für einen wahren Gelehrten ausgeben kann, für meinesgleichen anerkennen?«
»Sacht, mein Herr, sacht!« rief etwas ungestümer ein handfester kleiner Mann dazwischen, welcher ein wohlhabender Krämer war. »Ich, Duarte, kenne auch die Welt und ihre Verhältnisse und bin mit manchem Geistlichen und verehrten Gelehrten, Soldaten und Staatsmann umgegangen, aber ein solcher herrlicher, ausgebreiteter Geist, wie unser Freund Don Luis ist, ist mir noch niemals vorgekommen. Schade, daß er zu seinen Freunden nicht mehr Vertrauen zeigt, er scheint unglücklich und arm und ist zu stolz, einem von uns Verbindlichkeiten haben zu wollen: Er mag wohl früherhin ganz andre Gesellschaft gewohnt gewesen sein, als wir ihm bieten können.«
Der zukünftige Priester wurde hochrot vor Zorn, doch mäßigte er sich und sagte nur: »Ihr, Sennor Duarte, seht zu viel in ihm und wollt Euch selbst in Euerm Freunde verherrlichen.«
Indem kommt ein Mann von mäßiger Größe, aber edlem Stande zur Gesellschaft: Es war der erwartete Luis. Er begrüßte alle höflich, und eines seiner Augen, welches im braunen Glanze leuchtete, schaute alle seine Bekannten mit Freundlichkeit an; das andre war mit einer schwarzen Binde verhüllt, weil er eine Entzündung fühlte, sonst trug er dies erblindete und von einer Schußwunde zerstörte frei. Seine Mienen und der Ausdruck seines Gesichts war heiter, wenn auch der Menschenkenner einen tiefen, verhaltenen Kummer in diesen lesen konnte.
Es war eingeführt, daß man in diesen heitern Abendstunden abwechselnd etwas vorlas, und da jetzt der Wirt des Hauses, ein dickes, freundliches Männchen, sich auch zur Gesellschaft setzte, so fuhr Luis fort, den Ariost vorzutragen, an der Stelle, wo man vor einigen Tagen aufgehört hatte. Die schöne Klage der verlassenen Olympia bewegte alle Herzen, und dasjenige, was dunkel scheinen mochte, da nicht alle Zuhörer des Italienischen gleich kundig sein mochten, erklärte Luis auf verständige Weise.
»Der größte Dichter unsrer Zeit!« rief Ernesto aus. »Welche schöne Sprache, welche Wahl der Ausdrücke, welcher Glanz in den Bildern und Gleichnissen! Und diese ewige, unzerstörbare Heiterkeit, dieser Liebreiz in allen Gesinnungen! Es muß Euch freuen, Don Luis, daß dieser Ludovico auch Euern Taufnamen führt.«
Luis erhob sein sinnendes Auge vom Buch und sagte: »Schon oft habe ich mich daran ergötzt, denn jede Ähnlichkeit mit einem großen Manne, auch die zufällige, erfreut uns.«
»Wäre der feine Schalk«, sagte Matthias, »nur etwas frommer, so könnte er auch den Dienern der Kirche mehr gefallen.«
»Der frommen Lieder«, rief Duarte, »haben wir genug und überlei. Mich entzückt dieser Ariost, vollends mit den Erklärungen unsers Freundes. Aber ich muß immerdar tadeln, daß sein Buch weder Anfang noch Ende hat und daß es sich auf den verwirrten, verliebten Orlando des Bajardo lehnt. Die Abenteuer, so mannigfaltig sie auch beim ersten Anblick erscheinen mögen, gleichen sich doch alle mehr oder minder, und ich meine – wie soll ich doch gleich sagen –, als ob dem schönen Werke ein eigentlicher Kern mangelte, ein tieferes Interesse, das uns immer wieder zu jenem Mittelpunkt hinzöge, welchen ich vermisse. Belehrt mich darüber, Don Luis.«
»Ich kann, statt zu belehren«, erwiderte der freundliche Einäugige, »nur Eure Meinung und Ansicht bestätigen. Alle diese Gedichte der Italiener, von denen unser Ariost wohl die leuchtende Krone bildet, diese Pulci, der Bajardo und unser geliebter Freund, alle erregen mir, wenn ich ihnen recht ins Herz schauen will, eine tiefe Trauer und innige Wehmut. Nicht, solange ich den immer grünen Scherzen unsers Ariost zuhöre, wenn er mich in seinen süßen Gesang einwiegt und mich die ganze Welt vergessen läßt, sondern wenn ich an jenes Aufzählen von Namen, an die Genealogie des Hauses Ferrara komme, an das Lob, welches ausgespendet wird, auf alles, welches einen Bezug auf diese Fürstenfamilie hat. Dieses, mein Freund, diese trocknen Erörterungen und Aufzählungen von Ahnen sollen jenen echten innern Kern bilden, welchen Ihr mit Recht vermißt. Armes Italien, wie lange ist es nun schon dem Patrioten, dem Begeisterten kein Vaterland mehr! Seit wie lange hat es schon seine wahre Geschichte eingebüßt! Bild, Spiel, Gesang, Bauwerke, Pracht und Luxus müssen die Heiligkeit vertreten, welche vielleicht auf immer verlorengegangen ist.«
»Wie meint Ihr das?« fragte Ernesto. »Ihr redet sonst immer so verständlich, und dieser Ausspruch ist mir ganz dunkel, auch scheint mir, daß unsre übrigen Freunde Euch ebensowenig begreifen als ich.«
»Es ist ja nur die alte Klage«, fuhr der Geistliche hervor, »die Petrarca schon bis zur Ermüdung geführt hat, die Dantes Erbitterung vielfach austönt: daß Italien keine Einheit bilde, daß es von Fremden abwechselnd beherrscht werde, daß der alte Glanz gesunken, daß man nicht aus noch ein wisse und daß die Fürsten, auch die tugendhaften, nicht genügen, um das Band, welches zerrissen ist, wieder zu knüpfen und herzustellen.«
»Zum Teil ist das meine Meinung«, antwortete Luis mit Bescheidenheit. »Früh schon verlor durch ein zersplittertes Interesse, indem jeder kleine Staat etwas anderes wollte, Italien seine Selbständigkeit. In jeder Provinz herrschten wieder Faktionen, und eine jede suchte die andre zu vernichten. So ward jede Stadt und jedes größere und kleinere Land darauf hingewiesen, fremde Kraft zu suchen und dieser zu vertrauen und, was noch schlimmer war, sich an Fremde zu lehnen, um von diesen den Segen und das Gedeihen zu erwarten. Das ist das Traurigste, was einem Lande widerfahren kann, auf diesem Wege geht es allgemach seinem Untergange entgegen. Wir sagen so gewohnterweise: Italien, Italiener; allein wo sind diese zu finden? Nur Städte, Ländchen, Fürsten sind dort, die einander in allen Richtungen widerstreben und abwechselnd die Beute dieses oder jenes Fremdlings werden. Der Papst hat immerdar mit den Staaten Europas zu vermitteln und gewinnt oder verliert, indem sich die oder jene Waagschale senkt, sein Land wird von ihm mehr verwaltet als beherrscht, aber doch hat der Römer etwas von seinem hohen Sinn behalten. Venedig ist kräftig und in sich beschlossen und bewahrt auch seinen Einfluß auf das Ausland; aber das schöne Florenz hat seine Freiheit nicht ertragen können, Sizilien und Neapel werden von Fremden regiert, ebenso abwechselnd Mailand, und der Italiener, welcher sich als Patriot fühlen möchte, könnte nur trauern. Wenn Dante und Petrarca jetzt wiederkehrten, so fänden sie noch ganz andre Ursache zur Wehklage als in ihrem früheren Zeitalter. Woher soll also der große Dichter, wie es Ariost ist, den wahren Mittelpunkt eines so großen Werkes finden, als er in erhabener Laune hat ausführen wollen? Weder Religion noch Vaterland konnten es werden, wenn sein freier Sinn nicht seine Leser und Zuhörer verletzen wollte. Ja, ich fürchte, sich selber konnte er auf diesem Wege nur die größten Schmerzen erschaffen. Darum wirft er sich, als gäbe es keinen festern Boden, in dieses Lustmeer von Scherz und Spott, Witz und Laune und segelt, von singenden Schwänen auf smaragdner Flut dahingezogen, durch den lichtblauen reinen Äther, von scherzenden Göttern umspielt. Die Weisheit der Sterblichen muß ohne Kampf und Groll so viele Güter aufgeben und ihnen entsagen, und so kann auch aus diesen freien kristallenen Gebilden der Weiseste lernen. Es ist auch fromm, sich in die Notwendigkeit finden. Weil also der scheinbare Ernst und das Höchste diesem Gedicht fehlt, möchte ich ihm in dieser Entsagung nicht Mangel an Frömmigkeit vorwerfen. Aber wir Portugiesen, die wir so glücklich sind, ein herrliches, ruhmreiches Vaterland zu besitzen, welches vom Glanz großer Könige, erlauchter und verklärter Frommen, großer Helden und Krieger bestrahlt wird, Männer und Kämpfer, die Taten hier und in fernen, kürzlich noch unbekannten Weltteilen ausübten, wir dürfen auch nicht gescholten werden, wenn wir in patriotischer Begeisterung sogar Verzweiflung in diesem kecken Aufschwung der Lust und Laune wahrnehmen. Der poetische Übermut erklingt wohl so laut, um sich selber zu betäuben, um sich die Angst wegzusingen. – Auf ähnliche Weise, nur nicht so großartig, tönt das Aufgeben des Vaterlandes aus den Liedern des verständigen Horaz, wie aller Römer. Der zärtliche, weiche Virgil wird nur großartig, indem er einmal singt: Wohl mögen uns die Griechen im Bilderschnitzen und in künstlichen Gemälden übertreffen, sie mögen den Vers zierlicher singen, unsre, der Römer Aufgabe ist es, die Welt zu beherrschen, und darin wollen wir Meister sein! – Wollen sie sich anders als Patrioten zeigen, so ist es nur Lob und Schmeichelei ihrer Fürsten. Den großen, erhabenen Tacitus kann der Verständige als einen Dichter lesen: Hier spricht in jeder Zeile das gebrochene römische Herz, welches im Kampf des Todes den großen Verlust ausspricht, ohne ihn mit Namen zu nennen.«
»Ihr meint also«, fragte Duarte, »wir Portugaler dürfen auf unser Vaterland und Geschichte stolz sein?«
»Ist es denn nicht jeder Lusitanier?« erwiderte Luis. »Fühlt er sich nicht in jeder Ader beglückt und groß, daß er sich einen Lusitanier nennen darf, auch wenn er sich dessen nicht immer in Worten bewußt ist, wenn er nicht in gedankenreichen oder prahlenden Behauptungen sich ausspricht? Sehn wir auf jene Zeit zurück, als unser großer Heinrich, jener Prinz, der Entdecker, seine nächtlichen Studien machte und die Sterne fragte, als er seine Schiffe ausrüstete, die Afrika umsegeln wollten, als wir Ceuta eroberten und die Mohren Afrikas schreckten, als unser Ferdinand, der Standhafte, ein Opfer seines Glaubens und seiner Vaterlandsliebe wurde, als weise Regenten uns beherrschten und schon damals den Namen Portugal groß machten – damals ward durch Bürgerkriege das mächtige Frankreich elend und klein, die Beute eines fremden Eroberers. England, nur kurze Zeit glänzend, ward selbst von Faktionen zerrissen und kam dem Untergang nahe. Das große, weit verbreitete Germanien zerrüttete sich in innern Kriegen und Kämpfen. Das gesittete Italien mühte sich um fremde Interessen bis zur Ohnmacht ab. Unser kleines Land, als das äußerste, als das Haupt und Auge Europas, war durch Weisheit und Kraft regiert: der erste Johann, Eduard, Alphons kräftigten, erweiterten unser Gebiet. Nun hatte sich Spanien endlich vereinigt, das früher stets, wie das übrige Europa, in sich selbst entzweit war. Der große Emanuel sendet den Helden Vasco da Gama aus, und das östliche Indien mit seinen Schätzen und Wundern, von klugen Völkern bewohnt, neigt sich vor dem portugiesischen Mut. Ganz andre, wichtigere Reiche werden uns auf wundersame Art Untertan als jene wilden Horden, die der großmütige Colomb und der gelehrte Florentiner Vespucci entdeckte. Weit mächtigere Schwierigkeiten kämpften uns entgegen. Auch wird im Westen Brasilien unser. Und jetzt sind es noch nicht achtzig Jahr, daß Vasco da Gama jenen märchenhaften Orient, das Land der Wunder, entdeckte. Die beiden großen Albuquerque führten nun dort, in den fernen Zonen, ihr glorreiches Heldenleben und verübten Taten, die die ersonnenen der fabelnden Poeten übertroffen. Pacheco stiftete seinen unsterblichen Ruhm, Soares war nicht minder Held, Almeida regierte dort – und wer kann sie alle in kurzer Zeit nennen und rühmen, die dort kämpften und siegten oder großherzig starben und ihre Namen und Ruhm neben die ewig leuchtenden des Miltiades, Themistokles und Epaminondas einschreiben sahn?«
»Und in welchem kurzen Zeitraum«, fuhr Duarte fort, »sind alle diese Großtaten geschehn! Unsre Väter haben noch manchen von diesen unsterblichen Helden gesehn, sie haben die unglaublichen Dinge erlebt, ihnen war es vergönnt, den glücklichen König Don Emanuel anzuschauen, und jeder durfte wähnen, daß ihn ein Tropfen wenigstens von diesen Strömungen des Ruhmes benetze.«
»Loben wir diese Helden und Könige«, warf der Geistliche Matthias ein, »es kann sein, daß die hohe Stellung der Fürsten ihnen manche Tugend aus den Augen rückt und unzugänglich macht, die dem geringen Untertan nicht fehlen darf. Ist es aber nicht betrübt zu sehn, wie Talente, Gelehrsamkeit oft betteln gehn und verschmachten, wenn ein Leo der Zehnte Possenreißer reich macht und so mancher Fürst seinen Narren oder einen Tänzer, eine üppige Tänzerin mit Geld überschüttet? Augustus gab doch wenigstens dem Virgil sein Landgut zurück, und er und sein Rat Mäzen ließen den liebenswürdigen Horaz nicht darben. Der Lorenz von Medici, der Prächtige, ermunterte doch Künstler und war ein Freund des Politian und Marsilius Ficinus. Aber hier bei uns mögt Ihr Euch für die Könige begeistern, wie Ihr wollt, was haben sie hier für Wissenschaft, Gelehrte, Malerei oder Dichtkunst getan? Wo sind die großen Männer, die im Tau ihrer Gnade gediehen und aufwuchsen? Ja selbst ihre Entdecker und Helden, die ihnen Weltteile untertänig machten und Millionen Sklaven an die Schwelle ihres Thrones fesselten, wurden mit gallebitterm Undank belohnt. Es ist wohl ein herrliches Schauspiel, wenn der vielduldende Colomb in Ketten nach Spanien zurückgeführt wird, um über schändliche Anklagen seiner niederträchtigen Verleumder verhört zu werden? Ist nicht selbst bei uns der große Held Albuquerque in Armut gestorben? Wurde nicht sein ganzes Verdienst beinahe vergessen? Viel hat auch der einzige Vasco da Gama nicht von seinem Lohn genossen, er starb, als sein Glück anheben sollte. Es ist nicht zu tadeln, wenn dem ruhigen Betrachter, noch mehr dem Gelehrten, der mit tausend Mühsal doch nur bis zur Armut hindurchkämpft, bittre Gefühle gegen diese Großen und Regierenden überschleichen. Und wer wird reich und glücklich? Schmeichler, Toren, Eigennützige oder diejenigen, die die Leidenschaften der Großen zu benutzen wissen. Ist das nicht die Geschichte aller Reiche und Fürsten, ist Schmach, Armut, Verbannung, Verschmachten und Tod nicht die Marterkrönung der meisten großen Staatsmänner, Krieger und Gelehrten?«
Die Gesellschaft war durch diese Rede aufgeregt worden, und alle sprachen ziemlich heftig durcheinander. Sie zürnten auf ihre Weise über die so oft wiederkehrende schreiende Undankbarkeit der Völker und Fürsten. Nur Luis blieb ganz ruhig und schaute nachdenkend vor sich nieder.
Endlich sagte Duarte: »Ihr, mein würdiger Freund, sagt kein Wort zu dieser Anklage, die ich doch so gerecht finde wie wir alle hier. Wie viele große Geister stehn in der Weltgeschichte da als traurige Bilder dieser Tyrannei und des Leichtsinns, geschmäht, verkannt, oft verdammt, wieviel mehr noch sind wahrscheinlich in Dunkel und Vergessenheit geblieben, die auch groß hätten werden können, wenn sie Ermutigung und Beschützer gefunden hätten.«
Luis erwiderte: »Ich habe Euch, teure Freunde, meine Meinung hierüber nicht aufdrängen mögen, weil sie Euch vielleicht zu sonderbar dünken möchte und ich mich fürchte, den Verdacht zu erregen, als könnte ich etwas aussagen, bloß um allem zu widersprechen oder etwas Seltsames zu behaupten.«
»Wir werden Euch, edler Freund, gewiß nicht verkennen«, sagte Ernesto, »drum sprecht frei wie zu Eurer eignen Seele, auch wenn Ihr unsre Fürsten noch weit härter tadeln solltet, als wir es schon getan haben.«
»Was wir Dank und Undank nennen sollen«, sagte jetzt Luis, »ist schon schwer zu entscheiden, wenn man das Verhältnis und Leben einzelner Menschen betrachtet, wenn wir unsre nächste Umgebung und uns selbst beobachten. Jeder von uns hat, wie er überzeugt ist, schon für Dienste oder Wohltaten Undank eingeerntet, jeder von uns ist nach Gelegenheit schon undankbar gescholten worden. Ein rein erkannter Dank, ein fortlebendes klares Gefühl der Dankbarkeit für erwiesene Wohltat, beziehn sich diese auf weltliche Güter oder Lehre; aufopfernde Freundschaft ist eine Tugend, die ebenso selten sich groß und glänzend zeigt wie alle übrigen Tugenden. Das Laster des Undanks ist dagegen allgemein, wie jeder Fehler der in sich verirrten, von Leidenschaften geängstigten Menschheit. In glücklichen Zeiten drängen sich Tat auf Tat, große Männer folgen eilig aufeinander, Talente erwecken einander und zeigen sich dort und hier: dann ist das Vaterland reich an Geist und Kraft. Wie soll, wie kann einem Miltiades, einem Themistokles gelohnt werden? Ruhe, Zurückgezogenheit, Gleichheit mit seinen Kriegern war selbst eines Timoleon Krone. Das athenische Volk war damals zu reich und groß, sein Glück steigerte sich so schnell, der außerordentlichen Taten, der unsterblichen Verdienste waren zu viel, als daß es nach dem gewöhnlichen Sinne des Wortes hätte dankbar sein können. Das ist eben das Übermenschliche in den Schicksalen großer Helden und Volkslehrer und Wohltäter der Menschen, daß man sie vergißt, wohl verkennt. Und die tiefe Rührung unsers Herzens, das schönste Gefühl unsrer Anbetung aus der Ferne nach tausend Jahren noch, diese Huldigung der Urenkel und spätesten Nachkommen, die jedes Gemüt, welches der Erkenntnis des Großen und Schönen fähig ist, opfert, dieses, was nicht Gold, Ehre noch Lob ist, diese stumme Bewunderung, in der die reinste Verehrung und ein heiliges Mitleid sich wundersam vermischen, ist jener Helden schönster Lohn. So sind sie nicht vergessen, nicht verarmt, vertrieben, gestorben; die Geisterwelt ist ihre Heimat, der Palast, welchen sie bewohnen. Und jede gute Tat, jede schöne Regung, der Glaube an den Adel der Menschennatur wurzelt, wächst und blüht in diesem geweihten Boden.«
Alle hörten den Redenden in stiller Aufmerksamkeit an, und dieser fuhr nach einer kleinen Pause fort: »War die Kunst und Poesie der glücklichen Griechen nicht ganz, nicht im Gegensatz gegen das römische Wesen, vom schönsten Patriotismus durchklungen? Städte, Berge, Flüsse, Menschen und Völkerstämme waren schon seit Homer mit den Göttern des Volkes zugleich verherrlicht worden, und wie war immerdar Athen und alles, was sich auf dieses bezog, Sage, Land und Meer, von der attischen Tragödie verschönt und besungen worden? Und doch verließ Äschylus so wie später Euripides sein Vaterland, um in fremder Gegend zu sterben. Wir wissen nicht genau, was ihren Unwillen reizte und ob die großen Männer nicht auch vielleicht zu eigensinnige Forderungen an ihre Mitbürger machten. Denn das wird auch ein jeder von uns erfahren haben, daß ein Guttäter, dem wir auf irgendeine Art verpflichtet sind, wohl unsre unerläßliche Freiheit beschränken möchte und es Undankbarkeit schilt, wenn der wahre Edelmut in uns sich dem widersetzt. Reiht sich ein Bewußtsein an eine Guttat, die der Gelehrte, Künstler oder Dichter dem Lande erwiesen, der Freund dem Freunde, der Reiche dem Armen, der Hochgestellte dem Niedern oder der Untertan seinem Fürsten, und wächst immer starrer und stolzer empor, so verliert die Gabe vieles von ihrer Schönheit. Gern habe ich stets die Regenten entschuldigt, die gegen ihre Helden und die großen Männer des Vaterlandes undankbar erschienen. Sie haben so vieles zu beachten und zu versorgen, alles drängt sich an sie, das Edle und Herrliche erscheint ihnen von ihrer hohen Stellung aus als eine Naturnotwendigkeit, sie fühlen, daß es sich selbst belohnt. Verletzt sie der große Mann nun etwa im Gefühle seiner Kraft und seines Wertes, scheint er, wenn auch nur auf Augenblicke, zu vergessen, daß vom Thron aus ihm seine Bedeutsamkeit wird, sind nun Schwätzer und Verleumder noch obenein gegen ihn geschäftig, so ist es nur menschlich, wenn der Fürst sein Wohlwollen beschränkt, um den starren Sinn jener Tugend wieder zu mildern. Freilich gewinnen nun oft jene Schmarotzer und Schmeichler, jene Ohrenbläser, Schalksnarren und Gaukler und Tänzer die Reichtümer und Güter, die dem Talent und der Tugend zu gehören scheinen. Wenn aber solch armes Volk durch ihre Erniedrigung dies nicht erränge, was wäre dann ihr trübseliges Leben? Fast jedermann mißgönnt ihnen jene Güter, und selbst der Fürst hat nicht das Vermögen, ihnen Achtung zu verschaffen, Bürger und Pöbel schätzt sie geringe, und jedes Auge sieht mit Ehrfurcht auf Verdienst und Größe hin, und um so mehr, wenn sie verkannt oder geschmäht werden. Das hat mich mein Leben gelehrt, daß Verdienst oder Unverdienst hauptsächlich nur durch seine Persönlichkeit jene Güter erringt, die in den Augen der Menschen den höchsten Wert haben. Wer sich anmutig oder gar unentbehrlich zu machen weiß, nach Gelegenheit Vertrauen einflößt, dann wieder gern unbedeutend erscheint, jetzt wieder klagt oder zudringlich wird, zuweilen sogar überlästig, Lob und Spott mit gleicher